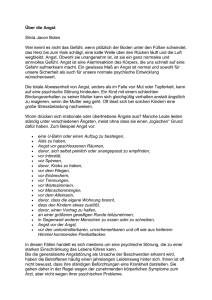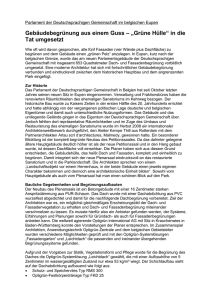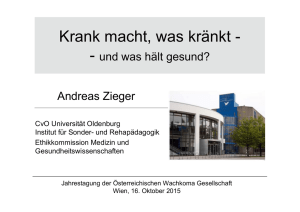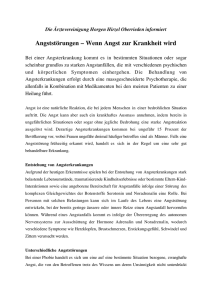Umgang mit Ängsten Jugendlicher
Werbung

Umgang mit Ängsten Jugendlicher Diplom Psychologe HANS PETER BRETTLE Diplom Sozialpädagoge Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Psychologischer Psychotherapeut – Supervisor Lehrpraxis, Selbsterfahrungsleiter Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Inhaltsverzeichnis 1. Wozu haben wir Gefühle 3 2. Angst 4 3. Risikofaktoren 9 4. Therapeutische Behandlungsansätze 9 5. Exkurs Entwicklungsschritte Kinder und Jugendliche 11 6. Was können wir als Bezugspersonen oder als Betroffene tun? 12 7. Protektive Faktoren 14 8. Literaturverweise 15 2 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle 1. WOZU HABEN WIR GEFÜHLE? 1. Gefühle hängen eng mit unseren Bedürfnissen zusammen und sind ein unverzichtbarer Teil unseres Wesens, unserer Persönlichkeit, unserer Identität. Ohne Gefühle wären wir nichts anderes als ein Computer oder Roboter, also seelenlose Maschinen, die sich voneinander nicht unterscheiden. 2. Gefühle sind Orientierungshilfen, die uns schneller und manchmal zuverlässiger als unser Verstand sagen, wann es für uns gefährlich und unangenehm werden könnte. Sie helfen uns bei der Einschätzung von Menschen und Situationen. 3. Gefühle sind Handlungsweisen. Sie sagen uns, wie wir im Sinne unserer Bedürfnisse und Interessen handeln sollen und liefern uns dazu auch die nötige Energie. Je intensiver das Gefühl, desto leichter überwinden wir evtl. Hindernisse. 4. Gefühle teilen sich anderen spontan durch unsere Körpersprache (Mimik, Gestik, Haltung) mit. Gefühle sind Mitteilungen an andere sich in bestimmter Weise zu verhalten. Sie haben Einfluss auf Stimmung, Gedanken und Verhaltensweisen unserer Mitmenschen. Fazit: Wenn Menschen ihre Gefühle abschalten, dann sind sie wie ein Schiff im Nebel, dass ohne Kompass (Orientierung), ohne Steuer und Motor (Handlungsanweisung) und ohne Funkgerät (Kommunikation mit anderen Menschen) übers Meer fährt. Ohne Gefühle kommt man nicht besser sondern schlechter durchs Leben und es ist viel gefährlicher. 4 Grundemotionen Falscher Umgang mit Gefühlen: 1. Wenn wir unseren Gefühlen zu starke Bedeutung beimessen, dann kann es passieren, dass uns unsere Gefühle wie Tatsachen erscheinen: „Wenn ich mich unfähig fühle, dann bin ich es auch. Wenn ich das Gefühl habe, dass etwas richtig ist, dann ist es auch richtig. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann ist es bedrohlich. Wenn ich einen Menschen liebe, dann muss er in Ordnung sein.“ 2. Manchmal machen wir andere für unsere Gefühle verantwortlich: „Wegen dir bin ich jetzt traurig. Du bist schuld, dass ich jetzt ärgerlich bin.“ Das stimmt nicht. Ich bin immer selbst verantwortlich für die Gefühle, die ich habe, denn es sind meine Gefühle, d.h. ich erzeuge sie selbst gemäß meiner Interessen und Bedürfnisse. Ich kann sogar aktiv Einfluss auf Art und Verlauf meiner Gefühle nehmen. 3 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle 2. Angst Angst ist eine der vier Grundemotionen, die bei der Entwicklung von Lebewesen auf der Erde eine wichtige Rolle spielen. Auch alle höheren Tierarten kennen Angst. Angst hilft uns Gefahren zu erkennen, zu entkommen und ihnen vorzubeugen. Angst ist daher ein überlebenswichtiges Warnsystem. Dieses Warnsystem ist lernfähig. Das Gehirn speichert Informationen, die mit akuten gefahrvollen Situationen in Verbindung stehen. Nehmen wir diese Signale zu einem späteren Zeitpunkt erneut wahr, sind wir vorsichtig und bekommen Angst. Ein bestimmtes Ausmaß an (sozialen) Ängsten ist gerade bei Kindern und Jugendlichen völlig normal. Ängste treten im Jugendalter häufig dann auf, wenn die typischen Entwicklungsaufgaben in diesem Lebensabschnitt nicht ausreichend bewältigt werden: Ablösung vom Elternhaus in Form von mehr Selbständigkeit, Eintritt in den KiGa, Schule oder die Berufswelt, Entwicklung einer eigenen Identität, Integration in die Gleichaltrigengruppe mit alterstypischen Aktivitäten, Kontaktfähigkeit gegenüber dem anderen Geschlecht, Umgang mit Veränderungen in der körperlichen Entwicklung. Auf der Suche nach einem verbindlichen Maßstab für das eigene Handeln entwickelt sich eine erhöhte Empfindsamkeit für kritische Reaktionen von Seiten der Umwelt. Kriterien für pathologische Angst • Angsterleben ohne reale Bedrohung • subjektiv/objektiv übertriebene Angstreaktion im Vergleich zum Auslöser • ausgeprägte Erwartungsangst • Angst vor der Angst • sozial/persönlich einschränkendes Vermeidungsverhalten • anhaltende Angst auch nach der Beseitigung der Bedrohung • Beeinträchtigung der Lebensbewältigung Ganz grob lassen sich Angststörungen danach unterscheiden, ob sich die Angst auf einen bestimmten Gegenstand oder eine Situation bezieht, wie es z.B. bei den Phobien der Fall ist oder ob die Angst eher eine umfassende ist. Generalisierte Angststörungen oder den Zwangsstörungen, bei denen die Betroffenen ihre ängstliche Spannung nur durch das ständige Wiederholen bestimmter „unsinniger“ Gedanken oder Handlungen in Schach halten können zählen zu letzterem. Schließlich gibt es Angststörungen, bei denen neben den Befürchtungen insbesondere die körperlichen Aspekte im Vordergrund stehen, wie bei den Panikattacken und den somatoformen Störungen. 4 Eupen 29.11.2014 2.1. Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Symptome verschiedener Angststörungen Die Symptome zeigen sich auf drei verschiedenen Ebenen: (1) Auf der körperlichen Ebene ist die Angst durch eine erhöhte Pulsfrequenz, Schweißausbrüche und Atembeschleunigung gekennzeichnet. Konkrete Symptome eines Patienten sind abhängig von der Art der Angststörung. (2) Das Erleben bzw. Denken und Fühlen des Menschen wird durch Befürchtungen Beeinträchtigungen und Überlegungen zur Vermeidung der gefürchteten Situation geprägt. (3) Das Verhalten zielt zunächst auf die Vermeidung der angstauslösenden Situation (Flucht, Ausweichen). Wenn dies nicht möglich ist, so ist der Mensch zumindest bestrebt, sich im Falle eines Angstanfalles schnelle Hilfe zu sichern. Störung Life-time Prävalenz Panikstörung mit/ohne Agoraphobie 1,5 – 3,5% Spezifische Phobie 10 – 11,3% Soziale Phobie 3 – 13% Zwangsstörung 2,5% PTBS 1 – 14% GAS 5% 5 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Verschiedene Angststörungen im Überblick 2.1.1. Phobische Angstsyndrome Phobische Angstsyndrome lassen sich in zwei größere Kategorien einteilen: Spezifische Phobien Soziale Phobien Spezifische Phobien Bezeichnet die Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen. Beispiele sind hier: Tierphobien, Klaustrophobie (also Angst vor geschlossenen Räumen), Angst vor der Dunkelheit oder Höhenphobie. Eine spezifische Phobie ist gekennzeichnet durch eine anhaltende Angst vor umschriebenen Objekten einer umgrenzten Situation. Vermeidungsverhalten Erwartungsängste häufig kein ausgeprägter Leidensdruck Soziale Phobien Das zentrale Merkmal der sozialen Phobie sind ausgeprägte Ängste, in sozialen Situationen im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und sich peinlich oder beschämend zu verhalten. Dies zeigt sich beispielsweise durch: • Angst vor prüfender Betrachtung in kleinen Gruppen. • Erröten, kein Blickkontakt, Zittern, Übelkeit usw. • Entsprechende soziale Situationen werden vermieden. Die Soziale Phobie tritt spezifischen Situationen oder generalisiert auf. Es kommt zu Alltagsbeeinträchtigung durch Vermeidung. Beginn: meist in der Jugend Verlauf: chronisch fluktuierend Punktprävalenz 5 %, M = F Hohe Komorbidität mit Alkoholmissbrauch und Depression Familiäre Häufung 6 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle 2.1.2. Panikattacken Unter Panikatacken versteht man das Auftreten wiederkehrender, ausgeprägter Angstattacken, die sich nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken, nicht vorhersehbar sind und deshalb zu Erwartungsangst führen können. Es kommt zu Episoden intensiver Angst, plötzlicher Beginn, Höhepunkt innerhalb 10 min, die nach 30 min bis Stunden wieder abklingen. Mindestens 4 der folgenden Symptome: 1. Herzklopfen, Tachykardie 2. Schwitzen 3. Zittern, Beben 4. Atemnot, Beklemmungsgefühle 5. Benommenheit, Ohnmachtsgefühl 6. Erstickungsgefühle 7. Übelkeit 8. Depersonalisation, Derealisation 9. Taubheit, Kribbelgefühle 10. Hitzewallungen, Kälteschauer 11. Schmerzen, Unwohlsein in der Brust 12. Furcht zu sterben 13. Fucht verrückt zu werden, Angst vor Kontrollverlust 2.1.3. Agoraphobie Phobische Befürchtung bezieht sich auf… …Situationen, in denen Flucht oder Hilfe unmöglich erscheint. …Öffentlichkeit …Situationen, in denen Sicherheit vermittelnde Personen nicht verfügbar sind. Es kommt zu Vermeidungsverhalten, sozialem Rückzug • Begleitung wirkt entlastend • Einsicht, dass Furcht übertrieben / unsinnig ist • Oft Kompensation durch symbiotische Bindung Typische agoraphobe Situationen: • Bus, Zug, Jet • Brücke, Tunnel • Von zu Hause entfernt sein • Menschenmassen • Anstehen • Kirche, Kino, Hörsaal • Supermarkt, Kaufhaus • Restaurant • Sportereignis • Alleine zu Hause zu sein 7 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle 2.1.4. Generalisierte Angststörung Unter der generalisierten Angststörung versteht man die frei flottierende, anhaltende Angst mit vielfältigen, insbesondere vegetativen Symptomen. Im Kindes- und Jugendalter treten häufig weniger typische Beschwerden und weniger spezifische vegetative Symptome sind: 1. Übermäßige Angst und Sorgen (furchtsame Erwartung) bzgl. mehrerer Ereignisse oder Tätigkeiten 2. Die Person hat Schwierigkeiten, die Sorgen zu kontrollieren 3. Die Angst und Sorgen sind mit mind. 3 der folgenden Symptome verbunden: - Ruhelosigkeit oder ständiges „auf dem Sprung sein“ - leichte Ermüdbarkeit - Konzentrationsschwierigkeiten oder Leere im Kopf - Reizbarkeit - Muskelspannung - Schlafstörungen 4. Die Symptome treten während mind. 6 Monaten an der Mehrzahl der Tage auf und verursachen in Klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung. 2.1.5. Trennungsangst Angst vor der Trennung von wichtigen Bezugspersonen, die erstmals während der ersten Lebensjahre auftritt und durch außergewöhnlichen Schweregrad sowie abnorme Dauer zu einer Beeinträchtigung sozialer Funktionen führt. Diagnostische Kriterien: • Auf die Trennung von wichtigen Bezugspersonen fokussierte Angst, die die Trennung unmöglich machen kann • Fehlen einer generalisierten Angststörung des Kindesalters • Beginn vor dem sechsten Lebensjahr • Störung tritt nicht im Rahmen einer umfassenderen Störung (z.B. der Emotionen, des Sozialverhaltens, der Persönlichkeit) oder im Rahmen einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung auf • Dauer mindestens vier Wochen Symptome bei Trennungsangststörung • Gedanken, der Bezugsperson könne etwas zustoßen • Gedanken, das Kind könnte durch ungünstige Ereignisse von der Bezugsperson getrennt werden • Verweigerung von Kindergarten- oder Schulbesuch (um die Trennung von der Bezugsperson zu vermeiden); diese so genannte Schulphobie ist keine eigentliche Phobie, weil nicht die Schule phobisch besetztes Objekt ist, sondern eine Trennungsphobie • Schlafen nicht ohne Hauptbezugsperson bzw. nicht außerhalb der eigenen Wohnung 8 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher • Nicht ohne Hauptbezugsperson daheim bleiben wollen • Alpträume betreffen die Trennung von der Bezugsperson • Unglücklichsein vor bevorstehenden Trennungen, Dipl. Psych. H. P. Brettle auch während und nach diesen • Körperliche Symptome, hauptsächlich Übelkeit 3. Risikofaktoren Individuum Ängstliche Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene leiden häufig unter negativen Gedanken und Sorgen. Sie konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf bedrohliche Ereignisse und erinnern sich auch besonders häufig an diese. Insbesondere für Kinder gilt, dass sie das Ausmaß der Bedrohung überschätzen und ihre eigenen Bewältigungsmöglichkeiten unterschätzen. Für das Jugendalter finden sich sehr hohe Bedeutungen im Zusammenhang zwischen Essstörungen und Ängsten. 30% aller ehemaligen Essgestörten erkranken später an Angststörungen. Familie Kinder mit depressiven Eltern entwickeln überdurchschnittlich häufig Angststörungen. Gleichaltrige Fehlende Akzeptanz in der Gruppe und fehlende enge Freundschaften erhöhen das Risiko für Angststörungen (MOF). 4. Therapeutische Behandlungsansätze 4.1 Systematische Desensibilisierung Bedingungen schaffen unter denen ein Patient mit Angststörungen lernen kann seine massive Angst und seine damit verbundenen Vermeidungsverhaltensweisen schrittweise zu überwinden. 3 notwendige therapeutische Maßnahmen nach Wolpe: 1. Entspannungstraining 2. Erstellen individuellen Angsthierarchien (0-100) 3. Darbietung der Angstreize unter Entspannung zunächst in der Vorstellung (in sensu) dann auch in der Realität (in vivo). 9 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher 4.2. Konfrontationstherapien 4.3 Kognitive Strategien Dipl. Psych. H. P. Brettle Ablauf: 1. Strategie der kleinen Schritte (Erfolge motivieren) 2. Registrieren automatischer Gedanken 3. „zwei Spalten-Technik“ = „Hausaufgabe“, Dokumentation automatischer Gedanken versus rationale Erwiderung 4. Identifikation u. Testen eigener Kognitionen in der Realität 5. Entkatastrophisieren (evtl. auch Distanzlose Übersteigerung) 6. Umattribution (Zusammenhänge neu erschließen) 7. Entwicklung alternativer Lösungen 8. Aufbau realistischer Erwartungen (Training sozialer Kompetenzen) 4.4 Entspannungsübungen � Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen (PMR) � Autogenes Training nach Schultz � Meditationstechniken � Yoga 10 Eupen 29.11.2014 5. Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Exkurs Entwicklungsschritte Kinder und Jugendliche Bei Kindern und Jugendlichen gilt es gesondert auf die altersspezifischen Anforderungen und Entwicklungsgegebenheiten einzugehen. Eine Auflistung eben dieser Merkmale findet sich in den Arbeiten von Erikson und Dreher. Entwicklungsaufgaben nach Erikson: Phase/ Alter I 0 bis 1½ Jahre II 1½ bis 3 Jahre III 3 bis 6 Jahre IV 6 Jahre bis Pubertät V Jugend (Adoleszen z) VI junges Erwachsenenalter psychosoziale Krisen Vertrauen vs. Misstrauen unangemessene Lösung Unsicherheit, Angst psychosoziale Modalitäten etwas erhalten, etwas dafür geben Selbstwahrnehmung als Handelnde(r), als fähig zur Körperbeherrschung, als Verursacher von Geschehnissen Vertrauen auf eigene Initiative und Kreativität Zweifel an der eigenen Fähigkeit zur Kontrolle von Ereignissen (fest)halten, (los)lassen Gefühl fehlenden Selbstwertes Tatendrang, Kompetenz vs. Minderwertigkeit Vertrauen auf angemessene, grundlegende, soziale und intellektuelle Fähigkeiten mangelndes Selbstvertrauen, Gefühle des Versagens tun (einer Sache nachgehen), „so tun“ (spielen) Dinge tun (zum Abschluss bringen), Dinge zusammenfügen Identität und Ansehen vs. Ausschluss und Rollen-/ Identitätsdiffusion festes Vertrauen in die eigene Person Wahrnehmung des eigenen Selbst als bruchstückhaft; schwankendes unsicheres Selbstbewusstsein sich selbst sein (oder nicht), selbst sein unter Mitmenschen Intimität und Solidarität vs. Isolierung Fähigkeit zur Nähe und zur Bindung an jemand anders Gefühl der Einsamkeit, des Abgetrenntseins; Leugnung des Bedürfnisses nach Nähe sich gegenseitig im anderen finden und verlieren Autonomie vs. Selbstzweifel, Scham Initiative vs. Schuldgefühle angemessene Lösung stabiles, grundlegendes Sicherheitsbewusstsein Entwicklungsaufgaben im Jugendalter nach Dreher (1985) Aufbau eines Freundeskreises (neue, tiefere Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts) Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung (und ihrer Veränderungen) Sich das Verhalten aneignen, dass die Gesellschaft von einem Mann / einer Frau erwartet Aufnahme intimer Beziehungen zum Partner Von den Eltern unabhängig werden Wissen, was man werden will und was man dafür können (lernen) muss Vorstellungen entwickeln, wie der zukünftige Ehepartner und die zukünftige Familie sein sollen Über sich im Bild sein: wer man ist und was man will Entwicklung einer eigenen Weltanschauung (welche Werte gelten, nach denen ich auch mein Verhalten richte) Entwicklung einer Zukunftsperspektive (Leben planen und Ziele ansteuern) 11 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle 6. Was können wir als Bezugspersonen oder Betroffene im Umgang mit der Angst tun? Konkrete Tipps: - Anforderungen reduzieren (Vorsicht: Vermeidung!!!) Fähigkeiten fördern Bewertungen verändern REZIPROKE HEMMUNG Das Verändern von Gefühlen durch reziproke (wechselseitige) Hemmung bei: - Verhalten Gedanken Körper 6.1 - Das Verändern von Gefühlen durch entgegengesetztes Handeln Tun Sie das wovor Sie Angst haben – probieren Sie es immer wieder (evtl. zuerst in Gedanken, dann in der Realität) Nähern Sie sich Situationen, Orten, Tätigkeiten, Aufgaben oder Menschen vor denen Sie Angst haben Tun Sie selbst Dinge, um sich ein Gefühl von Kontrolle und Kompetenz zu geben 6.2 - Entgegengesetztes Denken An bewältigte Situationen denken (Erfolge) Ich schaffe das / Ich stehe das durch An geliebte oder geschätzte Menschen denken „Sicherer Ort“ / „Innere Helfer“ Innere Distanzierung Realitätsprüfung (vs. Befürchtung) 6.3 - Entgegengesetzte Körperhaltung Aufrechte Körperhaltung Schultern zurücknehmen Blick nach oben Fersen zueinander / Spitzen n. außen Fäuste ballen Tiefe Bauchatmung Thymusdrüse stimulieren 6.4. Motivation Was aber tun, wenn wir oder unser Gegenüber nichts gegen seine Angst tun möchte? Offensichtlich liegt (neben dem Aspekt des Vermeidungsverhaltens) ein Motivationsproblem vor, was wir uns wie folgt näher anschauen. Motivation ist der Prozess, der mich dazu bringt, etwas zu tun. Subjektive Diskrepanz zwischen einem gegebenen IST Zustand und einem alternativen SOLL Zustand. Motivation ist folglich der Prozess, der mich dazu bringt einen gegebenen IST Zustand in einen alternativen SOLL Zustand umzuwandeln. 12 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Motive sind ein Grund / Beweggrund etwas zu tun. Deutlich wird die Unterscheidung Motiv / Motivation bei einem Fernsehkrimi. Viele haben ein Motiv, aber nur einer (der Mörder) hatte die Motivation das Opfer umzubringen. In Bezug auf Angst: Es gibt gute Motive in die Schule zu gehen – aber ich habe nicht die Motivation dazu. Maslows Bedürfnispyramide Selbstverwirklichung Anerkennung Zuwendung (Freundschaft, Liebe) Sicherheit und Geborgenheit (materiell, gesundheitlich) Physiologische Grundbedürfnisse (Hunger, Durst, Schlaf, Sex) Höhere Stufen bauen auf niedrigen Stufen auf Motivation ist der Prozess der zum Handeln führt. Motivieren heißt deshalb - bei einem anderen oder bei sich selbst - die Bereitschaft fördern, bestimmtes Verhalten zu zeigen und bestimmte Ziele anzustreben. Wie kann man jemand motivieren? Intrinsische Motivation (Eigenmotivation) um der Tätigkeit selber willen etwas gerne machen (Fußball, Klavier spielen) Extrinsische Motivation (Motivation von außen) positive Verstärkung Ziele setzen, unterweisen informieren, delegieren „Zwangsmotivation“ (überreden, überzeugen, bei Entscheidung helfen) Wenn alles für eine Alternative A spricht und man sich trotzdem nach B verhält, lässt das auf Widerstand schließen. Es gibt vier Arten von Motivationsblockaden, denen man in der Praxis begegnen kann: a) Beziehung ist gestört (Lehrer zu alt, zu jung, Fach zu blöde, zu schwer usw.) b) IST wird unrealistisch wahrgenommen (Arbeitsleistung, z.B. aufräumen, Prüfung) c) SOLL unklar oder unattraktiv (z.B. aufräumen, lernen, in die Schule gehen) d) Mittel sind unklar (wie mache ich es?) Lösungen: zu a) Akzeptanz, darüber reden, Eigenverantwortlichkeit, Einstellungsänderung zu b) Informationsmangel, Vermeidung u. Gefühle beachten (ansprechen), Realitätsprüfung zu c) Kognitive Bewertung verändern, Entscheidungsmatrix, neue Aspekte alternative Verstärker (Premackprinzip) zu d) Information, bisheriges analysieren, Plan 13 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Ergänzende Empfehlung für Bezugspersonen: Modellverhalten mastery – coping (Coping günstiger bei sozialen Verhaltensweisen) Eigenschaften, die ein Modell haben sollte • eher freundlich • Verhalten attraktiv und erfolgreich • Person attraktiv und erfolgreich • nachahmbar 7. Protektive Faktoren im Kindes- und Jugendalter o Eine stabile emotionale Beziehung zu mindestens einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson o Ein emotional positives, unterstützendes und strukturgebendes Erziehungsklima o Rollenvorbilder für ein konstruktives Bewältigungsverhalten bei Belastungen o Soziale Unterstützung durch Person außerhalb der Familie o Dosierte soziale Verantwortlichkeiten o Temperamentmerkmale wie Flexibilität, Annäherungstendenz o Kognitive Kompetenzen wie z.B. eine zumindest durchschnittliche Intelligenz o Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstkonzept o Ein aktives und nicht nur reaktives oder vermeidendes Bewältigungsverhalten bei Belastungen o Erfahrungen der Sinnhaftigkeit und Struktur in der eigenen Entwicklung 14 Eupen 29.11.2014 8. Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Literatur Ahrens-Eipper, S. und Leplow, B. 2004. Mutig werden mit Til Tiger. Göttingen. Hogrefe. Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder und CD mit Tigergeschichte und Entspannungsübungen. Barrett, P. et al. 2003. FREUNDE für Kinder. Gruppenleitermanual. München. Reinhardt. Barrett, P. et al. 2003. FREUNDE für Kinder. Arbeitsbuch für Kinder. München. Reinhardt Das Programm beinhaltet wertvolles Arbeitsmaterial zum Thema Angst und Depressionen, das auch in der Einzelbehandlung gut einsetzbar ist. Bodal, S. 1981. Selina, Pumpernickel und die Katze Flora Bohus, M. & Wolf, M. 2009. Interaktives SkillsTraining für Borderline-Patienten. Schattauer GmbH Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie,2000. Leitlinien zu Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings- Kindes-, und Jugendalter. Köln: Deutscher ÄrzteVerlag. Döpfner, M. & Rothenberger, A. Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen – Fragen und Antworten. Broschüre der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen Essau, C. 2003. Angst bei Kindern und Jugendlichen. München: Reinhardt. Görlitz, G. 2004. Psychotherapie für Kinder und Jugendliche Grob, A. & Jaschinski, U. 2003. Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Beltz Joormann, J. & Unnewehr, S.2002. Behandlung der sozialen Phobie. Therapiemanual. Göttingen: Hogrefe Lakatos, A. & Reinecker, H. 2001. Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen. Ein Therapiemanual. Göttingen: Hogrefe Berg et al. 1986. Leyton-Zwangssyndrom-Fragebogen-Kinderversion. In: Steinhausen, H. Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. München: Urban und Schwarzenberg Melfsen, S., Osterlow, J., Beyer, J., Florin, I. 2003. Evaluation eines kognitiv-behavioralen Trainings für sozial ängstliche Kinder Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie. 32. 191-199 Meyer-Glitza, E. 2011. Jakob der Angstbändiger Neudeck, P. & Wittchen, H.-U. 2004. Konfrontationstherapie bei psychischen Störungen. Theorie & Praxis Oerter & Montada 2002. Entwicklungspsychologie Oaklander, V. 1989. Gestalttherapie mit Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Klett-Cotta. Einige interessante Anregungen lassen sich auch in der Verhaltenstherapie einsetzen. Petermann, U. Angststörungen.1999. In: Steinhausen,H. und v. Aster, M. Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin bei Kindern und Jugendlichen. Weinheim: Beltz. Psychologie Heute. 2009. Keine Angst vor der Angst Scheffler & Donaldson. 1999 Der Grüffelo Schneider, S. (Hrsg.),. 2004. Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Berlin: Springer. Schuster, K. 2005. Neue Sichtweise der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Zwangsstörungen bei Kindern. Forum Psychotherapeutische Praxis. 2/2005/64-71. Ein kreativer Ansatz zum spieltherapeutischen Umgang mit leichteren Zwängen 15 Eupen 29.11.2014 Umgang mit Ängsten Jugendlicher Dipl. Psych. H. P. Brettle Weinberger, S. 2001. Kindern spielend helfen. Weinheim: Beltz m.E. die wichtigste Ergänzung zu den verhaltenstherapeutischen Therapiemanualen. Sehr hilfreich zum Beginn der kindertherapeutischen Arbeit. Elternbücher Schmidt-Traub, S. 2001. Selbsthilfe bei Angst im Kindes- und Jugendalter. Ein Ratgeber für Kinder, Jugendliche, Eltern und Erzieher. Göttingen: Hogrefe Schmitdt-Traub, 2006 Zwänge bei Kindern und Jugendlichen. Ein Ratgeber für Kinder und Jugendliche, Eltern und Therapeuten. Göttingen: Hogrefe Schulte-Markwort, M., 1999. Kinderängste: Was Eltern wissen müssen. Augsburg, Midena. Eltern- und Kindbuch Lüdke, C. & Becker, A. 2007. Der kleine Samurai Mio Mio Mausbär. Heidelberg: Psychotherapeutenverlag. Elternratgeber und Bilderbuch für Kinder. Kinderbücher (Jugendliche s. Schmidt-Traub und Broschüre Döpfner) Baumgart, K. 1997. Tommy ist (k)ein Angsthase. Zürich: Baumhaus Boje, Kirsten. 2001. Kirsten Boje erzählt vom Angsthaben. Hamburg. Oetinger. u.a. werden in anschaulicher Form die körperlichen Angstreaktionen beschrieben, sowie der Unterschied zwischen Mut und Leichtsinn.. Sehr brauchbar, auch in der Erwachsenentherapie bisweilen einsetzbar. Zum Vorlesen als Ganzes nur für wenige Kinder geeignet (die Geschichte ist zu lang und zu kompliziert) Janisch, H. & Jung, B. Wenn Anna Angst hat. Wien: Jungbrunnen Kreul, H. 1996. Ich und meine Gefühle. Bindlach:Loewe. Konkret und brauchbar Mai, M. 1998, Mein erstes Mutmach-Bilderbuch. Ravensburg: Ravensburger Portmann, R. 1994. Mut tut gut, Würzburg:Arena Stafelt, P. 200o. Und was kommt dann? Frankfurt: Moritz Stellenweise für meinen Geschmack etwas zu makaber/angsteinflößend Snuit, M. & Golomb, N. 1991. Der Seelenvogel. Hamburg: Carlsen Eine eher literarisch-poetische Annäherung an das Thema „Gefühle“. Gefällt mir gut. Literatur zur allgemeinen Elternberatung und Themenbezogene Vorlesebücher Traumfresserchen Albträume Kast-Zahn, Jedes Kind kann Regeln lernen Kast-Zahn, Jedes Kind kann schlafen lernen Papa wohnt jetzt in der Hermannstraße Trennung der Eltern 16