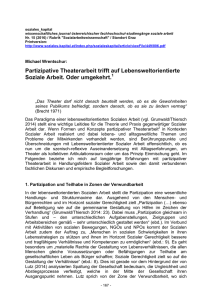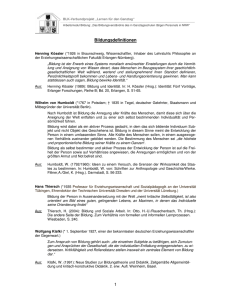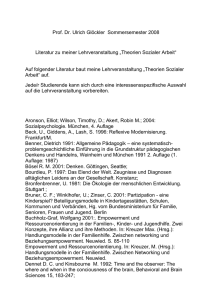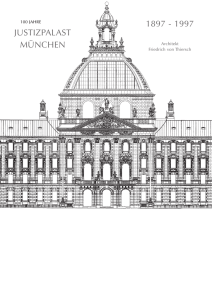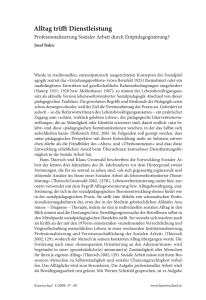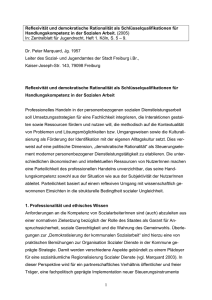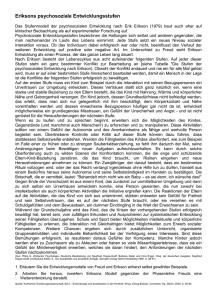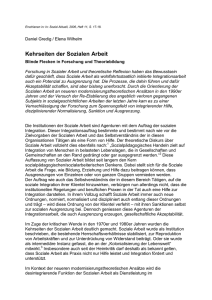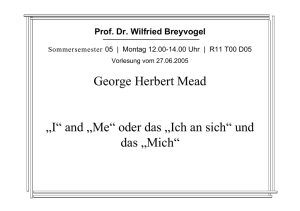Soziale Arbeit – ein monströser Bastard? Eine identitätstheoretische
Werbung

Soziale Arbeit – ein monströser Bastard? Eine identitätstheoretische Reflexion Fabian Kessl1 I. Ein Prolog aus aktuellem Anlass2 Die Erzählung seines Lebens in der Sozialpädagogik beginnt Hans Thiersch (2009: 222) mit einer Zuwanderungsgeschichte, deren Zielort gar nicht in der Weise vorbestimmt war, wie das der Titel des heutigen Symposiums markiert: „(D)ie Wahl der Sozialpädagogik (ist) eher zufällig gewesen. Man bot mir eine Assistentenstelle bei den Pädagogen an, Freundschaften zogen mich in praktische und theoretische Probleme der Sozialpädagogik, die – es wäre unehrlich, wenn ich das unterschlagen würde – mir vor allem als neue, offene und wenig bearbeitete Fragen attraktiv erschienen“. Denn hier, so Thiersch weiter, „war Neuland, hier lohnte es sich einzusteigen. - Trotz solcher Zufälligkeiten aber verstehe ich mich heute als gleichsam in der Wolle gefärbter Sozialpädagoge, so wie mich auch Freunde und Außenstehende mit ihr identifizieren. Ich habe mich auf Aufgaben eingelassen, bin in sie hineingewachsen und habe so meine Berufsidentität gefunden“.3 Dieser Ausschnitt aus Thierschs jüngster autobiografischer Retrospektion wird im Folgenden identitätstheoretisch interpretiert und zugleich als Ausgangspunkt einer verallgemeinerten identitätstheoretischen Reflexion auf die Soziale Arbeit insgesamt genutzt. 1 Erschienen in Thiersch, Hans/Treptow, Rainer( Hrsg.) (2011): Zur Identität der Sozialen Arbeit. Positionen und Differenzen in Theorie und Praxis, Neue Praxis Sonderheft 10. Lahnstein: Neue Praxis Verlag. 2 Der aktuelle Anlass ist der 75. Geburtstag des Sozialpädagogen Hans Thiersch, der im Rahmen eines Fachsymposiums am 11. und 12. Juni an der Universität Tübingen gefeiert wurde. Das Fachsymposium hatte auf Wunsch von Hans Thiersch das Thema Identität der Sozialen Arbeit. 3 An anderer Stelle wäre das von Hans Thiersch hier gewählte Textformat genauer unter die Lupe zu nehmen. Vieles spricht dafür, dass diese autobiografische Retrospektion die sozialpädagogische Historiografie vor allem in diskursgeschichtlicher Perspektive deutlich bereichert. II. Der identitätstheoretischen Reflexion erster Teil Für Erik H. Ericson, aber auch Margret Mead, war eine zeitdiagnostische Einschätzung der US-amerikanischen Gesellschaft Mitte des 20. Jahrhunderts Anlass für ihre identitätstheoretischen Grundlegungen, die aus heutiger Sicht als klassische Identitätstheorien kategorisiert werden können. Erikson wie Mead diagnostizierten in den Kriegsjahren und vor allem dem folgenden Jahrzehnt eine Identitätskrise vieler US-amerikanischer Gesellschaftsmitglieder wie der gesamten US-amerikanischen Gesellschaft. Um dieser Krise begegnen zu können, schien es beiden Autor_innen notwendig, eine wissenschaftliche Diskursivierung der notwendigen Identitätsentwicklung zu entwickeln (Jungwirth 2007: 171). Denn die damit „wissenschaftlich begründeten Normen“ ermöglichten wiederum eine „Diskursivierung gesellschaftlicher Normen“ (ebd.: 172). In dem damaligen historischen Kontext – dem Zusammenspiel von westlichem Imperialismus (Hobsbawm), der weiteren Stabilisierung national-wohlfahrtsstaatlicher Arrangements und der mit beiden verbundenen Etablierung eines Sozialentwurfs des autonomen Einzelnen als Mitglied dieser nationalwohlfahrtsstaatlicher Gesellschaftsformationen und somit als Stabilisierungsmoment sozialer Ordnung – ist der klassische sozialwissenschaftliche Identitätsdiskurs zu lokalisieren: Eriksons Konzept der „Ich-“, der „persönlichen“ und der „Gruppenidentität“, also die identitätstheoretische Figur, in der nun das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als harmonisch-ineinander verschränktes Verhältnis gefasst wird (vgl. ebd.: 162ff.).4 Und die Ausbildung einer solchen stabilen „Ich-“ und „persönlichen Identität“, die vor allem in der Jugendphase realisiert werden soll. Letztgenannten Aspekt arbeitet dann vor allem Margret Mead dahingehend heraus, dass sie betont, dass die Fokussierung der Jugendphase auch die entscheidende Phase der Stabilisierung des nationalwohlfahrtsstaatlichen Arrangements darstellt. Die Ausbildung einer stabilen Identität wird bei Erikson wie Mead somit zugleich zur Quelle der notwendigen Erneuerung des amerikanischen Nationalcharakters.5 Solchen klassischen identitätstheoretischen Konzeptionen unterliegt also ein lineares Identitätsentwicklungsmodell: Entwicklungsstufen, wie es bei 4 Das Gegenmodell hierzu sind freudianische und rousseauistische Gesellschaftsmodelle, die die Gesellschaft eher als Blockade für die Ausbildung eines stabilen Selbst begreifen (vgl. Jungwirth 2007: 163f.). 5 Die Figur des „Nationalcharakters“ wird dann auch zum Ausgangspunkt biorassistischer Politiken, die Eriksons identitätstheoretische Überlegungen explizit nutzen: Sioux und andere Gruppen wurden von ihm als „primitive Gruppen“ mit einer „negativen Identität“ beschrieben, die daher eine re-education zu unterwerfen seien (siehe national-character-studies). Erikson heißt, die den Menschen hin zur Ausbildung einer individuellen Identität führen und damit auch die kollektive Identität stabilisieren. Denn die gesellschaftliche Mitgliedschaft der Einzelnen ist zugleich immer Voraussetzung für die Entwicklungsmöglichkeit der Ich- und persönlichen Identität: Die national-wohlfahrtsstaatliche Gesellschaft macht den Einzelnen zu einem Mitglied, indem Einfluss genommen wird auf die Gestalt, in er sein Leben realisiert, das heißt die Aufgaben löst, die sich ihm stellen. Hans Thiersch spricht hinsichtlich seiner Identitätsbildungsprozesses in die deutschsprachige Sozialpädagogik von „Neuland“, das ihm zur Erschließung lohnenswert erschien.6 Dieser Hinweis lässt sich vor dem Hintergrund einer klassisch-identitätstheoretischen Theoriefolie durchaus einleuchtend interpretieren: Thiersch, so lässt sich dann schlussfolgern, stellt sich in seiner wissenschaftlichen „Jugendphase“ den auftretenden Aufgaben und löst sie in der Weise, wie sie im wissenschaftlichen Feld der Sozialen Arbeit zu lösen sind. Somit gelingt ihm die Ausbildung einer stabilen Identität als Sozialpädagogen. Übertragen auf die Soziale Arbeit als Profession wie Disziplin, würde die Identität der Sozialen Arbeit in dieser ersten identitätstheoretischen Version eine Konzeption voraussetzen, die auf wissenschaftlich begründeten Normen basiert und damit gültige professions- und disziplinsgesellschaftliche Normen ausbilden kann. Diese wäre dann die Voraussetzung, dass Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter wie Forscher_innen in den Feldern Sozialer Arbeit eine konsistente und tragfähige Identität entwickeln. Doch eine identitätstheoretische Interpretation der eingangs zitierten Selbstpositionierung Thierschs lässt nicht nur diese klassische Lesart zu. III. Der identitätstheoretischen Reflexion zweiter Teil Ingrid Jungwirth (2007: 209ff.) weist in ihrer Studie darauf hin, dass die klassischen identitätstheoretische Bestimmungen seit den 1960er Jahren aus den entstandenen neuen sozialen Bewegungen (u.a. Frauenbewegung und Dekolonisierungsbewegung) zunehmende Kritik erfuhren. Im Zentrum der Kritik steht damals das Modell der vorherrschenden Normalitätsmuster – als orientierender Bezugspunkt für die angestrebten Identitätsmodelle, da diese als gegebene Universalität angenommen werden. Aus Sicht beispielsweise 6 Ob Hans Thiersch mit dem Begriff „Neuland“ bewusst eine begriffliche Doppeldeutigkeit einführt, ist dem Text nicht explizit zu entnehmen. „Neuland“ war ein in der bürgerlichen Jugendbewegung weit verbreiteter Terminus, mit dem vor allem die visionäre – und dabei durchaus auch reaktionär konnotierte – Dimension der Jugendbewegung begrifflich markiert wurde. von Frauen oder Schwarzen stellt sich der von Erikson und Mead für die Ausbildung einer individuellen wie kollektiven Identität vorausgesetzte gesellschaftliche Bedingungskontext aber als historisch-spezifisches Herrschaftsverhältnis heraus (u.a. Heteronormativität und whiteness). Die klassischen identitätstheoretischen Konstruktionen basieren, das machen die Kritiker_innen somit sehr deutlich, auf Abgrenzungsund Ausschließungsmustern von den als anders markierten Gruppen , und keineswegs auf einer gegebenen Universalität als die die vorherrschenden Normalitätsmuster präsentiert werden. Allerdings, und das ist nun die identitätstheoretische Pointe von Jungwirths Analysen, ist den normalisierungskritischen Positionen eine analoge Argumentationsweise wie den von ihnen kritisierten klassischen Identitätstheorien inhärent: Auch von Franz Fanon und anderen wird nämlich eine Krisendiagnose vorgelegt, von der aus die Hoffnung formuliert wird, neue nicht-entmenschlichende Identitätsstrukturen ausbilden zu können. Die normalisierungskritisch ausgemachten Leerstellen (u.a. Frau-Sein oder Schwarz-Sein) sollen schließlich wieder füllbar gemacht werden, indem eine „wirkliche“ Universalität (Mensch-Sein) zum Bezugspunkt gemacht wird. Wenn Hans Thiersch in seiner Retrospektion davon schreibt, dass er sich als ein „in der Wolle gefärbter Sozialpädagoge“ versteht, „so wie mich auch Freunde und Außenstehende mit ihr identifizieren“, dann könnte diese Selbstmarkierung nun in einer normalisierungskritischen Lesart gedeutet werden. Erst die Markierung durch die Anderen, so ließe sich formulieren, die aus der hegemonialen, nicht-sozialpädagogischen Perspektive sprechen, produziert die Identität, die sich Thiersch im Rückblick heute zuschreibt. Diese Lesart verweist somit auch auf eine zweite identitätstheoretische Bestimmungsmöglichkeit Sozialer Arbeit: Historisch steht sie als „weibliche Profession“ (Wetterer 1995) – und entsprechend die ihr korrespondierende Disziplin, und als diejenige wohlfahrtsstaatliche Instanz, der „nach wie vor die negative Reputation der Leistungserbringung in exklusionsgefährdeten Kontexten anhaftet“ (Bommes/Scherr 2000: 146), häufig eher in der strukturanalogen Position zu den Nicht-Benennbaren selbst, das heißt zu den Gruppen, für die Fanon und andere kämpften, um die Ausbildung neuer nicht-entmenschlichender Identitätsstrukturen zu erreichen. Doch auch dies normalisierungskritische Lesart ist nicht ohne Widerspruch geblieben. IV. Der identitätstheoretischen Reflexion dritter Teil – und Schluss. Gegen die normalisierungskritischen Positionen wird nämlich vor allem aus subjektkritischer Perspektive eingewendet, dass sie mindestens latent selbst wiederum eine vereinheitlichende Identitätspolitik dynamisiert. Diese Kritik wurde seit den 1970er Jahren politisch vor allem von women of color im USamerikanischen Kontext gegenüber der von weißen Mittelschichtsfrauen dominierten zweiten Frauenbewegung formuliert. Zur theorie-systematischen Relevanz hat Judith Butler (1990) solchen identitätspolitischen Problematisierungen verholfen. Im Zentrum dieser Kritik der Normalisierungskritik steht die Beobachtung, dass im Kontext der neuen sozialen Bewegungen wiederum essenzialisierende Identitätskonstruktionen und damit gruppenbezogene Simplifizierungen realisiert wurden (u.a. Frauen als Frauen, Schwarze als Schwarze), womit aber andere Differenzierungen, beispielsweise die ethnische oder die Klassenpositionierung der Akteure überdeckt wird. Demgegenüber betonen nun identitätskritische Positionen, wie sie im Anschluss an Butler und andere ausbuchstabiert werden (vgl. Jungwirth 2007: 361ff.), dass Identität angemessen weder als Ausgangs(klassische identitätstheoretische Konzeptionen) noch als Endpunkt (normalisierungskritische Identitätskonzeptionen) angesehen werden können. Vielmehr müsse die jeweilige, und damit historisch-spezifische Identitätsproblematisierungen bzw. -thematisierungen zur Frage gemacht werden. Damit ist nicht mehr die Identität als eindeutiges, einheitliches und somit klar markierendes Produkt, sondern die Hybridität auf die Bühne gerufen (vgl. Ha 2003; Eickelpasch/Rademacher 2004). Vielleicht deutet sich in der autobiografischen Retrospektion von Hans Thiersch auch diese Lesart zumindest an, wenn er davon spricht, dass ihn „praktische und theoretische Probleme der Sozialpädagogik“ in die Soziale Arbeit zogen. Denn wendet man den Blick entsprechend und nimmt eine identitätskritische Perspektive ein und verlässt somit Ursprungskonstruktionen (Identität als Ausgangspunkt) ebenso wie teleologische Muster (Identität als Endpunkt) rücken die Fragen der konkreten Identitätspraktiken in den Fokus. Auf der Ebene professioneller Handlungsvollzüge sind das Fragen, wie die folgenden: Wie wird identifiziert, wie differenziert, wie segregiert? Wann vollziehen sozialpädagogische Akteure derartige Identifizierungs-, Differenzierungsund damit auch Segregationsprozesse? Verallgemeinert gesprochen: Wem lassen sozialpädagogische Fachkräfte, Organisationen oder Verbände bestimmte Identitätsprojekte zu und wem werden sie verweigert und wie werden diese blockiert? Analoge Fragen stellen sich auf der Ebene des disziplinären Tuns: Wie identifiziert, differenziert und segregiert die sozialpädagogische Community? Wem lassen die bestimmenden Vertreter_innen ein wissenschaftliches Identitätsprojekt der Sozialen Arbeit zu und wem wird ein solches verweigert und wie wird es blockiert? Mehr noch: Mit einem identitätskritischen Blick wird das Projekt einer einheitlichen und eindeutigen „Identität der Sozialen Arbeit“ selbst zweifelhaft. Im Anschluss an migrationstheoretische Arbeiten wäre damit nämlich eine Abwendung vom Idealtyp (vor)herrschender Zugehörigkeitsmuster zu vollziehen – von den Identifizierungs- und Differenzierungsmustern also, von denen „hybride Identitäten in einer signifikanten Weise ab(weichen)“ (Mecheril 2003: 21). Demgegenüber rücken dann Muster der hybriden Zugehörigkeit in den Blick, die irritieren, „weil ihr Verhältnis zum Zugehörigkeitskontext im Rahmen der dominanten Zugehörigkeitsordnung uneindeutig bleibt“ (ebd.). Solche „Mehrfachzugehörigkeiten“ bieten allerdings keine neue Eindeutigkeit (mehr) an, sie bleiben konstitutiv prekär. Es gibt Identität in dieser Lesart nurmehr als monströsen Bastard. Aber ist die Position desjenigen, der nicht in der gültigen Herrschaftsfolge steht und als solcher auch nicht der gegebenen Ordnung unterstehen muss, ein solch unangenehmer und taktisch ungeeigneter Ort für das, was Soziale Arbeit im Angesicht der gegenwärtig sich verschärfenden Klassenkämpfe – vor allem „von oben“ (z.B. Peter Sloterdijk, Guido Westerwelle oder Hamburger Bürgertum) – dringender denn je braucht: Herrschaftskritische (Selbst)Reflexionen?7 Literatur: Bommes, Michael/ Scherr, Albert (2000): Soziologie der Sozialen Arbeit. Eine Einführung, Weinheim/München: Juventa Butler, Judith (1990): Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge Eickelpasch, Rolf/Rademacher, Claudia (2004): Identität, Bielefeld: Transcript Ha, Kien Nghi (2003): Postkoloniale Migration, Rassismus und die Frage der Hybridität. In: Steyerl, Hito/Encarnación, Gutiérrez Rodríguez (Hrsg.): Spricht die Subalterne deutsch?. Migration und postkoloniale Kritik, Münster: Unrast, S. 146-165 Jungwirth, Ingrid (2007): Zum Identitätsdiskurs im den Sozialwissenschaften: eine 7 Das Moment der Herrschaftskritik ist entscheidend, denn es unterscheidet die hier präferierte identitätskritische Position auch grundsätzlich von postmodernistischen Plädoyers für eine uneindeutige Identität Sozialer Arbeit (vgl. Kleve 2000). Die wenig überzeugende Konsequenz aus solchen Plädoyers ist, die Auseinandersetzung mit Identitätsfragen schlicht für unnötig zu erachten: “Identität wäre wieder etwas für diejenigen, die sonst keine Sorgen haben“, wie der Journalist Freddie Röckenhaus dies Konsequenz kürzlich mit Blick auf das post-industrielle Ruhrgebiet zugespitzt hat (in Geo Special, Ruhrgebiet 2009/2010: 111). postkolonial und queer informierte Kritik an George H. Mead, Erik H. Erikson und Erving Goffman, Bielefeld: Transcript Kleve, Heiko (2000): Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften. Fragmente einer postmodernen Professions- und Wissenschaftstheorie Sozialer Arbeit, Freiburg i.B.: Lambertus Mecheril, Paul (2003): Politik der Unreinheit: ein Essay über Hybridität, Wien: Passagen Thiersch, Hans (2009): Schwierige Balance: über Grenzen, Gefühle und berufsbiographische Erfahrungen, Weinheim/München: Juventa Wetterer, Angelika (1995): Die soziale Konstruktion von Geschlecht in Professionalisierungsprozessen, Frankfurt a.M./New York: Campus