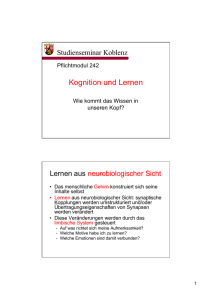Gehirngerechtes Lehren und Lernen - Zentrum für wissenschaftliche
Werbung

Gehirngerechtes Lehren und Lernen 09.12.2012 Henry González Peña Neuhaußstraße 3 60322 Frankfurt „Kontaktstudium Fremdsprachen für ErwachseneSprachandragogik“ Gender-Erklärung Zugunsten der einfacheren Lesbarkeit wird sowohl für die männliche wie die weibliche Form die männliche Form verwendet. Gliederung Einleitung 1 1. Das menschliche Gehirn 3 1.1 Anatomie 4 1.1.1 Hirnstamm 4 1.1.2 Kleinhirn 5 1.1.3 Zwischenhirn 5 1.1.4 Endhirn einschließlich Großhirnrinde 5 1.2 2. 3. Die Funktionen des Gehirns 9 1.2.1 Dorsaler Thalamus 9 1.2.2 Amygdala 10 1.2.3 Hippocampus 10 Wie werden Informationen im Gehirn verarbeitet? 12 2.1 Neuronen und Synapsen 12 2.2. Die neurobiologische Arbeitsweise von Neuronen und Synapsen 13 2.2.1 Neurotransmitter 15 2.2.2 Neuroplastizität und Langzeitpotenzierung 16 2.2.3 Wie wird eine Information verarbeitet? 18 2.2.4 Vergessen einer Information 19 Das menschliche Gedächtnis 20 3.1 Das Zeitmodell 21 3.1.1 Das Ultrakurzzeitgedächtnis (UZG) 21 3.1.2 Das Kurzzeitgedächtnis (KZG) 21 3.1.3 Das Langzeitgedächtnis (LZG) 22 3.2 Das inhaltsabhängige Beschreibungsmodell 23 3.2.1 23 Das deklarative Gedächtnis 4. 3.2.2 Das prozedurale Gedächtnis 24 3.2.3 Das emotionale Gedächtnis 26 Lernen 27 4.1. Faktoren die das Lernen beeinflussen 28 4.1.1 Aufmerksamkeit 28 4.1.2 Motivation 29 4.1.2.1 Dopamin 32 Emotionen 33 4.1.3.1 Angst 35 4.1.3.2 Stress 36 4.1.3 4.2 5. Lerntypen 38 4.2.1 Lerntypen nach bevorzugten Wahrnehmungssinn 38 4.2.2 Lerntypen nach Lernstil 40 4.3 Lernen im Alter 42 Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen 46 5.1 Wiederholungen 46 5.2 Verknüpftes Lernen .47 5.3 Strukturierter Input 47 5.4 Mehr Sinne anregen 47 5.5 Selbst tun 48 5.6 Die richtige Haltung zum Lernen einnehmen 49 5.7 Aktive Teilnahme am Unterricht 49 5.8 Geschichten 49 5.9 Immer zuerst das große Ganze 49 5.10 Schlaf 50 5.11 Regelmäßige Erfolgserlebnisse schaffen 50 6. 5.12 Sich über seine Lernmotive und -ziele im Klaren sein 50 5.13 Das Lernplateau verstehen 50 5.14 Unterrichtspausen einlegen 51 5.15 Pausen beim Lernen machen 52 Spiele im Sprachunterricht 53 6.1 Welchen Nutzen haben Spiele im Unterricht? 54 6.2 Wie sollte sich der Lehrer beim Spielen verhalten? 54 6.3 Geeignete Spiele für den Fremdsprachunterricht 55 Schlussbemerkung 56 Bibliographie 57 Anhang 59 Einleitung S ei te |1 Einleitung Die Neurodidaktik setzt sich mit der pädagogischen Relevanz der Gehirnforschung auseinander. Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde dieser Begriff von dem Fachdidaktiker Gerhard Preiß geprägt „um die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für Didaktik und Unterrichtspraxis zu betonen (Roth 2011: 281)“. Die Neurodidaktik stützt sich auf die Annahme, dass die biologische Grundlage jeglicher geistiger Tätigkeit und somit auch die des Lernens, das Gehirn ist. Es ist die medienpräsente Gehirnforschung, die die fundamentalen Kenntnisse über das Gehirn und seiner Funktionsweise liefert. Dank der ab 1980 eingesetzten Kernspinresonanztomographie (MRT) ist es möglich, die Gehirnareale, die für das Lernen von Bedeutung sind, zu lokalisieren. Weil jeder Lernvorgang mit einer Veränderung des Gehirns verbunden ist, ist die Kenntnis über die im Gehirn beim Lernen ablaufenden Prozesse eine Voraussetzung, um das Lehren und Lernen effizient und effektiv gestalten zu können. In diesem Sinne postuliert Manfred Spitzer in seinem Buch „Lernen“: „Wer lehrt, sollte etwas vom Lernen und dem Organ des Lernens, dem Gehirn, verstehen“ (2009: 19). Doch noch viele Lehrer bezweifeln den praktischen Nutzen der Gehirnforschung für den Unterricht und sehen in der Neurodidaktik eine reine Modeerscheinung. Die Kritiker der Neurodidaktik verneinen jegliche Relevanz der Neurowissenschaften für die Didaktik. Für Sie ist Lehren ein vielschichtiger Prozess, der sich nicht auf die Verstärkung synaptischer Verbindungen reduzieren lässt. (vgl. Roth 2011: 282ff) Meine Hausarbeit soll zeigen, wie sich Erkenntnisse der Gehirnforschung für ein erfolgreicheres Lehren und Lernen umsetzen lassen. Dazu soll als Erstes die Anatomie und die Funktionsweise des Gehirns beschrieben werden. Nach der Vorstellung der verschiedenen Gedächtnisarten werde ich mich dem Thema Lehren und Lernen aus neurobiologischer und lernpsychologischer Sicht widmen. Beim lernpsychologischen Aspekt sollen die Bedeutung von Aufmerksamkeit, Emotionen und Motivation für das Lernen beschrieben werden. Nach der Vorstellung der verschiedenen Lerntypen werde ich mich mit dem Lernen im Alter auseinandersetzen. Beispiele, wie gehirngerechtes Lehren und Lernen in der Praxis aussehen, folgen. Im letzten Kapitel soll der neuro-didaktisch fundierte Nutzen von Spielen im Fremdsprachenunterricht als „Dopaminausschüttungs-Instrument“ und Mittel, das Gehirn ganzheitlich zu aktivieren, beschrieben werden. Einleitung S ei te |2 Im Anhang werde ich ein von mir modifiziertes Spiel vorstellen, das sich speziell für das Wiederholen von Verben eignet. 1. Das menschliche Gehirn S ei te |3 1. Das menschliche Gehirn Chalvin (1993) Die Entwicklung unserer Vorfahren begann vor ca. 7 bis 10 Millionen Jahren in Ostafrika. Von dort aus begannen vor 100.000 Jahren unsere mittelbaren Ahnen, der Homo sapiens (der einsichtige Mensch), die Welt zu erobern (vgl. Medina 2009: 32ff). In der Evolution gab es zwei Strategien zu überleben: entweder stärker oder schlauer zu werden (vgl. Medina 2009: 28ff), (vgl. Spitzer 2009: 14). Bei unseren Vorfahren sicherte die Vergrößerung des Gehirns und die damit einhergehende Ausbildung höherer kognitiver Fähigkeiten (Einsicht, Verstand, Weisheit) das Überleben. An dem Modell des Dreieinigen Gehirns („Tribune Brain“) (vgl. Medina 2009: 39ff) kann man die Evolutionsgeschichte des menschlichen Gehirns an seinem Aufbau ablesen. Ausgehend vom Reptiliengehirn (grundlegende Lebensfunktionen) entwickelte sich bei den Säugetieren das limbische System (Emotionssteuerung), aus dem schließlich beim Homo sapiens der Neocortex (höhere kognitive Fähigkeiten) entstand. Ausschlaggebend für die Entwicklung des Gehirns war der Übergang zum aufrechten Gang. Dadurch wurde, im Gegensatz zur Fortbewegung auf allen Vieren, weniger Energie verbraucht. Die damit freiwerdende Energie konnte in die Entwicklung eines leistungsfähigeren Gehirns gesteckt werden. (vgl. Medina 2009: 38) Das menschliche Gehirn besitzt bei Männern ein durchschnittliches Gewicht von 1,35 Kilogramm und 1,22 Kilogramm bei Frauen. Es besteht aus Wasser (etwa 85 %), Fett (knapp 170 Gramm), etwas Eiweiß, drei Teelöffel Salz und weiteren komplexen Molekülen. Es verbraucht mehr als 20 Prozent der Körperenergie, obwohl er nur 2 1. Das menschliche Gehirn S ei te |4 Prozent des Körpergewichts ausmacht. 100 Milliarden Neuronen (Nervenzellen) und etwa 10-mal so viele Gliazellen (Faserverbindungen zwischen den Neuronen) sind die wesentlichen Bestandteile des Gehirns. Die Gliazellen sind Stütz- und Versorgungsgewebe für die Neuronen. Daneben nehmen sie an der neuronalen Erregungsverarbeitung teil. Die Verbindungen zwischen den Neuronen bezeichnet man als Synapsen, ihre Anzahl beträgt ca. 100 Billionen. (vgl. Roth 2009: 14ff), (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 7,12,15ff) 1.1 Anatomie Das menschliche Gehirn, das in seinem Aufbau dem Gehirn anderer Wirbeltieren entspricht, wird in fünf Hirnabschnitten gegliedert (vgl. Roth 2009:13ff): (vgl. Roth 2011: 314) 1.1.1 Hirnstamm Er ist der stammesgeschichtlich älteste Teil des Gehirns und bildet den untersten Gehirnabschnitt. Der Hirnstamm besteht aus dem Verlängertem Mark, der Brücke („Pons“) und dem Mittelhirn. Das Verlängerte Mark ist die Fortsetzung des 1. Das menschliche Gehirn S ei te |5 Rückenmarks und zieht sich bis zur Brücke. Die Brücke enthält wichtige motorische und limbische Kerne. (vgl. Roth 2009: 14,21ff) Zusammen mit dem Hypothalamus bildet er die Grundlage der biologischen Existenz: Atmung, Schlaf-Wach-Rhythmus, Erregungs- und Aufmerksamkeitszustände. (vgl. Roth 2009: 21) 1.1.2 Kleinhirn Es ist zuständig für das motorische Lernen. Das Kleinhirn steuert das Gleichgewicht, die Koordination des Bewegungsapparates, die Feinmotorik und die Feinkoordination von zeitlichen Abläufen wie Bewegung, Sprachlaute und Gedankenketten. Neuere Untersuchungsergebnisse lassen den Schluss zu, dass das Kleinhirn auch am Spracherwerb und dem sozialen Lernen beteiligt ist. (vgl. Roth 2009: 22) 1.1.3 Zwischenhirn Zu ihm werden gerechnet: - Epithalamus - Dorsaler Thalamus - Ventraler Thalamus (Subthalamus) - Hypothalamus - Subthalamus Die Funktion des dorsalen Thalamus, der für die Verarbeitung von Informationen von Bedeutung ist, wird im Abschnitt „Funktionen des Gehirns“ unter Punkt 1.2.1 genauer beschrieben. Das Zwischenhirn ist beteiligt an der Schlaf-Wach-Steuerung und der Schmerzempfindung. (vgl. Roth 2006: 23) 1.1.4 Endhirn einschließlich Großhirnrinde (Cortex) „Die Großhirnrinde gilt als Sitz von allem, was uns zum Menschen macht, und deshalb findet sie seit jeher das besondere Interesse der Hirnforscher“ (vgl. Roth 2011: 316). 1. Das menschliche Gehirn S ei te |6 Die Großhirnrinde (Cortex) ist der größte Teil des menschlichen Gehirns und macht etwa die Hälfte des gesamten Hirnvolumens bzw. Hirngewichts aus. Die Großhirnrinde entstand vor rund 130 Millionen Jahren, als sich die ersten Säugetiere entwickelten. Ihre evolutionäre Entwicklung war vor ca. 100000 Jahren mit der völligen Ausbildung des Neocortex (Isocortex) abgeschlossen, der zu 96 % den größten Teil des Cortex ausmacht. Der Neocortex besteht aus einer 2-5 mm dicken Schicht von Neuronen und besitzt das Aussehen eines gefalteten Tuches, das auseinander gefaltet eine Fläche von einem viertel Quadratmeter hat. Die etwa 15 Milliarden Neuronen des Neocortex werden aufgrund ihres pyramidenähnlichen Aussehens als Pyramidenzellen bezeichnet. Die Pyramidenzellen sind durch eine halbe Trillion Kontaktpunkte, sogenannte Synapsen, miteinander verbunden. Dadurch kann jedes Neuron Signale von etwa 10.000 anderen Neuronen empfangen und Signale an genauso viele übermitteln. Dieses Gesamtnetzwerk von Neuronen und Synapsen ist in zahlreiche Unternetzwerke eingeteilt, die miteinander verknüpft sind. (vgl. Roth 2011: 316), (vgl. Aamodt/Wang 2008: 43) Im Neocortex sind die sog. kortikalen Karten angesiedelt. Sie bestehen aus Neuronen, die bestimmte Inhalte repräsentieren. Kortikale Karten entstehen dadurch, dass sich eng benachbarte Neuronen aufgrund von häufigen und sich ähnelnden Input zu regelmäßigen Mustern ordnen. Kortikale Karten sind plastisch, weil sie sich durch ständiges Üben und Wiederholen vergrößern können. So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass akustische Karten bei Musikern etwa ein Viertel größer sind als bei Nichtmusikern. Unsere gesamte Körperoberfläche wird ebenfalls durch kortikale Karten repräsentiert (Penfielscher Homunkulus). (vgl. Spitzer 2009: 100ff) Die Großhirnrinde besteht aus zwei Hälften, der rechten und linken Hemisphäre, und wird in 52 unterschiedliche Hirnrinderfelder, den sog. Brodmann-Arealen, eingeteilt. Die beiden Gehirnhälften sind über Nervenfasern miteinander verbunden. Diese Verbindung wird als Balken (Corpus Callosum) bezeichnet. Der Balken steuert die Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 47) Die Hemisphären sind für verschiedene geistige Aktivitäten zuständig. Die linke Gehirnhälfte verarbeitet Informationen hauptsächlich in sprachlicher Form und ist für 1. Das menschliche Gehirn S ei te |7 das logische Denken und das Analysieren von Situationen zuständig. (vgl. Kilp 2010: 30) Die rechte Gehirnhälfte verarbeitet Informationen hauptsächlich in bildhafter Form. Sie operiert gefühlsbetont und kreativ. Des Weiteren ist sie für räumliches Denken und Steuerung von Bewegungen zuständig. (vgl. Kilp 2010: 30) Die Hemisphären sind aus je vier sogenannten Hirnlappen aufgebaut (vgl. Roth 2009: 25): (vgl. Aamodt, Wang 2008: 44) -Stirnlappen (präfrontaler Cortex): Er ist zuständig für die Handlungsplanung, Organisation, Koordination und Steuerung von Bewegungen. Des Weiteren ist er für das Schlussfolgern, die Überwachung des Denkvorgangs und für die Impulskontrolle zuständig. Der präfrontale Cortex ist Sitz der „allgemeinen Intelligenz“ und bildet das Arbeitsgedächtnis, d. h. er verarbeitet die Informationen, die momentan relevant sind. (vgl. Roth 2011: 320) -Scheitellappen (Parietallappen): Er ist zuständig für die symbolich-analytische Informationsverarbeitung (Mathematik, Sprache, Symbole).Der Scheitellappen empfängt und verarbeitet Informationen der 1. Das menschliche Gehirn S ei te |8 Hautsinne. Zudem fügt er die einzelnen Sinnesinformationen zusammen und entscheidet, worauf die Aufmerksamkeit zu lenken ist. (vgl. Roth 2011: 317ff) -Schläfenlappen (Temporallappen): Er ist zuständig für komplexes Hören und dem Verstehen und Sprechen einfacher Sätze. Das Erkennen von Gesichtern und deren emotionalen Ausdruck geschieht ebenfalls durch den Schläfenlappen. Des Weiteren steht er in engem Kontakt mit der Amygdala und dem Hippocampus und ist bedeutsam für Lernprozesse, Gedächtnis und emotionale Reaktionen. (vgl. Roth 2011: 320) - Hinterhauptslappen (Okzipitallappen): Er ist zuständig für einfaches Sehen und komplexes visuelles Erkennen. (vgl. Roth 2011: 319) In der linken Hemisphäre sind zwei wichtige Sprachareale angesiedelt: das Broca und Wernicke- Areal. (vgl. Roth 2011: 207 ff) Das Broca-Areal (motorische Sprachzentrum), das die Brodmann Areale 44 und 45 umfasst, befindet sich im präfrontalen Cortex direkt unterhalb der für das Arbeitsgedächtnis zuständigen Areale. Es ist das Zentrum für grammatikalischsyntaktische Sprache. Es ist zuständig für: -die Koordination der Bewegungen von Kehlkopf und Mund beim Sprechen -für die Syntax-Verarbeitung. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 108) Das Broca-Areal entstand vor 100.000 Jahren und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der menschlichen Sprache dar. Es ermöglichte ein reichhaltiges Lautrepertoire, mit dem es unsere Vorfahren befähigte, „Symbole sprachlicher wie nicht sprachlicher Art in ihrer zeitlichen Reihenfolge zu erkennen und systematisch abzuwandeln“ (Roth 2009: 66). Dazu kam die Ausbildung einer bewussten Steuerung des Sprechapparates. Eine Verletzung des Broca-Areals hat eine schlechte Artikulation zur Folge. (vgl. Grein 2012: 46) Das Wernicke-Areal (sensorisches Sprachzentrum), das im linken Temporallappen liegt (Brodmann Areal 22), dient dem Sprachverständnis (semantische Verarbeitung) und der Integration von Sprach- und Textinhalten. Bei einer Verletzung können 1. Das menschliche Gehirn S ei te |9 gehörte Wörter nicht mehr verstanden werden. (vgl. Roth 2011: 208), (vgl. Grein 2012: 47) Ein weiteres für die Sprache wichtiges Areal, der sogenannte Gyrus supramarginalis, sitzt im Scheitellappen (Brodmann Areal 40) und spielt beim Verbinden von Wort und Wortform eine wichtige Rolle. Beim Lesen wird dieser Bereich ebenfalls aktiviert. Bei einer Verletzung geht die Fähigkeit gehörte Buchstabenfolgen wiederzugeben verloren. (vgl. Grein 2012: 48) Der Gyrus angularis liegt im Brodmann Areal 39, wo Scheitel-, Schläfen- und Hinterhauptslappen aufeinandertreffen. Er spielt eine wichtige Rolle beim Schreiben, Lesen, Rechnen und der Fähigkeit zur Abstraktion. Der Gyrus angularis wandelt visuelle Informationen in Sprache um. (vgl. Grein 2012: 49) 1.2 Die Funktionen des Gehirns Die Funktionen des Gehirns lassen sich in fünf Bereiche einteilen: - Bereich für die vegetativen Funktionen - sensorischer Bereich für die Wahrnehmung - motorischer Bereich für den Bewegungsapparat - kognitiv-assoziativer Bereich für Denken, Erinnern und Vorstellen - Bereich des limbischen Systems, das u.a. für die emotionale Bewertung der Folgen unseres Handels und für Handlungsentscheidungen zuständig ist. Des Weiteren spielt es eine entscheidende Rolle bei der emotionalen Bewertung aufgenommener Informationen und deren Übertragung ins Langzeitgedächtnis. (vgl. Roth 2009: 28ff) Da das limbische System einen entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg hat, sollen drei Bausteine dieses Systems näher beschrieben werden: der dorsale Thalamus, die Amygdala und der Hippocampus. 1.2.1 Dorsaler Thalamus Er wird auch als Tor zum Bewusstsein bezeichnet, denn er ist mit der Großhirnrinde (Cortex) über auf- und absteigende Fasern verbunden. In ihm werden die über die sensorischen Bahnen ankommenden Reize für die weitere Verarbeitung im Cortex synchronisiert. Der dorsale Thalamus fungiert als Filter, der Wesentliches von 1. Das menschliche Gehirn S e i t e | 10 Unwesentlichem trennt. Dadurch werden nur Informationen an den Cortex weitergeleitet, die für den betreffenden Kontext von Bedeutung sind. Das folgende Beispiel soll dies veranschaulichen: Beim Lesen sorgt der dorsale Thalamus dafür, dass man Hintergrundmusik nicht wahrnimmt und sich so beim Lesen ganz auf den Text konzentrieren kann. Vom dorsalen Thalamus wird das eingehende Datenmaterial direkt an das Frontalhirn (Teil des Cortex) weitergeleitet. Dort erfolgt eine emotionale Bewertung des Sachverhalts. Danach werden die Informationen zum limbischen System zurückgespielt, das die Informationen mit Gefühlen versieht und dem Frontalhirn erneut zur abschließenden Beurteilung vorlegt. (vgl. Roth 2009:24ff), (vgl. Medina 2009: 228) 1.2.2 Amygdala Die Amygdala, auch als Mandelkern bezeichnet, verarbeitet die Geruchsreize und steuert das Flucht- und Angriffsverhalten. Sie ist für das emotionale Lernen, Stressreaktionen und dem Erkennen von Gestik und Mimik zuständig. Die in der Amygdala ankommende Informationen werden nach einem einfachen Muster ausgewertet: Feind oder Freund, Angriff oder Flucht. (vgl. Roth 2011: 323ff) 1.2.3 Hippocampus Der Hippocampus speichert Fakten und Ortsinformationen und spielt eine wichtige Rolle bei Lern- und Gedächtnisvorgängen. Er ist Voraussetzung zum Erlernen einzelner Ereignisse (vgl. Spitzer 2009: 23ff). Der Hippocampus ordnet die eingehenden Daten in den zeitlichen und räumlichen Gesamtzusammenhang ein. Da er besonders an Neuigkeiten interessiert ist, wird er auch als Neuigkeitsdetektor („novelty detektor“) bezeichnet (vgl. Spitzer 2009: 34). Eine neue und interessante Information speichert er ab, das heißt, er bildet eine neue Repräsentation von ihr (vgl. Spitzer 2009: 27ff, 34). Für Ereignisse stellt er einen emotionalen Orientierungsrahmen wie Trauer, Ärger, Angst, Freude und Schuld zur Verfügung (vgl. Medina 2009: 40). Der Hippocampus spielt eine wichtige Rolle bei Gedächtnisvorgängen, denn er ist am Übergang vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis, das im Cortex angesiedelt ist, beteiligt (vgl. Bonhoeffer/ Gruss 2011: 63). Dieser Vorgang wird als Konsolidierung bezeichnet (vgl. Spitzer 2009: 121ff). Der Hippocampus ist an der Bildung des deklarativen Gedächtnis (autobiographisches und Faktengedächtnis) beteiligt. Für das 1. Das menschliche Gehirn S e i t e | 11 Ultrakurzzeitgedächtnis spielt der er keine Rolle. Auch das prozedurale Gedächtnis (Fertigkeiten und Gewohnheiten) funktioniert unabhängig von ihm (vgl. Bonhoeffer/ Gruss 2011: 64). Für das Lernen neuer Inhalte ist der Hippocampus von großer Bedeutung. So konnte nachgewiesen werden, dass sich durch Vokabellernen neue neuronale Repräsentationen im Hippocampus bilden (vgl. Spitzer 2009: 33ff). Die Repräsentierung von Einzelheiten im Hippocampus ist auch bei der Orientierung von Wichtigkeit (vgl. Spitzer 2009: 30). Untersuchungen bei Londoner Taxifahrer, die bekanntlich auf ein starkes Ortsgedächtnis angewiesen sind, zeigten, dass sie über einen überdurchschnittlich großen Hippocampus verfügten. Gleich einem Muskel wurde der Hippocampus durch die Notwendigkeit einer optimalen Orientierung trainiert und vergrößerte sich dadurch. Dies ist ein eindeutiges Indiz, dass der Hippocampus in Abhängigkeit von der Erfahrung wächst und umso besser funktioniert, je mehr er beansprucht wird (vgl. Spitzer 2009: 31ff). Nach dieser Beschreibung der für das Lernen wichtigsten Bauteile des Gehirns will ich im folgenden Kapitel zeigen, wie Informationen im Gehirn verarbeitet werden. 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 12 2. Wie werden Informationen im Gehirn verarbeitet? Zum besseren Verständnis der Informationsverarbeitung im Gehirn sollen zuerst die zellulären (Neuronen und Synapsen) und molekularen (Neurotransmitter) Grundlagen der Gehirnfunktion beschrieben werden. Die Voraussetzungen für die Gedächtnisbildung, Neuroplastizität und Langzeitpotenzierung, werden anschließend behandelt. Am Schluss des Kapitels soll gezeigt werden, wie eine Information im Einzelnen verarbeitet wird und weshalb sie in Vergessenheit geraten kann. 2.1 Neuronen und Synapsen (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 76) Neuronen sind die kleinsten Funktionseinheiten des Gehirns. Sie sind auf die Speicherung und Verarbeitung von Informationen spezialisiert. Sie nehmen ankommende Erregungen auf, verarbeiten sie und geben sie wieder ab. Von anderen Körperzellen unterscheiden sie sich durch ihre langen dünnen Fortsätze, mit denen sie mit anderen Neuronen in Kontakt treten können. Es gibt im menschlichen Gehirn etwa 100 verschiedene Arten von Neuronen, deren Aussehen mannigfaltig 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 13 ist. Jedes Neuron besitzt einen Zellkörper, der den Zellkern mit der DNA enthält. Die Empfangsantennen des Neurons sind die Dendriten, die, gleich Wurzeln eines Baumes, Ausläufer am Zellkörper bilden. Auf den nur einigen zehntel Millimeter langen Dendriten sitzen die Dornen (spines). Diese können die von benachbarten Neuronen ausgeschütteten Botenstoffe, sog. Neurotransmitter, empfangen. Ausgangsstation eines Neurons ist das Axon. Es ist dünner als die Dendriten, aber mit einer Größe von einem Meter wesentlich länger. Um das Weiterleiten elektrischer Signale zu beschleunigen, sind Teile des Axon mit einer fettigen, isolierenden Schicht umhüllt, die aus ausgedehnten Gliazellen-Membranen besteht, der sog. Myellinhülle. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 12ff) Die Kontaktstellen zwischen den Neuronen bezeichnet man als Synapsen. Die Synapsen können unterschiedlich stark sein und sind in ihre Stärke veränderbar. Die eine Information weiterleitende Synapse wird als Präsynapse, die eine Information empfangende als Postsynapse bezeichnet. (vgl. Roth 2009: 18) 2.2 Die neurobiologische Arbeitsweise von Neuronen und Synapsen Grundlage für die Fähigkeit zur Verarbeitung von Informationen ist die elektrische Erregbarkeit der Neuronen. Die von den Sinnesorganen wahrgenommenen Informationen werden in elektrische Impulse umgewandelt. Diese entstehen, weil zwischen Außen- und Innenseite der neuronalen Zellmembran eine elektrische Spannung besteht. Dabei besitzt die negative Spannung des Zellinneren ein Ruhepotential von minus 70 Millivolt. Durch eine etwa eintausendstel Sekunde dauernde Änderung der Spannung auf plus 30 Millivolt wird das Neuron erregt. Diese plötzliche Spannungsänderung in Neuronen wird als Aktionspotential bezeichnet. Für die Informationsverarbeitung ist entscheidend, dass Aktionspotentiale schnell über den Ausgang des Neurons (Axon) zu anderen Nervenzellen weitergeleitet werden. Aktionspotenziale können auf Axonen Geschwindigkeiten von bis zu 120 m/s erreichen. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 16ff), (vgl. Aamodt/Wang 2008: 38) 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 14 Wo und wie werden Aktionspotentiale auf andere Neurone übertragen? (vgl. Roth 2011: 329) Die Übertragung findet an den Kontaktstellen zwischen Neuronen statt, den sog. Synapsen. An diesen findet der Wechsel zwischen elektrischer und chemischer Informationsverarbeitung statt, denn durch die in den Synapsen eintreffenden Aktionspotentiale kommt es zur Freisetzung biochemischer Stoffe. Diese werden als Neurotransmitter oder einfach als Transmitter bezeichnet. Neurotransmitter geben Informationen von einer Nervenzelle zu einer anderen weiter. Dies geschieht durch Ausschüttung der sich in der Präsynapse befindlichen Neurotransmitter in den synaptischen Spalt. Von dort gelangen sie an die Rezeptoren der Postsynapse des 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 15 Nachbarneurons. Dieser Vorgang spielt sich im Bereich von Tausendstelsekunden ab. Transmitter verursachen eine elektrische Spannungsveränderung des postsynaptischen Neurons. Wird dessen negative Spannung von minus 70 Millivolt im Ruhepotential durch erregende Transmitter verringert oder sogar positiv, spricht man von einer Depolarisierung. Durch sie werden weitere Aktionspotentiale ausgelöst, was bedeutet, dass Informationen weitergeleitet werden. Hemmende Transmitter können dagegen die negative Spannung der postsynaptischen Neuronen bis auf minus 80 Millivolt erhöhen. Dies führt dazu, dass die Nervenzellen für nachfolgende Erregungen der vorgeschalteten Neuronen unempfindlich werden. Als Folge werden ankommenden Informationen nicht weiter geleitet. Die Stärke der Übertragung ist abhängig von der Anzahl der von den präsynaptischen Neuronen ausgeschütteten Neurotransmitter, der Anzahl der Rezeptoren der postsynaptischen Neuronen und der Effizienz der Signalverarbeitung. Die Stärke der vorhandenen synaptischen Verbindungen ist ausschlaggebend, wie stark der Effekt des Impulses auf die nachfolgenden Neuronen ist. Bei starken synaptischen Verbindungen wird das nachfolgende Neuron stark erregt, während bei schwachen synaptischen Verbindungen die Erregung gering bleibt. Die Neuronen verarbeiten die eingehenden Informationen durch Bewertung nach Neuigkeit und Wichtigkeit, und je nach Ergebnis werden sie mehr oder weniger stark übertragen (vgl. Spitzer 2009: 21ff). (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 18ff), (vgl. Aamodt/Wang 2008: 37ff) 2.2.1 Neurotransmitter Je nach Wirkung auf die nachgeschalteten Neuronen unterscheidet man zwischen erregenden, hemmenden und langsam wirkenden Transmitter. Der wichtigste erregende Transmitter ist das Glutamat. Die bedeutendsten hemmenden Transmitter sind Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) und Glycerin. Zu der Gruppe der langsam wirkenden Transmitter gehören: Noradrenalin (Aufmerksamkeit, Wachheit), Serotonin (beruhigend, Gedächtnisbildung, Lebensenergie, Mangel verursacht Depressionen), Acetylcholin (Aufmerksamkeit, Leistungsfähigkeit des Gehirns) und das, auch als Glückshormon bezeichnete, Dopamin (Konzentration, Motivation, Aufmerksamkeit, Neugierde). (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 19ff), (vgl. Roth 2011: 49,275) Neben diesen Transmitter gibt es noch die sog. Neuropeptiden, bei denen es sich um eiweißhaltige Transmitter handelt. Sie werden als Cotransmitter zusammen mit Neurotransmitter ausgeschüttet und unterstützen oder hemmen deren Wirkung. 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 16 Unter den 100 verschiedenen Neuropeptiden sind die sog. Endorphine am bekanntesten. Es handelt sich dabei um körpereigene Opiate, die die Schmerzempfindlichkeit beeinflussen. Des Weiteren lösen sie Wohlbefinden aus. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 24), (vgl. Roth 2011: 328ff) 2.2.2 Neuroplastizität und Langzeitpotenzierung Bevor die neurobiologischen Grundlagen der Gedächtnisbildung durch Neuroplastizität und Langzeitpotenzierung beschrieben werden, soll die Bildung von Gedächtnisinhalten mittels eines anschaulichen Vergleiches, den Manfred Spitzer in seinem Buch „Selbstbestimmen“ zieht, veranschaulicht werden: Wenn im Gehirn Informationen verarbeiten werden, entstehen Spuren im Gehirn. Diese Spuren sind vergleichbar mit Spuren, wie sie beim Laufen über Schnee entstehen, deshalb spricht man auch von Gedächtnisspuren. Diese Gedächtnisspuren entstehen durch die Benutzung von Verbindungen zwischen den Nervenzellen und erleichtern den Durchgang und die Verarbeitung von Informationen. Und wie Spuren im Schnee durch häufig wiederholende Benutzung immer gefestigter werden, so verfestigt sich durch ständige Wiederholung die Erinnerung im Gehirn (vgl. Spitzer 2004: 27ff). Die entstandenen Spuren im Gehirn sorgen zugleich für die eigene Verfestigung, denn: „…es ist die Strukturbildung selbst, die für die Verfestigung der einmal entstandenen Struktur sorgt“ (Spitzer 2004: 39). Diese Selbststrukturierung geschieht durch die Freisetzung einer Art „Gehirndüngers“ namens BNDF („brain-derived neurotropic factor“) (vgl. Spitzer 2004: 44). Diese eigene Verfestigung führt beispielsweise dazu, dass frühkindliche Erfahrungen viel größeren Einfluss auf die Entstehung von inneren Strukturen haben, als spätere Erfahrungen (vgl. Spitzer 2004: 44). Dies zeigt sich am frühkindlichen Erwerb einer Fremdsprache, denn der frühe Kontakt entscheidet darüber, wie akzentfrei die Fremdsprache gesprochen wird und wie hoch die Sprachkompetenz ausgebildet ist (vgl. Spitzer 2004: 45). Jede einzelne Erfahrung erzeugt ein, nur wenige Millisekunden andauerndes, Aktionsmuster im Gehirn. Jede weitere Wiederholung dieser Erfahrung verändert die Stärke des Aktionsmusters um ein kleines Stück. Was nun von den einzelnen Erfahrungen bleibt, sind nicht ihre Einzigartigkeiten, sondern was sie gemeinsam haben, also das, was hinter den einzelnen Erfahrungen an Gemeinsamkeiten steht. Zum besseren Verständnis sei hier das von Manfred Spitzer in seinem Buch „Lernen“ angeführte „Tomaten-Beispiel“ wiedergegeben: wir haben schon so viele Tomaten 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 17 gesehen und können uns nicht an jede einzelne erinnern, können aber eine Tomate als solche sofort erkennen, da in unserem Gehirn die Gemeinsamkeiten aller Tomaten, nämlich rund und rot zu sein, abgespeichert sind (vgl. Spitzer 2009:75ff). Die Fähigkeit des Nervensystems seine Verbindungen an den Gebrauch anzupassen, bezeichnet man als Neuroplastizität. Zum ersten Mal nachgewiesen wurde diese Fähigkeit von Eric Kandel, der für seine Forschungsarbeit im Jahre 2000 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 66) Die Hebb`sche Regel Der Kanadier Donald O. Hebb (1904-1983) begründete die Grundlage der synaptischen Plastizität. In seinem Konzept der „Zellensembles“ vertrat er die Vorstellung, dass häufig gemeinsam aktive Zellen enge Verbindungen eingehen. In dem Buch „Zukunft Gehirn“ von Bonhoeffer und Guss wird beschrieben, dass diese Verstärkung dadurch entsteht, dass bei: „wiederholter oder dauerhafter Aktivierung einer Nervenzelle B durch ein Axon einer Nervenzelle A ein Wachstumsprozess oder eine metabolische Änderung in einer oder beide Zellen geschehen müsse, so dass die Effizienz von A als eine der B aktivierenden Zellen anwächst [sog. Hebb´sche Regel].“ Hebb (1949, zit. in Bonhoeffer/Gruss 2011: 66) Bei diesen gemeinsam aktiven Zellen verstärken sich die Synapsen. Es entstehen Teilnetzwerke, deren „Zündung“ die Aktivierung der ihnen entsprechenden Informationen bedeutet. Den Nachweis für die Richtigkeit der rein theoretisch formulierten Hebb`schen Regel lieferte die Entdeckung der Langzeitpotenzierung. Durch Experimente am Hippocampus konnte im Jahre 1973 nachgewiesen werden, dass Lernereignisse simulierende, elektrische Stimulation die Verbindung zwischen den Synapsen dauerhaft verstärken kann. Diese Verstärkung synaptischen Verbindungen zwischen gleichzeitig aktiven Neuronen wird als Langzeitpotenzierung (LTP, „long termpotentation“) bezeichnet. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 67) Gerhard Roth schreibt in seinem Buch „Bildung braucht Persönlichkeit“ über die neurobiologischen Grundlagen der Gedächtnisbildung: „Allgemein glaubt man, dass 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 18 das Einspeichern eines Gedächtnisinhaltes auf die Leistungssteigerung synaptischer Übertragungsmechanismen innerhalb oder größere Netzwerke beruht.“ (2011: 111). Diese Leistungssteigerung beruht nicht nur auf einer Verstärkung bestehender neuronaler Verbindungen, sondern auch auf strukturell-anatomische Veränderungen (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 73). Ein wichtiger Mechanismus bei der Veränderung der synaptischen Übertragungseffizienz, die entweder prä- oder postsynaptisch erfolgen kann, ist dabei die Langzeitpotenzierung. Sie ist letztendlich die Grundlage für jegliche Form des Lernens und Gedächtnisses. In Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass sich der Prozess der Verstärkung synaptischer Verbindungen auch umkehren lässt. Die lang andauernde Abschwächung der synaptischen Effektivität wird als Langzeitdepression (LTD, „long terme depression“) bezeichnet. Die molekulare Grundlage von Langzeitpotenzierung und Langzeitdepression ist Calcium. Ein großer Einstrom von Calcium in die Neuronen führt zu einer Langzeitpotenzierung, ein geringer Einfluss zu einer Langzeitdepression. (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 67) 2.2.3 Wie wird eine Information verarbeitet? Im ersten Schritt wird die von unseren Sinnesorganen aufgenommene Information codiert. Bei der Codierung wird die von außen in Form von Schallwellen und Lichtenergie eintreffender Energie in elektrische Muster umgewandelt, die das Gehirn verarbeiten kann (vgl. Medina 2009: 117). Wie stark die Codierung ausfällt, hängt u.a. davon ab, wie bedeutsam die Information ist, und wie stark sie mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft werden kann (vgl. Medina 2009: 123ff). Nach dem die Information in die Sprache des Gehirns übersetzt wurde, wird sie vom Thalamus in den Cortex weitergeleitet. Dort wird die Information buchstäblich in ihre Einzelteile zerstückelt. Die dabei entstandenen einzelnen Informationen über ein Objekt, wie beispielsweise Form, Farbe oder Bewegung, werden über den gesamten Cortex zerstreut und in den jeweils zuständigen Gehirnarealen abgespeichert (vgl. Medina 2009: 115ff). Dies lässt den Schluss zu, dass es kein separates Gedächtniszentrum gibt (vgl. Medina 2009: 126). Die einzelnen Informationen werden in denselben über das Gehirn verteilten Arealen abgespeichert, die zuvor an der Wahrnehmung und Verarbeitung der Informationen beteiligt waren (vgl. Medina 2009: 125ff).Die mit den Rinderfeldern durch Nervenbahnen verbundenen Assoziationsfelder sorgen dafür, dass abgespeicherte Inhalte wieder ins Bewusstsein treten können. 2. Wie werden Informationen im Gehirn v erarbeitet? S e i t e | 19 Die Assoziationsfelder sind untereinander durch Nervenbahnen (Assoziationsbahnen) miteinander verbunden und fügen die über den Cortex verteilten Informationsteile wieder zu einem Ganzen zusammen. Die Assoziationsfelder sind im Assoziationscortex angesiedelt. Zu ihm gehören: der Gyrus angularis, der Gyrus supramarginalis, der mittlere und inferiore temporere Cortex, der präfrontale und der orbiofrontale Cortex. (vgl. Roth 2009: 137 In den Assoziationsfeldern verläuft die Verarbeitung der Information sowohl von unten nach oben („bottom-up process“) als auch von oben nach unten („top-down process“) (vgl. Spitzer 2009: 176). Folgendes Beispiel soll dies veranschaulichen: Durch die von-unten-nach-oben-Verarbeitung werden beim Lesen die einzelnen Linien und Bögen zu Buchstaben und diese zu Wörter kombiniert. Danach erfolgt die von oben nach unten gerichtete Verarbeitung, indem die Wörter unter dem Aspekt des bereits vorhandenen Wissens analysiert werden. Dabei werden bereits abgespeicherte Informationen zu den neuen Informationen hinzugefügt. So wird beispielsweise ein Name mit den mit dieser Person gemachten Erfahrungen in Verbindung gebracht. (vgl. Medina 2009: 231ff) Beim Abruf einer Information werden mit Hilfe der Assoziationsfelder die in den verschieden Gehirnareale abgespeicherten Informationsteile wieder zu einem Ganzen zusammengeführt (vgl. Medina 2009: 230). Die komplexe Gehirntätigkeit des Verarbeitens einer Information von der Codierung bis zur Abspeicherung wird als Engramm bezeichnet (vgl. Medina 2009: 122). 2.2.4 Vergessen einer Information Das Vergessen einer Information geschieht zum Teil psychologisch durch das Unterdrücken der Erinnerung, was als Repression bezeichnet wird. Neurobiologisch lässt sich nachweisen, dass das Vergessen mit dem Abbau synaptischer Verbindungen in Zusammenhang steht. (vgl. Roth 2011: 123) Nur ein geringer Teil der verarbeiteten Informationen wird letztendlich im Gehirn abgespeichert. Wo und wie lange diese im Gehirn abgespeichert werden, soll Thema des folgenden Kapitels sein. 3. Das menschliche Gedächtnis S e i t e | 20 3. Das menschliche Gedächtnis Sprache und Wissen werden durch unser Gedächtnis erst möglich. Dank unseres Erinnerungsvermögens nehmen wir uns als Individuum wahr und können mit anderen Menschen interagieren. Lernen und Gedächtnis werden oft miteinander gleichgesetzt, was meistens auch zutrifft: „denn es gibt kein wirkliches Lernen ohne Gedächtnis, aber es gibt ein Gedächtnis ohne längeren Lernerfolg“ (Roth 2011: 102). Ende des 19. Jahrhunderts unternahm der Psychologe und Gedächtnispionier Hermann Ebbinghaus einen Versuch, bei dem er aus willkürlich zusammengefügten Konsonanten und Vokale rund 2300 sinnlose Silben bildete. Danach versuchte er diese Silben mittels verschiedener Methoden auswendig zu lernen. Seine dabei gemachten Erfahrungen veröffentlichte er im Jahre 1885. Er wies nach, dass nach 20 Minuten nur noch 60%, nach einer Stunde nur noch 45% und nach einem Tag nur noch 34% Prozent des Gelernten erinnert werden können. Nur 15% des Lerninhaltes geraten nicht in Vergessenheit (vgl. Roth 2011: 123ff). Eine weitere Entdeckung seiner Untersuchungen war, dass das Erinnerungsvermögen durch ständiges Wiederholen des Gelernten verlängern werden kann. Je häufiger diese Wiederholungen praktiziert werden, desto stabiler werden die Erinnerungen. Entscheidend hierbei ist, in welchen Zeitabständen die Wiederholungen erfolgen. Lernen in kleinen Lerneinheiten, mit ausreichendem Zeitabstand und häufigem Wiederholen, ist dem Lernen an einem Stück mit der gleichen Anzahl an Wiederholungen überlegen (vgl. Bonhoeffer/Gruss 2011: 60). Dass häufiges Wiederholen für das Lernen optimal ist, lässt sich auch neurowissenschaftlich belegen, denn durch ständiges Wiederholen werden die Synapsenverbindungen zwischen den Neuronen verstärkt (vgl. Aamodt/Wang 2008: 121). Über das Gedächtnis und seiner Funktionsweise gibt es verschiedene Theorien, von denen ich zwei vorstellen will. Das Zeitmodell, das auf den Untersuchungen von Atkinson/Shiffrin basiert (vgl. Kilp 2010: 32), unterscheidet zwischen Ultra-, Kurzzeitund Langzeitgedächtnis. Das inhaltsabhängige Beschreibungsmodell teilt das Gedächtnis in deklaratives bzw. explizites und prozedurales bzw. implizites ein. Diese Differenzierungen gehen auf die amerikanischen Psychologen Larry Squire und Daniel Schacter zurück (vgl. Roth 2011: 102ff). 3. Das menschliche Gedächtnis S e i t e | 21 3.1 Das Zeitmodell Die eingehenden Informationen werden in drei Stufen im Gehirn gefiltert und in der jeweiligen Gedächtnisform, je nach ihrer Wichtigkeit, kürzer oder länger abgespeichert. Die Wahrnehmungen (Reize) durchlaufen dabei zuerst das Ultrakurzgedächtnis (UZG), um nach dem ersten Ausfiltern ins Kurzeitgedächtnis (KZG) zu gelangen. Nach weiterer Selektion der Daten gelangen diese schließlich ins Langzeitgedächtnis (LZG). (vgl. Kilp 2010: 32), (vgl. Frick/Mosimann 2006: 37) 3.1.1 Das Ultrakurzeitgedächtnis (UZG) Die Informationen der ankommenden Reize, die visueller, auditiver, haptischer, olfaktorischer oder gustatorischer (geschmacklicher) Art sein können, werden in rein physikalischer Weise gespeichert und bleiben größten Teils unbewusst. Dies erlaubt eine enorm hohe Speicherkapazität, die beispielsweise bei visuellen Reizen 10.000 Millionen pro Sekunde beträgt. Die meisten im Ultrakurzeitgedächtnis (UZG) ankommenden Informationen zerfallen in Bruchteilen von Sekunden. Dadurch gelangen nur wichtige Informationen ins Kurzzeitgedächtnis. (vgl. Frick/Mosimann: 2006: 37) 3.1.2 Das Kurzzeitgedächtnis (KZG) Das Kurzzeitgedächtnis wandelt die rein physikalischen Informationen in sinnvolle Wörter oder Bilder um. Dies ist ein aufwendiger Vorgang und deshalb kann es gleichzeitig nur etwa sieben (plus/minus zwei) Informationen verarbeiten. Dass das Kurzzeitgedächtnis nur über eine begrenzte Kapazität verfügt, soll das von Sandra Aamondt und Samuel Wang in ihrem Buch „Welcome to your brain“ beschriebene Experiment veranschaulichen: Versuchspersonen sahen sich ein Video an, in dem sich drei Studierende in weißen Trikots einen Basketball zuspielten und sich gleichzeitig weitere drei Studierende in schwarzen Trikots einen zweiten Basketball zuspielten. Die Betrachter wurden aufgefordert, die Pässe des weißen Teams zu zählen. In dem Moment, in dem sich die beiden Gruppen vermischten, lief eine Person in einer Gorilla-Verkleidung quer durch die Spielszene. Direkt vor der Kamera blieb sie kurz stehen und trommelte sich auf die Brust. Das Experiment ergab, dass die Hälfte der Betrachter den “Gorilla “nicht wahrgenommen hatte, weil sie ganz auf das Zählen der Spielpässe konzentriert waren (vgl. Aamondt/Wang 2008: 23). Im Kurzeitgedächtnis angekommene Informationen werden höchsten zwei bis drei 3. Das menschliche Gedächtnis S e i t e | 22 Sekunden abgespeichert. Deshalb muss man eine Telefonnummer geistig mehrmals wiederholen, um sie sich merken zu können. Das Kurzeitgedächtnis erfüllt zwei Aufgaben: Einerseits vergleicht das im Kurzeitgedächtnis integrierte Arbeitsgedächtnis die aus dem Ultrakurzeitgedächtnis eintreffenden Informationen mit den im Langzeitgedächtnis abgespeicherten Inhalten, anderseits führt das lange Vergleichen der ankommenden Informationen mit dem im Langzeitgedächtnis gespeicherten Wissen zur Abspeicherung der neuen Informationen im Kurzzeitgedächtnis. (vgl. Frick/Mosimann 2006:37ff) 3.1.3 Das Langzeitgedächtnis (LZG) Die Übertragung der Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis führen, wie bereits im Kapitel 2 beschrieben, zu einer Verstärkung neuronaler Verbindungen. Es können nicht alle im Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen erinnert werden. Dieses passive Wissen wird erst wieder aktiv durch eine Wiederholung des Gedächtnisinhaltes oder wenn es mit aktuellen Informationen verknüpft werden kann. Dabei haben die Informationen die größte Chance erinnert zu werden, die mit möglichst vielen anderen verknüpft (assoziiert) sind (vgl. Frick/Mosimann 2006: 39). Das Langzeitgedächtnis besteht aus vielen „Schubladen“ oder „Modulen“ die über den gesamten assoziativen Cortex spezifisch verteilt sind (vgl. Roth 2011: 110). Die Gedächtnisinhalte werden je nach Art wie folgt abgespeichert (vgl. Roth 2011: 110ff): - visuelle im assoziativen virtuellen Cortex - auditorische im assoziativen auditorischen Cortex - räumliche und taktile im somatosorischen Cortex - sprachliche Inhalte in den Spracharealen des Cortex In den jeweiligen Modulen werden die Inhalte nochmals in weitere Kategorien aufgeteilt. Im visuellen Gedächtnis beispielsweise nach Farben, Formen, Gestalten und Szenen. In den entsprechenden Unterkategorien erfolgt dann noch eine spezifischere Konkretisierung. Darüber hinaus werden im Langzeitgedächtnis Inhalte nach ihren Funktionen (z.B. Musikinstrumente, Werkzeug) und Erlebnisse nach ihrem Zusammenhang mit bestimmten Orten abgespeichert (vgl. Roth 2011: 110). 3. Das menschliche Gedächtnis S e i t e | 23 3.2 Das inhaltsabhängige Beschreibungsmodell (vgl. Roth 2011: 103) Dieses teilt das Gedächtnis in ein deklaratives (explizites) und in ein prozedurales (impliziertes) Gedächtnis ein. Werden Inhalte bewusst gemerkt und können sie auch gut beschrieben werden, wie etwa Vokabel oder Schulwissen, spricht man vom deklarativen Gedächtnis. Prozedurales Gedächtnis liegt vor, wenn Inhalte eher unbewusst gespeichert werden und sich diese nur schwer durch Worte beschreiben lassen. Dazu gehören Gefühle oder eingeübte Handlungsabläufe wie beispielsweise. Fahrradfahren und Schwimmen. (vgl. Roth 2011: 102ff) 3.2.1 Das deklarative Gedächtnis Das deklarative Gedächtnis hat seinen Sitz in den Netzwerken des Neocortex. Es wird nach dem estnisch-amerikanischen Gedächtnisforscher Endel Tulving (vgl. Roth 2011: 103) unterteilt in ein episodisches Gedächtnis, ein Wissens- bzw. Faktengedächtnis und in ein Bekanntheits- und Vertrautheitsgedächtnis. Das Merkmal des episodischen Gedächtnisses ist das eigentliche „Sich-an-etwaserinnern-können“. Es gliedert sich in ein autobiographisches Gedächtnis und in ein Quellengedächtnis. Das autobiographische Gedächtnis speichert die konkreten Erlebnisse und Erfahrungen, die man selbst und mit anderen erlebt hat. Es wird auch als Kontext-Gedächtnis bezeichnet, weil es sich mit dem zeitlichen, räumlichen und 3. Das menschliche Gedächtnis S e i t e | 24 inhaltlichen Kontext von Gedächtnisinhalten beschäftigt. Das Quellengedächtnis speichert wann, wo und aus welcher Informationsquelle wir was erfahren haben. (vgl. Roth 2011: 103ff) Das Wissens- bzw. Faktengedächtnis speichert nur reines Wissen, ohne dass wir uns daran erinnert können von wem, wann, wo und in welchem Zusammenhang wir es erworben haben. (vgl. Roth 2011: 104) Das Bekanntheits- oder Vertrautheitsgedächtnis ermöglicht uns das Wiedererkennen von Objekten und Ereignissen. (vgl. Roth 2011: 104) Episoden-, Fakten- und Bekanntheitsgedächtnis sind nicht strikt voneinander getrennt, sondern ihr Übergang ist fließend, denn in einer Erinnerung sind immer Anteile der einzelnen Gedächtnisse vermengt. (vgl. Roth 2011: 104ff) 3.2.2 Das prozedurale (implizite) Gedächtnis Das prozedurale Gedächtnis, das einheitlicher als das deklarative Gedächtnis ist, teilt man ein in: Fertigkeiten, Gewohnheiten, Priming (Wiedergabe von Wissen aufgrund von Stichworten) und reflexartigen Formen des Lernens, wie Habituation und klassische und operative Konditionierung. Das prozedurale Gedächtnis sitzt in Gehirnstrukturen, die zu den Basalganglien, besonders des Strato-Pallidum, gehören. „Die genauen neurobiologischen Mechanismen der Gedächtnisbildung im prozeduralen Gedächtnis sind nicht bekannt“ (Roth 2011: 114). Die im prozeduralen Gedächtnis gespeicherten Kapazitäten sind dem Bewusstsein gewöhnlich nicht zugänglich, was bedeutet, dass der Zugriff darauf unbewusst geschieht. Es werden Kenntnisse und Fähigkeiten gespeichert, die ihrem Wesen nach eher reflexartig als reflektiv sind, wie zum Beispiel das Radfahren. Hat man es gelernt, denkt man nicht mehr bewusst über die einzelnen Bewegungsabläufe nach, weil sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Im prozeduralen Gedächtnis unbewusst Gespeichertes lässt sich nicht mehr ins Bewusstsein rufen, was beweist, dass unbewusste geistige Prozesse existieren. (vgl. Roth 2011: 105ff) Zur Erforschung des Lernens ist das prozedurale Gedächtnis ideal, da es sich leicht experimentell manipulieren lässt. Die Experimente von Iwan Pawlow und Edward Thorndike machen uns nicht deklarative Lernprozesse verständlich. (vgl. Squire/Kandel 2009: 24) 3. Das menschliche Gedächtnis S e i t e | 25 nicht deklarative Lernprozesse assoziatives Lernen klassische und operative Konditionierung nicht assoziatives Lernen Habituation und Sensitivierung (eigene Zeichnung) Klassische Konditionierung Bei ihr lernt ein Versuchstier über die Beziehung von zwei Reizen. Hat es gelernt, einen Glockenklang mit dem Geschmack von Futter in Verbindung zu bringen, wird der Speichelfluss auch nur beim Hören der Glocke ausgelöst. (vgl. Squire/Kandel 2009: 24) Operative Konditionierung Bei ihr lernt das Versuchstier die Beziehung zwischen einem Reiz und seinem Verhalten. So lernt es beispielsweise, das Drücken eines Hebels mit der Abgabe von Futter zu assoziieren. (vgl. Squire/Kandel 2009: 24) Habituation und Sensitivierung Darunter versteht man, sich wiederholende und unwichtige Reize zu erkennen und sie als bekannt zu ignorieren. So haben sich als Beispiel Städter an den Straßenlärm gewöhnt, wachen aber auf dem Lande von dem Zirpen der Grillen auf. Durch Habituation kann man sich an anfänglich ablenkende Geräusche gewöhnen, und lernen sich selbst in einer lauten Umgebung zu konzentrieren. (vgl. Squire/Kandel 2009: 25ff) Im Gegensatz zur Habituation nimmt bei der Sensitivierung die Stärke der Reaktion durch ständiges Wiederholen eines schädlichen oder bedrohlichen Reizes zu. (vgl. Squire/Kandel 2009: 48) 3. Das menschliche Gedächtnis S e i t e | 26 3.2.3 Das emotionale Gedächtnis Während man früher das emotionale Gedächtnis dem prozeduralen Gedächtnis zugerechnet hat, muss man heute laut Roth „aus vielerlei Gründen das emotionale Gedächtnis neben dem deklarativen und dem prozeduralen Gedächtnis als dritte grundlegende Gedächtnisart behandeln“ (Roth 2011: 107). Im emotionalen Gedächtnis werden Objekte oder Handlungen mit entsprechenden negativen oder positiven Gefühlen, wie Angst, Freude und Lust, besetzt. Wiederholen oder ähneln sich Handlungen, trifft man wieder auf dieselben oder ähnlichen Objekte, oder geschieht dies in einem ähnlichen Kontext, werden die entsprechenden gespeicherten Gefühle abgerufen und den Objekten oder Handlungen zugeordnet. Das emotionale Gedächtnis besteht sowohl aus Teilen des deklarativen wie auch des nicht deklarativen Gedächtnisses. Die Amygdala und das mesolimbische System lassen sich als Hauptorte der unbewussten emotionalen Konditionierung lokalisieren. Dabei können emotionale Erinnerungen der Art gefestigt werden, dass sich die inhaltlich emotionale Bewertung auch dann nicht ändert, wenn gegenteilige Erfahrungen gemacht werden. Hat man zum Beispiel mit einem Menschen schlechte Erfahrungen gemacht, so fällt es einem später, selbst bei nunmehr positiv gemachten Erlebnissen mit dieser Person, schwer, die negative emotionale Einstellung zu revidieren. (vgl. Roth 2011: 106) Wir kennen jetzt die Anatomie des Gehirns, verstehen wie Informationen verarbeitet und in den verschiedenen Gedächtnisarten abgespeichert werden und können uns nun mit diesem Wissen dem Thema Lernen zuwenden. In folgendem Kapitel sollen zunächst die neurobiologischen Voraussetzungen des Lernens und die das Lernen beeinflussenden Faktoren vorgestellt werden. Die Beschreibung der verschiedenen Lerntypen erfolgt im Anschluss. Am Schluss werde ich mich mit dem Thema „Lernen im Alter“ auseinandersetzen. 4. Lernen S e i t e | 27 4. Lernen Das menschliche Gehirn ist kein Computer, das man einfach mit Wissen füttern kann wie eine Festplatte. Aus der gewaltigen Flut von Informationen filtert es nur diejenige heraus, die es als wichtig erachtet und von denen es sich etwas verspricht. Dass dies nicht immer der Lehrstoff ist, liegt daran, dass Lernen immer ein Bewertungssystem voraussetzt. Es müssen nämlich zwei Voraussetzungen erfüllt sein, damit dieser erfolgreich abgespeichert wird: „Neuigkeit und Bedeutsamkeit“ (Spitzer 2009: 21). Nur durch ihr Vorhandensein kommt es zur Freisetzung von Dopamin. Die damit verbundene körpereigene Belohnung sorgt für ein erfolgreiches Lernen (vgl. Spitzer 2009: 183). Das Gehirn ist durch seine hohe Plastizität für das Lernen prädestiniert. Jegliches Lernen bedeutet aus neurologischer Sicht eine Veränderung der Stärke synaptischer Übertragung (vgl. Spitzer: 277). Dadurch genügen immer schwächer werdende Input-Reize, um immer stärkere Output-Reaktionen auszulösen (vgl. Medina 2009: 150). Bildlich gesehen gleicht Lernen einem Netz, das mit jedem Lernvorgang immer engmaschiger wird (vgl. Frick/Mosimann 2006: 49). Je mehr man gelernt hat, desto leichter fällt einem das weitere Lernen, denn Lernen bedeutet immer die Verknüpfung von neuem mit bereits vorhandenem Wissen (vgl. Spitzer 2009: 283). Beim ersten Lernen entstehen neue, das Gedächtnis kodierende, Dornen („spines“). Die Dornen sitzen auf den Dendriten der Neuronen. Geraten die gelernten Informationen in Vergessenheit, werden zwar die Synapsen abgeschwächt, die Dornen hingegen bleiben erhalten. Die Auswirkungen dieser neurobiologischen Tatsache auf das Gedächtnis werden von Ebbinghaus als „Ersparnis“ bezeichnet. „Damit bezog er sich auf den Umstand, dass eine einmal gelernte Information oder Fähigkeit, wie z.B. die Beherrschung einer Fremdsprache, selbst wenn sie zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten ist, wesentlich leichter wieder erlernt werden kann, als wenn das Lernen ganz von vorne beginnen müsste“ (Bonhoeffer/Gruss 2011: 74). 4. Lernen S e i t e | 28 4.1 Faktoren die das Lernen beeinflussen Im Folgenden werde ich drei, für das Lernen wichtige Faktoren, Aufmerksamkeit, Motivation und Emotionen, näher beschreiben. Zur Bedeutung dieser Faktoren für den Lernerfolg schreibt Manfred Spitzer: „Wer beim Lernen aufmerksam, motiviert und emotional dabei ist, der wird mehr behalten“ (Spitzer 2009: 139). 4.1.1 Aufmerksamkeit Wie sehr man sich an einen bestimmten Lehrstoff erinnern kann, hängt davon ab, wie viel Aufmerksamkeit ihm bei seiner Aufnahme geschenkt wurde (vgl. Medina 2009: 76). Unter Aufmerksamkeit versteht man aus neurologischer Sicht zwei voneinander unabhängige Prozesse. Der eine wird als allgemeine Wachheit (Vigilanz), der andere als selektive Aufmerksamkeit bezeichnet. (vgl. Spitzer 2009: 141ff) Vigilanz ist ein zeitlicher Prozess und beschreibt „…einen quantitativ angebbaren Zustand des Organismus, der von hellwach bis (im Extremfall), komatös reicht“ (Spitzer 2009: 141).Sie ist ein Teil des Bewusstseins und sorgt beim Lernen für die Aktivierung des Gehirns. Die selektive Aufmerksamkeit ist ein räumlicher Prozess, durch den die Gehirnareale aktiviert werden, die die fokussierten Sacherhalte verarbeiten. Die selektive Aufmerksamkeit kann mit einem Scheinwerfer verglichen werden, denn genau wie bei einem Scheinwerfer kann sie sich jeweils nur auf ein Objekt richten. Sie ist ein kognitiver Mechanismus, der einen befähigt, aus den pausenlos einströmenden Informationen nur diejenigen herauszufiltern, die relevant sind. Nur durch dieses Herausfiltern können sie überhaupt erst wahrgenommen werden. Irrelevante Inhalte hingegen werden einfach ignoriert. Tests zeigten, dass die selektive Aufmerksamkeit umso größer ist, je höher die Verarbeitung der Information im kortikalen Areal angesiedelt ist. Die der selektiven Aufmerksamkeit zur Verfügung stehende Quantität für die Informationsverarbeitung ist begrenzt. Wird für die Verarbeitung einer neuen Information eine bestimmte Menge an Verarbeitungsquantität gebraucht, so wird diese anderswo einfach abgezogen. Aus diesem Grunde kann man seine ganze Aufmerksamkeit letztendlich immer nur auf eine Sache konzentrieren. (vgl. Spitzer 2009: 143), (vgl. Roth 2011: 133) 4. Lernen S e i t e | 29 An Affen durchgeführte Experimente bewiesen die große Bedeutung von Aufmerksamkeit für ein erfolgreiches Lernen: Nur durch die Kombination von Input und Aufmerksamkeit entstanden neue kortikale Karten oder bereits vorhandene Karten wurden verstärkt. Es ist folglich der Faktor Aufmerksamkeit, der diejenigen Areale aktiviert, die für die entsprechenden Lerninhalte zuständig sind. Eine reine „Bombardierung“ des Gehirns mit neuem Lernstoff nach der Methode des „Nürnberger Trichters“, ohne dass dieser von Aufmerksamkeit begleitet wird, führt zu keiner Veränderung von synaptischen Verbindungen, was bedeutet: es wird nicht gelernt. (vgl. Spitzer 2009: 153) 4.1.2 Motivation Motivation ist eine Voraussetzung für nachhaltige Lernprozesse. Hinter jedem Lernziel verbirgt sich auch ein Grund, weshalb dieses erreicht werden soll. Dieser Grund ist das Motiv. Aus dem Motiv entsteht der Antrieb das konkrete Ziel zu erreichen, die sog. Motivation. Folglich sollte man sich immer über sein Lernziel im Klaren sein, um diese erfolgreich zu realisieren. Wer beispielsweise eine Fremdsprache erlernen will, sollte sich zuerst über seine Motive und Lernziele bewusst werden. Diese können beispielsweise sein: - man will in einem anderen Land Urlaub machen - man will in ein anderes Land beruflich oder privat auswandern - man will durch das Fremdsprachenlernen geistig fit bleiben will - weil man sprachbegabt ist - weil man im Ausland studieren will - weil man sich für fremdsprachige Literatur interessiert - weil es auf dem Stundenplan steht - (vgl. Grein 2012: 99) Motivation ist für das menschliche Handeln von so großer Bedeutung, dass sich eine eigene wissenschaftliche Disziplin mit ihr beschäftigt: die Motivationspsychologie. Jeder Mensch ist in seinem Handeln darauf ausgerichtet, dass es ihm unter den gegebenen Umständen gut geht (Affektoptimierung). Negatives (Angst, Schmerzen) hingegen soll vermieden werden. Das Streben nach Positivem wird als Appetenz, das Vermeiden von Negativem als Aversion bezeichnet. Unser Motivationssystem wird durch die Belohnungserwartung getrieben, was bedeutet: Es beruht auf der 4. Lernen S e i t e | 30 Annahme, dass sich durch die Wiederholung einer bestimmten Handlung erneut die Belohnung einstellt. (vgl. Roth 2011: 81ff) Im Gehirn existieren für positive Ereignisse zwei unterschiedliche Systeme: In dem einen wird der Lustgewinn eines Ereignisses repräsentiert, das andere sorgt dafür, dass das Ereignis erstrebenswert ist. (vgl. Roth 2011: 82) Wie entstehen Motive im Gehirn? Motive entstehen durch die Registrierung äußerer Reize im limbischen System. Unbewusste Reize werden in der Amygdala und im mesolimbischen System, bewusste Reize in corticalen limbischen Arealen, verarbeitet. Von dort wirken sie auf unterschiedliche Weise auf die das Verhalten steuernden Zentren ein. Bei den Motiven unterscheidet man zwischen biogenen Motiven und soziogenen Motiven. Zu den biogenen Motiven gehören lebensnotwendige Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Sexualität. Zu den soziogenen gehören drei Motivbereiche: Anschluss bzw. Intimität, Macht und Leistung (vgl. Roth 2011: 82ff). Im Folgenden soll das Motiv Leistung näher beschrieben werden, da dieses Motiv für das Lernen von Relevanz ist. Zum Leistungsmotiv wurde von dem Psychologen John Altkinson, dass „Erwartung-mal-Wert-Model entwickelt“. Es besagt: „dass das Ausmaß, in dem eine Person etwas in Angriff nimmt, dem entspricht, wie ihre subjektive Einschätzung der Erfolgsaussichten ist und welchen Wert das zu erreichende Ziel für die Person besitzt“ (Roth 2011: 84). Demzufolge ist jemand bei geringen Erfolgsaussichten wenig motiviert, ein Ziel zu erreichen. Aus diesem Grunde sollte der Lernstoff die Lernenden nicht überfordern. Des Weiteren ist die Motivation gering, wenn das Ziel nicht als erstrebenswert erachtet wird. (vgl. Roth 2011: 85) Die bei einer Zielverfolgung erwartete Erfolgserwartung hängt von drei Faktoren ab: - wie wird die eigene Kompetenz eingeschätzt - wie ist die zeitliche und räumliche Erreichbarkeit des Zieles - mit welchem Aufwand ist die Zielerreichung verbunden - (vgl. Roth 2011: 85) 4. Lernen S e i t e | 31 Neben der Unterscheidung in biogene und soziogene Motive werden Motive in intrinsische und extrinsische unterteilt. (vgl. Roth 2011: 86) Ist eine Tätigkeit „selbstbelohnend“, liegt ein intrinsisches Motiv zugrunde. Diese Selbstbelohnung kann sich in Spaß ausdrücken, wie man ihn etwa beim Lernen erleben kann. Im Zusammenhang mit den intrinsischen Motiven wird der Begriff der „Selbstwirksamkeit“ benutzt. Sie beschreibt die Fähigkeit eines Menschen etwas Bestimmtes „richtig zu machen“. „Selbstwirksame Menschen zeigen Persistenz d.h. eine Hartnäckigkeit bei der Verfolgung von Zielen, deren Erreichen eine hohe Belohnung verspricht (Roth 2011: 19)“. Das Erreichen eines Zieles wird bei „selbstwirksamen Menschen“ als Selbstbestätigung empfunden. Neben der Persistenz gehört zur Selbstwirksamkeit die Realitätsorientierung, womit das richtige Abschätzen, welcher Aufwand für welches Ziel gerechtfertigt ist, bezeichnet wird. (vgl. Roth 2011: 90) Zu den extrinsischen Motiven zählen materielle, aber auch immaterielle Motive, wie das Streben nach Einfluss, Macht und Anerkennung. (vgl. Roth 2011: 87) Im Gegensatz zu selbstwirksamen Menschen, die Aufgaben als eine Herausforderung sehen, leiden Vermeider unter der Angst des Versagens. Während Vermeider eigenen Erfolg eher als Zufall werten, schreiben selbstwirksame Menschen ihren Erfolg ihrem Können und ihrem Einsatz zu. Misserfolge sieht der Vermeider als Bestätigung seiner Unfähigkeit, wohingegen der Selbstwirksame seinen Misserfolg mit seinem zu geringem Einsatz begründet. (vgl. Roth 2011: 91) Intrinsische und extrinsische Motive besitzen einen großen Einfluss darauf, wie sich Lernende dem Lernen gegenüber verhalten. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 8) Lernende mit intrinsischen Motiven lernen aus eigenem Antrieb, denn sie sind neugierig und optimistisch in ihrer Zielsetzung. Sie besitzen eine aktive und reflektierende Haltung dem Lernen gegenüber. Lernen bereitet ihnen große Freude und das Lösen von Aufgaben stellt für sie eine Herausforderung dar, der sie sich gerne stellen. Neuen Lernstrategien gegenüber verhalten sie sich offen. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 8) Lernende mit extrinsischen Motiven hingegen verhalten sich passiv dem Lernen gegenüber und leisten Widerstand gegen Veränderungen ihrer Denkgewohnheiten. 4. Lernen S e i t e | 32 Sie empfinden beim Lernen keine Freude und fühlen sich sehr schnell überfordert. Interesse am Lernstoff und strukturiertes Lernen sind ihnen fremd. Sie lernen nur unter Zwang oder wenn ihnen eine Belohnung in Aussicht gestellt wird. Passiv Lernende reflektieren ihr Lernen nicht und sind gegen eine Veränderung ihrer Lernstrategien resistent. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 8) 4.1.2.1 Dopamin Dopamin spielt im Zusammenhang mit Motivation eine wichtige Rolle, denn es aktiviert das Belohnungssystem. Als Belohnung wird alles das bezeichnet, was einen veranlasst das Verhalten zu wiederholen, das die Belohnung verursacht hat, wie z.B. gutes Essen, Erfolg, Sex oder eine positive Gemeinschaft. (vgl. Spitzer 2009: 177,180ff) Dopamin ist ein wichtiger Neurotransmitter, das allgemein auch als Glückshormon bezeichnet wird. Die Begegnung mit Neuem führt zu Freisetzung von Dopamin. Deshalb wird es auch „als Substanz der Neugier und des Explorationsverhaltens, der Suche nach Neuigkeit (engl. novelty seeking behavior) bezeichnet“ (Spitzer 2009: 181). Dopamin weckt auf, weil es auf besonders interessante Situationen aufmerksam macht. Es fördert das Lernen, weil sich durch Dopamin besondere und neue Erfahrungen im Gehirn einprägen. Dopamin aktiviert, indem es die Muskeln steuert, damit der Körper unseren Willen in die Tat umsetzen kann. Dopamin wird in sog. dopaminerge Neuronen produziert. Diese befinden sich hauptsächlich in der Substantia nigra und der benachbarten Hirnregion Area ventralis tegmantalis. Von diesen beiden Kernen aus erstrecken sich Nervenäste, die das Dopamin in andere Gehirnteile weiterleitet. Die Dopaminfreisetzung im Cortex führt zu einer Steigerung des Denkvermögens. Im Nucleus accumbens führt die Dopaminfreisetzung zur Ausschüttung von endogenen Opioide im frontalen Cortex, was zu einem subjektiven Wohlgefühl führt. Die Erzeugung von Dopamin auf einen äußeren Reiz hängt davon ab, wie hoch die Differenz zwischen erhaltener und vorausgesagter Belohnung ausfällt: Die Dopaminneuronen zeigen eine Erregung, d.h. sie produzieren Dopamin, wenn die Belohnung höher als erwartet ausfällt. Ist dagegen die Belohnung genauso hoch oder sogar geringer als erwartet, reagieren die Dopaminneuronen nicht. (vgl. Spitzer 2009: 182) 4. Lernen S e i t e | 33 Neben Dopaminneuronen gibt es noch andere, auf Belohnung reagierende Neuronen im Gehirn. Diese haben ihren Sitz im Striatum, der Amydagla und im orbitofrontalen Cortex. Ihre Aufgabe ist es, zwischen den einzelnen verschiedenen Belohnungen zu unterscheiden, oder den Wert einer Belohnung festzustellen. (vgl. Roth 2011: 44ff) Wie wirkt Dopamin auf das Belohnungssystem? Wie bereits beschrieben, führt die Dopaminfreisetzung im Frontalhirn zur Freisetzung endogener Opioide. Neuere Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass Dopamin das Belohnungssystem nicht selbst auslöst, sondern dieses mittels endogener Opiate nur verspricht (vgl. Roth 2011: 157). Das damit entstandene Wohlgefühl wird als Belohnungseffekt empfunden. Dieser spielt bei der Informationsverarbeitung eine Art „Türöffner-Rolle“ (vgl. Spitzer 2009 180): „die Verhaltenssequenz bzw. das Ereignis, was zum besser- als- erwartet Resultat geführt hat, wird weiter verarbeitet und dadurch mit höherer Wahrscheinlichkeit abgespeichert. Wir können auch sagen: es wird etwas gelernt“ (Spitzer 2009: 181). Dabei wird jedoch nicht alles gelernt, sondern nur das, was für uns positive Konsequenzen hat. 4.1.3 Emotionen Emotionen haben einen großen Einfluss auf das Lernen, denn einerseits fördern positive Emotionen das Lernen, andererseits verhindern negative Emotionen ein erfolgreiches Lernen. (vgl. Spitzer 2009: 157) Durch die Gehirnforschung weiß man, dass das Gehirn nicht nur rationalen Gründen gehorcht, sondern auch stark von Emotionen beeinflusst wird. Emotionen werden oft unterstellt, sie würden die Fähigkeit vernünftige Entscheidungen zu treffen beeinträchtigen. Emotionen jedoch sind wichtig bei Entscheidungen, denn man kann sich bei den meisten Urteilen im Leben nicht nur auf die Logik stützen, weil die zur Verfügung stehenden Informationen oft unvollständig oder mehrdeutig sind. Deshalb sollte man sich bei vielen Entscheidungen auf sein Bauchgefühl (Intuition) verlassen, denn „Emotionen helfen uns beim Zurechtfinden in einer komplizierten und immer komplizierter werdenden Welt“ (Spitzer 2009: 171). 4. Lernen S e i t e | 34 Die Schwierigkeit Emotionen neurowissenschaftlich zu untersuchen, liegt daran, „…dass es bis heute keine allgemeine akzeptierte Theorie der Emotionen gibt (Spitzer 2009: 157)“. Emotionen lassen sich zumindest verbindlich in ihrer Stärke (wenig oder viel) und in ihrer Wertigkeit (positiv oder negativ) einteilen. Ein wesentlicher Bestandteil des emotionalen Systems ist der sich im Stirnlappen befindliche orbifrontale Cortex. Dort wird das Sozialverhalten gesteuert, indem Verhaltensweisen bewertet werden und danach die entsprechenden sozialen Gefühle (z.B. Schuld, Scham, Stolz) dem Verhalten zugewiesen werden. Ein weiterer Bestandteil des emotionalen Systems ist die Amygdala, die nicht nur Angstreaktionen hervorruft, sondern auch sehr schnell auf positive Reize reagiert. Die Amygdala ist zuständig für die Konzentration auf emotional wichtige Ereignisse. Der größte Teil der Emotionen wird von mehreren unspezifischen Hirnregionen erzeugt. (vgl. Spitzer 2009: 34,157) Bei emotionaler Erregung wird Adrenalin ausgeschüttet, das den Sympathikus anregt. Der Sympathikus ist ein Teil des Kampf- oder Fluchtreflex steuernden sympathischen Nervensystems. Er leitet die Informationen an die Amygdala und dem Hippocampus weiter. Diese sind an der Gedächtnisbildung beteiligt, denn durch deren Aktivierung kommt es zur Verstärkung synaptischer Plastizität, was bedeutet: es wird gelernt. Ereignisse, die in einem emotionalen Kontext stehen, werden besser behalten. So können sich heutzutage noch viele Menschen genau daran erinnern, womit sie in dem Moment beschäftigt waren, als sie von den Anschlägen auf das World Trade Center in New York erfuhren. (vgl. Spitzer 2009: 35,158) Experimentell konnte nachgewiesen werden, dass der emotionale Kontext in dem etwas gelernt wird, Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung hat. So wurden in einer Untersuchung Probanden Bilder gezeigt, die positive, negative oder neutrale Reaktionen hervorriefen. Mit dem jeweiligen Bild wurde ein zu merkendes, neutrales Wort eingeblendet. Das Ergebnis zeigte, dass diejenigen Wörter am besten wieder gegeben werden konnten, die in einem positiven Kontext gezeigt worden waren. (vgl. Spitzer 2009: 166) Des Weiteren konnte bewiesen werden, dass je nach emotionalem Kontext verschiedene Hirnregionen beim Lernen beteiligt sind: - Bei positiv emotionalem Kontext wird der Hippocampus aktiviert. 4. Lernen - Bei negativ emotionalem Kontext wird die Amygdala aktiviert. - Bei neutral emotionalem Kontext wird der frontale Cortex aktiviert. - (vgl. Spitzer 2009: 166) S e i t e | 35 Der Zusammenhang zwischen Gedächtnisleistung und emotionaler Beteiligung bestätigte auch folgende Untersuchung: Die Verabreichung von BetaRezeptorenblocker, einem Medikament, das Puls und Blutdruck senkt und dadurch die emotionale Erregung verringert, bewirkte ein Nachlassen des Erinnerungsvermögens. (vgl. Spitzer 2009: 159) 4.1.3.1 Angst Unter Angst kann man zwar schnell lernen, jedoch verhindert sie die für ein erfolgreiches Lernen erforderliche Verknüpfung von neuem mit bereits im Gehirn abgespeichertem Wissen. (vgl. Spitzer 2009: 161) Angst war bei unseren Vorfahren ein wichtiger Teil der Überlebensstrategie. Wer ein verdächtiges Geräusch in einem Gebüsch wahrnahm, war gut beraten, sich schnell zu entscheiden, ob er fliehen („flight“) oder kämpfen („fight“) sollte, denn für lange Überlegungen blieb oft keine Zeit. Verspürt der Mensch Angst, kommt es zu körperlichen Reaktionen. Zu diesen gehören ein schnellerer Puls, ein höherer Blutdruck und eine verstärkte Muskelspannung. Diese körperlichen Reaktionen werden durch Stresshormone ausgelöst, die im Körper Energiestoffe (z.B. Glukose) freisetzen. Aber nicht nur auf den Körper wirkt sich Angst aus, sondern auch auf die Art des Denkens und des Lernens. Hat der Mensch Angst, so steht das Gehirn unter dem besonderen Einfluss der Amygdala. Einerseits sorgt sie dafür, dass unangenehme Erfahrungen gelernt und zukünftig vermieden werden. Wer sich beispielsweise als Kind die Hand am Herd verbrannt hat, wird nie mehr eine heiße Herdplatte berühren. Anderseits führt die Aktivität der Amygdala zu einem Denkstil, in dem nur das Entkommen vor den Ursachen der Angst in Vordergrund steht. Durch diesen Tunnelblick werden einfache Lösungswege gesucht und bevorzugt. Kreatives und freies Denken dagegen werden blockiert. Manfred Spitzer zitiert hierzu Fiedler in seinem Buch „Lernen“: „eine ganze Reihe von Befunden spricht dafür, dass Angst einen bestimmten kognitiven Stil produziert, der das rasche Ausführen einfacher gelernter 4. Lernen S e i t e | 36 Routinen erleichtert und das lockere Assoziieren erschwert.“ Fiedler (1999 zit. in Spitzer 2009: 164) Oft haben ältere Menschen Angst vor dem Lernen, weil Lernen auch die Angst auslösende Begegnung mit Neuem und Unbekanntem bedeuten kann. Zusätzlich ist es die Angst vor Veränderung, denn wer lernt, der verändert seine Identität. Gerade weil sie in ihrer Persönlichkeit meistens stark gefestigt sind, können ältere Menschen auch deshalb Angst vor dem Lernen haben. Kinder hingegen stehen Neuem neugierig und offen gegenüber, weil sie noch in der Entwicklung ihrer Identität stehen. (vgl. Spitzer 2009: 11ff,163ff) 4.1.3.2 Stress. Jeansok Kim und David Diamond formulierten, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Mensch als gestresst bezeichnet werden kann: Es muss eine messbare physiologische Erregungsreaktion vorliegen. Der Auslöser des Stresses (Stressor) muss als unangenehm empfunden werden. Die Stresssituation muss als nicht beeinflussbar wahrgenommen werden. (vgl. Medina 2009: 194) Nicht jeder Mensch reagiert folglich auf eine bestimmte Situation mit Stress, denn die Entstehung von Stress hängt von der jeweiligen subjektiven Bewertung der Situation ab und ist immer eine Frage der Bewertung (vgl. Spitzer 2009: 173). Stress ist eine normale Reaktion des Körpers und der Psyche auf gestellte Herausforderungen. Bei Stress schüttet der Körper Stresshormone aus, die es einem ermöglichen, Antworten auf die jeweilige Situation zu finden. Durch die Ausschüttung von Stresshormonen kann sich der Körper blitzschnell an extreme Situationen anpassen. Stress ist somit auch ein Teil unserer Überlebensstrategie. Zu den Stresshormonen gehören Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol.(vgl. Roth 2011: 51) Adrenalin wird im Nebennierenmark gebildet und direkt ins Blut ausgeschüttet. Es fördert die Durchblutung durch Steigerung der Herzfrequenz und einer Erhöhung des Blutdrucks. Zudem werden die Bronchien erweitert, sodass mehr Sauerstoff in die Lungen gelangen kann. Die Freisetzung von Glukose erhöht den Muskeltonus und die geistige Aktivität wird gesteigert. (vgl. Spitzer 2009: 169) 4. Lernen S e i t e | 37 Noradrenalin wird ebenfalls in den Nebennieren produziert. Seine Ausschüttung wirkt sich blutdrucksteigernd aus. Neuroadrenalin ist nicht nur ein Hormon, sondern gleichzeitig ein Neurotransmitter. Es erhöht die Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft und wirkt anregend. (vgl. Grein 2012: 32) Cortisol stellt dem Körper in Stresssituationen durch die Ingangsetzung spezieller Stoffwechselvorgänge zusätzliche Energie zur Verfügung. (vgl. Spitzer 2009: 169) Für ein optimales Lernen bedarf es eines gewissen Grades an Stress (vgl. Spitzer 2009: 171). Dieser für das Lernen optimale Stress wird als Eustress bezeichnet (vgl. Grein 2012: 34ff). Bei dieser positiven Art von Stress befindet sich die Anregung durch Stresshormone und die Hemmung durch die Neurotransmitter Serotonin und GABA (Gamma-Aminobuttersäure) in einem Gleichgewicht. Serotonin wirkt beruhigend und stimmungsaufhellend. GABA besitzt eine hemmende und beruhigende Eigenschaft. (vgl. Roth 2011: 53ff) Ist das Gleichgewicht durch zu viele anregende Hormone und Neurotransmitter nicht mehr vorhanden, spricht man von Distress. Bei dieser negativen Art von Stress nimmt die Leistungsfähigkeit beim Lernen stark ab. Kommt der Körper durch ständigen Stress nicht mehr zur Ruhe, entsteht chronischer Stress. Er ist eine der wesentlichen Ursachen moderner Zivilisationskrankheiten wie Erkrankungen des Herz und Kreislaufsystems, Rückenleiden, Probleme des Verdauungstraktes, Potenzprobleme und psychische Erkrankungen, wie z.B. Depressionen. Chronischer Stress wirkt sich ebenfalls negativ auf das Lernen aus, denn Neuronen des Hippocampus werden durch den ständig hohen Stresshormonpegel geschädigt, was das Erinnerungsvermögen negativ beeinträchtigt. Durch chronischen Stress wird dem Gehirn weniger Glukose zugeführt. Dies vermindert die kognitive Leistungsfähigkeit. Des Weiteren verursacht er neuronalen Zelltod, wodurch sich der Gehirnmasse verringert. (vgl. Roth 2011: 52), (vgl. Spitzer 2009: 168,170ff) Die Menge an Neurotransmittern, ob leistungssteigernde oder hemmende, hat dabei nicht bei jedem Menschen die gleichen Auswirkungen. Je nach Lerntyp wird ein anderer „Neurotransmitter-Cockail“ bevorzugt, sodass ein kurzer Blick auf die unterschiedlichen Lerntypen geworfen wird. 4. Lernen S e i t e | 38 4.2 Lerntypen Jeder Mensch verfügt über sein eigenes Lernmuster. Effektives Lehren und Lernen verlangen, dass die dem jeweiligen Lerntyp entsprechenden Aufnahmekanäle und Verarbeitungsmechanismen angesprochen werden. Die Kenntnis welcher Lerntyp man repräsentiert hilft einem auf dem Weg zum optimalen Lernen. Man unterscheidet Lerntypen nach ihrem bevorzugten Wahrnehmungssinn und nach ihrem Lernstil. 4.2.1 Lerntypen nach bevorzugtem Wahrnehmungssinn. „Grundlage für das Lernen ist die Wahrnehmung durch die Sinne“ (Kilp 2010: 26). Beim Lernen gebrauchen wir unsere Sinne und durch diese gelangt der Lernstoff in unser Gehirn. Beim Menschen sind die Sinnesorgane unterschiedlich stark ausgeprägt. Je nach dem welches stärker ausgeprägt ist, unterscheidet man zwischen primär auditiven, stark visuellen und primär kinästetisch-haptischen Lerntypen. Bei dieser Lerntypenbestimmung handelt es sich nur um Tendenzen, denn bei einer Informationsaufnahme sind immer mehrere Sinne beteiligt. Deshalb sollte man, unabhängig davon welcher Lerntyp man ist, möglichst viele Sinne beim Lernprozess mit einbeziehen. Je mehr Sinne am Lernprozess beteiligt sind, desto höher ist die Erinnerungsquote. In dem Buch „Spiele für den Fremdsprachenunterricht“ von Eloide Kilp wird dies bestätigt, denn der Mensch behält: „20% von dem, was wir nur hören, 30% von dem, was wir nur sehen, 50% von dem, was wir hören und sehen, 70% von dem, was wir sowohl hören als auch sehen und darüber zusätzlich diskutieren und 90%, wenn wir das, was wir hören und sehen und worüber wir diskutieren, auch selbst tun“ (2003: 27). 4. Lernen S e i t e | 39 Die einzelnen Lerntypen im Überblick (vgl. Kilp 2010: 26ff): Der primär auditive Lerntyp Er lernt am besten über das Hören, denn gehörte Informationen können leicht aufgenommen, behalten und wieder gegeben werden. Akustische Mittel wie beispielsweise Lernkassetten sind eine geeignete Lernunterstützung. Ebenso fördert lautes Lesen der Lerntexte das Lernen. Da Selbstlesen viel Konzentration erfordert, sind Hörbücher für den auditiven Lerntyp optimal geeignet. Beim Lernen sollte auf ablenkende Musik verzichtet werden, da der auditive Lerntyp sehr anfällig für störende Geräusche ist. Der stark visuelle Lerntyp Er lernt am besten durch Betrachten und Beobachten. Da der visuelle Lerntyp das Lesen bevorzugt, sollte er im Unterricht mitschreiben. Komplizierte Inhalte sollte er sich durch Zeichnungen und Skizzen verständlich machen. Ideales Lernmittel für den visuellen Lerntyp sind Karteikarten, vor allem für das Vokabellernen. Bilder, Diagramme, Mind-maps und auf große Poster zusammengefasster Lernstoff unterstützen das Lernen. Der primär haptisch-motorische Lerntyp Er lernt am besten, wenn er am Lernprozess direkt beteiligt wird. Durch dieses „learning by doing“ können eigene Erfahrungen gesammelt und eigenständige Schlussfolgerungen gezogen werden. Der haptisch-motorische Lerntyp kann sich am besten an Informationen erinnern, die er durch Bewegung, Handeln und Fühlen aufgenommen hat. Für ihn ist es wichtig, zuerst das große Ganze erfassen zu können, bevor auf die einzelnen Aspekte eingegangen wird. Er sollte mit Lernmaterialien arbeiten, die er anfassen kann. Dazu gehören beispielsweise. Experimentierkästen und Modelle. Scrabble-Steine eignen sich ideal zum Erlernen von Vokabeln und Grammatik. Der haptisch-motorische Lerntyp sollte sich beim Lernen bewegen. Das Lernen in einer Gruppe oder mit Hilfe von Rollenspielen ist für ihn vorteilhaft. Wer seinen Lerntyp kennt und dies beim Lernen entsprechend berücksichtigt, kann effektiver und nachhaltiger Informationen aufnehmen und verarbeiten. 4. Lernen S e i t e | 40 Beim Herausfinden, welcher Lerntyp man ist, hilft der im Internet unter: www.stangltaller.at zu findende HALB-Test. 4.2.2 Lerntypen nach Lernstil Phasen des Erfahrungslernens nach Kolb (vgl. 1981, 235) Die Lerntypen nach Lernstil (nach D. A. Kolb) bauen auf einem Lernkreis auf, der aus vier Schritten besteht. Zunächst werden am Anfang eines Lernprozesses konkrete Erfahrungen gemacht. Danach wird über diese Erfahrungen reflektiert. Bei der abstrakten Konzeptionalisierung wird das Grundkonzept, das hinter den Erfahrungen steht, abstrahiert, das bedeutet, der Lernende erstellt seine individuelle Hypothese über die Zusammenhänge der gemachten Erfahrungen. Im nächsten Schritt wird seine aufgestellte Hypothese in einer neuen Situation getestet, um derer Richtigkeit zu überprüfen. Nach Kolb müssen für einen erfolgreichen Lernprozess alle vier Schritte durchlaufen werden. Demnach sollte der Lernende für ein erfolgreiches Lernen über folgende Lernfähigkeiten verfügen (vgl. Kilp 2010: 33ff): Er muss bereit sein, schon möglichst früh konkrete Erfahrungen in dem entsprechenden Lernbereich zu machen. Er muss die gemachten Erfahrungen beobachten und über sie reflektieren können. 4. Lernen S e i t e | 41 Er muss in der Lage sein, die hinter den Beobachtungen stehenden Regeln zu abstrahieren und sie zu verinnerlichen. Er muss durch eigenes Tun den Wahrheitsgehalt der gefundenen Regeln überprüfen können. Erst durch die dabei gewonnene Erkenntnis, dass Theorie und Praxis übereinstimmen, ist der Lernprozess abgeschlossen. Anhand dieses Lernkreises lassen sich je nach Stärke in den verschieden Lernphasen vier verschiedene Lerntypen herauskristallisieren (vgl. Kilp 2010: 35ff): Der Divergierer (Initiator) Er bevorzugt beim Lernen konkrete Erfahrungen und reflektierendes Beobachten. Der Divergierer betrachtet konkrete Situationen aus mehreren Blickwinkeln und besitzt über eine große Vorstellungskraft. Wegen seiner hohen sozialen Kompetenz ist er in besonderem Maße an seinen Mitmenschen interessiert. Kulturellem ist er ebenfalls gerne zugewandt. Den Lernstil des Divergierers bevorzugen Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler. Der Assimilierer (Theoretiker) Er lernt durch Analysieren und logisches Denken. Der Theoretiker durchdenkt Ideen und stellt Theorien auf. Anstatt sich mit Personen zu befassen beschäftigt er sich lieber mit abstrakten Konzepten. Diesen Lernstil findet man bei Mathematikern und Naturwissenschaftlern. Der Konvergierer (Spezialist) Er hat eine Vorliebe für abstrakte Begriffsbildung und aktives Experimentieren. Der Spezialist wendet am liebsten bereits vorhandene Ideen in die Praxis um. Er beschäftigt sich bevorzugt mit Dingen oder zu überprüfenden Theorien. Diesen Lernstil bevorzugen Ingenieure. Der Akkomodierer (Macher) Er lernt am besten durch die praktische Umsetzung der Theorie, wobei persönliche Erfahrungen integriert werden. Für diesen Lerntyp sind Bewegung und Fühlen von Bedeutung. Problemlösungen werden nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum 4. Lernen S e i t e | 42 angegangen. Für diese Lerntypen sind einzelne Fakten wichtiger als Theorien. An seinen Mitmenschen hat er ein besonderes Interesse. Dieser Lernstil ist vor allem im Verkauf und Marketing verbreitet. 4.3 Lernen im Alter Die Leistungsfähigkeit des Gehirns lässt mit dem Älterwerden unweigerlich nach. Gründe hierfür sind die spezifischen Veränderungen in der Struktur und der Funktion des Gehirns. Diese führen zu einer Verminderung der Gedächtnisleistung und der Exekutivfunktion. Unter Exekutivfunktion verstehen Neurologen all diejenigen Fähigkeiten, die es einem ermöglichen, das für eine bestimmte Situation adäquate Verhalten auszuwählen, und sich auf Aufgaben konzentrieren zu können (vgl. Aamodt/Wang 2008: 126). Ein Nachlassen der Exekutivfunktion zeigt sich in einer Verminderung der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit, der Reaktionszeit und der Orientierungsfähigkeit. Das Nachlassen der Gedächtnisleistung hängt mit einem sich mit zunehmendem Alter verkleinernden Hippocampus zusammen. Der für das Kurzeitgedächtnis und die Exekutivfunktion zuständige präfrontale Cortex schrumpft ebenfalls (vgl. Aamodt/Wang 2008: 126). Für die Schrumpfung von Hippocampus und präfrontalen Cortex ist nicht das Absterben von Neuronen ursächlich, sondern ausschließlich deren Schrumpfung. Im alternden Gehirn nimmt die Zahl der synaptischen Verbindungen ab und die synaptische Plastizität verlangsamt sich (vgl. Aamodt/Wang 2008: 129). Die Geschwindigkeit der Informationsübertragung reduziert sich durch das Dünnerwerden der Myelinhülle, die die Axone umgibt, und das Weiterleiten elektrischer Impulse beschleunigt. Die Abnahme der Myelinhülle kann mit Hilfe der P300-Welle physikalisch gemessen werden. P300 ist eine Welle des hirnelektronischen Potenzials. Je früher sie auftritt, desto schneller ist die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit. Mit jedem Lebensjahr tritt die P300-Welle zwei Millisekunden später auf. (vgl. Spitzer 2009: 281ff) Mit zunehmendem Alter verringert sich die Ausschüttung von Neurotransmitter, wie beispielsweise Acetylcholin, Dopamin, Serotonin und Noradrenalin. (vgl. Grein 2012: 118) Auch die Art der Intelligenz verändert sich mit zunehmendem Alter. Intelligenz kann unter anderem in fluide und kristalline Intelligenz unterteilt werden. Fluide Intelligenz zeichnet sich durch geistige Flexibilität, kreative Anpassungsfähigkeit, Kombinations- 4. Lernen S e i t e | 43 und Auffassungsgabe aus. Charakteristische Eigenschaft der kristallinen Intelligenz ist ihr Basieren auf gelerntem Wissen und gemachten Erfahrungen. Dadurch können Zusammenhänge leicht erkannt und bekannte Aufgaben schnell gelöst werden. (vgl. Roth 2011: 49). Das Erlernen einer Fremdsprache wird durch die kristalline Intelligenz erleichtert, da auf ein bereits vorhandenes Sprachwissen zurückgegriffen werden kann. Ältere Menschen lernen zwar langsamer, aber durch ihr größeres Wissen können neue Inhalte leichter integriert werden. Manfred Spitzer bestätigt diesen Zusammenhang: „je mehr man weißt, desto besser kann man neue Inhalte mit bereits vorhandenem Wissen in Verbindung bringen“ (Spitzer 2009: 283). Ab dem 25. Lebensjahr nimmt die fluide Intelligenz kontinuierlich ab (vgl. Grein 2012: 132). Die kristalline Intelligenz hingegen bleibt bis ins hohe Alter konstant, sie kann sich durch Lebenserfahrung sogar noch steigern. (vgl. Grein 2012: 121ff) Mit dem Älterwerden geht eine Verschlechterung der Sinneswahrnehmungen einher: -Hören: Im Vergleich zu einem 20-Jährigen beträgt die Hörfähigkeit beim einem 60Jährigen noch 80 Prozent und bei einem 70-Jährigen noch 70 Prozent. Betroffen davon sind besonders die höheren Lautfrequenzen. Weil ältere Menschen bei Hintergrundgeräuschen Probleme beim richtigen Hören haben, sollte der Unterricht in Räumen mit guter Akustik abgehalten werden. Zudem sollte der Lehrer für eine ruhige Atmosphäre im Unterricht sorgen und laut und deutlich sprechen. (vgl. Grein 2012: 134ff) -Sehen: die Verschlechterung der Sehleistung bei älteren Menschen kann durch entsprechende Sehhilfen ausgeglichen werden. Dem Nachlassen der Helligkeitsempfindlichkeit und damit verbundenen Verringerung der Kontrastwahrnehmung kann durch Verwendung von entsprechenden, sich vom jeweiligen Hintergrund abhebenden, Schreibmittel, Rechnung getragen werden. (vgl. Grein 2012: 138) Die Emotionen verändern sich ebenfalls mit zunehmendem Alter. Die Häufigkeit negativer Emotionen nimmt mit den Jahren stetig ab, bis sie mit dem 60. Lebensjahr ihren Tiefststand erreicht haben. Die positiven Emotionen hingegen bleiben gleich stark, was für ein optimales Lernen im Alter förderlich ist. (vgl. Aamodt/Wang 2008: 131) 4. Lernen S e i t e | 44 Bei älteren Menschen verändert sich die Hirnfunktion. So werden bei gleicher Aufgabenstellung bei Älteren zur Lösung andere Hirnregionen aktiviert als bei Jüngeren. Zudem benutzen ältere Menschen bei geistiger Aktivität Bereiche in beiden Hemisphären des Gehirns statt nur in einer. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass dadurch das Nachlassen der Leistungsfähigkeit des Gehirns kompensiert wird. So wurde mittels Untersuchungen im Kernspintomographen festgestellt, dass bei Menschen, die erst in späteren Lebensjahren eine Fremdsprache erlernt hatten, für jede einzelne Sprache ein separates neuronales Netzwerk vorhanden war. Wohingegen bei Menschen mit früher Zweisprachigkeit sowohl für die Muttersprache, als auch für die Fremdsprache, nur ein einziges neuronales Netz existierte (vgl. Aamodt/Wang 2008: 105ff). Zwar kommt es durch die Veränderung der Gehirnstruktur zu einer teilweisen Abnahme kognitiver Leistungsfähigkeit, es gibt aber auch Funktionen, die durch das Älterwerden nicht beeinträchtigt werden. Dazu gehören die Sprachkenntnisse und das Begriffsvermögen (vgl. Aamodt/Wang 2008: 129). Gerade durch die Unveränderlichkeit der Sprachkenntnisse bietet sich das Erlernen einer Fremdsprache besonders im Alter an, weil dabei viele Gehirnareale gleichzeitig beansprucht werden und dadurch das Gehirn fit gehalten werden kann. (vgl. Grein 2012: 114,130) Wie können diese neurologischen Erkenntnisse im Unterricht mit älteren Teilnehmenden umgesetzt werden? - Aufgrund der langsameren Informationsverarbeitung und der verringerten Gedächtnisleistung (Behalten und Abrufen) sollten des Öfteren Wiederholungen im Unterricht eingebaut werden. Auch sollte das Unterrichtstempo entsprechend angepasst sein. - Um mehrere Gehirnbereiche beim Unterrichten gleichzeitig anzuregen, sollte die Vermittlung des Lernstoffs über mehrere Sinneskanäle erfolgen. Dafür ist insbesondere der Einsatz von Spielen geeignet. - Der Unterricht sollte ritualisiert und strukturiert aufgebaut werden, weil ältere Menschen meist in ihrer Persönlichkeit stark gefestigt sind. So sollte am Anfang des Unterrichts immer eine Begrüßung stehen, gefolgt von einer kurzen Wiederholung der letzten Stunde und einer Vorschau auf den neuen 4. Lernen S e i t e | 45 Lehrstoff. Der Unterricht sollte mit einer kurzen Zusammenfassung des behandelnden Themas beendet werden. (vgl. Grein 2012: 141) Ein wichtiger Faktor das Gehirn im Alter fit zu halten, ist Sport, getreu der lateinischen Redewendung „mens sana in corpore sano“ (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper). (vgl. Aamodt/Wang 2008: 128) Die positive Wirkung von regelmäßigem Sport auf das Gehirn konnte durch zahlreiche Untersuchungen bestätigt werden (vgl. Aamodt/Wang 2008: 128ff): - Auf die gesamte Lebenszeit betrachtet kann das Demenzrisiko halbiert werden. - Das Risiko in den Siebzigern an Alzheimer zu erkranken, verringert sich bei Menschen, die im mittleren Alter beginnen regelmäßig Sport zu treiben, um über 60 Prozent. Selbst wer erst mit 60 Jahren damit anfängt, kann das Risiko noch um 50 Prozent senken. - Sport fördert das physische Wohlbefinden, denn die Ausschüttung der drei Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin wird angeregt. - Molekularbiologische Untersuchungen belegten, dass durch Sport die Produktion von BDNF („brain-derived neurotrophic factor“) im Gehirn gefördert wird. Wie bereits im Kapitel „Gehirn“ beschrieben, unterstützt BDNF das Wachstum und die Neuvernetzungen von Neuronen. Vor allem die Zellen des Hippocampus, der unter anderem eine wichtige Rolle für das Gedächtnis -und Erinnerungsvermögen spielt, profitieren von einer verstärkten BDNFAusschüttung. - Durch Sport wird die Bildung neuer kleiner Blutgefäße (Kapillargefäße) im Gehirn angeregt. Durch die verbesserte Blutversorgung gelangen mehr Nährstoffe und Sauerstoff ins Gehirn. Es war mein Anliegen, mittels der ersten vier Kapitel Grundkenntnisse der Gehirnforschung und Lernpsychologie zu vermitteln. Im 5.Kapitel soll anhand von Beispielen gezeigt werden, wie dieses Wissen erfolgreich in die Praxis des Lehrens und Lernens umgesetzt werden kann. 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen S e i t e | 46 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen Im folgenden Kapitel werden die konkreten Umsetzungen aus den vorherigen Kapiteln zusammengefasst und daraus Kriterien für ein gehirngerechtes Unterrichten und Lernen abgeleitet. 5.1 Wiederholungen Wie in dem 2.Kapitel dargelegt, arbeitet das Gehirn nach dem Prinzip der neuronalen Vernetzung. Dabei „halten sich die neuronalen Verbindungen an die bekannte Weisheit: Übung macht den Meister“ (Aamodt/Wang: 2008). Eingehende Informationen werden entweder mit bereits vorhandenen Strukturen vernetzt, oder es werden neue Strukturen gebildet. Dabei führt die Häufung vieler ähnlicher Aktivierungsmuster zu einer Vergrößerung des entsprechenden Gehirnareals, weil durch die kontinuierliche Wiederholung das Gehirn die Information als bedeutsam bewertet. Jede Wiederholung erleichtert die nächste, weil durch ständiges Repetieren immer stärkere synaptische Verbindungen geschaffen werden und deshalb das Gehirn auf bereits geringste Auslöser reagiert, um das Gelernte abzurufen. Gerhard Roth schreibt im Bezug auf die Bedeutung des Wiederholens: „neben Intelligenz, Motivation und Fleiß ist das systematische Wiederholen des Stoffes A und O des Lernens“ (Roth 2011: 306). Der optimale Zeitpunkt für die erste Wiederholung des Lernstoffs ist nach zehn Minuten, weil danach der Höhepunkt der Erinnerung erreicht ist. Durch die erste Repetition bleibt die Information vollständig erhalten. Weitere Wiederholungen sollten in Zeitabständen von einem Tag, einer Woche, einem Monat und einem Jahr erfolgen. (vgl. Roth 2011: 306ff) Ideal für Wiederholungen sind Lernkarteien. Mit ihrer Hilfe können vor allem Vokabeln, Fachbegriffe oder die wichtigsten Punkte eines Themas so lange wiederholt werden, bis man sie fehlerfrei beherrscht. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 32) Am Anfang des Unterrichts sollte der durchgenommen Stoff der letzten Stunde kurz wiederholt werden. Im weiteren Stundenverlauf sollte dann des Öfteren der neue Lernstoff wiederholt und am Ende nochmals ausführlich zusammengefasst werden. Weitere Wiederholungen sollten am nächsten Tag, in einer Woche, in einem Monat, 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen S e i t e | 47 erfolgen, damit der Lehrstoff erfolgreich im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird (vgl. Roth 2011: 306ff). Um die positive Wirkung von Wiederholungen zu nutzen, sollte aus meiner Erfahrung nach, in Tests nicht nur der aktuelle Lernstoff geprüft werden, sondern auch länger zurückliegende Themen. Dadurch werden die Lernenden gezwungen, den gesamten Lernstoff ständig zu wiederholen. 5.2 Verknüpftes Lernen Eine gute Technik Informationen dauerhaft im Gedächtnis ab zu speichern, ist das verknüpfte Lernen (Assoziationslernen). Dabei wird der Lehrstoff mit vorhandenem Wissen verknüpft, denn „je tiefer ein Inhalt verarbeitet wird, desto besser bleibt er im Gedächtnis“ (vgl. Spitzer 2009: 9).Diese Verknüpfung kann erfolgen durch Ähnlichkeiten ( ein Tor ist eine große Tür), Kontrasten (hell-dunkel), Reime (sieben, fünf, drei, schlüpft Rom aus dem Ei), bildliche Vorstellungen (die Form Italiens gleicht einem Stiefel) oder Eselsbrücken („Taschentuchknoten“). (vgl. Kilp 2010: 18), (vgl. Frick/Mosimann 2006: 46) 5.3 Strukturierter Input Lernen gelingt am besten durch strukturierten Input. Um die Datenflut bewältigen zu können, muss das Gehirn Wichtiges von Unwichtigen unterscheiden und Kategorien bilden. Dabei können nur strukturierte Informationen sofort in die entsprechenden Kategorien eingeordnet werden. Dadurch wird optimales Lernen erreicht, denn Wissen im Gehirn zu verankern, ist ein Einordnungsprozess. Dieser Einordnungsprozess ist bei chaotischem Input nicht möglich, weil durch das Fehlen von Regelmäßigkeit kein für das Lernen wichtiges Erkennen der hinter dem Lehrstoff stehenden Regeln stattfinden kann. (vgl. Spitzer 2009: 453), (vgl. Roth 2011: 302) 5.4 Mehr Sinne anregen Im Unterricht und beim Lernen sollten mehrere Sinne gleichzeitig stimuliert werden, denn:„die Behaltensquote steigt mit der Anzahl der am Lernprozeß beteiligten Sinne“ (vgl. Kilp 2010: 27). So konnte beispielsweise in einem Experiment das visuelle Wahrnehmen durch das gleichzeitige Verbinden mit Berührung verstärkt werden (vgl. Medina 2009: 234ff). Diesen Effekt, dass durch den Einsatz mehrere Sinne generell die Fähigkeit steigt, Reize wahrzunehmen, bezeichnet man als multimodale Verstärkung. Die vorteilhafte Verbindung von vielfältigen Sinneseindrücken und 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen S e i t e | 48 Lernen konnte mit folgendem Test nachgewiesen werden: Das Erinnerungsvermögen bei Probanden, die Informationen sowohl akustisch als auch visuell erhielten war größer als bei Probanden, die die Informationen entweder nur akustisch oder visuell erhielten (vgl. Medina 2009: 235). Andere Tests zeigten, dass sich die Fähigkeit zu Problemlösungen um bis 75 Prozent steigern ließ, wenn die Informationen multisensorisch präsentiert wurden. (vgl. Medina 2009: 236) Multisensorische Reize verbessern deshalb den Lernerfolg, weil sie im Augenblick des Lernens die Codierung verstärken (vgl. Medina 2009: 243). Der Kognitionspsychologe Richard Mayer hat aus seinen Untersuchungen fünf Leitsätze für die Wirkung multimedialer Präsentation, bezogen auf Hören und Sehen, entwickelt (vgl. Medina 2009: 238ff): - Multidiaprinzip: Man lernt besser mit Wörtern und Bildern als nur mit Wörtern. - Prinzip der zeitlichen Nähe: Man lernt besser, wenn Wörter und Bilder gleichzeitig und nicht nacheinander gezeigt werden. - Prinzip der räumlichen Nähe: Man lernt besser, wenn zusammenhängende Wörter und Bilder räumlich dicht beieinander gezeigt werden. - Kohärenzprinzip: Man lernt besser durch das vermeiden unwesentlicher Inhalte. - Modalitätsprinzip: Man lernt besser aus Animation und mündliche Erzählungen als aus Animation und geschrieben Text. Um Lerninhalte als multisensorische Erlebnisse zu gestalten, eignen sich Spiele (Kapitel 6) hervorragend. 5.5 Selbst tun Gemachte Erfahrungen prägen sich besser ins Gedächtnis ein als reine Theorie. Deshalb sollte der Unterricht handlungsorientiert sein. Lernende sollten konkrete Erfahrungen durch selbst tun und ausprobieren machen, denn jede gemachte Erfahrung verändert die Stärke der Synapsen um ein kleines Stück. Sich durch einen hohen Grad an Selbstorganisation auszeichnende Lernangebote ermöglichen den Lernenden, sich ihre eigene Denkstruktur zu konstruieren. Kolp (1981, 235ff, zit. in Kilp 2010: 33), (vgl. Roth 2011: 281) 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen S e i t e | 49 5.6 Die richtige Haltung zum Lernen einnehmen Wer mit einer aktiven Haltung lernt, lernt erfolgreicher und ist geistig leistungsfähiger als jemand, der dem Lernen gegenüber eine passive Haltung einnimmt. Beim Lernen sollte man sich die nicht die demotivierende Frage stellen „Was muss ich tun?“, sondern sich durch die Frage „Was ist mir wichtig?“ der Herausforderung stellen. Lernen sollte also stets ein aktiver und kein passiver Vorgang sein. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 8) 5.7 Aktive Teilnahme am Unterricht Um sich auf den Unterricht besser konzentrieren zu können, sollte man sich aktiv an ihm beteiligen, indem man aufmerksam zuhört und bei Verständnisschwierigkeiten immer wieder Rückfragen stellt. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 17) 5.8 Geschichten „Geschichten treiben uns um, nicht Fakten“ (Spitzer 2009: 35). Geschichten wecken Emotionen und diese wirken sich positiv auf das Lernen aus. Geschichten helfen, den Lehrstoff im großen Gesamtzusammenhang darzustellen. Durch in Geschichten eingebundene Lerninhalte entstehen Verbindungen zwischen episodischem Gedächtnis und Faktengedächtnis, was das Erinnern von Fakten erleichtert (vgl. Roth 2011: 105). Zudem lockern sie den Unterricht auf. (vgl. Spitzer 2009: 35,453) 5.9 Immer zuerst das große Ganze Das Gehirn verarbeitet Informationen hierarchisch, denn es bevorzugt das Wesentliche vor den Einzelheiten. Dies entspricht der normalen Funktionsweise des Gedächtnisses: „Gespeichert wird nicht eine realitätsgetreue Aufzeichnung des Erlebnisses, sondern das, was sie für den Kern der Sache hält“ (Medina 2009: 89). Im Unterricht sollte deshalb zuerst das große Ganze vermittelt und danach zu den Details übergegangen werden. Nur dadurch können Inhalte durch Verknüpfung besser behalten werden. 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen S e i t e | 50 5.10 Schlaf Ungestörter und ausreichender Schlaf ist eine absolute Voraussetzung für erfolgreiche Lernprozesse, denn „Schlafdefizit=Denkdefizit“ (Medina 2009: 182). Im Schlaf werden vom Hippocampus vorläufig gespeicherte Inhalte in das Langzeitgedächtnis (Cortex) übertragen. Dabei fungiert der Hippocampus „als Lehrer des Kortex“ (Spitzer 2009: 125). Es findet eine off-line Nachverarbeitung („postprocessing“) des Gelernten statt, indem im Tiefschlaf die im Hippocampus frisch gelernten Inhalte erneut aktiviert und abermals dem Cortex übermittelt werden. (vgl. Spitzer 2009: 123ff)) 5.11 Regelmäßige Erfolgserlebnisse schaffen Zur Erhaltung der Motivation gerade bei großen kognitiven Herausforderungen sollten diese in kleine Arbeitsschritte unterteilt werden. So entstehen durch das Erreichen von Teilzielen regelmäßige Erfolgserlebnisse, was wiederum dazu motiviert, das nächste Lernziel zu erreichen. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 12) 5.12 Sich über seine Lernmotive und -ziele im Klaren sein Wer zum Beispiel eine Fremdsprache erlernen will, sollte sich über seine Beweggründe und Lernziele bewusst sein. Nur wer seine Motive kennt, kann die für ein erfolgreiches Lernen notwendige Motivation zur Erreichung seiner Lernziele entwickeln. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 8ff) 5.13 Das Lernplateau verstehen Quelle:: Buzan, Kopftraining (1984) 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen S e i t e | 51 Lernfortschritte erfolgen nicht linear, sondern schubweise. Beim Lernen gibt es Phasen mit großen Lernfortschritten und solche, während denen es scheinbar keine Fortschritte zu geben scheint. Obiges Schaubild illustriert dies: Phase 1: Am Anfang ist der Lernerfolg mühsam, weil man sich zuerst mit den neuen Lerninhalten vertraut machen muss. Phase 2: Der Lernerfolg steigt stetig an, weil einem jetzt die Inhalte vertraut sind. Die Zunahme des Lernerfolgs motiviert zusätzlich, neue Lernziele zu erreichen. Phase 3: Im weiteren Verlauf des Lernens wird häufig das sogenannte Lernplateau erreicht. Auf diesem stagniert der Lernerfolg und es können keine Lernfortschritte mehr festgestellt werden. Dies kann demotivierend sein, zumal bereits erlernte Inhalte sogar wieder vergessen werden. Phase 4: Das Lernplateau wird überwunden und der Lernerfolg macht wieder Fortschritte. Das wiederum motiviert dazu, das angestrebte Lernziel, das volle Verständnis für den Lernstoff, zu erreichen. Das Lernplateau ist ein lernbiologisch notwendiger Vorgang, weil in dieser Phase, durch Veränderung der synaptischen Verbindungen, neue Strukturen im Gehirn gebildet werden. Das Wissen um diesen lernbiologischen Vorgang unterstützt den Lernenden bei der Erreichung seines Lernziels, indem er sich nicht durch den stagnierenden Lernfortschritt demotivieren lässt. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 53) 5.14 Unterrichtspausen einlegen Unser Kurzzeitgedächtnis kann nur eine begrenzte Menge an Informationen aufnehmen. Müssen zu viele Informationen verarbeitet werden, so werden sie einfach verdrängt .Da es sich zudem nur drei bis fünf Minuten konzentrieren kann, sollte der Lehrer spätestens nach fünf Minuten eine kurze Unterrichtspause einlegen. Dafür eignet sich eine Wiederholung des aktuellen Lehrstoffs, ein kleiner Scherz oder die Vorschau auf den weiteren Stundenverlauf. (vgl. Roth 2011: 133,301), Medina 2009: 96ff) (vgl. 5. Beispiele für gehirngerechtes Lehren und Lernen S e i t e | 52 5.15 Pausen beim Lernen machen Quelle: Mantel, Effizienter lernen (1980) Pausen sollten beim Lernen eingelegt werden, damit das Gehirn Zeit (Nachwirkzeit) für Einprägungsprozesse hat. Lernt man dagegen ohne Pausen, so hat das Gehirn keine Ruhe für das nötige „Nachwirken-lassen“. Dies hat zur Folge, dass der neue Lehrstoff das Einprägen des zuvor Gelernten ganz oder teilweise verhindert (rückwirkende Hemmung) und des Weiteren der neue Lehrstoff durch das Nachwirken des zuerst gelernten, nicht eingeprägt werden kann (vorauswirkende Hemmung. (vgl. Frick/Mosimann 2006: 45 Spiele bieten eine gute Möglichkeit zur Wiederholung. Sie fördern das Lernen, denn durch die beim Spielen gemachten Erfolgerlebnisse (positive Gefühle) wird Dopamin ausgeschüttet. Des Weiteren wird die Motivation gesteigert und Lernen wird zu einem multisensorischen Erlebnis. Aus diesen Gründen werde ich im folgenden Kapitel auf den Sinngehalt von Spielen im Sprachunterricht eingehen. 6. Spiele im Sprachunterricht S e i t e | 53 6. Spiele im Sprachunterricht In soziale Situationen eingebundene Lernprozesse sind effektiver (vgl. Roth 2011: 281), denn: „Menschliches Lernen vollzieht sich immer schon in der Gemeinschaft, und gemeinschaftliche Aktivitäten bzw. gemeinschaftliches Handeln ist wahrscheinlich der bedeutsamste „Verstärker“ (Spitzer 2009: 181). Aus neurowissenschaftlicher Sicht stellen Spiele vergleichbare Herausforderungen an das Gehirn wie der Spracherwerb, denn beim Spielen werden ebenfalls immer gleichzeitig mehrere Gehirnareale aktiviert (vgl. Kilp 2010: 31,53). Beim Spielen gelangen Informationen über mehrere Sinneskanäle in das Gehirn (mehrkanaliges Lernen). Dadurch werden eine weitreichende Verknüpfung und damit ein erleichtertes Wiederfinden der aufgenommenen Informationen ermöglicht. „Spielen ist die natürliche, neurophysiologisch verankerte Lerntechnik, die demnach sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen funktioniert“ (Kilp 2010: 45). Obwohl der pädagogische Nutzen von Spielen erwiesen ist, gibt es immer noch Vorurteile gegen deren Einsatz im Unterricht, denn: „noch immer halten viele Lehrkräfte das Spiel für eine wenig seriöse Lernform - falls man dem Spiel überhaupt Lernpotenzial zubilligt deren Wert man sich noch am ehesten für Motivation und Entspannung anerkennt“ Klippel (1983, zit. in Kilp 2010: 16). Aber auch der Mangel an Spielerfahrungen der Lehrenden, die Ungewissheit der Akzeptanz vor allem bei Erwachsenen und ein enger Unterrichtsplan sind weitere Gründe, weshalb Spiele als geeignetes Lernmittel der Fremdsprachenvermittlung noch keinen festen Platz im Unterricht gefunden haben (vgl. Kilp 2010: 65). Aber nicht nur Lehrer stehen dem Einsatz von Spielen skeptisch gegenüber. Gerade bei Erwachsen stößt die Anwendung von Spielen auf Widerstand, obwohl es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Kinder deshalb erfolgreicher lernen, weil sie es spielerisch tun (vgl. dazu Kilp 2010: 47) Gründe für die Ablehnung sind: - Spiele werden von Erwachsenen oft als „Kinderei“ abgetan. - Für Erwachsene gehören Spiele nicht in den Unterricht, sondern in die Freizeit. - Erwachsene denken zweckgebunden und befürchten, sich beim Spielen bloßzustellen. (vgl. Kilp 2010: 42, 65) 6. Spiele im Sprachunterricht S e i t e | 54 Wegen den zu erwartenden Widerständen Erwachsener gegen den Einsatz von Spielen im Unterricht sollte, aus eigenen gemachten Erfahrungen, der Begriff „Spiel“ vermieden werden. Geeignete Umschreibungen sind zum Beispiel: „kommunikative, lernmethodische oder praktische Übung“. 6.1 Welchen Nutzen haben Spiele im Sprachunterricht? - um den Unterricht aufzulockern - um bekanntes Wissen zu wiederholen und dadurch zu festigen - um das Gelernte aktiv anzuwenden - um den Spielteilnehmern ihren jeweiligen Wissensstand aufzuzeigen, denn der Lernerfolg ist immer ein Teil des Spielerfolgs - um Regeln intuitiv zu erfahren - um schwierige Lehrsätze leichter vermitteln zu können (Spiele als Katalysator für Lernprozesse) - um den Lernerfolg zu fördern, denn Spiele steigern die Motivation und regen emotional an - um Aufmerksamkeit zu erwecken - um die Konzentrationszeit zu verlängern - um eine entspannte Lernatmosphäre zu schaffen, durch die Angst und Hemmungen abgebaut werden - um nach Misserfolgen wieder aufzumuntern - um leichter in den Unterrichtsstoff einzusteigen - um das Kennenlernen zu erleichtern (Spiele als „Eisbrecher“) - um als Gruppe leichter zusammen zu wachsen - um soziale Kompetenz zu fördern - um Spannungen und Konflikte abzubauen (vgl. Kilp 2010: 47ff,96) 6.2 Wie sollte sich der Lehrer beim Spielen verhalten? - Er sollte als Motivator die Kursteilnehmer zum Spielen ermutigen. - Er sollte die Rolle des Spielleiters einnehmen. - Er sollte in der Funktion des Beobachters und Schiedsrichters das Spiel leiten. - Er sollte als Moderator korrigierend in das Spiel eingreifen. - Er sollte als Berater für Fragen der Spielteilnehmer fungieren. 6. Spiele im Sprachunterricht - S e i t e | 55 Er sollte am Ende des Spiels eine Fehleranalyse durchführen. (vgl. Kilp 2010: 97ff) 6.3 Geeignete Spiele für den Fremdsprachunterricht Für den Fremdsprachenunterricht geeignete Spiele lassen sich u.a. wie folgt kategorisieren: - Sprachlernspiele: „das Spiel in der Form des Lernspiels besitzt einen anerkannten Wert in der Pädagogik, auch in der Erwachsenenbildung“ (Kilp 2001: 65). Sprachlernspiele sind Spiele, die eine eng umrissene, deutliche sprachliche Zielsetzung haben. Nach Kilp sind Sprachlernspiele „keine Methode, sonder ein Lehr- und Lernmittel in der Methodenvielfalt“ (Kilp 2001: 15). Bei ihnen steht neben der spielerischen Handlung die Festigung sprachlicher Fertigkeiten (Verfestigungslernen) im Vordergrund. Sprachlernspiele sollten in Bezug zu dem jeweiligen Unterrichtsstoff stehen und leicht spielbar sein. Zu den Sprachlernspielen gehören: Brett-, Karten- und Würfelspiele, Rate-, Assoziations- und Erinnerungsspiele, Vokabel-, Sprech-, Lese- und Schreibspiele Löffler (1979: 36, zit. in Kilp 2010: 101ff) Darstellende Spiele: Bei ihnen wird die Fremdsprache mittels Spielens einer Szene oder eines Sketches gelernt. Des Weiteren kommen Theaterspiele und Dialoge zum Einsatz. - Löffler (1979: 36, zit. in Kilp 2010: 101ff) - Interaktionsspiele: Bei diesen Spielen stehen sprachliche und außersprachliche Interaktionen (Wechselbeziehung zwischen Personen) im Vordergrund. Zu ihnen gehören Rollen-, Simulations- und Kooperationsspiele. - Löffler (1979: 36, zit. in Kilp 2010: 101ff) Schlussbemerkung S e i t e | 56 Schlussbemerkung Ziel meiner Hausarbeit war aufzuzeigen, wie Erkenntnisse der Gehirnforschung in die Praxis des Lehrens und Lernens umgesetzt werden können. Mir war durchaus bewusst, dass zu einem optimalen Lernprozess mehr gehört als nur das Wissen über die Anatomie und die Funktionsweise des Gehirns. Jedoch gibt es durchaus Erkenntnisse der Gehirnforschung, die ein erfolgreicheres Lehren und Lernen unterstützen können. Wie diese Unterstützung in der Praxis aussehen kann, wurde von mir anhand mehrerer Beispiele beschrieben. Zuvor erläuterte ich zum besseren Verständnis unseres Gehirns dessen Anatomie und Funktionsweise. Anschließend behandelte ich folgende Themen: - die Informationsverarbeitung im Gehirn - die verschiedenen Gedächtnisformen, wobei speziell das Langzeitgedächtnis für Lernprozesse von großer Bedeutung ist - die unterschiedliche Lebensdauer von Gedächtnisinhalten - die grundlegende Bedeutung von Aufmerksamkeit, Motivation und Emotionen für erfolgreiche Lernprozesse - die verschiedenen Lerntypen nach Wahrnehmungssinn und Lernstil - die spezifischen Lernbedingungen älterer Menschen Im letzten Kapitel wurde der pädagogische Nutzen von Spielen im Fremdsprachenunterricht beschrieben. Ich hoffe, durch meine Hausarbeit Interesse für die Neurodidaktik geweckt zu haben, denn es „ist unbestritten, dass die Neurowissenschaften das naturwissenschaftliche Fundament für die Psychologie des Lehrens und Lernens schaffen können“ (Roth 2011: 283). Als Anhang werde ich ein von mir speziell für das Wiederholen von Verben modifiziertes Spiel vorstellen. Bibliographie S e i t e | 57 Bibliographie Aamondt, S. und Wang, S. (2008) :Welcome to your brain, München Bonhoeffer, T., Gruss, P. (Hg.). (2004): Zukunft Gehirn, Berlin Buzan, T. (1984): Anleitung zum kreativen Denken, Tests und Übungen, München Chalvin, M. J. (1993): Deux Cerveaux pour la classe, France. Fiedler, K. (1988): Emotional mood cognitive style and behavior regulation. In: Fiedler, K., Forgas J. P. Affect, cognition and social behaviour, Toronto. Frick, R., Mosimann, W. (2006): Lernen ist lernbar, Oberentfelden, Schweiz. Kilp, E. (2003): Spiele für den Fremdsprachenunterricht. Aspekte der Spielandragogik, Tübingen. Klippel, F. (1998): Spielend lernen: Lernspiele im Fremdsprachenunterricht, Frankfurt Kolb, D. (1981): Learning Styles and Disciplinary Differences, In: Chickering, Arthur, W.: The Modern American College. San Fransisco / Washington / London. Löffler, R. (1979): Spiele im Englischunterricht, München. Grein, M. (2012): Hand-out: Sprachenlernen und Gehirn. Mainz. Mantel, M. (1990): Effizienter Lernen, München Medina, J. (2009): Gehirn und Erfolg: 12 Regeln für Schule, Beruf und Alltag, Heidelberg Bibliographie S e i t e | 58 Roth, G. (2009): Aus Sicht des Gehirns, Frankfurt Roth, G. (2011): Bildung braucht Persönlichkeit: Wie Lernen gelingt, Stuttgart Spitzer, M. (2004): Selbstbestimmen. Gehirnforschung und die Frage: Was sollen wir tun? Heidelberg Spitzer, M. (2009): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg Squire, L.R., Kandel, E.R. (2009): Gedächtnis, die Natur des Erinnerns, Heidelberg Vester, F. (1998): Denken ,Lernen, Vergessen, München Anhang S e i t e | 59 Anhang Eines der von mir für den Fremdsprachenunterricht modifizierten Spiele ist das Würfelspiel „Parqués“. Es wird in Südamerika gespielt und ähnelt dem „Mensch ärgere Dich nicht“. Dieses Spiel eignet sich speziell zum Wiederholen von Verben. Die Spielschritte im Einzelnen: 1.Schritt: Da nur bis zu vier Teilnehmer gleichzeitig spielen können, teile ich die Klasse in entsprechende Gruppen ein. Jede Gruppe erhält ein Spiel. 2.Schritt: Jede Spielgruppe bekommt eine Liste mit 67 regelmäßigen Verben ausgehändigt. Die von 1-67 durchnummerierten Verben werden jeweils von den entsprechenden weiß unterlegten Spielfeldnummern repräsentiert. So steht beispielsweise das Spielfeld mit der Nummer 3 für das an dritter Stelle aufgelistete Verb. 3.Schritt: Jeder Mitspieler erhält eine individuelle Liste mit neun durchnummerierten, unregelmäßigen Verben, die von den farbigen neun Spielfeldern (farbiger Pfeil, einschließlich dem grauem Spielfeld) repräsentiert werden. 4.Schritt: Jedem Spielteilnehmer wird eine Spielfarbe zugewiesen. 5.Schritt: Gespielt wird mit zwei Würfeln. Um auf die Ausgangsposition zu gelangen, müssen mit zwei Würfeln identische Zahlen gewürfelt werden. Danach würfelt der Spieler mit einem Würfel weiter, um vorrücken zu können. Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn. Hat der Spieler ein Spielfeld erreicht, ordnet er dessen Nummer dem entsprechenden regelmäßigen Verb auf der Liste zu. Nachdem dieses richtig in die Zielsprache übersetzt worden ist, muss ein zweites Mal gewürfelt werden. Die dabei erhaltene Zahl steht für ein Pronomen, beispielsweise die Zahl 4 für „wir“. Das zuvor übersetze Verb ist entsprechend zu konjugieren. Anhang S e i t e | 60 6.Schritt: Erreicht der Spieler eines der farbige Spielfelder (farbiger Pfeil) wird nun unter Verwendung der Liste mit den unregelmäßigen Verben das Spiel entsprechend bis zur Erreichung des Spielziels (farbiges Dreieck) weitergespielt. Bei falscher Übersetzung oder Konjugation muss eine Würfelrunde ausgesetzt werden. S e i t e | 61 Erklärung: Hiermit versichere ich an Eides statt und durch meine Unterschrift, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig, ohne fremde Hilfe angefertigt worden ist. Inhalte und Passagen, die aus fremden Quellen stammen und direkt oder indirekt übernommen worden sind, wurden als solche kenntlich gemacht. Ferner versichere ich, dass ich keine andere, außer der im Literaturverzeichnis angegebenen Literatur verwendet habe. Diese Versicherung bezieht sich sowohl auf Textinhalte sowie alle enthaltenen Abbildungen, Skizzen und Tabellen. Die Arbeit wurde bisher keiner Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Stadt/Datum/Unterschrift…………………………………………………