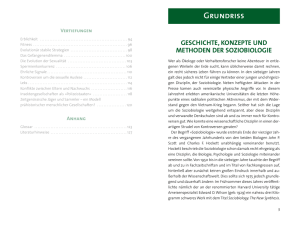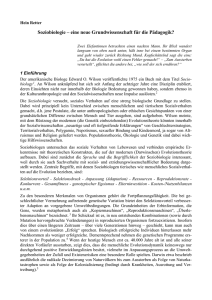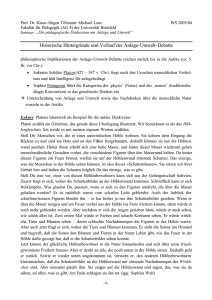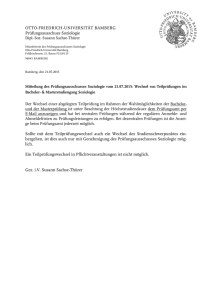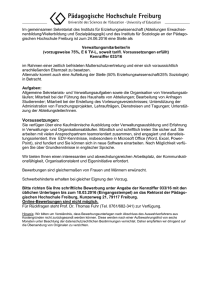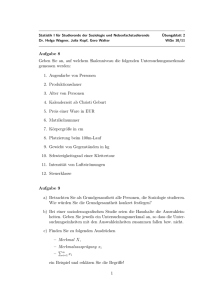Die (biologische) Natur des Menschen: Soziobiologie
Werbung

Erscheint in: Becker, R.; Fischer, J.; Schloßberger, M. (Hg.): Philosophische Anthropologie im Aufbruch. Max Scheler und Helmuth Plessner im Vergleich, Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie, Bd. 2, Berlin: Akademie Verlag (2009) Nico Lüdtke Die (biologische) Natur des Menschen: Soziobiologie – Philosophische Anthropologie – Soziologie Besprechungsessay zu: Matthias Groß: Natur, Bielefeld: transcript Verlag 2006 Sebastian Linke: Darwins Erben in den Medien. Eine wissenschafts- und mediensoziologische Fallstudie zur Renaissance der Soziobiologie, Bielefeld: transcript Verlag 2007 Eckart Voland: Die Natur des Menschen. Grundkurs Soziobiologie, München: Verlag C. H. Beck 2007 Thomas P. Weber: Soziobiologie, Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2003 Franz M. Wuketits: Was ist Soziobiologie?, München: Verlag C. H. Beck 2002 Die Herausforderung einer naturalistischen Fundierung der Sozial- und Humanwissenschaften besteht im Grunde seit Beginn des 20. Jahrhunderts – im Fall der Soziologie seit Anbeginn ihrer Institutionalisierung in Form einer eigenständigen Disziplin. Seit einiger Zeit – zumindest im deutschen Sprachraum – scheint die Problematik besondere Aktualität zu besitzen. Davon zeugen eine Reihe von Veröffentlichungen der letzten Jahre, die eine allgemeine Sensibilisierung in den wissenschaftlichen Diskursen widerspiegeln. Als zentraler Indikator für diese Entwicklung innerhalb der Soziologie kann der 2006 abgehaltene 33. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie mit dem Titel „Die Natur der Gesellschaft“ angesehen werden. Im Zentrum der Diskussionen stand u.a. der von den Naturwissenschaften (besonders der Biologie) formulierte Anspruch auf Deutungshoheit gegenüber sozial- und humanwissenschaftlichen Ansätzen – verbunden mit der (insb. für die Soziologie1) provokativen Prämisse, menschliche Gesellschaft als Naturphänomen erklären zu wollen (vgl. exemplarisch Mayntz 2006). Neben den Herausforderungen durch Humangenetik und Hirnforschung, die Gegenstand sehr zahlreich und intensiv geführter Auseinandersetzungen waren und sind, wird ein biologischer Ansatz unter der Bezeichnung ‚Soziobiologie‘ diskutiert. Bereits in den 1970’er Jahren war hierzu heftig gestritten worden. Grund für die damalige Kontroverse war das monumentale Werk von Edward O. Wilson, vor allem der darin enthaltende Versuch einer biologischen Deutung menschlichen Sozialverhaltens. Dessen ambitioniertes Ziel war es, sämtliche Geistes- und Sozialwissenschaften in die Soziobiologie integrieren zu können. Neben Wilsons’ „Soziobiologie“ von 1975 war Richard Dawkins ein Jahr später mit der Theorie des egoistischen Gens maßgeblich für das soziobiologische Bild einer ‚Natur‘ des Menschen. Die besondere Rolle von Genen in der Evolution wurde bereits seit den sechziger Jahren diskutiert. Dawkins machte jedoch den Ansatz einem breiten Publikum zugänglich. In aller Kürze lässt sich sagen, dass die Soziobiologie, ausgehend vom Darwinistischen Paradigma, Verhaltensvarianten im Sinne einer Erblichkeit von Verhaltensmerkmalen erklärt. Grundlage sind, wie in der Ethologie, Verhaltensbeobachtungen, jedoch steht nicht die Beschreibung von Einzelindividuen im Mittelpunkt, sondern die Analyse von evolutivem Wandel. Bei der Untersuchung der evolutionären Funktion von Verhaltensweisen wird von einer gen-egoistischen Anpassung ausgegangen. Die klassische Verhaltensforschung konnte mit dem Bild egoistischen Fortpflanzungsverhaltens eines Individuums (‚survival of the fittest‘) nicht erklären, warum etwa dessen Fortpflanzung nicht unbegrenzt stattfindet, drastische Konflikte zwischen Individuen einer Art bestehen oder warum und unter welchen Umständen es zu Kooperationen kommt – alles Fragen, die von der Soziobiologie aufgegriffen wurden. Wilson beschrieb altruistisches Verhalten als zentrales Problem der Soziobiologie. In der soziobiologischen Theorie des egoistischen Gens (Dawkins) werden Individuen zu Vehikeln genetischer Reproduktionsstrategien. Damit lässt sich Altruismus als Programm egoistischer Gene erklären. Gene, deren Träger die individuellen Lebewesen sind, werden dadurch gleichsam zu Subjekten der Evolutionsgeschichte. Egoistische wie altruistische Verhaltensweisen können auf diese Weise als evolutionär wirksame Strategien mithilfe spieltheoretischer Modelle beschrieben werden. Angesichts verschiedener, aktuell erschienener Publikationen kann die Frage aufgeworfen werden, ob gut 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Wilsons „Sociobiology. The New Synthesis“ (1975) sowie Dawkins’ „The Selfish Gene“ (1976)2 von einer Renaissance der Soziobiologie gesprochen werden kann. Zum Thema sind im Abstand weniger Jahre drei Einführungsbände von Eckart Voland, Thomas P. Weber und Franz M. Wuketits erschienen. Voland und Wuketits haben sich bereits in der Vergangenheit mit verschiedenen Publikationen zum Thema hervorgetan. Beide stehen in der Tradition des soziobiologischen Ansatzes von Wilson. Wie schon Wilson sind Wuketits und Voland von Hause aus Biologen, haben sich aber seit Jahren mit Philosophie und 1 Vergleichbare Debatten lassen sich auch in der Philosophie beobachten. Dass die Bestimmung des Menschen unter der Perspektive des (vermeintlichen) Gegensatzpaars ‚Natur‘ und ‚Kultur‘ ein kontrovers diskutiertes Thema ist, davon zeugen bspw. unlängst thematische Schwerpunkte in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. 2 Beide Monografien sind inzwischen als Jubiläumsausgaben neu aufgelegt worden. 1 Wissenschaftstheorie der Biowissenschaften beschäftigt. Weber, selbst auch Biologe, markiert dagegen eine weniger affirmative Position. Auf den ersten Blick zeigen die Bücher von Wuketits und Weber eine ähnliche Struktur. Weber gibt auf knapp einhundert Seiten einen Abriss der Geschichte und der Kernaussagen der Soziobiologie, im zweiten Teil werden verschiedene Themen eingehender behandelt. Auch Wuketits gibt in vergleichbarem Umfang einen Überblick über die wichtigsten soziobiologischen Themenbereiche (Gruppenleben, zweigeschlechtliche Fortpflanzung und Partnerfindung, Jungenaufzucht). In der Art und Weise, wie die Übertragung von Untersuchungsergebnissen aus der Tierwelt auf menschliches Verhalten thematisiert wird, zeigen sich hingegen deutliche Differenzen in den Positionen der Autoren. Gleich zu Beginn seines Buches „Was ist Soziobiologie?“ kritisiert Wuketits an den Sozialwissenschaften und der Philosophie, dass deren Menschenbilder die Einsichten Darwins ignorieren würden; wohingegen das Grundverständnis der Soziobiologie, dass „menschliche Sozialstrukturen im Wesentlichen nach den gleichen Mustern wie tierische gestrickt und – selbst in ihren komplexen Ausdrucksformen, etwa im Moralverhalten – auf evolutive, genetische Grundlagen zurückzuführen seien“, zutreffender sei (12). „Alle Formen des Sozialverhaltens“ in der Tierwelt und auch „die komplexen sozialen Beziehungen auf dem Niveau des Menschen“ könnten „nur auf dem Boden der Evolutionstheorie hinreichend“ – im Sinne kausaler Erklärungen – verstanden werden (15f). Dennoch will Wuketits vermeiden, eine bloße biologistische, gen-deterministische Sichtweise auf soziale Verhaltensweisen anzuempfehlen (13, 72ff.). In den einzelnen Kapiteln des Buches wird die soziobiologische Methode vorgeführt: In vergleichender Perspektive werden aus den Ergebnissen von Einzelanalysen allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Evolution herauszuarbeiten versucht. Dazu werden Verhaltensbeobachtungen verschiedenster, beispielhafter Tierarten, wie Bienen, Ameisen, Wölfe, Paviane, Pinguine usw. usf., mit spezifisch menschlichen Phänomenen zusammengeführt. Dass dieses Vorgehen höchst selektiv verfährt und mögliche Inkonsequenzen in diesem homogenisierten Bild evolutiver Strategien vernachlässigt werden, problematisiert Wuketits nicht. An vielen Stellen, wo solche Irritationen auftauchen könnten, arbeitet Wuketits mit Alltagsevidenzen und Einzelbelegen, um Aussagen zu plausibilisieren. Etwa wird argumentiert, dass sich Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern als Wettbewerb aufgrund unterschiedlicher Fortpflanzungsinteressen darstellen lassen: Beim Menschen sei entscheidend, dass Männer im Laufe ihres Lebens wesentlich mehr Nachkommen zeugen können als Frauen; bei Säugetieren und Vögeln kommt dann die besondere Bedeutung des Werbens um Weibchen hinzu. Wuketits schlussfolgert, dass der Wettbewerb der Geschlechter davon bestimmt sei, die eigenen Gene in die nächste Generation zu bringen. Innerhalb dieses Konflikts gehe es dann „oft nicht sehr ‚vornehm‘ zu“ (40). Hierbei hätte die Frage, ob von artspezifischen Verhaltensweisen bei Pfauen, Löwen oder Hirschen auf die Geschlechterfrage beim Menschen geschlossen werden kann und ob sich überhaupt ein allgemeines durchgehendes Muster im evolutionstheoretischen Stammbaum auffinden lässt, angesichts der (gerade im Diskurs um die Soziobiologie) brisanten Thematik eine intensivere Betrachtung verdient. Die Frage der adäquaten Übertragbarkeit stellt sich darüber hinaus, wenn bspw. die Situation einer Mutter mit Kind am Süßwarenregal mit der Brut- und Nestpflege bei Vögeln in Beziehung gebracht wird, um eine allgemeine Erklärung von Eltern-Kind-Konflikten zu geben; oder wenn Kooperation und Arbeitsteilung auf der Grundlage von Beobachtungen kooperativer Tendenzen im Tierreich etwa (im Anschluss an Wilson) bei Ameisen erklärt werden (52f.); gleiches gilt für Altruismus, Empathie und soziale Intelligenz (67ff.). Immer gehe es letztlich nur darum, Fortpflanzungstrategien zu erkennen, bei denen (gen-egoistische) Kosten-Nutzen-Kalkulationen Anwendung finden: Soziale Verhaltensmuster seien „letztlich nur aus dem Umstand erklärbar, daß jedes Lebewesen im Dienste seines Überlebens seine eigenen Gene weitergeben ‚will‘“ (72). Wuketits akzentuiert, dass für den Menschen und sein Verhalten die gleichen Prinzipien gelten würden wie bei anderen (sozialen) Spezies: „Es gibt keinen Grund, für ihn weiterhin eine ‚Sonderstellung‘ in der Organismenwelt zu reklamieren“ (80). So sei der Grundsatz der Humansoziobiologie durchaus angemessen, bei der Erklärung gesellschaftlicher Formen wie Politik und Staat, Moral und Recht sowie bei Aggression, Gewalt und Verbrechen auf die besondere Bedeutung der natürlichen Erbanlagen zu fokussieren; denn sämtliche Ausprägungen der menschlichen Kultur könnten „auf eine biologische Basis zurückgeführt werden“ (95) – Kulturwelt als Resultat mannigfacher biologischer Funktionen im menschlichen Fortpflanzungssystem. Weber beurteilt in seinem Buch, das einfach mit „Soziobiologie“ betitelt ist, die Plausibilität solcher Schlussfolgerungen anders. Er sieht es als begründet an, dass die Erklärungsversuche, die sich auf das Tierreich beziehen, nicht einfach auf die spezifischen Problemstellungen von menschlichen Verhaltensformen bezogen werden können. Diese Unterscheidung rechtfertige sich durch die besondere Bedeutung des Phänomens des kulturellen Wandels. An dieser Stelle grenzt sich Weber deutlich von Biologen ab, die diese Demarkation nivellieren. Entsprechend nimmt er die Darstellung des soziobiologischen Blicks auf den Menschen mit der Motivation vor, die „Grenzen dieser Betrachtungsweise aufzuweisen“ (70). Ein großes Problem der Humansoziobiologie sei die Inadäquatheit der Modelltiere. Solche „stammesgeschichtlich zweifelhaften Vergleiche“, wie Wilsons Analogie von menschlichen Gesellschaften und Ameisenstaaten, würden „seit der Pionierarbeit Jane Goodalls an Schimpansen in Tansania keine sonderlich 2 große Legitimität mehr“ besitzen (71). Unklar sei dennoch, welche Primatenart am geeignetsten ist, um das soziale Leben der Menschen zu modellieren. Weber stellt damit solche Ergebnisse grundsätzlich infrage, die in Übertragung aus Experimenten oder Beobachtungen mit Tieren gewonnen werden. Des Weiteren gerate die soziobiologische, gen-egoistische Forschungslogik aufgrund der Bedeutung spezifisch kultureller Prägung in Nöte. Wie Weber u.a. anhand des Paarungsverhaltens des Menschen zeigt, können Gene nicht als deterministische Faktoren angesehen werden, da deren Wirkung durch die soziale Umwelt überformt sei (24): „Das ‚Vererbungssystem‘ Kultur arbeitet nicht notwendigerweise im Interesse von Genen“ (85). Diese Kritik wiegt schwer, da die Soziobiologie ihre besondere, provokative Bedeutung gerade dadurch erlangt, dass sie die Entwicklung verschiedener Formen von Sozialverhalten als Evolution von Reproduktionsstrategien erklären will (5). Eine genetische Determination sei aber nicht belegbar (auch Wuketits spricht an solchen Stellen eher vorsichtig von ‚Disposition‘), sodass letztlich unklar ist, ob bzw. inwieweit sich Erbanlagen auf die kulturelle Evolution auswirken. Insgesamt bewertet Weber deshalb die eigentliche Kontroverse um die Soziobiologie als erloschen, nur „einige hitzköpfige Verteidiger und Kritiker“ würden noch die „Deutungsvormacht“ reklamieren (82).3 Fast liest es sich als Entwarnungsmeldung in Richtung Sozialwissenschaften: „In der Biologie konzentrieren sich die meisten Wissenschaftler auf das Studium von Tieren und meiden den Menschen als Untersuchungsobjekt“ (83). Weber macht unmissverständlich klar, „dass die Soziobiologie Wilson’scher Prägung ernsten und legitimen methodischen und konzeptuellen Kritiken ausgesetzt ist, die sich beim Studium des Menschen besonders deutlich zeigen“ (83). Auch Weiterentwicklungen unter den Bezeichnungen ‚Evolutionäre Psychologie‘ oder ‚Memetik‘ böten „oft nur plausibel klingende Geschichten als Erklärungen an, die kaum experimentellen oder vergleichenden Überprüfungen unterzogen werden können“ (93) – so lautet Webers abschließendes Urteil aus seiner Sicht als Biologe. Die Evolutionäre Psychologie sei infolgedessen – trotz „großer Beliebtheit auf dem Markt populärer Sachbücher“ (89) – wenig anerkannt in der akademischen Evolutionsbiologie. Aus geradezu sozialwissenschaftlicher Perspektive formuliert, gibt Weber abschließend zu bedenken: „Humansoziobiologie und Evolutionäre Psychologie versuchen zu zeigen, was angeblich die wahre, von einem kulturellen Überbau nicht verunreinigte Natur des Menschen ist. Dabei übersehen die Vertreter dieser Disziplinen nur allzu oft, dass Kultur und die Fähigkeit zum kulturellen Wandel ebenfalls ein fundamentales Element des menschlichen ‚Naturzustandes‘ ist“ (93).4 Entgegen Webers fast schon emphatischer Verteidigungsrede der Relevanz von sozial- und humanwissenschaftlicher Forschung und der Mahnung, die Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten der Biologie zu berücksichtigen, sieht Voland – entsprechend der Losung, die er in einer populären Abhandlung ausgegeben hat: „Die Soziobiologie räumt kräftig auf mit der vermeintlichen Sonderstellung des Menschen im Reich der Organismen“ (Voland 2000, VII) – die Adäquatheit der Übertragung von tierischem Sozialverhalten auf den Menschen nicht nur nicht infragegestellt, sondern legt direkt eine naturalistische Beschreibung der conditio humana vor. Das Buch von Voland „Die Natur des Menschen“ ist anders aufgebaut als die beiden vorigen Einführungen. Es basiert auf einer Serie von Aufsätzen, die unter den Titel „Grundkurs Soziobiologie“ von Mitte 2006 bis Anfang 2007 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Die Struktur dieser Einzelessays ist im Buch beibehalten worden. Voland geht von der These aus, dass sich alle sozialen Formen der menschlichen Kultur als biologisches Evolutionsgeschehen in „Darwins große Welterklärung einfügen“ lassen können müssen (13); denn der „Naturgesetzlichkeit der natürlichen Selektion ist nicht zu entkommen“ (12). Die gen-egoistische Sichtweise der Soziobiologie lasse alle sozialen und kulturellen Sachverhalte als „Spiel der Evolution“ erscheinen, in dem es „einzig um den Ausbreitungserfolg biologischer Programme“ geht (14). Voland zufolge können Gesellschaftsentwicklungen als Teil der Evolutionsgeschichte erklärt werden. Grundsätzlich verfährt er dabei so, dass er komplexe Sachverhalte simplifiziert, um sie mit dem einfachen soziobiologischen Vokabular zusammenzubringen. So wird etwa das Problem der sozialen Ordnung und der gesellschaftlichen Integration sowie die Bedeutung von Moral5 als spieltheoretische Kooperationsstrategie modelliert (Kap. 2, 3, 15, 16). Das Phänomen des sozialen Status in der Moderne wird mit Fortpflanzungserfolg in Verbindung gebracht und als frühgeschichtlich evolutionäre Funktion beschrieben (Kap. 5). Die Konflikte der Geschlechterdifferenz werden auf eine „Asymmetrie der Kosten für Fortpflanzung“ zurückgeführt (50), weshalb Frauen und Männer ungleiche „Marktpositionen“ im „Fortpflanzungwettbewerb“ besitzen und unterschiedliche (evolutionär geformte) Strategien für reproduktiven Erfolg verfolgen würden (Kap. 6). Die Folge seien 3 Am Beispiel des Terrorismus will Wuketits etwa verdeutlichen, dass soziobiologischen Analysen ein Primat gegenüber sozialwissenschaftlicher Forschung zukommt, weil „tiefer“ angesetzt und die Entstehung von Verhaltensweisen begründet werden könne: Sozialwissenschaften würden lediglich „proximate“ Erklärungen aus der politischen Situation und den sozialen wie ökonomischen Bedingungen einer terroristischen Gruppe ableiten, aber nicht erklären können, „warum Menschen grundsätzlich und überhaupt […] Terroranschläge zu verüben bereit sind. Die Soziobiologie liefert die ultimative Erklärung: Indem sie in der Tiefe unserer Natur verwurzelte Verhaltensantriebe offen legt, zeigt sie sozusagen die Letztursachen für ein Verhalten auf“ (91). Das Phänomen lasse sich anhand des biologische Nutzens erklären, als Steigerung des Fortpflanzungserfolgs der Gruppe genetisch verwandter Individuen. 4 Diese Einsicht entspricht der in der Soziologie weitverbreiteten Vorstellung von ‚Kultur‘ als vom (weltoffenen) Menschen selbst geschaffene ‚zweite Natur‘. 5 Dass Voland in diesem Zusammenhang auf Moral und deren sozialer Funktion zu sprechen kommt, ist nicht zufällig: Émile Durkheim und später Talcott Parsons sahen in der moralischen Grundordnung die Bedingung für die Möglichkeit sozialer Ordnung. 3 verschieden ausgeprägte Geschlechterrollen und Formen von Partnerwahl, Familienkonstellationen und Kindeserziehung, denen aber letztlich immer gen-egoistische Mechanismen zugrunde liegen würden (Kap. 713). Dem ökonomischen Prinzip der Evolution mit der „darwinistischen Nutzenfunktion“ könne nichts entkommen (126). Auch Religiosität nicht (Kap. 14). Deren Funktion sei die Stabilisierung von Kooperationen: Gottesgläubigkeit diene der „moralischen Disziplinierung der Gruppenmitglieder“ (119). Außerdem wirke sich Religion „nützlich“ auf Gesundheitszustand und Reproduktionserfolg aus. Menschliche Rationalität wird als Epiphänomen der Verhaltenssteuerung beschrieben, die durch die „Maschinerie“ der evolutionären „Weisheit“ bewirkt wird (144), und auch Emotionen wird eine evolutionäre Funktion attestiert (Kap. 17). Abschließend will Voland die in den Sozial- und Humanwissenschaften vorherrschende Grundvorstellung einer ‚Weltoffenheit‘ des Menschen als Fiktion entlarven (Kap. 18). Lernfähigkeit und Kognition seien – was an dieser Stelle nun nicht mehr überrascht – evolutionäre Strategien für adaptive Probleme: „Man lernt nur, wozu man in langen Evolutionsprozessen eingerichtet wurde, dass man es lernt“ (154). ‚Kultur‘ als Charakteristik des Menschen, „außergewöhnlich lernfähig zu sein“, gehe in dem „biologischen Imperativ“ auf, da „Lernprozesse […] von der natürlichen Selektion hervorgebracht“ worden seien (156). Ob diese Beschreibungen überzeugen können, mag bezweifelt werden. Eher tun sich Fragen auf, als dass man durch das Buch von Voland Antworten bekommt. Denn das Niveau der Problemstellungen in der Philosophie und Soziologie findet in den Darstellungen keinen rechten Widerhall. Dies mag dem feuilletonistischen Schreibstil geschuldet sein; angesichts der Unterkomplexität der Erklärungen leidet jedoch deren Plausibilität beträchtlich. Dies lässt sich an einem symptomatischen Beispiel verdeutlichen. Die Darstellung der besonderen Bedeutung der genetischen Verwandtschaft bildet den Ausgangspunkt und zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch. Verwandtschaft (als biologische Kategorie) sei verhaltensbestimmend und stehe im engen Zusammenhang mit sozialem Zusammenhalt und Führsorge bei Menschen (und bei Tieren). Sie sei entscheidend „für die Entstehung komplexer Sozialsysteme“ und auch in der Moderne wirksam (15f.). An dieser Stelle wird die Schwierigkeit in der Schilderung deutlich: Hier wird der Anspruch vertreten, gesellschaftliche Entwicklung erklären zu können; die Beschreibung bricht aber weit unterhalb der Komplexität dieses Problems ab. Der Zusammenhang von Verwandtschaft und familiärer Solidarität erklärt nicht die Evolution komplexer sozialer Strukturen. Wie erklärt werden kann, wie die gesellschaftliche Entwicklung verlaufen ist von segmentären (sog. primitiven) Gesellschaften, die in Familienclans organisiert waren, zur modernen Gesellschaft, die sich durch funktionale Differenzierung (Parsons, Luhmann) oder als Zivilisationsprozess (Elias) charakterisieren lässt, wo im Zuge von Individualisierungstendenzen der Familienzusammenhang zunehmend an Bedeutung verliert, diese Frage, die ein Kernproblem der Soziologie darstellt, kann mit den einfachen Konzepten der Humansoziobiologie nicht bearbeitet werden. Voland lässt den Leser im Unklaren darüber, ob er letztlich einer „Steinzeitpsychologie“ (43) nachgehen will, die für die komplexen Strukturen der Moderne keine Anwendung finden kann, oder ob die evolutive Universalgeschichte des Menschen bis in die Gegenwart gezeichnet werden soll. Dem formulierten Anspruch nach vertritt er Letzteres, den Möglichkeiten nach gehen die Erklärungen zumeist nicht über den ersten Punkt hinaus, sodass fraglich ist, welche Erklärungskraft der Ansatz für die moderne Gesellschaft (insb. Makrostrukturen) überhaupt besitzen kann. Insofern ist vielleicht die Einschätzung von Weber zutreffend, dass die Soziobiologie für die Human- und Sozialwissenschaften nicht (mehr) als ernst zu nehmende Herausforderung anzusehen ist. Wie werden die Ergebnisse der Soziobiologie in der Soziologie selbst bewertet? Erste Antworten darauf kann das Buch von Matthias Groß mit dem Titel „Natur“ geben.6 Groß zeichnet eine Reihe von Aspekten nach, die auch beim oben genannten Soziologiekongress erörtert wurden. In sieben einführenden Kapiteln versucht der Autor darzustellen, dass insb. die Auseinandersetzung mit Naturkonzepten maßgeblich für das Verständnis des Sozialen und in diesem Zusammenhang die Gegenüberstellung von Natur und Gesellschaft prägend für die Bildung der Soziologie als Disziplin war. Zur Identitätsbildung der Soziologie beigetragen habe vor allem die Grenzbildung gegenüber einem unsoziologischen Bereich, in Form von Auseinandersetzungen mit der äußeren Natur als auch mit der innere Natur des Menschen. Neben bestimmten Formen des Darwinismus (Sozialdarwinismus) zu Beginn des 20. Jahrhunderts seien Diskussionen über die natürlichen Grundlagen menschlichen Sozialverhaltens vor allem durch den soziobiologischen Ansatz ausgelöst worden. Abgelehnt worden sei in den Sozialwissenschaften vor allem die Sichtverweise, soziale Sachverhalte kausal durch physikalische und chemische Prozesse erklären zu können. Die genetische Ausstattung des Menschen sei lediglich als biologische Vorbedingung angesehen worden, aber nicht von entscheidender Bedeutung für die Erklärung des Variantenreichtums kultureller bzw. gesellschaftlicher Formen. Einen „Einzug der Soziobiologie in die Soziologie“ habe es im Grunde nicht gegeben, was vor allem einem vorherrschenden Anthropozentrismus und der Vorstellung einer Sonderstellung des Menschen als Kulturwesen geschuldet sei, konstatiert Groß (18). An dieser ablehnenden Haltung habe sich trotz Weiterentwicklungen des soziobiologischen Ansatzes nichts Grundsätzliches geändert. 6 Anders als im angloamerikanischen Raum, gab es vonseiten der deutschen Soziologie lange Zeit kaum explizite Auseinandersetzungen mit der Soziobiologie. Einen Überblick hierzu gibt Richter (2005). 4 Ob natürliche Anlagen oder gesellschaftliche Prägung entscheidend sind, diese Frage habe im Zusammenhang der Diskussion der Unterschiede der Geschlechter eine große Rolle gespielt – insb. durch solche biologischen Ansätze, die die Ungleichheit der Geschlechter als eine Folge natürlicher Unterschiede (und damit als unabänderlich) zu erklären versuchten. Groß kommt allerdings zu dem Schluss, dass – entsprechend der allgemeinen Tendenz – auch in diesem Bereich weitestgehend Distanzierung der Soziologie gegenüber biologischen Erklärungsansätzen vorherrschte oder eine Soziologisierung solcher Fragestellungen angestrebt wurde. In weiteren Kapiteln zeichnet Groß nach, dass die Vorstellung der Gesellschaft als Organismus prägend für die frühe Soziologie war; dass Soziologie nicht nur in Auseinandersetzung mit der Biologie, sondern auch mit der Geografie und Ökologie stattgefunden hat; wie sich im Rahmen der Wissenschafts- und Technikforschung ein Ansatz unter der Bezeichnung Actor-Network-Theory (ANT) entwickelt hat, der das Verhältnis von Menschen, Technik und Natur radikal neu formuliert hat, um soziale Prozesse (insb. wissenschaftliche Wissensgenerierung) zu beschreiben; und schließlich, wie sich die Subdisziplin Umweltsoziologie herausgebildet hat, die die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und ihrer natürlichen Umwelt untersucht. Insgesamt gibt das Buch einen guten Einblick in soziologische Auseinandersetzungen mit dem Thema ‚Natur‘ mit dem Ziel dies als einen klassisch und genuin soziologischen Gegenstand deutlich werden zu lassen. Entsprechend der Grundthese des Buches: „Soziologie kann Gesellschaft nur über den Bezug zu Natur verstehen“ (5), wird, statt einer frontalen Gegenüberstellung von ‚Gesellschaft‘ bzw. ‚Kultur‘ zu ‚Natur‘, die enge Verwobenheit beider Bereiche akzentuiert. Die Bedeutung der Beschäftigung mit der physischen Dimension des Sozialen hervorgehoben zu haben, ist nicht zuletzt deswegen verdienstvoll, da dies allzu oft in soziologischen Forschungen ausgeblendet wird, wenngleich eine stärkere Fokussierung auf anthropologische Fragen wünschenswert gewesen wäre. In dem Buch „Darwins Erben in den Medien“ von Sebastian Linke scheinen sich die Einschätzungen von Weber und Groß bezüglich der gescheiterten Inkorporation der Sozialwissenschaften durch die (Sozio-)Biologie zu bestätigen. Linke zufolge könne die Soziobiologie alles andere als eine Erfolgsgeschichte vorweisen (11f.). Es scheint also tatsächlich angemessen zu sein, von einer erloschenen wissenschaftlichen Kontroverse zu sprechen. Dennoch lasse sich – so Linke – aktuell eine „Konjunktur naturalistischer Deutungsmuster“ beobachten (9), die sich in einer spezifischen „Dynamik in der medialen Darstellung der Soziobiologie“ (15) äußert. Ausgehend von diesem überraschenden Befund fragt Linke, wie „die Vermittlung eines so problematischen Konzepts wie das der Soziobiologie zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit erfolgte“ (16). Um die Beziehung der wissenschaftsinternen Thematisierung der Soziobiologie und deren Rezeption in der massenmedialen Kommunikation zu beleuchten, vergleicht die Studie eine Auswahl wissenschaftlicher Publikationen und deutscher Printmedien aus den Jahren 1975 bis 2003. Linke gibt zu Beginn einen instruktiven Überblick darüber, wie der Ansatz in die Krise geraten ist (Kap. 2): einmal durch heftige, z.T. ideologisch geprägte Attacken aus anderen Wissenschaftskreisen; zum anderen durch – nicht minder scharf geführte – Anfechtungen der wissenschaftlichen Güte des adaptionistischen Programms der Soziobiologie vonseiten biologischer Fachkollegen (30f., 35f.). Dabei kann der Darstellung zugutegehalten werden, dass sie nicht politisch motiviert ist, sich nicht auf eine Seite schlägt. Linke steht seinem Untersuchungsgegenstand und den darin enthaltenden Positionen stets wertfrei gegenüber. Auf diese Weise gelingt es ihm, die Motivationen der Kontrahenten in der Debatte um die Soziobiologie ausfindig zu machen, zu kontextualisieren und in übergeordnete Diskursverläufe einzuordnen, so z. B., dass die angloamerikanische Rezeption des Ansatzes deutliche Differenzen zu der Situation etwa in Deutschland aufweist, wo die klassische Ethologie von Konrad Lorenz die Aufnahme stark abgebremst habe (39f.). An eine Darstellung des Forschungsstandes zur Wissenschaftskommunikation im öffentlichen Raum (Kap. 3.), schließen sich ausgiebige Materialanalysen an. An die Luhmann’sche Systemtheorie angelehnt, werden Wissenschaft und Massenmedien als gesellschaftliche Teilsysteme und intersystemische Wirkungen als Kopplungen verstanden. Der wissenschaftliche Diskurs und die Mediendarstellung werden als jeweils eigenständige Kommunikationsverläufe aufgefasst und analysiert, erst in einem zweiten Schritt wird den Bezügen beider Bereiche nachgegangen. Den Diskursverläufen zur Soziobiologie in Wissenschaft und öffentlichen Medien geht Linke zunächst anhand von Häufigkeitsauszählungen in anerkannten wissenschaftlichen Zeitschriften und Pressedarstellungen nach (Kap. 4): Während die akademische Rezeption (insb. in Science) 1975 mit Wilsons Buch einsetzt und dann abebbt, sei der „deutsche Mediendiskurs zur Soziobiologie nicht parallel [verlaufen], sondern eher entgegen dem internationalen wissenschaftlichen Diskursverlauf“ (72). Ein ähnliches Bild zeigen die qualitativen Inhaltsanalysen der Diskussionen in wissenschaftlichen Zeitschriften (Kap. 5) und der Berichterstattung in deutschen „Leitmedien“ (Kap. 6). Auf dieser Grundlage kommt Linke zu dem Ergebnis, dass der internationale Wissenschaftsdiskurs zur Soziobiologie und deren Thematisierung in den deutschen Printmedien mit einer „Zeitverschiebung“ von 20 Jahren weitestgehend voneinander abgekoppelt verlaufen seien (Kap. 7, 8). Entgegen einer Zurückhaltung in den 1970er und 1980er Jahren, kam es ab 1990 zu einem Anstieg in der medialen Berichterstattung, die zur Jahrtausendwende einen Höhepunkt erreichte, während die Soziobiologie in Science 5 und Nature kaum noch thematisiert wurde und in der deutschen Zeitschrift Naturwissenschaften im Grunde nie präsent war.7 Dabei ging es in der FAZ und im Spiegel zunehmend weniger um die Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse und Diskussionen. Stattdessen sei die Tendenz eines „laissez-faire im Umgang mit der Soziobiologie“ bei der Erklärung alltags- und kulturspezifischer Phänomene zu verzeichnen, auf eine „wissenschaftliche Kontextualisierung“ sei verstärkt verzichtet worden (193). Als Auslöser dieses eigendynamischen, lockeren Umgangs deutscher Medien mit naturalistischen Erklärungsmustern könne eine allgemein intensivierte und zumeist affirmative Berichterstattung von Bio- und Gentechnologien angesehen werden. Linke resümiert, dass es „gegen Ende der 1990er Jahre ‚auf dem Rücken‘ der Biotechnologie“ zur medialen Konjunktur der Soziobiologie gekommen sei (203). Der besondere Nutzen dieser Studie besteht darin, dass der Ansatz auf der Objektseite der Beobachtung sitzt. Die Untersuchung kann damit Aufschluss über wissenschaftliche Praktiken der Wissensgenerierung und die eigentümliche Präsenz der Soziobiologie in den Medien geben. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch das Buch von Voland einordnen, dem eine öffentlichkeitswirksam platzierte Aufsatzserie in der FAZ zugrunde liegt. Wissenschaftsintern gibt es offenbar weder eine neuerliche Kontroverse um die Soziobiologie noch durchschlagend neue Erkenntnisse,8 was einer Hochphase in der öffentlichen Medienlandschaft aber keinen Abbruch tun muss. Auch wenn die Versuche einer Naturalisierung oder Biologisierung der Sozialwissenschaften bisher als gescheitert gelten können, bleibt die Frage bestehen, ob die verwendeten Menschenbilder getrennt von den Prinzipien der Evolutionstheorie, die in der Biologie (derzeit) konkurrenzlos ist,9 bestehen können. Die Frage ist, werden sich die Sozialwissenschaft auf kurz oder lang evolutionstheoretischen Erklärungen öffnen müssen, um nicht in eine weltanschauliche Sackgasse zu geraten (vgl. Richter 2005, 538)? Aufschlussreiche Einsichten hierzu kann ein Blick auf die Ansätze von Arnold Gehlen und Helmuth Plessner bieten – wenn auch mit unterschiedlichem Resultat. Denn beide Anthropologien stellen methodisch völlig unterschiedliche Zugänge dar. Gehlen versuchte mit seiner „empirischen Philosophie“ die Bedingungen des Menschseins aufzuweisen, indem er empirische Forschungsergebnisse systematisch durcharbeitete und zu einem in sich konsistenten Gesamtbild, in das seine Institutionentheorie eingefügt war, zusammensetzte. Neuere Erkenntnisse der Biologie, insb. der Ethologie, ließen – um es vorsichtig auszudrücken – einige Schwächen der Konzeption deutlich werden. Gehlen, der selbst eingeräumt hatte, dass sich der Ansatz an den empirischen Einzelwissenschaften messen lassen müsse, sah sich in seinem späteren Werk „Moral und Hypermoral“ denn auch genötigt, Ergebnisse der Verhaltensforschung mit aufzunehmen. Ob diese Zugeständnisse nicht letztlich zur Revision des durch die Methode der „Ganzheit“ entwickelten Menschenbildes zwingen, diese Frage hat Gehlen nie beantwortet. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass ein spezifisches Problem der Methode in den Vordergrund rückt. Indem Gehlens Konzept auf Ergebnissen empirischer Wissenschaften basierte, war es nicht mehr möglich, auf Weiterentwicklungen in diesen Bereichen angemessen Bezug zu nehmen und reflexiv einzuarbeiten, sodass etwa aus Sicht der Biologie die Theorie durch ihren kontrafaktischen Zug bald als überholt angesehen werden musste (vgl. Karneth 1991). Plessner hat mit seinem Programm einer Philosophischen Anthropologie das Verhältnis von Naturerkenntnis und Selbstbild des Menschen auf andere Weise thematisiert – was erst in der neueren Plessner-Forschung gewürdigt worden ist. Die methodische Anlage seines Ansatzes sieht vor, den Zugang zur Verfassung leiblicher Individuen und zur äußeren Natur im Zusammenhang zu begreifen (vgl. Mitscherlich 2007). Bei der Frage der Erfahrung von Dingen geht Plessner vom Wahrnehmungsobjekt aus. Gegenstände erscheinen einem Beobachter jedoch nicht unmittelbar, sondern sind stets gesellschaftlich-historisch vermittelt. Natur als Gegenstand der Wissenschaften muss prinzipiell als mitweltlich-sozial konstituiert begriffen werden (vgl. Beaufort 2000). Was für die Erfahrung der äußeren Natur gilt, gilt grundsätzlich auch bei der Selbstbeobachtung; d. h., jeder Begriff des Menschen ist in seiner historischen Bindung zu sehen. Natürlichkeit ist in jeder Hinsicht eine vermittelte. Da Vorstellungen von Natur als Konstruktionen begriffen werden, die geschichtlich und sozial gebunden sind, erscheinen somit auch Auffassungen über die Natur des Menschen kontingent (Lindemann 2008, 129f.). Der Ansatz beschreibt die Unmöglichkeit, ein transhistorisch stabiles Bild des Menschen zu zeichnen. Zusätzlich stellt er die geschichtliche Gebundenheit der eigenen theoretischen Annahmen (Positionalitätstheorie) reflexiv in Rechnung. Von der Warte Plessners aus besteht die Möglichkeit, Kultur und Natur miteinander vermittelt zu betrachten. Gerät die Historizität von jedwedem Naturverständnis in den Blick, wird der Absolutheitsanspruch bestimmter naturwissenschaftlicher Forschungsansätze aufgrund der Einsicht in die Notwendigkeit historischer Relationierung obsolet. (Natur-)Erkenntnis ist in einem Entwicklungsprozess begriffen und grundsätzlich unabgeschlossen. Es kann (und muss) gar nicht entschieden werden, welche Position die Deutungsvormacht 7 Den Grund hierfür sieht Linke in der Dominanz der spezifisch deutschen Tradition der Verhaltensforschung. 8 Hierbei ist zu beachten, dass sich der Ansatz in verschiedene Weiterentwicklungen mit unscharfen Grenzverläufen, wie Evolutionäre Psychologie, Memetik oder Verhaltensökologie, aufgespalten hat, zumal sich das evolutionstheoretische Paradigma insgesamt seit den 1970er Jahren verbreitert hat. 9 Ob tatsächlich von evolutionären Universalien gesprochen werden kann, erscheint aufgrund der Historizität und grundsätzlichen Unabgeschlossenheit biologischer Forschung problematisch. 6 besitzt. Theorie und Forschung leisten Erkenntnis in ganz bestimmten Phänomenbereichen, auf die sie zugeschnitten sind. Probleme entstehen immer dann, wenn Erklärungsansätze die eigenen Grenzen verlassen und sich auf andere (wenn nicht sogar alle) Gebiete ausweiten wollen. Sind solche imperialistischen Züge jedoch nicht ganz und gar unwissenschaftlich? Denn wissenschaftliche Forschung ist per Definition (Popper) ausschnitthaft und nicht allumfassend. Ist nicht die alte Anlage-Umwelt-Debatte gerade deshalb unfruchtbar, weil jeweils mit Universalanspruch entweder einem naturalistischen oder kulturalistischen Erklärungsansatz ein Primat zugesprochen wird? Sachverhalte, die unter ‚Kultur‘ gefasst werden (insb. gesellschaftliche Makrostrukturen), können nicht auf Biologie reduziert werden, genauso wie biologische von physikalischchemischen Erscheinungen als irreduzibel unterschieden werden. Als Schlussfolgerung ließe sich ziehen: Einem ontologischen Monismus, wie dem von der Soziobiologie vertretenden Universalprinzip der Evolution, ist ein methodologischer Pluralismus vorzuziehen, weil auf diese Weise die jeweiligen Erkenntnisgrenzen biologischer wie sozialwissenschaftlicher Forschung nicht ignoriert, sondern explizit in Rechnung gestellt werden können (vgl. Seifert 2003). Biologie und Soziologie würden so nicht länger als Konkurrenzunternehmungen angesehen werden, sondern als anders ausgerichtete Forschungsmethoden auf unterschiedlichen Analyseebenen, die sich, wo sie sich berühren, gegenseitig befruchten könnten (vgl. Vowinckel 1991). Literatur Beaufort, Jan (2000): Die gesellschaftliche Konstitution der Natur. Helmuth Plessners kritischphänomenologische Grundlegung einer hermeneutischen Naturphilosophie in „Die Stufen des Organischen und der Mensch“, Würzburg. Karneth, Rainer (1991): Anthropo-Biologie und Biologie. Biologische Kategorien bei Arnold Gehlen - im Licht der Biologie, insbesondere der vergleichenden Verhaltensforschung der Lorenz-Schule, Würzburg. Lindemann, Gesa (2008): Verstehen und Erklären bei Helmuth Plessner, in: Greshoff, Rainer/Kneer, Georg/ Schneider, Wolfgang Ludwig (Hg.): Verstehen und Erklären. Sozial- und Kulturwissenschaftliche Perspektiven, München, 117-142. Mayntz, Renate (2006): Einladung zum Schattenboxen: Die Soziologie und die moderne Biologie, in: MPIfG Discussion Papers, 06/7. Mitscherlich, Olivia (2007): Natur und Geschichte. Helmuth Plessners in sich gebrochene Lebensphilosophie, Berlin. Richter, Dirk (2005): Das Scheitern der Biologisierung der Soziologie. Zum Stand der Diskussion um die Soziobiologie und anderer evolutionstheoretischer Ansätze, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 57/3, 523-542. Seifert, Franz (2003): Wie man die ‚menschliche Natur‘ besser nicht in die Sozialwissenschaften einführen sollte. Kritische Anmerkungen zu Kurt Kotrschal, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 29/1, 93100. Voland, Eckart (22000): Grundriss der Soziobiologie, Berlin. Vowinckel, Gerhard (1991): Homo sapiens sociologicus oder: Der Egoismus der Gene und die List der Kultur, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 43/3, 520-541. 7