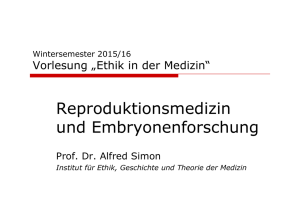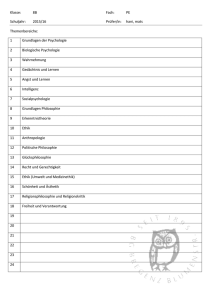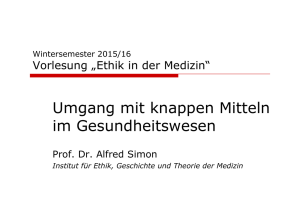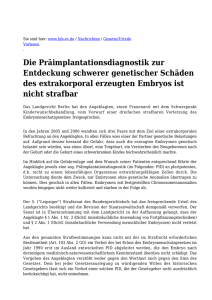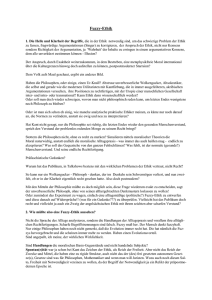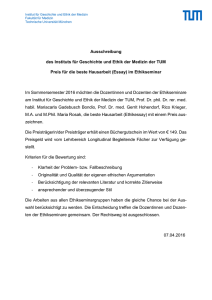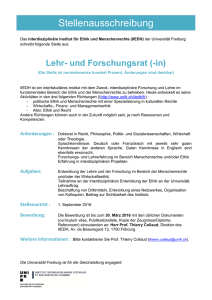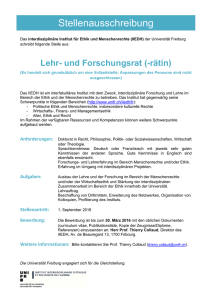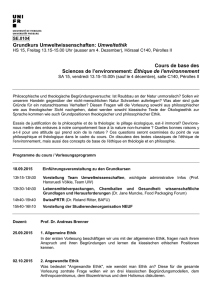Reproduktionsmedizin und Embryonenforschung
Werbung
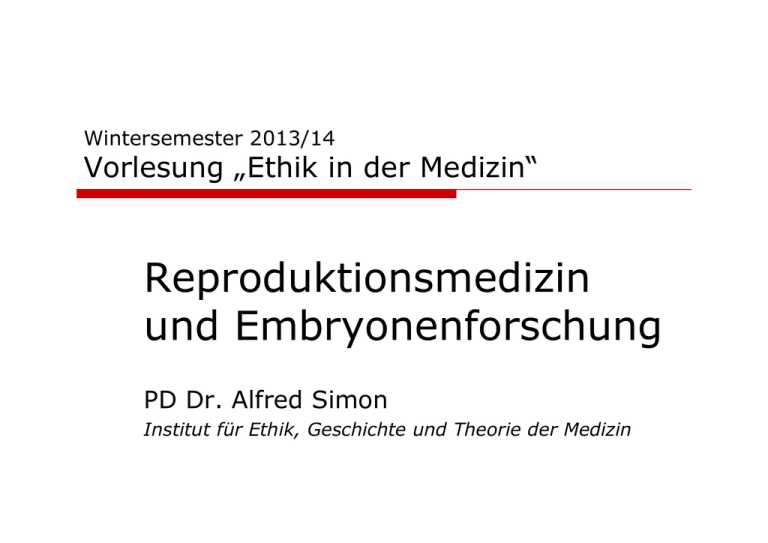
Wintersemester 2013/14 Vorlesung „Ethik in der Medizin“ Reproduktionsmedizin und Embryonenforschung PD Dr. Alfred Simon Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin Gliederung der Vorlesung Ethisch und rechtliche Fragen Assistierte Reproduktion Präimplantationsdiagnostik (PID) Forschung an humanen embryonalen Stammzellen (hESZ) A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Assistierte Reproduktion Methoden In-vitro-Fertilisation mit oder ohne ICSI Donogene Insemination Samenspende Eizellspende Embryonenspende Quelle: de.wikipedia.org A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Assistierte Reproduktion Richtlinien und Gesetze Embryonenschutzgesetz, 1990 (ESchG) Wiss. Beirat der Bundesärztekammer: (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, 2006 (RDaR) A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Assistierte Reproduktion Verfahren ESchG In-vitro-Fertilisation Zulässig1 Samenspende (heterologe Insemination) Zulässig1,2 Eizellspende Verboten Embryonenspende Verboten Leih- bzw. Ersatzmutterschaft Verboten Statusrechtliche Voraussetzungen (RDaR): 1 Ehe oder feste Partnerschaft 2 Ausgeschlossen bei Frauen die in keiner Partnerschaft oder in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Assistierte Reproduktion Single-Embryo-Transfer Deutschland: „Dreierregel“ Es dürfen pro Zyklus bis zu 3 Eizellen befruchtet und übertragen werden Dilemma: Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft oder geringere Erfolgsaussicht Ausland: elektiver Single-Embryo-Transfer Kultivierung mehrerer Embryonen Beurteilung der Embryonenmorphologie Übertragung des Embryos mit den größten Entwicklungschancen A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Präimplantationsdiagnostik Künstliche Befruchtung Entnahme einer Zelle im 8- bis 16-ZellStadium genetische Untersuchung Rechtliche Bewertung? Ethische Bewertung? Quelle: faz.net A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Rechtliche Bewertung der PID ESchG Verbietet jede Verwendung des Embryos zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck Als Embryo im Sinne des Gesetzes gilt die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle PID an totipotenten Zellen widerspricht ESchG PID an pluripotenten Zellen? (Problem: Vernichtung des positiv getesteten Embryos) A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Rechtliche Bewertung der PID BGH: Urteil vom 6.7.2010 PID an pluripotenten Zellen verstößt nicht gegen das ESchG Bei genetischer Vorbelastung der Eltern kann die PID eine PND und die damit verbundenen Risiken für die Schwangere verhindern PID an pluripotenten Zellen zur Entdeckung schwerer genetischer Schäden zulässig A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Rechtliche Bewertung der PID Präimplantationsdiagnostikgesetz PID grundsätzlich verboten Ausnahmen schwerwiegende Erbkrankheiten hohes Risiko von Fehl- und Totgeburt Voraussetzungen Aufklärung und Beratung zu medizinischen, psychischen und sozialen Folgen Positives Votum einer Ethikkommission Durchführung in zugelassenen Zentren A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Ethische Bewertung der PID Argumente der Kritiker: Moralische Status des Embryos Vorgeburtliche Selektion Dammbruch Diskriminierung von Behinderung Argumenten der Befürworter: Einschränkung der Fortpflanzungsfreiheit Widerspruch zur Zulässigkeit der PND Verbot Ausweichen ins Ausland A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Forschung an hESZ Stammzellen Vorläufer differenzierter Zellen Adulte Stammzellen Im Gewebe adulter Lebewesen (z.B. Knochenmark, Haut) Geweberegeneration Plastizität und Vermehrbarkeit eingeschränkt Embryonale Stammzellen Nur im Embryo Pluripotent Differenzierung in sämtliche Zelltypen Unbegrenzt teilungsfähig A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Forschung an hESZ Ziele und Hoffnungen Grundlagenforschung Differenzierung/Reprogrammierung von Zellen Krankheitsentstehung Medikamentenentwicklung Anwendung im Bereich der Humantherapie Zell- und Gewebeersatz Therapien für Parkinson, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes… A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Forschung an hESZ Risiken und Probleme Tumorbildung nach Transplantation Infektion hESZ durch Kulturbedingungen Immunkompatibilität ( therapeut. Klonen) A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Quelle: www.drze.de Quelle: www.drze.de Forschung an hESZ Ethische Bedenken Vernichtung von Embryonen Instrumentalisierung und Manipulation von Embryonen Abwägung: Embryonenschutz Forschungsinteressen Interessen künftiger Patienten A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Forschung an humanen ESZ Rechtliche Regelung ESchG verbietet Gewinnung von hESZ Stammzellgesetz (2002/2008) erlaubt Forschung an importierten hESZ unter bestimmten Voraussetzungen: Gewinnung vor dem 1.5.2007 aus überzähligen Embryonen hochrangiges Forschungsziel keine Alternativen Genehmigung durch Zentrale Ethik-Kommission für Stammzellforschung A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14 Zusammenfassung Embryonenschutz Unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen (StGB, ESchG, Stammzellgesetz) mit unterschiedlichen Schutzniveaus Diskrepanz zwischen dem rechtlichen Schutz des Embryos in vitro und in vivo Bedarf für ein einheitliches Fortpflanzungsmedizingesetz A. Simon: Vorlesung „Ethik in der Medizin“, WS 2013/14