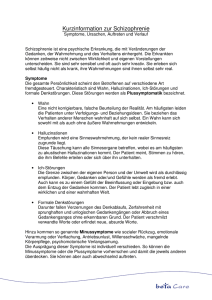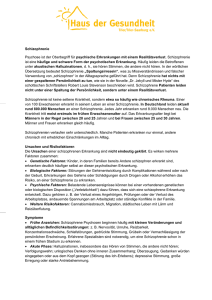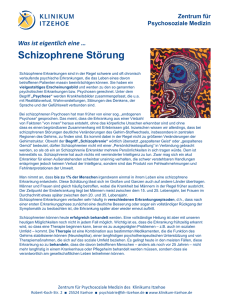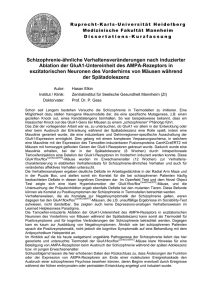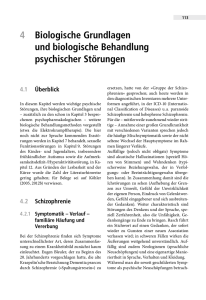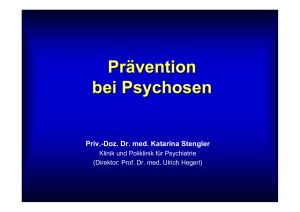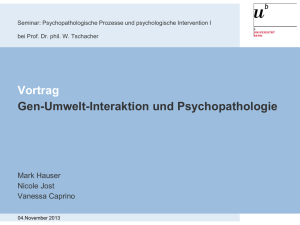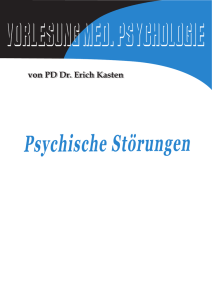Genetik der Schizophrenie
Werbung

697_729_BIOsp_0707.qxd:697_729 07.11.2007 14:14 Uhr Seite 727 727 Psychiatrische Erkrankungen Genetik der Schizophrenie DAN RUJESCU MOLEKUL ARE UND KLINISCHE NEUROBIOLOGIE, KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE, UNIVERSITÄT MÜNCHEN Die Schizophrenie stellt eine der schwerwiegendsten psychiatrischen Erkrankungen weltweit dar. Bei einem Risiko für die Allgemeinbevölkerung von 1 % an Schizophrenie zu erkranken, sind – bezogen auf Deutschland – 800.000 Bundesbürger betroffen. Trotz dieser hohen Zahl wurde der Schizophrenie über viele Jahrzehnte nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Erkrankung geht auch heute noch mit einer starken Stigmatisierung der Betroffenen und derer Familien einher. ó Dabei hat die Schizophrenie, wie Krebserkrankungen oder Diabetes, eine starke biologische, vor allem genetische Ursache. Die Schizophrenie betrifft das Verhalten und Erleben, einhergehend mit dem Auftreten von Wahnerleben, Halluzinationen, Denkstörungen, Kommunikationsstörungen und einem sozialen Rückzug. Zusätzlich geht die Störung oft einher mit Substanzabusus z. B. von Alkohol, Nikotin, Cannabis und Kokain[1–3]. Das Haupterkrankungsalter liegt zwischen der Pubertät und dem 35. Lebensjahr. Männer erkranken dabei häufig früher als Frauen. Die Schizophrenie kann verschiedene Subtypen, wie den paranoiden, den hebephrenen oder den katatonen Typ annehmen und hat einen heterogenen Verlauf. Die akuten Manifestationen können Wochen bis Monate dauern und rezidivieren. Die Krankheit kann zudem in Schüben verlaufen und es kommt häufig zu einer chronischen Residualsymptomatik mit bleibenden Einschränkungen. Mehr als 50 % der Erkrankten haben einen ungünstigen Verlauf mit Rezidiven, Residualsymptomatik und erheblichen Störungen der sozialen Integration[1, 4]. Risiko von ca. 50 %, ebenso wie die Kinder zweier schizophrener Eltern. Insgesamt weisen diese Daten auf eine Heritabilität von ca. 80 % hin[8, 9]. Darüber hinaus spielen auch epigenetische Faktoren eine Rolle bei der Erkrankung, da die Konkordanz bei eineiigen Zwillingen nicht 100 % beträgt[8–10]. Wahrscheinlich ist die Schizophrenie eine multifaktorielle Erkrankung, an der mehrere Gene mit einem schwachen bis mäßigen Effekt beteiligt sind, die in Verbindung mit Umweltrisikofaktoren zu einer Manifestation der Erkrankung führen[5–8]. Die Identifizierung dieser Gene und dadurch der Pathophysiologie dieser Erkrankung ist von großem therapeutischem Interesse. Erst wenn mehr über die genetischen und pathophysiologischen Ursachen der Schizophrenie bekannt ist, können gezieltere Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden. Die genetische Komponente hat hierbei eine wesentliche Bedeutung. In der Literatur werden momentan grundsätzlich zwei genetische Strategien verwendet: Kopplungs- und Assoziationsstudien, wobei beide komplementäre Informationen liefern. Kopplungsstudien Heritabilität Aus heutiger Sicht wird die Erkrankung durch eine multifaktorielle Ätiopathogenese erklärt. Dabei gibt es eine Vielzahl von Hinweisen auf eine klare genetische Komponente der Schizophrenie[5–7]. Das Lebensmorbiditätsrisiko von 1 % in der Allgemeinbevölkerung erhöht sich auf ca. 3–5 % bei Verwandten zweiten Grades oder Halbgeschwistern und auf 9–12 % bei Geschwistern und zweieiigen Zwillingen. Eineiige Zwillinge teilen ein relatives BIOspektrum | 07.07 | 13. Jahrgang Kopplungsstudien sind bei Geschwisterpaaren, Trios und Multiplexfamilien angewendet worden. Die Untersuchungen basieren auf einem Gen-Kartierungsverfahren, wobei zunächst die mit Schizophrenie gekoppelten Loci vor der eigentlichen Identifizierung des Gens bestimmt werden. Die ersten Kopplungsuntersuchungen zur Schizophrenie wurden in der Annahme durchgeführt, Gene mit einem Haupteffekt auf die Erkrankung identifizieren zu können. Erste positive Ergebnisse für Kopplungen, z. B. mit einem Gen auf Chromosom 5, konnten jedoch nicht repliziert werden[11,12]. Vermutlich sind Mutationen mit einer sehr hohen Penetranz äußerst selten oder nicht vorhanden[13]. Daraufhin wurden große gemeinschaftliche Anstrengungen unternommen, um genomweite Kopplungsstudien durchzuführen. In den letzten Jahren wurden zwar tendenzielle bis signifikante Kopplungen gefunden, allerdings waren die gefundenen Kandidatengenregionen jeweils sehr groß (etwa 30 Centimorgan (cM)) und konnten häufig durch unabhängige Gruppen nicht repliziert werden. Eine groß angelegte Meta-Analyse von Lewis et al.[14] wertete die Daten von 20 genomweiten Kopplungsstudien mit insgesamt 1208 Stammbäumen zur Schizophrenie aus und zeigte eine größere Übereinstimmung in den Ergebnissen der bisherigen Kopplungsstudien als bislang vermutet. Interessanterweise konnte diese Meta-Analyse verschiedene Hinweise auf Kopplungen bestätigen, die an einer kleineren Anzahl von Stammbäumen aus homogeneren oder isolierteren Bevölkerungsgruppen beobachtet wurden. Mittlerweile gibt es mindestens 12 Loci, für die eine Beteiligung an der Entwicklung von Schizophrenie wahrscheinlich ist, wie die Meta-Analyse publizierter und nicht publizierter Daten nahelegt. Diese Loci repräsentieren ca. 10 % des menschlichen Genoms (Abb. 1). Die Methode der Kopplungsuntersuchungen erlaubt es jedoch selten, die eigentlichen Dispositionsgene mit einer, wie bei der Schizophrenie zu erwartenden geringen Effektstärke direkt zu identifizieren. Auch ist mit dem Aufspüren gekoppelter Regionen zunächst nur die grobe chromosomale Region eingegrenzt, die eigentlichen, verursachenden Varianten in der DNA findet man allein mit diesem Ansatz in der Regel jedoch nicht. Kandidatengenstudien Eine komplementäre Strategie stellen Assoziationsstudien dar. Diese basieren auf einem statistischen Vergleich der Allelfrequenzen zwischen Patienten und Kontrollen und beinhalten die Untersuchung einer Kohorte von Patienten und gesunden, nicht verwandten 697_729_BIOsp_0707.qxd:697_729 728 07.11.2007 14:14 Uhr Seite 728 WISSENSCHAFT ˚ Abb. 1: Überlappende Kopplungsregionen für Schizophrenie. Kontrollen. Im Gegensatz zu Kopplungsstudien können Assoziationsstudien auch für Gene mit geringem Effekt eine eindeutige Assoziation zwischen einer Genvariante und einer komplexen Erkrankung liefern. Die meisten bisher durchgeführten Assoziationsstudien zur Schizophrenie beruhen auf den derzeitigen pathobiologischen Modellen dieser Erkrankung. Untersucht wurden Kandidatengene, von denen man annimmt, dass ihre Produkte an der Entstehung der Krankheit beteiligt sein könnten. Daher haben sich die Studien zunächst auf Modelle der dopaminergen Dysfunktion konzentriert. Sowohl die Dopaminhypothese der Schizophrenie als auch die Tatsache, dass Dopaminrezeptoren von den meisten Antipsychotika blockiert werden, geben Anlass zur Erforschung von Genen, die an der dopaminergen Neurotransmission beteiligt sind. In diesen Studien wurden Gene untersucht, die sowohl für Dopaminrezeptoren als auch für die Enzyme, die in dem Dopaminmetabolismus involviert sind, kodieren. Eine Meta-Analyse von mehr als 5.000 Personen hat eine Assoziation zwischen Schizophrenie und Homozygotie für einen Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP) aufgezeigt, welcher eine Aminosäurevariation (Ser9Gly) im Exon 1 des Dopamin 3(DRD3)-Rezeptorgens verursacht[15]. Weitere mögliche Assoziationen wurden im Bereich des Dopamin 2-Rezeptors gefunden[16]. Ebenfalls ein Hinweis auf eine Assoziation besteht hinsichtlich der CatecholO-Methyltransferase (COMT)[17]. Weiterhin wurden serotonerge Systeme untersucht, da Lysergsäurediethylamin (LSD), welches schizophrenieähnliche Symptome erzeugt, an den Serotonin(5-HT)-2A-Rezeptor bindet. Außerdem haben atypische Neuroleptika neben dem Dopamin-D2-Antagonismus v. a. einen 5-HT-2A-Antagonismus. Eine Meta-Analyse zu einem Basenaustausch-Polymorphismus von Thymin (T) nach Cytosin (C) an Position 102 im Serotonin-2A(5-HT-2A)-Rezeptorgen zeigte ebenfalls eine Assoziation mit Schi- zophrenie[18, 19]. Weitere Valdierungsstudien zu den aus dem Kandidatengenansatz stammenden Genen sind erforderlich. Expressionsanalysen in post mortemGehirnen und Tiermodellen der Schizophrenie Eine weitere Möglichkeit, Schizophrenie-relevante Gene zu finden, sind Tiermodelle der Psychose sowie Untersuchungen in post mortem-Gehirnen. Ein Gen, welches auf diesem Wege ermittelt wurde, ist das RGS4(Regulator of G-Protein Signaling-4)-Gen auf Chromosom 1q21–22, das zuvor nie mit Schizophrenie in Zusammenhang gebracht wurde. Es zeigte in einer Genexpressionsstudie eine Verminderung der Expression in post mortem-Gehirngewebe schizophrener Patienten[20]. In weiteren Kopplungs-[21] und Assoziationsstudien[22] wurden ebenfalls signifikante Ergebnisse gefunden. RGS4 gehört zu einer Gruppe von Proteinen, die eine wichtige Rolle in der Regulation der Dauer des postsynaptischen Signals verschiedener G(Guanosin)Protein-gekoppelter Neurotransmitter-Rezeptoren, wie der Dopamin-D2-, 5-HT2- und metabotroper Glutamatrezeptoren, spielen. Einige Tiermodelle der Schizophrenie beruhen auf einer Dysregulation des glutamatergen Systems[23–25]. Die psychomimetischen Effekte von nicht-kompetitiven N-MethylAspartat(NMDA)-Rezeptor-Antagonisten wie z. B. PCP und Ketamin in gesunden Personen[26, 27] und die Beobachtung, dass sie psychotische Symptome bei schizophrenen Patienten verstärken, haben zur Hypothese geführt, dass die Schizophrenie mit einer veränderten glutamatergen Neurotransmission zusammenhängt. Tiermodelle zeigen dabei Parallelen zwischen der Schizophrenie und molekularen, zellulären und funktionellen Veränderungen sowie Verhaltensabnormitäten in diesen Tieren. So verändert die niedrig dosierte chronische Gabe des NMDA-Rezeptor-Antagonisten MK801 die Expression von NMDA-Rezeptoruntereinheiten auf moleku- larer Ebene in ähnlicher Weise wie bei der Schizophrenie[28]. Auf zellulärer Ebene ist die Anzahl der Parvalbumin-positiven Interneurone selektiv erniedrigt[23], was wiederum post mortem-Befunden an Gehirnen schizophrener Patienten entspricht[29]. Auf funktionaler Ebene ist die rekurrente Inhibition von Pyramidalzellen verändert, wie durch die histologischen Befunde postuliert wurde. Auf der Verhaltensebene schließlich weisen diese Tiere kognitive Defizite wie ein gestörtes Arbeits- und deklaratives Gedächtnis auf, was wiederum Befunden bei schizophrenen Patienten entspricht[30]. Pharmakologische Tiermodelle bilden somit eine Reihe Schizophrenie-assoziierter Phänotypen ab und können genutzt werden, um weitere Kandidatengene für diese Erkrankung zu identifizieren. Mittels cDNA-Arrays können im Weiteren Expressionsuntersuchungen durchgeführt werden, um neue Gene zu identifizieren und diese in Patienten und Kontrollen zu untersuchen. Kombination von Kopplungs-, Assoziations-, Kandidatengen- und Expressionsstudien Die Kombination von Kopplungs-, Assoziations-, Kandidatengen- und Expressionsstudien in der Schizophrenie stellte bisher den effektivsten Ansatz zur Entdeckung von weiteren Suszeptibilitätsgenen dar und führte bereits zur Entdeckung erster putativer Schizophreniegene, wie Dysbindin auf 6p22.3[31, 32] und Neuregulin 1 auf 8p[33]. In einer genomweiten Kopplungsstudie replizierten Stefansson et al. Ergebnisse von Kopplungsstudien mit Schizophrenie auf Chromosom 8p an einer isländischen Bevölkerungsgruppe[33]. Des Weiteren entdeckten sie verschiedene Marker auf dem Neuregulin 1(NRG 1)-Gen und bildeten einen Haplotypen, der eine signifikante Assoziation mit Schizophrenie zeigte. Ein fast identisches Muster konnte an einer schottischen Bevölkerungsgruppe gefunden werden[34]. Eine Verbindung dieser Befunde zur NMDA-Hypofunktions-Hypothese der Schizophrenie vermitteln Neuregulin-1-Knock-out-Mäuse, bei denen die Zahl funktioneller NMDA-Rezeptoren reduziert ist. Straub und Kollegen untersuchten einen Bereich auf Chromosom 6p, der in irischen Familienstudien mit der Schizophrenie gekoppelt war und entdeckten mittels familienbasierter Assoziationsstudien von SNPs und Haplotypen das Dysbindin(DTNBP1)-Gen auf Chromosom 6p22.3. Es kann u. a. die NMDABIOspektrum | 07.07 | 13. Jahrgang 697_729_BIOsp_0707.qxd:697_729 07.11.2007 14:14 Uhr Seite 729 729 Tab. 1: Kandidatengene für Schizophrenie. Adaptiert nach Straub und Weinberger 2006. Gen RGS4 DISC1 GAD1 ERBB4 DTNBP1 MUTE D GRM3 NRG1 PPP3CC GRIK4 FEZ1 DAAO DAOA AKT1 CHRNA7 COMT PRODH regulator of G-protein signaling 4 disrupted in schizophrenia 1 glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa) v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian) dystrobrevin binding protein 1 muted homolog (mouse) glutamate receptor, metabotropic 3 neuregulin 1 protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, gamma isoform glutamate receptor, ionotropic, kainate 4 fasciculation and elongation protein zeta 1 (zygin I) D-amino-acid oxidase D-amino acid oxidase activator v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7 catechol-O-methyltransferase proline dehydrogenase (oxidase) 1 Rezeptorfunktion über die neuronale Nitrosyl(NO)-Synthase beeinflussen. Sie fanden hochsignifikant assoziierte SNPs in den Introns 4, 5 und 6[31], was auch in einer weiteren deutschen Studie bestätigt werden konnte[32]. Die Evidenz all dieser, in Assoziationsstudien mehrmals replizierten Befunde, wird gestützt dadurch, dass die identifizierten Gene alle in gekoppelten Regionen liegen, die mRNA dieser Gene im präfrontalen Kortex exprimiert ist und neurobiologische Daten auf eine funktionelle Relevanz dieser Gene hinweisen[5–7]. In Tabelle 1 werden die am meisten untersuchten Kandidatengene der Schizophrenie zusammengestellt. Endophänotypen Der Ansatz der intermediären Phänotypen stellt eine komplementäre Suchstrategie nach Genen für die Schizophrenie dar. Klinische Klassifikationssysteme psychiatrischer Erkrankungen, wie auch das für die Schizophrenie, scheinen heterogene Störungen mit einzelnen Subtypen, wie dem paranoiden, dem hebephrenen oder dem katatonen Typus der Schizophrenie zu beschreiben. Damit dürfte die gebräuchliche klinisch-psychiatrische Klassifikation für genetische Studien nicht immer optimal geeignet sein[35–38]. Aus diesem Grund erscheint eine Einteilung nach Endophänotypen, deren Beschreibung einfache, quantitative Messgrößen neuropsychiatrischer Funktionen zugrunde liegen, bei der Identifizierung relevanter Gene vielversprechend. Dieser Ansatz ermöglicht es, die mit ätiologischen Modellen einhergehenden methodischen Probleme zu umgehen. Der Hintergrund für die Verwendung von Endophänotypen bei der Genidentifizierung ist, dass diese stringent definierten Phänotypen mit den Ursachen einer psychiatrischen Erkrankung näher assoziiert sind und diese besser umschreiben als der klinische Phänotyp. Demnach repräsentieren Endophänotypen die Verbindung zwischen Genen und dem klinischen Phänotyp. Dies impliziert, dass die BIOspektrum | 07.07 | 13. Jahrgang Chr.region 1q23.3 1q42.1 2q31 2q33.3-q34 6p22.3 6p25.1-p24.3 7q21.1-q21.2 8p12 8p21.3 11q22.3 11q24.2 12q24 13q34 14q32.32 15q14 22q11.21 22q11.21 Assoziation +++ ++++ ++ ++ +++++ ++++ +++ +++++ + ++ ++ ++ +++ + + ++ + Anzahl der Gene, die erforderlich ist, um Variationen der Endophänotypen zu bedingen, möglicherweise geringer sein könnte als die Anzahl der Gene zur Verursachung der komplexeren, psychiatrisch diagnostischen Entitäten. Die für die Analyse von Endophänotypen der Schizophrenie zur Verfügung stehenden Methoden beinhalten neurophysiologische, neuropsychologische[39] und bildgebende (fMRI) Verfahren. Einige dieser Endophänotypen sind unabhängig vom Erkrankungsstadium mit der Krankheit assoziiert und kosegregieren in betroffenen Familien. Insgesamt hat sich durch den Einsatz von Endophänotypen eine bemerkenswerte Möglichkeit eröffnet, komplexe neuropsychiatrische Krankheiten zu untersuchen[40] und wird in naher Zukunft voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Genomweite Assoziationsstudien Eine Schwäche des Kandidatengen-Ansatzes ist, dass diese Studien auf im Vorfeld als plausibel angesehene Gene angewiesen sind. Eine Vielzahl von Assoziationsstudien zur Schizophrenie ist bislang durchgeführt worden[6]. Die Interpretation dieser Ergebnisse ist jedoch nur mit äußerster Vorsicht vorzunehmen, da viele Studien nur geringe Fallzahlen aufweisen und viele „Falsch-Positive“-Befunde ohne deren Replikation publiziert wurden. Mit Weiterentwicklung der Genotypisierungstechniken, die mittlerweile die parallele Genotypisierung von einer Million und mehr SNPs bei einer Person erlauben, geht der Trend hin zu hypothesenfreien Ansätzen, den genomweiten Assoziationsstudien. Die erste dieser Art zu Schizophrenie wurde im Frühjahr 2007 Kopplungsregion nach Lewis et al 2003 1p13.3-q23.3 [Rang] [10] 6pter-p.22.3 [7] 8p22-p21.1 11q22.3-q24.1 11q22.3-q24.1 [6] [3] [3] 22pter-q12.3 22pter-q12.3 [9] [9] von Lencz et al. publiziert[41], in welcher sie aus über 500.000 SNPs das Gen CSF2RA (colony stimulating factor, receptor 2 alpha) als mit der Schizophrenie assoziiert finden. Momentan werden einige weitere genomweite Assoziationsstudien weltweit durchgeführt[42], die vielversprechende Ergebnisse liefern. Es wird sich in einigen Monaten bis wenigen Jahren zeigen, ob mit diesem neuen Ansatz entscheidende Fortschritte in der Schizophrenieforschung gemacht werden oder ob die für in einigen Jahren antizipierte genomweite individuelle Sequenzierung den entscheidenden Durchbruch bringt. Die Kombination von Kopplungs-, Assoziations-, Kandidatengen- und Expressionsstudien, die Untersuchung von intermediären Phänotypen sowie insbesondere der hypothesenfreie Ansatz genomweiter Hochdurchsatzgenotypisierung stellt, nach unserem Ermessen, den effektivsten Ansatz zur Aufklärung der Pathophysiologie der Schizophrenie dar und in den nächsten wenigen Jahren ist mit entscheidenden Fortschritten auf diesem Gebiet zu rechnen. ó Literatur Eine umfangreiche Literaturliste finden Sie unter http://psywifo.klinikum.uni-muenchen.de/forschung/ neurobiologie/index.html Korrespondenzadresse: OA PD Dr. med. Dan Rujescu Psychiatrische Universitätsklinik Nussbaumstraße 7 D-80336 München Tel.: 089-5160 5756 Fax: 089-5160 5779 [email protected] AUTOR Dan Rujescu 1986–1993 Medizinstudium in Essen; Brisbane/Australien; Cape Town/Südafrika, 1993 Doktorarbeit an den Universitäten Essen und Heidelberg, 1993–1995 AiP an der Psychiatrischen Universitätsklinik Mainz, 1995–1997 Assistenzarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik München (LMU), 1997–1998 Postdoc in der Neurobiochemie am Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried. Seit 1997 Leitung der Sektion Molekulare und Klinische Neurobiologie an der Psychiatrischen Universitätsklinik München. 2004 Habilitation.