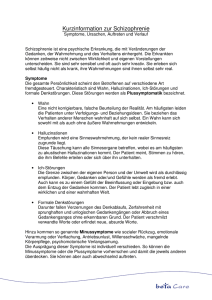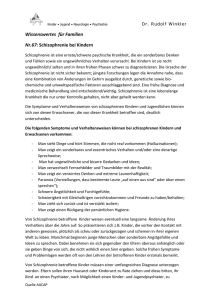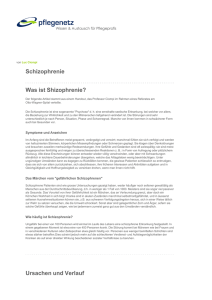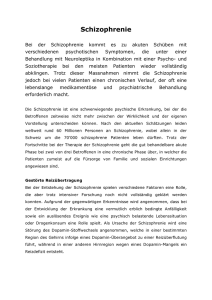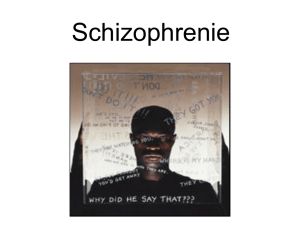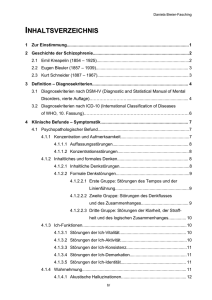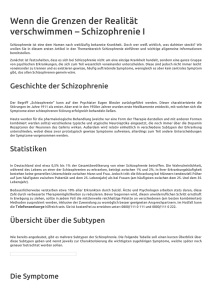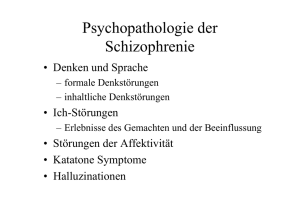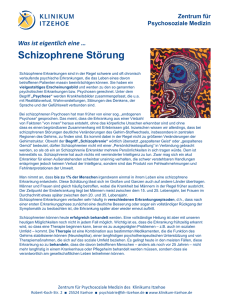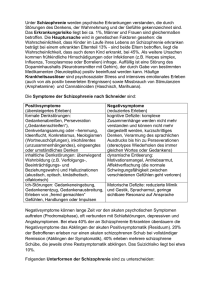4 Biologische Grundlagen und biologische Behandlung psychischer
Werbung
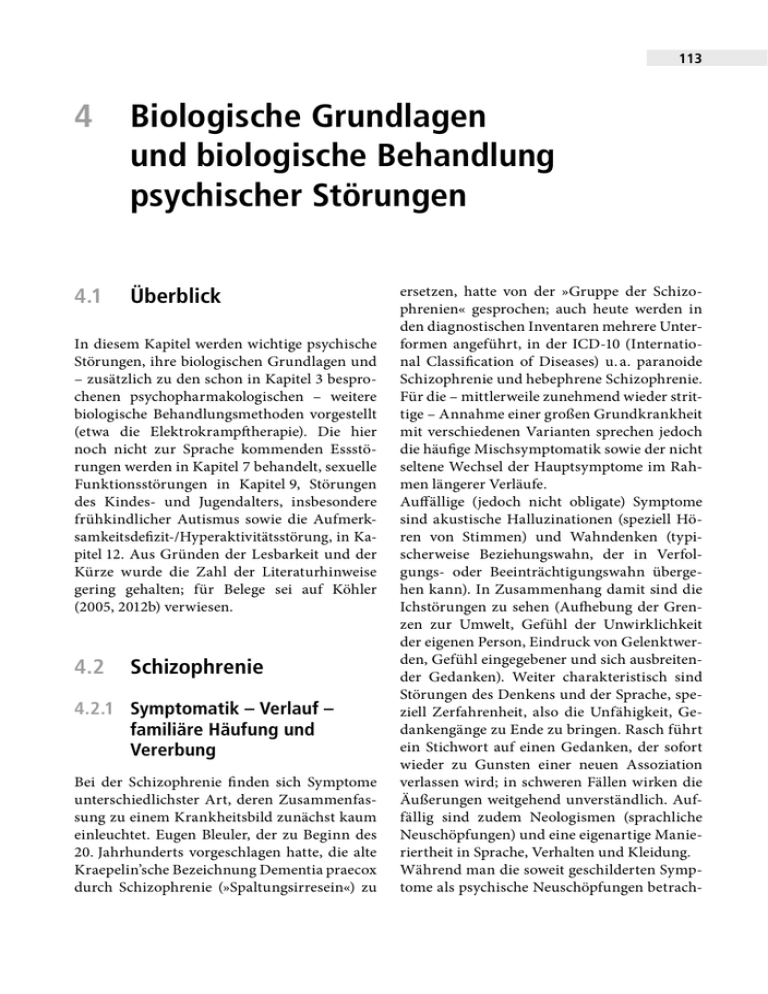
113 4 Biologische Grundlagen und biologische Behandlung psychischer Störungen 4.1Überblick In diesem Kapitel werden wichtige psychische Störungen, ihre biologischen Grundlagen und – zusätzlich zu den schon in Kapitel 3 besprochenen psychopharmakologischen – weitere biologische Behandlungsmethoden vorgestellt (etwa die Elektrokrampftherapie). Die hier noch nicht zur Sprache kommenden Essstörungen werden in Kapitel 7 behandelt, se­xuel­le Funktionsstörungen in Kapitel 9, Störungen des Kindes- und Jugendalters, insbesondere frühkindlicher Autismus sowie die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, in Ka­ pitel 12. Aus Gründen der Lesbarkeit und der Kürze wurde die Zahl der Literaturhinweise gering gehalten; für Belege sei auf Köhler (2005, 2012b) verwiesen. 4.2Schizophrenie 4.2.1 Symptomatik – Verlauf – ­familiäre Häufung und ­Vererbung Bei der Schizophrenie finden sich Symptome unterschiedlichster Art, deren Zusammenfassung zu einem Krankheitsbild zunächst kaum einleuchtet. Eugen Bleuler, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorgeschlagen hatte, die alte Kraepelin’sche Bezeichnung Dementia praecox durch Schizophrenie (»Spaltungsirresein«) zu ersetzen, hatte von der »Gruppe der Schizophrenien« gesprochen; auch heute werden in den diagnostischen Inventaren mehrere Unterformen angeführt, in der ICD-10 (International Classification of Diseases) u. a. paranoide Schizophrenie und hebephrene Schizophrenie. Für die – mittlerweile zunehmend wieder strittige – Annahme einer großen Grundkrankheit mit verschiedenen Varianten sprechen jedoch die häufige Mischsymptomatik sowie der nicht seltene Wechsel der Hauptsymptome im Rahmen längerer Verläufe. Auffällige (jedoch nicht obligate) Symptome sind akustische Halluzinationen (speziell Hören von Stimmen) und Wahndenken (typischerweise Beziehungswahn, der in Verfolgungs- oder Beeinträchtigungswahn übergehen kann). In Zusammenhang damit sind die Ichstörungen zu sehen (Aufhebung der Grenzen zur Umwelt, Gefühl der Unwirklichkeit der eigenen Person, Eindruck von Gelenktwerden, Gefühl eingegebener und sich ausbreitender Gedanken). Weiter charakteristisch sind Störungen des Denkens und der Sprache, speziell Zerfahrenheit, also die Unfähigkeit, Gedankengänge zu Ende zu bringen. Rasch führt ein Stichwort auf einen Gedanken, der sofort wieder zu Gunsten einer neuen Assoziation verlassen wird; in schweren Fällen wirken die Äußerungen weitgehend unverständlich. Auffällig sind zudem Neologismen (sprachliche Neuschöpfungen) und eine eigenartige Manieriertheit in Sprache, Verhalten und Kleidung. Während man die soweit geschilderten Symptome als psychische Neuschöpfungen betrach- 114 4 Biologische Grundlagen und biologische Behandlung psychischer Störungen ten kann und als Plus- oder Positivsymptomatik zusammenfasst, sind weitere Auffälligkeiten eher als Verhaltensdefizite zu begreifen; sie werden unter Minus- oder Negativsymptomatik subsumiert. Dazu gehören sozialer Rückzug, Interessenverlust, Entschluss- und Antriebs­ losig­keit, Reduktion sprachlicher Äußerungen (Alogie), Entscheidungsunfähigkeit (Abulie), uneindeutige Einstellungen (Ambivalenz), zunehmend verminderte emotionale Beteiligung (Affektverflachung). Weiter zu nennen – nicht eindeutig der Positivoder Negativsymptomatik zuzuordnen – sind zum einen Affektinadäquatheit, welche nicht selten mit einem »läppischen« Verhalten einhergeht, zudem psychomotorische Auffälligkeiten, die man bei einem gewissen Ausprägungsgrad als katatone Symptome bezeichnet; dies können Bewegungsstereotypen sein, ebenso aber extreme Regungslosigkeit für Stunden und Tage, welche die schwere, zuweilen lebensbedrohliche Form des katatonen Stupors annehmen kann. Differenzialdiagnostischer Hinweis Zuweilen ist es nicht einfach, Schizophrenie mit vorwiegender Negativsymptomatik von einer Depression (einem depressiven Syndrom) abzugrenzen. Hier hilft zum einen bereits die Über­ legung weiter, dass Depressionen (wenigstens in typischer Form) eher bei Frauen und meist nach dem 30. Lebensjahr auftreten, schizophrene Minussymptomatik hingegen gehäuft bei männ­lichen jüngeren Personen. Auch Manieriertheit der Sprache sowie psychomotorische Auffälligkeiten passen eher zur Schizophrenie. Nicht ohne Grund sprechen viele Psychiater von dem »Praecoxgefühl«, welches sich bei ihnen im Kontakt mit den Patienten einstellt. Gleichwohl wird sicher manche Schizophrenie – nicht unbedingt zum Nutzen der Patienten – lange als Depression in den Krankenakten geführt. Eine spezielle Symptomatik, die sich – wenn überhaupt – in der Regel erst nach längerem Verlauf einstellt, ist das schizophrene Residu- um (der schizophrene Residualzustand), gekennzeichnet durch andauernde Minussymptomatik, besonders Interessenverlust, Verlangsamung, Sprachverarmung, Affektverflachung, Einschränkung sozialer Kontakte, Vernachlässigung der Körperpflege und des eigenen Äußeren. • • • • • • Wie erwähnt, gibt es verschiedene Arten der Unterteilung schizophrener Symptomatik. Eine grobe, jedoch unter biologischen Aspekten nützliche Einteilung ist die in Typ-I- und Typ-IISchizophrenie: Die erste Form ist v. a. durch produktive Symptomatik gekennzeichnet, die zweite durch Vorherrschen von Minussymptomen. Häufig liegen jedoch gemischte Symptome vor; so kann etwa die Minussymptomatik von Wahn und Halluzinationen begleitet sein (s. Anmerkung 12, S. 321). Vereinfachend lassen sich die Verläufe so skizzieren: Die eher bei Frauen zu findenden Formen mit überwiegender Positivsymptomatik beginnen meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr; häufig bleibt es bei einer einzigen oder nur wenigen Episoden, die weitgehend folgenlos ausheilen; in anderen Fällen treten zahlreiche Rezidive auf, nach denen oft Einschränkungen zurückbleiben, etwa im Kontakt- und Leistungsbereich. Bei einem gewissen Prozentsatz kommt es zunehmend zur Entwicklung einer Minussymptomatik und zum Übergang in den Residualzustand; die Betroffenen können dann nicht mehr einem geregelten Berufsleben nachgehen und sind teilweise auf Pflege in Heimen angewiesen. Generell gilt die Pro­ gnose der eher männliche Personen treffenden, im Allgemeinen früher einsetzenden und weniger in Schüben verlaufenden Schizophrenie mit initial ausgeprägter Minussymptomatik als schlechter; Vollremissionen sind seltener, ein Übergang in das Residualstadium häufiger. Eine familiäre Häufung der Störung ist gut belegt. Gezeigt werden konnte auch, dass Kinder 4.2 Schizophrenie schizophrener Eltern, die in gesunden Adoptivfamilien aufwachsen, zu einem ähnlich hohen Prozentsatz Schizophrenie entwickeln wie je­ ne, die bei ihren erkrankten Eltern verbleiben. Untersuchungen ergeben bei eineiigen Zwillingen (mit identischen Erbanlagen) diesbezüglich deutlich höhere Konkordanz als bei zweieiigen. Zur Vererbung liegen mittlerweile klarere Befunde vor; Veränderungen auf einzelnen Chromosomen wurden beschrieben, die u. a. Einfluss auf den Dopaminstoffwechsel sowie die Hirnreifung haben (Howes u. Kapur 2009). Sicher handelt es sich nicht um einen einfachen Erbgang; zudem entscheiden Umweltvariablen wesentlich mit, ob die Erkrankung zum Ausbruch kommt. 4.2.2 Biologische Grundlagen ■■Die Dopaminhypothese. Dieses bekannteste und empirisch gut gestützte Modell der Schizophrenie bezieht sich im Wesentlichen auf Formen mit Positivsymptomatik. Als deren Grundlage wird eine Überaktivierung an dop­ aminergen Synapsen mesolimbischer Bahnen angenommen. Mittlerweile besteht weitgehend Konsens darüber, dass die Neurone nicht so sehr verstärkt Transmitter freisetzen, sondern dass postsynaptische Dopaminrezeptoren in diesen Regionen vermehrt (oder überempfindlich) sind; dies betrifft speziell die des Typs D2 , in geringerem Maße wohl D4-Rezeptoren. Abgeleitet wurde die Dopaminhypothese aus der Tatsache, dass mit klassischen Neuro­lep­ tika behandelte Schizophreniepatienten nicht selten Symptome entwickeln, die denen der Parkinson-Krankheit gleichen (s. Abb. 4-1 und Kap. 4.2.3). Deren Pathogenese ist bekannt, nämlich der Untergang von Neuronen in der Substantia nigra des Mittelhirns; dies führt zur Minderaktivität dopaminerger Bahnen ins Striatum und dort zu Dopaminverarmung. Daraus folgerte man, dass Neuroleptika ebenfalls die Aktivität des dopaminergen Systems 115 dämpfen. Auch der Wirkmechanismus konnte geklärt werden: Die Substanzen blockieren Dopaminrezeptoren; die Blockade dieser Bindungsstellen im limbischen System wird für den antipsychotischen (gegen die Plussymptome gerichteten) Effekt verantwortlich gemacht, die im Striatum für motorische Nebenwirkungen. Somit lag es nahe, die schizophrene Symptomatik auf Dopaminüberaktivität zurückzuführen. Diese Annahme wurde dadurch ­gestützt, dass der Dopaminpräkursor L-Dopa bei Parkinson-Patienten manchmal Wahn und Halluzinationen hervorruft, weiter dass die dop­ aminagonistischen Amphetamine und ­Cocain schizophrenieähnliche Symptome auslösen können (sogenannte Amphetamin- und Cocainpsychosen). Damit ist nicht zu entscheiden, ob diese Dop­ aminüberaktivität auf vermehrte präsynaptische Ausschüttung oder auf Überaktivität post­ synaptischer Bindungsstellen zurückgeht – in jedem Fall würde Rezeptorblockade antago­ nistisch wirken. Rezeptorbindungsstudien legen jedoch eine Vermehrung postsynaptischer Dopamin­bindungs­stellen nahe. Dies gilt offenbar speziell für D2-Rezeptoren, denn an diese binden einige antipsychotisch sehr wirksame Neuroleptika besonders stark; zudem finden sie sich in hoher Dichte im Striatum, was die neuroleptisch induzierte Parkinson-Symptomatik erklären würde. Die Bedeutung anderer Typen von Dopaminrezeptoren für die Pathogenese produktiver Schizophreniesymptome ist umstritten. Eine gewisse Rolle dürften D4-Rezeptoren spielen, die sich v. a. in limbischen Strukturen finden; möglicherweise sind sie – neben den D2-Rezeptoren – ebenfalls vermehrt. ■■Die Hypofrontalitätshypothese. Die Negativ- symptomatik lässt sich nicht über eine erhöhte Dopaminaktivität erklären; möglicherweise ist dieses System sogar dabei vermindert aktiv. Hier wird in der Literatur am häufigsten die These der Hypofrontalität vertreten: Bei Pa­ tien­ten mit Minussymptomatik soll eine Min-