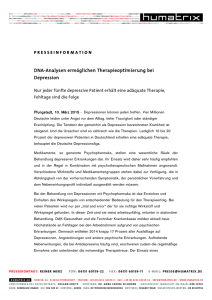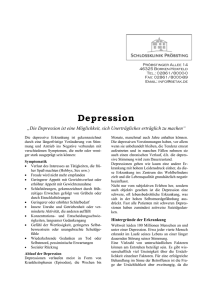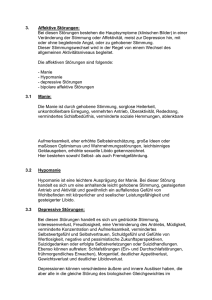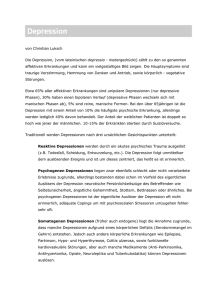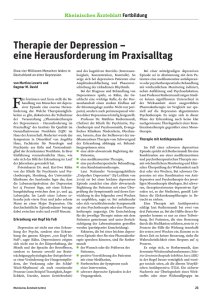Depression Depression Diagnose und Depressionen
Werbung
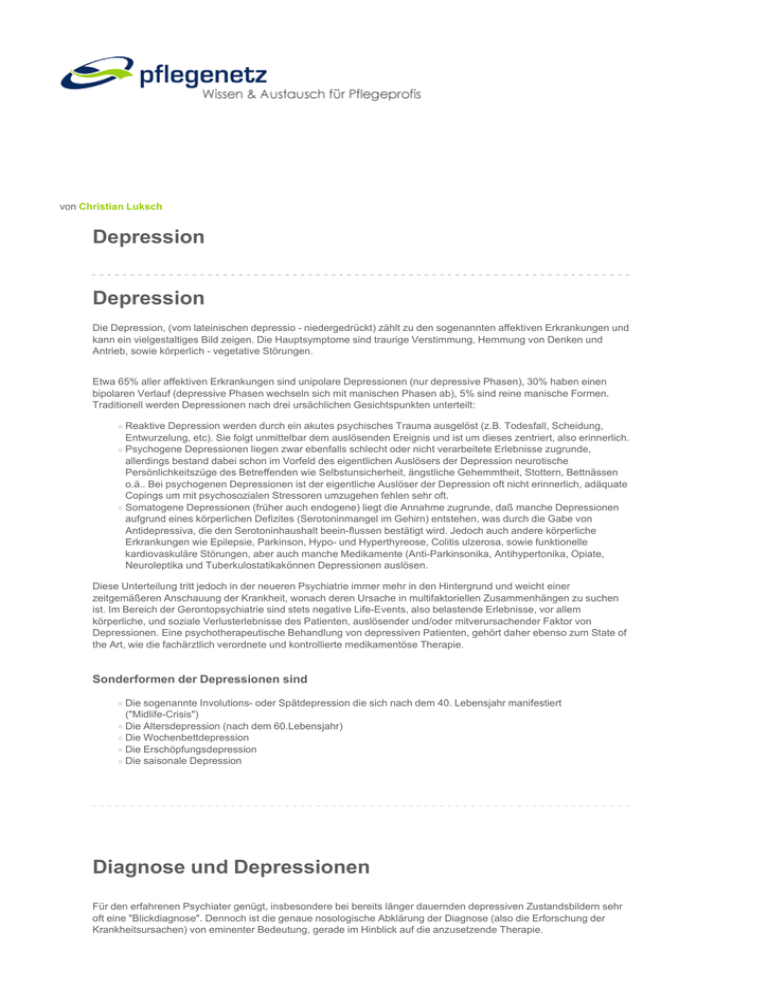
von Christian Luksch Depression Depression Die Depression, (vom lateinischen depressio - niedergedrückt) zählt zu den sogenannten affektiven Erkrankungen und kann ein vielgestaltiges Bild zeigen. Die Hauptsymptome sind traurige Verstimmung, Hemmung von Denken und Antrieb, sowie körperlich - vegetative Störungen. Etwa 65% aller affektiven Erkrankungen sind unipolare Depressionen (nur depressive Phasen), 30% haben einen bipolaren Verlauf (depressive Phasen wechseln sich mit manischen Phasen ab), 5% sind reine manische Formen. Traditionell werden Depressionen nach drei ursächlichen Gesichtspunkten unterteilt: Reaktive Depression werden durch ein akutes psychisches Trauma ausgelöst (z.B. Todesfall, Scheidung, Entwurzelung, etc). Sie folgt unmittelbar dem auslösenden Ereignis und ist um dieses zentriert, also erinnerlich. Psychogene Depressionen liegen zwar ebenfalls schlecht oder nicht verarbeitete Erlebnisse zugrunde, allerdings bestand dabei schon im Vorfeld des eigentlichen Auslösers der Depression neurotische Persönlichkeitszüge des Betreffenden wie Selbstunsicherheit, ängstliche Gehemmtheit, Stottern, Bettnässen o.ä.. Bei psychogenen Depressionen ist der eigentliche Auslöser der Depression oft nicht erinnerlich, adäquate Copings um mit psychosozialen Stressoren umzugehen fehlen sehr oft. Somatogene Depressionen (früher auch endogene) liegt die Annahme zugrunde, daß manche Depressionen aufgrund eines körperlichen Defizites (Serotoninmangel im Gehirn) entstehen, was durch die Gabe von Antidepressiva, die den Serotoninhaushalt beein-flussen bestätigt wird. Jedoch auch andere körperliche Erkrankungen wie Epilepsie, Parkinson, Hypo- und Hyperthyreose, Colitis ulzerosa, sowie funktionelle kardiovaskuläre Störungen, aber auch manche Medikamente (Anti-Parkinsonika, Antihypertonika, Opiate, Neuroleptika und Tuberkulostatikakönnen Depressionen auslösen. Diese Unterteilung tritt jedoch in der neueren Psychiatrie immer mehr in den Hintergrund und weicht einer zeitgemäßeren Anschauung der Krankheit, wonach deren Ursache in multifaktoriellen Zusammenhängen zu suchen ist. Im Bereich der Gerontopsychiatrie sind stets negative Life-Events, also belastende Erlebnisse, vor allem körperliche, und soziale Verlusterlebnisse des Patienten, auslösender und/oder mitverursachender Faktor von Depressionen. Eine psychotherapeutische Behandlung von depressiven Patienten, gehört daher ebenso zum State of the Art, wie die fachärztlich verordnete und kontrollierte medikamentöse Therapie. Sonderformen der Depressionen sind Die sogenannte Involutions- oder Spätdepression die sich nach dem 40. Lebensjahr manifestiert ("Midlife-Crisis") Die Altersdepression (nach dem 60.Lebensjahr) Die Wochenbettdepression Die Erschöpfungsdepression Die saisonale Depression Diagnose und Depressionen Für den erfahrenen Psychiater genügt, insbesondere bei bereits länger dauernden depressiven Zustandsbildern sehr oft eine "Blickdiagnose". Dennoch ist die genaue nosologische Abklärung der Diagnose (also die Erforschung der Krankheitsursachen) von eminenter Bedeutung, gerade im Hinblick auf die anzusetzende Therapie. Diagnostisch-anamnestisches Gespräch Wichtigstes diagnostisches Instrument ist dazu das ärztliche diagnostisch-anamnestische Gespräch, in dem neben Fragen nach erinnerlichen Auslösern auch Schlaf- und Appetitstörungen, Antriebsstörungen und Veränderungen im Selbstwertgefühl erfragt werden. Oft müssen die unmittelbaren Aussagen des Patienten mit einer sogenannten Fremdanamnese (einem Gespräch mit den unmittelbaren Angehörigen des Patienten) sowie verschiedenen psychologischen Tests (z.B. GDS) komplementiert werden. Im Rahmen der Altersdepression ist stets auch ein differentialdiagnostischer Prozeß angebracht, da depressive Zustände im Alter ein sehr ähnliches Bild wie dementielle Zustände zeigen können, jedoch einer völlig anderen Therapie bedürfen. Auch das Erscheinungsbild der Depression ist von Bedeutung für das weitere therapeutische Vorgehen. Demnach können wir folgende vier Arten unterscheiden: Die gehemmte Depression, bei der eine deutliche Antriebsreduzierung vorliegt Die agitierte Depression, bei der eine krankhaft gesteigerte Bewegungsunruhe imponiert Die larvierte Depression, bei der vegetative Störungen im Vordergrund stehen Die psychotische Depression, bei der sogenannte depressive Wahnarten auftreten können Symptome Psychisch Gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit, Interessensverlust (morgendliches Tief) Verminderung der Konzentrationsfähigkeit, Denkverlangsamung, Verminderung des Selbstwertgefühls, Ängstlichkeit, Schuldgefühle, Gefühle der Wertlosigkeit, Negativpessimistische Zukunftsperspektiven, Tendenz zur Verwahrlosung, Abbruch sozialer Kontakte, Suizidale Gedanken. Psychomotorisch Verminderung des Antriebs und der Lebensenergie, Psychomotorische Hemmung oder gesteigerte ziellose Angetriebenheit, gebeugte Haltung, ausdruckslose Mimik, leise und monotone Stimmme, matte und fahrige Gestik. Psychovegetative Symptome Erhöhte Ermüdbarkeit Schlafstörungen (Ein- und Durchschlafstörung, frühes Erwachen), verschiedene meist als "beengende" oder "schneidende" beschriebene Leibschmerzen (Rücken, Kopf, Nacken, Brust, Bauch,) Appetitverlust, Obstipation, Libidoverlust. Therapie von Depressionen Grundlage der Depressionsbehandlung ist das verständnisvolle, stützende Gespräch ("supportive Psychotherapie") mit Erstellung eines Gesamtbehandlungsplanes. Je nach dem ätiologischen Schwerpunkt der Störung stehen entweder die Therapie mit Antidepressiva oder die Psychotherapie (und andere Therapieformen) im Vordergrund. Die Behandlungsstrategie gliedert sich in drei Phasen: Akutbehandlung (3-6 Wochen) Erhaltungstherapie (3-6 Monate) Rezidivprophylaxe (Jahre bis lebenslang) Ob eine stationäre oder ambulante Behandlung erfolgt hängt von der Einschätzung des Schweregrades der Depression bzw. der Suizidalität ab. Immer jedoch sollte diese Einschätzung durch einen praktizierenden oder klinischen Psychiater erfolgen. Pharmakotherapie (Antidepressiva) Bei der Behandlung von Depressionen ist die Wahl des richtigen Medikamentes von besonderer Bedeutung,- um eine richtige Auswahl des Medikamentes zu treffen ist allerdings eine genaue nosologische Abklärung der Depression durchzuführen. Antidepressiva können nicht die Ursache einer Depression bekämpfen, sondern lediglich die Erscheinungsform mit Antidepressiva können nicht die Ursache einer Depression bekämpfen, sondern lediglich die Erscheinungsform mit ihrer vielfältigen Symptomatik. Einer Behandlung mit Antidepressiva, vor allem in der Gerontopsychiatrie sollte immer auch gleichzeitig eine fundierte psycho-therapeutische Begleitung beigestellt sein. Antidepressiva sind chemisch verschiedene Substanzen, deren Haupteigenschaft eine stimmungsaufhellende Wirkung ist, die aber ausschließlich im Kurgebrauch, also nach frühestens drei Tagen eintritt und ihr volles Wirkungsspektrum erst nach zwei bis drei Wochen entfaltet. Das heißt, daß eine Beurteilung der Wirksamkeit eines Antidepressivum sowie ein eventueller Medikamentenwechsel erst nach diesem Zeitraum sinnvoll ist. Auf keinen Fall sind Antidepressiva Stimulanzien! Nimmt ein Gesunder Antidepressiva, wird er müde und zeigt vegetative unerwünschte Wirkungen! Die Auswahl von Antidepresiva richtet sich in erster Linie nach dem Erscheinungsbild der Depression sowie dem Nebenwirkungsprofil des Präparats. Vom Wirkungsprofil her unterscheiden wir Antidepressiva mit sedierender Wirkung die vor allem bei der ängstlich-agitierten Depression eingesetzt werden, von Antidepressiva mit antriebssteigernder Wirkung, (bei gehemmten Depressionen). Die beiden gemeinsame Wirkung ist die Normalisierung von Antrieb Befindlichkeit. Insbesondere bei der letzteren Gruppe ist im klinischen Gebrauch jedoch höchste Vorsicht geboten, da der antriebssteigernde Effekt meist vor dem antidepressiven Effekt einsetzt und sich somit die Gefahr eines Suizidversuches erhöhen kann! Eine Anwendung von antriebssteigernde Antidepressiva ist also nur in Verbindung mit einem klinischen Aufenthalt, bzw. bei einem dichten und gut informierten sozialen Umfeld vertretbar. Bisweilen müssen Antidepressiva auch mit anderen (Psycho-) Pharmaka kombiniert werden, etwa niederpotenten Neuroleptika oder Benzodiazepine. In diesem Fall ist aber eine stationäre Aufnahme auf psychiatrischen Intensivstationen dringend anzuraten. Der "experimentellen Psychopharmakologie" mancher praktischer (und unpraktischer) Ärzte ist auch seitens der Pflege entschieden entgegenzutreten! Umgang mit Antidepressiva Prinzipiell werden die Antidepressiva "eingeschlichen" das heißt relativ langsam (in 3-7 Tagen) auf die Erhaltungsdosis gebracht. Im ambulanten Setting, also ohne fachärztliche Kontrolle sollte dies noch langsamer geschehen. Antidepressiva können dabei (innerhalb dieser Anflutungszeit) auch intravenös eingebracht werden, allerdings muß dies wirklich langsam geschehen, da sonst die Nebenwirkungsrate und das Risiko von pharmakogenen Delirien und Krampfanfällen extrem ansteigt. Aber auch die Berücksichtigung der Tageszeiten ist wichtig: Sedierende Antidepressiva sollten hauptsächlich in ihrer Hauptdosis abends gegeben werden, so kann man sich die Hypnotika sparen, indem man die schlafanstoßende Wirkung des Medikaments nutzt. Antriebssteigernde Medikamente sollten dagegen am vor allem am Morgen gegeben werden. Von zentraler Bedeutung ist die Etablierung einer zuverlässigen Medikamenteneinnahme, entweder durch den Patienten selbst, wenn dieser eine hohe Compliance zeigt (dies wird er im übrigen erst, wenn er über Krankheit und Medikament aufgeklärt ist) oder durch die Pflegepersonen. Ein selbständiges und/oder vorzeitiges ersetzen des Medikamentes aufgrund offensichtlicher Besserung der Symptome ist nicht zu empfehlen. Nach Abklingen der depressiven Symptomatik empfiehlt es sich in der Regel, eine anti-depressive Erhaltungsmedikation für eine Dauer von ca. 6 - 12 Monate fortzuführen, da während dieser Zeit eine hohe Rückfallsquote besteht. Dennoch sind auch Antidepressiva keine Dauermedikation, die ungeprüft über Jahre gegeben werden können! Nur bei rezidivierenden bzw. phasenhaften Verläufen muss die Langzeitmedikation mit einem Antidepressivum oder sogenannten Phasenprophylaktika wie Lithium fortgesetzt werden. Mögliche unerwünschte Wirkungen von Antidepressiva 1.Anticholinerg/Vegetativ: Trockenheit der Schleimhäute insbesondere in Nase, Mund und Augen Vorübergehende Akkomodationsstörungen Verstärkung der obligatorischen Obstipation 2. Kardiovaskulär: Blutdruckabfall und Tachykardie insbesondere zu Beginn der Therapie und morgens Herzrhythmusstörungen, insbesondere bei älteren Patienten (RR-Abfall) 3. Endokrin: Gewichtszunahme Störungen von Libido und Potenz 4. Neurologisch: Tremor und Dysarthrie Bei zu hohen Dosen cerebrale Krampfanfälle und Dyskinesien 5. Psychisch: Pharmakogene Delirien, insb. bei Amitryptilin und Nortryptilin Provokation schizophrenieartiger produktiver Symptome (z.B. Halluzinationen) Vor allem bei Älteren und Risikopatienten können diese Nebenwirkungen unter Umständen schwerwiegende Folgen haben (Harnverhalten, Kreislaufkollaps, Stürze). Hier sind deshalb in der Regel immer niederigere Dosierungen angezeigt. Psycho-(logische) Therapie Wenn ein Mensch zu einem Arzt (oder einer Pflegeperson) kommt (oder gebracht wird) dann sucht (oder braucht) er in erster Linie Hilfe und nicht Tabletten. Im Zentrum dieser Hilfe steht immer das direkte Gespräch zwischen Hilfesuchenden und Hilfeleistenden. Mitunter kann es vorkommen, daß diese Form der Hilfeleistung erst möglich wird, wenn zuvor andere Maßnahmen (wie z.B. Medikamente) gesetzt wurden. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß Medikamente, insbesondere Psychopharmaka, das zwischen-menschliche Gespräche ersetzen könnte (oder sogar soll). Im Rahmen der Behandlung von psychischen Krankheiten müssen wir genauso winen mehrdimensionalen Ansatz wahren, wie die Krankheit selbst eine mehrdimensionale Ätio-logie aufweist. Das heißt: Wir müssen den Menschen durch biologische (z.B. medikamentös), soziologische (durch Beziehungsarbeit) und psychologische (durch Kommunikation) Methoden zu heilen versuchen. Wie wir diese Behandlungsmethoden letztendlich benennen (und auch wer sie vollzieht) ist nur sekundär wichtig, primär wichtig ist, daß sie überhaupt passieren und daß der, der sie anwendet, weiß, was er tut, bzw. tun oder unterlassen muß. Wenn wir im folgenden also von psychologischer Therapie sprechen, dann schließen wir die klassischen anerkannten Formen der Psychotherapie mit ein, das einfache Entlastungsgespräch zwischen Betreuungsperson und Bewohner aber dezidiert nicht aus. Das psychotherapeutische Einzelgespräch Findet zwischen zwei Menschen (Helfer und Klient) statt und hat Befindlichkeit und erleben des Klienten zum Inhalt. Es kann tröstend, klärend, unterstützend oder anleitend sein, immer ist es jedoch getragen von der Empathie (Einfühlung) des Helfers, seiner Kongruenz (Echt-sein), von der Bereitschaft zur Verbalisation von Gefühlsinhalten, von Wertfreiheit der Äusserungen des Klienten und einer validativen Grundhaltung des Helfers. Das psychotherapeutische Gruppengespräch Findet zwischen einem (oder mehreren) Helfern und einer Gruppe von Klienten statt, die ein gleiches oder ähnliches Problem haben. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben der Klienten, das Lernen, das sie nicht mit ihrer Krankheit alleine sind und die Möglichkeit der gegenseitigen Hilfe bzw. des Lernens mit- und voneinander. Animation, Kunst- und Musiktherapie Sind (psycho-)therapeutische Arbeitsweisen, die auf der Ebene der Kreativität dem Klienten Raum zur Kommunikation geben, der auf einer verbalen Ebene nicht, bzw. nicht mehr gefunden werden kann. Insbesondere im Bereich der Altenarbeit, wo die Betroffenen sehr oft unter kognitiven Defiziten leiden sind sie unverzichtbare Arbeitsweisen Andere Therapieformen der Depression: Lichttherapie: Wird bei saisonal bedingten Depressionen angewandt. Die Patienten sind dabei mehrmals pro Tag für 20 - 30 Minuten einer Lichtquelle ausgesetzt, die Tageslicht simuliert. Schlafentzugstherapie: Bei etwa 35% der Patienten äusserst wirksame Therapieform, bei der der Patient eine volle Nacht nicht schlafen darf und dadurch eine etwa 3-5 Tage andauernde Symptombesserung erfährt. Elektrokrampftherapie: Nur mehr äusserst selten und vor allem bei jüngeren, pharmako-therapieresistenten Patienten unter Vollnarkose angewandt . Pflege Der Erfolg der Behandlung und Pflege depressiver Patienten steht und fällt mit der unmittelbaren Bezugsperson des Patienten im therapeutischen Team. Es ist von der allergrößten Bedeutung ob sich der Patient in der Behandlungssituation geborgen fühlt, wozu vor allem die unmittelbare Gegenwart und Nähe der Schwester (oder des Pflegers) gehört. "Da Sein" Diese Nähe ist jedoch in erster Linie nicht mit verbalen Kommunikationsmitteln mitzuteilen, sondern hauptsächlich durch tatsächliches "Da-sein", durch Empathie, Kongruenz, und Konsequenz sowie durch soziale und körperliche Nähe. Sehr oft ist es tatsächlich die Berührung oder das miteinander schweigen, das dem Patienten mehr aus seiner seelischen Isolation bringt, als das therapeutische Gespräch, insbesondere in der Phase der tiefsten Depression, die viele Patienten als "Nichts-fühlen-können" beschreiben. Oberflächliches aufmuntern, gute Ratschläge oder herunterspielen seiner Probleme treibt den Patienten im allgemeinen noch tiefer in sein desolates Selbstwertgefühl, da es ihm zeigt, daß niemand seine Probleme tatsächlich versteht oder verstehen will. Gefahr des Überpflegens Insbesondere bei Patienten mit antriebsreduzierten Depressionen ist die Gefahr sehr groß, sie zu überpflegen und wie kleine Kinder zu behandeln. Man nimmt ihnen so die letzte Selbständigkeit, signalisiert ihnen, daß sie die einfachsten Aufgaben nicht mehr können und somit keinen Wert mehr haben. Ganz ähnliches passiert, wenn man die depressiven Patienten unter Zeit- und/oder Leistungsdruck setzt. Depression ist eine "langsame" Krankheit, das heißt, dass die Patienten eine klare Reduktion ihrer Geschwindigkeit haben. Sie an die eigene Arbeitsgeschwindigkeit bzw. den Stationsrhythmus anpassen zu wollen (anstatt diesen an das Geschwindigkeitsvermögen der Betroffenen), geht zwangsläufig schief. Leben in der Abteilung Von Anfang an sollte der Patient am Leben der Abteilung teilhaben, ohne daß besonders große bzw. schwierige Aktivitäten von ihm verlangt werden. Insbesondere Zwang (auch die sogenannte "freiwillige" Form davon) führt beim depressiven Patienten eher zum Gegenteil. Natürlich heißt dies wiederum nicht, daß der Patienten nichts tun muß (oder gar: nichts tun darf), jedoch ist hier vor allem darauf wertzulegen, dass das, was er tun soll ihn nicht überfordert, von seinem negativen Denkinhalten ablenkt und durch positive Verstärkung unsererseits unterstützt. (Bett)-Ruhe, zu der alle depressiven Patienten im Rahmen ihres Krankheitsbildes obligatorisch tendieren, ist in jedem Fall kontraindiziert. Selbstwertgefühl Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Hebung auch des körperlichen Selbstwertgefühles, bzw. das Training der selbständigen Durchführung der ATL, insbesondere der Körperpflege-Aktivitäten, da bei den meisten Depressionen eine klare Tendenz zur Selbstverwahrlosung vorherrscht. Aber auch der Allgemeinzustand des Patienten benötigt mehr Aufmerksamkeit, insbesondere was Flüssigkeitszufuhr und Ernährung betreffen. Sehr oft helfen hier klare Direktiven und, insbesondere in den tieferen Phasen der Depression (jedoch nur hier), die Abnahme von Entscheidungen (z.b.: über die Menüwahl). Die obligatorisch auftretende und durch die anticholinerge Wirkung mancher Antidepressiva noch verstärkte Obstipation muß in der Pflegeplanung ebenfalls bedacht werden. Laxantien sind jedoch nur in Ausnahmefällen das Mittel der Wahl. In der Regel gilt hier vor allem Bewegung, schlackenreiche Kost und ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Das "öffentliche Abfragen" der Stuhlfrequenz des Patienten sollte prinzipiell vermieden werden, nicht nur beim depressiven Patienten. Quellen: MÖLLER Jürgen, Psychiatrie, Stuttgard 1996 DÖRNER & PFLOG; Irren ist menschlich; Stuttgard 1995; THIEL & JENSEN; Klinikleitfaden Psychiatrische Pflege; Stuttgard 1997