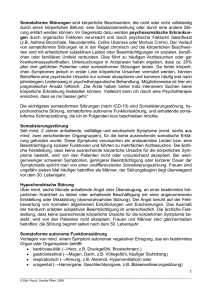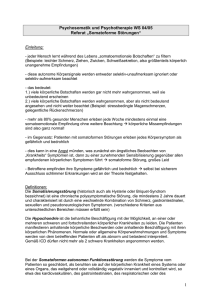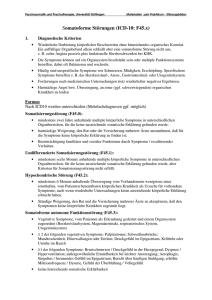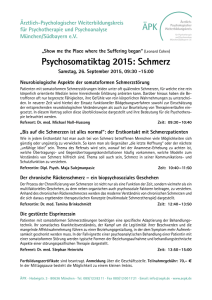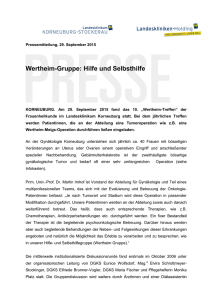Somatoforme Symptome in der Landarztpraxis
Werbung

Aus der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Somatoforme Symptome in der Landarztpraxis Eine empirische Untersuchung zur Häufigkeit, psychischen Begleitsymptomatik und Lebensqualität. INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Vorgelegt 2002 von Brigitte Krings-Ney geboren in Geilenkirchen Dekan: Prof. Dr. med. rer. nat. M. Schumacher 1. Gutachter: Prof. Dr. med. M. Wirsching 2. Gutachter: Prof. Dr. med. D. Richter Tag der mündlichen Prüfung: 17.04.2002 Für Johannes Danksagung Hiermit möchte ich allen danken, mit deren Rat und Unterstützung diese Arbeit entstanden ist. Zunächst gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Wirsching für die Möglichkeit der Durchführung dieser Promotionsarbeit und die Übernahme des Erstgutachtens. Herrn Prof. Dr. med. Richter danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens. Im Rahmen der Fort- und Weiterbildung im Bereich Psychosomatik in Gynäkologie und Geburtshilfe hat Herr Prof. Dr. med. Richter meinen beruflichen Werdegang mit geprägt. Für die geduldige Betreuung von der Entstehung bis zur Fertigstellung dieser Arbeit gilt mein Dank Herrn Dr. med. Kurt Fritzsche. Besonders danken möchte ich Frau Dipl. Psych. Astrid Larisch für die Unterstützung in methodischen und statistischen Fragen sowie für ihre intensive und kritische Betreuung in der letzten Phase dieser Arbeit. Mein Dank gilt auch den beiden Allgemeinärzten Herrn Miguel Pascual-Gracia und Herrn Joaquin Costa-Gracia, in deren Praxis ich als Praxisassistentin arbeiten und diese Studie durchführen durfte. Ebenso möchte ich mich bei den Arzthelferinnen der Praxis bedanken, die mich sehr unterstützt haben, PatientInnen für diese Studie zu gewinnen. Bedanken möchte ich mich auch bei den PatientInnen der Praxis, die bereit waren, an der Studie teilzunehmen. Mein besonderer Dank gilt meiner Familie, meinem Mann Michael und unserem Sohn Johannes. Sie haben mich „freigestellt“ für das Schreiben dieser Arbeit. Mein Mann ist gleichzeitig mein Mitdoktorand, mit dem ich mich immer wieder austauschen und kritisch auseinandersetzen konnte, dass wir beide die Geduld und den Mut zur Erstellung dieser Arbeit bewahren konnten. Auch bedanke ich mich an dieser Stelle bei vielen FreundInnen für ihre Gesprächsbereitschaft während der Lust- und Frustphasen dieser Arbeit. Nicht zuletzt möchte ich meinen Eltern danken, die mir meine Ausbildung ermöglicht haben. I Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung................................................................................................................. 1 2 Theoretische Grundlagen....................................................................................... 3 2.1 Definitionen der somatoformen Störungen....................................................... 3 2.2 Prävalenz der somatoformen Störungen ......................................................... 10 2.3 Differentialdiagnostik der somatoformen Störungen...................................... 22 2.4 Komorbidität mit anderen psychischen Störungen ......................................... 29 2.5 Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei somatoformen Störungen.............. 34 3 Eigene Fragestellungen und Hypothesen............................................................ 37 4 Methodik................................................................................................................ 40 4.1 Durchführung der Untersuchung .................................................................... 40 4.2 Beschreibung der Stichprobe .......................................................................... 41 4.3 Soziodemographische Merkmale und Repräsentativität der Stichprobe ........ 42 4.4 Messinstrumente ............................................................................................. 45 4.5 Statistische Auswertung.................................................................................. 48 5 Ergebnisse.............................................................................................................. 50 5.1 SOMS-2 Auswertung...................................................................................... 50 5.2 HADS-D Auswertung..................................................................................... 57 5.3 SF-12 Auswertung .......................................................................................... 60 5.4 Mini-DIPS Auswertung .................................................................................. 62 6 Diskussion .............................................................................................................. 65 7 Zusammenfassung ................................................................................................ 76 8 Literaturverzeichnis ............................................................................................. 77 Anhang........................................................................................................................... 83 I Tab. A1: Somatoforme Störungen im Vergleich der beiden Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV................................................................... ............. 83 II Tab. A2: Körperliche Symptome bei somatoformen Störungen............................. 89 III Tab. A3: Körperliche Symptome bei Angst- und Panikstörung nach ICD-10 ............... 90 IV Fragebogen: SOMS-2 ............................................................................................ 91 V Fragebogen: HADS-D............................................................................................. 94 IV Lebenslauf.............................................................................................................. 95 II Tabellen- und Abbildungsverzeichnis Tabellen Tab. 1: Prävalenzstudien in der Primärversorgung.........................................................21 Tab. 2: Komorbidität von somatoformen Störungen mit anderen psychischen Störungen.............................................................................................................33 Tab. 3: Soziodemografische Daten.................................................................................43 Tab. 4: Repräsentativität der Studienpopulation.............................................................44 Tab. 5: Unterschiedliche Diagnosezuweisungen............................................................52 Tab. 6: Vergleich somatoforme Störungen Männer / Frauen.........................................54 Tab. 7: Ein- und Ausschlusskriterien von somatoformen Störungen.............................55 Tab. 8: Anzahl der betroffenen Organsysteme...............................................................56 Tab. 9: Auffälligkeiten im SOMS-2 und in der HADS-D..............................................57 Tab. 10: Symptome nach Art der betroffenen Organsysteme........................................59 Tab. 11: Symptomhäufigkeit..........................................................................................59 Tab. 12: Aktuelle psychische Diagnose nach ICD-10 im Mini-DIPS............................63 Tab. 13: Übersicht Kennwerte SOMS-2, HADS-D, SF-12............................................64 Abbildungen Abb. 1: Übersicht Studienteilnahme...............................................................................42 Abb. 2: Häufigkeit somatoformer Symptome im SOMS-2............................................50 Abb. 3: SSI-4/6 Auffälligkeit im SOMS-2, nach DSM-IV und ICD-10........................52 Abb. 4: Geschlechtsabhängige Auffälligkeit im SOMS-2.............................................53 Abb. 5: Korrelation HADS-D/ SOMS-2 mit Regressionsgeraden.................................58 Abb.6: Häufigkeit der Praxisbesuche…………………………………………………. 61 Abb.7: Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage....................................................................61 1 1 Einleitung Bei somatoformen Symptomen liegen körperliche Beschwerden vor, ohne dass die Beschwerden durch einen organischen Befund ausreichend erklärt werden können. Die PatientInnen vermuten eine somatische Ursache ihres Leidens und suchen somatomedizinische Behandlungen auf. Somatoforme Symptome stellen eine Herausforderung in der hausärztlichen Praxis dar. Als ÄrztInnen fühlen wir uns oft überfordert mit PatientInnen, bei denen keine körperliche Ursache ihres Leidens zu erkennen ist. Wir sind daraufhin ausgebildet, mögliche schwerwiegende körperliche Erkrankungen abzuklären. Aus Angst vor einer möglichen Fehldiagnose wird oft eine umfangreiche Diagnostik eingesetzt, bevor geschlossen wird, dass keine körperliche Erkrankung vorliegt, die das Symptom erklären könnte (PEVELER et al. 1997). Ein großer Teil der PatientInnen zeigt die Beschwerden nur vorübergehend und lässt sich durch einen negativen medizinischen Befund beruhigen. Ein kleinerer Teil zeigt deutliche Chronifizierung (KRIEBEL et al. 1996). Die bestehende Struktur des Gesundheitssystems mit einer vorwiegend somatischen Orientierung und Betonung technischer Methoden kann mit als relevante Ursache für den oft chronischen Verlauf psychosomatischer Störungen betrachtet werden (STURM und ZIELKE 1988). Die Schulmedizin beherrscht an den Universitäten die Krankenversorgung, die Forschung und die Lehre (WIRSCHING 2000). Die Zwänge einer naturwissenschaftlich organisierten Medizin scheinen manchmal unüberwindlich (FRITZSCHE et al. 2000b). Das biomedizinische Gesundheitssystem der westlichen Welt mit seiner dualistischen Trennung zwischen körperlichen und psychischen Symptomen beinhaltet eine bedeutsame Verstärkung für Somatisierung (KRIEBEL 1996). Oft sind es aber auch die PatientInnen selbst, die in rigider und oft sehr ansprüchlichen Form auf einer „medizinischen Lösung“ ihrer Symptomatik bestehen (HILLER, RIEF 1998a). Das Festhalten an einer organischen Ursache bedeutet für die PatientInnen eine Legitimierung für ihre Beschwerden (AWMF online 1998). Zahlreiche Synonyme werden benutzt, um somatoforme Beschwerden zu beschreiben. Am gebräuchlichsten ist die Bezeichnung funktionelle Störung oder funktionelles Syndrom. Auch Begriffe wie psychovegetatives Syndrom, vegetative Dystonie, allgemeines psychosomatisches Syndrom, psychische Überlagerung, vegetatives Erschöpfungssyndrom, psychogene Schmerzstörung, Neurasthenie, oder neurozirkulatorische Asthenie versuchen PatientInnen mit körperlichen Beschwerden ohne ausreichendenden organischen Befund zu beschreiben. Auch einige neue Bezeichnungen von 2 Krankheitsbildern wie die multiple chemische Überempfindlichkeit (MCS), das chronische Müdigkeitssyndrom (chronic Fatigue Syndrome, CFS) oder die Fibromyalgie (FM) weisen eine deutliche Nähe zu den somatoformen Störungen auf (FALLER 1999, BARSKY und BORUS 1999). Die Flut der Begriffe zeigt die Unsicherheit im Umgang mit diesen PatientInnen und ihren Leiden (HERRMANN 1996). In verschiedenen Schätzungen wird davon ausgegangen, dass bis zu 60% der in Arztpraxen geschilderten Symptome nicht oder nicht eindeutig auf organmedizinische Erkrankungen zurückzuführen sind (KATON et al. 1984). Somatoforme Erkrankungen werden nach der ICD-10 bzw. DSM-IV als psychische Störungen klassifiziert (s. Abschnitt 2.1). Die PatientInnen mit körperlichen Beschwerden ohne organischen Befund kommen jedoch zunächst zu HausärztInnen, AllgemeinmedizinerInnen und InternistInnen, nicht zu PsychiaterInnen (HERRMANN 1996). In der klinischen Praxis wird die Diagnose selten gestellt (s. Abschnitt 2.2). Somatoforme Störungen werden von vielen ÄrztInnen nicht für ein eigenständiges Krankheitsbild gehalten, sie sind oft eine Ausschlussdiagnose. Den ÄrztInnen in der Primärversorgung fehlt es an positiven diagnostischen Kriterien zur Erkennung von somatoformen Erkrankungen (HERRMANN 1996). Sowohl in organmedizinischen Lehrbüchern als auch in psychologischen und psychotherapeutischen Werken nimmt die Gruppe der somatoformen Störungen nur wenig Raum ein (RIEF 1996). Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Häufigkeit von PatientInnen mit multiplen somatoformen Symptomen in einer ausgesuchten hausärztlichen Praxis zu erfassen. Bei diesen PatientInnen werden psychische Symptome wie Ängstlichkeit und Depressivität sowie die körperliche und psychische Beeinträchtigung mit untersucht. 3 2 Theoretische Grundlagen Was sind somatoforme Störungen? Wie häufig kommen somatoforme Störungen vor? Welche anderen Erkrankungen oder Störungen könnten die Beschwerden der PatientInnen erklären? Gehen somatoforme Störungen häufiger mit anderen Erkrankungen einher? Wie krank fühlen sich PatientInnen mit somatoformen Störungen? In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Definitionen von somatoformen Störungen, Studien zur Prävalenz, mögliche Differentialdiagnosen, Studien zur Komorbidität der somatoformen Störungen mit anderen psychischen Störungen sowie mögliche psychosoziale Einschränkungen der PatientInnen mit somatoformen Störungen vorgestellt. 2.1 Definitionen der somatoformen Störungen Das Auftreten einzelner somatoformer Symptome ist nicht gleichbedeutend mit einer somatoformen Störung. Nur wenn die körperlichen Beschwerden mit einem erheblichen subjektiven Leiden oder Beeinträchtigungen im sozialen, beruflichen oder familiären Lebensumfeld verbunden sind, kann diese Diagnose gestellt werden (SASS et al. 1998). Vorübergehende organisch unerklärte Körperbeschwerden, die nicht zum Anlass wiederholter Arztbesuche werden, gehören zur Normalität. Sie dürfen nicht mit den zur Chronifizierung neigenden somatoformen Störungen verwechselt werden (AWMF online 1998). Nach KELLNER (1987) nehmen 60% bis 80% der gesunden Bevölkerung einmal pro Woche körperliche Missempfindungen wahr. Mitbestimmend für das Umgehen mit körperlichen Missempfindungen sind die Erklärungsmodelle der PatientInnen. ROBBINS und KIRMAYER (S. 1029, 1991) beschreiben: „Deciding what to do about a symptom- whether to ignore it, worry about it , take a home remedy, or see the doctor-depends in large measure on what he believes is the cause of the symptom.“ PatientInnen mit somatoformen Störungen deuten harmlose körperliche Empfindungen eher als Hinweis auf eine körperliche Schwäche oder Erkrankung (LIEB und MARGRAF 1994). Diese PatientInnen zeigen im Umgang mit trivialen körperlichen Empfindungen somatisierungstypische Verhaltensweisen wie Schonverhalten, Medikamenteneinnahme, Sorge um die Gesundheit, häufige Arztbesuche und vermehrte Aufmerksamkeit auf körperliche Veränderungen (LIEB 1998). Gerade dem Schonverhalten kann eine krankheitsaufrechterhaltende Funktion zukommen. Ein körperlich un- 4 trainierter Zustand stellt ein Risiko für die erhöhte Wahrnehmung und Fehlbewertung von Körperempfindungen dar (RIEF 1998). Vor der Einführung der Diagnose einer somatoformen Störung nach ICD-10 oder DSM-III waren die Kriterien kaum vergleichbar, die angewandt wurden, um PatientInnen mit funktionellen Beschwerden zu diagnostizieren. Zwischen 1979 und 1982 wurden in der Mannheimer Kohortenstudie 600 Erwachsene der Mannheimer Stadtbevölkerung hinsichtlich der Häufigkeit psychogener Erkrankungen untersucht. Bei 26% wurden psychogene Erkrankungen wie Psychoneurosen, Charakterneurosen und funktionelle Beschwerden diagnostiziert. Eine funktionelle oder andere psychosomatische Störung wurde bei 11,6% diagnostiziert (SCHEPANK et al. 1984). Die Gruppe der somatoformen Störungen wurde erstmals 1980 in die psychiatrischen Klassifikationssysteme, damals DSM-III, eingeordnet. Zur allgemeinen Definition der somatoformen Störungen schreiben WITTCHEN et al. (S. 313, 1989): „Hauptmerkmal dieser Gruppe von Störungen sind körperliche Symptome, die eine körperliche Störung (daher somatoform) nahe legen. Es lassen sich für diese Symptome jedoch keine organischen Befunde oder bekannte pathophysiologische Mechanismen nachweisen, und es ... liegt der Verdacht nahe, daß psychischen Faktoren oder Konflikten Bedeutung zukommt.“ Die genaue Definition der somatoformen Störungen ist verwirrend. Aktuell gibt es die beiden Diagnosesysteme ICD-10 und DSM-IV, die die Charakteristika der somatoformen Störungen ausführlich beschreiben. Beide Klassifikationssysteme sind ähnlich, weisen im Detail jedoch Unterschiede auf, die zu Diskrepanzen in der Klassifikation führen können (RIEF et al. 1997). In Tabelle A1 (Anhang) sind die Definitionen beider Diagnosesysteme (in zum Teil etwas gekürzter Form) gegenübergestellt. Beide Systeme verwenden Symptomlisten, die allerdings zum Teil unterschiedliche Symptome enthalten. In Tabelle A2 (Anhang) werden alle in der ICD-10 oder im DSM-IV genannten Symptome aufgeführt und dem jeweiligen Klassifikationssystem zugeordnet. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Definitionen der somatoformen Störungen in den beiden Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 dargestellt, später werden neuere Definitionen vorgestellt. In der ICD-10 (DILLING et al. 1994) gehören zur Gruppe der somatoformen Störungen die Somatisierungsstörung, die somatoforme autonome Funktionsstörung, die anhaltende somatoforme Schmerzstörung, die undifferenzierte Somatisierungsstörung, sonstige somatoforme Störungen, die hypochondrische Störung und die Dysmorpho- 5 phobie. Bei der Somatisierungsstörung nach ICD-10 müssen mindestens 6 Symptome aus einer Liste mit 14 körperlichen Symptomen vorhanden sein und über zwei Jahre hinweg andauern. Ein weiteres diagnostisches Kriterium ist die Forderung der PatientInnen nach einer medizinischen Abklärung trotz wiederholter Negativ- Befunde und Erklärungen der ÄrztInnen über die nicht somatische Ursache der Beschwerden. Eventuell vorhandene morphologische Schäden können die Symptome und das Leid der PatientInnen nicht ausreichend erklären. Nach ICD-10 darf die Diagnose einer Somatisierungsstörung nicht gestellt werden, wenn beispielsweise somatoforme Symptome während einer Depression auftreten. Bei vielen PatientInnen liegen gleichzeitig somatoforme und depressive Symptome vor. Es ist zu diskutieren, ob diese Symptome eher differentialdiagnostisch oder nach dem Prinzip der Komorbidität betrachtet werden (s. Abschnitt 2.3 und 2.4). Im DSM-IV (SASS et al. 1998) wird in der Gruppe der somatoformen Störungen die Somatisierungsstörung von der undifferenzierten somatoformen Störung, der akuten und chronischen Schmerzstörung, der nicht näher bezeichneten somatoformen Störung, der Hypochondrie, der körperdysmorphen Störung und der Konversionsstörung abgegrenzt. Um die Diagnose einer Somatisierungsstörung nach DSM-III-R (WITTCHEN et al. 1989) zu stellen, mussten 13 Symptome aus einer Liste mit 35 möglichen Symptomen vorliegen. In der Weiterentwicklung des DSM-IV (1994) wurde die Symptomanzahl reduziert, jedoch weitere Bedingungen für die Diagnose gestellt. Laut DSM-IV müssen für die Somatisierungsstörung mindestens 8 Symptome von insgesamt 32 möglichen Symptomen für Frauen oder von 29 möglichen Symptomen für Männer vorliegen (vier Schmerzsymptome, zwei gastrointestinale Symptome, ein Symptom bei sexuellen Organen und ein pseudoneurologisches Symptom). Die Beschwerden müssen vor dem 30. Lebensjahr begonnen haben und seit mehreren Jahren bestehen. Ein weiteres diagnostisches Kriterium ist die Einschränkung der PatientInnen durch die Beschwerden in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Ausschlusskriterium für eine Somatisierungsstörung nach DSM-IV ist die absichtliche Erzeugung oder Vortäuschung der Symptome. Die Diagnose einer somatoformen autonomen Funktionsstörung existiert nur in der ICD-10, nicht im DSM-IV. Bei der somatoformen autonomen Funktionsstörung der ICD-10 (gebräuchliche Abkürzung: „SAD“ für „somatoform autonomic dysfunction“) stehen Störungen von autonom innervierten Organen im Vordergrund, die einem oder mehreren Systemen oder Organen zugeordnet sind: kardiovaskuläres System, obe- 6 rer Gastrointestinaltrakt, unterer Gastrointestinaltrakt, respiratorisches System, Urogenitalsystem, sonstiges Organ oder Organsystem. Sogenannte funktionelle Erkrankungen wie das Reizdarmsyndrom (Colon irritabile), der Reizmagen (Non-Ulcer-Dyspepsie), das Herzangstsyndrom (Non-Cardiac Chest-Pain) und die Hyperventilationstetanie können nach der ICD-10 als somatoforme autonome Funktionsstörung diagnostiziert werden (CSEF 1995). Eine Somatisierungsstörung nach ICD-10 darf nicht diagnostiziert werden, wenn Symptome der vegetativen Erregung im Vordergrund des klinischen Erscheinungsbildes stehen (DILLING et al. 1994). Somit ist nach ICD-10 die somatoforme autonome Funktionsstörung der Somatisierungsstörung hierarchisch übergeordnet (HILLER, RIEF 1998). Bei der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung nach ICD-10 haben PatientInnen über sechs Monate lang einen anhaltenden schweren und belastenden Schmerz, der nicht adäquat durch den Nachweis eines physiologischen Prozesses erklärt werden kann, und anhaltend Hauptfokus der Aufmerksamkeit ist. Im DSM-IV wird bei der Schmerzstörung differenziert in eine akute und eine chronische Form. Bei der chronischen Form muss seit mindestens 6 Monaten eine übermäßige Beschäftigung mit Schmerzen vorliegen, die nicht oder nicht ausreichend durch eine organische Ursache zu erklären ist. Unter der undifferenzierten Somatisierungsstörung werden in der ICD-10 Störungen diagnostiziert, bei denen somatoforme Symptome vorliegen und die Störung mehr als 6 Monate andauert (im Gegensatz zu 2 Jahren bei der Somatisierungsstörung). Die Symptomanzahl kann geringer sein (in der ICD-10 werden wie oben aufgeführt 6 Symptome von 14 für die Somatisierungsstörung gefordert). DSM-IV spricht von der undifferenzierten somatoformen Störung, wenn die Symptomdauer über 6 Monaten liegt. Es wird explizit erwähnt, dass bereits ein körperliches Symptom zur Diagnosestellung ausreicht. Obwohl bei der Hypochondrie und der körperdysmorphen Störung nicht das Leiden an körperlichen Symptomen im Vordergrund steht, werden sie in beiden Klassifikationssystemen in der Gruppe der somatoformen Störungen aufgeführt. In beiden Klassifikationssystemen unterscheiden sich die Kriterien für das Vorliegen einer hypochondrischen Störung (ICD-10) und Hypochondrie (DSM-IV) kaum. Bei der hypochondrischen Störung oder Hypochondrie leiden PatientInnen an übermäßigen Krankheitsängsten über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten. 7 Bei der Dysmorphophobie oder der körperdysmorphen Störung leiden PatientInnen an einem eingebildeten, nicht vorhandenen oder nur geringfügigen körperlichen Mangel, sie fühlen sich entstellt oder hässlich. Es kann sich um angebliche „Schönheitsfehler“ im Gesicht (z.B. Falten, Hautflecken, Form von Nase, Mund oder Kiefer), an den Extremitäten, Brust, Rücken oder anderen Körperteilen handeln (RIEF, HILLER 1992). Laut DSM-IV ist die Konversionsstörung ebenso den somatoformen Störungen zugeordnet. Bei der Konversionsstörung muss mindestens ein pseudoneurologisches Symptom vorhanden sein, bei dem entweder motorische oder sensorische Ausfälle, Anfälle oder Krämpfe im Vordergrund stehen. Die Störung beginnt meistens in einer Situation extremer psychischer Belastung. In der ICD-10 wird die Gruppe der Konversionsstörungen und dissoziativen Störungen nicht in der Gruppe der somatoformen Störungen aufgeführt, sondern in einer eigenen Gruppe beschrieben. Aufgrund der historischen Entwicklung wird im Zusammenhang mit somatoformen Störungen von einigen Autoren (PINI et al. 1999, FINK et al. 1999, FALLER 1999, AWMF online 1998) die Neurasthenie erwähnt. Im DSM-IV kommt diese Kategorie nicht vor. Nach der ICD-10 gehört die Neurasthenie (Erschöpfungssyndrom) nicht direkt in die Gruppe der somatoformen Störungen. Für die Neurasthenie typisch ist ein seit mindestens 3 Monaten anhaltendes und quälendes Erschöpfungsgefühl nach geringer geistiger und / oder körperlicher Anstrengung. Die Betroffenen sind nicht in der Lage, sich innerhalb eines normalen Zeitraumes von Ruhe, Entspannung oder Ablenkung zu erholen. In den vergangenen Jahren wurde von verschiedenen Seiten Kritik an den Definitionen der beiden Klassifikationssysteme laut und es wurden neue Definitionen für somatoforme Störungen gefordert. Auch wenn leicht der Anschein entsteht, es handle sich bei der undifferenzierten Somatisierungsstörung um eine Restkategorie, kommt die undifferenzierte Somatisierungsstörung weitaus häufiger als die Somatisierungsstörung vor (SACK 1998). Für die Diagnose einer undifferenzierten Somatisierungsstörung reicht ein einziges Symptom aus. Die Diskrepanz zwischen einem Symptom bei der undifferenzierten Somatisierungsstörung und 8 Symptomen aus 4 verschiedenen Symptomgruppen für die Somatisierungsstörung ist groß. FRANZ und SCHEPANK (S. 43, 1996) schreiben allgemein über funktionelle Beschwerden: „Darüber hinaus scheint wesentlich, daß funktionelle Beschwerden nur 8 selten singulär, sondern in der Regel als Polysymptomatik ..., in Kombination mit anderen funktionellen Beschwerden vorkommen.“ Somatoforme Störungen können definiert werden als polysymptomatische Krankheitsbilder, einhergehend mit einer Fülle von Beschwerden, die verschiedenste Organsysteme betreffen und die sich im zeitlichen Verlauf ändern (CSEF 1995). RIEF (1998) schlägt zwei Modifikationen zur Verbesserung der Klassifikation vor: die stärkere Berücksichtigung der subjektiven Beeinträchtigung und die stärkere Berücksichtigung psychologischer Merkmale. Häufig wird die Anzahl der Symptome als Indikator für den Schweregrad der Erkrankung insgesamt angesehen. HILLER et al. (1995) fanden z.B. bei PatientInnen mit mindestens 7 somatoformen Symptomen die psychopathologische Belastung mit Ängstlichkeit, Depressivität und Hypochondrie deutlich höher als bei PatientInnen unterhalb dieser Schwelle. Es folgen nun drei Beispiele für neuere Klassifikationsansätze der somatoformen Störungen. ESCOBAR et al. (1989) schlugen eine neue Klassifikationsgruppe der somatoformen Störungen vor, die sog. „abridged somatization disorder“ mit dem „Somatic Symptom Index“ (SSI). Danach liegt eine klinisch relevante Störung bei Männern ab vier Symptomen, bei Frauen ab sechs Symptomen aus der Symptomliste der Somatisierungsstörung nach dem DSM-III-R vor (abgekürzt „SSI-4/6“). Nach RIEF (1996) zählt eine Symptomatik nach dem SSI-4/6 zu den häufigsten psychischen Störungen überhaupt. KATON et al. (1991) ermitteln für PatientInnen mit „abridged somatization disorder“, die jedoch nicht die Kriterien einer Somatisierungsstörung erfüllten, ähnliche klinische Merkmale wie bei PatientInnen mit einer Somatisierungsstörung. Sie sehen die Anzahl der somatoformen Symptome und eine Beeinträchtigung in einem eher linearen Zusammenhang: „Our data suggest that many clinical and behaviorial features associated with somatization were significantly more common in patients in groups 2 and 3 (men with four to 12 and women with six to 12 medically unexplained symptoms) rather than changing dramatically at the diagnostic threshold (13 symptoms) for somatization disorder.” (S. 38). Eine Reihe empirischer Studien (s. Abschnitte 2.2 und 2.4) wurden bisher auf der Basis des SSI-4/6 durchgeführt und dieser Symptom Cut-off wurde weitgehend akzeptiert (LIEB 1996). Als deutscher Begriff für die Störungsgruppe SSI-4/6 wird von Rief et al. (1997) der Begriff „multiples somatoformes Syndrom“ oder „Somatisierungssyndrom“ gewählt. Nach HILLER und RIEF (1998b) könnte das multiple somatoforme Syndrom als Alternative zur undifferenzierten somatoformen Störung verwendet werden. 9 KROENKE et al. (1997) kritisieren am Konzept des SSI-4/6, dass zu viele PatientInnen eingeschlossen sind. Sie schlagen eine andere Klassifikationsgruppe, Multisomatoform disorder (MSD), vor. Dafür müssen 3 oder mehr unerklärte körperliche Symptome aus einer Symptomliste von 15 Symptomen vorliegen, die Symptome seit mehr als 2 Jahren bestehen und an mehr Tagen vorhanden sein als fehlen. Falls bei den PatientInnen gleichzeitig eine affektive – oder Angststörung diagnostiziert wurde, werden Symptome, die im Rahmen dieser Erkrankung auftraten, nicht als „unerklärt“ definiert und somit nicht mitgezählt. KROENKE et al. (1998) prüften die Übereinstimmung der Diagnose der MSD mit der Somatisierungsstörung nach DSM-III-R und der „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6) nach Escobar. 53% der PatientInnen mit MSD erfüllten die Kriterien einer Somatisierungsstörung und weitere 35% die SSI-4/6 Kriterien. „MSD is a moderate severe somatoform diagnosis intermediate in severity between full and „abridged somatization disorder“...“(S. 270, 1998). In neueren Veröffentlichungen kritisieren RIEF und HILLER (1999) an den Modellen der „abridged somatization disorder“ von Escobar und der „Multisomatoform disorder“ von Kroenke, dass die Diagnose einer somatoformen Störung nur aufgrund der Symptomanzahl gestellt wird und psychologische und psychophysiologische Prozesse ignoriert würden. Sie führen aus, dass PatientInnen mit somatoformen Störungen eine erhöhte Aufmerksamkeit auf körperliche Prozesse richten, dass sie übersteigerte Vorstellungen über eine gute Gesundheit aufweisen. Sie haben katastrophisierende Interpretationen bei geringen körperlichen Missempfindungen und sind stressintolerant. Dennoch stellen somatoforme Symptome auch in ihrem Konzept die Grundlage für die Diagnose einer somatoformen Störung: „Despite the critique that symptom counting is not sufficient to describe people with somatization syndrome, somatic symptoms should not be omitted as a feature relevant for classification, because somatic symptoms are most often the reason for a medical office visit.”(S. 516, 1999). Die unterschiedlichen Symptomlisten der ICD-10 und des DSM-IV werden von HILLER und RIEF (1998b) kritisiert. Im DSM-IV werden keine kardiovaskulären oder vegetativen Symptome aufgeführt, in der ICD-10 fehlen pseudoneurologische Symptome. Die Symptomauswahl in beiden Systemen erscheine willkürlich. In einer Untersuchung bei 324 PatientInnen einer psychosomatischen Klinik in Deutschland werden von RIEF und HILLER (1999) alle Symptome, die im Rahmen einer Somatisierungsstörung nach ICD-10 oder DSM-IV oder einer somatoformen autonomen Funktionsstörung beschrieben sind, auf ihre Validität überprüft. Sie stellen eine 10 Symptomliste mit insgesamt 32 Symptomen auf und schlagen eine neue Klassifikationsgruppe vor, die „polysymptomatische somatoforme Störung“ (hier abgekürzt „PSS-7“). Mindestens 7 Symptome müssen vorhanden sein und weitere Zusatzkriterien erfüllt sein. Zusatzkriterien sind z.B. die fokussierte Aufmerksamkeit auf körperliche Prozesse, die Neigung körperliche Empfindungen als Krankheitszeichen zu interpretieren oder häufige Arztbesuche für geringe Anlässe. Zusammenfassung : Die genaue Definition der somatoformen Störungen ist verwirrend. Es gibt die beiden Diagnosesysteme ICD-10 und DSM-IV, die die somatoformen Störungen ausführlich beschreiben. Beide Klassifikationssysteme sind ähnlich, haben ähnliche Bezeichnungen für die Störungsbilder. Sie weisen jedoch Unterschiede sowohl in den Definitionen als auch in den Symptomlisten auf. Das führt teilweise zu Unsicherheiten in der Diagnosestellung und es macht Forschungsbefunde schwer vergleichbar. Die Kriterien für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung sind sehr restriktiv. Die undifferenzierte Somatisierungsstörung ist dagegen unscharf definiert. Es ist wünschenswert, dass eine einheitliche Definition für multiple somatoforme Symptome unterhalb der Schwelle einer Somatisierungsstörung gefunden wird. Das Konzept der „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6 oder multiples somatoformes Syndrom) hat sich bisher am ehesten durchgesetzt. 2.2 Prävalenz der somatoformen Störungen Unter Prävalenz versteht man die relative Häufigkeit einer Erkrankung zu einem bestimmten Zeitpunkt (Punktprävalenz) oder in einem Zeitraum (Periodenprävalenz). Manche Autoren geben die Häufigkeit einer gegenwärtigen oder früheren Erkrankung an (Lebenszeitprävalenz oder lifetime-Diagnose). Es gibt zahlreiche Studien zur Häufigkeit der somatoformen Störungen. Es werden zunächst einige Studien zur Prävalenz der somatoformen Störungen in der Allgemeinbevölkerung vorgestellt, später umfangreicher die Studien zur Prävalenz in hausärztlichen Praxen. Angaben zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Häufigkeit somatoformer Störungen werden verglichen. Es folgt ein Abschnitt über die Erkennung von somatoformen Störungen. Die Prävalenzrate somatoformer Störungen in der Normalbevölkerung scheint in der Literatur überwiegend sehr niedrig. Die meisten Daten wurden nach 11 DSM-III erhoben und beziehen sich auf eine Untergruppe der somatoformen Störungen, die Somatisierungsstörung. Für diese Erkrankung liegen wie in Abschnitt 2.1 beschrieben detaillierte diagnostische Kriterien vor. Als Beispiel für eine niedrige Prävalenzrate der Somatisierungsstörung in der Allgemeinbevölkerung ist die bei einer sehr großen Bevölkerungsstichprobe in den USA durchgeführten Epidemiological Catchment Area (ECA) Studie. Etwa 15.000 PatientInnen wurden mittels Diagnostic Interview Schedule (DIS) untersucht. SWARTZ et al. (1986) geben dort eine Lebenszeitprävalenz der Somatisierungsstörung nach DSM-III-Kriterien mit ca. 0,4% an. NEUMER et al. (1998) geben einen Überblick über epidemiologische Studien zur Somatisierungsstörung in der Normalbevölkerung. In diesen Studien werden Prävalenzangaben von 0,03% bis 1,0% gemacht. Bei den anderen Formen der somatoformen Störungen wie Schmerzstörungen, Konversionsstörungen, Hypochondrie, körperdysmorphe Störungen liegen weniger epidemiologische Angaben vor. Bei diesen Krankheitsbildern sind die diagnostischen Kriterien nach ICD-10 oder DSM-IV weniger detailliert definiert. Noch weniger eindeutig ist die Situation bei der undifferenzierten somatoformen Störung oder sonstigen somatoformen Störung. In einigen Studien wurde die undifferenzierte somatoforme Störung mit den nach ESCOBAR (1989) eingeführten SSI-4/6 Kriterien untersucht. ESCOBAR (1989) fand in Puerto Rico bei nur 0,7% der Allgemeinbevölkerung eine Somatisierungsstörung. Bei der gleichen Stichprobe wurde bei 19% eine „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6) festgestellt. In Los Angeles wurde bei insgesamt 4,4% eine „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6) aufgrund der Daten der ECA-Studie festgestellt (ESCOBAR 1989). In einer neueren Prävalenz-Studie in Deutschland untersuchten WITTCHEN et al. (1999) 4181 Probanden zwischen 18 und 65 Jahren mit einer leicht modifizierten Fassung des computerisierten Composite-International-Diagnostic-Interview (DIA-XCIDI). Die Diagnose wurde nach ICD-10 gestellt. In der Gruppe der somatoformen Störungen wurden die Somatisierungsstörung, die undifferenzierte Somatisierungsstörung, die hypochondrische Störung und die anhaltende somatoforme Schmerzstörung berücksichtigt. Die Kriterien zur Feststellung einer undifferenzierten somatoformen Störung wurden nicht explizit genannt. Insgesamt wurde bei 17,2% eine psychische Störung festgestellt, bei 7,5% eine somatoforme Störung. 12 Über die Häufigkeit von somatoformen Störungen in hausärztlichen Praxen liegen bisher unterschiedliche Zahlen vor (s. Tabelle 1). PatientInnen mit somatoformen Symptomen suchen in der Regel zunächst HausärztInnen auf. Mehr als 50% der PatientInnen mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen wollen durch ihre HausärztInnen behandelt werden (KRUSE et al. 1999). Die Prävalenzangaben schwanken je nach Autor zwischen 0,4% und 58%. Eine Ursache liegt in der Verwendung sehr unterschiedlicher Krankheitsdefinitionen (KRUSE et al. 1998). Die Daten beziehen sich teils auf die Somatisierungsstörung, teils auf recht unklar definierte funktionelle oder psychische Störungen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Prävalenzstudien in der Primärversorgung. KATON et al. (1984) beschreiben, dass 10 bis 60% der PatientInnen mit den fünf häufigsten medizinischen Symptomen keine strukturellen Veränderungen haben, 25 bis 75% der Kontaktaufnahmen mit AllgemeinärztInnen seien auf psychosoziale Belastungen zurückzuführen, die sich in somatischen Symptomen ausdrücken. BRIDGES und GOLDBERG (1985) untersuchten 500 PatientInnen mit neu aufgetretenen Krankheiten in 13 Allgemeinmedizinpraxen in Großbritannien. Ein Drittel der untersuchten PatientInnen zeigte psychiatrische Krankheiten, wobei davon zwei Drittel zusätzliche körperliche Symptome schilderten. Etwa 20% aller untersuchten PatientInnen hatte bei genauer Diagnostik zwar psychische Störungen, präsentierten jedoch in erster Linie körperliche Symptome. In einer groß angelegten Studie in Mannheimer Allgemeinpraxen fanden ZINTLWIEGAND et al. (1980) ca. 33,2% der 1026 untersuchten ambulanten PatientInnen mit einer behandlungsbedürftigen psychiatrischen Erkrankung. Die Untersuchung fand vor Einführung der somatoformen Störungen in die ICD statt, auch funktionelle Störungen wurden nicht explizit aufgeführt. KATON et al. (1991) untersuchten mit Hilfe des Diagnostic Interview Schedule (DIS) 119 PatientInnen in zwei Primärversorgungseinrichtungen, die häufige Arztkonsultationen aufwiesen. 61 PatientInnen (51%) erfüllten die Kriterien einer „abridged somatization disorder“, weitere 27 (23%) die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-III-R. PORTEGIJS et al. (1996) untersuchten in einer holländischen Studie 80 PatientInnen zwischen 20 und 44 Jahren mit dem Diagnostic Interview Schedule (DIS). Als Einschlusskriterium für die Teilnahme an der Studie galt, dass die PatientInnen ihre HausärztInnen in den vergangenen 3 Jahren mehrfach konsultiert hatten und über Rücken-, 13 Schulter- oder abdominelle Schmerzen klagten. Etwa 45% der PatientInnen hatten mehr als 5 somatoforme Beschwerden seit mehr als zwei Jahren, 6% erfüllten die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-III-R. Die WHO initiierte 1991 unter dem Titel „Psychological Problems in General Health Care“ eine internationale Studie in 15 Städten zu psychischen Störungen in primärärztlicher Betreuung. Für diese Studie wurden in Berlin 35 und in Mainz 20 Allgemeinarztpraxen ausgewählt (LINDEN et al. 1996). Nach einer ersten Screening-Phase wurde eine geschichtete Stichprobe ausgewählt. LINDEN et al. (1996) unterscheiden zwischen der Inanspruchnahmepopulation, die bei einer Querschnittsstudie erfasst werden und der Praxispopulation, die im Verlauf eines Quartals behandelt werden. Sie gehen davon aus, dass psychisch erkrankte PatientInnen eine höhere Konsultationshäufigkeit aufweisen. Bei der Untersuchung der Inanspruchnahmepopulation werden alle PatientInnen einbezogen, die zu einer Untersuchung oder Behandlung einbestellt sind bzw. ein Rezept oder Überweisungsschein abholen. Ihrer Meinung spiegelt die Inanspruchnahmepopulation am besten den tatsächlichen Betreuungsbedarf wieder. Sowohl in Berlin als auch in Mainz wurden 400 PatientInnen mit dem „Composite International Diagnostic Interview“ (CIDI) untersucht. 20.9% der deutschen PatientInnen erhielten eine psychiatrische ICD-10 Diagnose, weitere 8,5% schätzten die UntersucherInnen als grenzwertige Fälle ein. Die Somatisierungsstörung wurde bei 2,1% der PatientInnen diagnostiziert (LINDEN et al. 1996). In den Niederlanden fanden TIEMENS et al. (1996) im Rahmen der WHO-Studie bei 20,2% der PatientInnen eine psychische Störung, 10,6% wurden als grenzwertig eingeschätzt. Die Diagnose einer Somatisierungsstörung wurde nicht gestellt, eine Neurasthenie (Erschöpfungssyndrom) bei 3% beschrieben. Im Rahmen der WHO-Studie wurde in Verona (Italien) bei 12,4% der PatientInnen der Primärversorgung eine psychische Störung nach ICD-10 festgestellt, 14,2% wurden als grenzwertig beschrieben. Insgesamt wurde bei 2,5% eine somatoforme Störung, dagegen nur bei 0,1% eine Somatisierungsstörung diagnostiziert (PINI et al. 1999). Sie beschrieben bei 2,1% eine Neurasthenie, bei 0,3% eine hypochondrische Störung. Über andere Formen der somatoformen Störung trafen sie keine Aussage. In der Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) Studie untersuchten KROENKE et al. (1997) in 4 Primärversorgungszentren in Indianapolis (USA) 1000 PatientInnen zwischen 18 und 91 Jahren mit einem speziell entwickelten diagnostischen Interview, das die Kriterien des DSM-III-R berücksichtigte (PRIME-MD-Interview). Sie fanden eine Prävalenz der somatoformen Störungen von 14%, die nach ihnen defi- 14 nierte „Multisomatoform disorder“ (MSD) wurde bei 8% diagnostiziert. Beim gleichen Kollektiv beschrieben SPITZER et al. (1995) insgesamt eine psychiatrische Störung bei 39%, 26% erfüllten die Kriterien einer genauer spezifizierten Störung, 13% erfüllten die Kriterien einer niederschwelligen psychischen Störung. In einer dänischen Studie bei 191 PatientInnen verglichen FINK et al. (1999) Diagnosen nach ICD-10 und DSM-IV. Die PatientInnen wurden mit Hilfe des „Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry“ (SCAN) interviewt. FINK et al. (1999) fanden eine Prävalenz der somatoformen Störungen bei 22,3% nach ICD-10 Diagnose und 57,5% nach DSM-IV Diagnose, dabei waren die undifferenzierte somatoforme Störung und sonstige somatoforme Störungen als auch die Hypochondrie eingeschlossen. Der Anteil der Somatisierungsstörung lag nach ICD-10 Diagnose bei 6%, nach DSM-IV Diagnose bei 1%. In einer repräsentativen Studie bei 1455 PatientInnen einer allgemeinen Krankenhausambulanz in Kalifornien wurde laut ESCOBAR et al. (1998) bei 22% eine „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6) nach der DSM-III Symptomliste festgestellt. Es wurde das „Composite International Diagnostic Interview“ (CIDI) zur Diagnosestellung eingesetzt. In einer anderen kalifornischen Untersuchung von MIRANDA et al. (1991) wurden 214 PatientInnen der Primärversorgung zwischen 18 und 69 Jahren mit dem Diagnostic Interview Schedule (DIS) untersucht. Kein Patient (0%) erfüllte die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-III, bei 25,2% wurde eine „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6) festgestellt. In der „Düsseldorfer Hausarztstudie“ wurden 1994 bis 1996 insgesamt 572 PatientInnen in 18 Praxen zur Erhebung der Prävalenz psychogener und somatopsychischer Erkrankungen mit dem „strukturierten klinischen Interview für DSM-III-R“ (SKID) untersucht (TRESS et al. 1997, KRUSE et al. 1998, KRUSE et al. 1999). Insgesamt erfüllten 69,5% der PatientInnen die Kriterien einer DSM-III-R Störung. Die somatoformen Störungen waren mit 30,7% in der Stichprobe am häufigsten vertreten, wobei die Kriterien des SSI-4/6 nach Escobar mit berücksichtigt wurden. Die Schwankungsbreite innerhalb der Praxen lag zwischen 12% und 50 % (KRUSE et al. 1998). Da psychosomatisch erkrankte PatientInnen höhere Konsultationsraten haben, haben sich TRESS et al. (1997) dazu entschlossen, nur PatientInnen einzuschließen, die wegen aktueller Beschwerden oder einer neuen Erkrankungsepisode die Arztpraxis aufsuchten. Sie gingen ebenso wie LINDEN et al. (1996) davon aus, dass psychosomatisch Erkrankte zu den „high utili- 15 zer“ des Gesundheitssystem gehören, aber es würde ihr Anteil überschätzt, wenn alle PatientInnen, die an einem bestimmten Zeitpunkt die Praxis aufsuchten, in die Untersuchung eingingen. In einer britischen Studie von PEVELER et al. (1997) wurden 175 PatientInnen mit Hilfe des „Diagnostic Interview Schedule“ (DIS) in insgesamt 10 Allgemeinmedizinpraxen untersucht. Es wurde eine Häufigkeit der „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6) nach DSM-III-R Symptomliste von 35% festgestellt. Weitere 9% hatten eine starke Gesundheitsangst (Hypochondrie), etwa 20% hatten eine affektive Störung. Einigen Studien zufolge scheint die Somatisierungsstörung eine typisch weibliche Krankheit zu sein. GOLDING et al. (1991) gaben ihrem Artikel zu Geschlechtsunterschieden bei der Somatisierungsstörung den Titel: „Does somatization disorder occur in men?“ 12 Männer und 68 Frauen erfüllten in ihrer Stichprobe die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-III-R. Sie fanden bei Frauen mit Somatisierungsstörung durchschnittlich 17 Symptome, bei Männern durchschnittlich 15 Symptome. Wurden nur die Beschwerden berücksichtigt, die für beide Geschlechter gelten, unterschied sich die Symptomanzahl zwischen den beiden Geschlechtern nicht. „We conclude that SD [somatization disorder] exists in men as well as women, although it is probably less common among men. We found no reason to believe that men and women with SD show differences in demographic or clinical characteristics, functional impairment, self-reported health status, or psychiatric comorbidity.”(S. 235). SWARTZ et al. (1987) beschreiben in einer Auswertung der ECA-Studie das Geschlechterverhältnis bei der Somatisierungsstörung mit 93% Frauen zu 7% Männer (wobei nur drei Männer mit einer Somatisierungsstörung identifiziert wurden). In einer der ECA vergleichbaren Studie in Puerto Rico fanden ESCOBAR et al. (1989) überraschenderweise die Somatisierungsstörung bei Männern und Frauen gleich häufig vor (je 0,7%). In einer Studienübersicht von NEUMER et al. (1998) wurde in klinischen Stichproben bei Frauen in 6 bis 22%, bei Männern dagegen nur in 1 bis 4% eine Somatisierungsstörung diagnostiziert. Aussagen zum Geschlechterverhältnis bei somatoformen Störungen werden in folgenden Studien gemacht: In der bundesweiten Studie über psychische Störungen in der Bevölkerung fanden WITTCHEN et al. (1999) doppelt so häufig eine somatoforme Störung bei Frauen (10%) als bei Männern (5%). 16 Bei FINK et al. (1999) bestand bei beiden Klassifikationssystemen (ICD-10 und DSMIV) kein statistisch relevanter Unterschied in der Häufigkeit einer somatoformen Störung zwischen den Geschlechtern. Tendenziell waren nach ICD-10 Männer häufiger von einer Somatisierungsstörung, undifferenzierten Somatisierungsstörung, anhaltenden somatoformen Schmerzstörung, hypochondrischen Störung und dissoziativen Störung betroffen. Nach DSM-IV waren Männer tendenziell häufiger von einer undifferenzierten Somatisierungsstörung, Schmerzstörung, Hypochondrie und Konversionsstörung betroffen. Bei Frauen wurde tendenziell häufiger eine somatoforme autonome Funktionsstörung nach ICD-10 und eine Somatisierungsstörung nach DSM-IV diagnostiziert. Folgende Studie beziehen sich auf das SSI-4/6-Konzept: In Puerto Rico erfüllten 20% der Frauen mehr als 6 und 18% der Männer mehr als 4 somatoforme Symptome (ESCOBAR et al. 1989). Sie fanden einen altersabhängigen Geschlechtsunterschied: Frauen, die älter als 50 Jahre waren, waren signifikant häufiger von einer „abridged somatization disorder“ betroffen als Männer über 50 Jahren. In einer Krankenhausambulanz in Kalifornien fanden ESCOBAR et al. (1998) bei 24,9% der Frauen und bei 18,4% der Männer eine „abridged somatization disorder“. MIRANDA et al. (1991) fanden bei 27% der Frauen und 22,7% der Männer eine „abridged somatization disorder“. In der Untersuchung von PEVELER et al. (1997) wurde bei 32% der Männer und 36% der Frauen eine „abridged somatization disorder“ festgestellt. Bei beiden Geschlechtern wurde bei je 5% eine Somatisierungsstörung nach DSM-III-R diagnostiziert. Bei Anwendung der SSI-4/6 Kriterien fanden PORTEGIJS et al. (1996) Frauen und Männer gleich häufig betroffen. Wenn jedoch für beide Geschlechter mindestens 5 somatoforme Symptome als diagnostische Schwelle angesehen wurden, waren Frauen doppelt so häufig wie Männer betroffen. In der „Düsseldorfer Hausarztstudie“ (TRESS et al. 1997) wurde bei 33,0% der Frauen und bei 25,7% der Männer eine somatoforme Störung diagnostiziert. KROENKE et al. (1997) fanden bei der PRIME-MD Studie Frauen signifikant häufiger (75%) von einer somatoformen Störung betroffen als Männer (57%). Die Erkennung somatoformer Störungen erfolgt oft erst spät. Bis zur richtigen Diagnosestellung und damit zum Beginn einer adäquaten Therapie vergehen durchschnittlich 6-9 Jahre (HERRMANN 1996). BRIDGES und GOLDBERG (1985) beschreiben, dass 94% der PatientInnen mit ausschließlich psychiatrischer Störung von 17 HausärztInnen erkannt werden. Das Präsentieren von körperlichen Symptomen erschwert jedoch die Diagnose einer psychischen Erkrankung. „It is important to note, however, that when somatisation occured, only about a half of all the psychiatric disorders were detected by the doctors.“(S. 567). LIPOWSKI (1988) beschreibt Somatisierung als Unstimmigkeit zwischen subjektiver und objektiver Gesundheit. Somatoforme Störungen werden nach SACK et al. (S. 218, 1998) von vielen ÄrztInnen immer noch nicht für ein eigenständiges Krankheitsbild gehalten: „So glaubten 42% der befragten Psychiater einer britischen Untersuchung zufolge (Stern et al., 1993a) nicht, daß SD [somatization disorder] ein eigenständiges Krankheitsbild ist... Dies mag neben der sicherlich noch mangelhaften Information von Ärzten über das Krankheitsbild SD auch an der fehlenden Repräsentation der somatoformen Störungen in den medizinischen Lehrbüchern liegen (Zoccolillo und Cloninger, 1986a).“ Nach LANGEWITZ et al. (1997) übersetzen ÄrztInnen die von PatientInnen geschilderten Symptome in Indikatoren bestimmter Krankheitsbilder. Wenn nach ausführlicher Diagnostik keine organische Erklärung für die Beschwerden gefunden wird, tritt an Stelle des ursprünglichen Symptoms das Symptom „Beschwerde ohne Ursache“. Behandelnde ÄrztInnen brauchen nun ein Krankheitskonzept, das das Symptom „Beschwerde ohne Ursache“ als Indikator für das Vorliegen z.B. einer somatoformen Störung ansieht. „Bei der Diagnose einer somatoformen Störung muss ein Dissens bestehen zwischen zwei Protagonisten, einem Menschen, der sich als Homo patiens, also als Patient definiert, und einem ärztlichen Gegenüber, das diesem Patienten wiederholt versichert, dass er «nichts habe», bzw. dass die vorliegenden Befunde nicht erklären können, woran er leidet.“(S. 232). In verschiedenen Studien wurde die Diagnose einer psychischen Störung sowohl durch die betreuenden AllgemeinärztInnen als auch parallel durch PsychiaterInnen oder PsychologInnen gestellt. Es ist diskussionswürdig zu überlegen, wer die „richtige“ Diagnose stellt. In der Regel wird davon ausgegangen, dass geschulte Experten, die mit Hilfe eines standardisierten Interviews eine Stichprobe untersuchen, die „objektivere“ Meinung vertreten. TIEMENS et al. (S. 639, 1996) schreiben: „…we assume that an ICD-10 diagnosis made by using the Composite International Diagnostic Interview represents the gold standard...“ Wann spricht man von einer korrekten Fallidentifikation durch HausärztInnen? ORMEL et al. (1990) und Kruse et al. (1999) betonen, dass von HausärztInnen nicht die exakte ICD oder DSM Diagnose erwartet werden sollte. Haus- 18 ärztInnen sollten unterscheiden, ob eine behandlungsbedürftige körperliche, psychische oder psychosomatische Symptomatik vorliegt. In der „Düsseldorfer Hausarztstudie“ erkannten HausärztInnen bei 59,9% ihrer PatientInnen mit einer somatoformen Störung eine seelische oder psychosomatische Symptomatik (KRUSE et al. 1998). In einer anderen Veröffentlichung wiesen KRUSE et al. (1999) darauf hin, dass die 18 ÄrztInnen, die an der Studie teilnahmen, weder an einem Kurs zur psychosomatischen Grundversorgung oder einer Balint-Gruppe teilgenommen hatten, noch befanden sie sich in psychotherapeutischer Weiterbildung. LINDEN et al. (1996) geben an, dass 60% der deutschen PatientInnen mit einer psychischen ICD-10 Diagnose von ihren HausärztInnen als psychisch krank erkannt wurden. Bei PatientInnen mit grenzwertigen Störungen waren es noch 46%. Etwa 10% der PatientInnen, die von ihren HausärztInnen als psychisch krank eingestuft wurden, waren im Interview unauffällig. In Berlin nahmen 35 und in Mainz 10 Allgemeinarztpraxen an der WHOStudie teil. Die Praxen wurden als prototypisch für das deutsche Hausarztsystem angesehen, ohne besondere Schwerpunktbildung. In Berlin umfasst die Studie das Stadtgebiet im Ost- und Westteil und in Mainz die städtische und die ländliche Region. In den Niederlanden erkannten nach der WHO-Studie von TIEMENS et al. (1996) AllgemeinmedizinerInnen psychische Erkrankungen in 54%. Die Studie wurde in 6 Allgemeinmedizinpraxen durchgeführt, 11 HausärztInnen waren beteiligt. Die Praxen wurden als repräsentativ für die niederländische Primärversorgung angesehen. In einer früheren niederländischen Untersuchung fanden ORMEL et al. (1990) eine Übereinstimmung zwischen AllgemeinärztInnen und PsychiaterInnen von 56% in der Diagnose einer psychischen Störung. Diese Untersuchung wurde mit PatientInnen durchgeführt, bei denen in den vergangenen 12 Monaten keine psychische Diagnose gestellt worden ist. Bei FINK et al. (1999) war die Erkennungsrate abhängig vom Klassifikationssystem ICD10 oder DSM-IV. Nach ICD-10 wurde eine somatoforme Störung bei 50 bis 71% der PatientInnen, nach DSM-IV nur bei 36 bis 48% der PatientInnen erkannt. Die Autoren erwähnen, dass die teilnehmenden HausärztInnen möglicherweise besonders psychologisch interessiert seien und die Identifikationsrate in der Primärversorgung generell eher niedriger einzuschätzen sei. In der Studie von PEVELER et al. (1997) erkannten HausärztInnen bei 38% eine „abridged somatization disorder“, bei 57% eine starke Gesundheitsangst und bei nur 25% eine affektive Störung. An dieser Studie nahmen alle 10 praktizierenden HausärztInnen einer Kleinstadt im Süden Großbritanniens (Aldermoor) 19 teil, es fand also keine Selektion hinsichtlich des Interesses für psychische Erkrankungen statt. Welchen Einfluss hat die Erkennung einer psychischen Störung auf das Behandlungsergebnis? In einer Studie von FRITZSCHE et al. (2000a) zur Qualitätssicherung in der psychosomatischen Grundversorgung wird die Erkennung und Behandlung psychischer und psychosomatischer Störungen in der Allgemeinmedizin untersucht. PatientInnen mit starker Ängstlichkeit und Depressivität erfahren häufiger eine psychosoziale Behandlung durch ihre HausärztInnen. PatientInnen, die mit psychosozialen Maßnahmen behandelt wurden, erzielten signifikant höhere Werte auf den Erfolgsvariablen als PatientInnen ohne diese Maßnahmen. Obwohl auch psychosoziale Belastungen bei PatientInnen vorlagen, die vorwiegend über körperliche Erkrankungen oder Schmerzen klagten, bekamen sie seltener unterstützende Gespräche und erzielten schlechtere Behandlungsergebnisse als PatientInnen mit primär psychischer Symptomatik (FRITZSCHE et al., S. 245, 2000b): „Behandlungsmaßnahmen, wie sie für Patienten mit somatoformen Symptomen entwickelt wurden, sollten in die Curricula der psychosomatischen Grundversorgung integriert werden. Die vorliegenden Daten zeigen, daß die Förderung des psychosomatischen Krankheitsverständnisses im Rahmen der Behandlungsmaßnahmen in der psychosomatischen Grundversorgung mit ausschlaggebend für den Erfolg ist.“ PINI et al. (S. 37, 1999) beschreiben einen Behandlungserfolg nach Erkennung der psychischen Störung: „Recognition of mental disorder by the physician ... was associated with an improvement in occupational disability and self-reported disability...“ In einer niederländischen Studie fanden ORMEL et al. (1990) einen Zusammenhang zwischen der Identifikation einer psychischen Störung und einer psychosozialen Verbesserung der PatientInnen. Sie gingen der Frage nach, ob eine Erkennung einer psychischen Störung durch einen Psychiater ebenso zu einer verbesserten Therapie der HausärztInnen führt. „In addition recognition had a strong association with outcome in terms of both psychopathology and social functioning. … „In our opinion… notification is not identical with (spontaneous) recognition and that notification will have a positive impact on management and outcome only when GPs are trained in handling this information, have effective MH [mental health] interventions at their disposal, and oppertunities to implement them.” (S. 922). TIEMENS et al. (S. 636, 1996) fanden: „Recognition of psychological disorders was not associated with better outcome. Recognition is a necessary but not a sufficient condition for delivery of treatment according to clinical 20 guidelines. Increasing recognition is likely to improve outcomes only if general practitioners have the skills and resources to deliver adequate interventions.” KRUSE et al. (1999) sehen als Aufgabe von HausärztInnen psychogene Erkrankungen zu erkennen, die Indikation für die weitere Therapie zu stellen, die PatientInnen zur Therapie zu motivieren bzw. teilweise die Therapie selbst zu führen. Sie fassen zusammen: „Dem Hausarzt kommt im Gesundheitssystem die entscheidende Screeningund Filterfunktion zu. Die Ergebnisse der vorgestellten Studie verdeutlichen, daß der Hausarzt die psychische oder psychosomatische Erkrankung seiner Patienten jedoch zuwenig erkennt. ... Schulungen zur psychosomatischen Grundversorgung haben genau hier einzusetzen, d.h. sie müssen zunächst auf die Verbesserung der psychosomatischen Diagnostik der Hausärzte unter den Bedingungen der hausärztlichen Praxis abzielen.“ (S. 21). Zusammenfassung: In bisherigen Studien sind die Häufigkeitsangaben für somatoforme Störungen extrem unterschiedlich. Die Ergebnisse unterschiedlicher Studien sind durch unterschiedliche Populationen (Normalbevölkerung oder Primärversorgung), unterschiedliche Diagnosesysteme (ICD oder DSM) und unterschiedliche Schweregradkriterien (somatoforme Störungen oder Somatisierungsstörung) nur bedingt vergleichbar. Für den hausärztlichen Bereich schwanken die Prävalenzangaben zwischen 0,1% und 6% für die Somatisierungsstörung. Für den Bereich der somatoformen Störungen insgesamt werden Prävalenzangaben zwischen 2,5% und 74% gemacht. Die meisten Studien beschreiben eine Häufigkeit der somatoformen Störungen in der Primärversorgung zwischen 20 und 50% (FINK et al. 1999, ESCOBAR et al. 1998, TRESS et al. 1997, MIRANDA et al. 1991, PEVELER et al. 1997). Geschlechtsspezifische Unterschiede bei somatoformen Störungen werden uneinheitlich beschrieben. Die Aussagen divergieren zwischen einer „fast ausschließlich weiblichen Erkrankung“ bei der Somatisierungsstörung über „häufiger bei Frauen als bei Männern, aber klinisch ähnlicher Verlauf“ über „gleich häufig bei Frauen und bei Männern“ bis hin zu „nach ICD-10 tendenziell häufiger bei Männern“. Meistens wird eine somatoforme Störung tendenziell häufiger bei Frauen als bei Männern beschrieben, der Unterschied ist oft jedoch nicht statistisch relevant. Die Erkennungsrate für eine psychische oder psychosomatische Störung liegt zwischen 36% und 60%. Die Erkennung von somatoformen und anderen psychischen Störungen ist eine wichtige Voraussetzung für eine verbesserte Therapie. Beteiligung % Stichprobe Alter Land Zintl-Wiegand et al. (1980) 20-50 ¹ N=1026 >15 Jahre Deutschland Linden et al. (1996), WHO-Studie Mainz: 33 Berlin: 44 N=800 18-65 Jahre Tress et al. (1997) Kruse et al. (1998) Prävalenz % Erkennungsrate % Psychosomatische Störung Psych. Erkrankungen ICD (1974) 11,0 33,2 60 Deutschland Psychische Störung ICD-10 Somatisierungsstörung ICD-10 20,9 2,1 60,2 N=572 16-70 Jahre Deutschland Somatoforme Störung DSM-III-R 30,7 (12-50) 59,9 SSI-4/6 DSM-III-R Somatisierungsstörung DSM-III-R 35 5 38 79 N=175 17-81 Jahre GB Pini et al. (1999) WHO-Studie 54,7 N=250 Italien 18-65 Jahre Psychische Störung ICD-10 Somatoforme Störung ICD-10 Somatisierungsstörung ICD-10 12,4 2,5 0,1 Psychische Störung ICD-10 Neurasthenie 20,2 3,0 54,3 36-71 Tiemens et al. (1996) WHO-Studie 69 N=340 18-65 Jahre Niederlande Fink et al. (1999) 86 N=191 Dänemark Somatoforme Störung ICD-10 Somatisierungsstörung ICD-10 Somatoforme Störung DSM-IV Somatisierungsstörung DSM-IV 22,3 6 57,5 1 0 25,2 18-65 Jahre Miranda et al. (1991) 30,2 N=214 18-69 Jahre USA Somatisierungsstörung DSM-III SSI-4/6 DSM-III Escobar et al. (1998) 50 N=1455 18-66 Jahre USA SSI-4/6 DSM-III 22 N=1000 18-91 Jahre USA Somatoforme Störung DSM-III-R Multisomatoform disorder 14 8 Kroenke et al. (1997) PRIME-MD 21 Peveler et al. (1997) Diagnose Tab. 1: Prävalenzstudien in der Primärversorgung ¹ Rate der ausgewählten PatientInnen zum Interview Autoren 22 2.3 Differentialdiagnostik der somatoformen Störungen Somatoforme Symptome gehen häufig mit anderen psychischen Störungen ein- her. LIPOWSKI (S. 1358, 1988) beschreibt Somatisierung als „borderland between medicine and psychiatry“. KATON et al. (1991) fanden mit ansteigender Anzahl von somatoformen Symptomen in der Regel auch eine Zunahme von anderen psychopathologischen Variablen wie Depressivität und Ängstlichkeit. KIRMAYER und ROBBINS (1996) beschreiben eine Tendenz von PatientInnen mit Angststörung oder Depressionen den ÄrztInnen der Primärversorgung zunächst körperliche Symptome zu präsentieren. BRIDGES und GOLDBERG (1985) sprechen von somatischen Symptomen als „ticket to admission“, einer „Eintrittskarte“ für eine medizinische Konsultation. Ungefähr 80% der PatientInnen, die in Allgemeinpraxen untersucht wurden und an einer Depression litten, stellten sich nicht mit psychischen, sondern mit körperlichen Beschwerden vor. GOLDBERG und BRIDGES (S. 139, 1988) beschreiben Somatisierung als einen BasisMechanismus, der Menschen zur Verfügung steht, um auf Stress zu reagieren: „the commonest way that psychiatric illness presents in developing countries is in the form of somatic symptoms... . Perhaps we should ask why people psychologise, instead of looking for explanations for somatisation.” RIEF und HILLER (S. 49, 1992) schließen aus einem Studienvergleich, „daß Somatisierung als ubiquitäre Symptomatik anzusehen ist und unterhalb der Diagnosenschwelle für eine spezifische somatoforme Störung grundsätzlich bei einer Vielzahl psychischer Störungen anzutreffen ist.“ Es stellt sich die differentialdiagnostisch bedeutsame Frage, ob bei PatientInnen mit körperlichen Beschwerden eine organische Erkrankung oder eine somatoforme Störung vorliegt oder ob andere psychische Störungen im Vordergrund stehen. In Tabelle A3 im Anhang werden z.B. alle körperlichen Symptome aufgelistet, die für die Diagnose einer Angstbzw. Panikstörung relevant sind. BARSKY und BORUS (1999) betonen, dass psychische Störungen nicht als Ursache einer somatoformen Störung angesehen werden sollten, sondern als Symptomverstärker. „Patients must be assured that the presence of a psychiatric disorder in no way means that their somatic symptoms are imaginary or feigned. They should be told, that psychiatric disorders are regarded less as causes of somatic symptoms than as amplifiers that exacerbate and perpetuate symptoms and impede recovery.” (S. 917). Laut Definition der somatoformen Störungen gelten verschiedene Ausschlusskriterien. In der ICD-10 (DILLING et al. 1994) heißt es: „Eine eventuell vorliegende bekannte körperliche Erkrankung erklärt nicht die Schwere, das Ausmaß, die Vielfalt 23 und die Dauer der körperlichen Beschwerden oder die damit verbundene soziale Behinderung.“ (S. 130). „Die Störung tritt nicht ausschließlich während einer Schizophrenie oder einer verwandten Störung (F2), einer affektiven Störung (F3) oder einer Panikstörung (F41.0) auf.“ (S. 131/132). Im DSM-IV (SASS et al., S. 200, 1998) steht: „Nach adäquater Untersuchung kann keines der Symptome von Kriterium B vollständig durch einen bekannten medizinischen Krankheitsfaktor oder durch die direkte Wirkung einer Substanz (z.B. Droge, Medikament) erklärt werden. Falls das Symptom mit einem medizinischen Krankheitsfaktor in Verbindung steht, so gehen die körperlichen Beschwerden oder daraus resultierende soziale oder berufliche Beeinträchtigungen über das hinaus, was aufgrund von Anamnese, körperlicher Untersuchung oder Laborbefunden zu erwarten wäre. Die Symptome sind nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht (wie bei der Vorgetäuschten Störung oder Simulation).“ Die in den Definitionen geschilderten Ausschlussdiagnosen werden im folgenden differentialdiagnostisch zu den somatoformen Störungen betrachtet. Zu den affektiven Störungen gehören nach ICD-10 (DILLING et al. 1994) als Erstdiagnose die manische Episode und die depressive Episode. Bei länger dauernder Erkrankung wird zwischen einer bipolaren affektiven Störung, und einer rezidivierenden depressiven Störung unterschieden. Die Definitionen der affektiven Störungen sind in der ICD-10 und im DSM-IV (ähnlich den somatoformen Störungen) im Detail unterschiedlich. Nur in der ICD-10 stellen die affektiven Störungen eine Ausschlussdiagnose zu den somatoformen Störungen dar. Bei einer depressiven Episode besteht eine bedrückte Stimmung, Interessenoder Freudverlust, verminderter Antrieb und gesteigerte Ermüdbarkeit. Es kann zu einem Verlust von Selbstvertrauen, zu Selbstvorwürfen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit kommen. Bei vielen PatientInnen treten Suizidgedanken oder Gedanken an den Tod auf. Bei den Depressionen wird zwischen leichten, mittelgradigen und schweren Episoden unterschieden. Sowohl bei depressiven als auch bei manischen Episoden werden Verläufe mit und ohne psychotische Symptome wie Wahn und Halluzinationen unterschieden. Bei Depressionen werden häufig körperliche Symptome unklaren Ursprungs von den PatientInnen angegeben. Besonders häufig treten 24 Magen- und Darmbeschwerden, Müdigkeit, Gewichtsverlust, Obstipation, Schwindel, Schwitzen, Schmerzen, Schlafstörungen, Luftnot und Parästhesien auf (LUPKE 1994). Es gab in der Vergangenheit wissenschaftliche Auseinandersetzungen über die Begriffe der sogenannten larvierten, maskierten oder auch somatisierten Depression. Nach diesem Modell sind somatoforme Störungen kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern werden als Beschwerden im Rahmen einer Depression angesehen, selbst wenn keine ausgeprägte depressive Grundstimmung besteht. HOHAGEN (S. 180, 1996) schreibt hierzu: „Die Diagnose einer larvierten Depression darf nur gestellt werden, wenn die Körpersymptome phasenhaft mit abgrenzbaren, beschwerdefreien Intervallen auftreten. Bei genauer Exploration sind meist doch gestörter Antrieb, niedergeschlagene Stimmung, eingeschränkte Modulations- und Schwingungsfähigkeit und andere Symptome eines depressiven Syndroms zu eruieren.“ Um die Frage zu klären, ob es sich bei den genannten Beschwerden um eine somatoforme Störung oder eine Depression handelt, unterscheiden RIEF und HILLER (1992) vier differentialdiagnostische Konstellationen: I Es handelt sich um eine Depression mit Körpersymptomen (larvierte Depression) II Eine somatoforme Störung hat sekundär zu einer Depression geführt. III Eine depressive Störung hat sekundär zu einer somatoformen Störung geführt. IV Somatoforme und depressive Störungen haben gemeinsame biologische und psychologische Bedingungen, sind also Ausdrucksformen einer in vielen Bereichen gemeinsam zugrundeliegenden Basisstörung. RIEF und HILLER (1992) führen weiter dazu aus: „Anders als im Modell I werden in den Modellen II-IV keine Grundannahmen über den nosologischen Stellenwert somatoformer Störungen gemacht... . Stattdessen wird Somatisierung als klinisch relevante Symptomatik gesehen, die sowohl alleine als auch in Kombination mit anderen Störungsbildern auftreten kann... . Die Kontroverse über das hierarchische Verhältnis zwischen somatoformen Störungen und Depressionen ist auch durch die Einführung des Komorbiditäts-Konzepts ... in den Hintergrund getreten.“ (S. 83). „Zukunftsweisend ist sicherlich auch der Ansatz, nach gemeinsamen biologischen und psychologischen Bedingungen für sowohl somatoforme als auch depressive Störungen zu suchen.“ (S. 89). In ihrer Dissertation schreibt LUPKE (S. 45, 1994) zum Zusammenhang von affektiven Störungen mit somatoformen Störungen: „Bei Bestehen affektiver Veränderungen ist die Schwelle zur Wahrnehmung somatischer Symptome abgesenkt und Symptome werden folglich mit subjektiv erhöhter Intensität wahrgenommen (Lipowski 1987, 25 1990). Möglicherweise kommt es in Folge der starken Beschwerden wiederum zu einem Anstieg der affektiven Symptome. Ein circulus vitiosus entsteht.“ Zwischen somatoformen und depressiven Störungen bestehen Überlappungen, jedoch auch klare Unterschiede. Ein Teil der PatientInnen mit somatoformen Störungen weist keinerlei typische Anzeichen einer Depression auf. Umgekehrt weisen eine Reihe von depressiven PatientInnen keine somatoformen Beschwerden auf. Die Depression verläuft meist episodisch, die somatoformen Störungen eher chronisch (LEIBBRAND und HILLER 1998). In der ICD-10 wird die Panikstörung als Ausschlussdiagnose zu den somatoformen Störungen genannt. Die Panikstörung wird in der ICD-10 unter phobischen Störungen und sonstige Angststörungen beschrieben. Die phobischen Störungen werden in Agoraphobie mit und ohne Panikstörung, soziale Phobien und spezifische Phobien unterteilt. Unter sonstiger Angststörung werden die Panikstörung und die generalisierte Angststörung aufgeführt. Es gibt Unterschiede zwischen der Definition der Angststörungen nach ICD-10 und DSM-IV, die in dieser Arbeit aber nicht näher erläutert werden. Panik ist ein Gefühl überwältigenden Bedrohtseins (SCHÖPF 1996). Bei der Panikstörung treten wiederholt Panikattacken auf, die nicht auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches Objekt bezogen sind. Die Attacken treten oft spontan auf, sind nicht verbunden mit besonderer Anstrengung oder gefährlichen Situationen. Die Dauer einer Panikattacke liegt zwischen Minuten bis ca. einer Stunde. SCHÖPF (S. 229, 1996) beschreibt: „Der Patient befürchtet, etwas Katastrophales werde über ihn hereinbrechen: Herzinfarkt, Hirnschlag, Erstickung oder ähnliches. ... Zudem bestehen Begleitsymptome wie Herzsensationen, Atembeschwerden, Schwitzen, heiße und kalte Schauer, Nausea, Abdominalbeschwerden, Tremor, Schwindel, Parästhesien und Entfremdungserlebnisse.“ In Tabelle A3 im Anhang sind die möglichen körperlichen und psychischen Symptome bei einer Angst- oder Panikstörung aufgeführt. Typisch für alle phobischen Störungen ist ein Vermeidungsverhalten, das zu einer deutlichen Einschränkung im Alltag führen kann. MARGRAF (S. 43, 1994) beschreibt: „Die Patienten schränken ihren Lebensstil ein, sie gehen nicht mehr an Orte, wo sie Angstanfälle befürchten oder wo die Konsequenzen eines Angstanfalles besonders unangenehm wären.“ Schon bei der bloßen Vorstellung der angstauslösenden Situation erleben manche PatientInnen intensive Angstzustände, sie befürchten die katastrophalen Konsequenzen der Angstsymptome („Angst vor der Angst“). 26 Bei der generalisierten Angststörung bestehen seit mindestens 6 Monaten Ängste, die sich auf verschiedenste Alltagssituationen, z.B. Arbeit, Finanzen oder Familie, beziehen. Die PatientInnen fühlen sich häufig erregt, angespannt, ruhelos und nervös. Sie haben Konzentrationsschwierigkeiten , fühlen sich anhaltend reizbar oder haben Einschlafstörungen wegen der Befürchtungen. RIEF und HILLER (S. 9, 1998) schreiben zur Differentialdiagnose zwischen somatoformen Störungen und Angststörungen: „Ausgeprägte Angstzustände sind ... mit körperlichen und insbesondere vegetativen Begleitsymptomen verbunden. Hierzu gehören ein unregelmäßiger oder beschleunigter Herzschlag, Schweißausbrüche, Hitzewallungen, Unruhe mit Zittern, Mißempfindungen an den Armen oder Beinen sowie Schmerzen oder Druckgefühle im Brustbereich. Diese Symptome dürfen aber nicht als ein Teil einer somatoformen Störung angesehen werden, solange sie ausschließlich in den Angstsituationen und somit als körperliches Angstäquivalent auftreten. Bei den Phobien und Angststörungen ist die Abgrenzung am klarsten, da es sich um zeitlich begrenzte Angstepisoden handelt. ... Etwas problematischer ist dagegen die Diagnose der generalisierten Angststörung, bei der eine Angstsymptomatik definitionsgemäß über einen längeren mehrmonatigen Zeitraum hinweg bestanden haben muß, und zwar im Sinne einer allgemeinen Ängstlichkeit mit übertriebenen Sorgen und Befürchtungen über alltägliche Dinge. ... Trotz dieser differentialdiagnostischen Überlegungen muß betont werden, daß beide Störungsformen grundsätzlich nebeneinander existieren können.“ LUPKE (S. 39, 1994) schreibt zum Zusammenhang von körperlichen Symptomen und Angsterkrankungen: „Patienten mit einer Panikstörung wenden Symptomen, die mit einer Erregung des Sympathikus in Zusammenhang stehen, in besonderem Maße ihre Aufmerksamkeit zu. Diese Symptome werden ... als Anzeichen einer bedrohlichen Erkrankung gewertet (Katon et al., 1987). ... Eine Bewertung körperlicher Symptome als bedrohlich bewirkt eine Angstentwicklung, welche im Sinne einer positiven Rückkopplung wiederum physiologische Veränderungen hervorruft (Margraf und Schneider, 1989)“. Bei dem Krankheitsbild der Hypochondrie, das nach ICD-10 und DSM-IV den somatoformen Störungen zugerechnet wird (s. Kapitel 2.1), steht die übertriebene Angst vor schweren körperlichen Erkrankungen im Vordergrund. RIEF und HILLER (S. 3, 1998) schreiben: „Durch die Betonung der Ängste als zentralem Merkmal scheint eine deutliche Nähe zu den Angststörungen zu bestehen.“ Es zeigen sich jedoch Unterschiede im Verlauf, Ansprechen auf Behandlungsversuche und zeitlichem Auftreten der 27 Symptome bei PatientInnen mit somatoformen Störungen und PatientInnen mit Angststörungen (LEIBBRAND und HILLER 1998). In der ICD-10 (DILLING et al., 1994) gilt eine Schizophrenie oder eine verwandte Störung (schizotype Störung, anhaltende wahnhafte Störungen, akute, vorübergehende psychotische Störungen, induzierte wahnhafte Störung und schizoaffektive Störungen) als Ausschlusskriterium für eine somatoforme Störung. Im Rahmen einer Schizophrenie sind Halluzinationen sehr häufig, besonders das Stimmenhören, aber auch visuelle Halluzinationen, Körperhalluzinationen, olfaktorische und gustatorische Halluzinationen. So könnten auch im Rahmen einer akuten Schizophrenie über verschiedene körperliche Symptome geklagt werden, die keine organische Ursache aufweisen (SCHÖPF 1996). Zur Differentialdiagnose zwischen somatoformen Störungen und der Schizophrenie schreiben RIEF und HILLER (S. 40, 1992): „In der Regel bestimmen körperliche Symptome nicht das klinische Bild der Schizophrenie, sondern massive Beeinträchtigungen von Denken, Wahrnehmung, Affekt, Umweltbeziehungen oder psychomotorischem Verhalten.“ Im DSM-IV ist das Ausschlusskriterium für das Vorliegen einer somatoformen Störung die Simulation oder die Vortäuschung von Symptomen. WITTCHEN et al. (1989) weisen darauf hin, dass die Symptomentstehung bei somatoformen Störungen anders als bei absichtlich erzeugten Symptomen oder der vorgetäuschten Störung nicht der willentlichen Kontrolle der Betroffenen unterliegt. PatientInnen mit somatoformen Störungen sind selbst vom Vorhandensein der Beschwerden überzeugt, während die Simulation Ausdruck bewusster Täuschung ist. Durch die Tendenz von PatientInnen mit somatoformen Störungen ihre Beschwerden verstärkt darzustellen, um ihr Gegenüber von der körperlichen Natur und der Schwere ihrer Erkrankung überzeugen zu wollen, kann die Abgrenzung zur Simulation erschwert werden (AWMF online 1998). RIEF und HILLER (S. 11-12, 1998) führen aus: „Unsicherheiten entstehen manchmal bei der Frage, ob ein Patient seine körperlichen Symptome nicht einfach „erfindet“ oder sich diese sogar selbst zugefügt hat. ... In der Praxis ist die Unterscheidung zwischen Simulation und vorgetäuschter Störung einerseits und den somatoformen Störungen andererseits in der Regel sehr schwierig. ... Eine Simulation ist offenkundig, wenn die Absicht sehr leicht zu erkennen ist und über die körperliche Symptomatik nach Erreichen des Zieles nicht mehr geklagt wird. ... Jedoch ist die Existenz eines „Krankheitsvorteils“ ... keineswegs allein ausreichendes Unterscheidungs- 28 kriterium. So ist auch bei Patienten mit einem Rentenbegehren eher davon auszugehen, daß die Symptome subjektiv erlebt werden und der betreffende Patient tatsächlich unter den damit verbundenen Beeinträchtigungen leidet.“ Bei den somatoformen Störungen ist das Vorliegen einer organischen Grundkrankheit durchaus möglich. Laut Definition des DSM-IV (SASS et al. 1998) und ICD-10 (DILLING et al. 1994) kann eine somatoforme Störung diagnostiziert werden, wenn die körperliche Erkrankung nicht die Schwere, die Dauer oder das Ausmaß der Erkrankung oder der daraus resultierenden Beeinträchtigung erklärt. Eine organische Grundkrankheit, die die körperlichen Symptome der Betroffenen vollständig erklären könnte, kann manchmal trotz einer gründlichen medizinischen Abklärung nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Solange sich die Diagnose einer somatoformen Störung auf eine Ausschlussdiagnostik (kein organischer Befund) beschränkt, bleibt für ÄrztInnen und PatientInnen die „Hoffnung“, dass mit verbesserten Analysemethoden doch noch irgendwann ein medizinisch nachweisbarer Befund erhoben werden kann (KRIEBEL et al. 1996). RIEF und HILLER (S. 37, 1992) schreiben: „Grundsätzlich ist immer daran zu denken, daß es sich bei einer unklaren somatischen Symptomatik immer auch um eine Krankheit handeln kann, die noch nicht diagnostiziert worden ist oder deren Pathophysiologie nach dem gegenwärtigen Wissensstand noch nicht ausreichend bekannt ist.“ Jedoch bekräftigen RIEF und HILLER (1992) an anderer Stelle, dass mit steigender somatoformer Symptomzahl auch die diagnostische Sicherheit steigen würde, dass keine unerkannte organmedizinische Erkrankung für die Symptome verantwortlich ist. Aus Angst vor einer möglichen Fehldiagnose und dem Nicht-Erkennen einer schweren, behandlungsbedürftigen organischen Grundkrankheit wird die Diagnose einer somatoformen Störung erst spät gestellt. PEVELER et al. (S. 245, 1997) schreiben: “Because docters are trained to expect physical symptoms to signify physical desease, and are anxious about the possibility of misdiagnosis, they may engage in an exhaustive but ultimately fruitless diagnostic search before reaching the conclusion that no physical desease is present to explain the symptoms.” RIEF und HILLER (S.19, 1998) folgern aus einer Studie: „Das Risiko von Fehldiagnosen erwies sich als äußerst gering. Von den ursprünglich als Somatisierungsstörung klassifizierten Patienten hatten vier Jahre später nur 3% eine tatsächliche körperliche Krankheit...“ 29 Zusammenfassung: Solange somatoforme Symptome im Rahmen einer depressiven Episode, einer Angststörung oder anderen psychischen Störung (z.B. Schizophrenie) auftreten, wird keine somatoforme Störung diagnostiziert. Die Abgrenzung einer somatoformen Störung von einer organischen Grundkrankheit ist besonders schwierig. Nicht das Vorliegen eines einzelnen organisch unerklärten Symptoms legt die Diagnose einer somatoformen Störung nahe, sondern das gleichzeitige, evt. auch wechselnde Vorliegen verschiedener somatoformer Beschwerden. 2.4 Komorbidität mit anderen psychischen Störungen Bis zur Einführung des DSM-III 1980 galt das hierarchische Modell der Klassifikation, nach dem verschiedenartige Symptome unter möglichst einer einzigen Hauptdiagnose subsumiert und verschlüsselt werden sollten. Seither ist das Prinzip der hierarchischen Klassifikation durch das Komorbiditäts- Konzept ersetzt. RIEF und HILLER (S. 71, 1992) weisen darauf hin, „daß für einen Patienten mehr als eine psychiatrische Diagnose gestellt werden sollte, wann immer eine klinisch relevante psychische Symptomatik in mehr als einem Störungsbereich vorliegt.“ In einigen Studien wird die aktuelle Komorbidität zum Zeitpunkt der Untersuchung angegeben. Andere Studien nennen die Lifetime-Komorbidität, also die gegenwärtige und auch die in der Vergangenheit diagnostizierte Komorbidität mit anderen psychischen Störungen. Einen Überblick über Studien zur Komorbidität der somatoformen Störungen mit anderen psychischen Störungen gibt Tabelle 2. Die Somatisierungsstörung ist aus der Gruppe der somatoformen Störungen am klarsten definiert und am häufigsten untersucht worden. Die folgenden Studien sprechen für eine hohe Komorbidität zwischen Somatisierungsstörung und Depression sowie zwischen Somatisierungsstörung und Angststörung: In der bereits erwähnten ECA-Studie fanden SWARTZ et al. (1986) bei 77,9% der Personen mit einer Somatisierungsstörung mindestens eine weitere psychische Diagnose. Bei 64,8% wurde zusätzlich zur Somatisierungsstörung eine schwere Depression diagnostiziert, bei 42,5% wurde eine Panikstörung und bei 70,2% eine phobische Störung diagnostiziert. Insgesamt erfüllten jedoch nur 15 Personen die Kriterien einer Somatisierungsstörung. EBEL und PODOLL (1998) verglichen einige Studien hinsichtlich der LifetimeKomorbidität der Somatisierungsstörung mit anderen psychischen Störungen. PatientInnen mit einer Somatisierungsstörung hatten in 75-90% ausgeprägte depressive Sym- 30 ptome. Die Komorbidität der Somatisierungsstörung mit einer phobischen Störung betrug zwischen 17 und 70%. Die Komorbidität der Somatisierungsstörung mit einer Panikstörung als Lebenszeitdiagnose betrug 10 bis 50%. Auch Persönlichkeitsstörungen traten bei 28 bis 72% der PatientInnen auf. In einigen Studien wird die Komorbidität von somatoformen Störungen unterhalb der Schwelle der Somatisierungsstörung mit affektiven Störungen und Angststörungen untersucht. Zum Teil werden die Kriterien eines multiplen somatoformen Syndroms („abridged somatization disorder“, SSI-4/6) zur Identifizierung von PatientInnen mit einer somatoformen Störung angewandt. Bei der „Düsseldorfer Hausarztstudie“ (TRESS et al. 1997) oder der Studie von WITTCHEN et al. (1999) wird keine Aussage zur Komorbidität speziell somatoformer Störungen, jedoch eine generelle Aussage zur Komorbidität von psychischen Erkrankungen getroffen. Die WHO-Studie wurde insgesamt in 15 Zentren weltweit durchgeführt. In dieser Studie wurden niedrige Prävalenzraten für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung gefunden. Somatoforme Störungen unterhalb der Schwelle einer Somatisierungsstörung wurden nicht beschrieben. Zusammenfassend untersuchten jedoch SIMON et al. (1999) die Beziehung zwischen somatoformen Symptomen und Depression. Durchschnittlich lag die Depressionsrate bei 10,1% in allen 15 Zentren. Durchschnittlich 69% (45-95%, abhängig vom Untersuchungszentrum) der PatientInnen mit einer Depression gaben ausschließlich körperliche Beschwerden an. PatientInnen, bei denen eine Depression diagnostiziert wurde, gaben durchschnittlich 4,4 somatoforme Symptome an. PatientInnen ohne diagnostizierte Depression hatten 1,2 somatoforme Symptome. ESCOBAR et al. (1998) diagnostizierten bei 22% der PatientInnen einer allgemeinen Krankenhausambulanz eine „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6). Bei 64% der nach SSI-4/6 auffälligen PatientInnen wurde eine Lifetime-Komorbidität mit einer Angst- oder depressiven Störung diagnostiziert. Die Unterschiede zwischen PatientInnen mit mehr als 4/6 und weniger als 4/6 somatoformen Symptomen waren signifikant. PatientInnen mit weniger als 4/6 Symptomen wiesen z.B. in 13,6% eine depressive Störung, in 11,9% eine phobische Störung auf. Bei PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen wurde in 37,5% eine depressive Störung und in 29,1% der Fälle eine phobische Störung diagnostiziert. ESCOBAR et al. (1998) prägten in ihrer Studie den Begriff der „discrete“ und der „comorbid somatizers“. „Comorbid somatizers“ sind PatientInnen, bei denen zusätzlich zu einer „abridged somatization disorder“ eine 31 Angst- oder depressive Störung diagnostiziert wurde, während bei „discrete somatizers“ keine weitere Störung diagnostiziert wurde. PEVELER et al. (1996) fanden bei 35% der PatientInnen in der britischen Primärversorgung eine „abridged somatization disorder“, davon bestand bei etwa 30% eine aktuelle Komorbidität mit Gesundheitsängsten und / oder einer affektiven Störung. In einer amerikanischen Studie verglichen KATON et al. (1991) die Lifetime- Komorbidität von PatientInnen mit einer Somatisierungsstörung, einer „abridged somatization disorder“ und ohne somatoforme Störungen. PatientInnen ohne somatoforme Störung hatten in der Vergangenheit im Durchschnitt in 3,2% eine Panikstörung, in 45,2% eine schwere depressive Episode. PatientInnen mit einer „abridged somatization disorder“ hatten durchschnittlich in 13,7% eine Panikstörung und in 74% eine schwere depressive Episode. PatientInnen mit einer Somatisierungsstörung hatten in 48,1% eine Panikstörung und in 81,5% eine schwere depressive Störung. So litten PatientInnen mit einer „abridged somatization disorder“ häufiger unter einer depressiven Störung oder einer Angststörung als PatientInnen mit weniger somatoformen Symptomen. MIRANDA et al. (1991) diagnostizierten bei 25,2% der PatientInnen der Primärversorgung eine „abridged somatization disorder“. Bei 31% der PatientInnen mit weniger als 4/6 somatoformen Symptomen und bei 56% der PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen wurde eine psychische Komorbidität innerhalb eines Jahres festgestellt. PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen litten im vergangenen Jahr in 39% unter einer schweren depressiven Episode, 33% unter einer phobischen Störung und 11% unter einer Alkoholabhängigkeit. In der PRIME-MD Studie lag die Prävalenz einer aktuellen psychischen Störung wie Angst- depressive –, somatoforme -, Essstörung oder Alkoholabusus bei 39%. Davon hatten mehr als die Hälfte (56%) mehr als eine psychische Diagnose, 29% sogar mindestens 3 Diagnosen. Bei 73% der PatientInnen, bei denen eine somatoforme Störung diagnostiziert wurde, wurde eine Komorbidität mit einer weiteren psychischen Störung, wie oben aufgeführt, beschrieben (SPITZER et al. 1995). Bei PatientInnen mit einer somatoformen Störung wurde zusätzlich in 61% eine affektive Störung, in 50% eine Angststörung diagnostiziert (KROENKE et al. 1997). In der dänischen Studie fanden FINK et al. (1999) bei 36% (DSM-IV) bis 50% (ICD10) der PatientInnen mit einer somatoformen Störung eine psychiatrische Komorbidität, diese wurde jedoch nicht näher spezifiziert. Sie fanden eine Korrelation zwischen dem Schweregrad der somatoformen Störung und der psychischen Komorbidität. „The 32 comorbidity was lowest in the less severe of the somatoform disorders, that is, 20% in the DSM-IV somatoform disorder NOS [not otherwise specified] and highest in the most severe, that is, 84-100% in the somatization disorder.” (S. 335). SACK et al. (1998) belegen durch einen Studienvergleich, dass PatientInnen mit einer Somatisierungsstörung überdurchschnittlich häufig auch an einer posttraumatischen Belastungssituation leiden. Umgekehrt lassen sich bei PatientInnen mit posttraumatischen Belastungsstörung, fast immer auch somatoforme Symptome beobachten. RIEF (S. 180, 1996) bekräftigt die Zusammenhänge zwischen traumatischen Erfahrungen und der Entwicklung somatoformer Symptome: „Diese bestätigt sich auch durch die Beobachtung, daß bei Kriegsteilnehmern oder bei Betroffenen von Umweltkatastrophen eine deutlich erhöhte Anzahl körperlicher Beschwerden im Gefolge der Ereignisse nachgewiesen werden kann... , die mit einer erhöhten Häufigkeit von Arztbesuchen einhergehen. ...Bei Frauen mit Somatisierungsstörungen ergaben sich deutlich mehr Hinweise auf sexuelle Übergriffe in der Anamnese als bei Frauen, die in erster Linie eine affektive Störung aufwiesen.“ Zusammenfassung: Bei PatientInnen mit somatoformen Störungen liegen häufig andere psychische Erkrankungen wie depressive Störungen und Angststörungen gleichzeitig vor, wobei die Häufigkeit von der Schwere der somatoformen Störung bzw. der Symptomanzahl abhängt. Es gibt Hinweise, dass somatoforme Symptome nach traumatischer Belastung entstehen können. Bei PatientInnen mit somatoformen Störungen ist ein Screening nach weiteren psychischen Beschwerden sehr zu empfehlen. Land Diagnose Swartz et al. (1986) ECA-Studie USA Somatisierungsstörung DSM-III 0,38 (N=15) 77,9 psychische Störung 64 Depression 42,5 Panikstörung Miranda et al. (1991) USA SSI-4/6 DSM-III 25,2 (N=54) 56 Katon et al. (1991) USA SSI-4/6 DSM-III 51 (N=61) Somatisierungsstörung DSM-III USA Escobar et al. (1998) USA Peveler et al. (1997) GB Fink et al. (1999) Dänemark Komorbidität % psychische Störung 39 Depression 33 phobische Störung 11 Alkoholabusus 74 Depression 13,7 Panikstörung 81,5 Depressionen 48,1 Panikstörung 22,7 (N=27) 14 (N=154) 73 SSI-4/6 DSM-III 22 (N=320) 64 psychische Störung 37,5 depressive Störung 29,1 phobische Störung SSI-4/6 DSM-III-R 35 (N=61) 30 Gesundheitsangst/ affektive Störung Somatoforme Störung DSM-III-R Somatoforme Störung ICD-10 Somatisierungsstörung ICD-10 Somatoforme Störung DSM-IV Somatisierungsstörung DSM-IV 22,3 (N=22) 6,1 (N=6) 57,5 (N=57) 1,0 (N=1) 61 50 50 83,3 35,6 100 psychische Störung affektive Störung Angststörung psychische Störung psychische Störung psychische Störung psychische Störung 33 Kroenke et al. (1997) PRIME-MD-Studie Prävalenz % Tab. 2: Komorbidität von somatoformen Störungen mit anderen psychischen Störungen Autoren 34 2.5 Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei somatoformen Störungen Nach rein biomedizinischem Krankheitsverständnis wird eine Person als krank bezeichnet, wenn anatomische oder physiologische Veränderungen festgestellt werden können. Nach dieser Definition wären PatientInnen mit somatoformen Beschwerden nicht als krank einzustufen. Die World Health Organization (WHO 1986) versteht Gesundheit als Zustand des vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Nach dieser Definition dürfte nur ein geringer Teil der Weltbevölkerung als gesund eingestuft werden. Es bleibt die Frage: Wie krank fühlen sich PatientInnen mit somatoformen Beschwerden? Wie kann man das physische und psychische Wohlbefinden von PatientInnen messen? Eine Möglichkeit das Krankheitsverhalten von PatientInnen zu beschreiben, ist die Konsultationshäufigkeit in der Primärversorgung oder die Anzahl der stationären Aufenthalte. PatientInnen mit somatoformen Störungen werden mit zu den „high utilizer“ des Gesundheitssystems gezählt (KATON et al. , S. 355, 1990). EGLE (S. 53-54, 1996) pointiert die starke Nutzung des Gesundheitssystems von PatientInnen mit somatoformen Beschwerden folgendermaßen: „Patienten mit funktionellen Störungen werden im Durchschnitt nach 7 Jahren erstmals einer psychosomatischen Abklärung unterzogen. Zu diesem Zeitpunkt könnte man die Diagnose meist sogar über eine naturwissenschaftlich exakte Messung sichern: Legte man die Krankenakte auf eine Waage, würde man feststellen, daß sie besonders schwer ist.“ PORTEGIJS et al. (1996) untersuchten PatientInnen, die häufige Konsultationen in den vergangenen drei Jahren machten. 75% dieser PatientInnen klagten über mindestens 5 somatoforme Symptome. KATON et al. (1991) fanden bei PatientInnen mit weniger als 4/6 somatoformen Symptomen durchschnittlich 13,3 Arztbesuche, bei PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen 14,7 Arztbesuche und PatientInnen mit einer Somatisierungsstörung 19,4 Arztbesuche bezogen auf das Jahr. KROENKE et al. (S. 354, 1997) schreiben zur Nutzung des Gesundheitssystems: „Multisomatoform disorder was also the only disorder associated with a notable increase in the number of clinic visits, as well as only 1 of 2 disorders to produce an excess number of emergency department visits.“ MIRANDA et al. (1991) fanden einen Zusammenhang zwischen schwierigen Lebensübergängen und der Konsultationshäufigkeit: „ somatizers who were under stress made more visits to the clinics than did nonsomatizers or somatizers who were not under stress.“ (S.46) … The number of life change events experienced in the last 6 months 35 was summed to provide an index of stressful life events (S. 47). FALLER (1999) vergleicht Studien, in denen PatientInnen mit somatoformen Störungen mit Personen verglichen wurden, die dieselben Beschwerden aufwiesen, jedoch keinen Arzt aufsuchten. Beispielhaft beschreibt er PatientInnen mit gastrointestinalen Störungen: „30% der Angehörigen der Gesamtbevölkerung leiden an dyspeptischen Beschwerden; lediglich ein Viertel bis ein Drittel konsultiert jedoch einen Arzt. Patienten mit funktionellen gastrointestinalen Störungen wurden immer wieder als psychisch auffällig beschrieben; sie wiesen besonders erhöhte Werte von Angst und Depressivität auf... . Personen der Allgemeinbevölkerung, die trotz vorhandener funktioneller Beschwerden keinen Arzt aufsuchten, unterschieden sich jedoch in psychologischen Parametern nicht signifikant von Personen ohne diese Beschwerden... .“ (S. 197-198). FALLER (S.198, 1998) folgert: „Psychologischer Distress scheint nach diesen Ergebnissen weniger dafür entscheidend zu sein, ob Symptome entstehen, sondern ob sie zum Anlass genommen werden, einen Arzt zu konsultieren.“ RIEF (1998) vergleicht in einer Studie die psychosoziale Belastung von PatientInnen mit multiplem somatoformen Syndrom mit Personen mit psychischen oder psychosomatischen Störungen. PatientInnen mit einem multiplen somatoformen Syndrom berichteten signifikant häufiger über mehr als 5 Arztbesuche in den vergangenen 12 Monaten. Des weiteren gaben PatientInnen mit multiplem somatoformen Syndrom häufiger eine starke Beeinträchtigung des psychosozialen Wohlbefindens und eine Beeinträchtigung im Alltagsleben, sowie häufiger eine außergewöhnliche Müdigkeit an, als z.B. PatientInnen mit Angst- oder depressiven Erkrankungen. In einigen Studien werden die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage bei PatientInnen mit verschiedenen Erkrankungen als Zeichen der Beeinträchtigung aufgeführt. ESCOBAR et al. (1989) fanden bei 15,5% der Personen einer „abridged somatization disorder“ eine aktuelle Arbeitsunfähigkeit, jedoch nur bei 4% mit weniger als 4/6 somatoformen Symptomen. Nach der PRIME-MD Studie beschrieben KROENKE et al. (1997), dass PatientInnen mit einer multisomatoform disorder (MSD) im Schnitt sieben Tage mehr arbeitsunfähig waren als PatientInnen ohne MSD. KATON et al. (1991) befragten PatientInnen ohne somatoforme Störung, mit einer „abridged somatization disorder“ und mit einer Somatisierungsstörung nach der Anzahl der Tage bezogen auf ein Jahr, die sie im Bett verbringen würden. PatientInnen ohne somatoforme Störungen gaben durchschnittlich 6 Tage an, PatientInnen mit einer „abridged somatization disorder“ 16 Tage und PatientInnen mit einer Somatisierungsstörung 26 Tage. WITTCHEN et al. (1999) untersuchten die Arbeitsunfähigkeit im Zeitraum von vier Wochen. Perso- 36 nen ohne psychische Störung waren durchschnittlich 0,1 Tage arbeitsunfähig, PatientInnen mit psychischen Störungen durchschnittlich 0,6 Tage. Dabei wiesen PatientInnen mit somatoformen Störungen 0,7 arbeitsunfähige Tage auf, PatientInnen mit affektiven Störungen jedoch noch deutlich mehr (1,3 Tage). In den vergangenen Jahren wurden Fragebogen entwickelt, die Aussagen über die subjektive Gesundheit und über das Befinden von PatientInnen geben sollten. Im englischsprachigen Raum spricht man von der „Health-related quality of life“, übersetzt von der „gesundheitsbezogenen Lebensqualität“. Mehrere Faktoren kennzeichnen die gesundheitsbezogene Lebensqualität: die körperliche Funktionsfähigkeit, körperliche Schmerzen, das psychische Befinden und die soziale Beziehungsfähigkeit (SPITZER et al. 1995, BULLINGER und KIRCHBERGER 1998). SPITZER et al. (1995) untersuchten die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei den PatientInnen der PRIME-MD Studie mit Hilfe eines Short-Form General Health Survey (SF-20). Bei allen psychischen Störungen (Angst-, depressive -, somatoforme -, Ess- und Alkoholstörung) fanden sie eine wesentliche Beeinträchtigung in mehreren Dimensionen des General Health Survey. Auch PatientInnen mit einer somatoformen Störung unterhalb der Schwelle einer Somatisierungsstörung fühlten sich stark beeinträchtigt. Überraschenderweise fühlten sich PatientInnen mit somatoformen Störungen in der körperlichen Funktionsfähigkeit nicht signifikant beeinträchtigt. ESCOBAR et al. (1998) untersuchten in einer Studie vorwiegend die körperliche Dimension der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei PatientInnen der Primärversorgung mit Hilfe des Short-Form General Health Survey (SF-36). PatientInnen mit einer „abridged somatization disorder“ fühlten sich signifikant häufiger (31%) körperlich beeinträchtigt als PatientInnen mit weniger als 4/6 somatoformen Symptomen (19%). Zwischen den „discrete“ und „comorbid somatizers“ fand sich kein signifikanter Unterschied in der körperlichen Funktionsfähigkeit. Zusammenfassung: Das psychische und physische Wohlbefinden von PatientInnen ist schwer zu messen. Ein objektives Kriterium kann die Konsultationshäufigkeit oder die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage sein. PatientInnen mit somatoformen Störungen nehmen das Gesundheitssystem vermehrt in Anspruch und sind häufiger arbeitsunfähig. Die subjektive Beeinträchtigung kann mit Hilfe eines Fragebogens zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität gemessen werden. Einige Studien weisen darauf hin, dass PatientInnen mit somatoformen Störungen auch unterhalb der Schwelle einer Somatisierungsstörung sich schwer gesundheitlich beeinträchtigt fühlen. 37 3 Eigene Fragestellungen und Hypothesen In der vorliegenden Arbeit soll die Häufigkeit von PatientInnen mit multiplen somatoformen Beschwerden in der Allgemeinmedizin dargestellt werden. Es wird das gleichzeitige Auftreten von somatoformen Symptomen und psychischen Symptomen wie Ängstlichkeit und Depressivität überprüft. Des weiteren wird die körperliche und psychische Beeinträchtigung von PatientInnen mit somatoformen Symptomen, sowie die Anzahl der Praxiskontakte und Arbeitsunfähigkeitstage untersucht. Die hier vorliegende Studie untersucht vorwiegend PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen im Fragebogen SOMS-2 (s. Abschnitt 4.4). 3.1 Fragestellung: Wie häufig geben PatientInnen zwischen 18 und 60 Jahren einer hausärztlichen Praxis multiple somatoforme Symptome im SOMS-2 an? Welche Häufigkeitsunterschiede ergeben sich bei unterschiedlichem Cut off im SOMS-2 und nach den Diagnosesystemen ICD-10 und DSM-IV? Gibt es einen Häufigkeitsunterschied zwischen den Geschlechtern? Hypothese: Da die Symptomauswahl im DSM-IV deutlich größer als in der ICD-10 ist, wird erwartet, dass nach der Symptomliste des DSM-IV mehr PatientInnen mit multiplen somatoformen Symptomen identifiziert werden, als nach der ICD-10. Frauen geben im Durchschnitt mehr somatoforme Symptome an als Männer. 38 3.2 Fragestellung: Unterscheiden sich PatientInnen mit einer Auffälligkeit im SOMS-2 im Hinblick auf Ängstlichkeit und Depressivität von im SOMS-2 unauffälligen PatientInnen? Besteht zwischen der Anzahl der somatoformen Symptome und dem Grad der Ängstlichkeit und / oder Depressivität eine Korrelation? Hypothese: Im SOMS-2 auffällige PatientInnen sind ängstlicher und / oder neigen mehr zu Depressivität als im SOMS-2 unauffällige PatientInnen. Bei steigender Anzahl somatoformer Symptome wird eine Zunahme von Ängstlichkeit und Depressivität erwartet. 3.3 Fragestellung: Wie häufig wird bei PatientInnen mit einer Auffälligkeit im SOMS-2 (mehr als 4/6 somatoformen Symptomen) die Diagnose einer somatoformen Störung (ICD-10) durch das Interview Mini-DIPS bestätigt? Welche weiteren Diagnosen werden nach dem diagnostischen Interview Mini-DIPS bei PatientInnen mit einer somatoformen Störung gestellt? Hypothese: Nicht bei allen PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen im SOMS-2 lässt sich eine somatoforme Störung nach der ICD-10 diagnostizieren. Bei PatientInnen mit einer somatoformen Störung wird vor allem eine hohe Komorbidität mit Angststörungen und affektiven Störungen erwartet. 39 3.4 Fragestellung: Unterscheiden sich PatientInnen mit einer Auffälligkeit im SOMS-2 und/ oder in der HADS-D im Hinblick die gesundheitsbezogene Lebensqualität im Vergleich zu PatientInnen, die im SOMS-2 und /oder in der HADS-D unauffällig sind? Hypothese: Es wird erwartet, dass sich die im SOMS-2 auffälligen PatientInnen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigter fühlen als die im SOMS-2 unauffälligen PatientInnen. Bei PatientInnen mit SOMS-2 und HADS-D Auffälligkeit („comorbid somatizers“) wird eine ähnliche körperliche und psychische Beeinträchtigung erwartet wie bei PatientInnen, die im SOMS-2 auffällig, aber in der HADS-D unauffällig sind („discret somatizers“, s. Abschnitt 2.4). 3.5 Fragestellung: Unterscheiden sich PatientInnen mit einer Auffälligkeit im SOMS-2 hinsichtlich der Konsultationshäufigkeit und/ oder der Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage von im SOMS-2 unauffälligen PatientInnen? Hypothese: PatientInnen mit einer Auffälligkeit im SOMS-2 haben häufigere Praxiskontakte und mehr Arbeitsunfähigkeitstage als PatientInnen, die im SOMS-2 unauffällig sind. 40 4 Methodik 4.1 Durchführung der Untersuchung Die Erhebung ist in zwei Untersuchungsabschnitten durchgeführt worden. In ei- ner ersten Screening-Phase wurden über einen Zeitraum von 3 Wochen vom 5.10. bis 23.10.1998 alle PatientInnen, die persönlich die Praxis aufsuchten, die zu einer Untersuchung oder Therapie einbestellt wurden (Labor, EKG, Reizstrom usw.), ein Rezept oder Überweisungsschein abholten oder bei Hausbesuchen besucht wurden, registriert, Alter und Geschlecht erfasst. Die gewählte Studienpopulation entspricht nach der Definition von LINDEN et al. (1996) der Inanspruchnahmepopulation (s. Abschnitt 2.2). Alle PatientInnen zwischen 18 und 60 Jahren wurden in diesem Zeitraum gebeten, ein Fragebogenpaket zur Selbstbeurteilung auszufüllen. Das Fragebogenpaket enthielt das „Screening für somatoforme Störungen“ (SOMS-2), die „Hospital Anxiety and Depression Scale- Deutsche Version“ (HADS-D) und den „Fragebogen zum Gesundheitszustand“ (SF-12) als Selbstbeurteilungsmessinstrumente. Bei den Angaben zur Person wurden Alter, Geschlecht, Familienstand, Schulbildung, berufliche Situation, Angaben zur Erwerbstätigkeit und Arbeitsunfähigkeit erfasst. Nach Auswertung der Fragebögen wurden Männer mit mehr als 4 Symptomen und Frauen mit mehr als 6 Symptomen im SOMS-2 durch eine der Arzthelferinnen telefonisch zu einem diagnostischen Interview (Mini-DIPS) in die Praxis bestellt. Bei anderen PatientInnen wurde bei einer nächsten Konsultation ein Interview-Termin ausgemacht. Bei N=36 von insgesamt N=79 PatientInnen, die im SOMS-2 auffällig waren, wurde das Interview durchgeführt. Im Mini-DIPS werden die möglichen körperlichen Symptome für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung nicht einzeln aufgeführt. Daher wurden zusätzlich zum Mini-DIPS die PatientInnen zu ihren im SOMS-2 angegebenen Beschwerden explizit befragt. Weitere psychische Diagnosen wie eine Angststörung, eine affektive Störung oder eine Medikamenten- Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, posttraumatische Belastungsreaktion, Zwang, Ess-Störung und Psychosen wurden im Interview mit erfasst. 41 4.2 Beschreibung der Stichprobe Die Erhebung wurde im Oktober 1998 in einer Gemeinschaftspraxis für Allge- meinmedizin in Rickenbach, einer Gemeinde mit etwa 4000 EinwohnerInnen im südlichen Schwarzwald durchgeführt. Innerhalb der Gemeinde gibt es zwei weitere Allgemeinmedizinpraxen. Die PatientInnen kommen aus Rickenbach und angrenzenden Ortschaften mit einem Radius bis zu 15 km. Im gesamten Einzugsgebiet gibt es 7 Allgemeinmedizinpraxen. Im Quartal IV 1998 haben 1766 KassenpatientInnen und 79 PrivatpatientInnen die Praxis aufgesucht. Die beiden Praxisinhaber sind Spanier, Ärzte für Allgemeinmedizin ohne psychotherapeutische Zusatzbezeichnung, 34 und 47 Jahre alt. Die Praxis besteht seit mehr als 30 Jahren, seit 12 Jahren ist der ältere Kollege dort niedergelassen, der jüngere seit 7 Jahren. Die Untersucherin arbeitete seit Beginn 1998 als Praxisassistentin in der Praxis. Es waren 684 verschiedene PatientInnen (von insgesamt 1845 im Quartal IV 1998) in der Praxis, davon waren 365 PatientInnen zwischen 18 und 60 Jahren alt , 63 PatientInnen unter 18 Jahren, 256 PatientInnen über 60 Jahren. Nur die PatientInnen zwischen 18 und 60 Jahren wurden in die Studie aufgenommen. Von den 365 PatientInnen haben 138 die Fragebögen ausgefüllt (37,8%). Einige PatientInnen haben einzelne Fragebögen unvollständig ausgefüllt, manche haben nur den SOMS-2 Symptomteil (Item 1-53) ausgefüllt. Hauptgründe für Nichtausfüllen war mangelndes Interesse und zu wenig Zeit. Nach Gesprächen mit den behandelnden Praxisärzten wurden 2 PatientInnen mit körperlichen Erkrankungen, bei denen die Beschwerden organisch erklärt werden konnten, ausgeschlossen. Es handelte sich um einen Patienten mit einer dilatativen Kardiomyopathie, und eine Patientin mit einer chronischen Niereninsuffizienz. Ein weiterer Patient mit einer Schizophrenie und gleichzeitig Oligophrenie wurde ebenso ausgeschlossen. Somit besteht die eigentliche Stichprobe aus n=135 PatientInnen (fortan „Stichprobe"). N=79 PatientInnen waren nach SSI-4/6 Kriterien auffällig im SOMS-2 (vgl. Kapitel 2.1), sie wurden zu einem diagnostischen Interview in die Praxis einbestellt. N=36 PatientInnen waren bereit, an einem diagnostischen Interview etwa im Umfang einer Stunde teilzunehmen. Sie wurden von der Untersucherin mit dem strukturellen Interview Mini-DIPS untersucht, um eine diagnostische Zuordnung nach ICD-10 zu treffen. 42 In Abbildung 1 wird ein Überblick gegeben, über die Gesamtzahl der registrierten PatientInnen im Untersuchungszeitraum, die an der Studie teilnehmenden PatientInnen und die interviewten PatientInnen. Abb. 1: Übersicht Studienteilnahme N=36 N=79 N=135 N=138 N=365 N=684 4.3 Mini-DIPS SSI-4/6 auffällig Stichprobe Fragebogen ausgefüllt 18-60 Jahre 0-95 Jahre Soziodemographische Merkmale und Repräsentativität der Stichprobe Es werden zunächst die soziodemografischen Merkmale beschrieben. Angaben zum Familienstand, Schulbildung, Beruf und Erwerbstätigkeit sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Alter: Von den 365 PatientInnen zwischen 18 und 60 Jahren („Gesamt“) beträgt das Durchschnittsalter M=40,36 Jahre (SD=12,38; Median 40,0 J.). Das Durchschnittsalter der Stichprobe (N=135) ist signifikant niedriger (M=36,33 Jahre; SD=10,76; Median 36,0 J.) als das Durchschnittsalter derjenigen, die die Studie ablehnen (M=42,72 Jahre; SD=12,58; Median 46 J.). Jüngere PatientInnen sind also eher bereit, an der Studie teilzunehmen. Geschlecht: Im Untersuchungszeitraum kamen 48,2% (n=176) Männer und 51,8% (n=189) Frauen zwischen 18 und 60 Jahren in die Praxis. 43,7% (N=59) Männer und 56,3% (N=76) Frauen sind in der Stichprobe vertreten. Es besteht kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Männern und Frauen bzgl. der Studienteilnahme. 43 Tab. 3: Soziodemografische Daten M SD Alter Stichprobe N=135 SSI-4/6 N=79 Mini-DIPS N=36 36,33 10,76 37,66 11,20 40,06 12,32 51,3 48,8 47,2 52,8 p<0,001 Geschlecht Männer Frauen % % 43,7 56,3 p=0,014 Familienstand Alleinstehend Verheiratet/ Partner Geschieden Verwitwet % % % % 27,2 60,3 10,6 1,9 27,7 60,0 9,2 3,1 24,2 66,7 6,1 3,0 Schulbildung Keine Volks-/ Hauptschule Realschule Gymnasium % % % % 0 72,5 21,6 5,8 0 75,4 20,0 4,6 0 75,8 24,2 0 6,9 10,9 35,6 35,6 2,0 8,9 4,7 9,4 37,5 35,9 1,6 10,9 3,1 12,5 34,4 37,5 3,1 9,4 64,7 9,8 13,7 11,8 67,7 4,6 13,8 13,9 51,5 9,1 18,2 21,2 Beruf in Ausbildung Haushalt ArbeiterIn Angestellte Beamte Selbständig Erwerbstätig Vollzeit Teilzeit Arbeitslos/ Erwerbslos Berufsunfähig/ Berentet % % % % % % % % % % M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; p: Irrtumswahrscheinlichkeit Signifikanzen in der Spalte „SSI-4/6“ beziehen sich auf die Stichprobe, Signifikanzen in der Spalte „Mini-DIPS“ beziehen sich auf die SSI-4/6-Auffälligen (da nur PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen interviewt wurden) 44 Zur Überprüfung der Repräsentativität wurde diese Studie weiteren Studien hinsichtlich einiger soziodemographischen Daten zum Alter, Geschlechterverhältnis, Familienstand und Schulbildung in Tabelle 4 gegenübergestellt. Bei den Vergleichstudien in Tabelle 4 handelt es sich zum einen um die „Düsseldorfer Hausarztstudie“ (TRESS et al. 1998) und eine bisher unveröffentlichte Hausarztstudie in Südbaden unter Leitung von Fritzsche. Die soziodemografischen Daten zu der Südbadenstudie wurden aus der Dissertationsarbeit von POMMERSHEIM (2001) entnommen. Tab. 4: Repräsentativität der Studienpopulation Krings-Ney Tress et al. 1998 Pommersheim 2001 N=135 N=572 N=1094 M SD 18-60 Jahre 36,3 Jahre 10,8 Jahre 16-70 Jahre 42,7 Jahre 15,7 Jahre 18-65 Jahre 45,2 Jahre 16,4 Jahre % % 43,7 56,3 31,3 68,7 33,9 66,1 Familienstand alleinlebend Verheiratet / mit Partner Verwitwet Geschieden % % % % 27,2 60,3 1,9 10,6 26,9 63,8 1,9 7,5 21,1 66,7 5,1 7,1 Schulbildung Keine Sonderschule Volks/ Hauptschule Realschule Fachabitur Gymnasium/ Abitur % % % % % % 1,5 72,5 21,6 1,9 3,1 38,1 31,3 10,0 15,0 M SD 7,47 6,51 Alter Geschlecht SOMS-2 Männer Frauen Symptomanzahl 5,8 47,0 25,7 25,8 7,68 6,94 In der hier beschriebenen Studie fällt zum einen das geringere Durchschnittsalter auf, das sich teilweise durch die Altersbegrenzung erklären lässt. In der WHO-Studie (LINDEN et al. 1996), die in Berlin und Mainz durchgeführt wurde, nahmen PatientInnen von 18 bis 65 Jahren teil. In Berlin lag das Durchschnittsalter bei 40,6 Jahren (SD=13,25). In Mainz lag das Durchschnittsalter mit 37,0 Jahren (SD=12,45) ähnlich wie in der hier beschriebenen Studie. Das Geschlechterverhältnis ist in der hier beschriebenen Studie ausgewogener als in den beiden Vergleichsstudien von TRESS et al. (1998) und POMMERSHEIM. (2001). In beiden Vergleichsstudien liegt der Frauenan- 45 teil bei über 65%. Bei der in den 80er Jahren durchgeführten und häufig zitierten EVaSStudie (Erhebung über die Versorgung im ambulanten Sektor, SCHACH et al. 1989) wird ein Geschlechterverhältnis von 60,3% Frauen zu 39,7% Männern angeführt. LINDEN et al. (1996) geben einen Frauenanteil von 58,8% in Berlin bzw. 57,0% in Mainz an. Die hier vorliegende Studie beschreibt also ein Geschlechterverhältnis, das vergleichbar mit anderen repräsentativen Studien ist. Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich das Geschlechterverhältnis der Stichprobe nicht signifikant von den erfassten PatientInnen, die im Untersuchungszeitraum die Praxis aufsuchten. Hinsichtlich des Familienstandes besteht kein starker Unterschied zu den beiden Vergleichsstudien. Der Anteil der Geschiedenen ist in der hier vorliegenden Studie etwas höher als in den anderen beiden Vergleichsstudien. In der Schulbildung besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der in der Studie beschriebenen Stichprobe und den Vergleichsstichproben. Mehr als 70% geben Volks- bzw. Hauptschulabschluss an, während bei den Vergleichsstudie 38% bzw. 47% angegeben werden. Dagegen haben in der hier vorliegenden Studie knapp 6% das Abitur, während in den Vergleichsstudien 15% bzw. 26% die Schule mit dem Abitur abgeschlossen haben. Diese Unterschiede in der Schulbildung sind dadurch zu erklären, dass die Studie in einer Landarztpraxis durchgeführt wurde. Eine Hauptschule existiert am Ort, alle weiterführenden Schulen sind im Umkreis von 14-20 km zu erreichen. Gerade für die ältere Generation standen vorwiegend Berufe in der Landwirtschaft oder handwerkliche Berufe zur Auswahl, für die kein weiterführender Schulabschluss benötigt wurde. Bei POMMERSHEIM (2001) wurde ebenso der SOMS-2 als Screeninginstrument bei einer unselektierten Stichprobe von 1094 PatientInnen eingesetzt. Die durchschnittlich angegebene Symptomanzahl war fast gleich wie die in dieser Studie angegebene Symptomanzahl (s. Tab. 4). Bei einer Interventionsstudie von FRITZSCHE und WIRSCHING (2002), wurden 282 PatientInnen, die im SOMS-2 nach 4/6 Kriterien auffällig waren, in die Studie aufgenommen. Die durchschnittliche Symptomanzahl lag bei M=13,76 (SD 7,66) Symptomen. 4.4 Messinstrumente Das Screening für somatoforme Störungen (SOMS-2, RIEF et al. 1997) Das „Screening für somatoforme Störungen“ (SOMS-2) ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, das die Erkennung von Personen mit somatoformen Störungen erleichtert. Im 46 deutschsprachigen Raum wurde 1990 bis 1992 von RIEF et al. der Fragebogen entwikkelt, der sich an der Symptomliste des damals gültigen DSM-III-R orientierte. Er umfasste ursprünglich 42 Items. Nach Inkrafttreten der ICD-10 1993 in Deutschland wurde der SOMS überarbeitet und umfasst nun 53 Symptome mit Ja/ Nein- Antwortalternative für den gesamten Zeitraum der letzten 2 Jahre. Die aktuelle Fassung des SOMS-2 berücksichtigt alle körperlichen Symptome, die für eine Somatisierungsstörung nach DSM-IV und ICD-10 als auch für die somatoforme autonome Funktionsstörung von Relevanz sind (s. Tabelle A2 im Anhang). Das Zusammenzählen der als positiv beantworteten körperlichen Symptome ergeben den „Beschwerden-Index Somatisierung“ oder „somatic symptom index“ (SSI). Weitere 15 Items erfassen die zentralen Ein- und Ausschlusskriterien der Somatisierungsstörung nach ICD-10 und DSM-IV sowie der somatoformen autonomen Funktionsstörung. Neben der Anpassung des Fragebogens an die neuen Klassifikationssysteme wurde ein weiterer Fragebogen zur Veränderungsmessung (SOMS-7) entwickelt. In dieser Version wird nicht nur das Vorhandensein körperlicher Beschwerden in den vergangenen sieben Tagen erfragt, sondern auch die Intensität der Symptome. Der SOMS-2 besitzt eine gute interne Konsistenz und eine gute Zeitstabilität (Retest- Reliabilität nach 72 Stunden: 0,85-0,87). Die Sensitivität des SOMS-2 liegt bei 82-98%, wenn im Fragebogen die gleichen Grenzwerte verwendet werden wie im Interview. Allerdings geht diese hohe Sensitivität zum Teil zu Lasten der Spezifität (RIEF et al. 1997). Dies bedeutet, dass der Fragebogen in seiner ursprünglichen Fassung die Anzahl von Somatisierungssymptomen höher einschätzt, als dies im Interview geschieht (RIEF et al. 1997). Die Werte für die Spezifität liegen zwischen 43-85%, wenn im Fragebogen die gleichen Grenzwerte verwendet werden wie im Interview (RIEF et al. 1997). Nach RIEF und HILLER (1992) muss bei einer Selbstbeurteilung mittels Fragebogen im Vergleich zu einer Fremdbeurteilung mittels Interview mit einer Überschätzung somatoformer Beschwerden gerechnet werden.. In einer klinischen Untersuchung zeigten RIEF und HILLER (1992), dass bei 73% der PatientInnen mit einem Verdachtsbefund im SOMS-2 auch tatsächlich eine somatoforme Störung vorlag (die Diagnose wurde mit Hilfe des SKID- Interviews gestellt). Aufgrund des SOMS-2 Befundes kann ein Verdacht für das Vorliegen einer somatoformen Störung angezeigt werden (RIEF et al. 1997). 47 Hospital Anxiety and Depression Scale- Deutsche Version (HADS-D, HERRMANN et al. 1995) Der Selbstbeurteilungsfragebogen HADS-D wurde zur Erfassung von Ängstlichkeit und Depressivität speziell bei PatientInnen mit primär körperlichen Beschwerden konzipiert. In zwei unabhängigen Subskalen (Depression und Angst) mit insgesamt 14 Items werden die für diese Störungsgruppe am häufigsten genannten psychischen Symptombereiche abgebildet. Die Testergebnisse legen keine Diagnose fest, sondern dienen der Orientierung. Werte ≤ 7 werden als unauffällig angesehen, Werte von 8-10 gelten als grenzwertig und Werte ≥11 als auffällig. Die HADS-D ist die gleichwertige deutsche Fassung der englischen HADS. Die HADS wurde weltweit in über 100 Studien mit insgesamt mehr als 15000 PatientInnen eingesetzt. Die Itemkennwerte weisen eine befriedigende und homogene Testkonstruktion aus. Die Sensitivität der HADS Originalversion für die Identifikation auffälliger Ängstlichkeit liegt bei 88%, die Spezifität für Ängstlichkeit bei 83%. Die Sensitivität für die Identifikation depressiver Zustände liegt bei 77%, ihre Spezifität für Depression bei 85% (bei einem Cut-off von ≥11 in jeder der beiden Subskalen, HERRMANN et al. 1995). Der Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-12, BULLINGER und KIRCHBERGER 1998) Der SF-12 ist ein Ausschnitt aus dem Selbstbeurteilungs-Fragebogen SF-36. Die Entwicklung des SF-36 Health Survey wurde bereits in den 60iger Jahren in den USA begonnen. In den vergangenen Jahren wurde der SF-36 zum Standardinstrumentarium zur Erfassung der subjektiven Gesundheit. Der SF-36 erfasst 8 Dimensionen, die sich in die Bereiche „körperliche Gesundheit“ und „seelische Gesundheit“ einordnen lassen. Seit 1992 wurde der SF-36 in einer internationalen Arbeitsgruppe auf mehrere Sprachen übersetzt. In über 15 Ländern existieren mittlerweile übersetzte und psychometrisch getestete Versionen. Die Ergebnisse aus Deutschland zeigen, dass die Übersetzung des Fragebogens als erfolgreich gewertet werden kann und dass der SF-36 nach der Anwendung in unterschiedlichen Populationen mit über 4000 Patienten auch im deutschen Sprachraum als psychometrisch zufriedenstellendes Verfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sein kann. Die 12-Items umfassende Kurzversion des SF-36 hat den Vorteil einer wesentlich kürzeren Bearbeitungszeit ohne schwerwiegenden Verlust an Information. Allerdings liegen bisher zum SF-12 im Vergleich zum SF-36 weniger empirische Daten vor. 48 Die Auswertung erfolgt durch ein computerisiertes Auswertungsprogramm, in dem für die Skalen spezielle Gewichtungen miteinbezogen werden. In der amerikanischen Normstichprobe wurden Mittelwerte von 50 und eine Standardabweichung von 10 festgelegt. Höhere Werte in den Summenskalen bedeuten einen besseren subjektiven körperlichen und seelischen Gesundheitszustand (BULLINGER und KIRCHBERGER 1998). Diagnostisches Kurz-Interview für psychische Störungen (Mini-DIPS, MARGRAF 1994) Das Mini-DIPS ist die Kurzform des Diagnostischen Interviews für psychische Störungen (DIPS, MARGRAF et al. 1991) und dient zur raschen Erfassung der für den psychotherapeutischen Bereich wichtigsten psychischen Störungen nach den Kriterien der international gebräuchlichsten Diagnosesysteme DSM-IV und ICD-10. Das DIPS ist eine deutschsprachige Version eines amerikanischen Interviews (Anxiety Disorders Interview Schedule). Strenge Überprüfungen der amerikanischen Originalversion belegen, dass die Diagnostik psychischer Störungen mit diesem Verfahren effektiv, reliabel und valide ist (MARGRAF 1994). Die deutschsprachige Version des DIPS wurde in mehrfacher Hinsicht gegenüber der amerikanischen erweitert und verändert. Im DIPS können insgesamt 17 psychische Störungen erfasst werden. Im Mini-DIPS werden Angststörungen, affektive Störungen, somatoforme Störungen, Essstörungen und Substanzabusus erfasst, sowie ein erster Ausschluss von Psychosen ermöglicht. Das Interview dient dazu, einen Überblick über die Probleme der PatientInnen zu gewinnen. Deswegen werden verschiedene Bereiche angesprochen, in denen Probleme auftauchen können. Um die Durchführung zu beschleunigen, wurden die Störungen zu „Problembereichen“ zusammengefasst, für die jeweils einleitende „Vor-Screening Fragen“ formuliert wurden. Dies maximiert die Möglichkeit, unnötige Fragen auszulassen. Die Diagnostiker orientieren sich während des Interviews an einem schriftlichen Leitfaden, der die Fragen enthält, und halten die Antworten der PatientInnen schriftlich fest. Durch das Mini-DIPS kann die Diagnostik in klinischer Praxis und Forschung erleichtert werden (MARGRAF 1994). 4.5 Statistische Auswertung Alle statistischen Anwendungen erfolgen mit dem Statistikpaket SPSS (Statisti- cal Package for the Social Sciences) in der Version 9.0. Das Kollektiv von 135 PatientInnen zeigt hinsichtlich der Symptomanzahl im SOMS-2 keine Normalverteilung. Aus 49 diesem Grund werden Mittelwertvergleiche mit nichtparametrischen Tests (durch den U-Test nach Mann und Whitney sowie den Wilcoxon Test) untersucht. Durch den ChiQuadrat-Test nach Pearson wird die Unabhängigkeit von 2 Variablen überprüft. Ist eine der erwarteten Häufigkeiten in der Vierfeldertafel kleiner 5, wird der exakte Chi-Quadrat- Wert nach Fischer angegeben. Bei den Korrelationsrechnungen wird der Korrelationskoeffizient nach Spearmann angegeben. Die Angaben des Signifikanzniveaus orientiert sich an folgender Einteilung: Hoch signifikant: p ≤ 0,01 Signifikant: 0,01 < p ≤ 0,05 Tendenziell bedeutsam: 0,05 < p ≤ 0,10 Keine Signifikanz: p > 0,10 50 5 Ergebnisse Im Ergebnisteil erfolgt die statistische Auswertung der Fragebögen SOMS-2, HADS-D und SF-12 sowie die Auswertung des Mini-DIPS Interview. 5.1 SOMS-2 Auswertung Anzahl der Symptome im SOMS-2 Die Symptomanzahl der körperlichen Beschwerden ohne organischen Befund reicht von 0 bis 31 Symptomen. Der Durchschnitt der erlebten körperlichen Symptome beträgt M=7,47 (SD=6,51; Median 6,0). Die Häufigkeitsverteilung der angegebenen körperlichen Symptome ohne organischen Befund entspricht nicht einer Normalverteilung. Es ist eine positive Schiefe zu verzeichnen (Schiefe 1,08). Nur 10,8% der PatientInnen geben an, in den letzten 2 Jahren keine körperlichen Symptome ohne organische Ursache erlebt zu haben, insgesamt 32% erlebten weniger als 4 Symptome. In Abbildung 2 wird die Häufigkeit somatoformer Symptome der Stichprobe dargestellt. Abb. 2: Häufigkeit somatoformer Symptome im SOMS-2 (je 3 Symptome zusammengefasst) 30 M=7,47 Mittelwert 21 20 20 15 13 10 11 Prozent 9 4 4 3 0 0 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 Anzahl der Symptome im SOMS-2 n=135 PatientInnen >21 51 Bei Anwendung der Kriterien für ein multiples somatoformes Syndrom (Männer mehr als 4 Symptome, Frauen mehr als 6 Symptome, abgekürzt „SSI-4/6“), sind im beschriebenen PatientInnenkollektiv 58,5% (n=79), also mehr als die Hälfte im SOMS2 auffällig. Die im SOMS-2 nach SSI-4/6 Kriterien auffälligen PatientInnen unterscheiden sich, wie nachfolgend beschrieben, signifikant hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung zwischen den Geschlechtern. Im Hinblick auf die anderen soziodemographischen Daten (Familienstand, Schulausbildung und Erwerbstätigkeit) unterscheiden sie sich nicht von den SOMS-2 unauffälligen. Es besteht kein statistisch signifikanter altersabhängiger Unterschied in Bezug auf die Anzahl somatoformer Symptome oder hinsichtlich SSI4/6 Auffälligkeit im SOMS-2. Die 5 häufigst genannten Symptome im SOMS-2 sind Schmerzsymptome. Etwa 67% aller PatientInnen klagen über Rückenschmerzen, 49% über Kopfschmerzen, 47% haben Schmerzen in den Armen und Beinen, 43% Bauchschmerzen, 40% Gelenkschmerzen. In Tabelle 11 ist die Symptomhäufigkeit einiger häufiger Symptome aufgeführt. Die 5 am seltensten genannten Symptome im SOMS-2 sind: Verlust von Berührungs- oder Schmerzempfinden (1,7%), Flüssigkeitsaustritt aus dem Darm (1,7%), Sinnestäuschungen (0,8%), Impotenz (0,8%), Blindheit (0%). Häufigkeits-Unterschiede bedingt durch die unterschiedlichen Diagnosesysteme ICD-10 und DSM-IV Der Anteil der PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen im SOMS-2 (insgesamt werden 53 Symptome im SOMS-2 aufgeführt), beträgt wie oben beschrieben 58,5% (n=79). Wenn nur Symptome nach DSM-IV (insgesamt 35 Symptome) ausgewertet werden, sind 50% (n=67) der PatientInnen auffällig nach 4/6 Kriterien. Werden nur Symptome nach ICD-10 (insgesamt 14 Symptome) ausgewertet, haben 30% (n=41) der PatientInnen mehr als 4/6 Symptome (s. Tabelle 5). Es ist bemerkenswert, dass alle 41 PatientInnen, die nach ICD-10 mehr als 4/6 Symptome aufweisen, auch nach DSM-IV auffällig sind, obwohl unterschiedliche Symptomlisten in beiden Diagnosesystemen benutzt werden (s. Abb. 3). PatientInnen, die mehr als 4/6 Symptome nach der Symptomliste des ICD-10 aufweisen, haben eine signifikant höhere durchschnittliche Symptomanzahl im SOMS-2 (M=14,3) im Vergleich zu PatientInnen, die mehr als 4/6 Symptome nach der Symptomliste des DSM-IV haben (M=9,0; p<0,001). 52 Abb. 3: SSI-4/6 Auffälligkeit im SOMS-2, nach DSM-IV und ICD-10 N=79 (59%) SSI-4/6 im SOMS-2 (53 Symptome) N=67 (50%) SSI-4/6, DSM-IV (35 Symptome) N=41 (30%) SSI-4/6, ICD-10 (14 Symptome) Tab. 5: Unterschiedliche Diagnosezuweisungen Auffällig N % Gesamt N SOMS-2 nach SSI-4/6 79 58,5 135 DSM-IV nach SSI-4/6 67 49,6 135 ICD-10 nach SSI-4/6 41 30,4 135 DSM-IV Somatisierungsstörung 7 7,3 96 ICD-10 Somatisierungsstörung 3 3,6 83 ICD-10 Somatoforme Autonome Funktionsstörung 21 22,3 94 Polysymptomatische somatoforme Störung (PSS-7) 58 43,0 135 Die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-IV im SOMS-2 erfüllen im untersuchten PatientInnenkollektiv 7,3% (n=7 PatientInnen von insgesamt n=94). Nur 94 der 135 PatientInnen haben alle Zusatzfragen zu Ein- und Ausschlusskriterien nach DSM-IV (z.B. Beeinträchtigung, Ursache für die Beschwerden, Beginn und Dauer der Beschwerden) beantwortet, daher gibt es 30,8% fehlende Daten. Ohne diese Informationen der Ein- und Ausschlusskriterien kann keine Aussage über das Vorliegen einer Somatisierungsstörung nach DSM-IV getroffen werden. Die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach ICD-10 im SOMS-2 erfüllen nur 3,6% (n=3 von n=83 PatientInnen). Die Kriterien einer somatoformen autonomen Funktionsstörung nach ICD-10 im SOMS-2 erfüllen insgesamt 22,3% (n=21 von n=94 53 PatientInnen). Die Übereinstimmung der Diagnose „Somatisierungsstörung“ zwischen ICD-10 und DSM-IV ist nur unzureichend. Von 7 PatientInnen, die die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-IV erfüllen und 3 PatientInnen, die die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach ICD-10 erfüllen, erfüllt nur eine Patientin die Kriterien beider Diagnosesysteme. Die in einer Studie (Rief, Hiller 1999) befürwortete Mindest-Symptomanzahl von 7 Symptomen aus einer empirisch validierten Symptomliste von 32 Symptomen, genannt polysymptomatische somatoforme Störung (PSS-7), ergibt einen Anteil von 43% Auffälligen. Alle 9 PatientInnen, die im SOMS-2 die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach ICD-10 oder DSM-IV erfüllen, erfüllen auch die Kriterien einer polysymptomatischen somatoformen Störung. Geschlechtsabhängige Auffälligkeit Bei Männern beträgt der Mittelwert der Symptomanzahl im SOMS-2 M=6,8 (SD=5,3; Median 6,0), bei Frauen M=8,0 (SD=7,3; Median 6,0). Es besteht kein statistisch signifikanter Unterschied in der Symptomanzahl zwischen Männern und Frauen. Von den N=55 unauffälligen PatientInnen im SOMS sind 31%männlich und 69% weiblich. Von den N=79 auffälligen PatientInnen im SOMS sind 53% männlich und 48% weiblich (s. Abb.4). Abb. 4: Geschlechtsabhängige Auffälligkeit im SOMS-2 80 69 60 53 48 40 31 Prozent 20 SSI-4/6 im SOMS-2 unauffällig auffällig 0 männlich Geschlecht weiblich 54 Insgesamt nehmen 59 Männer an der Studie teil. 71% (n=42) der Männer haben mehr als 4 Symptome im SOMS-2. 76 Frauen nehmen an der Studie teil. 50% (n=37) der Frauen haben mehr als 6 Symptome im SOMS-2. Nach SSI-4/6 Kriterien im SOMS-2 sind Männer statistisch signifikant auffälliger als Frauen (p=0,014). Die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-IV im SOMS-2 erfüllen 13,5% der Frauen (n=7), jedoch kein Mann. Bei der Diagnose einer somatoformen autonomen Funktionsstörung nach ICD-10 besteht kein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die validierte Symptomliste mit insgesamt 32 Symptomen enthält keine geschlechtsspezifischen Symptome. Wird diese Symptomliste zugrunde gelegt, haben n=24 Männer (41%) und n=34 Frauen (45%) mehr als 7 Symptome (PSS-7). Es besteht kein signifikanter Unterschied. In Tabelle 6 werden die geschlechtsspezifischen Häufigkeitsunterschiede auf die unterschiedlichen Diagnosemöglichkeiten nach ICD-10 und DSM-IV dargestellt. Tab. 6: Vergleich somatoforme Störungen Männer / Frauen im SOMS-2 Stichprobe N=135 Männer N=59 Frauen N=76 Alter M SD 36,50 10,76 35,63 10,91 36,88 10,68 Symptomanzahl M SD 7,47 6,51 6,75 5,30 8,04 7,29 SSI-4/6 % 58,5 71,2 p=0,014 44,5 DSM-IV Somatisierungsstörung % 7,3 0 13,5 ICD-10 Somatisierungsstörung % 3,6 4,9 2,4 ICD-10 Somatof. Autonome Funktionsstörung % 22,3 20,5 24,0 Polysymptomatische somatof. Störung (PSS-7) % 43,0 40,7 44,7 In Tabelle 7 sind Ein- und Ausschlusskriterien für das Vorliegen einer somatoformen Störung nach ICD-10 oder DSM-IV zusammengefasst, die danach ausführlicher behandelt werden. 55 Tab. 7: Ein- und Ausschlusskriterien von somatoformen Störungen Beeinträchtigung im Alltag / Wohlbefinden ≥ 3 Arztbesuche wegen der Beschwerden % % Stichprobe N=135 SSI-4/6 N=79 PSS-7 N=58 62,5 65,3 73,6 44,3 46,7 p=0,017 50 45,1 Ursache für die Beschwerden festgestellt % 43,6 p=0,084 47,1 Panikattacken % 19,6 22,2 p=0,058 28,3 Dauer der Beschwerden länger als 2 Jahre % 46,3 54,1 p=0,021 58,2 Beginn der Beschwerden vor dem 30. Lj % 59,4 p=0,046 60,6 p=0,012 55,8 Hypochondrische Ängste % 4,9 8,3 9,6 Starke Schmerzen ≥ 6 Monaten % 30,0 37,5 41,5 Medikamente wegen der Beschwerden % 59,2 p=0,013 63,9 p=0,004 64,2 Körperdysmorphophobie % 7,5 5,6 5,9 Signifikanzen in den Spalten SSI-4/6 und PSS-7 beziehen sich jeweils auf die Stichprobe 62,5% fühlen sich im Alltagsleben oder im Wohlbefinden durch die körperlichen Symptome beeinträchtigt. Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen SSI-4/6 Auffälligen und Unauffälligen hinsichtlich der Beeinträchtigung. Die PatientInnen mit mindestens 7 Symptomen aus der validierten Symptomliste nach RIEF und HILLER (1999) fühlen sich jedoch signifikant häufiger im Wohlbefinden oder im Alltagsleben beeinträchtigt (p=0,017). Laut SOMS-2 geben 44,3% mindestens 3 Arztbesuche wegen der genannten Beschwerden an. Tendenziell sind die SSI-4/6 Auffälligen im SOMS-2 häufiger beim Arzt wegen der genannten Beschwerden (p=0,084). 43,6% (n=44) der Stichprobe geben an, dass keine Ursache für ihre Beschwerden gefunden wurde. Von den SSI-4/6-Auffälligen geben 47% an, dass keine Ursache gefunden wurde, d.h. jedoch, dass 53% zumindest einige der Beschwerden für erklärbar halten. Tendenziell häufiger geben die PatientInnen mit mehr als 7 Symptomen an, dass keine Ursache für die genannten Beschwerden gefunden wurde (p=0,058). 19,6% 56 (n=20) der PatientInnen geben an, Panikattacken erlebt zu haben, davon haben ein Viertel (n=5) PatientInnen die genannten Beschwerden ausschließlich bei Panikattakken. Die Dauer der Beschwerden ist bei 72% der PatientInnen bereits seit mehr als 6 Monaten, 46,3% haben über 2 Jahre die genannten Beschwerden. Bei 59,4% begannen die Beschwerden vor ihrem 30.Lebensjahr. Die nach SSI-4/6 SOMS-2 Auffälligen haben signifikant häufiger seit über 2 Jahren anhaltende Beschwerden (p=0,046). Bei den PatientInnen mit mindestens 7 Symptomen ist der Unterschied noch deutlicher (p=0,012), d.h. diejenigen, die mehr Beschwerden haben, haben sie bereits seit längerer Zeit. 4,9% (n=6) haben hypochondrische Ängste, bei n=4 PatientInnen bestehen seit über 6 Monaten diese Ängste vor einer schweren Erkrankung. 30,0% haben Schmerzen, die sie seit mehr als 6 Monaten stark beschäftigen. Von den SOMS-2 Auffälligen nach 4/6 Kriterien beschäftigen sich signifikant mehr seit über 6 Monaten mit Schmerzen (p=0,013). PatientInnen, die mehr als 7 Symptome von der validierten Symptomliste aufweisen, haben noch häufiger seit mehr als 6 Monaten starke Schmerzen (p=0,004). Die im SOMS-2 genannten Symptome lassen sich verschiedenen Organsystemen zuordnen: Schmerzsymptome, gastrointestinale Symptome, urologische / gynäkologische Symptome, pseudoneurologische Symptome, vegetative Symptome und sonstige Symptome (Appetitverlust, schlechter Geschmack, belegte Zunge, Mundtrockenheit oder Flecken bzw. Farbveränderung der Haut). Die meisten PatientInnen, die viele Symptome angeben, haben Symptome in unterschiedlichen Organbereichen (s. Tabelle 8). Nur 15% der SSI-4/6-Auffälligen im SOMS-2 haben Beschwerden in 1-2 Organsystemen, also bei 85% der SSI-4/6-Auffälligen sind 3 oder mehr Organsysteme betroffen. Bei allen PSS-7-Auffälligen (100%) sind 3 oder mehr Organsysteme betroffen. Hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Organsysteme gibt es keinen statistisch signifikanten geschlechtsabhängigen oder altersabhängigen Unterschied. Tab. 8: Anzahl der betroffenen Organsysteme Stichprobe N=135 Durchschnittliche Symptomanzahl Keine Beschwerden 11,1% 0 Symptome Beschwerden in 1-2 Organsystemen 34,1% 2,9 Symptome Beschwerden in 3-6 Organsystemen 54,8% 11,8 Symptome 57 5.2 HADS-D Auswertung Es haben n=122 PatientInnen den HADS-D Fragebogen ausgefüllt: Der Mittelwert des Angstscore beträgt M=6,72 (SD=3,97, Median 6,0) bei einem Range von 0 bis 18. Als auffällig ängstlich (Angstscore ≥11) sind lt. HADS-D 15% (n=18) der PatientInnen einzuschätzen. Der Mittelwert des Depressionsscore beträgt M=5,15 (SD=3,77; Median 4,5) bei einem Range von 0 bis 18. Als auffällig depressiv (Depressionsscore ≥11) sind 11% (n=13) der PatientInnen einzuschätzen. Die ÄngstlichkeitsAuffälligen sind häufiger auch hinsichtlich Depressivität auffällig (p<0,001). 7,4% (n=9) der PatientInnen sind sowohl hinsichtlich Depressivität als auch hinsichtlich Ängstlichkeit auffällig. Der Mittelwert des HADS-D Gesamtscore beträgt M=11,9 (SD=7,0; Median 11,0). In der HADS-D sind insgesamt 18,0% (n=22) auffällig (Angst- oder Depressionsscore ≥11). Es besteht kein altersabhängiger Unterschied in der HADS-D Auffälligkeit. Frauen sind signifikant häufiger auffällig in der HADS-D (p=0,033). Die Anzahl der Praxiskontakte im Jahr 1998 ist bei den HADS-D Auffälligen (M=27,75; SD=20,25) signifikant höher als bei den HADS-D Unauffälligen (M=17,0; SD=14,06; p=0,026). 24% (n=16) der SOMS-2 Auffälligen sind auch in der HADS-D auffällig (s. Tabelle 9). Sie werden nach ESCOBAR et al. (1998) als „comorbid somatizers“ bezeichnet. 76% (n=51) der SOMS-2 Auffälligen sind in der HADS-D unauffällig. Sie werden im Folgenden als „discrete somatizers“ bezeichnet. Tab. 9: Auffälligkeiten im SOMS-2 und in der HADS-D SOMS-2 unauffällig SOMS-2 auffällig HADS-D unauffällig n=49 n=51 („discret somatizers“) HADS-D auffällig n=6 n=16 („comorbid somatizers“) Der Durchschnitt des HADS-D Gesamtscore (M=13,0; SD=6,6) ist signifikant höher (p=0,005) bei SOMS-2 Auffälligen als bei SOMS-2 unauffälligen (M=10,3; SD=7,3). In Abbildung 5 wird eine Korrelation zwischen der Anzahl der Symptome im SOMS-2 und der Gesamtzahl der Symptome in der HADS-D dargestellt. 58 Abb. 5: Korrelation HADS-D/ SOMS-2 mit Regressionsgeraden 40 30 HADS-Gesamtscore 20 10 0 0 10 20 30 40 SOMS-Gesamtindex Es besteht eine mittlere Korrelation zwischen der Anzahl der somatoformen und psychischen Symptome (Ängstlichkeit und Depressivität). Der Spearmann`sche Korrelationskoeffizient beträgt r=0,400, die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant. Bei einem größeren Teil der PatientInnen geht die Anzahl der somatoformen Symptome etwa mit dem Grad der Ängstlichkeit und /oder Depressivität einher. Ein Teil der PatientInnen fühlt sich psychisch stark eingeschränkt (ängstlich oder depressiv), hat aber gar keine oder nur wenige körperliche Begleitsymptome. Ein kleinerer Teil der PatientInnen hat jedoch eine hohe Anzahl körperlicher Symptome mit nur geringen psychischen Begleitsymptomen (s. Abb. 5). HADS-D Auffällige haben signifikant häufiger vegetative Symptome (p=0,002) und neurologische Symptome (p=0,009, s. Tabelle 10)als in der HADS-D Unauffällige. In Tabelle 11 sind zuerst die häufigst genannten Symptome im SOMS-2 aufgeführt, danach die Symptome, die von in der HADS-D auffälligen PatientInnen häufiger genannt werden. 59 Tab. 10: Symptome nach Art der betroffenen Organsysteme Stichprobe SSI-4/6 N=135 N=79 HADS-D auffällig N=22 Schmerzsymptome % 79,3 97,5 81,8 Gastrointestinale Symptome % 50,4 77,5 68,2 Urologische / gynäkologische Symptome % 40,7 52,5 45,5 Pseudoneurologische Symptome % 41,5 61,3 63,6 p=0,009 Vegetative Symptome % 49,6 72,5 81,8 p=0,002 Sonstige Symptome∗ % 31,9 48,8 50,0 Anmerkungen: ∗ sonstige Symptome wie Appetitverlust, schlechter Geschmack, belegte Zunge, Mundtrockenheit oder Flecken bzw. Farbveränderungen der Haut Signifikanzen in der Spalte „HADS-D auffällig“ beziehen sich auf die Stichprobe. Tab. 11: Symptomhäufigkeit Anzahl Stichprobe SSI-4/6 Rückenschmerzen N 75 % der Antworten 7,9 % der Antworten 6,8 HADS-D auffällig % der Antworten 5,8 Kopfschmerzen 58 6,1 5,6 4,8 Schmerzen in Armen, Beinen 53 5,6 5,7 6,1 Bauchschmerzen 50 5,3 5,7 4,3 Gelenkschmerzen 45 4,7 4,4 3,1 Völlegefühl 43 4,5 4,3 Schweißausbrüche 32 3,4 3,6 Hitzewallungen, Erröten 27 2,8 3,1 Extreme Müdigkeit 27 2,8 3,0 Druck in Herzgegend 24 2,5 2,6 Schluckbeschwerden, Kloßgefühl 11 1,2 1,2 4,9 p=0,023 4,6 p=0,006 3,7 p=0,042 6,0 p<0,001 3,7 p=0,008 1,6 p=0,038 Anmerkung: Signifikanzen in der Spalte „HADS-D auffällig“ beziehen sich auf die Stichprobe 60 5.3 SF-12 Auswertung Es haben n=121 PatientInnen den Fragebogen SF-12 ausgefüllt. Nach Auswer- tung der Items wurden die Werte transformiert. In der amerikanischen Normstichprobe wurden Werte von 50 und eine Standardabweichung von 10 festgelegt. In dieser Studie beträgt der Mittelwert der körperlichen Summenskala M=45,0 (Median 46) bei einem Range von 22,3 bis 63,3 (SD=9,0). Der Mittelwert der psychischen Summenskala beträgt M=49,0 (Median 52) bei einem Range von 19,6 bis 66,1 (SD=10,9). In der körperlichen Summenskala unterscheiden sich Männer (M=44,0) nicht signifikant von Frauen (M=45,7), in der psychischen Summenskala sind Frauen (M=46,1) signifikant beeinträchtigter als Männer (M=52,8; p<0,001). Die nach SSI-4/6 Kriterien im SOMS-2 auffälligen PatientInnen unterscheiden sich entgegen der Erwartung in der körperlichen Summenskala nicht von den unauffälligen. In der psychischen Summenskala sind die nach SOMS-2 Auffälligen (M=47,6) beeinträchtigter als die nach SOMS-2 Unauffälligen (M=51,2; p=0,048). PatientInnen, die 7 von 32 Symptomen aufweisen, fühlen sich sowohl körperlich (p=0,015) als auch psychisch (p=0,013) signifikant beeinträchtigter als die unauffälligen PatientInnen. „Comorbid somatizers“ (SOMS-2 auffällig und HADS-D auffällig; n=16), sind in körperlicher Hinsicht (M=37,8) hochsignifikant eingeschränkter als „discrete somatizers“ (SOMS-2 auffällig und HADS-D unauffällig; n=51; M=45,6; p=0,003). Auch in psychischer Hinsicht sind „comorbid somatizers“ (38,7) hochsignifikant mehr belastet als „discrete somatizers“ (50,2; p<0,001). PatientInnen, die in der HADS-D auffällig sind (Depressionsscore oder Angstscore ≥11), sind sowohl körperlich (M=40,4; p=0,015) als auch psychisch (M=36,7; p<0,001) signifikant stärker belastet als HADS-D Unauffällige. Praxisbesuche und Arbeitsunfähigkeit Die PatientInnen der Stichprobe (n=135) haben im Jahr 1998 im Durchschnitt M=17,65 (SD=15,53; Median 13,5) Praxiskontakte gehabt (Maximum 83 Praxiskontakte). Der Unterschied in der Anzahl der Praxiskontakte zwischen den im SOMS-2 nach SSI-4/6-Kriterien Auffälligen (M=19,3 Praxiskontakte) und den im SOMS-2 Unauffälligen (M=13,8) ist statistisch nicht signifikant, aber tendenziell (p=0,058). „comorbid Somatizers“ hatten signifikant mehr Praxiskontakte (M=27,8) als „discrete Somatizers“ (M=16,7; p=0,023). 61 Abb. 6: Häufigkeit der Praxisbesuche 28 19 17 1414 <4/6 ≥4/6 SOMS-2 HADS-D p=0,058 ≥4/6 neg. ≥4/6 pos. (comorbid S.) p=0,023 Angaben zur Arbeitsunfähigkeit machten 97 PatientInnen. Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage weist eine große Spannbreite von 0 bis 300 Fehltagen auf, daher können die Mittelwerte nicht verglichen werden. PatientInnen, die im SOMS-2 nach 4/6 Kriterien auffällig sind, sind signifikant häufiger arbeitsunfähig (p=0,041, s. Abb.7). Abb.7: Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage 100 94 80 75 60 40 SSI-4/6 im SOMS Prozent 20 14 11 6 0 kein Tag 1-5 Tage Arbeitsunfähigkeit mehr als 5 Tage unauffällig auffällig 62 5.4 Mini-DIPS Auswertung N=36 PatientInnen, die im SOMS-2 mehr als 4 bzw. 6 Symptome angeben, nehmen an einem diagnostischen Interview teil. Die interviewten PatientInnen sind repräsentativ für die Gruppe der SOMS-2 Auffälligen in der Praxis. Sie unterscheiden sich von den übrigen SOMS-2 auffälligen PatientInnen nicht im Hinblick auf die soziodemografischen Daten, den Mittelwert der Symptomanzahl im SOMS-2, den Mittelwert des HADS-D Score, den körperlichen oder psychischen Summenscore des SF-12 (s. Tabelle 3 und Tabelle 13). Tendenziell sind die interviewten PatientInnen etwas älter. Die im Mini-DIPS untersuchten PatientInnen haben signifikant mehr Praxiskontakte (M=26,8) als SOMS-2 Auffällige (M=19,3; p=0,018). In Tabelle 12 sind alle psychischen Diagnosen aufgelistet, die nach dem Interview nach ICD-10 vergeben wurden. Im Interview wird jeweils nur eine Diagnose einer somatoformen Störung vergeben. Die Diagnose einer Somatisierungsstörung und einer hypochondrischen Störung ist selten (je 1 PatientIn), dagegen haben 42% (n=15) mehr als 4 bzw. 6 Symptome im Interview (undifferenzierte Somatisierungsstörung). Der Gesamtanteil von somatoformen Störungen beträgt im Interview n=28 (78%). Da nur PatientInnen zum Interview geladen wurden, die in der Selbstbeurteilung die SSI-4/6Kriterien im SOMS-2 erfüllt haben, bedeutet dies, dass 22% der PatientInnen im Interview doch weniger als 4 bzw. 6 Symptome aufweisen. Insgesamt geben 64,7% (n=11) der Männer mindestens 4 Symptome und 73,7% (n=14) der Frauen mindestens 6 Symptome im Interview an. Bei 41,7% (n=15) der PatientInnen wurde in den vergangenen 4 Wochen eine Angststörung (Panikstörung mit /ohne Agoraphobie, generalisierte Angststörung, soziale Phobie), bei 30,6% (n=11) eine affektive Störung (leichte-, mittelgradige-, rezidivierende depressive Episoden, Zyklothymie, Dysthymie), und bei 11,1% (n=4) eine Abhängigkeit von Medikamenten, Alkohol und Drogen (inkl. Methadon-Substitution unter ärztlicher Betreuung) diagnostiziert. PatientInnen, bei denen im Mini-DIPS eine somatoforme Störung festgestellt wurde, haben in 68% (n=19) eine Komorbidität mit einer anderen psychischen Störung. Bei 47% besteht eine Komorbidität einer somatoformen Störung mit einer Angststörung, bei 32% eine Komorbidität mit einer affektiven Störung und bei 14% mit einer Abhängigkeitserkrankung. Im Mini-DIPS wird bei 11,1% (n=4) der PatientInnen keine psychische Diagnose vergeben, 38,9% (n=14) erhielten eine, 27,8% (n=10) zwei und 22,2% (n=8) drei 63 psychische Diagnosen (inklusive der Diagnose einer undifferenzierten somatoformen Störung. Zusätzlich wird als Lifetime- Komorbidität bei 11,1% (n=5) der PatientInnen eine posttraumatische Belastungsreaktion festgestellt. Diese PatientInnen hatten zum Teil als Kind, zum Teil als junge Erwachsene schwere Belastungssituationen erlebt, die sie bis heute als nicht verarbeitet bezeichneten. Tab. 12: Aktuelle psychische Diagnose nach ICD-10 im Mini-DIPS Kategorien Diagnosen Keine psychische Diagnose Anzahl 4 Abhängigkeit / schädlicher Gebrauch F1 Alkohol F10 Methadon F13 Multipler Substanzgebrauch F19 2 1 1 3 1 1 3 3 Phobische Störungen F40 Agoraphobie ohne Panikstörung F40.00 Soziale Phobien F40.1 Spezifische Phobien F40.2 Zwangsstörung F42 11,1% 11 30,6% 7 3 2 2 Sonstige Angststörungen F41 Panikstörung F41.0 Generalisierte Angststörung F41.1 4 11,1% 4 Affektive Störung F30 Depressive Episode, leicht F32.01 Depressive Episode, mittelgradig F32.11 Depressive Episode, schwer F32.2 Zyklothymia F34.0 Dysthymia F34.1 Summe 4 4 1 19,4% 8 22,2% 1 2,8% Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen F43 4 11,1% Somatoforme Störungen F45 Somatisierungsstörung F45.0 Undifferenzierte Somatisierungsstörung F45.1 Hypochondrische Störung F45.2 Somatoforme autonome Funktionsstörung F45.3 Somatoforme SchmerzstörungF45.4 4 28 1 15 1 6 5 77,8% 64 In Tabelle 13 werden abschließend wichtige Kennwerte des SOMS-2, der HADS-D und des SF-12 bezogen auf die Stichprobe, auf die Auffälligkeit im SOMS-2, auf die Auffälligkeit nach den Kriterien einer „polysymptomatischen somatoformen Störung“ (PSS-7) und auf den Mini-DIPS zusammenfassend dargestellt. Tab. 13: Übersicht Kennwerte SOMS-2, HADS-D, SF-12 Alter Stichprobe SSI-4/6 PSS-7 MiniDIPS N=36 N=135 N=79 N=58 M 36,50 37,66 39,16 41,4 58,6 40,50 p=0,064 47,2 52,8 13,53 12,47 Geschlecht: Männlich Weiblich % % 43,7 56,3 SOMS-2 Symptomanzahl M 7,47 51,3 48,8 p=0,014 11,23 HADS-D Angstscore M 6,72 7,44 8,02 8,19 Depressionsscore M 5,15 p=0,005 5,54 p=0,005 6,04 5,88 Gesamtsore M 11,87 12,99 14,06 14,06 M 44,97 p=0,005 44,21 p=0,005 42,71 41,58 M 49,04 47,58 p=0,015 46,24 47,27 SF-12 Körperlicher Summenscore Psychischer Summenscore p=0,048 p=0,013 Anmerkung: Signifikanzen in der Spalte „SSI-4/6“und „PSS 7“ beziehen sich auf die Stichprobe, Signifikanzen in der Spalte „Mini-DIPS“ beziehen sich auf die SSI-4/6-Auffälligen (da nur PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen interviewt wurden) 65 6 Diskussion Zwei Aspekte werden diskutiert: In einem ersten Teil geht es um den Aufbau der Studie, die Beteiligung und evt. vorhandene systematische Fehler. In einem zweiten Teil werden die Ergebnisse in der Reihenfolge der in Kapitel 3 gestellten Fragen diskutiert. Die hier beschriebene Studienpopulation ist wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, als repräsentativ für eine Landarztpraxis einzustufen. Die Stichprobe unterscheidet sich im Vergleich zu anderen Studie vorwiegend in der Schulbildung. In der hier vorliegenden Studie nehmen vorwiegend PatientInnen mit Volks- oder Hauptschulabschluss teil, weniger PatientInnen mit Abitur. Diese Auffälligkeit ist als charakteristisches Merkmal für die Landbevölkerung zu werten. Die Beteiligung in der hier vorliegenden Studie liegt bei 37,5%. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Es könnte sein, dass es für PatientInnen einer ländlichen Praxis sehr ungewöhnlich ist und sie wenig motiviert sind, an einer wissenschaftlichen Studie teilzunehmen. In dieser Studie wurde nach der Definition von LINDEN et al. (1996) die „Inanspruchnahmepopulation“ untersucht (s. Abschnitt 2.2). Dies könnte mitverursachend für eine niedrigere Beteiligungsrate sein. PatientInnen, die zu einer Untersuchung oder Therapie (z.B. Labor, EKG, Reizstrom) einbestellt waren oder ein Rezept oder einen Überweisungsschein abholten, hatten in der Regel keine Wartezeiten im Wartezimmer. PatientInnen mit Wartezeiten konnten durch das Ausfüllen des Fragebogens die Wartezeit überbrücken und waren vermutlich eher motiviert, an der Studie teilzunehmen. Es stellt sich die Frage: Wodurch unterscheiden sich die PatientInnen, die bereit sind, an der Studie teilzunehmen von PatientInnen, die die Studie ablehnen? Alle PatientInnen, die die Praxis im Untersuchungszeitraum aufsuchen, werden mit Alter und Geschlecht registriert. Das Durchschnittsalter der PatientInnen, die an der Studie teilnehmen, ist signifikant niedriger, als bei den PatientInnen, die die Studie ablehnen. In der Geschlechtsverteilung unterscheidet sich die untersuchte Stichprobe nicht von den PatientInnen zwischen 18 und 60 Jahren. Ob sich die teilnehmenden und die ablehnenden PatientInnen im Hinblick auf die Anzahl der präsentierten somatoformen Symptome unterscheiden, ist schwer abzuschätzen. Zum einen könnten PatientInnen, die keinerlei körperliche Symptome ohne organische Ursache haben, sich nicht angesprochen fühlen, einen solchen Fragebogen 66 auszufüllen bzw. sich PatientInnen mit somatoformen Symptomen besonders angesprochen fühlen. Vielleicht schöpfen sie Hoffnungen auf eine bessere Behandlungsmethode. So könnte es sein, dass relativ mehr PatientInnen mit somatoformen Symptomen teilnehmen. Es könnte aber auch sein, dass PatientInnen mit unerklärten körperlichen Symptomen nicht erkannt werden wollen und daher eine Studienteilnahme ablehnen. Die durchschnittliche Symptomanzahl liegt bei einer unselektierten Stichprobe (POMMERSHEIM 2001, s. Abschnitt 4.3) sehr ähnlich der hier ermittelten durchschnittlichen Symptomanzahl von 7,47 Symptomen. Dagegen liegt bei der selektierten Stichprobe von FRITZSCHE und WIRSCHING (2002), die nur PatientInnen einschließt, die mindestens 4/6 Symptome im SOMS aufweisen, die durchschnittliche Symptomanzahl mit 13,76 Symptomen deutlich höher als in der hier vorliegenden Studie. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Studienpopulation der hier vorliegenden Studie eine unselektive Stichprobe umfasst und auch hinsichtlich der Anzahl der somatoformen Symptome weitgehend als repräsentativ für eine ländliche Hausarztpraxis gilt. Die interviewten PatientInnen sind repräsentativ für die Gruppe der SOMS-2 Auffälligen in der Praxis. Sie unterscheiden sich von den übrigen SOMS-2 auffälligen PatientInnen nicht im Hinblick auf die Geschlechtsverteilung, den Familienstand, die Schulbildung, die Berufstätigkeit, die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage, den Mittelwert der Symptomanzahl im SOMS-2, den Mittelwert des HADS-D Score, den körperlichen oder psychischen Summenscore des SF-12 (s. Tabelle 3 und 13). Die interviewten PatientInnen sind tendenziell etwas älter (40,5 Jahre) als die übrigen SOMS-2 auffälligen (37,6 Jahre). Auffällig ist eine erhöhte Berufsunfähigkeitsrate (21,2% statt 13,9%) und signifikant auffällig ist die Anzahl der Praxisbesuche (M=26,8 statt M=19,3 Konsultationen). PatientInnen, die häufiger die Praxis aufsuchen, erklären sich also eher zu einem diagnostischen Interview bereit. Das lässt sich am ehesten dadurch begründen, dass ein Teil der PatientInnen bei einem nächsten Praxiskontakt auf das Interview angesprochen wird, bzw. dass auch die PatientInnen, die nach telefonischer Einladung am Interview teilnehmen, die stärkere Bindung zur Praxis haben. Zu der hier vorliegenden Studie muss kritisch angemerkt werden, dass nur etwa die Hälfte der SOMS-2 Auffälligen zu einem Interview motiviert werden konnte. Es wäre wünschenswert, möglichst alle auffälligen PatientInnen mittels Fremdbeurteilung zu untersuchen. Es ist weiterhin zu kritisieren, dass der Mini-DIPS nur eingeschränkt aussagekräftig zur Diagnosestellung einer somatoformen Störung ist. Im Mini-DIPS 67 sind nicht die Symptomlisten enthalten, die für die Diagnose einer somatoformen Störung nach DSM-IV oder ICD-10 nötig sind. Der Mini-DIPS ist vorwiegend zur Diagnosestellung von psychischen Störungen nach DSM-IV entwickelt worden. In bisherigen Studien wurde die Prävalenz von somatoformen Störungen in der Hausarztpraxis sehr unterschiedlich angegeben (s. Abschnitt 2.2). Im deutschsprachigen Raum wurden in den vergangenen 5 Jahren einige Studien zu somatoformen Störungen durchgeführt. Die WHO-Studie beschrieb eine Häufigkeit der Somatisierungsstörung in hausärztlichen Praxen in Deutschland von 2% (LINDEN et al. 1996). Die meisten Studien beschreiben die Häufigkeit somatoformer Störungen in der Primärversorgung zwischen 20 und 50%. Es wird auch in dieser Studie eine Häufigkeit des multiplen somatoformen Syndroms zwischen 20 und 50% erwartet. In der hier vorliegenden Studie sind 58,5% der PatientInnen nach den SSI-4/6 Kriterien im SOMS-2 auffällig. Der Durchschnitt der erlebten körperlichen Symptome beträgt 7,47 (Median 5,5). Es sind mehr StudienteilnehmerInnen als erwartet im SOMS2 auffällig. Es sind mehrere Gründe für die höhere Auffälligkeit zu diskutieren. Als erstes muss bedacht werden, dass der SOMS-2 ein Screeninginstrument ist, das eine hohe Sensitivität (98%), jedoch eine niedrigere Spezifität (73%) besitzt. Eine Auffälligkeit im SOMS-2 mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen kann also nicht gleich gesetzt werden mit einem multiplen somatoformen Symptom. Bei einer Selbstbeurteilung muss mit einer Überschätzung somatoformer Beschwerden gerechnet werden (s. Abschnitt 4.4). Im SOMS-2 fehlen Schweregradkriterien. Dadurch besteht nach HILLER und RIEF (1998) das Risiko, dass Symptome kodiert werden, denen kein eigentlicher Krankheitswert zukommt. Die Diagnose einer somatoformen Störung wird erst mittels Interview gestellt. Wie bereits in Abschnitt 4.4 beschrieben, wurde der SOMS-2 bei einer früher durchgeführten Studie an Berliner Hochschulen eingesetzt (LIEB 1996). Der Durchschnitt der erlebten körperlichen Symptome betrug M=5,9 (Median 4,5). Bei einer anderen Untersuchung wurde der SOMS-2 unauffälligen Personen aus dem Großraum Dresden vorgelegt (ELEFANT 1996, RIEF et al. 1997). Der Durchschnitt der erlebten körperlichen Symptome betrug M=5,1 (Median 3). In einer psychosomatischen Klinik eingesetzt (RIEF et al. 1997), betrug der Mittelwert der Beschwerden von PatientInnen mit psychischen und psychosomatischen Störungen im SOMS-2 M=15,0 (Median 13,5). Die Symptomanzahl im SOMS-2 bei den PatientInnen der hier vorliegenden Studie liegt 68 mit durchschnittlich M=7,47 Symptomen (Median 5,5) zwischen weitgehend gesunden Personen und PatientInnen einer psychosomatischen Klinik. Durch die unterschiedlichen Symptomlisten in den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV bedingt sich ein Häufigkeitsunterschied in der Diagnose einer somatoformen Störung. FINK et al. (1999) verglichen in ihrer Studie DSM-IV und ICD-10 Diagnosen beim gleichen Kollektiv. Eine somatoforme Störung diagnostizierten sie mehr als doppelt so häufig nach DSM-IV als nach ICD-10. Studien, in denen die Prävalenz eines multiplen somatoformen Syndroms (SSI4/6) untersucht wurde, benutzten die DSM-III oder die DSM-III-R Symptomliste mit insgesamt 35 möglichen Symptomen. Im DSM-IV sind 33 mögliche Symptome für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung aufgeführt. In dieser Studie wird die gesamte Symptomliste des SOMS-2 mit 53 möglichen Symptomen eingesetzt, alle Symptome, die im DSM-IV und in der ICD-10 erwähnt werden.. Somit ist in dieser Studie die Auswahl der Symptome deutlich größer und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Symptome angegeben werden. Für einen Studienvergleich müssten genau genommen die Symptomliste des DSM-III oder DSM-III-R zugrunde gelegt werden. In dieser Studie erfüllen 49,6% der PatientInnen im SOMS-2 die 4/6 Kriterien des DSMIV und 7,3% der PatientInnen die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-IV. In der ICD-10 sind 14 mögliche Symptome für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung aufgeführt. In dieser Studie erfüllen 3,6% der PatientInnen die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach ICD-10. 22,3% der PatientInnen erfüllen die Kriterien einer „somatoformen autonomen Funktionsstörung“ nach ICD-10 im SOMS-2. Es wurde in bisherigen Studien nicht die Symptomliste des ICD-10 zugrunde gelegt, um die SSI-4/6 Kriterien anzuwenden. Es gibt somit keinen Studienvergleich. 30,4% der PatientInnen haben in dieser Studie mehr als 4/6 somatoforme Symptome nach der Symptomliste der ICD-10. Obwohl die Symptomliste der ICD-10 und des DSM-IV verschieden sind, erfüllen alle PatientInnen, die die 4/6 Kriterien nach der Symptomliste der ICD-10 erfüllen, auch die 4/6 Kriterien nach der Symptomliste des DSM-IV. Das ist eine erstaunliche Übereinstimmung. Die Übereinstimmung kann einerseits damit erklärt werden, dass einige der meistgenannten Symptome in beiden Symptomlisten aufgeführt werden (Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen, Schmerzen in Armen und Beinen, Völlegefühl). Nach RIEF (1998) könnte eine weitere Erklärung für die Übereinstimmung sein, dass die Anzahl von körperlichen Beschwerden in den unterschiedlichen Symptomlisten korreliert. Das bedeutet, dass Personen, die nach einem Klassifikationsansatz 69 viele somatoforme Symptome haben, auch nach einer anderen Symptomliste aller Wahrscheinlichkeit nach viele Symptome aufweisen. Betrachtet man die PatientInnen, die nach DSM-IV mehr als 4/6 Symptome angeben, ist in dieser Studie die durchschnittliche Symptomanzahl der PatientInnen, die nach ICD-10 mehr als 4/6 somatoforme Symptome aufweisen, signifikant höher (M=14,3) als bei PatientInnen, die nach ICD-10 weniger als 4/6 Symptome angeben (M=9,0). Wie erwartet ist der Anteil der PatientInnen, die im SOMS-2 die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-IV oder ICD-10 erfüllen, niedrig. Die Diagnosezuweisung nach beiden Symptomlisten zeigt deutliche Unterschiede. Nur 1 Patientin (1,2%) erfüllt sowohl die Kriterien der Somatisierungsstörung nach ICD-10 als auch nach DSM-IV. Dabei ist zu bemerken, dass nur 84 von insgesamt 135 PatientInnen alle Zusatzfragen, die als Ein- und Ausschlusskriterium für das Vorliegen einer Somatisierungsstörung gelten, beantworten. Die nach 4/6 Kriterien Auffälligen geben signifikant häufiger ein Anhalten der Beschwerden seit über 2 Jahren an und beschäftigen sich signifikant häufiger mit Schmerzen seit mehr als 6 Monaten. 43% der PatientInnen erfüllen die in neueren Studien befürworteten Kriterien mit einem Cut-off von 7 Symptomen, aus der empirisch validierten Symptomliste von 32 Symptomen (RIEF, HILLER 1999). In dieser Gruppe sind alle PatientInnen, die im SOMS-2 die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach ICD-10 oder DSM-IV erfüllen, die also höchst auffällig sind, eingeschlossen. Die von RIEF und HILLER (1999) gewählte Schwelle von mindestens 7 Symptomen aus einer Symptomliste von 32 Symptomen zeigt in dieser Studie mehr signifikante Auffälligkeiten. PatientInnen mit mindestens 7 Symptomen fühlen sich signifikant häufiger beeinträchtigt im Wohlbefinden oder im Alltagsleben, es wurde signifikant häufiger keine Ursache für ihre Beschwerden gefunden und ihre Beschwerden halten signifikant häufiger länger als 2 Jahre an. Es ist zu diskutieren und in weiteren Studien zu prüfen, ob der Cut-off von 4/6 Symptomen nicht zu niedrig angesetzt ist und die hohe Sensitivität zu sehr auf Kosten der Spezifität geht. Der SOMS-2 ist ein hilfreiches und doch einfaches Mittel, um PatientInnen mit einer somatoformen Störung zu erkennen. Bei einer Auffälligkeit von fast 60% mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen werden HausärztInnen jedoch erneut vor Probleme gestellt: Welche PatientInnen sind beeinträchtigt durch ihre somatoformen Symptome? Welche PatientInnen sind behandlungsbedürftig? 70 In den meisten Studien zu Geschlechtsunterschieden geben Frauen im Durchschnitt mehr somatoforme Symptome an als Männer (ESCOBAR et al. 1989, MIRANDA et al. 1991, PORTEGIJS et al. 1996, PEVELER et al. 1997, TRESS et al. 1997, KROENKE et al. 1997, ESCOBAR et al. 1998). Dies wird zum Teil damit begründet, dass nach der Symptomliste des DSM Frauen mehr Symptome zur Auswahl haben (GOLDING et al. 1991). Im hier beschriebenen PatientInnenkollektiv haben Frauen eine etwas höhere durchschnittliche Symptomanzahl (8,0) im SOMS-2 als Männer (6,8), sie unterscheiden sich jedoch nicht signifikant. Erstaunlich erscheint zunächst, dass nach 4/6 Kriterien im SOMS-2 signifikant mehr Männer (71,2%) als Frauen (44,5%) auffällig sind. Auch in anderen Studien, in denen der SOMS-2 eingesetzt wurde, erfüllen Männer eher die SSI-4/6 Kriterien als Frauen. In der Studie von LIEB (1996) sind 54% der Männer und 49% der Frauen auffällig. Nach RIEF et al. (1997) sind in der Studie von ELEFANT (1996) 46% der Männer und 26% der Frauen auffällig. Die Somatisierungsstörung war vor allem nach DSM Kriterien in der Literatur deutlich häufiger bei Frauen als bei Männern beschrieben worden (SWARTZ et al. 1987, NEUMER et al. 1998). In der hier vorliegenden Studie hat kein Mann die Kriterien einer Somatisierungsstörung nach DSM-IV im SOMS-2 erfüllt, dagegen 7 Frauen. In der untersuchten Stichprobe sind Männer also nicht generell auffälliger als Frauen. Es stellt sich die Frage, was ESCOBAR et al. (1989) bewogen hat, die Schwelle für die Diagnose einer somatoformen Störung bei Männern und Frauen unterschiedlich festzulegen. ESCOBAR et al. (1989) geben eine empirische Begründung für die geforderte Symptomanzahl an. Durch den gewählten Cut-off unterschieden sich hispanische und nicht-hispanische schizophrene PatientInnen. LIEB (S. 39, 1996) bezeichnet diese Begründung als „nicht unproblematisch“. PORTEGIJS et al. (1996) wählten nicht den von Escobar vorgeschlagenen Cut-off von 4/6 Symptomen, sondern forderten 5 Symptome für beide Geschlechter. In der hier vorliegenden Studie hat ein recht großer Anteil der Männer (29%) genau 4 Symptome. Wird der Cut-off von 7 Symptomen der geschlechtsunabhängigen Symptomliste angewandt, sind Männer und Frauen in dieser Studie etwa gleich häufig betroffen. Der Selbstbeurteilungsfragebogen HADS-D wurde zur Erfassung der psychischen Symptomatik von Ängstlichkeit und Depressivität eingesetzt. Für gesunde deutsche Kontrollpersonen beträgt der Mittelwert auf der Angstsubskala 5,8, auf der De- 71 pressionssubskala 3,4 (HERRMANN et al. 1995). In der hier vorliegenden Studie beträgt der Mittelwert auf der Angstsubskala 6,7 und auf der Depressionssubskala 5,2, also erwartungsgemäß in beiden Subskalen höher als bei gesunden Kontrollpersonen. Bei weltweiten Untersuchungen in Allgemeinpraxen und allgemein- internistischen Polikliniken wurde eine Prävalenz von 16-34% der Angst-Auffälligen und 13-20% der Depressions-Auffälligen beschrieben (bei einem Cut-off von ≥11 bei jeder der beiden Subskalen, HERRMANN et al. 1995). In der hier vorliegenden Studie haben 15,1% auffällige Angstwerte und 11,3% auffällige Depressionswerte (ebenfalls bei einem Cut-off von ≥11 bei jeder der beiden Subskalen). Die Häufigkeiten sind damit etwas niedriger als in der Literatur angegeben. Es stellt sich die Frage, wie es zu erklären ist, dass im SOMS-2 eine hohe Auffälligkeit, in der HADS-D dagegen eine niedrigere Auffälligkeit als erwartet angegeben wird. Auch die HADS-D ist ein Selbstbeurteilungsinstrument. Es könnte sein, dass die PatientInnen gerade auf dem Land es vor sich und der Untersucherin nicht zugeben wollen, dass sie unter Ängstlichkeit und Depressivität leiden. Es könnte sein, dass es tendenziell als Makel empfunden wird, an psychischen Symptomen zu leiden und das Präsentieren körperlicher Symptome sozial eher anerkannt ist. Verschiedene Studien haben eine hohe Komorbidität von Angststörungen und affektiven Störungen mit somatoformen Störungen gezeigt, wobei die Häufigkeit der Komorbidität von der Schwere der somatoformen Störung bzw. der Symptomanzahl abhing. In dieser Studie sind ein Viertel der PatientInnen, die mehr als 4/6 Symptome im SOMS-2 angaben, auch in der HADS-D auffällig („comorbid somatizers“). Die nach 4/6 Kriterien auffälligen PatientInnen haben in dieser Studie einen signifikant höheren Angst- und / oder Depressionsscore in der HADS-D. Umgekehrt haben auch die HADS-D Auffälligen eine signifikant höhere Symptomanzahl im SOMS-2. In einer Studie von KATON et al. (1991) wurde bei steigender Anzahl somatoformer Symptome eine Zunahme von Ängstlichkeit und Depressivität beschrieben. Diese Korrelation bestätigt sich in der hier vorliegenden Studie. Mit einem Wert von r=0,40 ist die Korrelation durchaus als mittelgradig einzuschätzen. Es kann nur bestärkt werden, dass ÄrztInnen der Primärversorgung aufmerksam psychische Symptome eruieren sollten, wenn sie das Vorliegen von somatoformen Symptomen vermuten. In der hier vorliegenden Studie sind die insgesamt am häufigsten genannten Symptome im SOMS-2: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schmerzen in den Armen oder Beinen, Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen und Völlegefühl. PatientInnen mit 72 erhöhter Ängstlichkeit / Depressivität klagen signifikant mehr über außergewöhnliche Müdigkeit bei leichter Anstrengung, Hitzewallung oder Erröten, unangenehme Kribbelgefühle, Schwierigkeit beim Schlucken oder Kloßgefühl, Völlegefühl, Druckgefühl in der Herzgegend und Schweißausbrüche. Ängstliche PatientInnen geben zusätzlich signifikant häufiger Herzrasen oder Herzstolpern an. Die Diagnosestellung nach ICD-10 im Interview in der hier vorliegenden Studie zeigt, dass 78% der im SOMS-2 nach SSI-4/6 Kriterien auffälligen PatientInnen die Diagnose einer somatoformen Störung (Somatisierungsstörung, undifferenzierte somatoforme Störung, hypochondrische Störung, somatoforme autonome Funktionsstörung und somatoforme Schmerzstörung) erhielten. 22% hatten keine somatoforme Diagnose im Mini-DIPS, obwohl sie im SOMS-2 mehr als 4 bzw. 6 Symptome aufwiesen. Die Anzahl der im Interview berichteten somatoformen Symptome war grundsätzlich niedriger als die im SOMS-2 angegebene. Im Interview bezeichneten die PatientInnen einige ihrer im SOMS-2 angegebenen Beschwerden als „nicht so gravierend“, „doch erklärbar“ oder „nur vorübergehend“. Der Anteil der Falsch-Negativen wurde nicht erfasst, da nur die nach SSI-4/6 Kriterien SOMS-2 -Auffälligen zum Interview bestellt wurden. Die Sensitivität des SOMS-2 ist jedoch so hoch (98%), dass nur wenige falsch-negative Ergebnisse zu erwarten sind. Im Interview geben 64,7% der Männer mindestens 4 Symptome und 72,2% der Frauen mindestens 6 Symptome an. Der Gesamtanteil der PatientInnen mit mehr als 4/6 somatoformen Symptomen kann nach dem Interview auf etwa 46% geschätzt werden. Die Diagnosen wurden nach den Kriterien der ICD-10 gestellt. Zur Diagnosestellung eines multiplen somatoformen Syndroms (SSI-4/6) wurde allerdings die gesamte Symptomliste des SOMS-2 eingesetzt und nicht nur die Symptomliste der ICD-10. Wegen der deutlich erhöhten Symptomanzahl im SOMS-2 von 53 Symptomen, ist die Rate der PatientInnen mit multiplem somatoformen Syndrom in dieser Studie höher, als bei Einsatz der ICD-10 Symptomliste zu erwarten gewesen wäre. Während bei einer Selbstbeurteilung mit einer Überschätzung somatoformer Symptome gerechnet werden muss, kann es bei einer Fremdbeurteilung (Interview) zu einer Unterschätzung somatoformer Symptome kommen. Auch das Interview ist mit einer gewissen Fehlerquelle behaftet, es gibt bestenfalls eine Schätzung des „wahren Wertes“ wieder (RIEF et al. 1997, S. 25). 73 Im Interview wird bei 42% eine Angststörung, bei 31% eine affektive Störung diagnostiziert, 11% sind Medikamenten-, Alkohol- oder Drogenabhängig, bei 11% wurde eine posttraumatische Belastungsreaktion diagnostiziert. In der Literatur wird eine Komorbidität einer „abridged somatization disorder“ (SSI-4/6) mit anderen psychischen Störungen in 56-64% beschrieben (MIRANDA et al. 1991, ESCOBAR et al. 1989). Allgemein wird bei somatoformen Störungen eine Komorbidität mit anderen psychischen Störungen in 36-73% beschrieben (FINK et al. 1999, SPITZER et al. 1995). In dieser Studie werden die in der Literatur angegebenen Komorbiditätsraten bestätigt. Von den PatientInnen, bei denen eine somatoforme Störung im Mini-DIPS festgestellt wurde, haben 68% eine aktuelle Komorbidität mit einer anderen psychischen Störung. Bei 47% besteht eine Komorbidität einer somatoformen Störung mit einer Angststörung, bei 32% eine Komorbidität mit einer affektiven Störung, bei 14% mit einer Abhängigkeitserkrankung. Bei 18% der PatientInnen mit einer diagnostizierten somatoformen Störung im Mini-DIPS wurde eine posttraumatischen Belastungsreaktion diagnostiziert. Der Durchschnittswert der körperlichen Summenskala der gesundheitsbezogenen Lebensqualität für die gesunde deutsche Normalbevölkerung beträgt 49,03 (BULLINGER und KIRCHBERGER 1998). Für PatientInnen mit akuten oder chronischen Erkrankungen wird ein Wert von 46,32 angegeben. In der hier vorliegenden Studie liegt der Mittelwert der körperlichen Summenskala niedriger. Er beträgt in der Stichprobe (N=135) 44,97. Dieser Wert ist vergleichbar mit dem Wert von PatientInnen mit akuten Rückenschmerzen 44,43 (BULLINGER und KIRCHBERGER 1998). Der Durchschnittswert der psychischen Summenskala der gesunden deutschen Normalbevölkerung beträgt 52,24, bei PatientInnen mit akuten oder chronischen Erkrankungen beträgt der Durchschnittswert 51,24. In der hier vorliegenden Studie ist auch der Mittelwert für die psychische Summenskala niedriger, er beträgt bei der Stichprobe 49,04. Auffällig ist also sowohl bei der körperlichen als auch bei der psychischen Summenskala ein schlechterer Wert als der Mittelwert, der bei über 1890 Personen mit akuten oder chronischen Erkrankungen bestimmt wurde. Im Folgenden werden jedoch nur die relativen Unterschiede, die innerhalb der Praxis festgestellt wurden, verglichen: Nach einer Studie von ESCOBAR et al.(1998) fühlten sich PatientInnen mit einer „abridged somatization disorder“ signifikant häufiger körperlich beeinträchtigt als PatientInnen mit weniger als 4/6 somatoformen Symptomen. In der PRIME-MD Studie 74 von SPITZER et al. (1995) fühlten sich PatientInnen mit somatoformen Störungen überraschenderweise in der körperlichen Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt. In der hier vorliegenden Studie gibt es interessanterweise eine signifikante psychische Einschränkung von PatientInnen, die nach 4/6 Kriterien im SOMS-2 auffällig sind, in körperlicher Hinsicht unterscheiden sie sich nicht. Multiple somatoforme Symptome scheinen also mehr Einfluss auf das psychische Wohlbefinden der PatientInnen zu haben, als bisher angenommen. Wird ein Cut-off von 7 Symptomen angewandt, sind die auffälligen PatientInnen in körperlicher und psychischer Hinsicht signifikant beeinträchtigter. Hier kommt wieder die Frage auf, ob die Schwelle von mindestens 4/6 Symptomen im SOMS-2 zu niedrig angesetzt ist. PatientInnen, die mehr als 4 bzw. 6 unerklärte körperliche Symptome im SOMS-2 haben, fühlen sich psychisch eingeschränkter. Anscheinend fühlen sie sich erst mit steigender Anzahl von somatoformen Symptomen (mindestens 7) auch körperlich deutlich eingeschränkter. In dieser Studie unterscheiden sich Männer und Frauen nicht in der körperlichen Summenskala des SF-12. Frauen sind jedoch psychisch signifikant beeinträchtigter als Männer. PatientInnen zwischen 41 und 60 Jahren fühlen sich erwartungsgemäß in körperlicher Hinsicht eingeschränkter. In psychischer Hinsicht jedoch geben die Jüngeren (18 bis 40 Jahren) tendenziell eine stärkere Beeinträchtigung an. Hinsichtlich der Auffälligkeit in der HADS-D besteht kein altersabhängiger Unterschied. ESCOBAR et al. (1998) untersuchten PatientInnen mit einer „abridged somatization disorder“ und verglichen die mit („comorbid somatizers“) und ohne („discrete somatizers“) psychiatrischer Komorbidität hinsichtlich ihrer Beeinträchtigung. Sie fanden in beiden Gruppen ein ähnliches Maß an Beeinträchtigung. In der hier vorliegenden Studie sind „comorbid somatizers“ (nach 4/6 Kriterien) sowohl körperlich als auch psychisch signifikant beeinträchtigter als „discrete somatizers“. Dieses Ergebnis liegt aber mehr darin begründet, dass erstaunlicherweise die in der HADS-D auffälligen PatientInnen sich körperlich und psychisch hochsignifikant beeinträchtigter fühlen als HADSD unauffällige. In der Literatur wird beschrieben, dass PatientInnen mit psychischen Störungen „high utilizer“ des Gesundheitssystems sind (KATON et al. 1990). Auch PatientInnen mit somatoformen Störungen fallen durch eine überdurchschnittliche Konsultationsrate auf. In dieser Studie ist der Unterschied in der Anzahl der Praxiskontakte im Jahr 1998 75 zwischen den im SOMS-2 nach 4/6 Kriterien Auffälligen (19,3 Praxiskontakte) und den im SOMS-2 unauffälligen (13,8 Praxiskontakte) statistisch nicht signifikant. Jedoch ist die Anzahl der Praxiskontakte bei den „comorbide somatizers“ (27,8) signifikant höher als bei den „discrete somatizers“ (16,7). Übereinstimmend mit der Literatur (ESCOBAR et al. 1989, KATON et al. 1991, KROENKE et al. 1997) werden mehr Arbeitsunfähigkeitstage bei PatientInnen mit somatoformen Störungen angegeben. PatientInnen, die im SOMS-2 auffällig sind, sind signifikant häufiger arbeitsunfähig (25%) als SOMS-2 unauffällige PatientInnen (6%). 76 7 Zusammenfassung Vorangegangene Studien weisen auf das häufige Vorkommen von PatientInnen mit körperlichen Beschwerden ohne ausreichenden Organbefund hin. Bei diesen PatientInnen wird eine erhebliche psychische Belastung und eingeschränkte Lebensqualität beschrieben. Die meisten Studien wurden in England oder USA durchgeführt. Deutsche Hausarztpraxen wurden überwiegend in Großstädten untersucht. Bislang ist keine Studie bekannt, die diese PatientInnengruppe in einer Landarztpraxis untersucht hat. In einer konsekutiven, repräsentativen Stichprobe wurden n=134 PatientInnen mit Hilfe von psychometrischen Instrumenten und einem psychodiagnostischen Interview untersucht. Je nach Breite der Definition erfüllten zwischen 30% (Symptomliste ICD-10) und 59% (Fragebogen SOMS-2) PatientInnen die Kriterien für multiple somatoforme Symptome. Die Schwierigkeit der klaren Abgrenzung einzelner Krankheitsbilder und die große Inhomogenität der Beschwerden werden diskutiert. Ein Viertel (24%) der im SOMS-2 auffälligen PatientInnen haben erhöhte Werte für Angst und Depressivität, korrelierend mit der Anzahl der somatoformen Symptome. 78% der im SOMS-2 auffälligen PatientInnen erfüllen die Kriterien für eine somatoforme Störung nach ICD-10. 47% dieser PatientInnen haben zusätzlich eine Angststörung und 32% eine affektive Störung. Die Belastung durch körperliche Beschwerden und psychische Begleitsymptomatik führt auch im Vergleich zu den unbelasteten PatientInnen zu einer signifikanten Einschränkung der Lebensqualität. Auch im ländlichen Bereich finden sich eine hohe Anzahl von PatientInnen mit körperlichen Beschwerden ohne ausreichenden Organbefund, psychischer Begleitsymptomatik und eingeschränkter Lebensqualität. Diese PatientInnen sollten rechtzeitig erkannt und behandelt werden, um eine Chronifizierung der Beschwerden, der psychischen Belastungen und der damit verbundenen Gesundheitskosten zu vermeiden. 77 8 Literaturverzeichnis AWMF online (1998). Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Psychotherapeutische Medizin: Leitlinie somatoforme Störungen 1 BARSKY, A.J., BORUS, J.F. (1999). Functional Somatic Syndromes. Annals of Internal Medicine, 130: 910-921 BRIDGES, K.W., GOLDBERG, D.P. (1985). Somatic presentation of DSM II psychiatric disorders in primary care. Journal of Psychosomatic Research, 29: 563-569 BULLINGER, M., KIRCHBERGER, I. (1998). SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handanweisung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe CSEF, H.,(1995). Somatoforme Störungen in der inneren Medizin. Internist, 36: 625636 DILLING, H., MOMBOUR, W., SCHMIDT, M.H., SCHULTE-MARKWORT, E. (Hrsg.) (1994). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V (F), Forschungskriterien, Weltgesundheitsorganisation. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber EBEL, H., PODPOLL, K. (1998). Komorbidität von somatoformen Störungen mit anderen psychischen Störungen. In: Rudolf, G., Henningsen, P. (Hrsg.). Somatoforme Störungen: Theoretisches Verständnis und therapeutische Praxis: 35-38. Stuttgart, New York: Schattauer EGLE, U.T. (1996). Diagnose und Differentialdiagnose bei funktionellen Störungen. In: Herrmann, J.M., Lisker, H., Dietze, G.J. (Hrsg.). Funktionelle Erkrankungen. Diagnostische Konzepte - Therapeutische Strategien: 53-74. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg ELEFANT, S., (1996). Kognitive Aspekte bei somatoformen Störungen. Diplomarbeit, TU Dresden ESCOBAR, J.I., RUBIO-STIPEC, M., CANINO, G., KARNO, M. (1989). Somatic Symptom index (SSI): A new and abridged somatization construct - Prevalence and epidemiological correlates in two large community samples. Journal of Nervous and Mental Desease, 177: 140-146 ESCOBAR, J.I., WAITZKIN, H., SILVER, R.C., GARA, M., HOLMAN, A. (1998). Abridged Somatization: A Study in Primary Care. Psychosomatic Medicine, 60: 466472 FALLER, H. (1999). Somatoforme Störungen - neue oder alte Krankheitsbilder? In: Berufsverband Deutscher Psychologen / Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation (Hrsg.). Somatoforme Störungen- Diagnostik und Therapie in der Rehabilitation: 32-64. Bonn: Deutscher Psychologen Verlag 78 FINK, P., SØRENSEN, L., ENGBERG, M., HOLM, M., MUNK-JØRGENSEN, P. (1999). Somatization in primary care. Prevalence, Health care Utilization, and General Practitioner Recognition. Psychosomatics, 40: 330-338 FRANZ, M., SCHEPANK, H. (1996). Epidemiologie funktioneller Erkrankungen. In: Herrmann, J.M., Lisker, H., Dietze, G.J. (Hrsg.). Funktionelle Erkrankungen. Diagnostische Konzepte - Therapeutische Strategien: 37-52. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg FRITZSCHE, K., WIRSCHING, M. (2002). Spezifische psychosoziale Interventionen des Hausarztes bei somatoformen Störungen. Abschlussbericht an die deutsche Forschungsgemeinschaft FRITZSCHE, K., SANDHOLZER, H., BRUCKS, U., CAMPAGNOLO, I., CIERPKA, M., DETER, H.C., HARTER, M., HÖGER, C., RICHTER, R., SCHMIDT, B., WIRSCHING, M. (2000a). Psychosomatische Grundversorgung in der Hausarztpraxis. Zeitschrift für Ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung, 94: 127-131 FRITZSCHE, K., SANDHOLZER, H., WERNER, J., BRUCKS, U., CIERPKA, M., DETER, H.C., HARTER, M., HOGER, C., RICHTER, R., SCHMIDT, B., WIRSCHING, M. (2000b). Psychotherapeutische und psychosoziale Behandlungsmaßnahmen in der Hausarztpraxis. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 50: 240-246 GOLDBERG, D.P., BRIDGES, K.W. (1988). Somatic presentations of psychiatric illness in primary care setting. Journal of Psychosomatic Research, 32: 137-144 GOLDING, J.M., SMITH, G.R. Jr., KASHNER, T.M. (1991). Does somatization disorder occur in men? Archives of General Psychiatry, 48: 231-235 HERRMANN, CH., BUSS, U., SNAITH, R.P. (1995). HADS-D. Hospital Anxiety and Depression Scale - Deutsche Version. Testdokumentation und Handanweisung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber HERRMANN, J.M. (1996). Funktionelle Erkrankungen. Übersicht. In: Herrmann, J.M., Lisker, H., Dietze, G.J. (Hrsg.). Funktionelle Erkrankungen. Diagnostische KonzepteTherapeutische Strategien: 13-35. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg HILLER, W., RIEF, W., FICHTER, M.M. (1995). Further evidence for a broader concept of somatization disorder using the Somatic Symptom Index. Psychosomatics, 36: 285-294 HILLER, W., RIEF, W. (1998a). Therapiestudien zur Behandlung von Patienten mit somatoformen Störungen: Ein Literaturüberblick. Verhaltenstherapie, 8: 125-136 HILLER, W., RIEF, W. (1998b). Diagnose und Instrumente. In: Margraf, J., Neumer, S., Rief, W. (Hrsg.). Somatoforme Störungen. Ätiologie, Diagnose und Therapie: 15-35. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 79 HOHAGEN, F. (1996). Das Bild der somatisierten Depression in Abgrenzung zum funktionellen Syndrom. In: Herrmann, J.M., Lisker, H., Dietze, G.J. (Hrsg.). Funktionelle Erkrankungen. Diagnostische Konzepte - Therapeutische Strategien: 177-185. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg KATON, W., RIES, R.K., Kleinmann, A. (1984). The prevalence of somatization in primary care. Comprehensive Psychiatry, 25: 208-215 KATON, W., von KORFF, M., LIN, E., LIPSCOMB, P., RUSSO, J., WAGNER, E., POLK, E. (1990). Distressed high utilizers of medical care. DSM-III-R diagnoses and treatment needs. General Hospital Psychiatry, 12: 355-362 KATON, W., LIN, E., von KORFF, M., RUSSO, J., LIPSCOMP, P., BUSH, T. (1991). Somatization: a spectrum of severity. American Journal of Psychiatry, 148: 34-40 KELLNER, R. (1987). Hypochondriasis and somatization. JAMA, 258: 2718-2722 KIRMAYER, L., ROBBINS, J. (1996).- Patients who somatize in primary care: a longitudinal study of cognitive and social characteristics. Psychological Medicine, 26: 937951 KRIEBEL, R., PAAR, G.H., STÄCKER, K.H. (1996). Somatisierung. Psychotherapeut, 4: 201-214 KROENKE, K., SPITZER, R.L., de GRUY, F.V.III, HAHN, S.R., LINZER, M., WILLIAMS, J.B., BRODY, D., DAVIES, M. (1997). Multisomatoform disorder: an alternative to undifferentiated somatoform disorder for the somatizing patient in primary care. Archives of General Psychiatry, 54: 352-358 KROENKE, K., SPITZER, R.L., de GRUY, F.V.III, SWINDLE, R. (1998). A symptom checklist to screen somatoform disorders in primary care. Psychosomatics, 39: 263-272 KRUSE, J., HECKRATH, C., SCHMITZ, N., ALBERT, L., TRESS, W. (1998). Somatoforme Störungen in der hausärztlichen Praxis. In: Rudolf, G., Henningsen, P. (Hrsg.). Somatoforme Störungen: Theoretisches Verständnis und therapeutische Praxis: 119-131. Stuttgart, New York: Schattauer KRUSE, J., HECKRATH, C., SCHMITZ, N., ALBERT, L., TRESS, W. (1999). Zur hausärztlichen Diagnose und Versorgung psychogen Kranker. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 49: 14-22 LANGEWITZ, W., KISS, A., SCHACHINGER, H. (1998). Von der Wahrnehmung zum Symptom - vom Symptom zur Diagnose: Somatoforme Störungen als Kommunikationsproblem zwischen Arzt und Patient. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 128: 231-244 LEIBBRAND, R., HILLER, W. (1998). Komorbidität somatoformer Störungen. In: Margraf, J., Neumer, S., Rief, W. (Hrsg.). Somatoforme Störungen. Ätiologie, Diagnose und Therapie: 53-67. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 80 LIEB, R. (1996). Psychologische Aspekte der Somatisierungsstörung. Dissertation: FU Berlin LIEB, R. (1998). Kognitive und behaviorale Aspekte des Somatisierungssyndroms: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. In: Margraf, J., Neumer, S., Rief, W. (Hrsg.). Somatoforme Störungen. Ätiologie, Diagnose und Therapie: 149-166. Berlin, Heidelberg, New York: Springer LIEB, R., MARGRAF, J. (1994). Kognitive Aspekte des Somatisierungssyndroms. In: PAWLIK, K. (Hrsg.). 39. Kongreß der deutschen Gesellschaft für Psychologie, Sonderband II (L-Z). Hamburg: Psychologisches Institut der Universität. 433-434 LINDEN, M., MAIER, W., ACHBERGER, M., HERR, R., HELMCHEN, H., BENKERT, O. (1996). Psychische Erkrankungen und ihre Behandlung in Allgemeinarztpraxen in Deutschland. Nervenarzt, 67: 205-218 LIPOWSKI, Z.J. (1988). Somatization: the concept and its clinical application. Psychiatry, 145: 1358-1368 LUPKE, U. (1994). Behandlung des Somatisierungsverhaltens im Rahmen eines psychologischen Konsiliar- und Liaisondienstes in einem Allgemeinkrankenhaus. Frankfurt a. M. , Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang MARGRAF, J., SCHNEIDER, S., EHLERS, A. (Hrsg.) (1991). Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen (DIPS). Berlin: Springer MARGRAF, J. (1994). Diagnostisches Kurzinterview bei psychischen Störungen (MiniDIPS). Berlin, Heidelberg, New York: Springer MIRANDA, J., PÉREZ-STABLE, E.J., MUÑOZ, R.F., HARGREAVES, W., HENKE, C.J. (1991). Somatization, Psychiatric Disorder, and Stress in Utilization of Ambulatory Medical Services. Health Psychology, 10: 46-51 NEUMER, S., LIEB, R., MARGRAF, J. (1998). Epidemiologie. In: Margraf, J., Neumer, S., Rief, W. (Hrsg.). Somatoforme Störungen. Ätiologie, Diagnose und Therapie: 37-51. Berlin, Heidelberg, New York: Springer ORMEL, J., van den BRINK, W., KOETER, M.W.J., GIEL, R., van der MEER, K., van de WILLIGE, G., WILMINK, F.W. (1990). Recognition, management and outcome of psychological disorders in primary care: a naturalistic follow-up study. Psychological Medicine, 20: 909-923 PEVELER, R., KILKENNY, L., KINMONTH, A.L. (1997). Medically unexplained physical symptoms in primary care: a comparison of self-report screening questionnaires and clinical opinion. Journal of Psychosomatic Research, 42: 245-252 PINI, S., PERKONNING, A., TANSELLA, M., WITTCHEN, H.U. (1999). Prevalence and 12-month outcome of threshold and subthreshold mental disorders in primary care, Journal of Affective Disorders, 56: 37-48 81 POMMERSHEIM, A. (2001). Der Einfluss spezifischer hausärztlicher psychosozialer Interventionen auf das körperliche Befinden von Patienten mit somatoformen Symptomen. Dissertation: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. PORTEGIJS, P.J.M., VAN DER HORST, F.G., PROOT, I.M., KRAAN, H.F., GUNTHER, N.C.H.F., KNOTTNERUS, J.A. (1996). Somatization in frequent attenders of general practice. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 31: 29-37 RIEF, W. (1996). Die somatoformen Störungen. Großes unbekanntes Land zwischen Psychologie und Medizin. Zeitschrift für klinische Psychologie, 25: 173-189 RIEF, W. (1998). Somatoforme Störungen- ein Überblick. In: Margraf, J., Neumer, S., Rief, W. (Hrsg.). Somatoforme Störungen. Ätiologie, Diagnose und Therapie: 1-14. Berlin, Heidelberg, New York: Springer RIEF, W., HILLER, W. (1992). Somatoforme Störungen. Körperliche Symptome ohne organische Ursache. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber RIEF, W., HILLER, W., (1998). Somatisierungsstörungen und Hypochondrie. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe RIEF, W., HILLER, W. (1999). Toward emirically based criteria for the classification of somatoform disorders. Journal of Psychosomatic Research, 46: 507-518 RIEF, W., HILLER, W., HEUSER, J. (1997). SOMS-2, das Screening für somatoforme Störungen: Manual zum Fragebogen. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber ROBBINS, J.M., KIRMAYER, L.J. (1991). Attributions of common somatic symptoms. Psychological Medicine, 21 (4): 1029-1045 SACK, M., LOEW, T., SCHEIDT, C.E. (1998). Diagnostik und Therapie der Somatisierungsstörung und undifferenzierten Somatisierungsstörung - eine Übersicht zur empirischen Literatur. Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse, 3: 214232 SASS, H., WITTCHEN, H.U., ZAUDIG, M., HOUBEN, I. (Dt. Bearbeitung) (1998). Diagnostische Kriterien DSM-IV, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe SCHACH, E., SCHWARTZ, F.W., KEREK-BODDEN, H.E. (1989). EVaS Studie: Eine Erhebung über die ambulante medizinische Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, Köln: Deutscher Ärzte-Verlag SCHEPANK, H., HILPERT, H., HÖNMANN, H., JANTA, B., PAREKH, H., RIEDEL, P., SCHIESSL, N., STORK, H., TRESS, W., WEINHOLD-METZNER, M. (1984). Wie häufig kommen seelisch bedingte Erkrankungen wirklich vor? Ergebnisse des Mannheimer Kohortenprojektes. Praxis der Psychotherapie und Psychosomatik, 29: 105-114 SCHÖPF, H. (1996). Psychiatrie für die Praxis. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 82 SIMON, G.E., von KORFF, M., PICCINELLI, M., FULLERTON, C., ORMEL, J. (1999). An international study of the relation between somatic symptoms and depression. The New England Journal of Medicine, 341: 1329-1334 SPITZER, R., KROENKE, K., LINZER, M., HAHN, S.R., WILLIAMS, J.B.W., de GRUY, F.V.III, BRODY, D., DAVIES, M. (1995). Health related quality of life in primary care patients with mental disorders. JAMA, 274 (19): 1511-1517 STURM, J., ZIELKE, M. (1988). Chronisches Krankheitsverhalten: Die klinische Entwicklung eines neuen Krankheitsparadigmas. Praxis für klinische Verhaltensmedizin 1: 17-27 SWARTZ, M., BLAZER, D.G., GEORGE, L., LANDERMAN, R. (1986). Somatization disorder in a community population. American Journal of Psychiatry, 143: 14031408 SWARTZ, M., BLAZER, D.G., WOODBURY, M.A., GEORGE, L.K., MANTON, K.G. (1987). A study of somatization disorder in a community population using grade membership analysis. Psychiatric Developments, 3: 219-237 TIEMENS, B.G., ORMEL, J., SIMON, G.E. (1996). Occurrence, recognition, and outcome of psycholigical disorders in primary care. American Journal of Psychiatry, 153: 636-644 TRESS, W., KRUSE, J., HECKRADT, C., SCHMITZ, N., ALBERTI, L. (1997). Psychogene Erkrankungen in hausärztlichen Praxen, Zeitschrift für psychosomatische Medizin, 43: 211-232 WHO (1986). WIRSCHING, M. (2000). Arztbild 2000. Gesundheitswesen 62, Sonderheft 1: S54-S56 WITTCHEN, H.U., SASS, H., ZAUDIG, M., KOEHLER, K. (1989). Diagnostisches und statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-III-R (Übersetzt nach der Revision der dritten Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association). Weinheim: Beltz WITTCHEN, H.U., MÜLLER, N., PFISTER, H., WINTER, S., SCHMIDTKUNZ, B. (1999). Affektive, somatoforme und Angststörungen in Deutschland - Erste Ergebnisse des bundesweiten Zusatzsurveys „Psychische Störungen“. Gesundheitswesen 61, Sonderheft 2: S216-S222 ZINTL-WIEGAND, A., COOPER, B., KRUMM, B. (1980). Psychisch Kranke in der ärztlichen Allgemeinpraxis: Eine Untersuchung in der Stadt Mannheim. Weinheim, Beltz 83 Anhang I Tab. A1: Somatoforme Störungen im Vergleich der beiden Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV ICD-10 Somatisierungsstörung F 45.0 DSM-IV Somatisierungsstörung 300.81 A) Länger als 2 Jahre andauernde Klagen über multiple und wechselnde körperliche Symptome, die durch keine körperliche Erkrankung erklärt werden können. Eine evt. bekannte körperliche Krankheit erklärt nicht die Schwere, das Ausmaß, die Vielfalt und die Dauer der körperlichen Beschwerden. B) Ständige Sorge um die Symptome führt zu andauerndem Leiden und mehrfachen Konsultationen in der Primärversorgung, beim Spezialisten oder beim Laienheiler oder andauernder Selbstmedikation. C) Hartnäckige Weigerung, die medizinische Versicherung zu akzeptieren, dass keine angemessene körperliche Ursache für die körperlichen Symptome vorliegt. D) 6 Symptome aus einer Liste mit 14 möglichen Symptomen, Symptome aus mindestens 2 verschiedenen Gruppen (komplette Symptomliste in Tabelle A2.) E) Ausschlusskriterium: Die Störung tritt nicht ausschließlich während einer Schizophrenie, affektiven Störung oder Panikstörung auf. A) Eine Vorgeschichte mit vielen körperlichen Beschwerden, die vor Vollendung des 30. Lebensjahres begannen und über mehrere Jahre auftraten. Arztkonsultation wegen der Beschwerden oder deutliche Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. B) Jedes der folgenden Kriterien muss erfüllt sein: - 4 Schmerzsymptome - 2 gastrointestinale Symptome - 1-sexuelles Symptom - 1 pseudoneurologisches Symptom (komplette Symptomliste in Tabelle A2.) C) Keines der Symptome von Kriterium B kann durch einen bekannten medizinischen Krankheitsfaktor oder eine Substanz (Droge, Medikament) erklärt werden. D) Die Symptome sind nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht. 84 Tab. A1 ICD-10 Undifferenzierte Somatisierungsstörung F 45.1 DSM-IV Undifferenzierte somatoforme Störung 300.81 A) Kriterium A, C, und E für die Somatisierungsstörung sind erfüllt, außer, dass die Dauer der Störung hier nur mindestens 6 Monate beträgt. B) Eines oder beide Kriterien B und D für die Somatisierungsstörung sind nur unvollständig erfüllt. A) Eine oder mehrere körperliche Beschwerde(n) B) Symptome können nicht vollständig durch einen medizinischen Krankheitsfaktor oder eine Substanz erklärt werden. C) Symptome verursachen Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. D) Die Dauer der Störung beträgt mindestens 6 Monate. E) Die Störung wird nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt. F)Das Symptom wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht. Hypochondrische Störung F 45.2 Hypochondrie 300.7 A) Für mindestens 6 Monate anhaltende Überzeugung an höchstens 2 schweren körperlichen Erkrankungen zu leiden. B) Die ständige Sorge verursacht andauerndes Leiden oder eine Störung des alltäglichen Lebens. B) Medizinische Behandlungen oder Untersuchungen (oder Hilfe von Laienheilern) werden aufgesucht. C) Hartnäckige Weigerung, die medizinische Versicherung zu akzeptieren, dass keine ausreichende körperliche Ursache für die körperlichen Symptome vorliegt. D) Die Störung tritt nicht ausschließlich während einer Schizophrenie oder einer affektiven Störung auf. A) Übermäßige Beschäftigung mit der Angst oder der Überzeugung eine ernsthafte Krankheit zu haben. B) Trotz angemessener medizinischer Abklärung bleibt die Beschäftigung mit den Krankheitsängsten bestehen. C) Die Krankheitsängste sind nicht von wahnhaftem Ausmaß und nicht auf die äußere Erscheinung beschränkt. D)Die Beschäftigung mit den Krankheitsängsten verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. E) Die Dauer der Störung beträgt mindestens 6 Monate. F) Die Beschäftigung mit den Krankheitsängsten kann nicht besser durch eine Generalisierte Angststörung, Zwangsstörung, Panikstörung, Episode einer Major Depression, Störung mit Trennungsangst oder durch eine andere Somatoforme Störung erklärt werden. 85 Tab. A1 ICD-10 Dysmorphophobie F 45.2 DSM-IV Körperdysmorphe Störung 300.7 A) Anhaltende Beschäftigung mit einer vom Betroffenen angenommenen Entstellung oder Missbildung. B) Die ständige Sorge verursacht andauerndes Leiden oder eine Störung des alltäglichen Lebens. Medizinische Behandlungen, Untersuchungen oder Hilfe von Laienheilern werden aufgesucht C) Hartnäckige Weigerung, die medizinische Versicherung zu akzeptieren, dass keine ausreichende körperliche Ursache für die Entstellung vorliegt. D) Die Störung tritt nicht ausschließlich während einer Schizophrenie oder einer affektiven Störung auf. A) Übermäßige Beschäftigung mit einem eingebildeten Mangel oder einer Entstellung in der äußeren Erscheinung. B) Die übermäßige Beschäftigung verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. C) Die übermäßige Beschäftigung wird nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt. Somatoforme Autonome Funktionsstörung (SAD) F 45.3 A) Symptome der autonomen Erregung, die einer körperlichen Erkrankung in einem oder mehreren Systeme oder Organe zugeordnet werden: 1. Herz und kardiovaskuläres System 2. oberer Gastrointestinaltrakt 3. unterer Gastrointestinaltrakt 4. respiratorisches System 5. Urogenitalsystem B),C) 3 Symptome aus einer Liste mit insgesamt 12 Symptomen (s. Tab. A2). D) Kein Nachweis einer Störung von Struktur oder Funktion der Organe oder Systeme. E) Die Symptome treten nicht ausschließlich im Zusammenhang mit einer phobischen oder einer Panikstörung auf. (im DSM-IV gibt es keine vergleichbare Diagnose) 86 Tab. A1 ICD-10 Anhaltende somatoforme Schmerzstörung F 45.4 A) Mindestens 6 Monate kontinuierlicher, an den meisten Tagen anhaltender, schwerer und belastender Schmerz. Der Schmerz kann nicht ausreichend durch den Nachweis einer körperlichen Störung erklärt werden. Der Schmerz ist Hauptfokus für die Aufmerksamkeit des Patienten. B) Die Störung tritt nicht während einer Schizophrenie auf oder ausschließlich während einer affektiven Störung, einer Somatisierungsstörung, einer undifferenzierten somatoformen Störung oder einer hypochondrischen Störung. DSM-IV Schmerzstörung akut / chronisch 307.80 in Verbindung mit psychischen Faktoren 307.89 in Verbindung mit sowohl psychischen Faktoren wie einem medizinischen Krankheitsfaktor A) Schmerzen in einer oder mehreren anatomischen Region(en) mit ausreichendem Schweregrad, um klinische Beachtung zu rechtfertigen. B) Der Schmerz verursacht Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. C) Psychische Faktoren wird eine wichtige Rolle für Beginn, Schweregrad, Exazerbation oder Aufrechterhaltung der Schmerzen beigemessen. D) Das Symptom oder der Ausfall wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht. E) Der Schmerz kann nicht besser durch eine affektive- Angst- oder psychotische Störung erklärt werden und erfüllt nicht die Kriterien für Dyspareunie. Akut: Dauer weniger als 6 Monate Chronisch: Dauer sechs Monate oder länger Sonstige somatoforme Störungen F 45.8 Nicht näher bezeichnete somatoforme Störung 300.81 Die bei diesen Störungen geklagten Beschwerden sind nicht duerch das autonome Nervensystem vermittelt und sind auf bestimmte Systeme oder Körperteile, z.B. die Haut begrenzt. Morfologische Schäden sind nicht nachweisbar. Alle Empfindungsstörungen, die nicht durch eine körperliche Krankheit bedingt sind und in engem zeitlichen Zusammenhang mit belastenden Ereignissen stehen, sollten hier klassifiziert werden. Diese Kategorie umfasst Störungen mit somatoformen Symptomen, die nicht die Kriterien für eine spezifische somatoforme Störung erfüllen. Beispiele sind: 1. Scheinschwangerschaft 2. Hypochondrie von weniger als 6 Monaten Dauer 3. Nicht erklärbare körperliche Beschwerden von weniger als 6 Monaten Dauer. Nicht näher bezeichnete somatoforme Störung F 45.9 87 Tab. A1 ICD-10 Neurasthenie F 48.0 A) Anhaltendes und quälendes Erschöpfungsgefühl nach geringer geistiger und / oder körperlicher Anstrengung. B) Mindestens 1 der folgenden Symptome: Muskelschmerzen, Benommenheit, Spannungskopfschmerz, Schlafstörung, Unfähigkeit zu entspannen, Reizbarkeit. C) Die Betroffenen sind nicht in der Lage, sich innerhalb eines normalen Zeitraumes von Ruhe, Entspannung oder Ablenkung zu erholen. D) Die Dauer der Störung beträgt mindestens 3 Monate. E) Die Störung tritt nicht während einer organischen emotional labilen Störung, einem postenzephalitischen Syndrom, einem organischen Psychosyndrom, nach Schädelhirntrauma, einer affektiven Störung, einer Panikstörung oder einer generalisierten Angststörung auf. DSM-IV 88 Tab. A1 ICD-10 Dissoziative Störungen Konversionsstörungen F 44 DSM-IV Konversionsstörungen 300.11 In der ICD-10 sind die dissoziativen Störungen eine eigenständige Gruppe mit folgender Einteilung: F 44.0 dissoziative Amnesie F 44.1 dissoziative Fugue F 44.2 dissoziativer Stupor F 44.3 Trance- und Besessenheitszustände F 44.4 dissoziative Bewegungsstörungen F 44.5 dissoziative Krampfanfälle F 44.6 Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörung F 44.7 Dissoziative Störungen gemischt F 44.8 sonstige dissoziative Störungen F 44.80 Ganser Syndrom F 44.81 multiple Persönlichkeit F 44.82 vorübergehende dissoziative Stö rung im Kindes- und Jugendalter F 44.88 sonstige näher bezeichnete disso ziative Störungen F 44.9 nicht näher bezeichnete dissoziative Störung A) Kein Nachweis einer körperlichen Krankheit, die die für diese Störungsgruppe charakteristischen Symptome erklären könnte. B) Überzeugender zeitlicher Zusammenhang zwischen den dissoziativen Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen. A) Ein oder mehrere Symptome oder Ausfälle der willkürlichen motorischen oder sensorischen Funktionen, die einen neurologischen Krankheitsfaktor nahe legen. B) Konflikte oder andere Belastungsfaktoren gehen dem Beginn oder der Exazerbation des Symptoms oder des Ausfalls voraus. C) Das Symptom oder der Ausfall wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht. D) Das Symptom oder der Ausfall kann nicht vollständig durch einen medizinischen Krankheitsfaktor, durch die Wirkung einer Substanz oder als kulturelle sanktionierte Verhaltensformen erklärt werden. E) Das Symptom oder der Ausfall verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen, oder es rechtfertigt eine medizinische Abklärung. F) Das Symptom oder der Ausfall ist nicht auf Schmerz oder eine sexuelle Funktionsstörung begrenzt, tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer Somatisierungsstörung auf und kann nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden. 89 II Tab. A2: Körperliche Symptome bei somatoformen Störungen Kopfschmerzen Bauchschmerzen Rückenschmerzen Gelenkschmerzen Schmerzen in Armen, Beinen Brustschmerzen Schmerzen im Enddarm Schmerzen beim Geschlechtsverkehr Schmerzen beim Wasserlassen Übelkeit Völlegefühl Kribbeln im Bauch Erbrechen Aufstoßen Schluckauf, Sodbrennen Speisenunverträglichkeit Appetitverlust Schlechter Geschmack/belegte Zunge Mundtrockenheit Häufiger Durchfall Flüssigkeit aus dem Darm Häufiges Wasserlassen Häufiger Stuhldrang Herzrasen/stolpern Druck in Herzgegend Schweißausbrüche Hitzewallung/Erröten Atemnot Schnelles Ein/Ausatmen Extreme Müdigkeit Flecken der Haut Sexuelle Gleichgültigkeit Unangenehme Empfindung im /am Genitalbereich Koordinations/Gleichgewichtsstörung Muskelschwäche/ Lähmung Kloßgefühl Stimmverlust Harnverhaltung Sinnestäuschung Verlust von Berührungs/Schmerzempfinden Unangenehmes Kribbeln Sehen von Doppelbildern Blindheit Hörverlust Krampfanfälle Gedächtnisverlust Bewußtlosigkeit Schmerzhafte Regelblutung Unregelmäßige Regelblutung Übermäßige Regelblutung Erbrechen in gesamter Schwangerschaft Fluor Vaginalis Impotenz ¹Somatoforme autonome Funktionsstörung, ³Polysymptomatische somatoforme Störung DSM-IV + + + + + + + + + + + ICD-10 + + + SAD ¹* + + + + + MSD ² + + + + + + PSS 7 ³¹ + + + + + + + (+) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (+) (+) (+) + + ²Multisomatoform Disorder, 90 III Tab. A3: Körperliche Symptome bei Angst- und Panikstörung nach ICD-10 Symptome sind relevant für eine somatoforme Störung nach ICD-10 oder DSM-IV Palpitationen, Herzklopfen, erhöhte Herzfrequenz + Schweißausbrüche + Fein- oder grobschlägiger Tremor Mundtrockenheit (nicht infolge Medikation oder Exsikkose) + Atembeschwerden + Beklemmungsgefühl + Thoraxschmerzen und –missempfindungen + Nausea oder abdominelle Missempfindungen (Unruhegefühl im Magen) Gefühl von Schwindel, Unsicherheit, Schwäche oder Benommenheit Gefühl, die Objekte sind unwirklich (Derealisation) oder man selbst ist nicht wirklich hier (Depersonalisation) Angst vor Kontrollverlust, verrückt zu werden oder „auszuflippen“ + Angst zu sterben Hitzegefühl oder Kälteschauer Gefühllosigkeit oder Kribbelgefühle + 91 IV Fragebogen: SOMS-2 Anleitung: Im folgenden finden Sie eine Liste von körperlichen Beschwerden. Bitte geben Sie an, ob Sie im Laufe der vergangenen 2 Jahre unter diesen Beschwerden über kürzere oder längere Zeit gelitten haben oder immer noch leiden. Geben Sie nur solche Beschwerden an, für die von Ärzten keine genauen Ursachen gefunden wurden und die ihr Wohlgefühl stark beeinträchtigt haben. Ich habe die Anleitung gelesen Ich habe in den vergangenen 2 Jahren unter folgenden Beschwerden gelitten: Ja ٱ Nein ٱ Ja ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ Nein ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kopf oder Gesichtsschmerzen Schmerzen im Bauch oder in der Magengegend Rückenschmerzen Gelenkschmerzen Schmerzen in den Armen oder Beinen Brustschmerzen Schmerzen im Enddarm Schmerzen beim Geschlechtsverkehr Schmerzen beim Wasserlassen 10 11 12 13 14 15 ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 16 17 18 19 20 21 22 23 Übelkeit Völlegefühl (sich aufgebläht fühlen) Druckgefühl, Kribbeln, oder Unruhe im Bauch Erbrechen (außerhalb einer Schwangerschaft) Vermehrtes Aufstoßen (in der Speiseröhre) Luftschlucken, Schluckauf oder Brennen im Brust- oder Magenbereich Unverträglichkeit von verschiedenen Speisen Appetitverlust Schlechter Geschmack im Mund oder stark belegte Zunge Mundtrockenheit Häufiger Durchfall Flüssigkeitsaustritt aus dem Darm Häufiges Wasserlassen Häufiger Stuhldrang ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 24 25 26 27 28 29 30 31 Herzrasen oder Herzstolpern Druckgefühl in der Herzgegend Schweißausbrüche (heiß oder kalt) Hitzewallungen oder Erröten Atemnot (außer bei Anstrengung) Übermäßig schnelles Ein- und Ausatmen Außergewöhnliche Müdigkeit bei leichter Anstrengung Flecken oder Farbveränderung der Haut ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 92 Fragebogen: SOMS-2 32 33 Sexuelle Gleichgültigkeit Unangenehme Empfindungen im oder am Genitalbereich Ja ٱ ٱ Nein ٱ ٱ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Koordinations- oder Gleichgewichtsstörungen Lähmung oder Muskelschwäche Schwierigkeit beim Schlucken oder Kloßgefühl Flüsterstimme oder Stimmverlust Harnverhaltung oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen Sinnestäuschungen Verlust von Berührungs- oder Schmerzempfindungen Unangenehme Kribbelempfindungen Sehen von Doppelbildern Blindheit Verlust des Hörvermögens Krampfanfälle Gedächtnisverlust Bewusstlosigkeit ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 48 49 50 51 52 Für Frauen: Schmerzhafte Regelblutungen Unregelmäßige Regelblutungen Übermäßige Regelblutungen Erbrechen während der gesamten Schwangerschaft Ungewöhnlicher oder verstärkter Ausfluss aus der Scheide ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 53 Für Männer: Impotenz oder Störungen des Samenergusses ٱ ٱ Die folgenden Fragen beziehen sich auf die von Ihnen auf der Vorderseite und oben genannten Beschwerden. Falls Sie keine Beschwerden hatten, können Sie die folgenden Fragen auslassen und mit Frage 64 weitermachen. keinmal 1-2x 54 55 56 57 58 Wie oft waren Sie wegen der genannten Beschwerden beim Arzt? ٱ ٱ Konnte der Arzt für die genannten Beschwerden eine genaue Ursache feststellen? Wenn der Arzt Ihnen sagte, dass für die Beschwerden keine Ursache zu finden seien, konnten Sie dies akzeptieren? Haben die genannten Beschwerden Ihr Wohlbefinden stark beeinträchtigt? Haben die genannten Beschwerden ihr Alltagsleben (z.B. Familie, Arbeit, Freizeitaktivitäten) stark beeinträchtigt? 3-6x ٱ 6-12x >12x ٱ ٱ Ja Nein ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 93 Fragebogen: SOMS-2 59 60 61 62 Nahmen Sie wegen der genannten Beschwerden Medikamente ein? Hatten Sie jemals Panikattacken, bei denen Sie furchtbare Angst bekamen und zahlreiche körperliche Beschwerden empfanden, und die nach einigen Minuten oder Stunden wieder abklangen? Traten die geschilderten Beschwerden ausschließlich während solcher Panikattacken (Angstanfälle) auf? Begannen die ersten Beschwerden bereits vor dem 30. Lebensjahr? Nein ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ unter 6 Monate 6 Monate bis 1 Jahr 1-2 Jahre über 2 Jahre ٱ ٱ ٱ ٱ 63 Wie lange halten die Beschwerden nun schon an? 64 66 Haben Sie Angst oder sind Sie fest überzeugt, eine schwere Krankheit zu haben, ohne dass bisher von den Ärzten eine ausreichende Erklärung gefunden wurde? Wenn ja, haben Sie diese Angst oder Überzeugung bereits seit mindestens 6 Monaten? Haben Sie Schmerzen, die Sie stark beschäftigen? 67 Wenn Ja, besteht dieses Problem seit mindestens 1 Jahr? 68 Halten Sie bestimmte Körperteile von Ihnen für missgestaltet, obwohl andere Personen die Meinung nicht teilen? 65 Ja Ja Nein ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ 94 V Fragebogen: HADS-D Dieser Fragebogen bezieht sich auf Ihr Befinden in der vergangenen Woche. Wir bitten Sie, jede Frage zu beantworten und zwar so, wie es für Sie persönlich in der letzten Woche am ehesten zutraf. Machen Sie bitte nur ein Kreuz pro Frage. Lassen Sie bitte keine Frage aus! 1) Ich fühle mich angespannt oder überreizt ٱmeistens ٱoft ٱgelegentlich ٱüberhaupt nicht 8) Ich fühle mich in meinen Aktivitäten gebremst ٱfast immer ٱsehr oft ٱmanchmal ٱüberhaupt nicht 2) Ich kann mich heute noch so freuen wie früher ٱganz genau so ٱnicht ganz so sehr ٱnur noch ein wenig ٱkaum oder gar nicht 9) Ich habe manchmal ein ängstliches Gefühl in der Magengegend ٱüberhaupt nicht ٱgelegentlich ٱziemlich oft ٱsehr oft 3) Mich überkommt eine schreckliche Vorahnung, dass etwas Schreckliches passieren könnte ٱja, sehr stark ٱja, aber nicht zu stark ٱetwas, aber es macht mir keine Sorgen ٱüberhaupt nicht 10) Ich habe das Interesse an meiner äußeren Erscheinung verloren ٱja, das stimmt genau ٱich kümmere mich nicht so darum, wie ich sollte ٱevtl. kümmere ich mich zuwenig darum ٱich kümmere mich so viel darum wie immer 4) Ich kann lachen und die lustigen Dinge sehen ٱja, so viel wie immer ٱnicht mehr ganz so viel ٱinzwischen viel weniger ٱüberhaupt nicht 11) Ich fühle mich rastlos, muss immer in Bewegung sein ٱJa, tatsächlich sehr ٱziemlich ٱnicht sehr ٱüberhaupt nicht 5) Mir gehen beunruhigende Dinge durch den Kopf ٱeinen Großteil der Zeit ٱverhältnismäßig oft ٱvon Zeit zu Zeit, aber nicht zu oft ٱnur gelegentlich / nie 12) Ich blicke mit Freude in die Zukunft 6) Ich fühle mich glücklich ٱüberhaupt nicht ٱselten ٱmanchmal ٱnie 13) Mich überkommt plötzlich ein panikartiger Zustand ٱja, tatsächlich sehr oft ٱziemlich oft ٱnicht sehr oft ٱüberhaupt nicht 7) Ich kann behaglich dasitzen und mich entspannen ٱJa, natürlich ٱgewöhnlich schon ٱnicht oft ٱüberhaupt nicht 14) Ich kann mich an einem guten Buch, einer Radio- oder Fernsehsendung freuen ٱoft ٱmanchmal ٱeher selten ٱsehr selten ٱja, sehr ٱeher weniger als früher ٱviel weniger als früher ٱkaum bis gar nicht 95 VI Lebenslauf Name: Brigitte Krings-Ney Geburtsdatum: 11. Juli 1967 in Geilenkirchen Familienstand: verheiratet, 1 Kind (3 Jahre) Schulbildung: 1973 - 1974 1974 - 1977 1977 - 1986 6/1986 Grundschule Gangelt Grundschule Langerwehe St. Angela Gymnasium, Düren Abitur in Düren Freiwilliges Soziales Jahr: 1986 - 1987 Altenheim St. Anna, Düren Studium: Praktisches Jahr: 1987 – 1994 1993 1993 1994 5/1994 Medizinstudium, RWTH Aachen Innere Medizin, RWTH Aachen Kinderheilkunde, RWTH Aachen Chirurgie, Craigavon, Nordirland Drittes Staatsexamen Auslandsaufenthalt. 1994 - 1995 Praktika in Gesundheitsbildungseinrichtungen in Brasilien Ärztin im Praktikum: 1995 - 1996 Assistenzärztin: 1996 - 1998 Gynäkologie und Geburtshilfe, Städtisches Krankenhaus Nettetal Gynäkologie und Geburtshilfe Krankenhaus Waldshut-Tiengen Allgemeinmedizinpraxis Rickenbach Eltern-Kind-Kurklinik, Rickenbach Gynäkologie und Geburtshilfe Kreiskrankenhaus Lörrach 1998 1999 - 2001 seit 10/2001