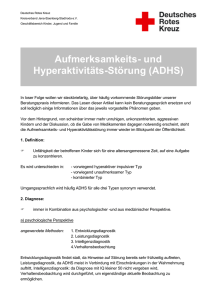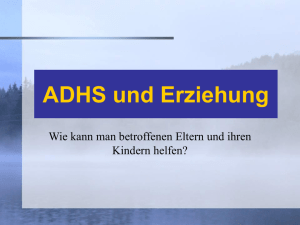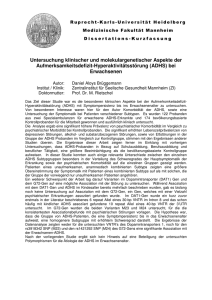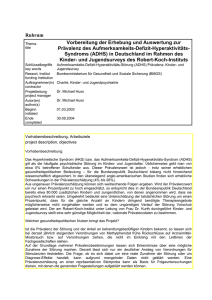Ärzteblatt Sachsen 03/2012
Werbung

Tagungsbericht Wer ist schon normal? Im Januar und Februar 2012 wurde von der Sächsischen Landesärztekammer in Kooperation mit dem Deutschen Hygiene-Museum in Dresden eine Veranstaltungsreihe zu psychischen Störungen durchgeführt. Die fünf Fachvorträge in der Reihe „Wer ist schon normal?” wurden von insgesamt 1.300 Gästen besucht. Was ist normal? – Einführung „Vor hundert Jahren hätten so manche Personen des heutigen öffentlichen Lebens eine eindeutige psychiatrische Diagnose bekommen“ formulierte Prof. Dr. med. habil. Otto Bach, Vorsitzender der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung, und, “dass sich die Ansichten zu ‘Was ist normal und was nicht?’ ändern können und auch stark vom gesellschaftlichen Kontext abhängig sind“. Er eröffnete damit am 11. Januar 2012 die Votragsreihe zu psychischen Störungen. Insbesondere ging er auf die schwierige Unterscheidung von „normal“ und „krank“ ein, weil die Übergänge immer fließend sind und Symptome niemals losgelöst von persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Faktoren betrachtet werden dürften. In Deutschland nehmen psychische Erkrankungen nicht zuletzt wegen der immer älter werdenden Bevölkerung, aber auch wegen der Änderung des sozialen Umfeldes zu. Der Anteil der über 75-Jährigen mit riskantem Alkoholkonsum liegt bei 6,5 Prozent. Depressionen haben in dieser Altersgruppe 6,8 Prozent der Männer und 11 Prozent der Frauen. Dies sei unter anderem darauf zurück zu führen, dass immer mehr Menschen allein leben und kaum soziale Kontakte haben. Die soziale Isolierung sei das häufigste Problem bei psychischen Störungen, nicht nur bei älteren Menschen, betonte Prof. Dr. Bach. Zitterpartien: Angststörungen Angst ist eine wichtige Emotion und physiologische Reaktion in Gefahrensituationen, die das Überleben des Ärzteblatt Sachsen 3 / 2012 Menschen sicherstellt. Allerdings können Angst und Panik auch in Situationen und Formen auftreten, die nicht bei allen Menschen mit Gefahr verknüpft sind. Die Differenzierung zwischen gesunder und pathologischer Angst und wann eine Angststörung vorliegt, erläuterte Dipl.-Psych. Katja Petrowski in ihrem Vortrag über Angsstörungen. Dass Angststörungen mittlererweile keine Seltenheit mehr sind, zeigt sich in einer Studie, nach der bei 13 Prozent der deutschen Bevölkerung im Laufe des Lebens einmal eine Angststörung aufgetreten ist. Und acht Prozent aller Deutschen entwickeln spezielle Phobien. Des Weiteren gibt es soziale Phobien und generalisierte Angsstörungen. Zu den Ursachen von Angsstörungen können Bindungsstörungen in der Kindheit, wie der Tod eines Elternteils, alkoholabhängige Eltern oder Gewalt in der Familie gehören. Auch die Übertragung von Ängsten durch die Mutter auf das Kind (Zahnarztphobie/Höhenangst) spielen eine nicht unwesentliche Rolle. Aber es gibt auch hormonelle Ursachen zum Beispiel für Panik­ attacken. Bei Patienten, die darunter leiden, kann eine Hormonüberproduktion von CHR oder Cortisol vorliegen, wodurch der Angstpegel nicht abgebaut werden kann. Bevor aber eine solche Störung erkannt wird, haben diese Menschen zumeist eine langjährige Patientenkarriere beim Hausarzt oder in der Kardiologie hinter sich. Die Ausprägung der Angststörung kann zu eingeschränkter Lebensqualität, Alkoholabhängigkeit und Krankschreibung führen. Obwohl die Spontan-Remissionsrate gering ist, lassen sich Angststö­ rungen gut behandeln. Welche psychotherapeutischen Interventionen und welche Bedingungen die Erfolgschancen einer Therapie von Angststörungen verbessern, wurde von Frau Dipl.-Psych. Petrowski unter Verwendung neuester empirischer Ergebnisse dargestellt. Erste Wahl ist nachweislich die Konfrontationstherapie in Verbindung mit Einzel- oder Gruppengesprächen sowie einer medikamentösen Behandlung. Die Anzahl der an Angststörungen erkrankten Personen nahm in den Prof. Dr. med. habil. Otto Bach und Dipl.-Psych. Katja Petrowski letzten fünf Jahren um 27 Prozent zu. Diesem Ansturm sind die Versorgungsstukturen laut Katja Petrowski derzeit in Sachsen nicht gewachsen. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz bei einem niedergelassenen Therapeuten liegt hier bei vier Monaten. „Eine Prävention von Angststörungen“, so Frau Petrowski auf Nachfrage aus dem Publikum, „findet praktisch nicht statt“. Die Welt in Grautönen – Depression Die Depression ist die am häufigsten auftretende psychische Erkrankung. Es ist eine affektive Störung, die mit einer Veränderung der Stimmungslage einhergeht. Eines der Hauptsymptome depressiver Episoden ist die gedrückte Stimmung des Patienten und der Verlust der affektiven Resonanz, das heißt der Patient ist durch Zuspruch nicht aufmunterbar. Aber auch eine Reihe anderer Symptome, wie unter anderem Antriebsminderung, Appetitminderung und Schlafstörungen bis hin zu Suizid­ gedanken, gehen mit Depressionen einher. Auch Kinder und Jugendliche können schon an Depressionen erkranken. Der Psychiater Prof. em. Dr. med. habil. Werner Felber erklärte in seinem Vortrag, dass depressive Erkrankungen verschiedene Auslöser haben können: als Folge organischer Krankheitsprozesse oder veränderter Stoffwechselprozesse im Gehirn (endogene Depressionen), als Reaktion auf ein aktuell belastendes Ereignis oder auf eine länger andauernde Belastung, zum Teil aber auch ohne er­­ kennbare Ursache, genetisch be­­ dingt. Oft kehrt die Erkrankung in Episoden wieder, zwischen welchen bis zu zehn Jahre vergehen können. 111 Tagungsbericht ADHS – eine erfundene Erkrankung? Prof. Dr. med. habil. Werner Felber „Die mangelnde oder verzögerte Behandlung führt häufig zur Chronifizierung, Rezidivierung oder auch zu einer Therapieresistenz“, so Prof. Dr. Felber. Im Lebensverlauf erkranken fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung an Depressionen. 80 Prozent der Er­­ krankten werden beim praktischen Arzt behandelt bzw. von diesem an Therapieeinrichtungen weiter überwiesen. Psychiatrisch behandelt werden meist nur schwere Ausprägungen, die Suizidalität und/oder wahnhafte Gedanken aufweisen. Bei leichteren Depressionen ist die Be­­ handlung mittels Therapie ausreichend, während diese bei schwereren oder chronischen Fällen mit einer Pharmakotherapie verbunden wird. Meist ist es eine Kombination mehrerer Faktoren, die zur Entstehung einer Depression führt. Frühe Traumata, zum Beispiel durch frühkind­ liche Deprivation, führen zu einem „biological priming“ mit einer Änderung der Rezeptorstruktur der „second-messenger“-Kaskade. In der ersten Latenzphase kommt es zu einer Reaktivierung durch psychologische Mechanismen wie Trauer oder Rollenwechsel oder „physiologische Ereignisse“ wie Operationen oder Unfälle. Durch das Fehlen einer adäquaten emotional-kognitiven Verarbeitung kommt es zu einer zweiten Latenzphase, in der im Gehirn psychobiologische Stressreaktionen erfolgen und eine erhöhte Menge CRH, Cortisol und β-Rezeptoren produziert werden. Dies führt dann zu einem Ausbrechen der Krankheit. 112 Die Aufmerksamkeitsdefizit- oder Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, wird seit circa 150 Jahren in der Literatur beschrieben und ist seit 1980 in die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) aufgenommen. „ADHS beginnt bei den meisten Betroffenen bis zum 6. Lebensjahr“, erklärte Prof. Dr. med. habil. Veit Rößner, ärztlicher Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus im vierten Vortrag der Reihe. Die psychische Störung weist drei Kernsymptome auf: Die Störung der Aufmerksamkeit, die motorische Hyperaktivität und Impulsivität. Dabei können verschiedene Ausprägungen aufteten: eine Störung des Sozialverhaltens, welches durch Hyperaktivtät und Impulsivität gekennzeichnet ist oder aber auch die primäre Unaufmerksamkeit ohne andere Symptome, zu welcher bisher wenig geforscht wurde. Die Prävalenz liegt im Vorschulalter bei zwei Prozent und steigt im Schulalter auf fünf bis sieben Prozent an. Jungen sind dabei deutlich häufiger betroffen als Mädchen. Damit einhergehen Probleme wie die Ausgrenzung durch Gleichaltrige, häufige Auseinandersetzungen mit Lehrern oder Eltern, und ein von den Betroffenen wahrgenommenes Gefühl des Andersseins. Die Störung kann mit einer etwas veränderten Symptomatik bis ins Erwachsenenalter (Prävalenz zwei bis drei Prozent) bestehen, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Zur Ausprägung von ADHS bei über 45-Jährigen existiert bisher keine Forschung. ADHS ist zu 70 bis 80 Prozent genetisch angelegt. Ungünstige Umweltfaktoren wie Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen, Infektionen oder traumatische Hirnschädigungen in früher Kindheit, aber auch die Toxinexposition kann zum Ausbrechen einer solchen Störung führen. Allergien und bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. ADHS ist eine dimensionale Störung. Die Festlegung, ab wann eine Störung vorhanden ist, erfolgt nach Prof. Dr. med. habil. Veit Rößner bestimmten Diagnosekriterien. Für eine verlässliche Diagnose müssen verschiedene Parameter wiederholt gemessen werden. Das Verhalten wird dazu in Bezug zum Alter, Entwicklungsstand und IQ gesetzt. Neben einer ausführlichen Exploration mit Eltern, Jugendlichen und Lehrern oder Erziehern, werden zum Teil andere Diagnoseverfahren wie Aktometrie, Videorating oder neuropsychologische Testung eingesetzt, die allerdings eine geringere Vorhersagewahrscheinlichkeit und Verlässlichkeit aufweisen. Erste Wahl bei der Behandlung von ADHS sollte eine Psychotherapie sein, wenn diese nicht anschlägt, wird der Patient auf ein Methylphenidat eingestellt. Erkennisse zur Wirksamkeit von Psycho- oder Pharmakotherapien oder einer Kombination von beiden erläuterte Prof. Dr. Rößner anhand einer Studie von van der Oord et al. (2008). Diese zeigt, dass gerade aus Perspektive der Lehrer, die besten Effekte auf das Sozialverhalten der betroffenen Kinder durch eine medikamentöse Behandlung erreicht werden, während eine Kombination von Pharmako- und Psychotherapie die Wirkung nur wenig erhöht. Optimal sind gleichzeitige Interventionen in der Familie, um eventuell verstärkende Umwelteinflüsse zu minimieren oder die Familie durch ein Elterntraining zu unterstützen, das hilft, die Kinder konsequent mit den richtigen Methoden zu erziehen. Ein solches wird unter anderem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Dresden angeboten. Ärzteblatt Sachsen 3 / 2012 Tagungsbericht Psychische- und Verhaltensstörungen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 27,6% 28,0% 27,9% 28,6% 29,0% 31,4% 31,9% Quelle: Barmer GEK Arztreport 2012: Auszug aus der Tab. Anteil der Bevölkerung mit Diagnosen 2004 – 2010 nach Diagnosekapiteln AUSNAHME | ZUSTAND: Psychose und Schizophrenie Krankheitszustände, die von einer schweren geistig-psychischen Störung gekennzeichnet sind, werden allgemein als Psychosen bezeichnet. Psychosen – die in der psychiatrischen Praxis aber eher als Symptomkomplexe verstanden werden – bedürfen einer genaueren Beschreibung der gestörten menschlichen Wahrnehmungsmuster und Funktionen, um eine Krankheit konkret benennen und behandeln zu können. Im Falle der Schizophrenie spricht man deshalb von schweren Psychosen, die mit Denkstörungen, Halluzinationen oder Wahn einhergehen. Jene Krankheitsbilder, bei denen das Fühlen, Denken und Wollen der Betroffenen beeinflusst und wie von außen verändert und gesteuert wahrgenommen wird, erscheinen nicht nur den Patienten zumeist erschreckend. Vorurteile und Ängste im Umgang mit diesen Krankheiten und den davon Betroffenen sind weit verbreitet. Schließlich greifen die Symptome Funktionen der Psyche an, die den Kern des menschlichen Ichs und der individuellen Persönlichkeit ausmachen. Für einen adäquaten und stigmafreien Umgang mit der Erkrankung sind die Vermittlung von Wissen und die Auseinandersetzung mit diesen Themen grundlegend wichtig. Dieser Aufgabe sah sich auch Frau Dr. med. Karolina Leopold im fünften Vortrag der Reihe „Wer ist schon normal“ im HygieneMuseum verpflichtet. In ihrem anschaulichen Vortrag erläuterte Frau Dr. Leopold Diagnose, Genese, Epidemiologie und Therapie­ möglichkeiten von schizophrenen Psychosen. Schon bei der Beschreibung der Krankheitsgruppen nach den auftretenden Merkmalen wurden sowohl der große Erfahrungsschatz der Psychiaterin als auch die Ärzteblatt Sachsen 3 / 2012 pie mit dem Ziel möglichst symptombesonderen Zustände der Patienten freien Lebens setzt sich dennoch aus deutlich. Schizophrenie äußert sich einer Verbindung von medikamentödemnach unter anderem in einer Störung der Ich-Umwelt-Grenze, also ser Behandlung, Psychoedukation – einer Wahrnehmung der Welt als Patienten und Angehörige müssen fremd und gemacht, in Halluzinatio- zu Experten werden – und Soziothenen oder einer wahnhaften Fehlbe- rapie zusammen. Frau Dr. Leopold urteilungen der Realität. Eine weitere betonte zum Ende ihrer AusführunKategorie – die Gruppe der formalen gen noch einmal die Wichtigkeit der Denkstörungen – erhielt ein beson- frühzeitigen Krankheitserkennung ders drastisches Bild durch die für eine erfolgreiche Therapie. Um Beschreibung einer extremen Form Betroffenen die Akzeptanz der des Konkretismus. Hier berichtete immer noch stigmatisierten Diagnose zu erleichtern, nimmt die Be­­ die Ärztin von einer Patientin, die deutung von neuen anonymen und aus Ermangelung der Fähigkeit zur Unterscheidung von abstraktem und unbürokratischen Hilfe-Angeboten konkretem Denken auf den Hinweis, zu, wie sie im Dresdener Früherkensie solle wieder „auf den Boden nungszentrum bereits praktiziert zurück kommen“ aus dem Fenster werden. sprang. Relativ unbekannt ist die schizophrene Ausprägung in Nega- Den Abschluss der Reihe „Wer ist tiv-Symptomen. Diese durch das Feh- schon normal?“ bildete eine spanlen essenzieller Antriebe gekenn- nende Lesung unter dem Titel zeichnete Gruppe, die sich in Sprach- „Großstadtneurotiker“ mit Jens Sparverarmung, Ge­­nussverlust oder sozi- schuh und Jakob Hein. alem Rückzug zeigt, findet immer Knut Köhler M.A. stärkere Beachtung nicht zuletzt desLeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit halb, weil diese Merkmale bisher oft Maxi Moder M.A. als Nebenwirkung der medikamentöMartin Kandzia B.A. sen Therapie fehl gedeutet wurden. Schizophrenie, welche bei etwa einem Prozent der Bevölkerung diagnostiziert wird, tritt in allen Kulturen gleichhäufig auf. Ein Fakt, der für Frau Dr. Leopold mit ausschlaggebend dafür ist, sich gegen anhaltende Theorien stark zu machen, wonach die Krankheit auch durch bestimmte westliche Erziehungsstile ausgelöst werden soll. Die Faktoren für eine Anfälligkeit bestehen nach dem heutigen medizinischen Stand aus einer Kombination von biologischen (genetischen) und psychosozialen Merkmalen. Die Krankheit an sich kann als eine Störung des neurologischen Netzwerkes im Gehirn begriffen werden. Genau hier setzen auch die etablierten Behandlungsmöglichkeiten über Neuroleptika und Antipsychotika ein. Eine Thera- Weitere Informationen/ Kontakt: Angststörungen Dr. phil. Dipl.-Psych. Katja Petrowski Klinik & Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus www.psychosomatik-ukd.de Forschungsbereich Angst- und Bindungsforschung ADHS Prof. Dr. med. habil. Veit Rößner Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus www.kjp-dresden.de Spezialambulanz für Kinder und Jugendliche mit ADHS Studien u. a. zur Wirkung von Elterntraining bei ADHS und expansivem Problemverhalten Psychosen und Schizophrenie Dr. med. Karolina Leopold Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus http://psychiatrie.uniklinikum-dresden.de Forschungsbereich Klinische Psychopharmakologie 113