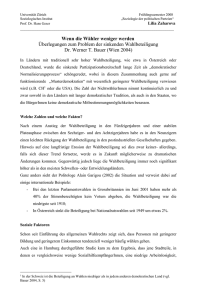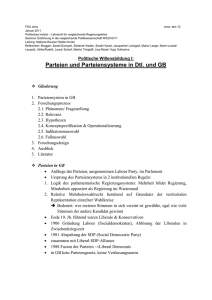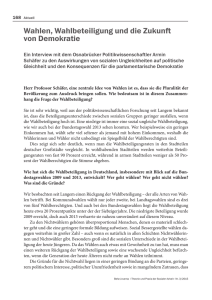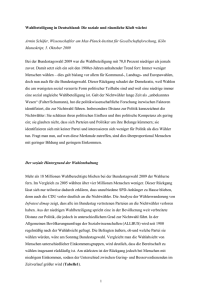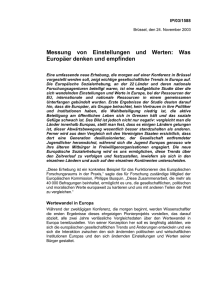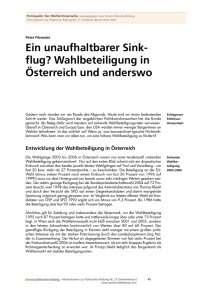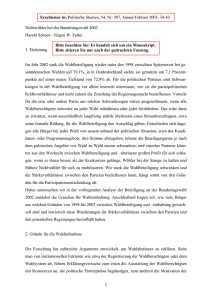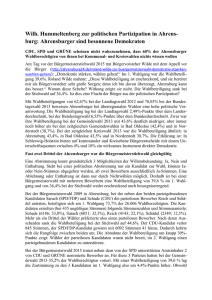Wenn die Wähler weniger werden_Fschug
Werbung
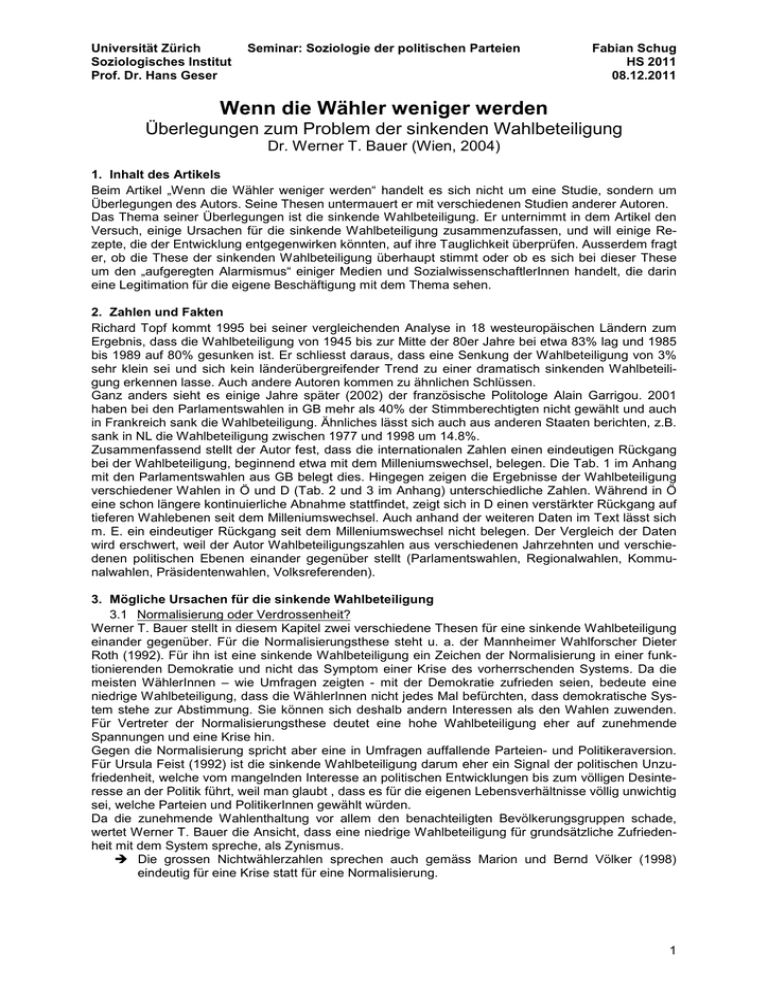
Universität Zürich Soziologisches Institut Prof. Dr. Hans Geser Seminar: Soziologie der politischen Parteien Fabian Schug HS 2011 08.12.2011 Wenn die Wähler weniger werden Überlegungen zum Problem der sinkenden Wahlbeteiligung Dr. Werner T. Bauer (Wien, 2004) 1. Inhalt des Artikels Beim Artikel „Wenn die Wähler weniger werden“ handelt es sich nicht um eine Studie, sondern um Überlegungen des Autors. Seine Thesen untermauert er mit verschiedenen Studien anderer Autoren. Das Thema seiner Überlegungen ist die sinkende Wahlbeteiligung. Er unternimmt in dem Artikel den Versuch, einige Ursachen für die sinkende Wahlbeteiligung zusammenzufassen, und will einige Rezepte, die der Entwicklung entgegenwirken könnten, auf ihre Tauglichkeit überprüfen. Ausserdem fragt er, ob die These der sinkenden Wahlbeteiligung überhaupt stimmt oder ob es sich bei dieser These um den „aufgeregten Alarmismus“ einiger Medien und SozialwissenschaftlerInnen handelt, die darin eine Legitimation für die eigene Beschäftigung mit dem Thema sehen. 2. Zahlen und Fakten Richard Topf kommt 1995 bei seiner vergleichenden Analyse in 18 westeuropäischen Ländern zum Ergebnis, dass die Wahlbeteiligung von 1945 bis zur Mitte der 80er Jahre bei etwa 83% lag und 1985 bis 1989 auf 80% gesunken ist. Er schliesst daraus, dass eine Senkung der Wahlbeteiligung von 3% sehr klein sei und sich kein länderübergreifender Trend zu einer dramatisch sinkenden Wahlbeteiligung erkennen lasse. Auch andere Autoren kommen zu ähnlichen Schlüssen. Ganz anders sieht es einige Jahre später (2002) der französische Politologe Alain Garrigou. 2001 haben bei den Parlamentswahlen in GB mehr als 40% der Stimmberechtigten nicht gewählt und auch in Frankreich sank die Wahlbeteiligung. Ähnliches lässt sich auch aus anderen Staaten berichten, z.B. sank in NL die Wahlbeteiligung zwischen 1977 und 1998 um 14.8%. Zusammenfassend stellt der Autor fest, dass die internationalen Zahlen einen eindeutigen Rückgang bei der Wahlbeteiligung, beginnend etwa mit dem Milleniumswechsel, belegen. Die Tab. 1 im Anhang mit den Parlamentswahlen aus GB belegt dies. Hingegen zeigen die Ergebnisse der Wahlbeteiligung verschiedener Wahlen in Ö und D (Tab. 2 und 3 im Anhang) unterschiedliche Zahlen. Während in Ö eine schon längere kontinuierliche Abnahme stattfindet, zeigt sich in D einen verstärkter Rückgang auf tieferen Wahlebenen seit dem Milleniumswechsel. Auch anhand der weiteren Daten im Text lässt sich m. E. ein eindeutiger Rückgang seit dem Milleniumswechsel nicht belegen. Der Vergleich der Daten wird erschwert, weil der Autor Wahlbeteiligungszahlen aus verschiedenen Jahrzehnten und verschiedenen politischen Ebenen einander gegenüber stellt (Parlamentswahlen, Regionalwahlen, Kommunalwahlen, Präsidentenwahlen, Volksreferenden). 3. Mögliche Ursachen für die sinkende Wahlbeteiligung 3.1 Normalisierung oder Verdrossenheit? Werner T. Bauer stellt in diesem Kapitel zwei verschiedene Thesen für eine sinkende Wahlbeteiligung einander gegenüber. Für die Normalisierungsthese steht u. a. der Mannheimer Wahlforscher Dieter Roth (1992). Für ihn ist eine sinkende Wahlbeteiligung ein Zeichen der Normalisierung in einer funktionierenden Demokratie und nicht das Symptom einer Krise des vorherrschenden Systems. Da die meisten WählerInnen – wie Umfragen zeigten - mit der Demokratie zufrieden seien, bedeute eine niedrige Wahlbeteiligung, dass die WählerInnen nicht jedes Mal befürchten, dass demokratische System stehe zur Abstimmung. Sie können sich deshalb andern Interessen als den Wahlen zuwenden. Für Vertreter der Normalisierungsthese deutet eine hohe Wahlbeteiligung eher auf zunehmende Spannungen und eine Krise hin. Gegen die Normalisierung spricht aber eine in Umfragen auffallende Parteien- und Politikeraversion. Für Ursula Feist (1992) ist die sinkende Wahlbeteiligung darum eher ein Signal der politischen Unzufriedenheit, welche vom mangelnden Interesse an politischen Entwicklungen bis zum völligen Desinteresse an der Politik führt, weil man glaubt , dass es für die eigenen Lebensverhältnisse völlig unwichtig sei, welche Parteien und PolitikerInnen gewählt würden. Da die zunehmende Wahlenthaltung vor allem den benachteiligten Bevölkerungsgruppen schade, wertet Werner T. Bauer die Ansicht, dass eine niedrige Wahlbeteiligung für grundsätzliche Zufriedenheit mit dem System spreche, als Zynismus. Die grossen Nichtwählerzahlen sprechen auch gemäss Marion und Bernd Völker (1998) eindeutig für eine Krise statt für eine Normalisierung. 1 Universität Zürich Soziologisches Institut Prof. Dr. Hans Geser Seminar: Soziologie der politischen Parteien Fabian Schug HS 2011 08.12.2011 3.2 Politik, Gesellschaft und Zeitgeist In diesem Kapitel werden gesellschaftliche und politische Gründe vorgestellt, die zu einer sinkenden Wahlbeteiligung führen. Als wesentlicher Grund wird die erodierende Bindung der WählerInnen zu den politischen Parteien genannt. In Folge der Auflösung der traditionellen Sozialmilieus habe die Zahl der StammwählerInnen stark abgenommen. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung von 2001 zeigt, dass sich die Hälfte der Wahlberechtigten nicht mehr mit einer bestimmten Partei identifizieren. Als weiterer Grund wird der zunehmende Individualisierungsprozess genannt. Die „Pflichtwerte“ verlagern sich zu den „Selbstentfaltungswerten“. Dies führt dazu, dass Parteien, aber auch andere Organisationen wie Verbände und Religionsgemeinschaften immer weniger Mitglieder haben. Das Durchschnittsalter in den grossen Volksparteien steigt. Erwähnt wird auch, dass die partizipatorische Revolution (Max Kaase) der Siebzigerjahre längerfristig zu einer De-Institutionalisierung sowie zu einer Ausweitung des Beteiligungsrepertoirs geführt habe. Beides gehe einher mit einer zunehmenden Ablehnung der etablierten politischen Institutionen und damit zu Lasten der politischen Beteiligungsformen, zu denen die Wahlen gehören. Zusammenfassend lässt sich gemäss Werner T. Bauer sagen, dass der Zeitgeist den erwähnten Organisationen zu schaffen macht und dass es einen Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Integration und der Bereitschaft zur politischen Partizipation gibt: Je niedriger die Integration desto niedriger die Beteiligung. 3.3 Soziale Faktoren Arend Lijphard (1998) weist darauf hin, dass eine geringe Wahlbeteiligung auch immer eine geringe Beteiligung unterprivilegierter BürgerInnen bedeutet. Faktoren wie sozialer Status, Einkommen und Bildung beeinflussen heute noch den Wahlbeteiligungsgrad, auch wenn sich – zuungunsten der Wahlbeteiligung – die Tendenz zeigt, dass die Unterschiede langsam abnehmen Die klassischen Faktoren für einen hohen Wahlbeteiligungsgrad (Bildung, sozialer Status und Einkommen) zählen allerdings immer weniger. Zunehmend verzichten auch höhere und wohlhabendere Schichten auf ihre Stimmabgabe. Sie fühlen sich immer weniger für öffentliche Belange zuständig und verabschieden sich von der Politik. Die Wahlverdrossenheit der wohlhabenden Schichten ist nicht mit einem Ohnmachtsgefühl verbunden, wie dies bei den tieferen Schichten gegeben ist. Dennoch ist auch bei ihnen die Auffassung weit verbreitet, dass ihre Stimmabgabe nutz- und folgenlos ist. Diese Schichten gehen davon aus, dass die Entscheidungsmacht sich von der Politik und vom Staat hin zur Wirtschaft und zu grossen Unternehmen verlagert. Als weiterer Faktoren kommen das Alter und das Geschlecht hinzu: Mit steigendem Alter wächst die Bereitschaft, wählen zu gehen und Frauen gehen tendenziell immer noch in etwas geringerem Mass wählen als Männer. 3.4 „Problemfall“ Jugend Das Alter ist der stärkste Sozialindikator für Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung verändert sich über das Lebensalter hinweg. Es gibt eine hohe Erstwahlbeteiligung, gefolgt von einem relativ grossen Desinteresse. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahlbeteiligung und senkt sich zum Lebensende hin wieder ab. Das niedrige Wahlinteresse der Jungwähler ist deshalb per se kein Grund zur Beunruhigung. Wahlen aus D zeigen jedoch, dass die Wahlbeteiligung der Jungwähler zwischen 18 und 24 Jahren stärker zurückging als die durchschnittliche Wahlbeteiligung. Gesunken sind bei den Jungen auch die Mitgliedschaft und die Mitarbeit in den grossen Parteien (CDU und SPD). Über den Anteil der unter 29jährigen bei den Grünen gibt es keine offiziellen Angaben. Umfragen aus Ö zeigen, dass nur 7% der Jugendlichen aktiv in der Politik mitwirken wollen, während 92% ein Mitwirken ganz ablehnen. PolitikerInnen gingen aus der Umfrage als jene Berufsgruppe hervor, die das geringste Vertrauen geniesst. Das allgemeine Interesse der Jugendlichen an Politik ist rückläufig, wie auch die „Shell-Jugendstudie 2002“ zeigt. Nur noch 34% der 15- bis 24jährigen bezeichnen sich als politisch interessiert. 1984 und 1990 waren es noch rund 20% mehr. Die Mehrheit der Jugendlichen in D hält die Demokratie für eine gute Staatsform. Das Vertrauen, das den politischen Parteien entgegengebracht wird, ist jedoch gering. Die Jugend per se gibt es jedoch nicht. Bildung und soziale Herkunft prägen die Einstellung der Jugendlichen zu Gesellschaft, Politik und Demokratie. Man kann dabei folgende vier Grundtypen unterscheiden (Shell Jugendstudie 2002): • Mitwirkungsbezogene Jugendliche (22%). V.a. ältere, besser gebildete Jugendliche, Gymnasiasten und Studenten. Man kann ihre Grundhaltung als „politisiert“ bezeichnen. • Politikkritische Jugendliche (24%). Meist etwas ältere Jugendliche in Ausbildung, bereits erwerbstätig oder arbeitslos. Sie zeigen ein geringes Interesse an Politik und sind politikverdrossen. 2 Universität Zürich Soziologisches Institut Prof. Dr. Hans Geser Seminar: Soziologie der politischen Parteien Fabian Schug HS 2011 08.12.2011 • Politisch desinteressierte Jugendliche (31%). V.a. junge Jugendliche und v.a. Haupt- und Realschüler, z. T. auch junge Gymnasiasten, die sich nur eine geringe politische Kompetenz zuschreiben. Sie beschäftigen sich v.a. mit sich selbst und weniger mit gesellschaftlichen Fragen. • Ordnungsorientierte Jugendliche (23%). Relativ inhomogene Gruppe, die sich zwar mehrheitlich zur Demokratie bekennt; Recht auf demokratische Freiheiten wie Meinungsfreiheit und Recht auf Opposition spielen jedoch eine untergeordnete Rolle. Politische Angelegenheiten sollen straff und ohne grosse Debatten geregelt werden. Die Untersuchungen zeigen ein differenziertes Bild vom Verhältnis der Jugendlichen zur Politik. Es zeigt sich jedoch, dass auch die Jugendlichen, die sich engagieren wollen, dies meist nicht in traditionellen Parteien tun möchten, sondern unkonventionelle Partizipationsmöglichkeiten wählen, wobei der Trend hin zu einer nicht anstrengenden/konsumtiven Partizipation führt. Offen bleibt die Frage, ob es sich bei der geringen Wahlbeteiligung und der geringen Parteimitgliedschaft der Jugendlichen um eine Lebenszyklusfrage handelt, d. h. eine höhere Partizipation folgt erst in einer späteren Lebensphase. Dieser Lebenszyklusthese steht die Generationenthese gegenüber, die von einem Wertewandel in der neuen Generation ausgeht. 3.5 Institutionelle und politische Faktoren Auch institutionelle Regeln haben einen Einfluss auf die Höhe der Wahlbeteiligung. Z.B: • Hohe Eintrittshürden für Parteien in ein Parlament senken die Partizipationsbereitschaft. • Die Wahlpflicht führt zu einer Erhöhung der Wahlbeteiligung, v.a. bei Personen mit geringer Partizipationsbereitschaft. • Häufige Wahlgänge senken die Beteiligung, deshalb sei eine Kombination von „zweitrangigen“ lokalen Wahlgängen mit „erstrangigen“ nationalen sinnvoll. • E-Voting zeigt keinen relevanten Einfluss auf die Wahlbeteiligung, erhöht jedoch den Komfort. • Briefwahl steigert die Wahlbeteiligung. Generell darf der Einfluss der institutionellen Faktoren nicht überschätzt werden. Wichtiger sind das Ausmass der Polarisierung und Emotionalisierung im Wahlkampf. Parteien mit einem sehr eindeutigen Profil (dazu gehören v. a. auch die rechten Populisten) bringen deshalb ihre Anhänger leichter zur Urne als Parteien mit einem breiten Profil. Alain Garrigou (2002) meint, dass in den entwickelten Demokratien, in denen fast alle mit ähnlichen Konzepten um die politische Mitte buhlen, die Bürger vielleicht die Möglichkeit einer Wahl von echten Alternativen vermissen. Ein Grund für die Politikverdrossenheit wird auch darin gesehen, dass sich die politische Klasse immer stärker zu einem exklusiven Milieu entwickelt. Politikverdrossenheit sei daher vielfach v. a. eine Politiker- und Parteienverdrossenheit (Skandale, Politikfilz etc.). 3.6 Die Medien – Mittler oder Mitverursacher In diesem Kapitel wird die Frage gestellt, ob den Medien die Rolle des Seismographen zukommt, der die Politik- und Parteienverdrossenheit in der Bevölkerung wahrnimmt, oder ob die Medien durch Skandalberichterstattung, Personalisierung der Politik und Komplexitätsreduktion nicht vielmehr eine Ursache des Verdrusses darstellen. Hans Mathias Kepplinger (1996) stellt eine quantitative Zunahme der Skandale fest. Er führt diese aber insbesondere auf die schärfer werdende Konkurrenz der Medien untereinander zurück, die deshalb Skandale bräuchten. Manche Autoren halten Skandale für funktional, weil sie gesellschaftliche Werte in Erinnerung rufen und diese bekräftigen würden. Andere halten die Skandalisierung für dysfunktional, weil sie die Politik zum Schauspiel degradiere und das Misstrauen gegenüber der Politik und deren Akteuren vergrössere. Zu diesen Autoren gehört auch Kepplinger, der meint, die Daten wiesen eindeutig in diese Richtung. Auch Mike Friedrichsen (1996) stellt fest, dass es einen positiven und messbaren Zusammenhang zwischen der medialen Skandalberichterstattung einerseits und dem Politik- und Parteienverdruss andererseits gibt. 4. Die „Partei der Nichtwähler“ Es gibt verschiedene Kategorien, in die man NichtwählerInnen einordnen kann. Die Typologisierungen sind mit Vorsicht zu geniessen, sie erlauben jedoch, verschiedene Kategorien von NichtwählerInnen differenzierter anzuschauen. Die Politologie unterscheidet heute grob zwischen: • Technischen NichtwählerInnen: Sie sind persönlich durch Krankheit, Arbeit, Reise etc. verhindert. Ihr Anteil beträgt ca. 3-5%. • Konjunkturelle NichtwählerInnen: Es handelt sich um ProtestnichtwählerInnen. Diese Gruppe bildet den grössten Anteil der NichtwählerInnen. 3 Universität Zürich Soziologisches Institut Prof. Dr. Hans Geser Seminar: Soziologie der politischen Parteien Fabian Schug HS 2011 08.12.2011 • Habitualisierte NichtwählerInnen: Ihr Anteil beträgt bis zu 10% der WählerInnen. Es handelt sich um DauernichtwählerInnen, die schwer stimulierbar sind. Daneben gibt es dem Lebenswelten-Ansatz mit Milieugruppen. Eine weitere Typisierung stammt von Thomas Kleinhenz (1995). Er unterscheidet sieben Nichtwählertypen: • Junger Individualist: stark hedonistisch, wenig traditionelle Bindung, geringes Vertrauen in Politik, (ca. 20%). • Aktiver Postmaterialist: jung, hohes Bildungsniveau, Arbeit und Karriere sind wichtig, eher linksliberal, Erwartungen an die Politik sind hoch, (ca.6%). • Gehobene Jungkonservative: ähnlich wie junge Individualisten, jedoch hohe Zufriedenheit mit den Zuständen, geringes staatsbürgerliches Pflichtgefühl, (ca. 9%). • Saturierte Mittelschichtler: integriert und zufrieden, Wahlverzicht eher von kurzfristigen Motiven geleitet, (ca. 10-15%). • Desinteressierte Passive: sozial integriert, eher zufrieden, in den letzten Jahre jedoch zunehmend verdrossen, geringes Interesse an Politik, Law and Order-Mentalität, (ca. 20-30%). • Enttäuschte Arbeiter: eher integriert, hoher Grad an Unzufriedenheit mit politischen Verhältnissen und den Akteuren, fühlt sich allein gelassen, Law and Order-Mentalität, (ca. 10%). • Isolierte Randständige: niedriger Bildungsgrad, geringes Einkommen, ablehnende Haltung gegenüber dem System, kein politisches Interesse, soziale Entfremdung, (ca.15-20%). Nebst diesen Typologien gibt es auch Erkenntnisse aus der Motivforschung. Die beiden Wahlforscher Carsten Ascheberg und Ueltzhöffer beschreiben insgesamt 7 Motivkreise (Ursula Feist, 1994): Fundamentalopposition, aggressive Apathie gegen die da oben, Protest aus aktuellem Anlass, Saturiertheit, Sinnkrise, Neues weibliches Selbstbewusstsein, radikaler Individualismus. Einige Motive entsprechen dem Typ des klassischen Nichtwählers (niedriger Sozialstatus, niedriges Einkommen und kein hoher Bildungsgrad). Es gibt jedoch neue Entwicklungen: So gibt es z. B. politisierte BürgerInnen, die aus Protest nicht wählen. Der Anteil der gut informierten und gutsituierten NichtwählerInnen nimmt stark zu. Deshalb lasse sich auch bei den NichtwählerInnen eine Tendenz zur Mitte bezüglich ihrer politischen Einstellung feststellen. 5. Ist unsere Parteiendemokratie reformierbar? Für das politische System der Demokratie werden die Parteien als unverzichtbar erachtet. Der schleichende Legitimationsverlust der Parteien wird daher als Gefahr wahrgenommen. Als eines der dringendsten Probleme der Parteien wird die Nachwuchsrekrutierung erachtet. Wenn die Parteien für die Jungen wieder attraktiver werden wollen, müssten sie ihre Prozesse verändern (z. B. statt langwierige Sitzungen und Tagungen mehr Workshops und spezielle Aktionen). Reformen braucht es auch beim strukturellen Aufbau der Parteien. Diese sind in der Regel oligarchisch organisiert. Die Parteimitglieder haben in der Regel nur wenig Einfluss auf innerparteiliche Entscheide. Deshalb werden folgende Reformpunkte vorgeschlagen: • Stärkere Mitwirkungsrechte für Parteimitglieder • Grössere Transparenz bei Entscheidungen • Die Parteibasis soll über das Spitzenpersonal stärker mitentscheiden • Begrenzung von Mandatszeiten, Trennung von Amt (öffentliche Anstellung) und Mandat (Parlamentssitz) • Zusammenarbeit themenspezifisch mit anderen Organisationen, welche ähnliche Interessen und Ziele verfolgen. Dadurch können vorhandene Partizipationspotentiale durch Netzwerkstrukturen eingebunden und Allianzen geschaffen werden. • Rückzug der Parteien aus gewissen Bereichen des öffentlichen Lebens • Neue Kommunikationsformen nutzen, um die Politik zugänglicher zu machen Die Vorschläge sind nicht neu, sie wurden jedoch kaum umgesetzt, denn die Hauptverlierer eines solchen Prozesses seien die unteren und mittleren Parteifunktionäre. Viele Experten sind jedoch skeptisch, dass Reformen die Wahlbeteiligung wieder erhöhen. Thomas Kleinhenz (1995) ist im Gegenteil davon überzeugt, dass die Wahlbeteiligung noch weiter sinken wird, denn immer mehr Bürger bräuchten einen Grund, um zu wählen, statt wie früher einen Grund, um nicht zu wählen. Eine Rückkehr zu einem höheren Wahlpflichtbewusstsein sei schwierig und möglicherweise nur mit politischer Bildung und der Hilfe der Medien zu erreichen. Quelle: http://www.politikberatung.or.at/typo3/fileadmin/02_Studien/3_wahlen/wahlbeteiligung.pdf. 4