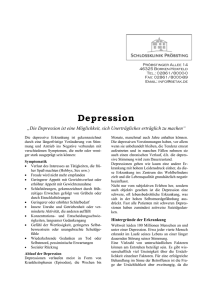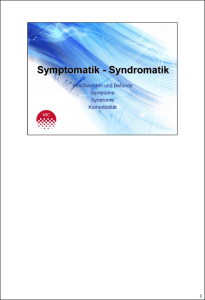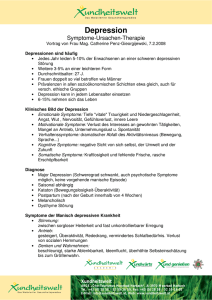Diabetes mellitus und Depression - eine
Werbung
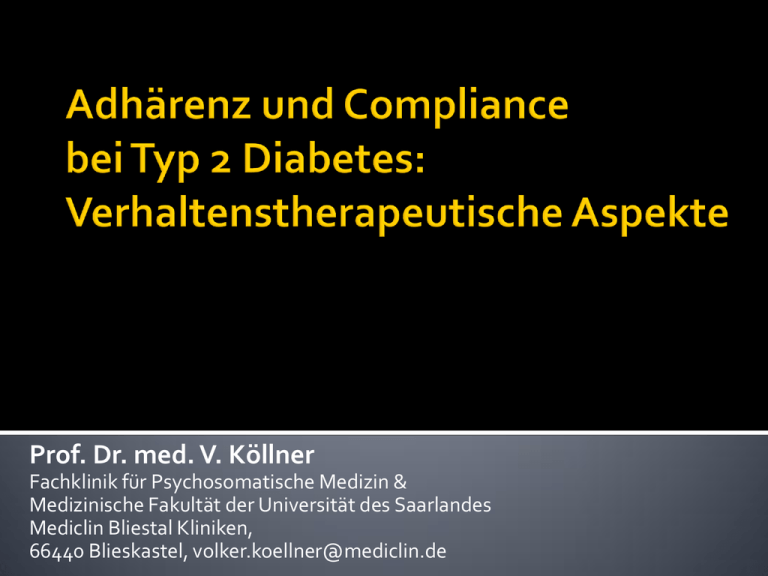
Prof. Dr. med. V. Köllner Fachklinik für Psychosomatische Medizin & Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes Mediclin Bliestal Kliniken, 66440 Blieskastel, [email protected] Fachkliniken für Innere Medizin (Schwerpunkt Kardiologie & Stoffwechsel), Orthopädie und Rheumatologie sowie Psychosomatische Medizin Enge Kooperation mit der Uniklinik Homburg in Forschung, Lehre & Krankenversorgung In der Psychosomatik ca. 1.500 vollstationäre Reha-Maßnahmen/Jahr, Schwerpunkte: chronischer Schmerz (u. a. Fibromyalgie) arbeitsplatzbezogene Störungen, Depression, Angst/Trauma und Verarbeitung chronischer körperlicher Erkrankungen, Tagesklinik, Klinikambulanz In Kooperation mit der Inneren Medizin: Psychokardiologie, Adipositas Adherence = Compliance? Strategien, um Patienten zur Verhaltensänderung zu motivieren - Stages of Change - Motivierende Gesprächsführung Psychische Komorbidität als Ursache für Non-Adherence: Die Bedeutung der Depression Therapie & Prävention Drugs don‘t work in patients who don‘t take them. C.E. Koop COMPLIANCE Therapietreue Patient befolgt konsequent die ärztlichen Ratschläge und Patient passt sich an die Notwendigkeiten von Krankheit und Therapie an ADHERENCE informed consent Patient arbeitet aufgrund eigener Überzeugung aktiv mit Basis: Gemeinsam vereinbarter Therapieplan Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Barrieren des Patienten mit dem Patienten Konsens finden, daß ein Probelm existiert und eine Entscheidung nötig ist Klären, ob Patient in Entscheidungsprozeß eingebunden werden will Ideen, Ängste und Erwartungen explorieren unterschiedliche Behandlungsoptionen darstellen Vor- und Nachteile gemeinsam nach individuellen Patientenbedürfnissen abwägen Prozess des Informationsverständnisses prüfen Patient Gelegenheit zur Überprüfung der eigenen Entscheidung geben mit dem Patienten Konsens finden, daß ein Probelm existiert und eine Entscheidung nötig ist Klären, ob Patient in Entscheidungsprozeß eingebunden werden will Ideen, Ängste und Erwartungen explorieren unterschiedliche Behandlungsoptionen darstellen Vor- und Nachteile gemeinsam nach individuellen Patientenbedürfnissen abwägen Prozess des Informationsverständnisses prüfen Patient Gelegenheit zur Überprüfung der eigenen Entscheidung geben Patienten mit (hypochondrischen) Ängsten scheitern oft am Beipackzettel (aktuelle Reize & kurzfristige Konsequenzen wirken stärker verhaltenssteuernd...) Patienten mit einer Depression haben erhebliche Probleme mit Adherence bezüglich Terminen, Gesundheitsverhalten und Medikamenteneinnahme Frühe Traumatisierung und Vernachlässigung erschweren einen fürsorglichen Umgang mit sich selbst und sind mit schlechterer Adherence und höherer Morbidität / Mortalität verknüpft (Felitti VJ et al., Am J Prev Med, 1998, 14, 245-258) Symptome sind anfangs nur gering ausgeprägt = geringer Leidensdruck Kurzfristiger Benefit der Behandlung oft nicht auf den 1. Blick erkennbar Kurzfristige Konsequenzen wirken stärker verhaltenssteuernd als langfristige meist sind lebenslange Verhaltensänderungen erforderlich. beschäftigt sich mit der Bedeutung menschlichen Verhaltens für die Entstehung, Aufrechterhaltung, Prävention, Heilung und Rehabilitation von Erkrankungen. macht das in der empirischen Psychologie und Verhaltenstherapie gewonnene Wissen über die Möglichkeiten, Menschen bei Verhaltensänderungen zu unterstützen, für die Medizin nutzbar. Ideales Anwendungsfeld: Psychosomatische Grundversorgung und chronische Erkrankungen, bei denen Verhaltensbezogene Faktoren bedeutsam sind. Hilfe dabei, Gesundheitsproblem zu verstehen Information über den Verlauf Information über Untersuchungsergebnisse Information über NW von Medikamenten Information, was sie tun können, um den Verlauf zu beeinflussen (Langewitz et al., 1998, Psychosom Med 60: 268-276) Patienten würden durchschnittlich 66 Minuten mehr Wartezeit in Kauf nehmen für einen Arzt, der ihnen zuhört (Scott et al., Social Science & Medicine 2003; 56:803–814) Ein den Patienten einbeziehender Gesprächstil verbessert Adherence, Patientenzufriedenheit und Zufriedenheit des Arztes (Langewitz, 2005) Warten (Pausen zulassen) Wichtige Aussagen des Patienten wiederholen Spiegeln (= rückmelden von Emotionen („Sie wirken sehr beunruhigt, wenn Sie darüber berichten...“) Zusammenfassung am Ende von Gesprächsabschnitten Pre-Contemplation Contamplation Action Planing Action Maintenance Relapse (Sorglosigkeit) (Nachdenken) (Vorbereitung) (Verhaltensänderung) (Aufrechterhaltung) (Was tun bei Rückfall?) Pre-contemplation Contemplation Termination Relapse Preparation Maintenance Action Pre-Contemplation Aufbau kognitiver Dissonanz, Schaffen von Problembewußtsein, Informationsvermittlung, individuell formulierte Empfehlung, Verhalten zu ändern Contemplation Abwägen von für & wider, Informationsvermittlung, motivierende Gesprächsführung Preparation Information über geeignete Strategien, Auswahl einer Methode, Konkrete Verabredung Action Durchführung des Plans (z. B Ernährungsumstellung, Nordic-Walking-Kurs, Nichtraucher-Seminar ...) Verstärkung (Lob), engmaschige Konsultation Maintenance Verstärkung, Konsultationshäufigkeit zurückfahren (Selbstmanagement), weitere Unterstützung anbieten Relapse Pat. ermutigen, möglichst schnell Kontakt aufzunehmen, keine Vorwürfe machen, Schadensbegrenzung Ist - Zustand Ziel - Zustand 1. Patient hält den Ist-Zustand für unproblematisch („mir geht es doch gut; brauche was zum Zusetzten...“ 2. Patient hält den Ziel-Zustand für nicht erstrebenswert („...dann habe ich keine Lebensqualität mehr...“) 3. Patient hält das Ziel für nicht erreichbar („ich habe schon so viele Diäten ausprobiert...“) die positiven Aspekte der gegenwärtigen Situation nicht aufgeben möchten die negativen Aspekte einer Veränderung nicht in Kauf nehmen möchten oder keine Vorstellung von einem Zielzustand haben oder weil sie zwar Veränderungsbedarf sehen, sich diese Veränderung aber nicht zutrauen stärker verhaltenssteuernd wirkt, was gesagt wurde, nicht was gehört wurde! Argumentiert der Arzt permanent für die Veränderung, drängt er den Patient in die Gegenposition. Alternative: Change talk induzieren, d. h. den Patienten dazu bringen, für die Veränderung zu argumentieren. Was könnte aus Ihrer Sicht für eine Verhaltensänderung sprechen? Was könnten gerade Sie von einer Verhaltensänderung für Vorteile haben: - jetzt schon - langfristig? Was glauben Sie ist Ihr persönliches Risiko, wenn Sie nichts ändern? Wenn Sie jetzt noch nicht zu einer Änderung bereit sind – was könnte der richtige Zeitpunkt sein? Warum gerade dann? Wichtig ist, den Patienten seine eigenen Werte formulieren zu lassen und ihn dann zu fragen, wo das bisherige Verhalten diesen widerspricht, z.B. : Autonomie vs. Abhängigkeit Gesund leben Genießen Fit & leistungsfähig sein Für die Familie da sein .... wenn der Patient sich die Verhaltensänderung nicht zutraut, sollte der Arzt ihm nicht Selbstvertrauen einreden („Sie schaffen das doch!“) Alternative: Confidence talk induzieren, d. h. den Patienten dazu bringen, über seine Ressourcen zu sprechen: „Ist es Ihnen schon einmal gelungen, eine ungünstige Angewohnheit zu ändern? Wie haben Sie das geschafft?“ „Bei welcher der möglichen Änderungen geben Sie sich die beste Chance, es zu schaffen? Warum gerade hier?“ In Deutschland erleiden 12% der Männer und 20% der Frauen in ihrem leben mindestens eine depressive Episode. Punktprävalenz 6,3 % der erwachsenen Bevölkerung Mittleres Erkrankungsalter 32 Jahre, höchste Prävalenz > 65. Lebensjahres Nach WHO & Weltbank ab 2020 nach KHK „teuerste“ Erkrankung schwere, mittlere und leichte depressive Episode ( einzeln oder als Teil einer rez. depressiven oder bipolaren Störung F32.x/ F33.x) Dysthymie als schleichend (> 2 Jahre) verlaufende Depression mit geringerer Symptomintensität (F 34.1) Anpassungsstörung als depressive Reaktion auf belastendes Lebensereignis (F43.2) Mindestens fünf Symptome während eines Zeitraumes von mindestens zwei Wochen gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit verminderter Appetit, Gewichtsverlust, Schlafstörungen, Verminderung des Antriebs, erhöhte Ermüdbarkeit, Schuldgefühle, Konzentrationsstörung, Suizidgedanken /-handlungen, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, deutlicher Libidoverlust 896 Patienten nach Myokardinfarkt werden ein Jahr nachbeobachtet: 37 kard. Todesfälle, 48 nichtletale kard. Ereignisse BDI 10 Kard. Todesfälle Arrhythmien Re-Infarkt harte Events ges. ja=290 7.6% 4,5% 8,3% 13,1% nein=606 2,5% 1,5% 5,3% 7,1% Metanalyse von Anderson et al., 2003 (23 kontr. Studien): 9% „major depression“ bei Diabetikern, 5% in der Normalbevölkerung; 26,1% vs. 14,4% haben auffällige Fragebogenwerte Kruse et al. (2003) bestätigen diese Ergebnisse für den deutschen Sprachraum Kein Unterschied zwischen Typ I und II-Diabetes Studien, die statt klinischen bevölkerungsrepräsentative Stichproben untersuchen, fanden eine höhere Prävalenz nur bei Diabetikern mit Folgeerkrankungen. Keine Evidenz für Depression als RF für Typ IDiabetes (aber Hinweise auf erhöhte Streßbelastung und Traumatisierung in der Familie als RF; Sepa et al., 2005) Erhöhtes Risiko (1,4 - 2,3) v. a. für depressive Männer, einen Typ II-Diabetes zu entwickeln Depression steigt an nach schweren Hypoglykämien, Umstellung auf Insulin und Auftreten von Folgekomplikationen. Höhere PTB-Inzidenz bei Diabetikern als in der Normalbevölkerung (Goodwin & Davidson, 2005) Gehäuft gewalttätige und sexuelle Übergriffe in der Kindheit von Typ-II-Diabetikern (Felliti et al., 1998, 2002) Vermutete Pathomechanismen: - Streßinduzierte Störung der HHN-Achse - Reduktion innerer Anspannung durch Essen, Alkohol und Rauchen Diabetes mellitus Mort.-Risiko (7Jahre) ohne Depression mit subklinisch erhöhter Depressivität 1,9 mit Dysthymie/ minor depression 4,9 mit Major Depression 4,6 2,6 Deutlich erhöht war bei depressiven Diabetikern auch das Risiko für Folgekomplikationen wie Retinopathie, Mikro- und Makroangiopathie. Hyperkortisolismus durch Aktivierung der HHN-Achse bei Depression Aktivierung von Entzündungsmediatoren (IL6, TNF-A) bei Depression, diese dämpfen die Insulinreaktion der Zelle Verminderte Herzratenvariabilität sowohl bei Diabetes als auch bei Depression Aktivierung des Gerinnungssystems bei Depression erhöhte Depressivität => schlechtere BZ-Einstellung (Metaanalyse von Lustman et al., 2000, Fehm-Wolfersdorf 2009) Schlechtere Medikamnenten- und Ernährungscompliance bei Typ-II-Diabetes (Ciechanowski, 2000) Schlechteres Ergebnis in Programmen zur Gewichtsreduktion (Marcus et al., 1992) Mehr Nikotinabusus, weniger körperliches Ausdauertraining (Schmitz et al., 2003, 2004) Diabetiker mit depressiven Symptomen haben signifikant mehr AU-Tage sind bei gleicher Stoffwechsellage stärker durch körperliche Symptome belastet verursachen um 86% höhere (v. a. indirekte) Gesundheitskosten als Patienten ohne Komorbidität (Goldney et al., 2004, Hanninen et al., 1999, Egede et al., 2004, Ciechanowski et al., 2000). depressive Patienten eher selten ihre Emotionen zeigen, im Gegensatz zu ängstlichen Patienten eher selten durch ständiges Fragen „nerven“, sich häufig in ihr Zimmer zurückziehen und den Stationsablauf wenig stören Erfahrene Orthopäden schätzen 125 konsekutive Patienten hinsichtlich psychischer Belastung ein. Es folgt eine strukturierte Nachbefragung 96% Spezifität bei der Erkennung nicht belasteter Patienten. 26% Sensitivität bei der Erkennung psychisch belasteter Patienten HADS-D = Hospital Anxiety and Depression Scale, dt. von Hermann-Lingen et al., Sensitivität und Spezifität etwa 80%, 14 Items, Angst und Depressivität. Zeitaufwand 2 - 5 Minuten aber: eher Überschätzung der Prävalenz psychischer Störungen Alternative: semistrukturiertes Interview Zeitaufwand 5-10 Min. 1. 2. Litten Sie während des letzten Monats unter Gefühlen von Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung oder Depression?” Waren Sie während des letzten Monats interesselos und freudlos auch für Dinge, die Ihnen gewöhnlich Spaß machen?“ Werden beide Fragen mit „NEIN“ beantwortet, kann eine Depression mit 96%-iger Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 10% aller Depressiven haben konkrete Suizidpläne 10-15% aller Patienten mit einer rez. Depressiven Störung versterben am Suizid, Suizide kommen aber auch bei allen anderen depressiven Störungen vor. Das höchste Suizidrisiko haben alleinstehende Männer > 65 und Patienten nach Entlassung aus stat. Behandlung Die Mehrzahl der Betroffenen hatte in den Tagen zuvor Hilfe im med. System gesucht. Suizidalität offen erfragen/ansprechen! Als evidenzbasierte Therapie der Depression stehen sowohl - Psychotherapie (Verhaltenstherapie, IPT, psychodyn. Kurztherapie) - Antidepressiva und - Ausdauertraining zur Verfügung. Für die Komorbidität von Diabetes & Depression konnte in ersten Studien die Wirksamkeit von SSRI und verhaltensmedizinischen Interventionen nachgewiesen werden (Fehm-Wolfersdorf, 2009). Trizyklische Antidepressiva verschlechtern die Stoffwechselsituation und sind nicht empfehlenswert. SSRI sind eher stoffwechselneutral, evtl. auf Hypoglykämie achten! Kurzzeit-VT (Depressionsbewältigung und Selbstmanagement) führte in einer kontrollierten Studie zu einer besseren Stoffwechselsituation (Lustman et al.,1998) Individualisierte Schulungsprogramme bessern Depressivität und Stoffwechsellage (Kulzer et al., 2001) Depression kann gezielt behandelt und die Lebensqualität hierdurch verbessert werden Kognitive Verhaltenstherapie kann (wenn sie diabetesspezifisch angepasst ist) auch die Stoffwechselsituation verbessern Verhaltensmedizinische Patientenschulungen haben sich in Therapie und Prävention (z. B. PRAEDIAS, Hermanns et al., 2011) bewährt Zur Prävention der Depression sind soziale Netzwerke (z. B. Selbsthilfegruppen) und körperliches Ausdauertraining geeignet! vertrauensvolle Arzt-Patient-Kommunikation hinreichendes Diabetesspezifisches Wissen günstige soziale Gegebenheiten (v. a. soziale Unterstützung) emotionales Wohlbefinden und Motivation zur Selbstfürsorge Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Bereitschaft zur Veränderung. G. Fehm-Wolfersdorf: Diabetes Mellitus. Reihe Fortschritte der Psychotheapie, Hogrefe, 2009 S. Herpertz et al.: Evidenzbasierte Leitlinie „Psychosoziales und Diabetes mellitus“ von DDG und DKPM S. Herpertz & V. Köllner: Themenheft Gesundheitsverhalten, Psychotherapie im Dialog; Thieme, 2008 J. Kruse et al.: Review: Diabetes mellitus und Depression. Z Psychosom Med Psychother 2006, 52: 289-309 V. Köllner & M. Broda (Hrsg.): Praktische Verhaltensmedizin, Stuttgatrt: Thieme, 2005