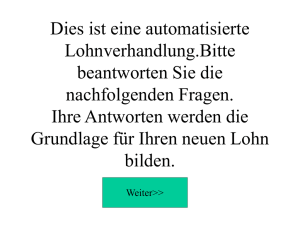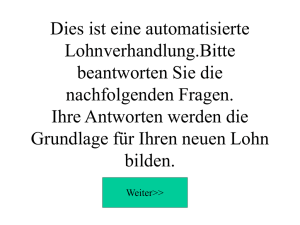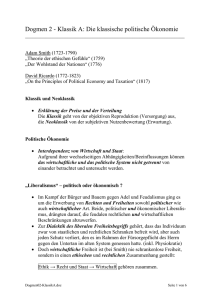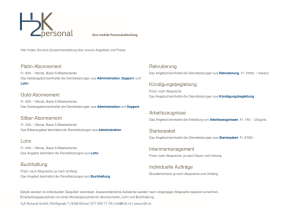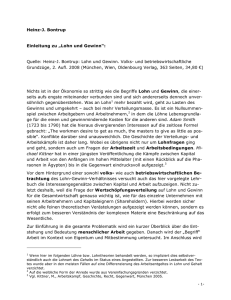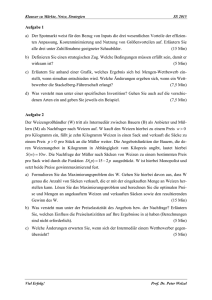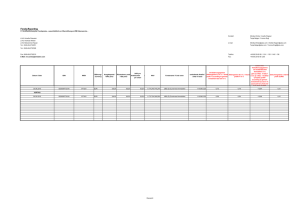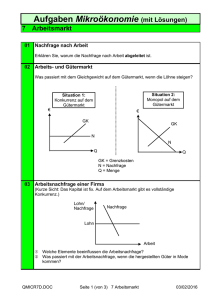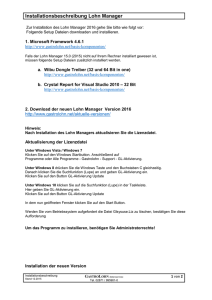Etwas Ökonomie - karl
Werbung

Karl Betz Etwas Ökonomie Teil 1: Lohn. Preis, Profit Berlin 2004 Inhalt S. I Inhalt Teil 1 Wie entstehen Preise?: Lohn, Preis, Profit ........................................................................ 1 Aussagen, die nicht vom theoretischen Ansatz abhängen ............................................. 2 Das Modell ............................................................................................................ 5 Exkurs: Wahl der Technik .................................................................................. 10 Reallohn und Nominallohn ................................................................................. 13 Profitrate und Zinssatz ........................................................................................ 16 Resümee .............................................................................................................. 19 Drei Wert­ und Verteilungstheorien ............................................................................ 20 Die klassische Variante: Wert der Ware Arbeitskraft ......................................... 20 Wert­ und Verteilungstheorie ..................................................................... 20 Reallohn und Nominallohn ........................................................................ 22 Profitrate und Zinssatz ............................................................................... 24 Tendenzieller Fall der Profitrate? ............................................................... 25 Wer trägt die Steuern? ................................................................................ 26 Die neoklassische Variante: Vollbeschäftigung ................................................. 27 Der Arbeitsmarkt ........................................................................................ 27 Wert­ und Verteilungstheorie ..................................................................... 30 Reallohn und Nominallohn ........................................................................ 32 Tendenzieller Fall der Profitrate? ............................................................... 33 Profitrate und Zinssatz................................................................................ 34 Wer trägt die Steuern? ................................................................................ 34 Die keynesianische Variante: Geld regiert die Welt ........................................... 35 Wert­ und Verteilungstheorie ..................................................................... 36 Tendenzieller Fall der Profitrate? ............................................................... 38 Profitrate und Zinssatz ............................................................................... 39 Reallohn und Nominallohn ........................................................................ 39 Wer trägt die Steuern? ................................................................................ 41 Resümee: Löhne, Preise, Profite, Produktivität .................................................. 41 Verzeichnis der Abbildungen Abb. 1 Lohn­Profit­Relation ............................................................................................ 13 Abb. 2: Wahl der Technik ................................................................................................. 14 Abb. 3: Arbeitsschutzbestimmungen ................................................................................ 15 Abb. 4: Lohn­Profit­Relation in der Klassik ................................................................... 22 Abb. 5: Marktdiagramm ................................................................................................... 27 Abb. 6: Probleme bei der Findung des Gleichgewichts ................................................. 28 Abb. 7: Arbeitsmarktdiagramm ....................................................................................... 30 Abb. 8: Verteilungstheorie der Neoklassik ...................................................................... 31 Abb. 9: Lohn­Profit­Relation bei Keynes ......................................................................... 37 Wie entstehen Preise? Lohn, Preis, Profit Es gibt drei sehr unterschiedliche große Preistheorien: die der Klassik, der Neoklassik und die von Keynes.1 Wirklich bedeutsam ist heute nur der neoklassische Ansatz – die neoliberale Theorie. Die anderen beiden Ansätze werden nur von wenigen Menschen, im wesentlichen Dinosaurieren, die noch aus der Zeit der Studentenbewegung übrig geblieben sind, vertreten und diese werden jetzt so nach und nach biologisch abgebaut, verschwinden von den Universitäten, weil sie in Rente gehen. Trotzdem möchte ich in der Folge alle drei Theorien abhandeln. Dies deshalb, weil dies die drei möglichen Varianten sind, mit denen man Preise, Löhne und Profite theoretisch sauber erklären kann. Eine vierte, noch unentdeckte Möglichkeit kann es aus logischen Gründen nicht geben – ich kann höchstens noch mit „ historischen Preisen“ arbeiten, also letztlich einfach sagen, die Preise sind halt so wie sie sind, oder auf eine Preistheorie ganz verzichten – aber das sind eben keine Erklärungen, sondern ein Zurückweisen der Frage. Wenn man also eine Kritik der herrschenden Theorie versucht, ist man auf eine der beiden anderen Varianten angewiesen (oder man verzichtet ganz auf eine Preistheorie) und dieser Sachverhalt macht Klassik und keynesianische Theorie wichtig, auch wenn sie derzeit kaum noch Vertreter haben. Hinzu kommt natürlich die zusätzliche Motivation, daß ich selbst ein Dinosaurier bin, ein Anhänger der kleinsten und unbedeutendsten der drei Schulen: einer an Keynes angelehnten Preistheorie. Man könnte jetzt der Lehrbuchfolkore aufsitzen und sagen: Die Neoklassik bestimmt die Preise über Angebot und Nachfrage, die Klassik bestimmt sie über die Produktions­ 1 Vertreter der Klassik waren im 18. und 19. Jahrhundert: Adam Smith, David Ricardo, John Stewart Mill. Als heute lebende Vertreter könnte man z.B. Pasinetti in Italien oder auch Schefold in Frankfurt nennen. Neoklassiker ist heute praktisch jeder – diese Leute verstehen sich schon gar nicht mehr als ökonomische Schule, sondern nur mehr als „ die Ökonomie“, der ökonomische main stream. Dies gilt nicht zuletzt auch für die meisten Neukeynesianer (Blanchard, Mankiw, Romer; einzig bei Solow und Stiglitz würde ich hier ein Fragezeichen setzen. Ferner bei Hahn, aber der wird dieser Gruppe sowieso nicht zugerechnet.) die sich halt nur stärker als andere darum bemühen, kurzfristige Abweichungen zu dem auch von ihnen akzeptierten neoklassischen Gleichgewicht zuzulassen. Begründer der heutigen neoklassischen Preistheorie war (der Sozialist) Leon Walras (1870). Hinweise zu einer keynesianischen Preistheorie finden sich bei Keynes (überrascht?, in jüngerer Zeit bei Rotheim). Systematischer daran weiter gearbeitet hat Hajo Riese in Berlin, der mittlerweile emeritiert ist und an dessen Institut ich arbeiten durfte. Falls irgend jemand den Namen Marx in der Aufzählung vermissen sollte: Marx gehört zur Klassik. Er selbst wies darauf hin, daß das Neue am „ Kapital“ nicht die Erklärung der Höhe der Preise, der Löhne etc. sei, sondern daß es darin bestehe, daß er die grundsätzlichere Frage gestellt habe, warum es überhaupt so etwas wie Preise, Löhne etc. gibt – sinngemäß: warum dieser Inhalt (die gesellschaftliche Arbeit) jene Form (Preis, Geld, Kapital ...) annimmt. Auf diese Frage hat er meines Erachtens in der Tat die richtige Antwort gegeben: Es sind dies die entfremdeten Vergegenständlichungen eines gesellschaftlichen (Produktions­) Verhält­ nisses. Nur ist dies nicht die Fragestellung dieses Papiers, daher gehe ich auf diesen Zusam­ menhang nicht ein. Lohn, Preis, Profit S.2 bedingungen etc. Nur: das trifft den Sachverhalt nicht. Auch die Neoklassik kennt die Produktion. Bei produzierbaren Waren steht die Produktion (und stehen damit die Produktionsbedingungen) hinter dem Angebot – und wenn man dem Modell genug Zeit läßt, damit die produzierten Mengen sich an die Nachfrage anpassen können, bestimmen auch hier die Angebotsbedingungen die Preise praktisch alleine. Und auch die Klassiker wissen, daß kurzfristige Schwankungen der Nachfrage (oder des Angebots: Mißernten) einen Einfluß auf die Preise haben (sowohl bei Mill als bei Malthus findet man längere Abschnitte zu diesem Thema, auch Marx erwähnt dies an verschiedenen Stellen des „ Kapital“), nur interessieren sie sich nicht weiter dafür, weil es ihnen um langfristige Entwicklungen geht und sie diese Abweichungen nur als Störungen begreifen, von denen sie bewußt abstrahieren. Daher will ich, um die Theorien so vergleichbar wie nur irgend möglich zu machen – und so die Unterschiede besonders klar herausarbeiten zu können –, in einem Rahmen diskutieren, mit dem alle drei Theorien leben können – wenn er für die Neoklassik auch nur einen Teil der Zustände beschreibt, die sie als Gleichgewicht modellieren kann. Dieser theorieunabhängige Rahmen soll zunächst vorgestellt werden und es werden einige Folgerungen aus ihm gezogen, die für alle Theorieansätze verbindlich sind. Erst anschließend soll dann gefragt werden, wie die drei großen Schulen in diesem Rahmen Löhne, Preise und Profite erklären. Aussagen, die nicht vom theoretischen Ansatz abhängen Ich unterscheide zunächst einmal zwischen Ungleichgewicht und Gleichgewicht – 2 Ungleichgewicht: Nehmt an, die globale Erwärmung setzt schlagartig und unerwartet ein. Dann steigt die Nachfrage nach Speiseeis drastisch und solange keine neuen Fabriken gebaut worden sind, können die Preise explodieren. Vielleicht nicht in den Supermärkten, weil die Hersteller eventuell aus Gründen der langfristigen Marketingstrategie eine Preispolitik betreiben, die keine starken Preisschwankungen vorsieht. Aber dann sind die Kühlregale leer gekauft und Ihr kriegt das Zeug nur noch teuer auf dem Schwarzmarkt (Ihr kennt den Effekt bei Konzertkarten) – und dieser Schwarzmarktpreis ist dann der eigentliche Marktpreis, denn der Preis ist der Geldbetrag, für den ich ein Produkt auch wirklich bekommen kann. Mittelfristig werden dann aber zuerst Überstunden gefahren und später zusätzliche Eisfabriken gebaut werden und der Preis wird sich wieder auf seinen „ Normal­“ bzw. Gleichgewichtspreis zurück bewegen. 2 Damit unterscheide ich mich von formal anspruchsvoller Neoklassik, die auch Prozesse der Anpassung an die Preise des langfristigen Gleichgewichts noch als Gleichgewichtsprozesse modellieren würde und stehe einem klassisch­marxistischen Gleichgewichtsbegriff näher (vgl. Weintraub). Ich halte das für leichter verständlich und es hat inhaltlich keine Konsequenzen, weil ich sowieso nur im Kontext langfristiger Gleichgewichte argumentieren werde und diese (stationary oder steady state) Gleichgewichte – jedenfalls für die Preistheorie – in allen Ansätzen ähnliche Eigenschaften haben (Hahn 1982). Lohn, Preis, Profit S.3 Umgekehrt: Nehmt an, es bricht unerwartet eine Eiszeit aus. Dann geschieht das Umgekehrte: Die Produktionskapazitäten stehen ungenutzt 'r um, die Kaufhäuser sitzen auf ihrem Eis und der Preis fällt, um die Lager zu leeren. Irgendwann ist dann aber die Produktion so weit geschrumpft, daß das wenige Eis, das noch produziert wird, wieder zu kostendeckenden Preisen verkauft werden kann, wir also wieder mehr oder weniger bei einem Gleichgewichtspreis angelangt sind. Gleichgewicht ist hier nix sonderlich Geheimnisvolles, es ist einfach ein Preis, der, solange es keine neuen äußeren Einflüsse gibt (veränderte Bedürfnisse, veränderte Produktionsbedingungen), keine Tendenz mehr hat, weiter zu steigen oder zu fallen. Über das Ungleichgewicht habe ich nix zu sagen, in ihm fällt oder steigt der Preis halt, und wie genau, hängt von sehr willkürlichen Annahmen ab. Alles was folgt, bezieht sich auf das Gleichgewicht – auf das Schwankungszentrum, um das herum die Marktpreise schwanken können. Ein Marxist würde dies vielleicht die „ Werte“ nennen, in der üblichen ökonomischen Terminologie wird zwischen Werten und Preisen nicht unterschieden und der Begriff Wert bezeichnet etwas anderes (Wert = Preis mal Menge). Also, neue Frage: Was bestimmt die Gleichgewichtspreise? Wenn irgendwelche Dinge nicht (re)produzierbar sind – Land, alte Meister, Schall­ platten mit einer Widmung von Jim Morrsion – werden die Preise über Seltenheit (wie viel gibt's von dem Zeug) und Nachfrage, (kaufkräftiges) Bedürfnis (wie viele Leute sind bereit, wie viel dafür zu zahlen), bestimmt, aber das interessiert nicht weiter, denn perspektivisch wollen wir ja auf Löhne und Beschäftigung hinaus, also interessieren nur die Preise produzierbarer Güter. Also, noch weitere Einschränkung der Frage: Was bestimmt die Gleichgewichtspreise produzierbarer Güter? So, nach dem jetzt erstmal die Frage so zurechtgestutzt wurde, daß sie sich beantworten läßt, führe ich ein kleines Denk­Instrument, ein Mini­Modellchen, ein, mit dem sie diskutiert werden kann. Dieses Modell ist noch völlig theorieunabhängig – es ist eine radikal vereinfachte Version von Sraffa (1960), dessen Büchlein3 auf Deutsch übrigens zuerst in der DDR erschien und zunächst als Formalisierung von Marx gefeiert wurde. Die unterschiedlichen ökonomischen Theorien kommen dann zum Zuge, wenn man das Modell interpretiert. Das Modell Nehmt an, ein Gut werde mittels Arbeit und mit sich selbst als einzigem Rohstoff hergestellt. Beispielsweise werde Weizen mit Arbeit und mit Weizen als Saatgut erzeugt. Ein Produktionsverfahren, eine Technik, kann dann beschreiben werden wie ein Kochrezept: Man gebe k Kilo Weizen und a Liter Arbeit in einen Topf (den 3 Warenproduktion mittels Waren. Lohn, Preis, Profit S.4 Produktionsprozeß) und heraus kommt, nach hinreichend langem Köcheln, das fertige Gericht, der Produktionsausstoß, eine Portion Weizen : Also: Einsatzfaktoren ==> Produktionsausstoß k * Weizen, a * Arbeit ==> 1 Weizen Das Modell ist zu simpel? Nein, denn es ist beliebig erweiterbar. Daß es nur ein Gut enthält, ist kein Problem: Statt eines einzigen Gutes können auch jede Menge Güter in eine Produktion als Einsatzfaktoren eingehen, nur muß ich dann halt auch die Produktionsprozesse betrachten, in denen sie hergestellt werden. Statt eines Gutes habe ich dann eine ganze Tabelle, eine Input­Output­Matrix, wie sie z.B. in den USA während des zweiten Weltkrieges für die Planung der Kriegsproduktion verwandt wurde.4 Hier ist nur Weizen drin und kein Kapital, keine Maschinen ... Ändert nix, auch die kann man über eine Erweiterung der Systems mit 'rei nnehmen. Jetzt müssen nur noch die Mengen richtig angegeben werden – sage: ich brauche 0,25 Sack Weizen und vier Einheiten Arbeit, um einen Sack Weizen herzustellen: 0.2 * W + 4 * A ==> 1 * W Diese Einschränkung auf eine bestimmte Technik – 4 Einheiten Arbeit und 0,2 Sack Weizen ergeben einen Sack Weizen – ist nicht wichtig. Ich werde später kurz andeuten, daß man durchaus auch unterschiedliche Verfahren zulassen kann – es kann also auch arbeitsintensivere Techniken geben: Es wird mehr Arbeit aufgewandt und es ist weniger Saatgut erforderlich, z.B. könnte man jemanden anstellen, um Saatkrähen zu verscheuchen. Oder „k apitalintensivere“ 6 Technologien: es wird, um einen Sack Weizen 4 Dafür war das Konzept ursprünglich von Leontief (unabhängig von und zeitgleich mit Sraffa) entwickelt worden. Eine Kriegswirtschaft bedeutet in der Regel (solange der Krieg nicht im eigenen Territorium stattfindet) Vollbeschäftigung, ja, oft sogar Überbeschäftigung. Daher ist die Frage wichtig: Wie viele Ressourcen und wie viel Arbeit muß ich aus anderen Bereichen abziehen, wenn ich z.B. ein Kriegsschiff bauen will. Denn ich brauche ja nicht nur den Stahl und die Maschinen die direkt im Bau des Kriegsschiffs eingesetzt werden, sondern ich brauche auch die Maschinen und Rohstoffe, die erforderlich sind, um die Maschinen und Rohstoffe zu produzieren, die ich in der Werft einsetze. Und ich brauche die Maschinen und Rohstoffe, die erforderlich sind, um die Maschinen und Rohstoffe zu produzieren, die ich haben muß, um die Maschinen und Rohstoffe und Rohstoffe zu produzieren, die ich in der Werft einsetzen will. Ich denke, das Problem ist deutlich geworden: Statt einer klaren Antwort kriege ich einen infiniten Regress. Dieser läßt sich mit Hilfe der Input­Output­Matrix (genauer: mit deren Kehrwert, der Inversen der Input­Out­Matrix, auch Leontief­Inverse genannt) auflösen. 5 Es ist klar, daß man sinnvoller Weise annehmen sollte, daß weniger Weizen in die Produktion eingebracht wird, als von dieser hergestellt wird, sonst ist irgendwann der Weizen alle und es kann nicht mehr produziert werden. 6 Man kriegt dann allerdings bei mehreren Gütern ein systematisches Problem: Ich kann Kapitalgüter nicht addieren, ohne sie zuvor mit ihren Preisen mal genommen zu heben. Diese aber ändern sich gerade, wenn ich z.B. die Löhne verändere. Ich gehe hier nicht weiter darauf ein, aber diese Tatsache bedeutet, daß man z.B. nicht sicher sagen kann, daß eine Absenkung Lohn, Preis, Profit S.5 zu erhalten, mehr ausgesät, aber weniger Arbeit eingesetzt – z.B. nicht bewässert, so daß man eine höhere Menge Saatgut braucht, um auf die gleiche Ernte zu kommen. Es mag auch Technologien geben, bei denen man von beidem, sowohl von Weizen als von Arbeit, mehr einsetzen muß, um einen Sack Ernte zu erreichen. Aber solche Technologien sind ganz sicher zu teuer und daher nur noch für das Museum interessant. In der ökonomischen Anwendung werden sie ausgerottet, im Extremfall, indem die Firmen, die sie anwenden, pleite gehen, weil sie zu hohe Kosten haben. Um das Ergebnis gleich allgemeiner zu kriegen, werde ich im Folgenden statt konkreter Zahlen Variablen verwenden. Es steht k – für die Menge an Korn, die ausgesät werden muß, um eine Einheit Weizen zu ernten und a – steht für die Menge an Arbeitseinheiten, die eingesetzt werden müssen, um eine Einheit Weizen zu ernten Damit sind bereits zwei Größen im Modell, denen man gelegentlich begegnet: Arbeitsproduktivität: Wenn a die Menge an Arbeit ist, die man braucht, um eine Einheit Weizen herzustellen, dann ist 1/a die Menge an Weizen, die mit einer Einheit Arbeit hergestellt werden kann. Dies ist die Arbeitsproduktivität. Im Beispiel war a = 4, es waren 4 Einheiten Arbeit nötig, um eine Einheit Weizen zu erzeugen. Also war die Arbeitsproduktivität gleich ¼ bzw. 0,25 [Weizen/Arbeit]. Bei der Arbeitsproduktivität, von der man gelegentlich in den Zeitungen liest, werden alle Güter und Dienstleistungen, die in einer Ökonomie hergestellt wurden, zu einem Aggregat zusammengefaßt,7 dem (Brutto)Nationalprodukt (in älteren Lehrbüchern heißt das noch Sozialprodukt) und durch den Arbeitsaufwand, entweder die Zahl der Beschäftigten oder durch die geleisteten Arbeitsstunden (Stundenproduktivität), geteilt. Letztere ist das bessere Maß, weil bei ihr der Effekt von Arbeitszeitverkürzungen herausgerechnet ist. Wenn man von technischem Fortschritt liest, ist in der Regel diese Entwicklung gemeint – der jährliche Zuwachs der Menge an Gütern, die mit einer Einheit Arbeit hergestellt werden können.8 Das Wachstum der Arbeitsproduktivität hängt zusammen mit der Löhne dazu führt, daß mehr Arbeit und weniger Maschinen in der Produktion eingesetzt werden. Alle Ökonomen, die behaupten, niedrigere Löhne würden über eine arbeitsintensivere Technik zu höherer Beschäftigung führen, lügen. Und sie wissen dies, denn in ihren eigenen Lehrbüchern kennen sie diesen Effekt. Aber überspannt das Argument nicht: Man kann angebotsorientiert schon begründen, warum Lohnsenkungen die Beschäftigung erhöhen sollten. Nur halt nicht so. 7 Im Kern werden alle produzierten Mengen an Gütern und Dienstleistungen mit ihren Preisen multipliziert, die Beträge addiert und dann wird noch die Inflationsrate herausgerechnet. (Reales Nationalprodukt oder auch Nationalprodukt zu konstanten Preisen.) Hier schleichen sich Fehler ein, das sogenannte Indexproblem, aber diese sind nicht zu vermeiden und müssen daher in Kauf genommen werden. Darauf einzugehen, würde hier zu weit führen. 8 Arbeitssparender technischer Fortschritt ist definiert als Absenken von a, also als Reduktion des zur Produktion einer Einheit Output erforderlichen Arbeitseinsatzes bei konstant Lohn, Preis, Profit S.6 erstens dem technischen Fortschritt, der auf Grund der Wissenschaftsentwicklung sowieso stattfindet und zweitens hängt er noch von der Wachstumsrate9 ab. Dieser Zusammenhang („ Verdoorns Gesetz“) ist von Land zu Land und von Zeitraum zu Zeitraum unterschiedlich, aber er erweist sich doch für längere Perioden als recht stabil. In der Bundesrepublik etwa stieg die Arbeitsproduktivität in den letzten 10 bis 15 Jahren pro Jahr um ca. ein Prozent plus der Hälfte der Wachstumsrate des National­ produkts: Zuwachs der Arbeitsproduktivität = 1% + 0,5 * Wachstumsrate. Ich komme im zweiten Papier (Abschnitt: technologische Arbeitslosigkeit?) auf diesen Zusammenhang zurück. Kapitalproduktivität: Analog zur Arbeitsproduktivität ist die Kapitalproduktivität darüber definiert, wie viel Kapital man einsetzen muß, um eine Einheit Produktions­ ausstoß zu erzeugen. Im Beispiel läge also die Kapitalproduktivität bei 5 (= 1/k = 1/0,2). Kapitalsparender technischer Fortschritt liegt dann vor, wenn man, bei gleichem Arbeitseinsatz, mit weniger Einsatzgütern mehr herstellen kann. So, damit ist aus dem einfachen Kochrezept erstmal alles an Beziehungen heraus gekitzelt. Um uns langsam mal in Richtung der Frage nach den Preisen zu bewegen, müssen wir nun noch die Preise, Löhne und den Gewinn in das Modell einbauen. Weizen habe den Preis p, der Lohnsatz pro Arbeitseinheit sei w (engl.: wages). Und den Gewinn geben wir nicht direkt an, sondern als Profitrate (r) (engl: rate of profit) auf das eingesetzte Kapital. Dabei unterstellt man im Allgemeinen, daß die Profitrate nur auf den Wert des Weizens, nicht aber auf die Lohnsumme gezahlt wird, weil der Lohn erst am Ende der Produktionsperiode bezahlt wird, der Weizen aber bereits zu Beginn gekauft – und daher bezahlt – werden muß. Daher steht der Wert des Weizens für den Kapitalwert, die Löhne gehören nicht dazu. Diese Unterstellung wird gemacht, weil sie die Rechnerei bei umfangreicheren System vereinfacht. Sie hat aber keine inhaltlichen Konsequenzen. Also, mit dieser Erweiterung lautet unser System nunmehr: Kapitalwert + Profit auf den Kapitalwert + Lohnsumme = Produktpreis. k * p + r * k * p + w * a = p w * 4 = p oder, mit den konkreten Werten von oben: 0,2 * p + r * 0,2 * p + Laßt uns die Gleichung nochmal zu Fuß durchgehen: p ­ Auf der rechten Seite dieser Gleichung steht der Produktpreis und nicht der Umsatz, weil wir ja von Anfang an ein System betrachtet haben, in dem nur ein Sack gehaltenem Kapitaleinsatz. 9 Die Wachstumsrate ist die jährliche prozentualen Steigerung des Nationalprodukts. Sie wird häufig auch „das Wirtschaftswachstum“ genannt. Lohn, Preis, Profit S.7 Weizen hergestellt wird. Und der Preis von Weizen mal eins ist eben gerade wieder der Preis von Weizen. Linke Seite: k * p – um eine Einheit Weizen zu erzeugen, müssen k (im Beispiel: 0,2) Einheiten ausgesät werden. Also muß der Unternehmer, um produzieren zu können, vor Beginn der Produktion k Einheiten (0,2 Sack) kaufen und die kosten eben k * p; also 0,2 mal den Preis von einem ganzen Sack. r * k * p – das ist der Gewinn, der nach Abzug der Kosten übrig bleibt. Er ist hier definiert als prozentualer Aufschlag (von r Prozent) auf den Kapitalwert (k * p). Oder, weil genau hier wird die weitere Überlegung auch einsetzen: als Verzinsung des Kapitalwerts. w * a – die Kosten pro Arbeitseinheit (der Lohnsatz) multipliziert mit der Anzahl der eingesetzten Arbeitseinheiten sind die Lohnkosten des Unternehmens. Rechte Seite = linke Seite ­ Auf der rechten Seite der Gleichung steht der Erlös aus dem Verkauf. Dieser Erlös wird entweder verwendet für Lohnzahlungen, ersetzt die ursprünglich vorgeschossene Kapitalsumme (k*p) und/oder er erlaubt einen Gewinn (r * k * p).10 Die rechte Seite der Gleichung ist also notwendigerweise genau so groß wie die linke. Der Preis von Weizen, p, ist auf beiden Seiten der Gleichung gleich hoch. Das muß nicht so sein, denn der Weizen wird ja dieses Jahr ausgesät und erst im nächsten geerntet. Und in der Zwischenzeit könnten sich die Preisverhältnisse ja geändert haben. Diese Einschränkung macht das Modell aus Sicht der Neoklassik zu einem Spezialfall, dem „ Produktionspreis­Modell“ , denn die herrschende Theorie kann auch Fälle als Gleichgewichte modellieren, in denen sich die Preisverhältnisse im Zeitablauf ändern. Aber wie oben schon gesagt – dies ist kein prinzipieller Einwand, denn auch diese Modelle schwingen sich, so es nicht immer wieder zu äußeren Einflüssen kommt, die die Entwicklung aus der Bahn werfen, mit der Zeit auf einen Zustand ein, in dem sich die Preisverhältnisse nicht mehr ändern. Das allgemeinere neoklassische Modell konvergiert also zu einem Produktionspreispreismodell. Und deswegen kann in seinem Rahmen auch die Neoklassik diskutiert werden.11 So, aus diesem Ansatz: Kapitalwert + Profit auf den Kapitalwert + Lohnsumme = Produktpreis. 10 Hinweis: Noch habe ich nichts über r angenommen. Es ist also auch noch nicht sichergestellt, daß der Unternehmer überhaupt einen Gewinn macht. Ist der Erlös aus dem Verkauf (rechte Seite) geringer als die Kosten für das Saatgut und die Löhne, dann ist r eben kleiner als Null, das Unternehmen macht einen negativen Gewinn (erleidet einen Verlust). Aber die Gleichung ist nach wie vor erfüllt. 11 Zumal solche Feinheiten bei der Theorie der Wirtschaftspolitik sowieso keine Rolle mehr spielen. Insbesondere Frank Hahn hat immer wieder bewiesen, daß die neoklassischen Ökonomen, wenn sie über gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge reden, ständig Behaupt­ ungen aufstellen, die von einem sauberen preis­theoretischen Ansatz gar nicht gedeckt werden können. Lohn, Preis, Profit k * p + S.8 r * k * p + w * a = p lassen sich durch einfache Umformung zwei Beziehungen herausholen. Einmal kann man sie nach dem Preis auflösen, in dem man den Preis auf eine Seite der Gleichung bringt: p * (1 – k – r * k) = w * a <==> p= 1 ∗w∗a 1−k−r∗k k und a, wie viele Arbeitseinheiten und Saatgut brauche ich pro Sack Korn, sind mir durch den Stand des technischen Wissens vorgegeben. Eine Größe wird durch die Gleichung erklärt (p) also fehlen mir noch r, die Profitrate, und w, der Geldlohnsatz, um den Preis von Korn zu erklären. Wirklich interessant sind allerdings nur die relativen Preise also etwa: Ein Sack Korn kostet doppelt soviel wie eine Einheit Arbeit. Eine Verdopplung aller Preise im Modell (inkl. der Löhne, versteht sich, denn der Lohn ist ja auch ein Preis) hat keine ökonomische Wirkung.12 Daher kann man eine Größe, w oder p, als Einheit wählen (z.B.: w = 1). Zur Erklärung der relativen Preise fehlen daher nicht zwei Werte, sondern nur einer. Darüber, wie dieser fehlende Wert erklärt wird, kann man sinnvoll unter­ schiedlicher Meinung sein – und dies macht den Unterschied in der Preistheorie unterschiedlicher ökonomischer Theorien aus. Damit ist, wie gesagt, noch keine bestimmte Preis­ oder Profittheorie unterstellt. Marx kritisiert z.B. Smith dafür, daß dieser zwei Preistheorien habe – Aufschlags­ und Abzugstheorie des Profits: Lohn + Profit ==> Preis sowie: Preis – Lohn ==> Profit. Diese Theorien sind bereits eine Interpretation der Gleichung, weil in die Gleichung ein Ursache­Wirkungs­Zusammenhang hineingelesen wird (aus = wird ==> gemacht). Die Gleichung, die wir jetzt erarbeitet haben, ist aber noch keine Theorie, denn sie sagt ja noch nichts darüber aus, in welche Richtung sie gelesen werden muß, welche Größen also von ihr erklärt werden und welche die Theorie ihr vorgibt. Weiter kann man die Gleichung so umformen, daß sie den Rahmen für eine Verteilungstheorie liefert, in der das Verhältnis von Löhnen und Profiten erklärt werden kann. Interessant sind in diesem Zusammenhang wieder nur die relativen Preise, denn ich kann, wenn ich irgendwelche Geldlöhne vorgebe, immer noch beliebig hohe Profite erwirtschaften, wenn ich nur die Preise hoch genug ansetzen darf. Und für den Arbeiter ist die Höhe der Geldlöhne ebenfalls egal, er muß wissen, wie viel er sich für seinen Lohn kaufen kann. Ist der Lohnsatz w z.B. 5 und p, der Preis eines Sacks Weizen, ist 10, dann 12 Allerdings Achtung: Ich rede nicht von einer Inflation. Diese kann sehr wohl ökonomische Wirkungen haben. Sondern z.B. von einer Währungsumstellung, wie z.B. dem Übergang vom Alten zum Neuen Franc in Frankreich, bei dem verfügt wurde, daß in Zukunft alle Franc­ Preise durch 1000 zu teilen seien. Schon die Umstellung auf den Euro war etwas anderes, denn hier wurde eine ganz neue Währung eingeführt. Wir haben hier nicht so wirklich viel davon gemerkt, weil der Euro der DM in der Erwartung der Märkte ziemlich ähnlich war, aber z.B. in Italien ist das Zinsniveau dadurch drastisch gesunken. Ohne diese Zinssenkung hätte das Land sein Budgetdefizit nie in den Griff gekriegt. Lohn, Preis, Profit S.9 kann er sich für eine Arbeitseinheit, so er sie am Markt los wird, einen halben Sack Weizen kaufen (w/p = 5/10 = 0,5). Diese Größe, die Kaufkraft des Lohnes, w/p, den Lohn geteilt durch den Preis (bzw., bei vielen Waren, durch das Preisniveau), bezeichnet man als Reallohn. Also, umformen der Gleichung k * p + r * k * p + w * a = p um den Zusammenhang von Profitrate und Reallohn diskutieren zu können: k * p + r * k * p + w * a =p | : p k + r * k + a* (w/p) = 1 | nach w/p auflösen (w/p) * a = 1 ­ k * (1 + r) (w/p) = 1/a – (k * (1+r)) /a w 1 k a 1 w = − ∗1r oder, aufgelöst nach der Profitrate: r= ∗ − −1 p a a k a p Wie schon oben beim Preis: Dieser Ausdruck liefert noch keine Verteilungstheorie – wir kriegen die Verteilung erst dann, wenn wir (mindestens) entweder r oder w/p erklären können. Er liefert aber a) einen Zusammenhang, der definitorisch richtig ist, und dem deshalb keine Verteilungstheorie widersprechen darf. Sowie b) er sagt, was erklärt werden muß, wenn man die Einkommensverteilung erklären will. Und schließlich c) Er liefert eine interessante Beziehung, die Lohn­Profit­Relation (englisch: die factor­price­frontier), die im Hinterkopf zu haben beim Nachdenken über viele Zusammenhänge hilfreich ist. Um diese Lohn­Profit­Relation noch kurz zu diskutieren: Die Gleichung w 1 k = − ∗1r p a a sagt uns, daß, bei bekannter Technik (k und a), die Profitrate nur von der Höhe der Reallöhne abhängt, bzw. daß die Höhe der Reallöhne nur von der Höhe der Profitrate abhängt.13 Als praktisch gerade noch so denkbare Extremfälle können wir einen Lohnsatz von Null nehmen (niemand wird noch Geld zur Arbeit mitbringen) sowie eine Profitrate von Null. (Schließlich kann niemand den Unternehmer zwingen, was zu unternehmen.) 13 Kunststück: Es verdienen ja nur zwei Gruppen an der Produktion: die Bezieher von Lohn­ einkommen und die von Profiteinkommen. Was die eine Gruppe weniger kriegt, muß die andere mehr haben. Aus einem Modell holt man halt nie mehr heraus, als man zuvor an Annahmen in es hineingesteckt hat. Aber trotzdem: Dieser Zusammenhang ist jetzt präziser formuliert und besser diskutierbar als zu Beginn. Lohn, Preis, Profit S.10 Bei einer Profitrate von Null ist der maximale Reallohnsatz, der mit dieser Technik möglich ist: w 1 0,2 = − ∗10 = 0,25 – 0,05 = 0,2 [Sack Weizen pro Arbeitseinheit] p 4 4 also nicht etwa ¼ Sack, weil mit vier Arbeitseinheiten ein Sack Weizen erzeugt wird, sondern etwas weniger, denn es muß ja aus der Ernte noch das Saatgut ersetzt werden, sonst hätte der Unternehmer Verlust gemacht, weil er nach der Ernte weniger Weizen zurück kriegt, als er zur Aussaat zur Verfügung gestellt hat. (r wäre dann negativ und diese Möglichkeit hatte ich ja per Annahme ausgeschlossen). Bei einem Lohnsatz von Null ist die maximale Profitrate, die mit dieser Technik möglich ist, 4 (bzw. : 400%) : 1 0,2 0= − ∗1r 4 4 0,2 1 ∗1r = 4 4 1 4 r= ∗ −1=5−1=4 4 0,2 Abb. 1: Lohn­Profit­Relation r 400% Steigt der Reallohnsatz, so fällt die Profitrate. In diesem speziellen Fall ist der Zusammenhang eine Gerade: r = 4 – 20 * (w/p) Wenn der Reallohn von Null an­ fängt zu steigen, so fällt die Profitrate, beginnend bei 400%, bis sie schließlich – bei einem Reallohnsatz von 0,2 (Sack pro Arbeitseinheit) bei Null anlangt. 0,2 w/p Die Lohn­Profit­Relation muß nicht immer eine Gerade sein. Wenn es um mehr als ein Produkt geht, kann ihr Verlauf auch kurvenförmig sein. Und wenn es mehrere bekannte Produktionsverfahren und mehrere Produkte gibt, kann es einzelne Punkte auf der Kurve geben, an denen bei steigenden Löhnen die Profitrate bei einer nur winzigen Lohnvariation gerade noch so verteidigt werden kann, indem eine andere Technik gewählt wird. Aber • nie können Reallöhne und Profitrate gleichzeitig steigen (es sei denn, es gibt neue Erfindungen, die k und oder a senken) und: • wenn die Reallöhne etwas mehr als nur ein winziges bißchen steigen, muß die Profitrate fallen. Lohn, Preis, Profit S.11 Exkurs: Wahl der Technik Ich hatte oben angedroht, kurz etwas über die Technikwahl zu sagen. Dieser Abschnitt ist für das Verständnis des weiteren Textes nicht erforderlich. Er mag sinnvoll sein, falls einige von Euch die Annahme eines einzigen bekannten Produktionsverfahrens für zu restriktiv halten. In der Abbildung ist zunächst einmal die Lohn­Profit­Relation der Technik abgetragen, die wir bisher diskutiert haben. Dies ist die Gerade, die auch schon in Abb. 1 zu sehen war. Abb. 2: Wahl der Technik r 400% Nun nehme ich mal an, es gebe noch eine andere Technik, deren Lohn­Profit­Relation in Abb. 2 durch die gestrichelte Linie wiedergegeben ist. Ich hatte ja schon gesagt: Bei mehr als einem Produkt muß das keine Gerade mehr sein und weil ich so gleich noch ein zweites Phänomen erläutern kann, nehme ich mal an, es sei eine (hier: konkave) Kurve. 0,2 w/p Wie hilft uns nun diese Zeichnung bei der Frage der Technikwahl? Nun, nehmt an, wir haben irgendein Reallohnniveau. Wenn wir nun diesen Lohn auf der Lohnachse suchen und von diesem Punkt dann senkrecht nach oben schauen, erlaubt die Technik mit der am weitesten von der Lohnachse entfernten Kurve die höchste Profitrate bei diesem Reallohn. Da sie am profitabelsten ist, wird sie gewählt. Umgekehrt: Nehmt an, die Profitrate ist vorgegeben. Dann startet man auf der Profit­Achse und geht so lange nach außen, bis man die am weitesten entfernte Kurve erreicht. Die Technik, zu der sie gehört, erlaubt es, bei dieser Profitrate die höchsten Löhne zu zahlen. Natürlich wählt keine Unternehmerin eine Technik, um die Löhne zu maximieren – aber sie kann ja, solange die Marktlöhne noch niedriger liegen, die Differenz in die eigene Tasche stecken. Beide Methoden kommen auf das gleiche Ergebnis. Die Technikwahl ist also auch noch nicht von einer bestimmten Theorie abhängig. Würde die Lohn­Profit­Relation der zweiten Technik (die gestrichelte Kurve) durchgängig unter oder oberhalb der (durchgezogenen) Geraden (der Lohn­Profit­ Relation der ersten Technik) verlaufen, wäre nur eine der beiden Techniken effizient – egal wie hoch die Reallöhne sind, mit der Technik, deren Lohn­Profit­Relation weiter außen verläuft, kann ich eine höhere Profitrate realisieren. In der Graphik ist auch ein Phänomen illustriert, das ich schon weiter oben in einer Fußnote angesprochen habe (FN 6): Startet bei sehr hohen Löhnen und laßt die Löhne Lohn, Preis, Profit S.12 dann gedanklich sinken. Dann erlaubt zunächst die Technik mit der durchgezogenen Linie die höchste Profitrate, sie wird also gewählt. Sinken die Löhne jetzt lange genug, dann wird die gestrichelte Technik überlegen, wenn sie aber noch weiter sinken, kommt wieder die Technik mit der durchgezogenen Linie zum Zuge. Dieses Phänomen ist in der ökonomischen Debatte als re­switching, oder auf deutsch: als Wiederkehr der Technik bekannt. Wie also könnte man sagen, daß bei fallenden Löhnen arbeitsintensivere Verfahren eingesetzt werden, wenn eine Technik bei fallendem Lohnsatz zuerst abgewählt und werden und bei noch weiter fallenden Löhnen wieder erste Wahl werden kann? Die Geschichte von der notwendigen Lohnsenkung, damit weniger Arbeit weg rationalisiert wird, ist also, wie oben schon betont, eine Lüge.14 Wir können die gleiche Graphik auch benutzen, um Arbeitsschutz­ vorschriften oder manteltarifliche Regelungen der Arbeitsbedingun­ gen zu diskutieren. Abb. 3: Arbeitsschutzbestimmungen r 400% Eine solche Regelung bezweckt, bestimmte Techniken zu verbieten. Dies wäre nicht erforderlich, wäre diese Technik sowieso nicht gewählt worden. Also muß die Vorschrift in der Regel dazu dienen, eine Technik durchzu­ setzen, deren Lohn­Profit­Relation unterhalb der Technik verläuft, die 0,2 w/p ohne diese Regelung gewählt worden wäre. Sie ist also weniger produktiv: Entweder muß mehr Arbeit eingesetzt werden (z.B.: bezahlte Pausen, Sicherheitsbeauftragte, niedrigere Maschinengeschwindigkeit ...) oder es muß mehr Material eingesetzt werden (Schutzvorrichtungen, Klimaanlagen, größere Räume, Pausenräume, Beleuchtung ...). Also fallen durch solche Vorschriften entweder die Reallöhne und/oder die Profite.15 Trotzdem müssen sie natürlich, so lange die Gesellschaft noch nicht restlos verroht ist, von irgend wem getragen werden, entweder aus der Lohn­ oder aus der Profitsumme bezahlt werden. (Wer sie letztlich bezahlen 14 In kleinen Volkswirtschaften, welche die eingesetzten Kapitalgüter zum größten Teil importieren (Holland z.B.) mag sie schon zutreffen, denn dort hat der heimische Lohnsatz keinen Einfluß auf die Preise der Kapitalgüter. Diese hängen vielmehr von den Löhnen im Ausland ab, weil sie dort hergestellt werden. Für die BRD ist sie aber sicher falsch. 15 Mit einer wichtigen Ausnahme: dann nämlich, wenn durch schlechte Arbeitsbedingungen gesellschaftliche Kosten entstehen (Krankengeld, Berufsunfähigkeitsrenten etc.), die der einzelne Unternehmer nicht zahlen muß und die er daher nicht in seinem Kalkül hat. In diesem Falle können solche Vorschriften die Kosten der Produktion letztlich im Extremfall sogar senken und so höhere Reallöhne und/oder Profite erlauben. Lohn, Preis, Profit S.13 würde, hängt wiederum vom theoretischen Ansatz ab, ist also erst bei den einzelnen Theorien diskutierbar. Ich nehme das Thema dort wieder auf.) Reallohn und Nominallohn Wie schon gezeigt: Für die Arbeiter interessant und für die Profitrate entscheidend ist die Kaufkraft des Lohnes, der Reallohn, also der durch das Preisniveau geteilte Geldlohn. Tariflöhne aber sind Geldlöhne, während das Preisniveau von den Unternehmen am Markt für Güter­ und Dienstleistungen bestimmt wird. Die Reallöhne können also in den Tarifverhandlungen gar nicht bestimmt werden.16 Sicher, wenn, in Folge der Geldlohnerhöhung, die Profitrate sinkt, weil die Preise konstant bleiben, dann, aber auch nur dann, steigen die Reallöhne. Aber wieso sollte nach einer Geldlohnerhöhung nicht mehr die gleiche Profitrate, also der gleiche profit­ sichernde Aufschlag auf die Lohnkosten möglich sein wie zuvor? Oder anders: wenn auch eine niedrigere Profitrate am Markt durchsetzbar gewesen wäre, wieso mußten dann die Geldlöhne steigen, damit die Reallöhne steigen konnten? Wieso waren dann nicht von vorne herein die Preise niedriger? Tatsächlich können, immer noch ganz unabhängig von der gewählten Theorie, höhere Geldlöhne nur dann die Reallöhne beeinflußen, wenn entweder die Zentralbank, durch Inflationsbekämpfung via hoher Zinsen und/oder die Regierung, durch eine Kürzung der Staatsnachfrage und/oder die Importkonkurrenz einen Anstieg der Preise verhindern. Allerdings bedeuten alle drei Varianten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit: Die Inflationsbekämpfung der Notenbank, weil sie die Inflation nur durch Anheben der Zinsen und damit durch das Abwürgen der Investitionsnachfrage bekämpfen kann. Die Kürzung der Staatsnachfrage, weil die (staatliche) Nachfrage so direkt sinkt. Und die Importkonkurrenz, weil die inländischen Unternehmen Marktanteile am Binnenmarkt und auf den Exportmärkten an ausländische Konkurrenten verlieren. Dabei kann es sich um einen Anpassungsprozeß handeln, bei dem früher oder später dann doch die Preiserhöhungen durchgesetzt werden. (Die Notenbank z.B. will ja nur die Inflation bremsen. Wenn sie die Tendenz zum weiteren Anstieg der Löhne gebrochen hat, wird sie ein einmaliges Ansteigen der Preise auf das neue höhere gleichgewichtige Niveau zulassen.) Oder aber es kann sein, daß die Erhöhung der Löhne (und damit die Reduktion der Beschäftigung) dauerhaft ist – dann nämlich, wenn die außenwirt­ 16 Es hilft auch nicht weiter, in die Lohnforderung die erwartete Inflationsrate mit einzuarbeiten. In die Prognosen über die zukünftige Preisentwicklung gehen nämlich vor allem Annahmen über die zukünftige Lohn­ und Produktivitätsentwicklung ein. Werden nun diese Annahmen falsch, weil die Löhne stärker steigen, als in den Prognosen unterstellt, so wird auch die Prognose falsch. Lohn, Preis, Profit S.14 schaftliche Wettbewerbsposition dauerhaft verschlechtert wurde. (Hierzu evtl. in Teil 4 mehr.) Die schlechte Nachricht also ist, daß die Gewerkschaften über ihre Lohnpolitik die Reallöhne nicht erhöhen können, es sei denn, es gelingt Ihnen, bei konstantem Wechsel­ kurs die Lohnstückkosten im Vergleich zum Ausland zu erhöhen und so zugleich die Beschäftigung zu senken. Die gute Nachricht allerdings ist, daß das Lohnniveau in der Bundesrepublik nicht zu hoch ist. • Weder haben wir eine Inflation (also weder steigen die Löhne zu schnell und können auf die Preise überwälzt werden), • noch hat die bundesdeutsche Industrie eine geldpolitisch erzeugte Krise (eine Krise haben wir z.Zt. schon, aber die hat etwas mit dem Wachstum im Ausland, letztlich: in den USA, und damit mit der Exportkonjunktur zu tun), • noch gibt es ein Problem mit der außenwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Im Gegenteil: nach einem Einbruch nach dem Anschluß der DDR erzielt die Bundes­ republik wieder einen Überschuß in der Leistungsbilanz von über 50 Mrd. € pro Jahr.17 Wieso sollten denn die Preise steigen, wenn doch die Arbeitsproduktivität steigt? Nun, dann steigen sie natürlich nicht. Wenn ich in diesem Papier argumentiere, argumentiere ich immer unter der ceteris paribus Bedingung. Ich ändere, solange ich nicht ausdrücklich etwas anderes sage, immer nur einen Einflußfaktor – hier also habe ich angenommen, daß sich an der Technik nichts ändert (daß also Arbeitsproduktivität und Kapitalproduktivität unverändert bleiben) und die Gewerkschaften die Geldlöhne erhöhen. Bei technischem Fortschritt haben wir zwei Einflußfaktoren: Der technische Fortschritt senkt die Preise, die Lohnerhöhung erhöht sie. Gleichen sich die beiden Einflüsse aus, so bleiben die Preise konstant – deshalb haben die Keynesianer ja in den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg, als das vom Rest der Ökonomen noch nicht so gesehen wurde, die regelmäßigen Lohnrunden verteidigt. Mittlerweile hatte das sogar der Sachver­ 17 Die Handelsbilanz, die hier oft genannt wird, und bei der die BRD noch deutlicher im Plus ist als bei der Leistungsbilanz, ist kein besonders guter Indikator, weil sie nur einen Teil der Transaktionen mit dem Ausland erfaßt. (Sie ist nur eine Teilbilanz der Leistungsbilanz.) Ein Land kann einen Überschuß in der Handelsbilanz aufweisen und trotzdem immer tiefer in den außenwirtschaftlichen Schlamassel geraten, z.B. weil es mehr Zinsen an das Ausland über­ weisen muß, als es netto über den Außenhandel einnimmt. Die Leistungsbilanz hingegen erfaßt alle Einnahmen und Ausgaben. Ein Überschuß in der Leistungsbilanz (eine aktive Leistungsbilanz) bedeutet daher, daß ein Land mehr an Zahlungen aus dem Ausland erhält, als es an das Ausland leistet. Bedenkt zur Interpretation des Überschusses von 50 Mrd. bitte auch, daß die Einnahmen eines Landes die Ausgaben aller übrigen Länder sein müssen. (Von wem kriegt die BRD denn die Einnahmen?) Im Durchschnitt der Welt also muß die Leistungsbilanz ausgeglichen sein, weder einen Überschuß nach ein Defizit aufweisen. Ein Überschuß von 50 Mrd. € pro Jahr bedeutet mithin, daß der Rest der Welt bei der BRD Jahr für Jahr tiefer in der Kreide steht. Das kann nun wahrhaft nicht als ein Indiz für mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit, für ein Standortproblem herhalten. Lohn, Preis, Profit S.15 ständigenrat zeitweise mal kapiert (Stichwort: produktivitätsorientierte Lohnpolitik), so daß die Diskussion nicht mehr weiter geführt werden mußte. Allerdings gibt es auch hier wieder ein Aber: Bedenkt, daß der Anstieg der durch­ schnittlichen Arbeitsproduktivität nur zwischen 1 % und 2 % pro Jahr liegt. Dies ist die Referenzgröße für eine Geldlohnentwicklung, die mit konstanten Preisen verträglich ist. Dieser Durchschnitt entsteht durch sehr unterschiedliche Produktivitätsentwicklungen in den einzelnen Branchen – so steigt die Produktivität der Arbeit eines Lehrers, einer Psychologin oder eines Kindergärtners gar nicht (es sei denn Ihr wollt größere Gruppen bzw. Klassen und die Synchrontherapie mehrerer Patienten auf nebeneinander stehenden Liegen.) Wenn daher z.B. die IG Metall ihre Lohnforderungen mit der Produktivitäts­ entwicklung nur in ihrer Branche begründet – die eben über dem gesellschaftlichen Durchschnitt liegt, dann fordert sie entweder, daß die Metallerinnen in Zukunft relativ zu den Kindergärtnern mehr verdienen sollen, will also die relativen Löhne ändern. Oder sie fordert, gemessen an Preisstabilität, zu hohe Lohnzuwächse. Ok, praktisch passiert natürlich was ganz anderes: Man muß anfangs mehr fordern, damit man nachher beim Kompromiß ungefähr den durchschnittlichen Produktivitätszuwachs rauskriegt. Das tatsächliche Ergebnis war ja gar nicht zu hoch. Ich weise aber trotzdem darauf hin, damit Ihr nicht auf die eigene Propaganda hereinfallt. Noch eine letzte, aber für die Interpretation des Modells wichtige Bemerkung. Auf der rechten Seite der Gleichung Kapitalwert + Profit auf den Kapitalwert + Lohnsumme = Produktpreis. stehen die Erlöse, auf der linken die Kosten. Das w in der Gleichung sind also die Kosten des Unternehmens pro Arbeitseinheit. Und das sind nicht die Nettolöhne, sondern alles, was das Unternehmen für eine Arbeitseinheit zahlen muß, also Bruttolöhne plus dem Unternehmeranteil an den Sozialversicherungsbeiträgen. Für die Kosten – und daher für Preise und Reallöhne – ist es völlig egal, wer die Sozialversicherungsbeiträge nominell zahlt; ob es so geregelt ist wie heute, oder ob die Bruttolöhne höher sind und die Arbeiter die Beiträge alleine tragen.18 Die aktuelle Regelung mit dem „ Arbeitgeberanteil“ hat nur zwei Funktionen: eine ideologische: zum einen soll der Eindruck entstehen: Was sind unsere Unternehmer doch so sozial und zum anderen wird für die Arbeiter die wahre Höhe ihrer Abzüge kaschiert; und eine politische. Die „A rbeitgeberbeiträge“ liefern die Rechtfertigung für den Einfluß der Unternehmer­ verbände auf die Sozialversicherungsträger (Drittelparität). 18 Als Ausnahme würde ich die Beiträge zur Unfallversicherung der Berufsverbände gelten lassen. Da sie in der Höhe von der Unfallhäufigkeit in der jeweiligen Firma abhängig sind, setzen sie einen kleinen Anreiz zu verbessertem Arbeitsschutz. Lohn, Preis, Profit S.16 Profitrate und Zinssatz Da in k * p + r * k * p + w * a = p nur ein einziges Produkt betrachtet wird, es geht um die Produktion von Weizen, ist es erstmal plausibel, daß wir es nur mit einer einzigen Profitrate zu tun haben. Falls die Höhe der Löhne für alle Weizenproduzenten identisch ist, und falls alle die gleichen technischen Kenntnisse haben, könnte Betrieb A nur dann eine höhere Profitrate als Betrieb B an Markt erzielen, wenn er für sein Produkt höhere Preise als seine Konkurrenten durchsetzen könnte. So etwas kann aber bei einem homogenen Produkt nicht auf die Dauer gut gehen – seine Kunden würden zur Konkurrenz abwandern, und er müßte seine Preise entweder senken, oder er verschwände auf die Dauer vom Markt. Es gibt aber doch unterschiedliche Preise für das gleiche Produkt – schau Dir nur mal die Preise für Zigaretten an, oder die Preise von MS­Windows, bei dem die OEM Lizenzen einen anderen Preis haben als die Firmenlizenzen und diese wieder billiger sind, als die Preise für den Privatanwender im Einzelhandel. Nun, das erste Beispiel trifft nicht so recht: In der Ökonomie wird der Begriff Produkt oder Ware darüber definiert, daß Konsumenten keinen Unterschied zwischen ihnen sehen. Wenn es gelingt, so etwas wie Markennamen zu etablieren, so daß der Raucher eben nicht Zigaretten, sondern Players Navycut, R 6 oder Reval raucht, wenn Firmen also erfolgreich Produktdifferenzierung betreiben, dann würde der Ökonom von unterschied­ lichen Gütern sprechen. Damit ist das Phänomen der unterschiedlichen Preise und damit evtl. unterschiedlicher Profitraten natürlich nicht aus der Welt, es gehört aber thematisch an eine andere Stelle, nämlich in die Diskussion der Frage, wie sich die Profitraten zwischen unterschiedlichen Branchen verhalten. Das Microsoft­Beispiel wiederum ist das Beispiel eines Monopolisten, der am Markt so stark ist, daß er unterschiedlichen Abnehmergruppen unterschiedliche Preise vorschreiben kann. Also, wenn wir es mit unterschiedlichen Firmen zu tun haben, die das gleiche Gut produzieren, dann müssen diese Firmen die gleichen Preise am Markt nehmen. Mithin können unterschiedliche Profitraten innerhalb einer Branche nur dann existieren, wenn die Firmen unterschiedliche Kosten haben. Dann machen Firmen, die billiger produzieren können als ihre Konkurrenten, natürlich zunächst einen höheren Gewinn, als die anderen. Aber das kann kein Dauerzustand sein. Denn erstens ist ihr höherer Gewinn ein Anreiz für die übrigen Firmen, die Technologie ihrer innovativeren Konkurrenten zu übernehmen. Und zweitens können die Produzenten mit den niedrigeren Kosten ihre Konkurrenten vom Markt verdrängen, in dem sie diese etwas unterbieten. Sie machen dann zwar pro Stück einen etwas niedrigeren Gewinn, aber dafür setzen sie aber mehr ab. Auf die Dauer muß sich also die Profitrate innerhalb einer Branche angleichen. Zwischen unterschiedlichen Branchen muß, solange es keine zusätzlichen Einfluß­ faktoren gibt, gleiche Tendenz bestehen. Denn ein Unternehmer kann ja, auch wenn das länger dauert, die Branche wechseln. Z.B. können Gewinne, die in Branche A erzielt Lohn, Preis, Profit S.17 wurden, in Branche B investiert werden, so daß Branche B expandiert und Branche A stagniert oder auch schrumpft. Solange es daher keine Beschränkungen gibt, die Branche zu wechseln, solange wir es also mit vollständigem Wettbewerb zu tun haben, müssen sich die Profitraten auch zwischen den Branchen angleichen. Mit einer, nicht ganz unwichtigen, Einschränkung – sie müssen das nur dann, wenn nicht die Produktions­ oder Absatzbedingungen die Produktion in einer Branche be­ sonders unattraktiv machen. Nehmt z.B. an, daß in einer Branche besonders starke Preisschwankungen typisch sind – z.B. weil für den Export produziert wird und die Wechselkurse stark schwanken. Oder weil das Risiko in der Produktion besonders hoch ist – z.B. weil (falls) Sprengstofffabriken öfter in die Luft fliegen als Schokoladefabriken. In diesem Fall wird des einen höheren Anreiz geben müssen, damit in dieser Branche investiert wird, und daher wird in dieser Branche die Profitrate überdurchschnittlich hoch sein müssen. Allerdings handelt es sich bei dieser höheren Profitrate wohl in den meisten Fällen in Wahrheit gar nicht um Gewinn, sondern um versteckte Kosten: So können Wechselkursrisiken an den Devisenterminmärkten weitgehend abgesichert werden – wenn ich erwarte, im nächsten Jahr für 1000 $ Autos in den USA zu verkaufen, dann kann ich entweder das Wechselkursrisiko übernehmen, ein Jahr warten und meine $­Einnahmen erst in € umtauschen, wenn ich sie erzielt habe. Oder ich kann heute einen Terminverkauf – von $ gegen € – vornehmen also meine $, lieferbar in einem Jahr, zum heutigen (und damit: bekannten) Terminkurs verkaufen.19 Oder ich kann eine Terminoption erwerben – das Recht, in einem Jahr $ zu einem heute bereits festgelegten Kurs in € umzutauschen. Diese Devisenmarktoperationen sind im hier diskutierten Fall, eine Versicherung: Eine Versicherung gegen eine Aufwertung des €. Und auch die Sprengstofffabrik läßt sich versichern. Mehr als die Kosten der Versicherung, also im Falle der Sprengstofffabrik die Versicherungsprämie und im Falle der Autofabrik die Kosten des Terminkontrakts, kann ich dann auch nicht am Markt durchsetzen. Letztlich, d.h. wenn man auch die versteckten Kosten als Kosten thematisiert, können sich daher die Profitraten auch zwischen den Branchen nicht unterscheiden. Das gilt allerdings dann nicht mehr, wenn die Annahme vollständigen Wettbewerbs verletzt wird. Wenn es Marktzutrittschranken gibt, ist es in einer Branche möglich, höhere Preise und daher höhere Profitraten durchzusetzen. Und wenn es gar Monopole wie Microsoft gibt, so sind sie dazu in der Lage, ihren Profit noch weiter zu erhöhen, in dem sie von Kunden mit unterschiedlicher Zahlungsbereitschaft unterschiedlich hohe Preise nehmen. 19 Dies ist übrigens ein Fall, bei dem die Devisenspekulation Risiko mindernd wirkt – und von daher die Produktionskosten senkt. Denn der Gegenpart bei diesem Geschäft kann ja ein amerikanisches Unternehmen sein, das seine, im nächsten Jahr erwarteten, € Erlöse in $ umtauschen will. Dadurch vermindert sich für beide Seiten das Risiko. Für beide Partner ist aus einem unsicheren ist ein sicherer Wechselkurs geworden. Dies senkt die Preise, weil jetzt beide statt der Entschädigung für das Eingehen eines Wechselkurs­Risikos nur noch die Kosten für den Abschluß eines Terminkontrakts am Markt durchsetzen können. Lohn, Preis, Profit S.18 Trotzdem diese Phänomene praktisch wichtig sind, würde ich mich nicht von der Ausgangsannahme verabschieden, unserem Modell, in welchem die Kapitalkonkurrenz zu einheitlichen Profitraten führt. Ich würde das Modell nur später, z.B. für konkrete Analysen, so erweitern, daß ich zu den Profitraten in den einzelnen Branchen noch eine weitere Variable addiere, die davon abhängt, wie hoch die Marktzutrittsschranken in der jeweiligen Branche sind.20 Für praktische Zwecke könnte man diese Werte gewinnen, in dem man einfach die tatsächlichen Profitratendifferenzen der letzten Jahre zwischen den Branchen betrachtet. Gut. Abgesehen davon, daß die Profitraten zwischen den Branchen bei Marktmacht differieren können (was beispielsweise über einen brachenspezifischen Aufschlag auf die Profitrate, der vom Monopolgrad in dieser Branche abhängt, in das Modell 'rei n­ genommen werden kann), müssen die Profitraten zwischen unterschiedlichen Branchen gleich sein. Diese Einschränkung läßt aber unsere bisherigen Ergebnisse nicht zusammenbrechen. Insbesondere bedeuten höhere Geldlöhne nach wie vor höhere Preise – man kann nicht, 20 Übrigens ist dieser Bereich ein ganz gutes Beispiel für neoliberale Ideologie, im Unterschied zu neoliberaler Theorie. Denn die neoklassische (und beiläufig auch: die keynesianische) Theorie weist aus, daß Marktzutrittsschranken, daß insbesondere Monopole schlecht für die Ökonomie sind, weil sie zu einer geringeren Produktion führen als Konkurrenz: Der Mono­ polist setzt ja höhere Preise durch, in dem er weniger von seinem Produkt anbietet und dieser Effekt wird nicht dadurch ausgeglichen, daß in anderen Branchen entsprechend mehr produziert wird (ich zeige dies hier nicht). Das Volkseinkommen ist also mit Monopolen niedriger als ohne. Neoklassisch heißt das nicht unbedingt, daß Arbeitslosigkeit entsteht (das wäre nur der Fall, wenn wir es mit Monopolen am Arbeitsmarkt zu tun hätten – Gewerkschaften z.B.), aber die Vollbeschäftigung ist bei vermachteten Märkten niedriger – bei den (auf Grund der höheren Preise) niedrigeren Reallöhne wollen einfach weniger Leute arbeiten. Erstaunlicher Weise wird dieser Aspekt bei den Diskussionen um geistiges Eigentum nie diskutiert, sei es beim Patent­ oder sei es beim Urheberrecht ­ obwohl er eine gesicherte theoretische Aussage darstellt. Diese lieferte ja auch die Motivation für die Etablierung von Kartellbehörden. Ich gebe ja gerne zu, daß so etwas wie Entwicklungskosten in den Konkurrenzmodellen aus formalen Gründen nicht behandelt werden kann. Der technische Fortschritt fällt dort aus formalen Gründen in der einfachsten Form vom Himmel und in komplizierteren Modellen vollzieht er sich nicht in Stufen – ich muß nicht 5 Jahre lang ein neues Betriebssystem entwickeln, sondern kann es ständig in kleinen Schritten verbessern. Insofern gibt es sicherlich eine Ratio für Patente, deren möglicher Wert ein Anreiz für private Forschung ist. Aber dieser Vorteil muß abgewogen werden erstens gegen die Nachteile, die sich daraus ergeben, daß das Patentrecht Monopole schafft und zweitens gegen die Alternative, dann halt, wenn' s auf Grund fehlender Anreize privat nicht geht, eine öffentliche Lösung zu wählen (z.B. in dem der Staat, wenn er nicht gleich selbst forscht, Prämien für Erfindungen auslobt, die dann frei zugänglich gemacht werden). Eine solche Abwägung aber findet nirgends statt. Vielmehr wird das Recht auf geistiges Eigentum, und damit auf Monopole und Monopol­ profite, mit den ökonomischen Vorteilen von Privateigentum gerechtfertigt – Vorteilen, die sich selbst auf dem Boden der neoklassischen Theorie nur in Modellen zeigen lassen, die solche Monopole gerade ausschließen. Lohn, Preis, Profit S.19 wie einige lateinamerikanischen Ökonomen dies tun, den Monopolgrad der Märkte für Inflation verantwortlich machen: Solange sich an der Vermachtung der Märkte nichts ändert, steigen auch die Preise nicht. Sie sind dann zwar (relativ zu den Geldlöhnen) hoch, und die Reallöhne sind entsprechend niedrig, aber sie steigen eben nicht. Unter den getroffenen Einschränkungen müssen die Profitraten also zwischen den Branchen gleich sein, weil jeder Unternehmer die Alternative hat, in einer anderen als seiner eigenen Branche zu investieren. Aber nach der gleichen Überlegung muß die Profitrate auch gleich dem Zinssatz sein. Denn die Alternative zu einer produktiven Verwertung von Kapital ist die Anlage in Geldvermögen. Statt Eigenkapital kann ich auch Fremdkapital benutzen, um eine Investition zu finanzieren. Damit muß es eine Verbindung zwischen dem inflationsbereinigten Zinssatz (dem Realzinssatz) und der Profitrate geben. Im Prinzip müssen beide gleich hoch sein – allerdings muß dabei berücksichtigt werden, daß • die Anlage in der Produktion langfristiger ist als in Geldvermögen und • daß sie riskanter ist (denn der Unternehmer haftet ja mit seinem Eigenkapital und dadurch ist das Risiko für den Kreditgeber geringer als für den Unternehmer.) Beide Faktoren führen dazu, daß die Profitrate höher sein muß als der Zinssatz, aber sie ändern nichts daran, daß die beiden Größen in einem festen Zusammenhang stehen. Ich werde deshalb vereinfachend, solange ich nichts anderes sage, davon ausgehen, daß die Profitrate und der Zinssatz gleich sind, aber Ihr könnt ja diese Differenz in Gedanken noch hinzuaddieren. Ob die Profitrate den Zinssatz, oder ob der Zinssatz die Profitrate bestimmt – die Wirkungsrichtung dieses Zusammenhangs – ist damit noch nicht entschieden, aber geben muß es diesen Zusammenhang. Resümee Eine Technik läßt sich beschreiben wie ein Kochrezept: mit a Einheiten Arbeit und k Einheiten Weizen läßt sich eine Einheit Weizen herstellen: k * Weizen, a * Arbeit ==> 1 Weizen Dabei ist 1/a die Arbeitsproduktivität und 1/k die Kapitalproduktivität. Für eine Preistheorie müssen darüber hinaus die Profitrate, der Lohnsatz und der Preis von Weizen in das Modell integriert werden. Man erhält dann: Kapitalwert + Profit auf den Kapitalwert + Lohnsumme = Produktpreis. k * p + r * k * p + w * a = p Eine Gleichung kann maximal eine Unbekannte bestimmen. k und a sind bekannt, weil die Technik bekannt ist. Also haben wir drei Unbekannte: r, p und w. Lohn, Preis, Profit S.20 Weil aber nur die relativen Preise, hier der Reallohn, wichtig sind, läßt sich diese Zahl um eins reduzieren. Wir suchen w/p und nicht w. w, der Geldlohnsatz, kann dem Modell einfach vorgegeben werden – z.B. als in den Tarifverhandlungen bestimmter Geldlohn. Daraus sieht man, daß ein höherer Geldlohn im Gleichgewicht nur das Preisniveau ändert. Nach Lohnänderungen wird es in der Regel Anpassungsprozesse geben und diese können Zeit erfordern. Aber letztlich steigen, ganz unabhängig vom theoretischen Ansatz, einfach nur alle Preise, solange sich nur der Geldlohn erhöht und sich mit k, a oder r nichts weiter tut. Die bisher erhaltene Gleichung können wir jetzt nach p auflösen und für die Preistheorie benutzen: p= 1 ∗w∗a 1−k−r∗k Oder wir können sie nach w/p bzw. r auflösen und sie für die Verteilungstheorie einsetzen. w 1 k = − ∗1r p a a Da wir immer noch eine Variable zu viel haben: r und w/p sind noch unbekannt, ist die Theorie noch nicht fertig. Der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Preis­ und Verteilungstheorien läßt sich auf die Frage zuspitzen, wo diese die fehlende Variable hernehmen. Hier sind drei Varianten möglich und diese werde ich jetzt der Reihe nach durchgehen, wobei ich die Präsentation der Wert­ und Verteilungstheorie gleich mit ihrer Anwendung auf einige Fragestellungen verknüpfe. Drei Wert­ und Verteilungstheorien Die klassische Variante: Wert der Ware Arbeitskraft In der klassischen Theorie wird von den beiden Größen w/p und r der Reallohn erklärt. Arbeit(skraft) ist eine produzierte Ware wie jede andere auch. Ergo bestimmt sich der Wert der Ware Arbeitskraft wie der Wert jeder anderen Ware auch: Durch den für ihre (Re­)produktion erforderlichen Aufwand an Arbeit und Gütern. Zu diesem Preis paßt sich die angebotene Menge (evtl.: mit der Zeit) der Nachfrage an. Wert­ und Verteilungstheorie Praktisch heißt das, daß die Gleichung k * p + r * k * p + w * a = p um eine weitere Gleichung ergänzt wird, die angibt, wie viel Weizen und Arbeit erforderlich sind, um eine Einheit Arbeitsleistung bereit zu stellen: Sage also, es seien x Einheiten Arbeit (Erziehung, Ausbildung etc.) und y Einheiten Weizen erforderlich, um Lohn, Preis, Profit S.21 eine Einheit Arbeitskraft zu produzieren, wobei ich der Einfachheit halber mal annehme, daß in der Reproduktion von Arbeitskraft kein Kapital eingesetzt wird, also auch kein Profit anfällt: y * p + x * w = w links steht der Bedarf an Lebensmitteln Kleidung etc. und die Lohnkosten z.B. der Erzieher, aber auch die Entschädigung für die Erziehungsarbeit der Eltern, denn selbst wenn diese nicht formell entlohnt werden, so müssen doch auch sie, um sich repro­ duzieren zu können, irgendwie ihre Nahrungsmittel erhalten. Die Reproduktionskosten für die Erziehungsarbeit müssen also im Lohn abgegolten sein, was immer die gesellschaftliche Form ist, über die sie letztendlich bei den Erziehenden landet. So, durch die zweite Gleichung sind keine zusätzlichen Variablen in das Modell gekommen, denn x und y sind ja bekannt.21 Also haben wir jetzt zwei unabhängige Gleichungen und zwei Variablen, r und w/p. Die Chancen stehen also gut, daß das System sich lösen läßt. Allgemein würde man nun wieder Matrizenrechnung benutzen, aber so übersichtlich wie unser Beispiel ist, genügt auch die Einsetzmethode: Die Gleichung für die Reproduktion der Arbeitskraft nach dem Reallohnsatz auflösen: y * p + x * w = w <==> y * p = w * (1 – x) <==> w/p = y/(1­x) Der Ausdruck ist positiv – x muß kleiner als eins sein, sonst müßte ich auf die Aufzucht der kleinen Arbeiter mehr Arbeit verwenden, als dabei herauskommt. Die Menschheit würde also langsam aussterben und für die Produktion stünde überhaupt keine Arbeit zur Verfügung. Und y, die Menge an Weizen, die verzehrt wird, kann jedenfalls auch nicht negativ werden, sonst hätte man nach dem Essen ja mehr auf dem Teller als zuvor – und das passiert aller höchstens bei sehr schlechten Köchen und auch da nur gelegentlich. So, und damit ist die Profitrate und, wenn ich den Geldlohnsatz vorgebe, der Preis von Weizen bestimmt. Nehmen wir an, x sei 0,2 und y sei 0,1. Die Technik in der Weizenproduktion ist, wie bisher, bestimmt durch k = 0,2 und a = 4. Dann ist die Profitrate r = 150%: 1 a∗y a 1 w −1 ==> r= ∗ − −1 <==> r= ∗1− k 1−x k a p r=5∗1− 4∗0,1 −1 = 1,5 0,8 und der Preis von Weizen beträgt das achtfache des Geldlohnsatzes: p= 1 1 ∗w∗a ==> p= ∗w∗4 = 8*w 1−k−r∗k 1−0,2−1,5∗0,2 Damit ist der Reallohnsatz (w/p) = w/(8*w) = 0,125 [Sack Weizen pro Arbeitseinheit]. 21 Wenn sie auch, wie ja bereits Ricardo betont hat, historisch und kulturell differieren können, so sind sie doch für eine bestimmte historische Epoche und Region gegeben. Ich gehe darauf gleich noch etwas weiter ein, aber zunächst soll die klassische Schließung des Modells zu Ende diskutiert werden Lohn, Preis, Profit In der Preis­ und Verteilungst­ heorie der Klassik wird also die Lohn­Profit­Relation vom Lohnsatz zur Profitrate hin gelesen. Der Reproduktionslohn (der Wert der Ware Arbeitskraft) bestimmt den Lohnsatz und dieser Lohnsatz wiederum bestimmt die Profitrate. In dieser Logik ist die Profitrate eine Restgröße: Sie ist eigentlich funk­ tionslos. Die Kapitalistenklasse eig­ net sich, auf Grund ihres Besitzes an den Produktionsmitteln, den Teil des gesellschaftlichen Wertprodukts an, der zur Reproduktion der Arbeiter nicht erforderlich ist. S.22 Abb. 4: Lohn­Profit­Relation in der Klassik r 400% 150% 0,125 0,2 w/p Das stimmt so zwar nicht mehr ganz, wenn man annimmt, daß nur aus den Profiten investiert wird, weil dann eine hohe Profitrate zugleich hohes Wachstum ermöglicht. Andererseits ist diese Einschränkung auch wieder, jedenfalls für den Vergleich von Gleichgewichten, ziemlich belanglos: Wenn ein höheres Volkseinkommen nur dazu führt, daß die Menschheit schneller wächst, ohne daß sich die Lage der Menschen verbessert, dann ist sein einziges Ergebnis, daß es noch mehr Menschen gibt, die gerade mal ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Was sollte dann daran so erstrebenswert sein? Eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität (ein Sinken von a) (Marx' Produktion des relativen Mehrwerts) führt zu einer Erhöhung der Profitrate, weil jetzt jeder Arbeiter bei konstantem Reallohn mehr herstellt. Damit steigt die Profitmasse, die, durch den Wert des Kapitalstocks geteilt, die Profitrate ergibt. Ebenso erhöht eine höhere Kapitalproduktivität (ein Sinken von k), die Profitrate, weil jetzt in diesem Fall ein konstant gebliebener Profit durch einen niedrigeren Kapitalwert geteilt wird. Beide Varianten haben keinen Einfluß auf den Reallohn, es sei denn, eine Real­ lohnsteigerung ist die Bedingung für eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität, z.B. weil eine bessere Ausbildung erforderlich ist, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. (Auf den Wert des Reallohns haben sie schon einen Einfluß: Der Wert von Weizen (gemessen in Lohneinheiten) sinkt ja. Es sinkt aber nicht nicht die Menge an Weizen, die man sich mit diesem Lohn kaufen kann) Lohn, Preis, Profit S.23 Reallohn und Nominallohn Aus der Preisgleichung folgt, daß auch in der klassischen Preistheorie eine Geldlohn­ erhöhung keine Erhöhung des Reallohnes ermöglicht. p= 1 ∗w∗a 1−k−r∗k Formal: Verdoppelt man den Geldlohn w, so verdoppelt sich auch das Preisniveau. Seine praktische Ursache hat dieser Zusammenhang für die Klassik in der Annahme, die Arbeitskraft sei eine produzierte Ware wie jede andere auch. Steigt der Marktpreis einer Ware über den Gleichgewichtspreis, so steigt die Produktion an, bis der Preis wieder auf sein gleichgewichtiges (Produktionspreis­)Niveau zurückgekehrt ist. Ist die Arbeitskraft eine Ware, so führt ein Lohnsatz, der über den Reproduktionslohn steigt, dazu, daß die Arbeiter sich vermehren wie die Karnickel, bis es genug von ihnen gibt und der Lohnsatz wieder auf sein Gleichgewichtsniveau, den Reproduktionslohn, fällt. Und bleibt der Lohn hinter dem Reproduktionsniveau zurück, so entstehen Hungersnöte und/oder die Eheschließungen gehen zurück. Die Arbeitsbevölkerung schrumpft, bis sie schließlich wieder die Größe erreicht hat, die das Kapital benötigt, so daß der Lohnsatz wieder auf sein Gleichgewichtsniveau hochkonkurriert wird. Auf dem klassischen Arbeitsmarkt herrscht also Vollbeschäftigung. ­ Wenn auch nicht deswegen, weil der Marktprozeß dazu führt, daß alle Arbeit suchenden Menschen Stellen finden, sondern deshalb, weil der Marktprozeß dazu führt, daß es nur so viele Menschen gibt, wie das Kapital benötigt. Auch bei Marx findet sich keine Theorie der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosen, die bei ihm im 23. Kapitel des ersten Bandes diskutiert werden, sind ein Phänomen der Krise, also des Ungleichgewichts. Dieses „ Eherne Lohngesetz“ (Lassalle22), fanden die Klassiker nicht unbedingt gut. Besonders Sismondi prangert die Hungerkrisen an, die entstehen, wenn das Kapital keine Verwendung für alle Arbeit hat. Es gibt aber, aus Sicht der Klassik, nur zwei Wege, die Lage der Arbeiterklasse zu verbessern. Entweder der Lohnsatz kann über dem Reproduktionslohn gehalten werden. Das ist nur dann möglich, wenn die Nachfrage nach Arbeit schneller wächst als die Bevölkerung. Also benötige ich Wirtschaftswachstum. Daher sowohl bei Smith wie bei Ricardo die Position, nur eine wachsende Wirtschaft ermögliche ein glückliches Land, und bei beiden der Horror vor einer stagnierenden Ökonomie (dem stationären Zustand bzw. engl.: stationary state). 22 Es ist einer der weniger sympathischen Charakterzüge von Marx, daß er gerne Leute angreift, die das Gleiche sagen wie er, wenn sie ihn nicht als Übervater anerkennen. So kritisiert er Lasalle für dessen „E hernes Lohngesetz“, steht aber mit dem Wert der Ware Arbeitskraft inhaltlich auf der gleichen Position. Bei ihm findet sich denn auch (am Ende entweder von „Lohn, Preis, Profit“ oder aber von „Lohn arbeit und Kapital“ ) eine Passage, in der er sinngemäß sagt, die Gewerkschaften könnten zwar zeitweise (!!!) das Lohnniveau etwas erhöhen, sie verfehlten aber ihr Ziel völlig, wenn sie sich darauf konzentrierten. Lohn, Preis, Profit S.24 Oder aber es gelingt mir, die Reproduktionskosten der Arbeit zu erhöhen. Dies funktioniert einmal wenn die Menschen, auf Grund besserer Bildung (Smith, Ricardo) oder durch Beschränkungen der Eheschließung (Malthus) erst bei einem höheren Einkommen eine Familie gründen. Oder aber, zweite Möglichkeit, wenn ich Teile der Familie von der Arbeit ausschließe: Verbot der Frauen und Kinderarbeit. Die Klassik ist deshalb auch die einzige Theorie, in welcher der Marktmechanismus eine Arbeitszeitverkürzung bei vollständigem Lohnausgleich erlaubt. Eine Verkürzung der Arbeitszeit senkt ja nicht (oder doch wenigstens: nicht wesentlich) die Reproduktions­ kosten. Ergo muß der Stundenlohn bei einem 8­Stunden­Tag höher liegen als bei einem 12­Stunden­Tag, wenn weiterhin genug Arbeitskräfte nachwachsen sollen. Der gegebene Reallohnsatz führt ebenfalls dazu, daß die Kosten für Arbeits­ schutzmaßnahmen alleine vom Unternehmen getragen werden, also die Profitrate mindern. Profitrate und Zinssatz In der Klassik wird die Profitrate also in der Produktion bestimmt. Also muß der Zinssatz sich (im Gleichgewicht) an die Profitrate anpassen, denn mit der Kreditauf­ nahme kann ich die Produktion ausweiten, ich tausche mit einer Kreditaufnahme also Zinseinkommen (das ich dem Kreditgeber zahle) gegen Profiteinkommen (das ich aus der Produktion beziehe). Daher werden die Unternehmer den Zinssatz mit der Zeit auf die Höhe der Profitrate hochbieten.23 Ein Ergebnis, auf das auch Marx kommt, wenn er im dritten Band des Kapital zunächst die Spaltung des Profits in Unternehmerlohn und Zins betrachtet und dann konstatiert, daß der Unternehmerlohn im Marktprozeß in Richtung auf einen reinen Lohn für Leitungstätigkeit herunter konkurriert wird. Daß der Geldzinssatz sich im Gleichgewicht passiv nach der Profitrate richtet, bedeutet natürlich nicht, daß es immer so ist. Es gab natürlich auch zu Zeiten der ökonomischen Klassik Geldkrisen, in denen, entweder wegen einer Krise des Bankensystems und/oder aber wegen einer Politik der Inflationsbekämpfung der Notenbank der Geldzins explodierte.24 Aber diese Themen sind Themen dies 23 Ich verweise hier nochmal auf die oben (S. 19) gemachten Einschränkungen. 24 Bankenkrisen gab es in England vor 1868 regelmäßig und eine restriktive Geldpolitik der Bank of England kennzeichnete die ersten 10 bis 15 Jahre des 19. Jahrhunderts, in denen die Bank von England das, in Folge der Inflation während der Napoleonischen Kriege, entwerte Pfund wieder auf seine alte Goldparität zurückführte. Die Bankenkrise von 1798 ist der Anlaß von Henry Thorntons „ Paper Credit“ und die Restriktionsperiode zu Beginn des 19. Jahrhunderts u.a. war der Anlaß zu sowohl Ricardos „High Price of Bullion“ als zum Bullion­ Report, an dem wiederum Thornton federführend beteiligt war. Nach 1868 verschwinden (in England) die periodischen Geldkrisen, weil die Bank of England ein anderes Krisenmanage­ ment betreibt. Dies wird in der im gleichen Jahre erschienen „Lo mbard Street“ von Bagehot analysiert. Wobei vor allen anderen Bagehot, als Herausgeber des Economist, es war, der diese veränderte Geldpolitik gefordert hatte. Lohn, Preis, Profit S.25 Ungleichgewichts.25 Sie können für einige Zeit dominant sein, weil die Kreditnachfrage der Unternehmen nicht schlagartig zurück gehen kann, wenn der Zinssatz steigt: Die Unternehmen haben schließlich Zinsen und Tilgung auf ihre bestehenden Verbind­ lichkeiten zu zahlen, und wenn sie, in Folge der Geldkrise, nicht genug verdienen, müssen sie eben, egal zu welchem Zinssatz, neue Schulden aufnehmen, um ihre alten zu bedienen. Die Kreditnachfrage geht dann nur langsam zurück, während das Kredit­ angebot schlagartig sinkt. Aber sie geht zurück, und auf die Dauer muß sich wieder ein Gleichgewicht bei Zinssatz = Profitrate einstellen. Tendenzieller Fall der Profitrate? Eine der Fragestellungen der Klassik war die nach der langfristigen Entwicklung des Zinssatzes. Die Merkantilisten hatten schon seit dem 17. Jahrhundert gefragt, wieso das Zinsniveau der Bank von Amsterdam so deutlich unter dem englischen Zinsniveau lag. (Eine Konsequenz dieser Debatte war der Vorschlag zur Gründung der Bank of England.) Und seit etwa Mitte / Ende des 18. Jahrhunderts fiel das Zinsniveau auf Englische Pfund – ein Trend, der bis zum ersten Weltkrieg andauerte. In dieser Diskussion war es eine generell akzeptierte Tatsache, daß das Zinsniveau sank, wenn eine Volkswirtschaft reicher wurde.26 Die zu beantwortende Frage war nicht ob, sondern warum die Zinsen mit steigendem Einkommen sanken. Nun, wenn der Zinssatz von der Profitrate bestimmt wurde, dann konnte der Zins nur sinken, wenn die Profitrate sank. Aus der Frage der Merkantilisten nach der Entwicklung des Zinssatzes wurde daher für die Klassik die Frage nach der langfristigen Entwicklung der Profitrate. Die Bestimmungsgleichung der Profitrate sagt auch sofort, welche Kandidaten hier in Frage kommen. Wegen: a 1 w 1 a∗w r= ∗ − −1 ==> r= ∗1− −1 k a p k p kann die Profitrate nur fallen, wenn entweder der Reallohn steigt, oder wenn die Technik weniger produktiv wird, wenn entweder die Arbeitsproduktivität sinkt (a steigt) und/oder die Kapitalproduktivität sinkt (k steigt). Ricardo wählte den ersten Ansatz: Zwar steigt mit zunehmender Bevölkerung nicht der Reallohn gemessen in Gütereinheiten, aber die Lohngüter, vor allem Nahrungsmittel, sage: Korn, müssen auf immer arbeitsaufwändigere Weise hergestellt werden, weil mit wachsender Bevölkerung immer schlechtere Böden in die Bebauung genommen werden 25 Ich gehe im dritten Teil, Wirtschaftspolitik, im Zusammenhang mit der Geldpolitik auf diese Themen etwas näher ein. 26 Im 17. und 18. Jahrhundert war das Einkommen in Holland höher als das in England, England überholte erst im 19. Jahrhundert und die Bank von Amsterdam war von Napoleon geplündert worden. Die Geschichte der Bank von Amsterdam erstreckte sich also nur auf die Zeit, in der Holland einen wirtschaftlichen Vorsprung hatte. Lohn, Preis, Profit S.26 müssen.27 Korn hat aber am Markt einen einheitlichen Preis. Der Anbau auf schlechteren Böden erfordert daher einen höheren Marktpreis – und die Grundeigentümer, welche über bessere Böden verfügen, können sich den Vorteil der geringeren Produktionskosten über einen höheren Pachtzins entgelten lassen. Eine wachsende Bevölkerung führt daher zu einer Umverteilung des Vermögenseinkommens weg vom Profit hin zu Mieten und Pachten. Eine steigende Grundrente führt zu einem Sinken der Profitrate. Daher fordert Ricardo auch die Aufhebung der Getreidezölle, um über Importe den Anstieg der Getreidepreise zu bremsen und so die Profitrate zu verteidigen. Was immer man von dieser Erklärung halten mag – selbst unter den Annahmen der Klassik wäre es ja möglich, daß die Entwicklung durch den technischen Fortschritt in der Landwirtschaft neutralisiert wird – sie ist jedenfalls kohärent, wenn man die entsprechenden Annahmen über die Entwicklung des technischen Wissens in der Landwirtschaft trifft. Das Gleiche läßt sich von Marx' These des tendenziellen Falls der Profitrate nicht sagen. Marx leitet das „ Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate“ her, bevor er die Grundrente thematisiert. Ihm stehen daher als Argumente nur noch k und a zur Verfügung. Seine These ist, daß, um die Mehrwertrate zu steigern, also um a zu senken, der Kapitalaufwand steigen muß. Wenn in der Profitratengleichung k nur schnell genug steigt, wird jeder Fall von a (jede Steigerung der Arbeitsproduktivität) überkompensiert. Und Marx postuliert, daß genau dies der Fall sei. Allerdings ist sein Argument nur scheinplausibel. Schon seine Behauptung im ersten Band des „ Kapital“, eine Erhöhung der Mehrwertrate erfordere eine „ steigende organische Zusammensetzung des Kapitals“ (eine Zunahme des Kapitalwertes relativ zu den Lohnkosten), ist nicht schlüssig hergeleitet. Rechnet man Marx' eigene Annahmen nach, so kann alles herauskommen: Die organische Zusammensetzung des Kapitals kann steigen, fallen oder gleich bleiben, eine zwingende Tendenz in irgend eine Richtung läßt sich nicht herleiten. Und das wird nicht besser, wenn man bedenkt, daß auch bei Marx mit dem Übergang von der Wert zur Produktionspreistheorie im dritten Band des Kapital nicht der Mehrwert, sondern die Profitrate die Kalkulation des Kapitalisten bestimmt. Wie die Überlegungen zur Technikwahl oben auswiesen, kann die Technikwahl nie zur Wahl einer weniger produktiven Technik führen. Wenn eine neue Technik gefunden wird, so wird sie nur dann eingesetzt, wenn sie, beim gegebenen Reallohnsatz, eine höhere Profitrate abwirft. Wer trägt die Steuern? Generell gilt, daß derjenige, der die Steuern zahlt, noch lange nicht diejenige sein muß, die sie in letzter Instanz auch trägt. Denn Steuern kann man über die Preise weitergeben. 27 Neben der hier erläuterten Grundrente I kennt Ricardo noch eine Grundrente II, Aber um die Logik des Arguments vorzuführen, ist es nicht nötig, auch auf diese einzugehen. Lohn, Preis, Profit S.27 In der klassischen Theorie ist es egal, bei wem die Steuern erhoben werden. Sie sind stets Abzug vom Profit (oder aber der Grundrente). Der Grund dafür liegt darin, daß der Nettolohn funktionales Einkommen ist, Profit und Rente hingegen Surpluseinkommen, funktionsloses Überschußeinkommen sind. Werden Steuern auf die Löhne erhoben, so fällt das Arbeitseinkommen unter das Repoduktionsniveau. Die Zahl der Arbeiter geht zurück und das Kapital muß die Brutto­ Löhne auf eine Höhe hochbieten, bei der die Arbeiterinnen Netto wieder ihren Reproduktionslohn erzielen. Bei indirekten Steuern (Konsumsteuern) ist dies nicht anders: Sollen die Arbeiter sich nach der Erhebung der Steuer weiter reproduzieren können, so müssen sie sich soviel kaufen können, wie zuvor. Jede Steuer führt deshalb, so lange sie nicht von den Grundbesitzern erhoben wird, zu einer Reduktion der Profite. Daher die Forderung der späteren Bodenreformbewegungen, die Staatsausgaben nur durch Besteuerung von Grundvermögen zu finanzieren. (Henry George, Adolf Damaschke) Die neoklassische Variante: Vollbeschäftigung Die Neoklassik ist, wie bereits bemerkt, die heute konkurrenzlos dominierende ökonomische Theorie. Im Unterschied zur Klassik liefert sie eine formale Theorie auch für die Erklärung der Preise nicht produzierter Güter und Dienstleistungen. Da Arbeit von ihr als ein solches nicht­produziertes Gut (und die Bereitstellung von Kapital als nicht produzierter Dienst, als Verfügung über knappes Vermögen) gefaßt wird, ist es sinnvoll, zunächst kurz auf die Modellierung des Arbeitsmarktes einzugehen. Der Arbeitsmarkt Ein Markt wird generell verstanden als ein Raum, in dem Mengen von Gütern oder Dienstleistungen in Abhän­ gigkeit von deren Preis bereitgestellt und nachgefragt werden. Die Bereitstellung in Abhängigkeit vom Preis wird durch die Angebots­ kurve, die beim jeweiligen Preis nachge­ fragte Menge durch die Nachfragekurve angegeben. Mit p für den Preis, X für die Menge, D (demand) als Exponent für die Nachfrage sowie S (supply) für das Angebot und * als Zeichen für das Gleichgewicht ist in der nebenstehenden Graphik ein Beispielmarkt abgetragen. Abb. 5: Marktdiagramm p XS p* XD X* X Lohn, Preis, Profit S.28 Bei „ normalem“ Verlauf steigt die Angebotskurve (zu höheren Preisen wird mehr von X angeboten als bei niedrigeren Preisen) und fällt die Nachfragekurve (bei einem niedrigen Preis wird mehr X nachgefragt als bei einem hohen Preis). Ist der Preis höher als p*, so ist das Angebot größer als die Nachfrage, die Anbieter bieten die Preise herunter, und der Preis fällt. Bei einem Preis unterhalb von p* geht ein Teil der Nachfrager leer aus, die Preise werden hochgeboten, weil die Nachfrager, die leer ausgingen, höhere Preise bieten, um doch noch an das Produkt zu kommen. Wie gesagt, Ihr kennt das Phänomen wahrscheinlich von Konzertkarten. Sind die Preise höher als p* gibt es also einen Druck auf die Preise, sie fallen. Sind sie niedriger als p* gibt es eine Tendendenz zu Preissteigerungen. Damit bewegen sich die Preise und Mengen normaler Weise in Richtung auf das Gleichgewicht (p*, X*), solange sich nichts an den Kurven tut. X*, die Gleichgewichtsmenge, ist die größte Menge, die am Markt umsetzbar ist. Liegt p über p*, so nehmen die Nachfrager weniger als X* ab. Liegt p unterhalb von p*, so stellen die Anbieter weniger als X* her. Die Kurve, die der Preisachse am nächsten liegt, gibt also an, wieviel umgesetzt werden kann – oder, auf fachchinesisch: die kurze Marktseite rationiert den Markt. p* ist deswegen der Gleichgewichtspreis, weil er keinen Anlaß zu weiteren Preis­ änderungen mehr gibt. Zu p* wird alle zu diesem Preis geplante Nachfrage befriedigt und die Anbieter können soviel absetzen, wie sie bei diesem Preis anzubieten planen. Im Marktgleichgewicht, bei dem Preis p* und der umgesetzten Menge X*, sind also die Pläne der Anbieter und Nachfrager kompatibel, der Preismechanismus koordiniert die Pläne. Abb. 6: Probleme bei der Findung des Gleichgewichts In diesem simplen Bildchen steckt mehr, als man ihm auf dem ersten Blick ansieht: Hinter den Nachfrageplänen der Haushalte steht der Wunsch, einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. Hinter den Angebotsplänen der Unternehmen steht der Wunsch nach Maximierung des Profits. Im Marktgleichgewicht gehen diese Pläne, für den Preis p*, gleichzeitig auf. Im Marktgleichgewicht sind also gleichzeitig die Haushalte in ihrem Lohn, Preis, Profit S.29 Nutzenmaximum (bei diesem Preis) und die Unternehmen in ihrem Gewinnmaximum (bei diesem Preis).28 Damit es ein solches Gleichgewicht gibt, muß man nicht unbedingt bestimmte Kurvenverläufe annehmen. Solange die Kurven nicht gerade parallel verlaufen, schneiden sie sich ja irgendwo, also gibt es auch einen (oder mehrere) Gleichgewichtspunkte. In Sonderheit ist es kein Problem, wenn die Angebotskurve, wie in unserem Produktions­ preismodell, flach (parallel zur X­Achse) verläuft. Solange die Nachfragekurve fällt, bestimmt dann einfach das Angebot den Preis und die Nachfrage bei diesem Preis entscheidet über die Menge, die hergestellt wird. Allerdings sollten die Angebots­ und Nachfragekurven keine Sprungstellen aufweisen (weil sie sonst vielleicht gerade an der Stelle springen, wo sie sich sonst treffen würden) und sie sollten sich bei positiven Preisen und Mengen schneiden. Außerdem wäre es gut, wenn nicht gerade das Angebot mit steigendem Preis zurückginge und gleichzeitig die Nachfrage mit steigendem Preis steigt. Denn in diesem und ähnlichen Fällen würde das System explodieren, wenn wir nicht gerade zufällig im Gleichgewicht sind: Wäre die Nachfrage größer als das Angebot, so würden die Preise steigen. Dadurch stiege aber die Nachfrage noch weiter an und das Angebot ginge weiter zurück. Die Preise würden jetzt noch weiter steigen u.s.w. Und umgekehrt bei einer zu Beginn zu hohen Nachfrage. Hier würden die Preise fallen, das Angebot stiege weiter, die Nachfrage ginge weiter zurück etc. Noch ein Hinweis ist wichtig: Beide Kurven geben nur die bei unterschiedlichen Preisen geplanten Angebots­ und Nachfragemengen wieder. Ändert sich irgend ein an­ derer Einfluß als der Preis, so verschieben sich die Kurven, der Gleichgewichtspunkt ändert sich also. Solche Einflüsse kann man durchaus im Marktdiagramm diskutieren. Man muß dann nur fragen, welche der beiden Kurven wohl in welche Richtung vers­ choben wird. Dies wird spätestens im Abschnitt zur Wirtschaftspolitik wichtig werden. Beiläufig können so auch unangenehme Marktprozesse entstehen, Prozesse, die weg vom Gleichgewicht führen. Bei Aktien z.B. hängt die Nachfrage von Preiserwartungen (Kursentwicklung) ab. Haben jetzt die erwarteten Kurse etwas mit der bisherigen Preis­ entwicklung zu tun, so führen steigende Kurse zur Erwartung weiterer Kursanstiege und 28 Man darf das nicht zu apologetisch interpretieren: Das Nutzenmaximum eines Obdachlosen (bei gegebenen Preisen) ist eben erreicht, wenn er unter einer Brücke schläft, weil er sich die Miete nicht leisten kann. Auch im Kapitalismus können Menschen verhungern, aber dies eben „ optimal“. Aber der Marktmechanismus erzeugt eine hohe Systemstabilität. Wenn ich in der DDR keine Wohnung bekam, war Günter Mittag daran schuld. Der Fünf­Jahres­Plan hatte nicht genügend Wohnraumbau vorgesehen. Über den Marktmechanismus wird eine Menge an Kritik aus Systemkritik in Selbstvorwürfe transformiert: Wenn ich mir im Kapitalismus keine Wohnung leisten kann, bin ich selbst daran schuld. Es sind ja „ genug“ da, nur ich verdiene nicht genug, also bin ich unfähig, der Nachbar kriegt' s doch auch hin. Wobei das genug gar nicht mal impliziert, daß im Kapitalismus mehr Wohnungen angeboten werden. Sie sind nur einfach so teurer, daß die Nachfrage so niedrig ist, daß die Menge (bei diesem Preis) die Nachfrage deckt. Lohn, Preis, Profit S.30 dadurch zu einer steigenden Nachfrage (die Nachfragekurve würde sich nach außen verschieben). Und diese wiederum führt zu steigenden Kursen. So funktioniert eine Börsenblase. Umgekehrt kann eine Deflation funktionieren. Wenn fallende Preise zur Erwartung auch weiterhin fallender Preise führen, so regt dies zum Aufschieben der Nachfrage an. (Ihr kennt das von der Überlegung: Kauf ich mir den neuen PC oder warte ich noch, bis der Preis des neuen Prozessors gesunken ist.) In diesem Falle würden fallende Preise zu einem Rückgang der Nachfrage (einer Verschiebung der Nach­ fragekurve nach innen) führen und dies würde wiederum die Preise weiter fallen lassen. Die Arbeitsmarkttheorie ist nun letztlich nichts anderes, als das Übersetzen dieses Marktdiagramms auf den Arbeitsmarkt. Aus XD, der Nachfragekurve der Haushalte nach Gütern, wird AD, die Nachfragekurve der Unternehmen nach Arbeit oder die Arbeitsnachfragekurve. Aus XS, der Angebotskurve der Unternehmer an Gütern, wird AS, die Arbeits­ angebotskurve der Haushalte. Die am Arbeitsmarkt bestimmte Menge ist die Beschäftigung A und der relevan­ te Preis ist der Reallohn w/p. Abb. 7: Arbeitsmarktdiagramm w/p AS (w/p)* AD A* A Der Markt ist geräumt, es herrscht Vollbeschäftigung, wenn der Reallohn eine Höhe erreicht hat, bei der die Haushalte gerade genau das Arbeitsvolumen (in Stunden) loswerden, das sie zu diesem Lohnsatz anbieten wollen. Und bei dem die Unternehmen gerade soviel Arbeit bekommen, wie sie bei diesem Lohnniveau einsetzen möchten. Wert­ und Verteilungstheorie Vom Arbeitsmarktdiagramm führt eine recht einfache Überlegung auf die Wert­ und Verteilungstheorie: Hinter der Arbeitsangebotskurve steht die Wahl der Haushalte zwischen Arbeit und Freizeit. Was aber steht hinter der Arbeitsnachfragekurve? Nun, um Arbeit einzusetzen, sind Arbeitsmittel, ist (im Kapitalismus) Kapital erforderlich. Im einfachen Modell: Der Farmer hat auch eine Wahl, er kann seinen Weizen essen, oder ihn für die Aussaat bereitstellen. Er wird umso mehr aussäen, und daher umso weniger essen, je höher die Profitrate ist, die er in der Produktion erzielt.29 Und in komplexeren 29 Marx Kritik an dieser Profittheorie, die den Profit als Lohn für Sparen ausgibt, ist, die Kapitalisten müßten wohl nicht dafür entschädigt werden, daß sie ihre Maschinen nicht essen. Nur: Diese Kritik trifft nicht, denn eine höhere Nachfrage nach Konsumgütern und eine geringere nach Maschinen würde bewirken, daß weniger Maschinen und mehr Konsumgüter produziert werden. In Zukunft wären dann weniger Maschinen „da“. Das heißt aber nicht im Umkehrschluß, daß die „ Entsagungstheorie des Profits“ die Klassik Lohn, Preis, Profit S.31 Zunsammenhängen: Um die Produktion auszuweiten, sind die Unternehmen, zumindest zum Teil, auf Kredit angewiesen. Ein höheres Kreditvolumen erfordert aber, unter sonst gleichen Umständen, einen höheren Zinssatz. So, und damit haben wir die Arbeitsnachfragekurve zusammen: Um mehr Arbeiter einzusetzen, brauchen die Unternehmer mehr Kapital. Mehr Kapital aber erfordert mehr Kredit und dafür sind höhere Zinssätze erforderlich. Um höhere Zinsen zahlen zu können, brauche ich aber eine höhere Profitrate. Und eine höhere Profitrate, das sagt mir die Lohn­Profit­Relation, bedeutet niedrigere Reallöhne. Deshalb muß – unter sonst gleichen Umständen – eine höhere Arbeitsnachfrage einen niedrigeren Reallohn implizieren. Sehen wir uns vor dem Hintergrund des Arbeitsmarktes also nochmal das Lohn­Profit­ Diagramm an: Abb. 8: Verteilungstheorie der Neoklassik r 400% zu wenig Arbeiter: Lohn steigt, Profit rate fällt Vollbeschäftigung r* zu wenig Kapital: Lohn fällt, r steigt w* 0,2 w/p Bei hohen Löhnen ist die Profitrate niedrig. Die Unternehmen könnten zwar viel Arbeit zu diesem Lohnsatz bekommen. Aber da sie nur wenig Kapital einsetzen können, brauchen sie nur wenig Arbeit. Es ist einfach nicht viel Korn auszusäen, also wird wenig Arbeit beschäftigt. Bei hohen (Real)Löhnen ist die Beschäftigung also gering, weil die Nachfrage nach Arbeit zu niedrig ist, es herrscht Arbeitslosigkeit. Die Löhne sinken und die Profitrate steigt. widerlegt hätte: Wenn die Löhne durch den Reproduktionslohnsatz die Profitrate bestimmen, kann diese ohne weiteres über dem Niveau liegen, das als Entschädigung für Konsumverzicht erforderlich wäre. Der Klassiker könnte z.B. durchaus argumentieren, daß, weil mit Vermögensbildung soziale Sicherheit und Prestige einhergeht, der erforderliche Zins für Kapitalbildung Null oder gar negativ ist. (Ein Beispiel für einen negativen Zins sind Kontoführungsgebühren.) In diesem Falle bliebe der Profit reiner Surplus, funktionsloses Einkommen. Keine der beiden Theorien kann der anderen nachweisen, daß sie falsch sei. Lohn, Preis, Profit S.32 Bei niedrigen Löhnen ist die Profitrate hoch. Die Unternehmer können zwar an viel Kapital kommen, aber bei diesen niedrigen Löhnen finden sie nicht genug Arbeiter. Das Korn verrottet in den Speichern, weil niemand es aussät. Also müssen die Unternehmen das Lohnniveau hochbieten – und damit sinkt zugleich die Profitrate. Für Neoklassik sind beide Einkommensarten, Lohn­ und Profit, funktionale Einkommen – ist der Lohnsatz zu niedrig, arbeiten zu wenige Menschen. Und ist die Profitrate zu niedrig, so sind nicht genug Machinen und Rohstoffe da, um alle zu beschäftigen, die gerne arbeiten möchten. Daher wird in der Verteilungstheorie sowohl der Lohn als auch der Profit bestimmt. Aber oben hatte ich doch gesagt, daß, weil die Verteilungsgleichung a 1 w r= ∗ − −1 k a p nur zwei Unbekannte aufweist, nur eine der beiden Größen bestimmt sei, wenn die andere bekannt sei. Richtig. Es sei denn, man hat noch eine weitere Größe, die man gleichzeitig bestimmt. Und diese zusätzliche Größe ist in der Neoklassik die Beschäftigung bzw. das Volkseinkommen. (Weil das Volkseinkommen gleich Produktion pro Arbeitsstunde mal Anzahl der Stunden ist, also gleich Arbeitseinsatz mal Arbeitsproduktivität ist.) Für die Neoklassik entscheidet sich also die Höhe des Volkseinkommens am Arbeitsmarkt. Und zugleich versteht man die Fixierung der Neoklassik auf Vollbeschäftigung – außerhalb der Vollbeschäftigung funktioniert bei diesem Ansatz nichts mehr, weder die Preis­ noch die Verteilungs­ noch die Beschäftigungstheorie. Dies ist die eigentliche Ratio, die den Neoliberalen dazu führt, zumindest die durchschnittliche Beschäftigung im Konjunkturzyklus (hierzu mehr in den Teil II und III) als Vollbeschäftigung, und die gemeldeten Arbeitslosen als freiwillig Arbeitslose zu interpretieren. Technischer Fortschritt führt hier zu einer Ausweitung der Beschäftigung bei gleichzeitig steigenden Löhnen und steigender Profitrate – denn die Lohn­Profit­Relation verschiebt sich nach außen und daher können sowohl höhere Löhne als eine höhere Profitrate gezahlt werden – und wegen der höheren Löhne kann die Beschäftigung steigen. Die genaue Aufteilung des Zuwachses hängt vom konkreten Verlauf der Arbeitsangebots­ und ­nachfragekurve ab. Arbeitsschutz bewirkt, weil Verschiebung der Lohn­Profit­Relation nach innen, das genaue Gegenteil: Beschäftigung, Löhne und Profitrate sinken – es sei denn, der bessere Arbeitsschutz erhöht die Arbeitsbereitschaft, so daß man auch bei niedrigeren Löhnen soviel Arbeit bekommt, wie zuvor. Dann würden evtl. nur die Löhne sinken. Reallohn und Nominallohn Auch hier gilt, daß, solange sich sonst nichts tut, ein höherer Geldlohn einfach ein höheres, ein niedrigerer Geldlohn ein niedrigeres Preisniveau bedeutet. Lohn, Preis, Profit S.33 Zu dieser Aussage gibt es eine Einschränkung, die auf die Quantitätstheorie des Geldes zurück geht. Wenn der von der Notenbank emittierte Bestand an Zentralbankgeld fest vorgegeben ist und wenn es eine feste Beziehung zwischen diesem Geldbestand und dem Volumen an Käufen gibt, die er ermöglichen kann, dann legt quasi die Notenbank das nominale Nationalprodukt fest. (Also die jährlich produzierte Menge an Gütern und Dienstleistungen mal ihren Preisen.) Hohe Preise (auf Grund hoher Löhne) würden dann bedeuten, daß entsprechend weniger Produkte umgesetzt werden können und deshalb die Beschäftigung niedriger sein wird. Diese Idee hört man gelegentlich noch von Mitgliedern des Sachverständigenrates, wenn sie sagen, die Notenbank gebe die Entwicklung des „ Geldmantels“ vor und die Tarifparteien könnten, über die Höhe der Tarifabschlüsse, darüber bestimmen, wie viel davon Preiserhöhung und wie viel zusätzliche Beschäftigung werde. Dies ist allerdings Quatsch, denn die Notenbank bestimmt nicht die Geldmenge, sondern den Zinssatz.30 Mittlerweile hat sich das 'r umgesprochen und kein seriöser Neoklassiker benutzt dieses Argument mehr. (Diese Aussage ist kein Widerspruch zur Feststellung, daß Mitglieder des SVR gelegentlich immer noch auf dieser ollen Karmelle herumreiten. Allerdings sollte sich das jetzt geben, weil Bofinger neu im SVR ist, und der hat das in seinem Lehrbuch zur Geldtheorie ebenfalls mitgekriegt.) Tendenzieller Fall der Profitrate? Ein tendenzieller Fall der Profitrate ist denkbar, wäre aber Gleichgewicht, nicht Krisenphänomen. Man stelle sich eine arme Ökonomie mit konstanter Bevölkerung vor. Diese Ökonomie produziert und dadurch steigen langsam Einkommen und Vermögen. Der Zuwachs an Vermögen bedeutet, daß Kapital mit der Zeit reichlicher wird, während die konstante Bevölkerung impliziert, daß sich am Arbeitsangebot nichts ändert – eher geht es sogar zurück, weil das höhere Vermögen bedeutet, daß die Menschen sich mehr Freizeit leisten können. Kapital wird also mit der Zeit relativ zur Arbeit entknappt und daher billiger angeboten werden. Dadurch sinken die Zinsen und die Profitrate kann fallen, die Löhne steigen. Der Prozeß ist zu Ende, wenn die Zinsen so weit gefallen sind, daß die Gesellschaft kein weiteres Vermögen mehr bilden will, daß also die jährliche Netto­Ersparnis Null wird. Die Gesellschaft hat ihren optimalen Vermögensbestand und das optimale Einkommensniveau erreicht. Die Ökonomie wächst nicht mehr weiter. Allerdings wirken diesem Prozeß praktisch nicht nur das Bevölkerungswachstum sondern auch der technische Fortschritt entgegen, der ja eine gleichzeitige Erhöhung der Löhne und der Profitrate ermöglicht (die Lohn­Profit­Relation verschiebt sich nach außen). Daher kann ein solcher Fall der Profitrate eintreten, er muß aber nicht. 30 Zentralbänker wußten das schon immer, im Zweifelsfall spätestens seit Goschen (ca. 1860) (vgl. auch de Kock). Riese hat 1991 in einem ausführlichen Papier darauf hingewiesen und, oh Wunder, so langsam merkt das sogar die herrschende Lehre. Ich gehe spätestens in Teil III, im Abschnitt Geldpolitik, ausführlicher darauf ein. Lohn, Preis, Profit S.34 Profitrate und Zinssatz Auch hier bestimmt die in der Produktion erwirtschaftbare Profitrate den Zinssatz. Letztlich wird daher der Reallzinssatz am Arbeitsmarkt bestimmt – gleichgewichtig ist der Realzinssatz, der der Profitrate entspricht, die sich bei dem Reallohn ergibt, bei dem der Arbeitsmarkt geräumt ist, also Vollbeschäftigung herrscht. Der Nominalzinssatz, also der Zinssatz, der von der Bank gezahlt wird und der in den Börsenteilen der Zeitung notiert ist, ist dann der Realzinssatz plus die Inflationsrate. Die Notenbank paßt ihren Zinssatz passiv diesem Marktzinssatz an. Tut sie dies nicht, entsteht entweder Inflation (wenn sie einen zu niedrigen Zins wählt) oder Deflation (wenn sie einen zu hohen Zinssatz wählt). Den Zinssatz, bei dem Preisniveaustabilität herrscht, nennt Wicksell (1898) den „ natürlichen Zins“. Diese Zinstheorie war zwar zwischenzeitlich einmal ein wenig aus der Mode, weil die Notenbank in der Quantitätstheorie gar keinen Zins nahm, aber mittlerweile feiert sie zu Recht ein come back (Romer, Laidler). Wer trägt die Steuern? Wenn wir die wohlfahrtstheoretischen Details weglassen, ist es auch in der Neoklassik egal, bei wem die Steuern erhoben werden: Getragen werden sie immer von beiden Parteien, von Lohnarbeit und Kapital, und in allen Fällen führen sie zu einem Rückgang der Beschäftigung. Lohnsteuer: Die entscheidende Größe für das Arbeitsangebot ist der Nettolohn – denn der Haushalt wählt, wenn er über sein Arbeitsangebot entscheidet, zwischen Lohn und Freizeit. Und Freizeit wird nicht besteuert. Also geht, wenn eine Steuer auf Löhne erhoben wird, das Arbeitsangebot beim alten Bruttolohn zurück. (Die Arbeitsangebots­ kurve verschiebt sich nach links.) Die Unternehmen müßten, wollten sie so viel Arbeit beschäftigen wie zuvor, höhere Bruttolöhne zahlen. Dafür aber müßte ihre Profitrate sinken. Also geht der Kapitaleinsatz zurück, damit die Zinsen sinken können, und die Beschäftigung sinkt. Im Ergebnis werden die Bruttolöhne etwas steigen, die Profitrate wird etwas sinken und die Beschäftigung ist geringer als ohne Steuer. Gewinnsteuer (nicht anders: Umsatzsteuern): Durch die Besteuerung der Profite geht die Nettoprofitrate zurück. Entsprechend können die Unternehmen weniger für Kredite zahlen. Die Kreditnachfrage geht zurück, also wird weniger Kapital eingesetzt. Daher ist die Arbeitsnachfrage niedriger. Entsprechend müssen die Löhne und die Beschäftigung niedriger sein. Eine Steuer auf Zinseinkommen hilft auch nicht weiter. Hier sinkt das Kreditangebot. Wollten die Unternehmen nun soviel Kredite aufnehmen wie zuvor, müßten sie höhere Zinsen zahlen – was sie aber nur könnten, wenn die Profitrate höher wäre. Entsprechend geht auch hier die Arbeitsnachfrage zurück, die Löhne sinken, die Beschäftigung sinkt, die Profitrate und die (Brutto­)zinssätze steigen.31 31 So führte etwa die Einführung einer 10%igen Zinsabschlagssteuer in der BRD Mitte der Lohn, Preis, Profit S.35 Wer die Hauptlast einer Steuer trägt, Arbeits­ oder Kapitaleinkommen, hängt vom konkreten Verlauf der Kurven ab und läßt sich daher nicht allgemein beantworten. Sicher ist aber, daß stets beide Gruppen von einer Steuer getroffen werden, egal, worauf diese erhoben wird, und daß in Folge der Steuer die Beschäftigung sinkt. Dies, nicht die (scheinplausiblen, hierzu später) Argumente zur Konsumnachfrage, ist die theoretische Rechtfertigung der Absenkung der Einkommensteuer. Die Ausnahme bilden wieder, wie in der Klassik, die Einkommen aus Grundvermögen sowie sonstige Monopol­ bzw. Knappheitsrenten. Sie könnten, jedenfalls, wenn man es geschickt anstellt, ohne Wirkung auf die Beschäftigung besteuert werden. Die keynesianische Variante: Geld regiert die Welt Tatsächlich gibt es keine keynesianische Lehrbuchversion einer Wert­ und Verteilungstheorie. Was es in diesem Zusammenhang gibt (Robinson/Eatwell oder Rotheim) bezieht sich meist auf Sraffa (der schließlich zum Kreis um Keynes gehörte). Dies hat einen systematischen Grund: Im Prinzip bleibt nur noch eine Möglichkeit offen: die Vorgabe der Profitrate – und es gibt eine Reihe von Kapiteln in der Allgemeinen Theorie von Keynes (Kapitel 12, 16 und 17), die auch in genau diese Richtung gehen. Aber darüber, wie genau diese Theorie auszusehen hat, in Sonderheit wenn doch eigentlich die Zentralbank den Zins setzt, herrscht keine Einigkeit. Hinzu kommt, daß Keynes schon früh, eigentlich schon mit einem Aufsatz von Hicks aus dem Jahre 1936, so uminterpretiert wurde, daß er in die Neoklassik paßte.32 Über lange Zeit waren daher die Lehrbücher so aufgeteilt, daß die Neoklassik für die Preise und die Keynesianer für die Beschäftigung zuständig waren – und die Keynesianer fanden sich darein und erklärten die Preistheorie zu unwichtigen Glasperlenspielen (Robinson), die sie gerne den anderen überließen, während sie sich um die wichtigen Themen, Arbeitslosigkeit und Verteilung, kümmerten.33 Nur funktioniert diese Arbeitsteilung nicht, denn, ich erinnere an das Preis­Mengen­ Diagramm, wenn die Neoklassik Preise bestimmt, bestimmt sie immer zugleich auch Mengen. Also führt die Preistheorie immer gleichzeitig auch auf die Beschäftigung. Und Achtziger zu einer schlagartigen Erhöhung des Zinsniveaus für Wertpapiere. Wenn man bedenkt, daß die Steuerehrlichkeit in diesem Bereich nicht gerade übertrieben ausgeprägt ist, wird die Zinssteuer für den Staat so zu einem Verlustgeschäft, weil er über die höhere Ver­ zinsung der Staatsschuld mehr zusätzliche Ausgaben hat, als er an Zinssteuer einnimmt. 32 Wo genau das Problem liegt, werde ich in Teil II erläutern. 33 Ich will nicht unterschlagen, daß es eine sehr wichtige Forschung im Anschluß an Clower gibt, die „ Mikrofundierung der Makroökonomie“ (Hahn/Solow ist das jüngste wichtige Werk in dieser Traditionslinie). Clowers Unterscheidung von effektiver und notionaler Nachfrage, die in Teil II eingeführt werden wird, ist meines Erachtens unverzichtbar für jeden nur denkbaren keynesianischen Ansatz. Aber auch Clower versteht seinen Ansatz nur als Abweichung vom neoklassischen Gleichgewicht. Ungleichgewichte können bei ihm stabiler sein, aber „ letztlich“ muß der Markt doch eine Tendenz zur Rückkehr zum neoklassischen Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung aufweisen. Lohn, Preis, Profit S.36 sie ist zwingend gleichzeitig Verteilungstheorie, weil Lohnsatz und Profitrate Preise sind. Dieses nicht­Funktionieren der Arbeitsteilung führte schließlich zum Niedergang des Keynesianismus in der akademischen Diskussion – er lieferte einfach keine komplette Theorie, erklärte lückenhaft, und er wies Widersprüche zur Preistheorie auf. Kurz, keynesianische Argumentation war unsauber, unsolide, schlechte Theorie. Ich werde in der Folge meinen eigenen Ansatz skizzieren, mit dem ich versucht habe, einen konsistenten keynesianischen Ansatz zu basteln, einen Ansatz der damit begann, daß ich fragte, wie denn eine Wert­ und Verteilungstheorie aussehen müßte, die keynesianische Ergebnisse liefern kann. Auf dem Niveau, auf dem ich hier Theorien präsentiere, wird dieser Ansatz ebenso komplett wirken, wie Klassik und Neoklassik. Ich will aber der Ehrlichkeit halber nicht verhehlen, daß ich weder im Alleingang gegen die gesamte ökonomische Forschung anstinken kann, noch die mathematischen Fähigkeiten eines Frank Hahn habe. Daher ist der Ansatz praktisch formal weit weniger ausgearbeitet, als die beiden anderen Theorien. Wert­ und Verteilungstheorie Kapital ist nicht knapp, es ist sehr viel richtiger zu sagen, daß knapp gehaltenes Geld Kapital knapp hält, sagt Keynes sinngemäß im 16. Kapitel der Allgemeinen Theorie. Eine Passage, die viele Kommentatoren für eine der (neben dem fabulösen 17. Kapitel) dunkelsten Stellen der Allgemeinen Theorie halten (so z.B. Alvin Hansen). Dabei ist die Idee in Termini unseres Produktionspreismodells doch sehr simpel – anstatt daß die Profitrate den Zinssatz bestimmt, bestimmt eben der Zinssatz die Profitrate. Damit entscheidet im Unterschied zur Klassik und Neoklassik nicht der Reallohn des Arbeitsmarktes über die Profitrate, sondern der Zinssatz erzwingt eine (zumindest) gleich hohe Profitrate. Damit lautet die Ableitungskette: An den Vermögensmärkten bestimmter Zins ==> Profitrate ==> Reallohn. Eine keynesianische Preis­theorie startet deshalb bei einem von den Vermögensmärkten bestimmten Zinssatz.34 34 Ich weiß, das löst Bauchschmerzen aus, weil „ hinter den Zinseinkommen doch letztlich produzierte Güter stehen müssen“. Aber, Leute: so what? Natürlich stellt das Geldkapital die Güter nicht her – es bestimmt aber über ihre Verteilung. Muß ich Euch denn wirklich etwas über Entfremdung, Verdinglichung und den Fetischcharakter des Geldkapitals erzählen? Und bedenkt bei der Interpretation des Fetischbegriffs bei Marx: Fetische sind Gegenstände, denen die Gesellschaften Macht verleihen – sie haben diese Macht zwar nicht aus sich selbst, aber wenn sie auf sie übertragen wird, wirkt diese Macht auf die Gesellschaften zurück (vgl. das Exzerpt zum Fetischbegriff – wenn ich mich nicht irre, steht das den „G rundrissen“) . Lohn, Preis, Profit Dieser Zinssatz bestimmt die Profitrate – und wenn wir erstmal die Profitrate haben, ist der Lohnsatz über die Lohn­Profit­ Relation bestimmt. S.37 Abb. 8: Lohn­Profit­Relation bei Keynes r 400% Keynesianische Theorie macht so den Reallohnsatz zur Restgröße und stellt damit die Klassik (nun ja: zumindest aus 150% meiner Warte) vom Kopf auf die Füße. Nicht das Kapital bekommt das, was die Arbeiter ihm übrig lassen, sondern die Arbeiter 0,125 0,2 w/p verdienen das, was die Verwer­ tungsinteressen des Kapitals ihnen übrig lassen. Nicht das Profiteinkommen ist die Restgröße, das Surpluseinkommen, sondern der Lohn. Eine solche Theorie weist einen entscheidenden Unterschied zu den andern Ansätzen auf: Die Preis­ und Verteilungstheorie ist nicht an Vollbeschäftigung gebunden. Weder muß sich, wie in der Klassik, das Arbeitsangebot an die Beschäftigung anpassen, noch müssen, wie in der Neoklassik, alle Haushalt, die dies wollen, eine Beschäftigung finden. Keynesianische Preis­ und Verteilungstheorie funktioniert bei Arbeitslosigkeit. Keynesianisch ist also das Skandalon eines Gleichgewichts bei Unterbeschäftigung zumindest denkbar. Und tatsächlich wird es der theoretisch zu erwartende Normalfall sein. Zwar wird die Theorie der Beschäftigung erst Gegenstand von Teil II sein, aber ich muß hier doch ein wenig vorgreifen, um zu erklären, wie der Zinssatz erklärt werden kann. Um zu investieren, brauchen Unternehmen (jedenfalls auch:) Kredit. Das ist zunächst kein größeres Problem, denn Kredit ist Geld und Buchgeld kann man einfach auf Konten schreiben (schöpfen) und Zentralbankgeld kann man drucken. Das Problem besteht aber darin, daß Kredite und Guthaben zwei Seiten einer Medaille sind: Mit jedem Kredit entsteht zugleich ein Guthaben (das das Unternehmen an seine Lieferanten oder an seine Arbeiter überweist). Und dieses so entstehende Geldvermögen muß auch von irgendwem gehalten werden. In offenen Volkswirtschaften ist die Alternative zum Halten von Landeswährung das Halten von Auslandswährung – das aber würde, so die Zentralbank nicht interveniert, eine Abwertung bedeuten. Und in einer geschlossenen Volkswirtschaft, die keine Fremd­ währung kennt, gibt es immer noch die Möglichkeit der Flucht in Sachwerte (Grund­ stücke, Gebäude – zu Beginn der siebziger Jahre wurde der Slogan vom „ Betongold“ pro­ minent) – das aber bedeutet steigende Preise. Will die Zentralbank ihre Währung verteidigen – weder eine Inflation noch eine Abwertung hinnehmen (und letztere könnte Lohn, Preis, Profit S.38 über die Preise der Importgüter auch wieder eine Inflation lostreten), dann muß sie, bei einer Ausweitung des Geldvermögens in ihrer Währung, höhere Zinsen durchsetzen. Denn nur dann wird das zusätzliche Geldvermögen auch freiwillig, ohne Gefahr für die Geldwertstabilität, von den Vermögenseigentümern gehalten. Unter sonst gleichen Umständen erfordert also eine höhere Produktion ein höheres Zinsniveau. Andererseits aber bedeuten höhere Zinsen niedrigere Löhne und damit eine Einkommensumverteilung von der Arbeit zum Kapital. Wenn nun Reiche durch­ schnittlich mehr sparen wollen als Arme, dann muß die Nachfrage langsamer steigen als das Angebot, wenn ein höheres Angebot höhere Zinssätze erfordert. Ein Gleichgewicht zwischen Güter­ und Vermögensmarkt stellt sich daher bei dem Zinsniveau her, bei dem das Angebot von Gütern und Dienstleistungen (das Volkseinkommen) gleich der Nachfrage ist. So, wunderschön. Nun haben wir alles bestimmt: Das Volkseinkommen, daher die Beschäftigung – denn wenn ich 10 Sack Weizen pro Jahr produziere ((Brutto­) Nationalprodukt), brauche ich, das sagt mir meine Technik, 40 Arbeiter. Den Zinssatz und damit die Profitrate – also auch die Reallöhne. Damit habe ich beides: Reallöhne und Beschäftigung, ehe ich auch nur ein Wort über den Arbeitsmarkt verloren habe. Sicher, eine Restriktion gibt es: Ich muß zu diesem Reallohn genügend Arbeiter finden, sonst lande ich in einer Inflation (Lohn­Preis­Spirale). Aber es können ruhig mehr da sein, als ich brauche. Es kann also ohne weiteres Massenarbeitslosigkeit herrschen und die Volkswirtschaft ist trotzdem im Gleichgewicht – solange es Institutionen gibt, (Gewerkschaften, Mindestlöhne, Sozialleistungen) die eine Deflation, ein Abstürzen der Geldlöhne und ­preise ins Bodenlose verhindern. Sicher, Vollbeschäftigung ist ein denkbarer Extremfall. Aber er wäre zufällig, es gibt keinen Marktprozeß dorthin und nichts macht ihn wahrscheinlicher als irgend ein anderes denkbares Niveau an Arbeitslosigkeit größer Null. Tendenzieller Fall der Profitrate? Da die Zinssätze vorgegeben sind, führt technischer Fortschritt unter sonst gleichen Bedingungen zu einer Erhöhung der Reallöhne (Ob er die Beschäftigung erhöht oder senkt, ist in Teil II noch zu diskutieren). Demzufolge werden die Kosten von Arbeitsschutzvorschriften von den Reallöhnen getragen. Die Logik manteltariflicher Forderungen besteht also darin, daß die Arbeiterinnen bessere Arbeitsbedingungen gegen Realeinkommen tauschen. Dies ist, darauf wird in Teil III noch einzugehen sein, nur kollektivvertraglich möglich. Einen tendenziellen Fall der Profitrate gibt es nicht – wohl aber unterschiedliche Zinsniveaus für unterschiedlich starke Währungen. Eine stärkere Währung führt, unter sonst gleichen Bedingungen, auf niedrigere Zinssätze, eine niedrigere Profitrate und daher höhere Reallöhne. Ferner steigen die Lohn, Preis, Profit S.39 Reallöhne (nicht aber: die Profitrate) durch technischen Fortschritt (steigende Kapital­ oder Arbeitsproduktivität). Der Keynesianismus hat also, statt eines tendenziellen Falls der Profitrate, eine Theorie des tendenziellen Anstiegs der Reallöhne. Natürlich, auch das sei noch vorweggenommen – die Stärke einer Währung ist relativ. Der Erfolg einer Währung ist daher der Niedergang anderer. Die ökonomische Stagnation Großbritanniens in der Zwischenkriegszeit ist nicht zuletzt dem Aufstieg des $ geschuldet. Und die (relative) Stärke des $ hat einen großen Anteil an den ökonomischen Problemen Lateinamerikas. Aber dazu mehr in Teil IV. Die (monetär)keynesinanische Antwort auf die Fragestellung der Klassiker lautet daher: Die klassische Theorie saß mit ihrer Fragestellung einer optischen Täuschung auf, die auf die falsche Frage führte: Nicht die Profitrate (der Zinssatz) ist im Trend gesunken, sondern lediglich das englische Zinsniveau ist gesunken. Im 17. Jahrhundert war der Gulden der Bank von Amsterdam die internationale Leitwährung, im späten 18. Jahrhundert begann der Aufstieg des Pfundes (weil Großbritannien zum Weltgläubiger wurde) und daher sanken die Zinsen der Bank of England. Zeitgleich ist u.a. das holländische gestiegen. Aber im 19. Jahrhundert schaute niemand mehr auf das Zinsniveau in Amsterdam. Profitrate und Zinssatz Es dürfte bereits klar geworden sein, daß in diesem Modell im Gleichgewicht der Zinssatz die Profitrate bestimmt. Also sind auch hier – wie übrigens aus guten Gründen in allen anderen Theorien – Zinssatz und Profitrate im Prinzip (abgesehen von Risiko­ prämien etc.) gleich hoch – andernfalls könnte ich mir Geld zu 10% leihen und es zu 20% anlegen. Die Kreditnachfrage würde explodieren und den Leihzins in die Höhe treiben. Zwar kann es auch hier, im Zuge von Geld­ Finanz­ oder Währungskrisen, zu einer kurzfristigen Entkoppelung von Zinssatz und Profitrate kommen. Aber das ist ein Phänomen der Krise, auf das ich in Teil III (Geldpolitik) sowie in Teil IV (Abschnitte Schuldenkrise und Dollarisierung) eingehe. Für das Gleichgewicht und für die durchschnittliche Entwicklung kann dies nicht vorkommen. Reallohn und Nominallohn Auch hier folgt, daß der Nominallohn nicht den Reallohnsatz sondern nur den Geldpreis des Produkts bestimmt. Diese Theorie des Reallohnes, die wir hier mikroökonomisch, über die Preistheorie bestimmt haben, gibt es in einer makroökonomischen Form schon seit Keynes' „ Vom Gelde“. Es ist die sogenannte mark­ up­Gleichung. Nach ihr bestimmt sich das Preisniveau durch einen Aufschlag (mark­up) der Unternehmer auf die Lohnstückkosten, der ihren Profit sichert. Lohn, Preis, Profit S.40 Die Lohnstückkosten sind Geldlohn geteilt durch Arbeitsproduktivität (diese ist ja Stück pro Arbeitseinheit). Die Arbeitsproduktivität ist 1/a (S. 5). Also lautet die mark­up Gleichung: P = [w/(1/a)] + [w/(1/a)]*m ==> P = [w/(1/a)] * (1 + m) oder P = (1+m) * w * a Inhaltlich genau die gleiche Beziehung wurde hier mikroökonomisch entwickelt : p= 1 ∗w∗a 1−k−r∗k Auch hier ist das Preisniveau gleich den Lohnstückkosten (w * a) mal einer Größe, die größer eins ist (im Nenner des Bruchs steht ja weniger als eins) und die, solange sich nicht der Kapitaleinsatz (k) pro Stück ändert, konstant ist. Daß der Kapitaleinsatz hier auftaucht, ist sinnvoll – wenn mehr Kapital eingesetzt wird, sind die Kapitalkosten pro Stück höher, also muß ein höherer Preis durchgesetzt werden. Dies ist ein Zusammen­ hang, den man in der mark­up­Gleichung nicht sieht. Er ist in den Annahmen über m versteckt. Ansonsten sind die Verhältnisse wie in der mark­up­Gleichung: Ein höherer Geldlohn bedeutet, unter sonst gleichen Umständen, höhere Preise, eine höhere Arbeitsproduktivität niedrigere und ein (wegen gestiegenem k oder gestiegenem r) höherer mark up verlangt höhere Preise. Einige Keynesianer verteidigen diese mark­up­Gleichung mit dem Argument, die Keynesianer hätte eine andere Theorie des Unternehmerverhaltens als die Neoklassik, für Keynes würden die Unternehmer nicht den Profit maximieren, sondern eine Aufschlags­ kalkulation auf die Lohnkosten vornehmen (vgl. Spahn). Ich habe gezeigt, daß diese Verhaltens­Annahme nicht erforderlich ist – die mark­up Beziehung läßt sich aus dem gleichen mikroökonomischen Modellrahmen entwickeln, in dem wir die neoklassische Preistheorie diskutiert haben. Nicht die Annahmen über das Verhalten der Unternehmer sind anders, sondern die Annahmen über die Funktionsweise des Wirtschaftssystems Kapitalismus. Dieser Zusammenhang, daß der eigentliche Preis der Arbeit, der Reallohn, gar nicht am Arbeitsmarkt bestimmt werden kann, erlaubt eben die Preistheorie auch für einen Fall der Unterbeschäftigung. Der Arbeitsmarkt ist für die Bestimmung der relativen Preise und der Verteilung völlig entbehrlich. Er legt mit dem Niveau der Geldlöhne nicht mehr fest, als den Numeraire, die Zähleinheit, in der die Geldpreise ausgedrückt werden – und diese ist in allen Theorien ökonomisch unwesentlich. Deshalb muß er auch nicht geräumt sein, muß die Preistheorie nicht Vollbeschäftigung unterstellen. Es ist egal, ob ich in €, Cent, oder, wie wohl noch die meisten von uns, in Gedanken noch in Mark rechne, alle Preise mal zwei nehme. Dadurch kann ich mir weder mehr noch weniger leisten. Der wichtige Preis, der Reallohn, wird eben nicht am Arbeitsmarkt durchgesetzt, sondern am Gütermarkt, weil die Preise, gegeben den Geldlohn, auf das Niveau herunter­ oder hochkonkurriert werden, bei dem die gleichgewichtige Profitrate, und nur diese, realisiert werden kann.35 35 Auch hier erinnere ich für die gleichgewichtige Profitrate wieder daran, daß diese durchaus, wenn wir die Annahme vollständiger Konkurrenz aufgeben, auch Monopolprofite berücksichtigen kann. Lohn, Preis, Profit S.41 Wer trägt die Steuern? Ich kann mich kurz fassen – da die keynesianische Verteilungstheorie das Spiegelbild der klassischen ist – klassisch sind die Gewinne Restgröße, keynesianisch die Löhne –, ist es hier genau umgekehrt wie in der Klassik: Die Steuer wird immer von den Arbeitern getragen, egal, wer sie abführt: Lohnsteuern zahlen die Arbeiter direkt, Gewinn. und Umsatzsteuern tragen sie über höhere Preise. Die Ausnahme bilden auch hier, wie in den beiden anderen Theorien, Knappheits­ renten, also Erträge aus Grundbesitz oder aus sonstigen knappen Angeboten. Resümee: Löhne, Preise, Profite, Produktivität Nochmal ein kurzer Überblick über die wesentlichen Unterschiede in den drei Theoriegebäuden: Preis­ und Verteilungstheorie: Klassik: Der Reproduktionslohn (mithin: der Netto­Reallohnsatz) wird vorgegeben. Bestimmt wird die Profitrate. Neoklassik: Am Arbeitsmarkt wird die Kombination von Profitrate und Reallohnsatz gefunden, bei der Vollbeschäftigung herrscht. (monetärer) Keynesianismus: Die Profitrate wird (über den Zinssatz) vorgegeben. Bestimmt wird der Brutto­Reallohnsatz (sowie das Nationalprodukt). Zinstheorie Klassik: Die Profitrate bestimmt den (Real­)Zinssatz auf Geldvermögen. Neoklassik: Die Profitrate bestimmt den (Real­)Zinssatz auf Geldvermögen. (monetärer) Keynesianismus: Der (Real­)Zinssatz auf Geldvermögen bestimmt die Profitrate. Vollbeschäftigung für das Gleichgewicht erforderlich? Klassik: Ja, Arbeitsangebot paßt sich an die Arbeitsnachfrage an. Neoklassik: Ja, Gleichgewicht des Arbeitsmarktes bestimmt Reallohnsatz und Profitrate. (monetärer) Keynesianismus: Nein. Wozu? technischer Fortschritt Klassik: erhöht die Profitrate Neoklassik: erhöht Profitrate, Reallöhne, Volkseinkommen und Beschäftigung (monetärer) Keynesianismus: erhöht die Reallöhne. Die Wirkung auf die Beschäftigung hängt von der Wirkung auf die Nachfrage ab. Mehr hierzu in Teil II. Lohn, Preis, Profit S.42 Steuern Klassik: Alle Steuern werden aus den Profiten gezahlt. Keine Auswirkung auf die Beschäftigung. Neoklassik: Alle Steuern belasten sowohl die Reallöhne als die Profitrate. Sie senken die Beschäftigung und das Einkommen. (monetärer) Keynesianismus: Alle Steuern werden aus den Löhnen gezahlt. Für die Wirkung auf die Beschäftigung verweise ich auf die Teile II und III. (Vorab: Nutzt der Staat die Steuereinnahmen zur Nachfrage, so erhöhen sie Nationalprodukt und Beschäfti­ gung). Bei ökonomisch funktionalem Einkommen bewirkt eine Steuer, daß weniger als zuvor von der entsprechenden Leistung angeboten wird. Dadurch kann die Steuer überwälzt werden. Daher treffen in der Klassik alle Steuern die Profite, während im Keynesianismus alle Steuern die Löhne treffen. Einzig in der Neoklassik sind sowohl Löhne wie Profite funktionales Einkommen. Das Gesagte gilt sowohl für direkte wie für indirekte Steuern. Ökonomisch funktionsloses Einkommen, reine Knappheitsrenten – wie die Pacht­ erträge von Grundstücken, die Differenz der Mieten von Geschäften in „ guter Lage“ zu gehobenen Durchschnittsmieten, Extra­Profite von Monopolen, „w indfall­profits“ von Erdölfeldern oder Mienen oder die Gehälter von Fußballern – kann man in allen Theorien durch eine Steuer treffen.36 Dies deshalb, weil die entsprechenden Leistungen auch zu einem niedrigeren Preis bereit gestellt würden:37 Grundstücke sind nun mal „ da“, gleichgültig, wie viel man mit ihnen erlösen kann. Eine höhere Steuer bewirkt lediglich eine Umverteilung der Knappheitsrenten vom Eigentümer hin zum Staat – mit der einzigen ökonomischen Konsequenz, daß der Vermögenswert dieser Objekte durch die Steuer sinkt. 36 Allerdings bleibt natürlich die Möglichkeit der Steuervermeidung – sei es durch Ausnutzen der Steuergesetze, sei es durch Steuerflucht – oder, wie die Neoliberalen das so euphemistisch nennen, durch den Steuerwettbewerb zwischen Staaten. Das ist aber ein praktisches, nicht ein prinzipielles Problem. 37 Eine extreme Anwendung dieses Zusammenhangs ist die Kopfsteuer, bei der Steuern völlig unabhängig vom Einkommen erhoben werden. Da man nun mal „da“ ist, ohne daß man dafür bezahlt werden müßte, kann (außer in der Klassik) die Kopfsteuer wie die Grundsteuer nicht überwälzt werden, was sie für die Neoklassik besonders attraktiv macht. In Großbritannien ist Thatcher nicht zuletzt über die Einführung der poll­tax gestürzt und auch in Deutschland, das ja ganz gerne die Fehler der anderen mit mehrjähriger Verspätung als neuesten Schrei nach­ vollzieht, kommt sie scheinbar langsam in Mode – denn nichts anderes als eine Kopfsteuer stellt der Vorschlag dar, die Krankenversicherungen über einkommensunabhängige Pflicht­ Beiträge zu finanzieren. Die Kopfsteuer ist nur für die Neoklassik attraktiv, denn in der Klassik müßte der (Brutto­) Lohnsatz steigen, wie bei jeder Steuer auf die Löhne auch, da sonst der Reproduktionslohn nicht mehr gewährleistet wäre. Und Keynesianisch ist sie uninteressant, weil das Argument nur bei Vollbeschäftigung zum Zuge kommt: Wenn ich sowieso Massenarbeitslosigkeit habe, was schadet es dann, wenn Einige auf Grund der Steuern etwas kürzer arbeiten wollen?