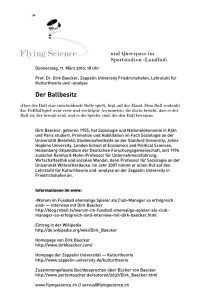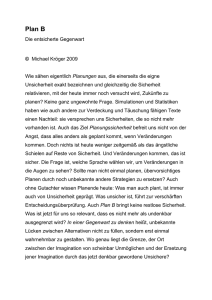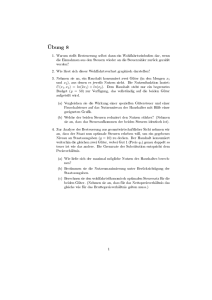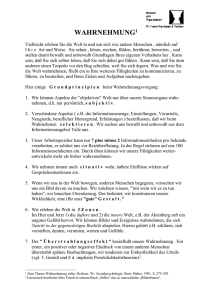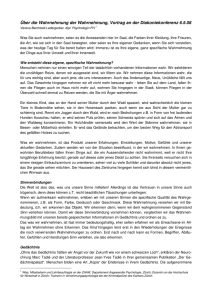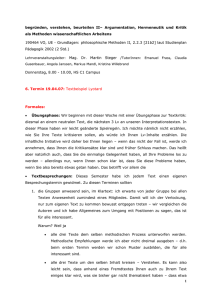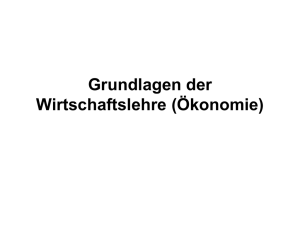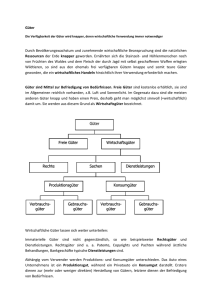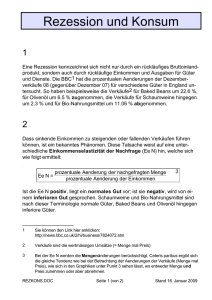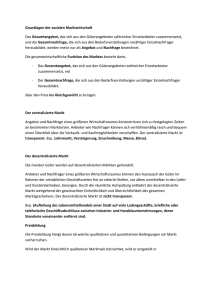Kunst als Ressource der Wirtschaft - Zeitschrift für Wirtschafts
Werbung

Kunst als Ressource der Wirtschaft* BIRGER P. PRIDDAT** Art as an Economic Resource Art und markets are different spheres, but they are overlapping in a certain way – in the perception of something new. In the markets they call it innovation, in art it is to deal with the new. Usually communication matters in economy, not perception. To learn from arts to deal with the perception of something new is a model for the economy to analyze itself in a different way. Keywords: Kunst, Wirtschaft, Innovation, Kreation, das Neue 1. (1) (2) (3) Einführung Zuerst ein paar Trivialitäten. Kunst und Wirtschaft scheinen sich gegenüber zu stehen. Manche meinen: unversöhnlich. Andere meinen, dass die Wirtschaft sich der Ressourcen der Kunst bedient. Manche meinen: schamlos. Nun ist die Kunst einzigartig (wenn das auch keine einzigartige Interpretation ihrer ist). Stellt sie aber jeweils Unikate her, ist ihr, au contraire de l’économie, nicht deren Umsatz- und Profitbegehren durch Umsatz- und Absatzausweitung unterstellbar: der Kunst fehlt gewöhnlich jede serielle Fertigung (einige Künstler ausgenommen, die mit der Kopie der Serie der Industrie ironisch auf den Kunstbetrieb reagierten, der natürlich, und zwar immer schon, ein marktlicher ist (und war)). Die Qualität von Waren/Gütern, immer identisch gleich zu sein, selbst in höchster Seriengröße, ist, momentan noch, in der Wirtschaft gewünscht. Nicht hingegen bei der Kunst, die neu (vgl. Girard 2004; Sp. 5): überraschend, anders, variant etc. sein soll. Jedenfalls in ihrer modernen Variante. Dass Kunst, wenn sie etabliert ist, seriell reproduziert wird, ist ein nachfolgender Verwertungszusammenhang, nicht aber ihr Entstehungszusammenhang. Hier – in ihrem Eigensten – ist Kunst nicht einmal innovativ (das lässt sie der Wirtschaft), sondern inventiv: Neues schaffend (oder Neues variierend (vgl. Girard 2004: Sp. 5)). Sie schließt dort zur Wirtschaft auf, wo das Neue, das Kunst schafft, auch in die Wahrnehmung des Betrachtens gelangen muss, um Geltung ________________________ 324 * Beitrag eingereicht am 12.06.2006; nach doppelt verdecktem Gutachterverfahren überarbeitete Fassung angenommen am 19.10.2006. ** Prof. Dr. rer. pol. Birger P. Priddat, Head of Department for Public Management & Governance und Lehrstuhl für Politische Ökonomie, Zeppelin University gGmbH, Am Seemooser Horn 20, D-88045 Friedrichshafen/Bodensee, Tel.: +49-(0)7541-6009-1411, Fax: +49-(0)7541-6009-1499, E-Mail: [email protected], Forschungsschwerpunkte: Institutionenökonomik, Netzwerktheorie, Wirtschaftsethik, Theoriegeschichte, Staatsreform. (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) zu erlangen. Das geschieht, wenn das, was die Kunst als neu anbietet, ereignishaft wird. So ist Kunst für die Wirtschaft dann von höchster Bedeutsamkeit, wenn sie Muster/Modelle liefert für das Auf- und zuvor Wahrnehmen von Neuem: durch Überraschung, Aufmerksamkeiten differenziertester Art etc. Das meint man wahrscheinlich, wenn man meint, dass Kunst ‚ganzheitlicher‘ sei. So redet man, wenn man die Kunst gegenüber der Wirtschaft höherrangig machen will. Man hat dann eine Art von Vorstellung über imaginäre Komplementarität. Was in der Realität ‚zu wenig‘ sei, habe die Kunst zu vollenden, ‚ganz‘ anzubieten. Wenn das so ist, dann vervollständigt Kunst Realität (selbst dann, wenn sie realistische Kunst wäre, vervollständigte sie die Realität durch Realität (hyperreality)). Und wenn das so ist, dann ist die Realität, die nicht durch Kunst komplementiert ist, unvollständig. Doch wäre das eine einseitige Interpretation, denn, wie andere meinen, schafft Kunst eine eigene Realität. Es reicht, wenn wir hier damit operieren: Kunst unterbricht Realität – die eigene wie mögliche andere, wenn sie nahe genug in Verbindung gebracht werden. Kunst lässt die Menschen, Künstler wie Betrachter, ‚mehr wahrnehmen‘. Nur ist das dann mit ‚ganz‘ oder ‚ganzheitlich‘ missweisend bezeichnet. Das ‚mehr‘ ist kaum ‚ganzer‘, sondern mehr: opening the frame – neue Horizontierung, neue Aspektierung, Öffnung. Doch ist das auch noch ungenau. Denn das ‚mehr‘ ist natürlich möglicherweise mehr als ‚ganz‘. Denn wenn das, was Kunst anbietet, ‚mehr‘ ist, als man gewöhnlich wahrnimmt, dann leistet Kunst einen genaueren Blick: also ‚mehr Wirklichkeit‘? Oder: ‚mehr als wirklich‘? Ist ihr Geschäft Transzendierung (um einen älteren Ausdruck zu gebrauchen). Oder Optionenüberschuss? Es reicht, wenn man konstatiert, dass Kunst noch anderes wahrnehmen lässt, als was im Alltag oder gewöhnlich wahrgenommen wird. Kunst öffnet Aspektenmannigfaltigkeiten, neue Dimensionen, andere Sichtweisen. Kunst betreibt horizoning. Wenn also gilt, dass man diese anderen Sichtweisen, Horizonte, Dimensionen etc. gewöhnlich nicht wahrnimmt, dann zeigt Kunst, über das hinaus, was sie offensichtlich zeigt, was wir gewöhnlich nicht-wahrnehmen: the other side of the mirrow. Doch unterschlagen diese Betrachtungen die Differenzierungen, die nötig sind: es genügt nicht, wahrnehmen und nicht-wahrnehmen auseinander zu halten, weil wir gewöhnlich noch die Unterscheidung erkennen/wahrnehmen benutzen. Die Diskurse, die wir über Kunst führen, sind epistemische Diskurse. Indem wir darüber reden, wie wir oder dass wir wahrnehmen, nehmen wir nicht wahr, sondern rekapitulieren Wahrnehmungen in begrifflichem Zuschnitt. Wahrnehmungen als Wahrnehmungen zu kommunizieren, ist fast unmöglich. Wir müssen sie in Worte/Bilder/Töne fassen (sie gleichsam ein-bilden): und produzieren dann, unter anderem, Kunst. Rezipienten, die das nicht können, bleiben hier kommunikationslos (also ohne kognitiv geladene Kommunikation). Aber das ist ja gerade die Form des Ereig- zfwu 7/3 (2006), 324-335 325 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 326 nisses, die wir als Kunst aufnehmen: als Differenz von Kommunikation und Wahrnehmung. Das Betrachten von Kunst ist jene einzigartige Form der Kommunikation, die im Wahrnehmen eine Differenz zur Kommunikation entfaltet (vgl. Baecker 2001: 4). Was D. Baecker als Differenz von Kommunikation/Wahrnehmung analysiert, bezieht J.-F. Lyotard auf das Betrachten von Malerei, der es darum gehe, „die Entwaffnung des Geistes zu fordern“ (Lyotard 1989: 256). „Die Malerei vervielfältigt die Intrigen, Techniken, Theorien, um die Repräsentation zu überlisten und mit ihr zu spielen. Diese gehört zum willentlichen Gedächtnis, zur Intelligenz, zum Geist, zu dem, was fragt und Schlüsse zieht. Doch es geschieht, dass das Gelb, zum Beispiel der Stadt Delft bei Vermeer den Willen und die Intrige eines Marcels aussetzt“ (Lyotard 1986: 256). Deswegen gibt es keine Übersetzbarkeit von Kunst in Wirtschaft: weder in kreative Prozesse, noch in Produkte (bzw. deren Design (vgl. dazu den schwierigen Dialog Jepsen et al. 2003), noch in Werbung – wenn auch vieles genutzt wird (vgl. Priddat 2004). Denn Kunst ist die Differenz der Wahrnehmung zu allem, was wir bereits kennen oder wissen (oder meinen, so und nicht anders immer schon wahrgenommen zu haben). Kunst kann abgeholt werden durch die Wirtschaft, genutzt und verwendet: dann aber nicht mehr ‚als Kunst‘, sondern schattenbildhaft: als disegno von Kunst, nicht mehr als Kunst selbst. Denn wenn Kunst die Unterbrechung der Wahrnehmung ist, dann ist sie auch die Unterbrechung der Kommunikationen. An der Kunst erfahren wir, dass das, was wir wahrnehmen (oder meinen, wahrzunehmen), eine eigene Dignität hat, die die Kommunikation unterbricht, d. h. das immer schon sogleiche Zuhandensein von Bedeutungen unterbricht. Kunst ist weder, auch nicht im Abstraktesten, reines Wahrnehmen (weil immer bereits kontextuell ‚verschmutzt‘), noch bedeutungsgeleitet. Kunst geschieht, wenn das Wahrnehmen wahrnimmt, dass es wahrnimmt, aber nicht gleich konfiguriert, sondern offen, schweben lässt, welche Potentiale sich hierin bergen. „Dies ist die Funktion der Kunst“, schreibt D. Baecker. „Sie erlaubt es dem Bewußtsein, sich an Kommunikationen zu beteiligen, die ihm Wahrnehmungen ermöglichen, in denen es die eigene Differenz gegenüber jeder Kommunikation erfahren kann“ (Baecker 2004: 4). Eine Wahrnehmung, die jeder Kommunikation gegenüber different ist, beschreibt Lyotard bei Cezanne: „Eine Farbschattierung erfasst den Maler oder entzieht sich ihm. Cezanne vor seinem Berg. Er versucht, ihn auf seine Unterlage zu bringen. Er weiß, dass er ihm nicht getreu werden wird. Doch was versucht er dann? Dass der Betrachter seinerseits dieses Entziehen empfindet (…), wenn er vor der im Bild aufgetragenen und komponierten Farbe steht“ (Lyotard 1986: 256). Jene Differenz ist selber nicht ohne weiteres kommunizierbar. Sie wirft auf ein Wahrnehmen zurück (oder: voran), d. h. auf bedeutungsfreie Zonen. Erst wenn dem Wahrnehmen eine Interpretation folgt, beginnt die Sprache einzusetzen, (19) (20) (21) (22) (23) das Bewusstsein, die Kognition, der Geist, as You like. Lyotard fährt fort: beim Entziehen der Schattierung bei Cezanne geht es „nicht um Authentizität. Dieses ist ein Wert des Marktes“ (Lyotard 1986: 256). Hier sind wir wieder in der Kommunikation, diesseits der Wahrnehmung, um in Baeckers Terminologie zu bleiben. Indem wir in der Kommunikation sind, sind wir bereits im Markt, der Kunst als Authentizität von Bildern handelt. Das „Ereignis“, das für Lyotard die Kunst bedeutet (Lyotard 1989: 186), unterscheidet sich von den Ereignissen, die die Wirtschaft ausmachen: „Das Vorkommnis, das Ereignis hat nichts mit dem Prickeln, dem Pathos des Rentablen zu tun, das eine Innovation begleitet“ (Lyotard 1989: 187). Gegen das Funktionieren der Innovationen der Wirtschaft unterbricht das Ereignis der Kunst die Metaphysik des Kapitals (vgl. Lyotard 1989: 187). Natürlich setzt man in der Kultur auf Differenz. Auch und gerade in der Relation Wirtschaft/Kunst. „Milliarden fließen in den deutschen Kulturbetrieb“, interpretiert man gewöhnlich die Lage, aber alles sei eher „Trompetenblech“. Das ist normale kulturkritische Kritik der Wirtschaft/Kultur-Relation (Schmidt 2004: 45, Sp. 1). Denkt man so, denkt man, dass der „überwiegende Anteil an der zeitgenössischen Kunst (…) nichts anderes als Kunstgewerbe“ ist (Schmidt 2004: 45, Sp. 1). Nun ist das ein billiges Wortspiel: Kunst und Ökonomie als ‚Kunst-Gewerbe‘ argwöhnisch zu synthetisieren, liegt zu sehr auf der wortspielerischen Hand, als dass man es ausspielen dürfte „Durchschnittskunst hat klare soziale Funktion, aber keine besonders weiten Sinnhorizonte. Um darin ein Körnchen Transzendenz aufzufinden, muss man schon eine Menge Fantasie mitbringen“ (Schmidt 2004: 45, Sp. 1). Zwei Pluspunkte der Kunst sind damit bereits notiert: ‚Sinnhorizonte‘ und ‚Transzendenz‘. „Bedeutende Kunst“ – im Gegensatz zu unbedeutendem Kunstgewerbe – „steht in einem Verhältnis misstrauischer, wenn nicht aggressiver Gleichgültigkeit zur heutigen Gesellschaft“ (Schmidt 2004: 45, Sp. 3). In einem anderen Kontext würde man diesen Satz als extrem elitär bezeichnen. Es geht um Distanz. Kunst ist Distanznahme. „Sie verkompliziert das Dasein. Auf schmerzliche Weise konfrontiert sie mit den Gebresten des eigenen Ich“ (Schmidt 2004: 45, Sp. 3). „Große Kunst“ ist „radikal individualistisch“. Das heißt: sie geht in die Differenz. Es ist wichtig, für die Relation Wirtschaft/Kultur, die Distinktion von Wirtschaft/Kunst hochzufahren. Doch steht diese Distinktion, als überkommenes Kulturgut, gleichsam als hoher Wert, in Frage. Ist das Mehr, der Überschuss an Kunst auch normativ ‚mehr‘? Hier beginnen sich die Geister zu scheiden. Viele befragen die Kunst: was sie leisten kann für andere gesellschaftliche Entwicklungen. „Jedes Kunstwerk, jedes Kunstereignis arbeitet selbst am Problem, als solches zur Kenntnis genommen zu werden. Darin steckt eine Kompetenz, die eine Wirtschaft auf der Suche nach knapper gewordenen Kunden beeindrucken muß“ (Baecker 2004: 3). zfwu 7/3 (2006), 324-335 327 (24) Kunst ist, aus der Sicht der Wirtschaft, eine quasi natürliche Ressource für Werbung, Aufmerksamkeitserheischung generell. Das wird in der Kunst nicht als Kunst honoriert, aber wir fragen ja nach den Verbindungen: Werbung ist eine klare Verbindung zwischen Kunst und Wirtschaft. Analysieren wir das genauer. 2. (25) Das Kulturprogramm der Ökonomie: z. B. Markenproduktion Bisher haben wir auf die Rezeption von Kunst abgestellt und gefragt, welche Ressource Kunst für die Wirtschaft sein kann. Damit wird die Kunst nicht beschädigt, aber neu oder anders oder zusätzlich genutzt: in an extended mode. Die Nutzung der Kunst z. B. durch Werbung ist keine Engführung der Kunst, sondern ein Parallelprozess – der natürlich Rückwirkungen hat. Wenn Kunst aber überschüssig arbeitet, transzendiert sie auch diese Intervention. Es gilt zu überlegen, ob die Abwehr/Ablehnung der Wirtschaft, die in der Kunst üblich ist, auf falschen Prämissen beruht: also ob die Wirtschaft die Kunst verführen würde, nicht mehr Kunst zu sein, sondern Kulturindustrie, wie das alte Wort Adornos lautet. Doch dann ist die Wirtschaft immerhin mehr Kultur, als ihr gewöhnlich zugestanden wird: Kultur-Industrie. Erörtern wir es: ‚Werbung’ ist eine spezifische Produktion der Unternehmen, nämlich die Produktion von Literatur und Kunst – nun allerdings nicht, wie man gewöhnlich meint, freischwebend, sondern kontextuiert. Unternehmen, die Güter + Vertrauen produzieren, d. h. Vertrauen in eine Marke, sind Parallelproduzenten: das Gut, das sie herstellen, ist ein Duplex, eine Kombination aus Gut (G) und Literatur (L) wie Kunst (K). Produktion = G + L, K ‚Werbung als Kunst und Literatur‘ ist hier die Metapher für eine ideelle Produktion, die Geschichten erzählt über den Kontext des Gutes, in den die potentiellen Konsumenten eintreten sollen. Die Geschichte, die in Form von Texten, Bildern, Videos, Filmen als neue – und eigenständige neue – Kunstgattung produziert wird, erzählt das Gut als potentiell sinnaufwertendes Ereignis im Leben der Konsumenten: ‚sensemaking‘ (vgl. Weik 1995). Um das leisten zu können, muss die Geschichte ein potentielles Leben erzählen, und zwar in einem Bild/Text-Kombinat bzw. in einer 8-sekundigen Videosequenz. Wenn sie das Gut kaufen, wird ihr Leben bereichert als Teilhabe an der Geschichte, die zum Gut erzählt wird. Unternehmen, die Güter produzieren, sind, wenn sie zugleich Marken kreieren oder Werbung machen, zur Hälfte bereits Kunstproduzenten, die Geschichten erzählen, um Kontexte zu produzieren, in denen ihre Güter Wertzunahmen erfahren. Güter, die zugleich mit Bedeutung geliefert werden, haben Selektionsvorteile. Güterproduktion ist systematisch, wenn man die Produktion der Markierung mitrechnet, wie ich marketing übersetzen will (vgl. Hellmann 2003), cultural industry – gleichgültig, welches Produkt hergestellt wird. (26) (27) (28) (29) (30) 328 (31) (32) (33) (34) Die Wertschöpfung, die durch höheren Umsatz erreicht wird, wird, bei präziser Betrachtung, durch Investitionen in Kunst und Literatur erreicht, die Sinn produzieren, oder zumindest: neue Lebensweltinterpretationen, in die einzutreten der Kauf der markierten Güter dient. Wir sind längst in eine Epoche der engen Korrelation von Kunst und Wirtschaft eingetreten (vgl. Zdenek et al. 2002; Schmidt 2004). Werbung ist kein akzidentielles Phänomen, sondern eine Produktionsform, der kein Unternehmen sich entziehen kann, wenn es um die knappe Ressource Aufmerksamkeit konkurriert. Alle Unternehmen, die werben oder Marken generieren, sind Teile der Kulturindustrie, d. h. derjenigen Teile der Wirtschaft, die Weltbilder produzieren – moderne ‚cultural agencies‘. Man kann nüchtern davon reden, dass alle Unternehmen, die ihre Güter oder Leistungen über ein Marketing vermarkten, d. h. spezielle Texte und Bilder, Musiken etc. dazu verwenden (und zwar wiederum auf einem spezifischen Markt der Werbung, in einem hochdifferenzierbaren Spektrum an Medien etc.), Kulturproduktion betreiben (vgl. Giesler 2004). Ihre Güter/Leistungen haben nur als marked commodities Wert: G + K. Ohne die kulturelle oder KunstMarkierung (+K) sind sie für den Markt entweder gar nicht sichtbar, oder unmarked: unbelievable. Es geht nicht nur um den Informationsprozess: dass die potentiellen Nachfrager ohne Werbung nichts von einem neuen Angebot erfahren, sondern darum dass selbst dann, wenn sie davon erführen, sie keine hinreichende story erzählt bekommen, die sie glauben macht, dass es ein Produkt ist, das in ihrer Lebenswelt eine Rolle spielen sollte. Der Verkauf der Güter ohne kulturelle Interpretation gelingt in den Angebotsinflationswelten moderner Märkte nicht mehr. Die Kulturindustrie der Werbung macht ja nicht mehr nur auf die Güter, für die sie wirbt, aufmerksam, sondern ordnet die Phänomenologie der Angebotswelten ebenso wie sie sie gleichzeitig ausweitet. Jede Geschichte erweitert den kulturindustriell hergestellten Raum der Erzählungen der Welt. Weil die Diversifikation des Angebotes extrem hoch ist, müssen die Unternehmen Marken produzieren, unter deren Dach das Vertrauen in die Qualität der Güter etabliert ist. Wir haben es mit einer Parallelproduktion von Gütern und Semantik zu tun; jedes materielle Gut ist bedeutungsmarkiert, d. h. bekommt seinen Wert im Kontext eines Kontextes, der kommuniziert wird. Aus der Sicht der Nachfrager können wir das als Parallelität von Präferenz und Semantik darstellen. Genauer würde man eine Semiotik/Semantik-Mischung analysieren. Das hat methodologische Konsequenzen: es reicht nicht aus, die ‚ökonomische Handlung‘ als Präferenzrealisation darzustellen, da sie parallel durch Semantik/Semiotik gesteuert wird. Nicht die – semantikfreie und bildlose – Wahl von besten Gütern ist alleine relevant, sondern die Geltung von ‚literatical‘ oder ‚cultural frames‘; d. h. von Geschichten und Bilder, in die die Güter ‚verpackt‘ werden. Das Marketing spielt in der ökonomischen Theorie – außerhalb der management science – keine oder nur eine marginale Rolle, als Überredungstechnik: als Rhetorik des Verkaufs/Vertriebs, damit gleichsam nur als Verstärker einer sowieso vorhandenen präferentiellen Neigung. Ich halte dagegen, dass Marketing keine akzidentielle Angelegenheit ist (die man deshalb auch nicht einfach unterlassen könnte), son- zfwu 7/3 (2006), 324-335 329 (35) (36) (37) (38) (39) (40) 330 dern eine Ko-Produktion der Erzeugung von Aufmerksamkeit durch ‚short stories’, ohne deren Vorhandensein Güter gar nicht bemerkt (oder nicht genügend bemerkt) würden (Zur Ökonomie der Aufmerksamkeit: vgl. Frank 1998). Dieses parallel-processing gilt es zu erforschen. Jede Unternehmung agiert deshalb ‚zur Hälfte‘ als art-agency. Erst Bianchi u. a. entwickeln Konzepte des active consumer, der selbst innovativ (respektive: inventiv) agiert (vgl. Bianchi 1998). Die Ökonomik entdeckt, was ein Teil von ihr, die Marketingtheorien, längst nutzen: semiotic und semantic (vgl. Baudrillard 1972; Herrmann 1999; Liebl 2000, Schroeder 2002, Hutter 1998; Priddat 2000; Markowski 2001). Hier ist eine Theorie des Konsumverhaltens zu entwerfen, die als Inklusion in stories und in imaginative Welten ausgebaut wird, in der semiotische und semantische Potentiale, semiotische Landschaften wie linguistic communities dominieren und eine governance-structure bilden, in der sich Konsumenten nach anderen Kriterien als nur nach den ‚rein wirtschaftlichen‘ orientieren (vgl. Du Gay 1997; Schroeder 2002). Der vordem als passive Instanz modellierte Konsum wird zu einem aktiven Akt: zu einem Akt der Gestaltung von Konsum als Produktion von Konsum (‚prosuming‘) (vgl. Davidow/Malone 1993; Bianchi 1998). Man kann das ‚advertizing‘ als ‚Verpackung‘ bezeichnen, d. h. als verkaufsfördernde Attribution. Die Verpackung aber ist die Kennung des Gutes, seine offenbarte Bedeutung. ‚Verpackungen‘ wie Design sind Argumente im semantischen Raum der literarischen Produktionsseite der Unternehmen, die die Kommunikation des Marktes mit steuert. Wir haben uns die Ökonomie als einen parallelen Produktionsprozess von Gütern (präferenzbezogen) und Bedeutungsmarkierungen dieser Güter (semantikbezogen) vorzustellen, d. h. als eine ‚Zwei-Welten-Theorie‘, innerhalb derer Präferenzen wie Bedeutungen oszillieren. Präferenzen generieren Bedeutungen wie Bedeutungen Präferenzen generieren (vgl. generell dazu Bianchi 1998). Die Tatsache, dass Bedeutungen Präferenzen generieren, weist auf eine zweite Steuerungsebene der Ökonomie: auf die bedeutungsverschiebende oder – generierende Ebene der Kommunikation, die in der Ökonomie gewöhnlich als ‚cheap talk‘ beiseite gelassen wird. Denn wir haben es mit der Ko-Existenz von zwei Prozessen zu tun, die notwendig interagieren. Semantik, wenn wir das ‚advertizing‘ so kurz fassen dürfen, steuert die Aufmerksamkeit auf Güter, die, wegen dieses Prozesses, nicht mehr als bloße Gegebenheiten mit Evidenz auftreten können. Die Ökonomie der Produktion von Aufmerksamkeit (vgl. Frank 1998) ist kein zusätzlicher, sondern ein basaler Produktionsparallelprozess, der, unabhängig von den tatsächlichen Investitionskosten, den Absatz steuert. Weil die Unternehmen selber Kulturagenten geworden sind, sind sie kompetent, auch Vertrauen zu produzieren. Das Vertrauen, das sie für die Konsumenten erzeugen, ist eine Koppelung von Erfahrungswelt und neuer Weltoption. Das Kulturprogramm der Markenvertrauensbildung ist ein epistemologisches Programm: Nichtwissen über die möglichen Qualitäten von ständig neu angebotenen neuen Gütern oder Gütervariationen kann nicht durch Wissen substitutiert werden, aber durch einen Stellvertreter: Vertrauen. (41) (42) 3. (43) (44) Deswegen ist für das Kulturprogramm der Wirtschaft die InformationsKategorie, die die ökonomische Theorie z. T. verwendet, wenig brauchbar. Information will Wissen erzeugen. Aber Information über etwas, was ich noch nicht kenne, und auch nicht kennen kann, weil es neu auf den Markt tritt, gibt es nicht. Stattdessen erzählt das Kulturprogramm der Wirtschaft eine Geschichte, die zum einen Teil an mein Wissen, an meine Erfahrungen anknüpft, zum anderen Teil das Novum, das sie einbringen will, als Virus in den Erfahrungsraum mit einschleust. Die Virus-Metapher ist hierfür besonders geeignet: Das Neue, für das der Konsument aufgeschlossen werden soll, muss wie ein Virus eingeschleust werden, ohne dass man ihn merkt, um nicht ängstlich Abwehr aus Unwissen zu erzeugen; er ändert, wenn er eingeschleust ist, das ‚genetische Programm’ des Erfahrungswissens. D. h. der Virus des Neuen reinterpretiert das vorhandene Wissen des Käufers auf eine Art und Weise, dass der Konsument meint, eine neue Erfahrung zu haben, bevor er die Erfahrung mit dem neuen Gütern hat. Dann ist er bereit zu kaufen, d. h. dann traut er sich, die Transaktion einzugehen. Wer sich traut, hat Vertrauen, ist nicht mehr unsicher. Der Konsument hat kein Wissen über das neue Gut, aber er vertraut der Erzählung, die das Unternehmen ihm werblich geliefert hat, indem sie ihn in einen Zustand der Kopplung von Erfahrung und Neuem versetzt. Die Kunst- und Literaturproduktion der Unternehmen ist keine beliebige Erzählung, sondern eine überzeugende. Sie hat rhetorische Qualität. Rhetorik zählt seit McCloskey zum ‚extended program of economics’ (vgl. McCloskey 1985; 1994a+b). Dieser Nichtwissen/Wissen-Übergang, den die Literatur- und Kunstproduktion der Unternehmen leisten muss, ist ein epistemischer Prozess der Erzeugung von Gewissheit über etwas, über das man im Grunde nichts weiß. Es entsteht eine neue, besondere Form qualifizierten Nichtwissens (vgl. Baecker 2000). ‚Kunst signalisiert Differenz‘ Wir befinden uns nicht mehr im analytischen Raum der rational choice, den die Ökonomie besetzt, sondern wechseln in den klassischen Raum der Theorie der Urteilskraft, d. h. in den Raum der Kompetenz, in neuen Situationen neu reflektieren, neu beurteilen und neu entscheiden zu können. Solche Situationen sind nicht durch die klassische epistemische Gegebenheit von Alternativen ausgezeichnet, nicht durch Ontologiezuschreibung, sondern durch epistemologische Riskanz: Bedeutungsunklarheit, interpretatorische Offenheit, Musterlosigkeit etc. In diese Offenheit hinein spielt die Wahrnehmungsfähigkeit, die die Kunst gegen die (kognitiven) Kommunikationen ins soziale Spiel bringt. Dirk Baecker macht einen Vorschlag, Kunst als Sozialtechnik zu beschreiben. „In dem Maße (…), in dem die moderne Gesellschaft die Erfahrung der eigenen Konstruiertheit macht, wird es erforderlich, Techniken bereit zu stellen, die es erlauben, die Konstruktion der Gesellschaft zu überprüfen. Eine dieser Techniken ‚überwacht‘, um es etwas pathetisch zu sagen, die Grenze zwischen Kommunikation zfwu 7/3 (2006), 324-335 331 (45) (46) (47) (48) (49) 332 und Bewusstsein. Sie beobachtet diese Grenze, sie überspielt diese Grenze, sie unterstreicht diese Grenze und macht in allen diesen Formen die Grenze in der Gesellschaft für die Gesellschaft in einem immer begrenzten (der Grenze adäquaten) Ausmaß verfügbar. Diese Technik ist die Kunst“ (Baecker 2001: 4 f.). Die These lautet: die Kunst wird von einer Adels-Luxus-Angelegenheit zu einem Beitrag gesellschaftlicher Funktion. Es wird sogleich auch deutlich, dass wir uns im Bildungsthema der modernisierten Moderne befinden. „Die Kunst wird als diese Technik umso unverzichtbarer, je mehr die moderne Gesellschaft darauf verzichtet, allgemein sich stellende Probleme auch allgemein, das heißt zentral, zu adressieren. Unternehmen, Behörden, Kirchen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Vereine können sich nicht mehr darauf verlassen, dass für die Bereitschaft der Bewusstseinssysteme, sich nach wie vor an den – anforderungsreichen, ermüdenden, von einer Begeisterung in die nächste jagenden und von einer Enttäuschung zur nächsten treibenden – Kommunikationen der sozialen Systeme willig, motiviert und problemlos zu beteiligen, durch Herkunft oder Ausbildung hinreichend gesorgt ist. Stattdessen müssen sie Formen finden, den Bewusstseinssystemen ihrer Mitarbeiter, Anhänger, Gläubiger und Kunden deutlich zu machen, dass sie um die Differenz dieser Bewusstseinssysteme wissen und sie akzeptieren, obwohl sie sie überspielen müssen. Die Kunst signalisiert diese Differenz. Und sie signalisiert sie umso besser, je unwilliger sie dieses Spiel mitspielt“ (Baecker 2001: 5). „Ihr Vorbehalt“, lesen wir bei Th. E. Schmidt, von der Kunst redend, „gegenüber der Gegenwart … ist unbegrenzt“ (Schmidt 2004: 45, Sp. 4). Die Differenz zwischen Kunst und Wirtschaft ist ein Moment ihrer Spannungsproduktion: nämlich der Verweis auf die Differenz, die umfassender zur constitution mondial gehört. Die Kunst generiert Wahrnehmungen, die in die Kommunikationen der sozialen Systeme intervenieren. „Bestenfalls geht es in der Kunst ums geistige Überleben, um eine andere Weise wahrzunehmen, zu fühlen, vielleicht auch zu denken“ (Schmidt 2004: 45, Sp. 4). Baecker differenziert an dieser Stelle zwischen Wahrnehmen und Denken (Kommunikation). „Die Kommunikation ist mit der Wahrnehmung im Zweifel immer schnell fertig. Sie adressiert sie, macht sie zum Thema und baut sie ein in die Reproduktion der Kommunikation. Aber als Adressierte und Thematisierte ist die Wahrnehmung nicht die Wahrnehmung selbst. Diese bleibt die Eigenwelt des Bewusstseins, ‚die Welt, in der wir leben‘ (Maurice Merleau-Ponty). Daran erinnert die Kunst, darauf macht sie aufmerksam und dafür weckt sie nach beiden Seiten immer wieder neu Interesse“ (Baecker 2001: 6). Die Anspielung auf die Bildung (siehe oben) wird hier offensichtlich: Kunst lehrt Differenzbewusstsein im Wahrnehmen des Wahrnehmens. Kunst ist eine in der modernen Moderne notwendige Übung in Komplexitätsauffächerung und Differenzierungssensibilität. „Denn so schnell die Kommunikationen mit der Wahrnehmung fertig ist, so sehr neigen auch die Bewusstseine dazu, sich im Zweifel lieber unterhalten zu lassen als auf die Kunst einzulassen. Die Unterhaltung überspielt die Differenz zwischen Kommunikation und Bewusstsein. Die Kunst macht sie zum Ereig- (50) (51) (52) (53) 4. (54) (55) nis“ (Baecker 2001: 6). Nicht nur für die Wirtschaft, auch für die Kunst selbst ist die Kunst wahrzunehmen eine Kompetenz, die einen Schlüssel hat zur Welt in ihrer unaufgeschlossenen Offenheit. Baecker wiederholt hier, was wir Schmidt vorhin sagen ließen: Kunst verfehlt oft Kunst, wird Kunstgewerbe, soll ‚emotionalisieren‘ (Schmidt 2004: 45, Sp. 1). Erst als Ereignis ist Kunst Kunst, making differences. So wie wir oben das Neue als Virus im Erfahrungsraum der Menschen eingeführt hatten, als eine durch Werbung und Kommunikation vollführte kulturindustrielle Aktion, die eine Verpackung des Neuen serviert, oder eine sanfte Injektion, so wird umgekehrt klar, dass Kunst umgekehrt verfährt: Aufbrechen der Verpackung, Offenlegung der Ereignis-Gene. Deshalb ist Kunst ein Ereignis, das zu beobachten für die Wirtschaft von Bedeutung ist, wenn es um ereignishafte Prozesse geht: um Innovationen, market making, Präferenzänderungen etc. – d. h. um Dekonstruktionen von Gewohnheiten und Konventionen des Handelns, Denkens und Wahrnehmens. Lyotard sieht die Analogie zwischen Kunst und Wirtschaft eher bedenklich: „Man versteht, dass der Kunstmarkt, der wie alle Märkte der Regel des Neuen unterliegt, auf Künstler verführerisch wirken kann. (…) Das Geheimnis künstlerischen Gelingens wie das des kommerziellen Erfolges hängen ab von der Dosierung von Überraschung und Wohlbekanntem, von Information und Kode. Darin besteht die Innovation in den Künsten: man greift auf Lösungen zurück, die durch frühe Erfolge bestätigt sind, man modelt sie um, indem man sie mit anderen, im Grunde unvereinbaren Lösungen kombiniert, mit Amalgamen, Zitaten, Ornamenten, Pasticci. Man kann bis zum Kitsch, bis zum Barocken gehen. Man schmeichelt dem ‚Geschmack’ eines Publikums, das keinen Geschmack haben kann, und dem Eklektizismus eines Sensoriums, das von der Vervielfältigung verfügbarer Formen und Objekte geschwächt ist. In dieser Weise glaubt man den Zeitgeist auszudrücken und spiegelt doch nur den Markt wieder“ (Lyotard 1989: 186). Die Innovation, in die die Kunst sich verirrt, wird zur Form der Bedürfnisbefriedigung. Die Kunst, die diesen Weg geht, gleicht sich den Werbewelten an: ‚Vervielfältigung verfügbarer Formen’, die wiederum aus der Kunst, insbesondere dieser Kunst, schöpfen. Was der Kunst an der innovatorischen Dimension misslingt, ist für die Wirtschaft wiederum sensationell: die Unterbrechungs-Kunst. Die pädagogische Dimension Wenn wir das so bedenken, ist die Ausbildung, die wir für Menschen bieten, die in der Wirtschaft Entscheidungen und Wahrnehmungen generieren sollen, falsch, wenn sie nicht das in der Kunst sich ereignende Wahrnehmen mit ausbildet. Wie in Pos. 4 bereits gesagt: „So ist Kunst für die Wirtschaft dann von höchster Bedeutsamkeit, wenn sie Muster/Modelle liefert für das Auf- und zuvor Wahrnehmen von Neuem: durch Überraschung, Aufmerksamkeiten differenziertester Art etc“. zfwu 7/3 (2006), 324-335 333 (56) (57) (58) (59) Das Liefern solcher Muster/Modelle ist eine Pädagogik eigner Art/eigner Kunst. Es erfordert die Ausbildung eines non-calcul als Technik (Technik allein schon deshalb, weil es eine wiederholbare, für Viele gelten könnende Methode sein muss). Als Technik muss das Wahrnehmen des Neuen eingeführt werden, um wiederholbar zu sein, bis ans Schematische heran, mit allen Risiken für das Neue. Nur wenn die Wahrnehmung zur Methode wird, wird sie im Wirtschaftlichen überlegen; sonst bleibt sie zu sehr an individuelle Kompetenz gekoppelt, die mit der nächsten Vertragsänderung aus der Organisation verschwindet. So in die Wirtschaft transponiert ist die Kunst der Wahrnehmung kein singuläres Ereignis, sondern eine Methode: die jedem widerfahren möge, um neue Wahrnehmungen, neue Dispositionen, andere Fähigkeiten zu schaffen. Um das aber in der Wirtschaft zu können, muss es vorher ausgebildet sein: in einem pädagogischen Raum, der dafür sensibilisiert, bevor es in Anwendung kommt. Bevor es schematisch wird, muss es einmal frei geübt worden sein. Die Pädagogik ist nur der Name für den Ort der Freiheit der Wahrnehmung, zugleich aber ein Name für das Methodische des Einübens von Freiheit. Paradox: das Prinzip der Repetition, gegen das sich die Kunst wehrt, muss zum Einsatz kommen für das Bilden in Kunst, damit die Kunst vermehrt zum Einsatz kommt, um Dekonstruktionen der Gewohnheiten, also auch der Repetition, zu liefern. Literaturverzeichnis Baecker, D. (2000): Theorien und Praktiken des Nichtwissens, Discussion Paper Studium fundamentale, Universität Witten/Herdecke. Baecker, D. (2001): Etwas Theorie, in: Luckow, D. (Hrsg.): Wirtschaftsvisionen 2: Peter Zimmermann. München: Siemens Kulturprogramm: 3-6. Baudrillard, J. (1972): Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris: Gallimard. Bianchi, M. (Hrsg.) (1998): The Active Consumer. Novelty and Surprise in Consumer Choice, London/New York: Routledge. Davidow, W. H./ Malone, M. S. (1993): Das virtuelle Unternehmen. Der Kunde als CoProduzent, Frankfurt a. M.: Campus. Du Gay, P. (1997): Production of Culture/Cultures of Production, London: Sage Publications Ltd. Frank, G. (1998): Ökonomie der Aufmerksamkeit, München: Hanser. Giesler, M. (2004): Consuming Cyborgs: Steps to an Ecology of Posthuman Consumer Culture, Dissertation an der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke. Girard, R. (2004): Nachricht von Neuerung, die drauf und drunter geht, in: FAZ Nr. 266, 13.11.2004: 41. Hellmann, K. U. (2003): Soziologie der Marke, Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Herrmann, C. (1999): Die Zukunft der Marke: Mit effizienten Führungsentscheidungen zum Markterfolg, Frankfurt a. M.: Frankfurter Allgemein Zeitung. Hutter, M. (1998): On the Consumption of Signs, in: Bianchi, M. (Hrsg.): The Active Consumer. Novelty and Surprise in Consumer Choice, London/New York: Routledge. 334 Jepsen, St./ Preissler, H./ Reckhenrich, J. (2003): Wert-Schöpfung. Ein Dialog zwischen Kunst und Wirtschaft, in: Zeitschrift für Organisationsentwicklung, Nr. 4/2003: 68-74. Liebl, F. (2000): Der Schock des Neuen. Entstehung und Management von Issues und Trends, München: Gerling Akademie Verlag. Lyotard, J.-F. (1986): Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, Berlin. Lyotard, J. F. (1989): Das Inhumane, Wien: Passagen Markowski, M. (2001): Marken als Mem: Strategien zur Evolution von Marken, Diplomarbeit an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Witten/Herdecke. McCloskey, D. N. (1985): The Rhetoric of Economics. Madison: The University of Wisconsin Press. McCloskey, D. N. (1994a): Knowledge and persuasion in economics, Cambridge: University Press. McCloskey, D. N. (1994b): The economy as a conversation, in: McCloskey (1994a): 367-385. Priddat, B. P. (2000): Moral hybrids – Skizze zu einer Theorie des moralischen Konsums, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 1/Heft 2: 128-151. Priddat, B. P. (2004): Kommunikative Steuerung von Märkten. Das Kulturprogramm der Ökonomik: 343–361, in: Blümle, G./ Goldschmidt, N./ Klump, R./ Schauenberg, B./ Senger, H. v. (Hrsg.): Perspektiven einer kulturellen Ökonomik, Münster: Lit-Verlag. Schmidt, Th. E. (2004): Mit der Rasierklinge ins Auge: 45, in: ZEIT Nr. 8, 12.2.2004. Schroeder, J. (2002): Visual Consumption, London/New York: Routledge. Weik, K. E. (1995): Sensemaking in Organizations, Thousand Oaks: Sage. Zdenek, F./ Hentschel, B./ Lickow, D. (2002) (Hrsg.): Art & Economy, Ausstellungskatalog, Hamburg. zfwu 7/3 (2006), 324-335 335 Die Attraktion der Warenwelt und der Distinktionswert der Kunst TILMAN REITZ* Korreferat zum Beitrag von Birger P. Priddat Falls es so etwas gibt wie einen „Neuen Geist des Kapitalismus“, ist er durch eine Integration ehemals marktfeindlicher Impulse gekennzeichnet. Die Figur, an der Luc Boltanski und Ève Chiapello (1999) diese Umkehrung festmachen, nennen sie „Künstlerkritik“: das Ausspielen eng mit ästhetischer Produktion verbundener Werte wie Spontaneität, Fantasie, Neuerungs- und Experimentierfreude gegen eine erstarrte Ordnung des rationalen Kalküls. War diese Opposition in den 1960er bis 80er Jahren vorrangig so zu begreifen, dass frische Kräfte gegen den müden Spätkapitalismus und seinen Staat rebellierten, herrscht nunmehr die Idee vor, eine Bewegung unternehmerischer Kreativität müsse verkrustete Strukturen aufbrechen, seien es die des Sozialstaats oder einfach die unprofitabel gewordener Wirtschaftssegmente selbst. Bereits in der Ahnenreihe dieser Idee haben kunstnahe Motive wiederholt eine Rolle gespielt: prominent in Schumpeters schöpferischer Zerstörung (die Horst Bredekamp vor einiger Zeit denn auch auf die Kunst, nämlich den Bau von St. Peter zurück übertragen hat), weniger augenfällig in Kirzners Grundannahme, dass kapitalistische Wirtschaft mehr brauche als bloßes Kalkül – nämlich die möglichst verbreitete Aufmerksamkeit für Marktlücken und -ungleichgewichte. Seit diese Ansätze politisch einflussreich geworden sind, den Diskurs ökonomischer Flexibilisierung bestimmen und kulturell auf alle möglichen Lebensbereiche ausgreifen, wird die Nähe auch expliziert und gelegentlich zur Identität: „Entrepreneurship ist Kunst. Es ist die kreative Tätigkeit des Neuentwurfs, die Inspiration verlangt, Intuition und Einfühlungsvermögen, auch in soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge“ (Faltin 2005: 104). Birger Priddats Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er solche Gleichsetzungen weitgehend vermeidet. Zwar kann auch er nicht umhin, den Beispielcharakter und pädagogischen Wert ästhetischen Neuheitssinns zu betonen: „So ist Kunst für die Wirtschaft dann von höchster Bedeutsamkeit, wenn sie Muster/Modelle liefert für das Auf- und zuvor Wahrnehmen von Neuem: durch Überraschung, Aufmerksamkeiten differenziertester Art etc.“ (4, 55). Doch er bemüht sich mit Lyotard, die ästhetische ‚Invention’ bzw. das künstlerische ‚Ereignis’ von der ökonomischen ‚Innovation’ abzuheben. Ersteres sei eine „Unter________________________ * 336 Dr. Tilman Reitz, Institut für Philosophie/Friedrich-Schiller-Universität Jena, Zwätzengasse 9, D-07743 Jena, Tel.: +49-(0)3641944123, Fax: +49-(0)3641944122, E-Mail: [email protected], Forschungsschwerpunkte: Politische Philosophie, Sozialphilosophie, Ästhetik. brechung der Wahrnehmung“ und „Kommunikation“ (15), in der letzteren dagegen geht es, wie man wohl ergänzen darf, immer schon um den jeweils anschließenden Tauschakt. Genauere Argumente dafür, dass es „keine Übersetzbarkeit von Kunst in Wirtschaft gibt“ (13), werden (trotz reichlich zitierter Literatur) nicht ausgeführt. Vielmehr erfolgt ein radikaler Terrainwechsel: Statt das mystische Schöpfungspotential von Kunst weiter positiv oder negativ auf Markthandeln zu beziehen, fragt Priddat einfach nach den ästhetischen und symbolischen Erfordernissen kapitalistischer Produktion. Dabei kommt er wie Wolfgang Fritz Haug (dessen Theorie der Warenästhetik seltsamer Weise nicht genannt wird) zu der Einsicht, dass sich kaum immer neue Produkte auf einem anonymen Markt lancieren lassen, wenn nicht sinnlicher Schein die zunächst fehlende Gebrauchserfahrung substituiert. Haug hatte diesen Zusammenhang in dem umständlichen Titel des ‚ästhetischen Gebrauchswertversprechens’ gebündelt (Haug 1980: 45); Priddat nennt ihn nicht weniger umständlich, aber in neuerem Theoriedesign eine ‚Parallelproduktion von Gütern und Semantik’: „Wir haben uns die Ökonomie als einen parallelen Produktionsprozess von Gütern (präferenzbezogen) und Bedeutungsmarkierungen dieser Güter (semantikbezogen) vorzustellen, d. h. als eine ‚Zwei-Welten-Theorie‘, innerhalb derer Präferenzen wie Bedeutungen oszillieren. Präferenzen generieren Bedeutungen wie Bedeutungen Präferenzen generieren“ (37). Den letzten Satz wird man so übersetzen dürfen, dass Werbung, Verpackung, Präsentation u. ä. Kaufentscheidungen beeinflussen und diese umgekehrt die Kultur einer Gesellschaft prägen. Während Haug dies auf sinnliche Attraktion zurückführte (Haug 1980: 51), betont Priddat, auch hier systemtheoretischen Stichworten folgend, die Ökonomien von ‚Aufmerksamkeit’ (39) und ‚Vertrauen’ (40). Indem er an dieser Stelle genuin ästhetische Faktoren ausblendet, droht Priddat freilich das Thema Kunst zu verfehlen. Weder scheint es für ihn entscheidend zu sein, dass Werbung auf Wahrnehmung wirkt, noch spielt der Gesamtapparat der Konsumentensinnlichkeit, in dem das Begehren nach neuen Gütern geweckt wird, eine sichtbare Rolle – und die Kriterien für anspruchsvolle, den sinnlichen Schein verselbständigende Kunstproduktion scheinen an dieser Stelle ohnehin vergessen. Von den verlockenden Oberflächen und Bildern sinnlichen Glücks bleiben Semiotik und Semantik (35), „Werbung als Kunst und Literatur“ definiert sich durch „sensemaking“ (29). Die nahe liegende Verbindungsfigur der promesse de bonheur, die man tatsächlich in Kunst wie Werbung ausmachen kann (wenngleich dann der Status der in Aussicht gestellten Erfüllung differieren dürfte) kommt so erst gar nicht in den Blick. Und die eingangs favorisierte Figur des Ereignisses, das etablierte Bedeutungszusammenhänge aufbricht, muss so weit zurückgenommen werden, dass die warenästhetischen Innovationen allenfalls wohlbekannte Sinngefüge mit Überraschungen anreichern – das Neue beschränkt sich ja funktional auf Aufmerksamkeitserregung und bislang nicht erhältliche Güter. Autoren wie Barthes, Lefebvre und Debord hatten in diesem Sinn untersucht, wie in der Werbewelt dynamisierte und konservative Symbolik verflochten sind. Priddat knüpft hier zwar nicht an, wechselt aber schließlich konsequent vom Modell der Kunst zu dem der Rhetorik: zfwu 7/3 (2006), 336-339 337 „Die Kunst- und Literaturproduktion der Unternehmen ist keine beliebige Erzählung, sondern eine überzeugende. Sie hat rhetorische Qualität. Rhetorik zählt (…) zum ‚extended program of economics‘ “ (42). Die Kategorie der Wahrnehmung taucht erst wieder auf, wo Kunst dann doch als Analogie zur Wirtschaft genutzt wird. Um zu zeigen, weshalb diese, will sie „Innovationen, market making, Präferenzänderungen etc.“ betreiben, das „Ereignis“ Kunst auf „Dekonstruktionen von Gewohnheiten und Konventionen des Handelns, Denkens und Wahrnehmens“ hin beobachten sollte (51), greift Priddat noch einmal in die systemtheoretische Werkzeugkiste. Mit Dirk Baecker bezieht er die je individuelle Wahrnehmung auf soziale Möglichkeitshorizonte. Die Quelle ist Luhmann, für den Kunst einerseits erlaubt, „etwas prinzipiell Inkommunikables, nämlich Wahrnehmung, in den Kommunikationszusammenhang der Gesellschaft einzubeziehen“ (Luhmann 1997: 227), andererseits aber eine „Unterscheidung von realer und fiktionaler Realität hervorbringt“ (ebd.: 229), die schließlich „Ordnungszwänge (…) im Bereich des nur Möglichen“ (238) sichtbar macht. Bei Luhmann sind die beiden Aspekte – Wahrnehmungsthematisierung und Möglichkeitsreflexion – unvermittelt geblieben. Priddat kann sie besser vereinbaren, weil er das Mögliche, „Offenheit“ (43f.), stillschweigend auf das Verschiedene, auf Differenz reduziert. Kunst macht dann einfach sensibel für die Vielfalt einer komplexen Welt; sie „lehrt Differenzbewusstsein im Wahrnehmen des Wahrnehmens. Kunst ist eine in der modernen Moderne notwendige Übung in Komplexitätsauffächerung und Differenzierungssensibilität“ (48). Hierin soll nicht weniger als ihre soziale Funktion liegen. „Die These lautet, dass die Kunst von einer Adels-Luxus-Angelegenheit zu einem Beitrag gesellschaftlicher Funktion wird“ (45). Das folgende längere Baecker-Zitat bestimmt diese Funktion näher so, dass die großen Organisationen der modernen Gesellschaft den an ihnen Beteiligten durch Kunst ihre sonst nicht weiter relevante Nichtübereinstimmung zugestehen. Die fragliche „Differenz“ zwischen sozialen und „Bewusstseinssystemen“ wird in der ästhetischen Produktion und Erfahrung unschädlich thematisiert. Wie das geschieht, erläutert Priddat nicht näher – was schade ist, weil die These plausibel klingt. Störend wirkt allerdings ihr monofunktionaler Zuschnitt. Auch als „Adels-LuxusAngelegenheit“ wird „Kunst“ eine Funktion gehabt haben – etwa die Repräsentation von Macht und Herrschaft. Und es ist nicht auszuschließen, dass diese Funktion in veränderter Form fortbesteht. Gerade wo ästhetische Erzeugnisse prononciert als Kunst (statt etwa einfach als ‚Unterhaltung’) ausgestellt und konsumiert werden, haben sie weiterhin repräsentativen und distinktiven Wert. Foyers oder Chefetagen von Banken und Großunternehmen sind weiterhin mit renommierten Kunstwerken bestückt, ihre Mitarbeiter werden, um den Erwerb der zugehörigen Gesprächscodes zu erleichtern, mit VIP-Karten in Ausstellungen geschickt, das Mäzenatentum hat als Kultursponsoring seinen festen Platz im öffentlichen Leben, und der spätestens seit den 1980er Jahren verstärkte ästhetische Ehrgeiz der Werbung verdankt sich nicht allein der Suche nach Innovationen, sondern dient auch der Suggestion des Hohen und Exklusiven. Die Beispiele ließen sich vermehren, das Problem dürfte jedoch deutlich geworden sein: Wenn der Stellenwert von Ästhetik in der sozialen Kommunikation und in ökonomischen Strategien untersucht werden soll, muss auch reflektiert werden, wie die alten Unterscheidungen zwischen Hoch- und Volkskultur, Kunst und 338 Kulturindustrie, Avantgarde und Massenästhetik heute verarbeitet werden – weil es dabei unter anderem um die Zuweisung sozialer Ränge geht. Es genügt nicht, Adornos Kritik der Kulturindustrie und verwandte Positionen einfach als ‚elitär’ zu verwerfen (21), um dann doch nur formalere, ‚intelligentere’, weniger anstößige Formulierungen derselben Rangdifferenz zu finden (49). Vielmehr wäre zu sehen, wie die alte Differenz hoch/niedrig mit der klassischen Kunst/Nichtkunst und der modernen bewährt/innovativ reagiert hat. Dass das Innovative im Lauf des 20. Jahrhundert oft genug zur Chiffre fürs Oppositionelle und Marginalisierte geworden ist, macht die Aufgabe nur reizvoller. Eine solche Untersuchung würde allerdings verlangen, ‚Kunst’ oder ästhetische Produktion insgesamt nicht nur als ökonomische Ressource, sondern auch als politischen Faktor zu begreifen. Die Voraussetzung dafür wäre, theoretisch wieder stärker mit der Beobachtung zu operieren, dass wirtschaftliche Verfügungsgewalt soziale Macht ist und in Anspruch nimmt. Was diesen Zugang verhindert, ist vielleicht weniger die wachsende Verbundenheit führender Sozialtheorien mit der ökonomischen Macht, die die zuvor übliche Kapitalismuskritik abgelöst hat. Vielmehr werden einfache Sachprobleme zusehends unsichtbar, sobald die Warenästhetik die Theoriesprache kolonisiert. Von Techniken des Selbstmarketing, des Hinweisens auf die eigene Innovationsleistung, der Aufmerksamkeitserregung und des Eindruckschindens ist von Foucault bis in die Luhmannschule vermutlich keine neuere Sozialtheorie mehr frei. Doch es macht einen Unterschied, ob die PR-Sprache eine dienende oder eine führende Rolle spielt. An einigen Stellen von Priddats Text ist nicht ganz klar, was von beidem der Fall ist. „Hier ist eine Theorie des Konsumverhaltens zu entwerfen, die als Inklusion in stories und in imaginative Welten ausgebaut wird, in der semiotische und semantische Potentiale, semiotische Landschaften wie linguistic communities dominieren und eine governancestructure bilden“ (36) – der Sinn des Ganzen würde vermutlich klarer, wenn die englischen und lateinischen Signalwörter etwas zurückgenommen wären. Und auch wenn ihre Häufung die Zugehörigkeit zu einer theoretischen Avantgarde markiert – ästhetisch gelungen, schön ist sie nicht. Literaturverzeichnis Boltanski, L./ Chiapello, È. (2003 [1999]): Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz. Faltin, G. (2005): Für eine Kultur des Unternehmerischen. Entrepreneurship als Qualifikation der Zukunft, in: Bucher, A./ Lauermann, K./ Walcher, E. (Hrsg.): Leistung – Lust & Last. Erziehen in einer Wettbewerbsgesellschaft, Wien, 78-106. Haug, W. F. (1980): Warenästhetik und kapitalistische Massenkultur (I): ‚Werbung’ und ‚Konsum’. Systematische Einführung in die Warenästhetik, Berlin. Luhmann, N. (1997): Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp. zfwu 7/3 (2006), 336-339 339