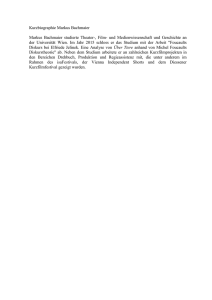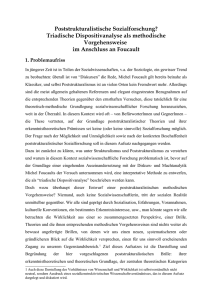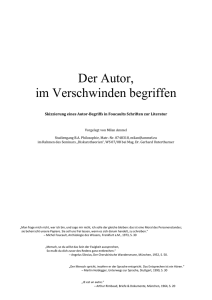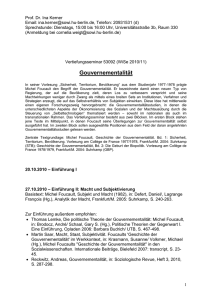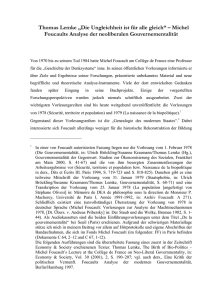Kritische Neubeschreibung. Michel Foucaults Beitrag zu einer
Werbung
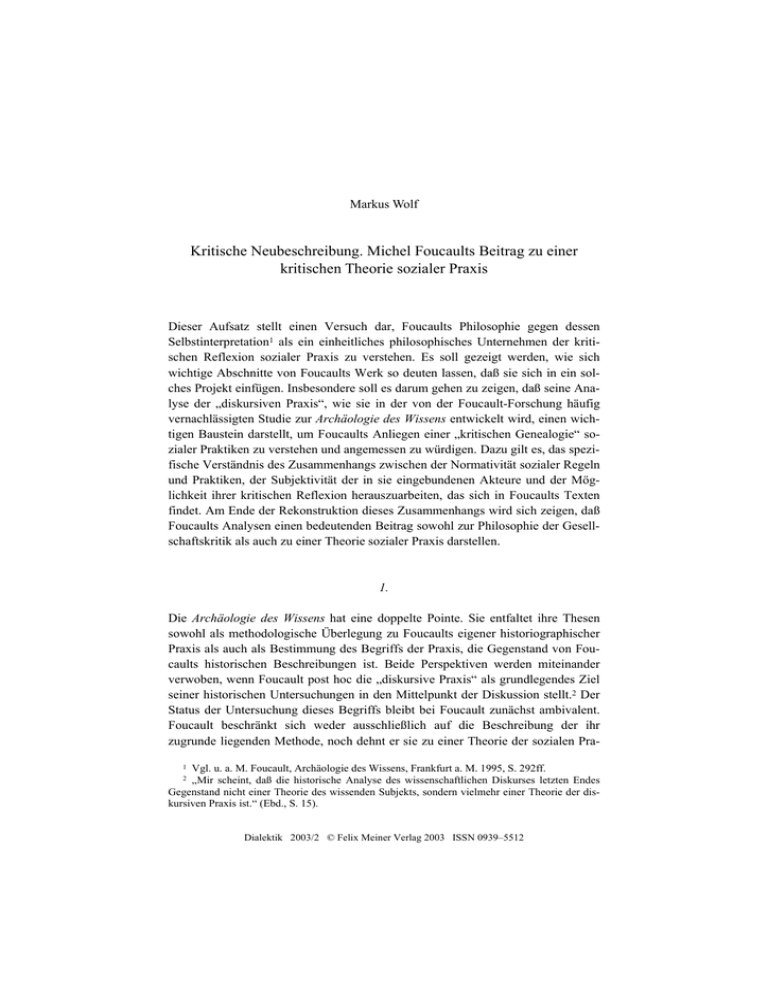
Markus Wolf Kritische Neubeschreibung. Michel Foucaults Beitrag zu einer kritischen Theorie sozialer Praxis Dieser Aufsatz stellt einen Versuch dar, Foucaults Philosophie gegen dessen Selbstinterpretation1 als ein einheitliches philosophisches Unternehmen der kritischen Reflexion sozialer Praxis zu verstehen. Es soll gezeigt werden, wie sich wichtige Abschnitte von Foucaults Werk so deuten lassen, daß sie sich in ein solches Projekt einfügen. Insbesondere soll es darum gehen zu zeigen, daß seine Analyse der „diskursiven Praxis“, wie sie in der von der Foucault-Forschung häufig vernachlässigten Studie zur Archäologie des Wissens entwickelt wird, einen wichtigen Baustein darstellt, um Foucaults Anliegen einer „kritischen Genealogie“ sozialer Praktiken zu verstehen und angemessen zu würdigen. Dazu gilt es, das spezifische Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Normativität sozialer Regeln und Praktiken, der Subjektivität der in sie eingebundenen Akteure und der Möglichkeit ihrer kritischen Reflexion herauszuarbeiten, das sich in Foucaults Texten findet. Am Ende der Rekonstruktion dieses Zusammenhangs wird sich zeigen, daß Foucaults Analysen einen bedeutenden Beitrag sowohl zur Philosophie der Gesellschaftskritik als auch zu einer Theorie sozialer Praxis darstellen. 1. Die Archäologie des Wissens hat eine doppelte Pointe. Sie entfaltet ihre Thesen sowohl als methodologische Überlegung zu Foucaults eigener historiographischer Praxis als auch als Bestimmung des Begriffs der Praxis, die Gegenstand von Foucaults historischen Beschreibungen ist. Beide Perspektiven werden miteinander verwoben, wenn Foucault post hoc die „diskursive Praxis“ als grundlegendes Ziel seiner historischen Untersuchungen in den Mittelpunkt der Diskussion stellt.2 Der Status der Untersuchung dieses Begriffs bleibt bei Foucault zunächst ambivalent. Foucault beschränkt sich weder ausschließlich auf die Beschreibung der ihr zugrunde liegenden Methode, noch dehnt er sie zu einer Theorie der sozialen PraVgl. u. a. M. Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1995, S. 292ff. „Mir scheint, daß die historische Analyse des wissenschaftlichen Diskurses letzten Endes Gegenstand nicht einer Theorie des wissenden Subjekts, sondern vielmehr einer Theorie der diskursiven Praxis ist.“ (Ebd., S. 15). 1 2 Dialektik 2003/2 © Felix Meiner Verlag 2003 ISSN 0939–5512 28 Markus Wolf xis aus. Es geht ihm auch nicht um die philosophische Reflexion praxisfundierender begrifflicher Zusammenhänge. Er blendet jeden philosophiegeschichtlichen Bezug überhaupt aus. Statt dessen versucht er, methodische Grundprämissen seiner Arbeit zu systematisieren und zu reflektieren. Diese sind zunächst in Abgrenzung zu einem konkurrierenden methodischen Projekt zu verstehen, das man „hermeneutische Ideengeschichte“ nennen könnte. Gleich am Anfang des ersten Kapitels heißt es: „Zunächst ist eine negative Arbeit zu leisten: sich von einem ganzen Komplex von Begriffen zu lösen, von denen ein jeder in das Thema der Kontinuität Abwechselung bringt.“3 Es handelt sich um die Begriffe „Tradition“, „Einfluß“, „Entwicklung“, „Evolution“, „Mentalität“ und „Geist“. Ihnen korrespondieren „Einheiten“, die von der Geschichtsschreibung vorausgesetzt werden, um die historischen Gegenstände zu erfassen. Es handelt sich um Gattungsbegriffe und Disziplinen, „Buch“ und „Werk“ sowie regulative Leitideen der ideengeschichtlichen Forschung: die Idee eines verdeckten Ursprungs von geschichtlichen Entwicklungen bzw. die Idee eines „Ungesagten“, das es hinter den materiell-konkreten Manifestationen der Geschichte zu entdecken gibt.4 Hermeneutisch kann man diese Art von Geschichtsschreibung nennen (obwohl Foucault das nicht tut), weil die Begriffe, mit denen sie operiert, so konstruiert sind, daß sie eine Einheit, eine Sinntotalität einkreisen, die sich aus den empirischen Gegebenheiten herauslesen läßt. Ausgehend von den empirischen Gegebenheiten versucht die hermeneutische Ideengeschichte ein Ganzes rekonstruktiv zu erfassen, von dem sie vermutet, daß es den untersuchten Manifestationen zugrunde liegt. Der historische Prozeß in seiner „Kontinuität“ wäre die zeitliche Abfolge der (sei es zufälligen, sei es sich notwendig auseinander ergebenden) Modifikationen dieses Ganzen. Die Idee einer solchen Totalität ist dann kein empirisches Ergebnis, das beim Betrachten historischer Dokumente sofort in die Augen springt, sondern die vorauszusetzende Form der historischen Forschung. Sie bedarf daher einer Rechtfertigung, die über ein bloßes Aufweisen ihres empirischen Vorhandenseins hinausgeht. Man könnte Foucault (oder besser der hier gegebenen Interpretation) entgegenhalten, daß es, wenn das seine These ist, seltsam ist, daß er auf eine explizite Auseinandersetzung mit der Tradition der Hermeneutik, die man mit Hans-Georg Gadamer auch als Tradition der Rechtfertigung dieser Art von Historiographie lesen kann, vollkommen verzichtet.5 Möglich ist dieser Vorwurf aber nur, wenn man dem polemischen Charakter seiner Schrift nicht Rechnung trägt. Es geht ihm nicht M. Foucault, Archäologie des Wissens, S. 33. Ebd., S. 33ff. 5 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, in: Gesammelte Werke, Bd. 1, Tübingen 1990. 3 4 Kritische Neubeschreibung 29 darum zu zeigen, daß jede historische Beschreibung in diesem begrifflichen Rahmen zum Scheitern verurteilt ist bzw. auf einem fundamentalen Irrtum beruht. Er betont lediglich den konstruktiven Charakter der hermeneutischen Ideengeschichte und klagt zu Recht die theoretische Rechtfertigung ihrer Form ein.6 Foucaults Vorwurf an die nach dem Paradigma der hermeneutischen Ideengeschichte verfahrenden Historiker lautet, daß sie diese Form als selbstverständlich und schlechthin gültig nehmen und ihren konstruktiven, theoriegeleiteten Charakter verkennen. Jedenfalls möchte er sich gegenüber dieser Tradition auf einen externen und gleichzeitig tieferen Standpunkt stellen. Dieser Standpunkt ist der Standpunkt der „diskursiven Praxis“, der Standpunkt der Archäologie:7 „Ich werde die Gesamtheiten, die mir die Geschichte anbietet, nur akzeptieren, um sie sogleich in Frage zu stellen; um sie zu entknüpfen und um zu erfahren, ob man sie legitimerweise wieder zusammensetzen kann; um zu erfahren, ob man daraus nicht andere herstellen muß; um sie in einen allgemeinen Raum zu stellen, der, indem er ihre scheinbare Vertrautheit auflöst, erlaubt, ihre Theorie zu bilden.“8 Die Grenzlinie zwischen Archäologie und hermeneutischer Ideengeschichte läßt sich auf verschiedene Weise ziehen. Sie unterscheiden sich u. a. in ihrer Haltung zum historischen Material. Während die Ideengeschichte in ihm ein „Dokument“ sieht, das erst im Zusammenhang mit einem Sinnganzen (beispielsweise eines 6 M. Foucault, Archäologie des Wissens, S. 40. Siehe aber Axel Honneth, Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt a. M. 1985, S. 131–145, 165– 167. Honneth interpretiert Foucaults Zurückweisung der Ideengeschichte bedeutend stärker im Sinne einer Kritik an einer Historiographie, die das reflexionsphilosophische Modell „des sinnstiftenden Ichs in das soziale und historische Geschehen projiziert“. Foucaults Archäologie sieht er auf dem Weg zu einer transzendentalen Semiologie, der zufolge die „Struktur einer tatsachenneutralen Zeichenordnung die subjektiv notwendige Form der Erfahrung“ bestimmt (ebd., S. 142). Foucaults Kritik übersähe aber, daß es „durch das überzeugendere Modell einer Vielzahl von historischen Akteuren ersetzt werden kann“, die dann nicht mehr gezwungen seien, „das historische Geschehen als die sinnhafte Schöpfung eines singulären Subjekts aufzufassen.“ (ebd., S. 136f.) Meines Erachtens will Foucault nicht dieses Modell kritisieren, sondern nominalistisch auf den Modellcharakter einer solchen Geschichtsbetrachtung aufmerksam machen. Nur in diesem schwachen Sinn „zieht [er] nicht den monologischen Charakter der Reflexionsphilosophie in Zweifel, sondern eskamotiert das ihr zugrunde liegende Denkmodell überhaupt.“ (ebd., S. 136). 7 Es ist sicherlich nicht überflüssig darauf hinzuweisen, daß es die „diskursive Praxis“ für Foucault nicht gibt. „Diskursive Praxis“ ist ein Begriff, der nur im Plural gebraucht werden soll. Das, was als diskursive Praxis beschrieben werden kann, ist inhaltlich heterogen. Es wird aber durch dieselbe Methode ans Licht gebracht. Da es hier nicht um die historischen Analysen Foucaults selbst geht, sondern um seine Methode (und die darin implizite Konzeption von Praxis), erlaube ich mir, den Begriff überwiegend im Singular zu verwenden. Vgl. M. Foucault, Antwort auf eine Frage, in: Schriften in vier Bänden – Dits et Ecrits, hrsg. von Daniel Defert/François Ewald unter Mitarbeit von Jacques Lagranges, Frankfurt a. M. 2001ff. [im folgenden abgek. als „Schriften“], Bd. 1, Nr. 58, S. 859–886. 8 Ders., Archäologie des Wissens, S. 41 (Übersetzung modifiziert, M. W.) – „Theorie“ meint hier folglich die methodologische Reflexion operativer Begriffe und Kategorien der historischen Forschung. 30 Markus Wolf „Werks“, einer Tradition oder des Geistes einer Epoche) einen Sinn erhält – und zwar indem es ihn ausdrückt – behandelt die Archäologie das historische Material als „Monument“, als Zeuge einer bestimmten „diskursiven Praxis“.9 Es wäre unpräzise zu sagen, daß die Monumente die diskursive Praxis „ausdrücken“. In dieser Redeweise verfügte die (implizite) diskursive Praxis gleichsam über die expressive Fähigkeit, sich in Monumenten zu artikulieren. Die Regeln, die der diskursiven Praxis zugrunde liegen, haben jedoch nicht den Status eines impliziten „Geistes“, der in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren. Vielmehr verweigern sie sich der symbolischen Artikulation und der kritischen Reflexion im Rahmen der diskursiven Praxis, der sie zugrunde liegen. Sie werden erst in einem fremden Kontext, in der archäologischen Untersuchung, offen sichtbar. Die Regeln haben gewissermaßen keine Existenz für sich, sondern nur für uns. Die diskursive Praxis hat keine Möglichkeit der Selbstvergewisserung und kein Selbstbewußtsein jenseits ihrer archäologischen Rekonstruktion. „Monumente“ sind Konglomerate von „Aussagen“. Die „Aussagen“ erscheinen, indem man die „Einheiten“ (d. h. den formalen begrifflichen Rahmen) der hermeneutischen Ideengeschichte einklammert. Sie bilden die elementaren Bausteine, von denen ausgehend die Archäologie die „Regeln“ der „diskursiven Praxis“ rekonstruiert: „Bevor man in aller Gewißheit mit einer Wissenschaft oder mit Romanen, mit politischen Reden oder dem Werke eines Autors oder gar einem Buch zu tun hat, ist das Material, das man in seiner ursprünglichen Neutralität zu behandeln hat, eine Fülle von Ereignissen im Raum des Diskurses im allgemeinen. So erscheint das Vorhaben einer reinen Beschreibung der diskursiven Ereignisse als Horizont für die Untersuchung der sich darin bildenden Einheiten.“10 Es würde von unserer Fragestellung zu weit abführen, Foucaults Bemühungen um die Abgrenzung der Aussage (als „Material“) von konkurrierenden oder sekundären Einheiten im Detail zu verfolgen. Es soll nur darauf ankommen, deutlich zu machen, was das Spezifische der „Aussage“ als elementares Diskursereignis ist. Dies findet sich darin, daß Aussagen (im Gegensatz zu Einheiten wie „Satz“, „Proposition“, „Gedanke“, „Sprechakt“) nicht über strukturelle Invarianzen (bzw. die Zusammensetzung von strukturell invarianten Elementen) identifiziert werden können. Sie bilden keine logische oder sprachliche Form, die unterschiedliche „Inhalte“ bzw. Realisierungen aufweisen kann und in der formale Bestandteile durch wechselseitige Ersetzbarkeit definiert werden können.11 Die „Aussage“ geht zurück auf eine „Existenzfunktion, die den Zeichen eigen ist und von der ausgehend man Ebd., S. 198. Ebd., S. 41. 11 Zu einer solchen Analyse der logischen Form über die Ersetzbarkeit von Ausdrücken am Beispiel singulärer Termini siehe Kap. 4 von Robert B. Brandom, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in den Inferentialismus, Frankfurt a. M. 2001. 9 10 Kritische Neubeschreibung 31 dann durch die Analyse oder die Anschauung entscheiden kann, ob sie einen ‚Sinn ergeben‘ oder nicht, gemäß welcher Regel sie aufeinanderfolgen oder nebeneinanderbestehen, wovon sie Zeichen sind und welche Art von Akt sich durch ihre (mündliche oder schriftliche) Formulierung bewirkt findet. Man braucht also nicht zu staunen, daß man für die Aussage keine strukturellen Einheitskriterien gefunden hat. Das liegt daran, daß sie in sich selbst keine Einheit ist, sondern eine Funktion, die ein Gebiet von Strukturen und möglichen Einheiten durchkreuzt und sie mit konkreten Inhalten in der Zeit und im Raum erscheinen läßt.“12 Die Archäologie ist eine Analyse nicht der Formen, sondern des Inhalts des Wissens in einer bestimmten Epoche. Sie ist aber andererseits keine, in einem platten Sinne „positivistische“, Darstellung dessen, was man in einem gegebenen Zeitraum alles wußte (und was nicht). Sie versucht vielmehr herauszuarbeiten, daß man zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten gesellschaftlichen Ort einen bestimmten Wissenstyp und damit auch bestimmte Wissensinhalte privilegierte. Diese Privilegierung ist (aus der methodischen Perspektive der Archäologie) gleichbedeutend mit einer Selektion bestimmter Strukturen aus der unendlichen Menge von logisch oder formal aber eben nicht im Rahmen jeder „diskursiven Praxis“ möglichen Aussagen. Diese Selektion erzeugt die „Einheit“, die relative inhaltliche Geschlossenheit, des Wissens. Archäologie ist das Verfahren der Rekonstruktion dieser komplexen, mehrdimensionalen Selektion. Eine Dimension dieser Selektion führt zur Privilegierung bestimmter Gegenstandstypen. Unter „Gegenstand“ ist hier keine logische oder metaphysische Kategorie zu verstehen, die ontologisch primär und überzeitlich gültig wäre, sondern eine bestimmte, historische Form der Anerkennung bzw. Nichtanerkennung von Dingen und Sachverhalten als „Gegenstand“ einer bestimmten Praxis. Die „Formation der Gegenstände“ bestimmt „als was“ ein bestimmtes rohes Phänomen im Wissen erscheint. Beispielsweise ist das Wissen über den Wahnsinn (das letztlich identisch ist mit dem, was der „Wahnsinn“ für eine Wir-Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem festgelegten Ort ist) für Foucault nicht geschichtlicher Ausdruck einer überzeitlichen Idee, sondern das Produkt bestimmter Bedürfnisse und institutionell verankerter Techniken: „Die Einheit der Diskurse über den Wahnsinn wäre nicht auf die Existenz des Gegenstands ‚Wahnsinn‘ oder die Konstitution eines einzigen Horizonts von Objektivität gegründet; es wäre das Spiel der Regeln, die während einer gegebenen Periode das Erscheinen von Objekten möglich machen: von Objekten, die durch Maßnahmen der Diskriminierung und der Repression abgegrenzt werden, von Objekten, die sich im täglichen Gebrauch, in der Jurisprudenz, in der religiösen Kasuistik, in der Diagnostik der Ärzte differenzieren, von Objekten, die sich in patho12 M. Foucault, Archäologie des Wissens, S. 126. 32 Markus Wolf logischen Beschreibungen manifestieren, von Objekten, die von Bestimmungen oder Rezepten der Medikation, der Behandlung, der Pflege umrissen sind.“13 Die Archäologie deckt auf, daß empirisch betrachtet nicht ein aus jedem sozialen Kontext ablösbares Streben nach der wahren Bedeutung des „Wahnsinns“ die psychiatrische Erkenntnispraxis konstituiert. Voraussetzung für die Möglichkeit der (normativ) an der Wahrheit orientierten Frage danach, was der Wahnsinn ist, d. h. dafür, daß es so etwas wie das Phänomen des Wahnsinns als potentiellen Gegenstand einer solchen Frage „gibt“, ist ein Netz von Techniken und Praktiken, die ihn als Gegenstand einer wissenschaftlichen Erkenntnis hervorbringen. Dieses mangelnde Bewußtsein der praktischen Voraussetzungen der normativen Frage nach der Wahrheit einer Aussage ist keine Kritik am „Ausblenden“ solcher Voraussetzungen, was auf eine oberflächliche und selbstgerechte Kritik der ideologischen Verblendung derjenigen hinausliefe, die die Frage nach den praktischen Bedingungen der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht stellen, sondern sich bloß darum kümmern, was denn nun wirklich der Fall oder wahr ist. Foucaults Auffassung ist viel radikaler: Das Nicht-Bewußthaben ihrer praktischen Voraussetzungen ist für ihn eine notwendige Bedingung der Möglichkeit der normativen Wahrheitsfrage. Die diskursive Praxis hat kein reflexives „Selbstbewußtsein“, weil sie nicht auf eine Subjektivität zurückführbar ist, die sich in ihr artikuliert. Kritik kann folglich in diesem Kontext nicht bedeuten, daß man das falsche Selbstverständnis und die mangelnde Selbstreflexion dieser Subjektivität kritisiert.14 Dies hat zur Konsequenz, daß Kritik im Kontext der Archäologie des Wissens nicht heißen kann, daß man das falsche Bewußtsein von jemandem kritisiert.15 Mit der Dissoziation von Normativität und diskursiver Praxis ist bei Foucault auch eine Dissoziation von diskursiver Praxis und Subjektivität verbunden. 2. Nun scheint es allerdings, als handele sich Foucault damit eine Reihe von Schwierigkeiten ein, die unter dem Stichwort des „Positivismus“ diskutiert worden sind.16 Auf entsprechende Vorwürfe hat er ironisch reagiert, indem er sich selbst als Ebd., S. 50f. Das schließt aber nicht aus, in einem ganz bestimmten Sinn damit unser Selbstverständnis zu kritisieren. Siehe Abschnitt 5 in diesem Aufsatz. 15 Zu einem solchen Verständnis von Kritik als Kritik an einem „falschen Bewußtsein“ vgl. Raymond Geuss, Die Idee der kritischen Theorie, Frankfurt a. M. 1996. 16 Dieser Vorwurf ist schon früh im Umfeld von Sartre gegen den Foucault der Ordnung der Dinge erhoben worden. Vgl. Sylvie LeBon, Un positiviste désespéré: Michel Foucault, in: Les Temps Modernes 248 (1967), S. 1299–1319. 13 14 Kritische Neubeschreibung 33 „glücklichen Positivisten“ bezeichnet hat. Von entscheidender Bedeutung ist in dieser Debatte letztlich die Frage, welche Konzeption sozialer Praxis man der Analyse von Aussagen legitimerweise zugrunde legen kann und ob Foucaults „diskursive Praxis“ eine solche legitime Konzeption darstellt. Foucault versteht die Analyse der diskursiven Praxis ausdrücklich als Feststellung von „Positivitäten“: „Eine diskursive Formation zu analysieren, heißt also, eine Menge von sprachlichen Performanzen auf der Ebene der Aussagen und der Form der Positivität, von der sie charakterisiert werden, zu behandeln; oder kürzer: es heißt den Typ der Positivität eines Diskurses zu definieren. Wenn man an die Stelle der Suche nach den Totalitäten die Analyse der Seltenheit, an die Stelle des Themas der transzendentalen Begründung die Beschreibung der Verhältnisse der Äußerlichkeit, an die Stelle der Suche nach dem Ursprung die Analyse der Häufigkeiten stellt, ist man Positivist, nun gut, ich bin ein glücklicher Positivist, ich bin sofort damit einverstanden.“17 Betrachtet man Foucaults Analyse der diskursiven Praxis kritisch, so scheint dieser ein defizientes Bild der sozialen Praxis zugrunde zu liegen, das man als „positivistisch“ brandmarken könne: ein Bild, in dem weder Menschen noch Institutionen vorkommen und zwar nicht einmal in der Weise, daß diese auf fundamentale Strukturen reduziert würden. Die Archäologie beschränkt sich durch ihr positivistisches Vorgehen darauf, regelmäßige Beziehungen zwischen Aussagen zu beschreiben. Damit wird ihr Unterfangen zugleich tautologisch und paradox. Tautologisch, insofern die Archäologie nur Regelmäßigkeiten wiederholt, ohne sie zu erklären oder zu verstehen. Paradox, insofern die Beschreibung der diskursiven Praxis zwar jede Menge Diskursives zu Tage fördert, in der Beschreibung des Diskursiven die Praxis, die dem Diskurs zugrunde liegen soll, aber gerade zum Verschwinden bringt. Scheinbar handelt es sich um eine Methode, die sich darauf beschränkt, Relationen und Konfigurationen von Aussagen festzustellen und dabei übersieht, daß Aussagen eine genuin expressive Funktion haben, daß sie eine Praxis artikulieren bzw. ausdrücken. Eine Methode also, die ihren Blick an den „Aussagen“ fixiert und vergißt, daß diese in einer Praxis hergestellt werden. Anders gewendet artikuliert die zusammengefaßte Kritik vor allem einen methodischen Mangel: sie deckt einen problematischen Schein der Unmittelbarkeit auf. Foucault übersieht demnach, indem er das „Archiv“, d. h. die Regeln, die festlegen, ob eine Aussage im Rahmen einer bestimmten diskursiven Praxis als sinnvoll gilt und was sie in ihr aussagt, als unmittelbar gegeben annimmt, daß die beschriebene Praxis eben nicht bloß ein Konglomerat von Aussagen darstellt, die sich auf ein recht abstraktes „System“, d. h. auf bestimmte konstante Relationen zwischen Diskurselementen zurückführen lassen, sondern eine humane Kultur aus17 M. Foucault, Archäologie des Wissens, S. 182. 34 Markus Wolf drücken. Sind die Aussagesysteme die fundamentalen Data, zu denen sich die Beschreibung der (diskursiven) Praxis unmittelbar in Beziehung setzt, entsteht das geschilderte Paradoxon, daß die archäologische Beschreibung der Praxis diese selbst aus dem Blick verliert. Foucault könnte gegen diesen Einwand geltend machen, daß er sich in seiner Polemik gegen die hermeneutische Ideengeschichte gerade gegen den Schein der unmittelbaren Gegebenheit ihrer Gegenstände wendet, der die historiographische Praxis der Ideengeschichte bestimmt. Als Archäologie zielt die historische Betrachtung statt dessen auf die Praxis der Aussagenproduktion, welche die historischen Regelmäßigkeiten erst konstituiert, die von der unaufgeklärten Ideengeschichte als Sachen selbst genommen werden. Die Praxis der Aussagenproduktion wird durch den Historiker auf der Grundlage eines gegebenen Korpus von Aussagen erst rekonstruiert. Zwischen der vollzogenen Praxis der Aussagenproduktion und den festgestellten „Positivitäten“ gibt es de jure immer noch eine Differenz. Foucaults „Archäologie“ will die immanenten Regelmäßigkeiten analysieren, die sich als „diskursive Praxis“ in der Praxis der Aussagenproduktion zeigen. Wie oben schon ausgeführt, bestimmt für den Historiker eine vorausgesetzte Vorstellung über das Wesen der Praxis entscheidend mit, wie die Geschichtsschreibung sie – und zwar sowohl bezüglich ihres Inhalts, als auch ihrer Form – beschreibt. Foucaults Projekt, Diskurse nicht als „Dokument“ sondern als „Monument“ zu behandeln, läßt sich unter dieser Prämisse als die Entscheidung verstehen, einen möglichst armen bzw. schwachen Praxisbegriff vorauszusetzen, wenn es darum geht, die „diskursive Praxis“ zu analysieren. Der ärmste denkbare Praxisbegriff ist nun derjenige, der sich darauf beschränkt, Aussagen in ihrer Positivität zu beschreiben, nämlich als Elemente eines regelgeleiteten Systems der Aussagenproduktion.18 Diese Entscheidung ist entgegen dem Anschein nicht die Konsequenz eines unreflektierten Positivismus, sondern im Versuch begründet, zunächst einmal die Faktizität des historischen Materials in seiner Regelmäßigkeit sprechen zu lassen, bevor ein durch externe Begriffe und Kategorien vermittelter interpretativer Zugriff auf dieses Material erfolgt.19 Deswegen tauchen in ihr keine voraus- 18 Wenn man so will, ist dies die ärmste und zugleich grundlegendste Definition der diskursiven Praxis. Die diskursive Praxis hat also insofern einen konstruierten Charakter, als sie sich in dieser Interpretation von der ihr zugrunde liegenden sozialen Praxis abhebt. Daß sie erst unter den hier skizzierten methodischen Voraussetzungen in der historischen Beschreibung erscheint, heißt allerdings nicht, daß es sie in Wirklichkeit nicht gibt, d. h., daß sie nicht das Resultat einer sozialen Praxis wäre. 19 Dabei ist das Die-Faktizität-sprechen-Lassen allerdings selbst eine konstruktive Operation der Historikers, die so angelegt ist, daß Archäologie weder „Fiktion“ (pure Konstruktion) noch „Interpretation“ (Konstruktion eines Sinns auf der Grundlage regulativer Prinzipien der Auslegung von Aussagen) ist. Foucault betont mehrfach, daß das archäologische Verfahren keine Inter- Kritische Neubeschreibung 35 setzungsreichen Entitäten wie Subjekte, kollektive Agenten (z. B. Klassen, Gruppen, Netzwerke, Institutionen oder der „Geist“ einer Kultur) auf. Damit bestreitet Foucault keineswegs, daß die Praxis der Aussagenproduktion ein komplexes Phänomen darstellt, in dem sich Spuren entsprechender Praxisformen ablagern könnten. Die archäologische Beschreibung läuft aber darauf hinaus, diese Spuren nur in ihrer materiellen Manifestation als Aussagen zu verfolgen. Die entscheidende Frage ist nun, wie das Verhältnis von Positivitäten und Praxis der Aussagenproduktion genauer zu beschreiben ist. Hier bieten sich zwei Lesarten an. Die erste Lesart beschreibt das Spiel zwischen Praxis und Positivitäten als Verhältnis von „Innen“ und „Außen“, als ein Spiel, das sich zwischen dem Innenraum eines Sinnsystems und seinen externen Bedingungen vollzieht. Das „Archiv“, in dem sich die Positivitäten ablagern, erscheint als ein praxisexternes, fundamentales Datum. Diese „diskursive Praxis“ wäre selbst keine gemeinschaftliche Praxis. Die Archäologie behauptet in dieser Lesart eine Art ontologischen Vorrang (oder eine ontisch-ontologische Differenz) der so verstandenen diskursiven Praxis gegenüber den sozialen Vollzügen in denen sie sich realisiert.20 Die aufgeworfene Kritik am paradoxen Charakter der Archäologie (gleichzeitig Beschreibung der Praxis sein zu wollen und den Begriff der Praxis nicht als grundlegend anzusehen) könnte in diesem Zusammenhang mit der (von Nietzsche inspipretation in diesem Sinne darstellt und gerade durch dieses Merkmal von der kritisierten Ideengeschichte abgegrenzt werden kann. Vgl. u. a. Archäologie des Wissens, S. 14f., 175, 181. 20 Die skizzierte praxisexterne Lesart der Archäologie wurde mit großer Klarheit von Hubert L. Dreyfuß und Paul Rabinow vertreten. Sie stellen in diesem Zusammenhang die in der Foucault-Literatur in verschiedenen Kontexten immer wieder artikulierte Frage, wie die scheinbare Neutralität der „positivistischen“ Archäologie mit den Aktivitäten des Historikers in der Gegenwart, insbesondere mit dessen Geltungsansprüchen zu vereinbaren ist. Foucaults Archäologie erscheint ihnen paradox: der „Metaphänomenologe“ Foucault klammert in der Beschreibung des Archivs die Geltungs- und Wahrheitsansprüche (und damit letztlich auch die „Bedeutung“) der Aussagen ein. Zugleich scheinen diese in einem allgemeinen Sinn Voraussetzung für seine Arbeit als „Archäologe“. Daraus folgt für sie ein „stets abgeschwächter Nihilismus“ Foucaults. Dieses Paradoxon entsteht jedoch nur, wenn man die Einklammerung der Teilnehmerperspektive in der Archäologie nicht als Konsequenz eines methodischen Interesses an der Beschreibung von der Entscheidung von Einzelnen entzogenen Verknappungspraktiken versteht, sondern stärker als (phänomenologische) These über notwendige und hinreichende Bedingungen der Produktion von Wahrheit und Bedeutung. Überspitzt gesagt bekommt das Archiv einen absoluten Charakter, indem es, obwohl es nicht auf in performativer Einstellung vollzogene soziale Bezüge zurückgeht, diese Vollzüge als diskursive Praxis zumindest partiell aber zugleich konstituiert. Es ist, folgt man dieser Interpretation, nur konsequent, wenn die in dieser Arbeit formulierte These der Vereinbarkeit einer philosophischen Wahrheits- und Bedeutungsanalyse, die tendenziell aus der Teilnehmerperspektive verfährt, mit der Beschreibung von historisch kontingenten Praktiken der „Wahrheitsproduktion“ aus der archäologischen Beobachterperspektive von den Autoren bestritten wird. H. L. Dreyfuß/P. Rabinow, Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Weinheim 1994, S. 111ff. 36 Markus Wolf rierten) Gegenfrage beantwortet werden, ob sie nicht durch den Versuch motiviert wird, das „Außen“, die Regeln und Regelmäßigkeiten, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen und die deshalb zugleich diesseits und jenseits der sozialen Praxis stehen, in das „Innen“ einer Geschichte einzuschließen, die immer die Geschichte einer bestimmten Form von Subjektivität ist.21 Die zweite, praxisinterne Lesart antwortet nicht mit einer erneuten Metakritik der erwähnten Kritik an Foucaults „Positivismus“. Sie deutet das „Archiv“ nicht als „Außen“, als Ensemble quasi-transzendentaler Bedingungen einer „diskursiven Formation“, sondern als Ausdruck der kontingenten Existenzbedingungen einer Wissensform. Diese Bedingungen werden nicht jenseits der Praxis fixiert, sondern selbst wieder durch eine Praxis geformt.22 Die im Archiv fixierte Ordnung des Wissens ist in dieser Lesart das zu Texten geronnene Resultat eines Willens zum Wissen, der sich in konkreten Praktiken der Wissenserzeugung verkörpert.23 Die „diskursive Praxis“ läßt sich nun als Praxis verstehen, die zwar vollzogen wird, deren Vollzug aber nicht im selben Moment vollkommen reflektiert werden kann. Das „Archiv“ ist nicht eine transzendentale Funktion, die allen Aussagen vorausgeht und ihr ereignishaftes Erscheinen determiniert, sondern es ist der Niederschlag dessen, was einer Praxis selbst intransparent bleiben muß.24 Es beschreibt 21 Ich verstehe den Begriff des „Außen“ als den Versuch Foucaults, Denken und Wissen mit Blick auf seine sprachliche Konstitution als etwas zu fixieren, das jenseits seiner linguistischen und logischen Form und seiner expressiven Funktion (seiner kulturellen und humanen Form) eine eigene, ontologische Dimension hat. M. Foucault, Die Sprache, unendlich, in: Schriften, Bd. 1, Nr. 14, S. 342–356; ders., Das Denken des Außen, in: ebd., Nr. 38, S. 670–696. So läßt die Archäologie „da, wo das anthropologische Denken nach dem Sein des Menschen und seiner Subjektivität fragte, [...] das Andere und das Außen aufbrechen.“ Ders., Archäologie des Wissens, S. 190, vgl. auch dort S. 298f. 22 Dafür spricht, daß Foucault sagt: „Aber wenn man im Verhältnis zur Sprache und zum Denken die Instanz des Aussageereignisses isoliert, so geschieht dies nicht, um sie so zu behandeln, als ob sie an und für sich unabhängig, singulär und souverän wäre. Es geht im Gegenteil darum, zu begreifen, wie diese Aussagen als Ereignisse in ihrer spezifischen Eigenart sich über Ereignisse äußern können, die nicht diskursiver Natur sind, sondern einer technischen, praktischen, ökonomischen, sozialen oder politischen Ordnung zugehören können. Den Raum, in dem sich die diskursiven Ereignisse verteilen, in seiner Reinheit erscheinen zu lassen [...] heißt, sich frei zu machen, um zwischen ihm und anderen externen Systemen ein Spiel von Beziehungen zu beschreiben. Beziehungen, die sich – ohne durch die allgemeine Form der Sprache noch durch das einsame Bewußtsein sprechender Subjekte hindurchzugehen – im Feld der Ereignisse errichten müssen.“ M. Foucault, Über die Archäologie der Wissenschaften. Antwort auf den cercle d’épistémologie, in: Michel Foucault, Schriften, Bd. 1, Nr. 59, S. 887–931, hier S. 901. 23 Vgl. M. Foucault, Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a. M. 1997, bes. S. 10–17. 24 Frédéric Gros, Michel Foucault, Paris 1998, S. 50ff. Ähnlich argumentiert auch Wolfgang Detel, Macht. Moral. Wissen. Foucault und die klassische Antike, Frankfurt a. M. 1998, S. 36f. Vgl. außerdem M. Foucault, Probleme der Kultur. Eine Debatte zwischen Foucault und Preti (Gespräch mit G. Preti), in: Schriften, Bd. 2, Nr. 109, S. 461–476. In diesem Gespräch sagt Foucault, daß er sich in seinen Forschungen „bemühe [...] jeden Bezug auf das Transzendentale, das eine Bedingung der Möglichkeit jedweder Erkenntnis sein soll, zu vermeiden.“ (Ebd., S. 466). Kritische Neubeschreibung 37 das, was in einer Praxis nicht auf ein Subjekt, ein Tun, eine Tradition oder eine Institution zurückgeht. Foucaults These wäre demnach, daß es in der sozialen Praxis eine Dimension gibt, die sich nicht unmittelbar selbst reflektieren kann, sondern die vielmehr zu ihrer Selbstreflexion einer vorhergehenden archäologischen Diagnose bedarf. Diese Dimension zeigt sich nur aus der Distanz einer historischen Beschreibung. Das erklärt, daß der Archäologe sein „eigenes Archiv“ nicht erfassen kann.25 Foucaults Positivismus wäre „unglücklich“, wenn er nur darin bestünde, ein der kritischen Reflexion entzogenes, gleichsam vorbewußtes Regelsystem aufzuzeigen, das zugleich kontingent und unveränderbar wäre, d. h. das die Praxis determinieren würde und ihr zugleich entzogen wäre. In der praxisinternen Lesart hingegen ist die Archäologie ein „glücklicher Positivismus“ und zwar deshalb, weil sie das Archiv in seiner Vergänglichkeit als eine diskursive Praxis versteht, die selber das Ergebnis von Praktiken der Aussagenproduktion ist. Die Feststellung der Kontingenz, der prinzipiellen Transformierbarkeit der diskursiven Praxis, hat eine kritische Bedeutung und eine strategische Funktion: sie dient der Destruktion des Selbstverständnisses herrschender Diskurse, sofern diese ihre eigene Historizität verschleiern, wenn sie ihre Begriffe und Praktiken an überzeitlichen Idealen orientieren. Damit nimmt sie eine wichtige Dimension der Foucaultschen Kritikkonzeption vorweg.26 3. Eine verkürzte Skizze von Foucaults Machtanalytik, die er gelegentlich als Verfahren der „Genealogie“ kennzeichnet, läßt sich um die Begriffe der „Macht“, der „Subjektivierung“ und der „Kritik“ zentrieren.27 Jeder dieser Bausteine der MachtDers., Archäologie des Wissens, S. 188f. Vgl. Andrea Roedig, Foucault und Sartre. Die Kritik des modernen Denkens, Freiburg 1997, S. 185–210. Roedig gelangt zu der Auffassung, daß Foucault die Entscheidung für die ontologisch reifizierende oder die methodologisch-kritische Lesart seines Projekts in der Schwebe hält, so daß „hinter der positivistischen Attitüde [...] auch ein unglücklicher ‚Transzendentalist‘ (steckt)“, der die normative Kritik fundierende Unterscheidung zwischen Ontologie und kontingenten Praktiken verwischt. (Ebd., S. 199). 27 Der Begriff der Genealogie wird bei Foucault selbst sehr flexibel und wenig einheitlich verwendet, um verschiedene inhaltliche und methodische Aspekte seiner Studien zu bezeichnen. Am ertragreichsten für den Versuch einer systematischen Auswertung ist die 1. Vorlesung aus dem Zyklus In Verteidigung der Gesellschaft; M. Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France [1975–76], Frankfurt a. M. 2001. Einen guten Systematisierungsversuch in Anerkennung dieser Tatsache bietet Martin Saar, Genealogie und Subjektivität, in: Axel Honneth/M. Saar (Hg.), Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, Frankfurt a. M. 2003, S. 157–177. 25 26 38 Markus Wolf analytik kann nur im Zusammenhang mit den anderen erläutert werden: Der Machtbegriff selbst oszilliert zwischen seiner handlungstheoretischen, seiner gesellschaftstheoretischen und mitunter sogar einer sozialontologischen Dimension.28 Diese Ambivalenz wird durch die These der „subjektivierenden Unterwerfung“ (assujettissement) aufgelöst, denn diese erklärt, wie anonyme Machtpraktiken als Strategien zu verstehen sind, die das Handeln von Subjekten beeinflussen, ohne auf offen oder verdeckt strategisches Handeln einzelner Subjekte zurückzugehen.29 Die Analyse von Subjektivierungsprozessen zeigt, wie „Macht“ Subjekten Handlungsmöglichkeiten vorgibt, indem sie diese erst zu dem macht, was sie sind.30 Die genealogische Darstellung von Macht/Wissen-Komplexen und von Subjektivierungsprozessen ist zugleich ein Instrument der Gegenwartsdiagnose, die sich als ein Projekt der Aufklärung mit dem Ziel der kritischen Zurückweisung von Machtund Subjektivierungsformen versteht. Erst in der kritischen Perspektive der Aufklärung, die „in der Kontingenz, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeit auffinden (wird), nicht länger das zu sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken“31, geraten die von Foucault beschriebenen Machtstrukturen und Subjektivierungsvorgänge als solche in den Blick. Letztlich ist die Foucaultsche Machtanalytik daher eine Philosophie der Kritik, die sich bemüht, den spezifischen Gegebenheiten moderner Machtformen Rechnung zu tragen.32 Es gilt zunächst, dieses Projekt näher zu erläutern. Hilfreich ist hierfür eine oft zitierte Reflexion auf den Machtbegriff in Band 1 der Geschichte des Sexualität: „Die Möglichkeitsbedingung der Macht oder zumindest der Gesichtspunkt, der ihr Wirken bis in die ‚periphersten‘ Verzweigungen erkennbar macht und in ihren Mechanismen einen Erkenntnisraster für das gesellschaftliche Feld liefert, liegt [...] in dem bebenden Sockel der Kräfteverhältnisse, die durch ihre Ungleichheit unablässig Machtzustände erzeugen, die immer lokal und instabil sind. [...] Nicht weil sie alles erfaßt, sondern weil sie von überall kommt, ist die Macht überall. Und ‚die‘ Macht mit ihrer Beständigkeit, Wiederholung, Trägheit und Selbsterzeugung ist nur der Gesamteffekt all jener Beweglichkeiten, die Verkettung, die sich auf die M. Foucault, Sexualität und Wahrheit, Bd. 1, Der Wille zum Wissen, Frankfurt a. M. 1998. Diese Begriffe im Sinne der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas. Vgl. J. Habermas, Aspekte der Handlungsrationalität, in: ders., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a. M. 1995, S. 441–472 30 M. Foucault, Nachwort von Michel Foucault. Das Subjekt und die Macht, in: H. L. Dreyfuß/P. Rabinow, Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, S. 243–261. 31 M. Foucault, Was ist Aufklärung?, in: Eva Erdmann et al. (Hg.), Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt a. M. 1990, S. 48. 32 Judith Butler, Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend, in: DZPhil 50 (2002), S. 249–265; R. Geuss, Kritik, Aufklärung, Genealogie, in: A. Honneth/M. Saar (Hg.), Zwischenbilanz einer Rezeption, S. 145–156; David Owen, Kritik und Gefangenschaft. Genealogie und Kritische Theorie, ebd., S. 122–144. 28 29 Kritische Neubeschreibung 39 Beweglichkeiten stützt und sie wiederum festzumachen sucht. Zweifellos muß man Nominalist sein: die Macht ist nicht eine Institution, ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt.“33 Das Zitat läßt drei Thesen erkennen, die Foucaults Machtbegriff charakterisieren: 1. Macht hat ihre „Möglichkeitsbedingung“ in einem Kräfteverhältnis. Das bedeutet, daß ein Machtverhältnis begrifflich und ontologisch nicht mit einem „Kräfteverhältnis“ gleichzusetzen ist. Vielmehr liegt eine Machtbeziehung nur dann vor, wenn eine asymmetrische soziale Beziehung zwischen zwei Individuen besteht. Ohne das Vorliegen einer solchen asymmetrischen Beziehung gibt es keine Macht, obwohl diese Beziehung allein nicht hinreichend ist, um von einem Machtverhältnis zu sprechen. 2. Macht ist (im Gegensatz zu „Handlung“ oder „Kommunikation“) kein soziologischer Grundbegriff, der das Soziale schlechthin auszeichnet (d. h. der „alles erfaßt“). Dennoch ist Macht ein potentiell ubiquitäres soziales Phänomen (das „von überall kommt“), welches allerdings voraussetzt, daß soziale Beziehungen nicht restlos in Machtbeziehungen aufgehen. Foucaults Machtanalytik stellt keine rudimentäre Gesellschaftstheorie dar.34 Sie vertritt insbesondere keine Position, die soziale Beziehungen auf Machtbeziehungen reduzieren würde. 3. Macht ist zunächst kein globales, sondern ein singuläres Phänomen. Grundlegend für Machtbeziehungen sind in erster Linie konkrete Kräfteverhältnisse. Diese Kräfteverhältnisse sind zudem ihrer Natur nach instabil: um bestehen zu bleiben, bedürfen sie fortwährender Aktualisierung. Erst in einem zweiten Schritt, auf der Grundlage ihrer beständigen Aktualisierung, bekommen sie einen allgemeinen und dauerhaften Charakter.35 Macht unterscheidet sich in dieser Hinsicht grundlegend von Institutionen und sozialen Status, die nicht beständig aktualisiert werden müssen. Sie ist von allen sozialen Phänomenen zu unterscheiden, die ein Allgemeines verkörpern, das sich in konkreten historischen Institutionen, Gewohnheiten und Praktiken ausdrückt. Der nominalistisch verstandene Machtbegriff beschreibt zwar ebenfalls eine (noch zu präzisierende) allgemeine Form. Sie hat aber nicht darin ihr Bestehen, daß sie von den sozialen Akteuren begriffen und anerkannt wird, sondern existiert, indem sie von diesen permanent neu erzeugt wird. Für die Interpretation des Machtbegriffs ist von entscheidender Bedeutung, wie das „Kräfteverhältnis“, das die Möglichkeitsbedingung der Macht bildet, genauer zu verstehen ist. Dem diskutierten Zitat läßt sich schon ein erster Hinweis auf eine M. Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 114. Wolfgang Detel, Macht. Moral. Wissen, S. 62. 35 M. Foucault, Das Subjekt und die Macht, S. 254. Siehe auch M. Foucault, Irrenanstalten. Sexualität. Gefängnisse, in: Schriften, Bd. 2, Nr. 160, S. 955–970. 33 34 40 Markus Wolf mögliche Präzisierung der Rede von „Kräfteverhältnissen“ entnehmen: Macht ist ein „Name“ für eine „komplexe strategische Situation in einer Gesellschaft“.36 Macht ist als strategische Integration von Kräfteverhältnissen zu verstehen. Foucault vertritt damit eine Variante des Machtbegriffs, die Wolfgang Detel das „Invisible-Hand-Modell“ genannt hat.37 Es ist nicht so, daß Individuen als Handlungsträger in Foucaults Machtanalyse abgeschafft werden. Vielmehr besteht ein Kräfteverhältnis in seiner Aktualität immer zwischen Individuen und ist in seinem Fortbestehen von ihren Handlungen abhängig.38 Handlungen wiederum stehen unter Bedingungen, die für die Individuen nicht verfügbar sind, und sie haben Folgen und Wirkungen, die über deren Intentionen hinausgehen. Sie bilden einen strategischen Zusammenhang, dessen Ansatzpunkte und Elemente von einzelnen Individuen konzipiert werden, über den insgesamt aber niemand verfügen kann. Daß eine Machtbeziehung vorliegt, heißt nicht nur, daß Handeln in unverfügbaren und unkontrollierbaren Kontexten abläuft – dies ist vielmehr ein Merkmal von Handlungen überhaupt – sondern immer auch, daß diese Kontexte einen strukturellen Zusammenhang besitzen, der den Beteiligten nicht bewußt ist. In dieser Feststellung liegt letztlich das „Politische“ der Machtanalytik Foucaults. Das Individuum ist demnach in einen Raum des Politischen unmittelbar eingeschrieben, weil es immer in Machtbeziehungen eingebunden ist. Das gilt u. a. für seine körperliche Existenz in einer Praxis der „Arbeit“: „Der menschliche Körper existiert innerhalb eines politischen Systems und durch dieses System. Die politische Macht gibt dem Einzelnen einen Raum, in dem er sich verhalten, eine bestimmte Haltung einnehmen, in bestimmter Weise sitzen, kontinuierlich arbeiten kann. Marx glaubte – und hat es so geschrieben –, dass die Arbeit das konkrete Wesen des Menschen sei. Ich halte das für einen typisch Hegelschen Gedanken. Die Arbeit ist nicht das konkrete Wesen des Menschen. Wenn der Mensch arbeitet, wenn der menschliche Körper eine Produktivkraft darstellt, so weil der Mensch gezwungen ist zu arbeiten. Und er ist dazu gezwungen, weil er von politischen Kräften durchdrungen und in Machtmechanismen eingebunden ist.“39 36 Passend dazu spielt Foucault mit der Umkehrung der Formel von Clausewitz, indem er fragt, ob „Politik als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln“ verstanden werden könnte. M. Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft, S. 32f.; ders., Der Wille zum Wissen, S. 114f.; ders., Überwachen und Strafen, Frankfurt a. M. 1994, S. 217. 37 W. Detel, Macht. Moral. Wissen, S. 44. 38 Siehe auch M. Foucault, Was ist Kritik?, Berlin 1992, S. 38 und S. 40. 39 M. Foucault, Gespräch über die Macht, in: Schriften, Bd. 3, Frankfurt 2003, Nr. 221, S. 600f. Wie man in diesem Zitat schön sehen kann, folgt aus Foucaults Analyse der Einschreibung von Individuen in singuläre Machtverhältnisse, daß er ein essentialistisches Verständnis sozialer Praxis (etwa der Arbeit als deren „Wesen“) zurückweisen muß. Kritische Neubeschreibung 41 Handeln kann daher immer doppelt beschrieben werden: zum einen als (mit Habermas könnte man sagen: primär verständigungsorientierter) Vollzug von Interaktionen auf der Grundlage konstitutiver sozialer Regeln. Zum anderen als Vorgang der Handlungssteuerung durch anonyme Strategien, die zwar bestimmten gesellschaftlichen Gruppen (in Foucaults Beispielen häufig dem Establishment, der Bourgeoisie) nützen, durch diese aber nicht kontrolliert oder gesteuert werden.40 Das Bild, das die durch eine Machtbeziehung miteinander verbundenen Agenten von ihren Handlungen entwerfen können, ist grundsätzliches ein anderes als jenes, welches eine genealogische Betrachtung ergibt.41 4. Es gilt jedoch zu beachten, daß die skizzierten handlungstheoretischen Grundlagen der Machtanalytik nur die Voraussetzung für eine inhaltliche Option darstellen: Machtanalytik ist Analyse der Verklammerung von Macht und Wissen mit der Konstitution von Subjektivität.42 Foucault thematisiert nicht schlechthin strategisches Handeln von Subjekten im Kontext seiner komplexen Bedingungen und Folgen, sondern die Verknüpfung dieser Bedingungen und Folgen mit einem „Wissen“, das entweder auf praktischen Erfahrungen oder auf wissenschaftlich kodifizierten Beobachtungen beruht. Wissen ist in diesem Zusammenhang nicht als unschuldiger Gehalt zu verstehen, sondern als eine Dimension von Machtbezie40 M. Foucault, Das Subjekt und die Macht, S. 251ff. Zu betonen ist, daß Handlungssteuerung hier das genaue Gegenteil von Determination meint. Die Steuerung von Handlungen ist vielmehr auf das Vorhandensein von Freiheitsspielräumen angewiesen. Foucault hat an mehreren Stellen das zufällige Entstehen solcher Dispositive analysiert: ders., Überwachen und Strafen, S. 351ff.; Das Gefängnis aus Sicht eines französischen Philosophen (Gespräch mit F. Scianna), in: Schriften, Bd. 2, Nr. 153, S. 895–902; Gespräch über das Gefängnis: das Buch und seine Methode (Gespräch mit J.-J. Brochier), in: Schriften, Bd. 2, Nr. 156, S. 913–932; Das Auge der Macht, in: Schriften, Bd. 3, Nr. 195, S. 250–271; Die Macht, ein großes Tier, in: Schriften, Bd. 3, Nr. 212, S. 477–495; siehe auch: Thomas Lemke, Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität, Hamburg 1997, S. 80–88. 41 W. Detel, Macht. Moral. Wissen, S. 46f. 42 M. Foucault, Das Subjekt und die Macht, S. 243, 246f., 255. Foucault thematisiert werkbiographisch betrachtet von Anfang bis Mitte der siebziger Jahre hauptsächlich Beziehungen zwischen Macht und Wissen und Mechanismen der „Subjektivierung“ und wendet sich danach verstärkt der Theorie der „Regierung“ bzw. der „Gouvernementalität“ zu. M. Foucault, Theorien und Institutionen des Strafvollzugs, in: Schriften, Bd. 2, Nr. 115, S. 476–490; ders., Die Wahrheit und die juristischen Formen, in: ebd., Nr. 139, S. 669–792; ders., Irrenanstalten. Sexualität. Gefängnisse, in: ebd., Nr. 160, S. 955–970; ders., Michel Foucault – die Antworten des Philosophen [Gespräch mit C. Bojunga und R. Lobo], ebd., Nr. 163, S. 1001–1018; ders., Macht und Wissen, in: Schriften, Bd. 3, Nr. 216, S. 515–534; ders., Sexualität und Macht, ebd., Nr. 233, S. 695–718; ders., Wahrheit und Macht [Interview mit A. Fontana und P. Pasquino], in: ders., Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin 1978, S. 21ff. 42 Markus Wolf hungen, die erlaubt, die impliziten Regeln zu erschaffen, die soziale Handlungen regulieren. Machtförmige soziale Regeln kommen überhaupt erst ins Spiel, indem Handlungen einem von den Interaktionspartnern anerkannten Wissen unterworfen werden.43 Daher werden „Kräfteverhältnisse“ für Foucault nicht wie bei Nietzsche durch den Widerstreit von „Kräften“ konstituiert. Sie bilden sich vielmehr in einer als agonale Auseinandersetzung konzipierten sozialen Praxis spielerisch heraus. Individuen sind nicht das Resultat eines „Kräftedifferentials“, so daß ihre Subjektivität auf Machteffekte zu reduzieren wäre. Die „Spiele der Macht“ setzen die Existenz von Teilnehmern voraus, damit Kräfteverhältnisse überhaupt generiert werden können. Dadurch wird eine Deutung der Machtanalytik ausgeschlossen, nach der buchstäblich alles Soziale durch die ebenso ubiquitäre wie basale und theoretisch unverständliche „Macht“ konstituiert würde, so daß Widerstand gegen diese „Macht“ denkunmöglich wäre.44 Das heißt aber nicht, daß eine Analyse der „Subjektivierung“, d. h. der Formierung von Subjektivität durch disziplinierende „Machttechnologien“, ausgeschlossen wäre. Im Gegenteil: Gerade die These, daß soziale Praktiken sich als ein Feld strategischer Auseinandersetzung beschreiben lassen, in welchem Individuen Machtformen aktualisieren, indem sie auf ein strategisch überdeterminiertes Wissen zurückgreifen, erlaubt zu verstehen, wie sie in einem bestimmten Sinn erst dadurch zu „Subjekten“ werden. Dieser Vorgang der Subjektivierung läßt sich auf zwei Weisen deuten. Die starke Lesart der Subjektivierungsthese behauptet, daß Subjekte durch Subjektivierung als solche erst entstehen. Die personale Identität und die Kompetenzen, die ein menschliches Wesen zu einem Individuum bzw. einem Subjekt machen, sind das Resultat subjektivierender Abrichtung. Die starke Lesart ist deswegen besonders interessant, weil sie verspricht, Gesellschaftstheorie und Theorie des Individuums auf elegante Weise zu verknüpfen, indem beide in den identischen theoretischen Rahmen einer Theorie gestellt werden, die Individuum und soziale Beziehungen 43 Besonders deutlich wird dies in der von Foucault analysierten Praxis der „Prüfung“. M. Foucault, Überwachen und Strafen, S. 238ff. 44 Darauf hat mich am deutlichsten Norbert Axel Richter hingewiesen, der den Spielbegriff in einer noch unveröffentlichen Dissertation an der Universität Potsdam für eine Theorie politische Handlungsformen fruchtbar zu machen versucht. Eine Interpretation, die den Spielbegriff stark betont, kann sich unter anderem auf eine genaue Lektüre der letzten Seiten von Was ist Kritik? berufen; M. Foucault, Was ist Kritik?, S. 31ff.; vgl. ders., Was ist Aufklärung?, S. 35ff. Damit wird auch der bekannten Kritik von Nancy Fraser die Grundlage entzogen; N. Fraser, Foucault und die moderne Macht. Empirische Einsichten und normative Unklarheiten, in: dies., Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs, Geschlecht, Frankfurt a. M. 1994, S. 31–55. Den weitergehenden Implikationen des Spielbegriffs kann hier nicht nachgegangen werden. Kritische Neubeschreibung 43 als Ergebnis performativer Praktiken darstellt. Kritischer Gesellschaftstheorie wäre damit eine neue theoretische Perspektive eröffnet.45 Unklar bleibt in dieser Lesart zunächst, wie ein Individuum, das durch soziale Praktiken gewissermaßen „hergestellt“ wird, in dem Sinne autonom sein kann, daß es die Regeln und Praktiken, die seine Identität ausmachen, nicht nur aufdeckt, sondern im Namen seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung radikal in Frage stellt. Unklar ist, wie durch Subjektivierung Subjekte entstehen, die nicht nur etwas können bzw. etwas vermögen, sondern ihr Leben zugleich auch selbstbestimmt führen können.46 Sein Leben selbstbestimmt zu führen, setzt voraus, das eigene Tun reflexiv in Frage stellen zu können. Die Fähigkeit zu einer selbstbestimmten Infragestellung potentiell aller Normen (also zu radikaler Kritik) scheint eine der Bedingungen für Autonomie zu sein. Das Problem dieser Lesart ist demnach, wie ein autonomes Individuum Ergebnis von Subjektivierungsprozessen sein kann. In der schwächeren Lesart kann man diesem, in der Foucault-Literatur derzeit noch nicht befriedigend gelösten Problem aus dem Weg gehen. Foucaults Begriff des „Subjekts“ ist demnach nicht mit dem empathischen Subjektbegriff zu verwechseln, der in der idealistischen Philosophie nach Kant gebraucht wird. Ein „Subjekt“ ist hier ein Individuum vielmehr als Gegenstand von Prozeduren der „Disziplinierung“ und der „Regierung“, die seine Selbstbeziehung auf eine bestimmte Weise formen. Die Macht-Wissen-Komplexe und Subjektivierungsprozesse, in die soziale Praktiken eingebettet sind, setzen Individuen und deren Vermögen, diese subjektiven Leistungen zu erbringen, auf eine nicht näher bezeichnete Weise bereits als konstituiert voraus. Der Genealogie fällt demnach nur die Aufgabe zu, die Einschreibung der Individuen in Macht-Wissen-Komplexe, Mechanismen der Subjektivierung und (Selbst-)Regierung zu beschreiben, ohne die personalen Kompetenzen der Einzelnen allein durch diese Strukturen erklären zu müssen. 5. Vergleicht man Foucaults Konzeption der „diskursiven Praxis“ in der Archäologie des Wissens und die spätere Machtanalytik, so scheinen beide auf den ersten Blick sehr wenig miteinander gemein zu haben. Während es in der Machtanalytik um die 45 Diesen faszinierenden Versuch hat Judith Butler unternommen. Zum Begriff der subjektivierenden Unterwerfung vgl. J. Butler, Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt a. M. 2001; dies., Noch einmal: Körper und Macht, in: A. Honneth/M. Saar (Hg.), Zwischenbilanz einer Rezeption, S. 52–67; zu Butler siehe Heike Kämpf, Politische Philosophie als Sprachkritik. Zum Machtdiskurs bei Judith Butler, in: Dialektik 2 (2002), S. 101–116. 46 Christoph Menke, Zweierlei Übung. Zum Verhältnis von sozialer Disziplinierung und ästhetischer Existenz, in: A. Honneth/M. Saar (Hg.), Zwischenbilanz einer Rezeption, S. 283–299. 44 Markus Wolf Analyse subjektivierender und handlungsregulierender sozialer Praktiken geht, versteht sich die Archäologie als Analyse kontingenter Praktiken der Aussagenproduktion, deren immanente Struktur aus ihren materiellen Überresten rekonstruiert wird. Ihrer tiefen Ähnlichkeit kommt man jedoch auf die Spur, wenn man das Verhältnis von Normativität, Subjektivität und dem Bild der sozialen Praxis betrachtet, das beiden Konzepten zugrunde liegt. Sowohl Archäologie als auch Genealogie abstrahieren in unterschiedlicher Hinsicht von der normativen Dimension sozialer Praktiken. Die Archäologie stellt nicht die Frage nach dem „Sinn“, der „Wahrheit“ oder „Richtigkeit“ der untersuchten Wissensbestände und Wissenstypen. Die Machtanalytik stellt nicht die Frage nach der Legitimität der von ihr untersuchten Machtstrukturen und Machtformen. Vielmehr fragen beide nach den Bedingungen, unter denen sich eine gemeinschaftliche Praxis vollzieht. Beide implizieren, daß diese Bedingungen nicht unmittelbar im Vollzug der gemeinschaftlichen Praxis kontrolliert werden können. Aussagesysteme und Machtbeziehungen gehen nicht intentional auf einzelne Individuen oder Wir-Gruppen zurück. In der performativen Einstellung, die diese im Handeln einnehmen, sind sie als solche gar nicht sichtbar. Bemerkenswert ist, daß Diskurse und Dispositive gleichwohl keine selbstreferentiellen Systeme darstellen, die von der gemeinschaftlichen Praxis von Individuen entkoppelt sind. Vielmehr sind Kräfteverhältnisse immer auch die Grundlage für soziale Beziehungen. Geregelte Aussagenproduktion vollzieht sich immer auch auf Grundlage einer implizit zu Grunde liegenden „diskursiven Praxis“. Archäologie und Genealogie artikulieren somit implizite Normen, die sozialen Praktiken zugrunde liegen. Dies hat weitreichende Folgen für Foucaults Verständnis von „Aufklärung“ oder „Kritik“, das immer wieder kritische Vergleiche mit anderen Theoretikern von Adorno über Rorty bis Wittgenstein herausgefordert hat.47 Das Problem der Gesellschaftskritik, wie es Michael Walzer geschildert hat, besteht darin, daß der Kritiker, wenn man Kritik als eine spezifische Praxis versteht, die in das Ganze der gesellschaftlichen Praxis eingebettet ist, sich auf eine scheinbar paradoxe Weise zugleich negativ und positiv auf diese Praxis bezieht.48 Negativ bezieht er sich auf sie, indem er sie kritisiert, d. h. indem er auf Normen, Werte und Praktiken aufmerksam macht, die schlecht bzw. zu verwerfen sind. Positiv bezieht er sich auf die Praxis, insofern die kritischen Maßstäbe, in deren Licht er Kritik übt, Ausdruck derselben gesellschaftlichen Praxis sein müssen. Walzer glaubt 47 Vgl. Thomas Schäfer, Reflektierte Vernunft. Michel Foucaults Projekt einer antitotalitären Macht- und Wahrheitskritik, Frankfurt a. M. 1996, sowie die Aufsätze R. Geuss, Kritik, Aufklärung, Genealogie, in: A. Honeth/M. Saar (Hrsg.), Zwischenbilanz einer Rezeption, S. 145–156; D. Owen, Kritik und Gefangenschaft. Genealogie und Kritische Theorie, , ebd., S. 122–144. 48 Michael Walzer, Kritik und Gemeinsinn. Drei Wege der Gesellschaftskritik, Frankfurt a. M. 1993. Kritische Neubeschreibung 45 daraus den Idealtypus des kritischen „Interpreten“ der Werte einer Gemeinschaft ableiten zu können, der sich nicht so weit von der kritisierten Gemeinschaft und ihren Werten entfernt, um die Möglichkeit der Anerkennung seiner Kritik zu verspielen, aber sich ihr auch nicht so stark annähert, daß er nicht mehr über die nötige kritische Distanz verfügen kann. Verglichen mit Walzers Konzeption von Kritik als „Interpretation“ ist Foucaults Projekt der Kritik von ganz anderem Typ.49 Strenggenommen besteht für Foucault Kritik nicht darin, gesellschaftliche Praktiken im Lichte gemeinschaftlicher Maßstäbe zu kritisieren. Kritik ist vielmehr eine zugleich diagnostische (also eher kognitive als evaluative) und rhetorische Operation. Sie zielt auf genau die Dimension gemeinschaftlicher Praxis, die Archäologie und Genealogie beschreiben sollen. Beide beschreiben Dimensionen des Sozialen, die nicht Ausdruck der Subjektivität von Subjekten sind und die sich auch nicht im Namen normativer Ideale (etwa der Wahrheit oder Gerechtigkeit) vollziehen. Der diagnostische Teil der Kritik besteht im Feststellen von Archiven und Dispositiven, die in der Entwicklung der modernen Gesellschaft zu dem, was sie ist, von Bedeutung waren. Ihre rhetorische oder strategische Dimension ist viel schwieriger zu erfassen. Sie ist eine Konsequenz der Einsicht, daß soziale Praktiken immer schon in Dispositive und Diskurse, d. h. in politische Zusammenhänge, eingeschrieben sind. Aus den machtförmigen Praktiken (selbst in einer theoretischen, beobachtenden Einstellung) auszusteigen und diese quasi von außen objektivistisch zu erfassen, wird daher durch die Genealogie nicht angestrebt.50 Auch der positivistische Blick des Historikers kann Machtverhältnisse nur sichtbar machen, ihnen aber nichts von ihrer Aktualität bzw. von ihrem politischen „Einsatz“ nehmen. Die Macht- und Diskursanalyse ist unauflöslich in einen politischen Zusammenhang gestellt. Foucault begreift seine Arbeiten daher als Instrumente politischer Aktion. Er möchte mit ihnen konkrete „Waffen“ für gegenwärtige politische Kämpfe liefern.51 Dadurch wird allerdings nur erklärt, warum Archäologie und Genealogie eine politische Bedeutung haben müssen. Warum diese politische Funktion zugleich 49 A. Honneth, Rekonstruktive Gesellschaftskritik unter genealogischem Vorbehalt. Zur Idee der „Kritik“ in der Frankfurter Schule, in: DZPhil 48 (2000), S. 729–737. Vgl. zum folgenden nochmals M. Saar, Genealogie und Subjektivität, in: A. Honneth/Saar (Hg.), Zwischenbilanz einer Rezeption, S. 157–177. Meine Ausführungen verdanken diesem Aufsatz sehr viel. 50 Vgl. dagegen J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M. 1998, S. 323f. 51 Foucault hat den Ausdruck geprägt, seine Arbeiten seien eine „Werkzeugkiste“ für politische Kämpfe. Siehe z. B. M. Foucault, Über Gefängnisse und Anstalten im Mechanismus der Macht (Gespräch mit M. D’Eramo), in: Schriften, Bd. 2, Nr. 136, S. 648–653, bes. S. 651; ders., Von den Martern zu den Zellen (Gespräch mit R.-P. Droit), in: Schriften, Bd. 2, Nr. 151, S. 882– 888, bes. S. 887f.; ders., Gespräch über die Macht, in: Schriften, Bd. 3, Nr. 221, S. 594–608, bes. S. 607; ders., Macht und Wissen, in: Schriften, Bd. 3, Nr. 216, S. 515–534, bes. S. 533. 46 Markus Wolf Kritik bedeutet, bleibt zunächst unklar, weil sich der strategische Widerstand gegen diagnostizierte Diskurs- und Machtformationen ausdrücklich nicht auf normative Maßstäbe berufen möchte, um diese im Lichte dieser Maßstäbe zu kritisieren. Die politische Philosophie Foucaults will sich expliziter normativer Bewertungen enthalten, ohne in eine neutrale Abstinenz von allen politischen Stellungnahmen zu verfallen. Die Zurückweisung einer normativen politischen Analyse, sofern diese auf gute Gründe und explizite Begründungen rekurriert, ist bei Foucault, radikaler noch, Kennzeichen einer neuen, besonderen Weise, als Intellektueller politisch Stellung zu beziehen.52 Jürgen Habermas hat in diesem Zusammenhang bei Foucault mit dem Argument, daß ein solcher Bezug auf normative Maßstäbe und Kriterien unausweichlich ist, einen selbstwidersprüchlichen „Krypotnormativismus“ festgestellt.53 Denn wenn das Ziel der politischen Analyse ist, Machtformen parteiisch so zu beschreiben, daß diese Beschreibungen selbst Instrumente in politischen Kämpfen sind, dann erscheint unklar, wie sich die damit unweigerlich verbundenen Parteinahmen rechtfertigen können. So verstanden wäre Foucaults Auffassung von Kritik eigentlich ein politischer Dezisionismus, dem ein Verständnis von Politik als nicht normativ ausweisbarem Kampf um Herrschaft zugrunde läge.54 Wahr ist, daß Foucault eine sehr spezifische Auffassung von der Aufgabe der Philosophie als Machtanalyse vertreten hat: „Vielleicht könnte man sich vorstellen, dass es für die Philosophie noch eine gewisse Möglichkeit gibt, in Bezug auf die Macht eine Rolle zu spielen, die nicht mehr die Rolle der Begründung oder der Verlängerung der Macht wäre. Vielleicht kann die Philosophie noch eine Rolle auf der Seite der Gegen-Macht spielen, unter der Bedingung, dass diese Rolle nicht darin besteht, gegenüber der Macht das Gesetz der Philosophie selbst zur Geltung zu bringen, unter der Bedingung, dass die Philosophie aufhört, sich entweder als Pädagogik oder als Gesetzgebung zu denken, und sie es sich zur Aufgabe macht, die Strategien der Gegner innerhalb der Machtbeziehungen, die angewandten Praktiken, die Widerstandsherde zu analysieren, zu erhellen, sichtbar zu machen und folglich die Kämpfe zu intensivieren, die sich um die Macht herum abspielen, indem die Philosophie aufhört, die Frage der Macht in Begriffen von Gut und Böse zu stellen, sondern vielmehr im Begriff der Existenz. Sich nicht fragt: Ist die Macht gut oder böse, legitim oder illegitim, Frage 52 Vgl. sein Konzept des „spezifischen Intellektuellen“: M. Foucault, Wahrheit und Macht (Gespräch mit A. Fontana und P. Pasquino), in: ders., Dispositive der Macht, S. 21–54, bes. S. 44ff. 53 J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 333f. 54 Zu dieser Art der Foucault-Kritik und ihrer Zurückweisung siehe auch J. Butler, Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend, in: DZPhil 50 (2002), S. 246–265, bes. S. 257ff. Butler analysiert das Problem unter dem Stichwort des „Voluntarismus“. Kritische Neubeschreibung 47 der Moral oder des Rechts? Sondern einfach versucht, die Frage nach der Macht von allen moralischen und juristischen Überfrachtungen zu befreien, von denen sie bislang affiziert war, und die naive Frage zu stellen, die nicht oft gestellt wurde, auch wenn einige Menschen sie seit langem stellten: Worin bestehen eigentlich die Machtbeziehungen?“55 Foucault grenzt in der zitierten Passage sein Projekt einer „analytischen Philosophie der Politik“ gegen einen normativistischen Typ philosophischer Analyse ab, von dem seine Kritiker wiederum behaupten, daß er unausweichlich ist, sobald man Gesellschaftskritik betreiben will, ohne in „Kryptonormativismus“, „Relativismus“ oder „Voluntarismus“ zu verfallen. Strenggenommen geht es ihm jedoch darum, einen anderen Typ von Philosophie jenseits der falschen Alternative zwischen Normativismus und Relativismus bzw. Voluntarismus zu etablieren. Es ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, wie man die „Strategien“, „Taktiken“ und „Widerstandspunkte“, von denen Foucault spricht, versteht. Sie sind nicht einfach Korrelate eines auf strategischem Handeln basierenden Machtbegriffs. Der Machtbegriff beschreibt eine soziale Form, die den Rahmen für die Realisierung von Handlungen abgibt. Strategien, Taktiken und Widerstand gibt es folglich auf zwei Ebenen: zum einen auf der Ebene interessegeleiteten Handelns, bei dem Individuen versuchen, ihre Präferenzen gegen die Absichten der anderen durchzusetzen, zum anderen aber, und auf diese Ebene kommt es Foucault in erster Linie an, auf der Ebene des Widerstands innerhalb einer Machtform gegen die Strategien und Taktiken dieser Machtform. Aus diesem Grund ist die Intensivierung der „Kämpfe [...], die sich um die Macht herum abspielen“, entgegen dem ersten Anschein nicht schlicht als Kampf um die Macht zu verstehen, die sich bestimmter Strategien und Taktiken bedient, damit die Unterlegenen den Siegern Widerstand entgegensetzen können. Es handelt sich statt dessen um eine politische Analyse der Machtformen, die bestimmte Kräfteverhältnisse und Kämpfe erst ermöglichen. Individuen kämpfen nicht um Macht (in der Bedeutung, die Foucault diesem Wort gibt), sondern sie verfolgen Handlungsziele in von Macht durchdrungenen, d. h. von vornherein asymmetrischen Kontexten. Sie versuchen, im Rahmen gegebener Machtverhältnisse die Kräfteverhältnisse zu verschieben, die zwischen ihnen und anderen Individuen bestehen. Die Beschreibung dieser Machtverhältnisse und ihrer Form durch die Machtanalyse soll verändernd auf die Kräfteverhältnisse und Kämpfe einwirken. Kritik in Foucaults Sinn ist nicht einfach ein Verschieben von Kräfteverhältnissen, sie erschöpft sich aber auch nicht in der Analyse von Machtformen als Gegenstand und Rahmenbedingung politischer Kämpfe. Sie ist auch nicht Kritik an 55 M. Foucault, Die analytische Philosophie der Politik, in: Schriften, Bd. 3, Nr. 232, S. 682 (Hervorhebung M.W.). 48 Markus Wolf einer bestimmten Praxis im Lichte bestimmter Werte, die dieser Praxis entstammen. Sie ist vielmehr eine negative Haltung, die bestimmte Machtformen nach deren Analyse zurückweist. Das zeigt die historische Definition, die Foucault in Was ist Kritik? dem Kritikbegriff gibt56: „Als Gegenstück zu den Regierungskünsten, gleichzeitig ihre Partnerin und Widersacherin, als Weise ihnen zu mißtrauen, sie abzulehnen, sie zu begrenzen und sie auf ihr Maß zurückzuführen, sie zu transformieren, ihnen zu entwischen oder sie immerhin zu verschieben zu suchen, als Posten zu ihrer Hinhaltung und doch auch als Linie der Entfaltung der Regierungskünste ist damals in Europa eine Kulturform entstanden, eine moralische und politische Haltung, eine Denkungsart, welche ich nenne: die Kunst nicht regiert zu werden bzw. die Kunst, nicht auf diese Weise und um diesen Preis regiert zu werden. Als erste Definition der Kritik schlage ich also die allgemeine Charakterisierung vor: die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden.“57 Trotz ihres historischen Bezugs ist diese Begriffsbestimmung hinreichend allgemein, um anzudeuten, was Kritik bei Foucault überhaupt heißt. Kritik ist der Widerstand, den Individuen innerhalb einer bestimmten Machtform (z. B. der Regierungsmacht) gegen diese Machtform ausüben oder zumindest auszuüben beabsichtigen.58 Sie bedarf einer „Kunst“, eines praktischen Wissens, das fähig ist, geeignete Ansatzpunkte für Widerstand auszumachen. Deshalb geht es auf dieser Ebene zunächst nicht darum, ob Widerstand moralisch richtig oder gerecht ist, sondern es ist vor allem nötig, Widerstandspunkte sichtbar zu machen. Denn erst wenn die in einem Machtverhältnis agierenden Individuen sich darüber klar werden, daß die asymmetrische Beziehung, die einem konkreten Kräfteverhältnis zugrunde liegt, in einem für sie ursprünglich intransparenten Machtverhältnis gründet, werden sie wünschen können, dieses Verhältnis loszuwerden. Eine Philosophie, die dieses Projekt verfolgt, muß aufhören, normative Fragen als grundlegend anzusehen, sofern diese strikt an rationale Rechtfertigung gekoppelt sind (was nicht das gleiche ist wie zu behaupten, sie wären bedeutungslos). Denn diese können, wenn es um Macht geht, erst auf einer zweiten Stufe gestellt 56 Ihr liegt der Begriff der „Regierung“ von Individuen nach dem Modell der christlichen Pastoralmacht im 15. und 16. Jahrhundert zugrunde. 57 M. Foucault, Was ist Kritik?, S. 12. Zum Thema der Regierung bzw. der Regierungsmacht vgl. Thomas Lemke, Eine Kritik der politischen Vernunft, S. 126–256. 58 „Wenn es sich bei der Regierungsintensivierung darum handelt, in einer sozialen Praxis die Individuen zu unterwerfen – und zwar durch Machtmechanismen, die sich auf Wahrheit berufen, dann würde ich sagen, ist die Kritik die Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin. Dann ist die Kritik die Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Ungenügsamkeit. In dem Spiel, das man die Politik der Wahrheit nennen könnte, hätte die Kritik die Funktion der Entunterwerfung.“ M. Foucault, Was ist Kritik?, S. 15. Kritische Neubeschreibung 49 werden. Sie fragen danach, ob Widerstand gegen ein Machtverhältnis gerechtfertigt ist oder nicht, d. h. ob er aus einer moralischen oder ethischen Perspektive wünschenswert oder abzulehnen ist. Die normative Rechtfertigung nimmt das Machtverhältnis selbst und den Widerstand als gegeben, als Ausgangsbasis für ihre philosophische Reflexion, während es in Foucaults Projekt der Genealogie deren Ziel darstellt. Es ist daher nicht unangemessen zu sagen, daß eine ausschließlich normative Fragestellung den Weg zu Kritik in Foucaults Sinn versperrt, indem sie als gegeben annimmt, was nach Foucault doch eigentlich erst Aufgabe und Ziel der historisch-philosophischen Arbeit sein müßte. Obwohl sie sich nicht im Modus des Gebens und Nehmens von Gründen bewegt und damit ihre eigene normative Rechtfertigung und Begründung ausspart, ist Foucaults Konzeption von Kritik ein intersubjektives, gemeinsames Projekt von Leser und Autor archäologischer und genealogischer Schriften. Der performative Erfolg von Foucaults historischen Beschreibungen beruht darauf, daß sie als Kritik, als kritisches Aufmerksam-Machen auf Verhältnisse, von denen wir uns befreien wollen, verstanden werden. Seine Analysen erzielen einen kritischen Effekt erst dadurch, daß er nahe legt, daß es „unsere“ Gesellschaft ist, daß wir es sind, die durch die beschriebenen Machtverhältnisse und Aussagesysteme in ihrer Identität bestimmt werden.59 Kritik ist demnach nicht nüchterne Diagnose, sondern immer auch politische Konstruktion, deren Plausibilität davon abhängt, daß sie ihren Adressaten als glaubwürdige Rekonstruktion ihrer Erfahrung erscheint.60 Als „Politik der Wahrheit“ lehrt Foucaults Kritik ihre Adressaten, sich auf eine Weise neu zu verstehen, die als politisch konstruierte Wahrheit tief in das eigene Selbstverhältnis eingreift, bevor normative Fragen nach den „guten Gründen“, d. h. nach der „Wahrheit“ dieser Wahrheit überhaupt einsetzen können. Die Infragestellung des lebensweltlichen Vorverständnisses bzw. der überkommenen, traditionellen Interpretation, die die Teilnehmer einer gesellschaftlichen Praxis von deren Sinn und deren Ursprüngen haben, ist letztlich das gemeinsame Anliegen von Archäologie und Genealogie Foucaults. Sie erfolgt im Aufzeigen grundlegender, dem üblichen Verständnis erst einmal entzogener Aspekte dieser Praxis, auf deren Grundlage eine plausible Neubeschreibung erfolgen soll. Foucaults Arbeiten verweisen damit jeweils auf eine wichtige Dimension des Sozialen, die in einem Verständnis von Kritik, das die Aktivität des Kritikers immer schon als explizite Auseinandersetzung mit Werten und Gründen versteht, abgeblendet wird. Sie zeigen, daß auch der kritische Interpret einer gemeinschaftlichen Praxis eines spezifischen, normativ aufgeladenen Vorverständnisses dieser 59 M. Saar, Genealogie und Subjektivität, in: A. Honneth/M. Saar (Hg.), Zwischenbilanz einer Rezeption, S. 157–177. 60 Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieser Effekt in Foucaults Darstellung der Disziplinargesellschaft in Überwachen und Strafen. M. Foucault, Überwachen und Strafen, S. 251–292. 50 Markus Wolf Praxis bedarf, bevor er sie prüfend ins Licht normativer Ideale hält. Die zentrale methodische These Foucaults ist, daß dieses Vorverständnis nicht durch die kritische Selbstreflexion eines einzelnen oder kollektiven Subjekts (etwa durch phänomenologische Reflexion, Begriffs- oder Sprachanalyse) eingeholt werden kann, sondern durch eine kritische Neubeschreibung aufgedeckt werden muß, für die Archäologie und Machtanalytik methodische Modelle liefern. Diese These ist es im Kern, die Foucaults Werk nicht nur historisch interessant, sondern auch philosophisch originell macht.61 Daß das intersubjektiv geteilte normative Vorverständnis sozialer Praxis immer zugleich Gegenstand und Instrument politischer Auseinandersetzung ist, ist eine weitere zentrale Einsicht, die man bei ihm finden kann. Es im Lichte dieser Einsicht transparent zu machen und aufzuklären ist das einheitliche Ziel von Foucaults historischen Untersuchungen sozialer Praktiken. 61 Foucaults in der Tradition Nietzsches stehendes Vorgehen bekommt so den Charakter einer philosophischen Methode, die auch für andere Zwecke (z. B. der Kritik an der im Liberalismus gängigen Unterscheidung zwischen einer privaten und öffentlichen Sphäre) nutzbar gemacht werden kann. Vgl. R. Geuss, Privatheit. Eine Genealogie, Frankfurt a. M. 2002.