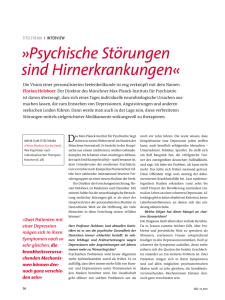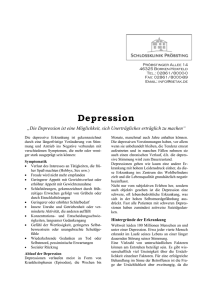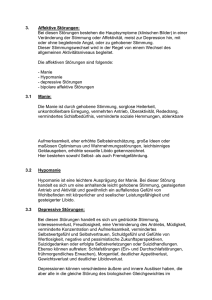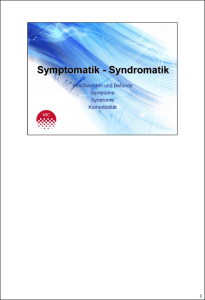Depression - RWI Essen
Werbung

Depression Wie die Krankheit unsere Seele belastet Editorial Editorial Im Jahr 2030 wird die Depression laut einer Prognose der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Industrienationen die am häufigsten vorkommende verbreitete Krankheit sein. Bereits heute leiden an ihr weltweit rund 120 Millionen Menschen. In Deutschland sind rund vier Millionen Menschen daran erkrankt. Dennoch verschließt die Öffentlichkeit nur allzu oft die Augen vor der Depression. Um zu begreifen, wie sehr uns diese Krankheit heute schon betrifft, mittelbar oder unmittelbar, braucht es oftmals ein dramatisches Ereignis wie etwa den Suizid des Fußball-Nationaltorwarts Robert Enke. Der mediale Aufruhr um den Tod als Folge einer Depression zeigte uns, wie sehr dieses Thema alle beschäftigt, allerdings auch, wie schnell es wieder in Vergessenheit geraten kann. Mit diesem Report möchte die Allianz deshalb auch dafür sorgen, sich der schleichenden Gefahr, die die Krankheit mit sich bringt, bewusst zu bleiben. Das persönliche Leid, das die Betroffenen, ihre Familien und Freunde durchmachen, lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken, die Schäden, die die Depression verursacht, sind niemals zu beziffern. Berechnen lässt sich allerdings, dass diese Krankheit die deutsche Volkswirtschaft jährlich zwischen 15,5 und 21,9 Milliarden Euro kostet − immerhin 0,88 Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung. Die Allianz hat in diesem Report die wichtigsten Fakten zum Thema Depression zusammengetragen und allgemein verständlich aufbereitet. Unser besonderer Dank gebührt dabei den renommierten Wissenschaftlern, die unseren Autoren Einblick in den Stand ihrer aktuellen Forschung gewährt haben. So erklärt Prof. Mathias Berger, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg, warum die zweigleisige Behandlung mit Antidepressiva und Psychotherapie die erfolgversprechendste Therapie gegen eine Depression ist. Priv.-Doz. Dr. Dr. Albert Zacher, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg, spricht über die Rolle der Sozialpsychiatrie bei der Behandlung von Depressiven und beklagt dabei den dramatischen Mangel an Psychiatern vor allem im ländlichen Raum. Prof. Gerhard Gründer, stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Aachen, beschreibt, wie schwer es für die bildgebende Diagnostik ist, Depressionen im menschlichen Gehirn so sichtbar zu machen, dass man sie wirksam behandeln kann. Prof. Thomas Pollmächer, Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt, skizziert die Methoden des Schlafentzugs und Prof. Christoph Hock, Chefarzt für Alterspsychiatrie an der Universität Zürich, erklärt, wie häufig Depressionen auch im Alter sind und welche Folgen das haben kann. Mit Prof. Florian Holsboer, Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, haben wir einen der weltweit angesehensten Depressionsforscher als Autor für diese Publikation gewinnen können. Prof. Holsboer entwirft seine Vision der personalisierten Medizin. Seine These: Jede Depression ist eine eigene Krankheit. Und jede Krankheit verdient eine eigene Therapie. Gerade im psychiatrischen Bereich ist Patientenautonomie wichtig, und das geht nur auf Basis umfassender Information, Transparenz und Aufklärung. 4 Editorial Mit diesem Report setzt die Allianz die Publikationsreihe fort, die wir mit einer Veröffentlichung zum Thema Pandemie im Jahr 2006, auf dem Höhepunkt der Hysterie um die Vogelgrippe, begonnen haben. Wir möchten damit einen Beitrag zur umfassenden Aufklärung und Information über gesellschaftlich relevante Themen leisten. Christian Molt Mitglied des Vorstands der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG 5 6 Vorwort Vorwort Die Depression ist wohl diejenige Krankheit, die den Menschen am tiefsten in seinem Inneren trifft. Sie macht ihn hilflos und beraubt ihn seiner Fähigkeit, mit klaren Gedanken Künftiges zu planen und die Tragweite gefällter Entscheidungen abzuschätzen. Aus dieser Hilflosigkeit heraus entwickeln sich Verzweiflung und der Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Täglich sterben in Deutschland 30 bis 40 Menschen durch Suizid und erinnern uns somit eindrucksvoll daran, dass die Depression auch eine potenziell tödliche Krankheit ist. Die Depression kann jeden treffen, egal, in welchem Land und in welcher Kultur er lebt, welcher Religion er angehört, welche Hautfarbe er hat, ob er Mann oder Frau ist, arm oder reich, alt oder jung. Die Depression ist wohl die „menschlichste“ aller Krankheiten. Ob Tiere eine Depression haben können, ist unbekannt. Willentlich, also durch Suizid, scheiden Tiere nicht aus dem Leben. Die Depression ist auch eine rätselhafte Erkrankung. Trotz aller Fortschritte kann die Forschung die Depressionsentstehung noch nicht exakt erklären. Aber auch für die Öffentlichkeit ist die Depression ein Mysterium: Sie ist eine Bühne für geistvolle, aber unproduktive Leib-Seele-Diskussionen. Oft mag man sie gar nicht als Krankheit akzeptieren, ja nicht einmal eingestehen, dass man depressiv erkrankt ist. Es werden verschleiernde Diagnosen geschaffen, wie das „Burn-out“-Syndrom, um das Stigma einer Depression zu vermeiden. Die Depression ist eine heimliche, aber vor allem eine unheimliche Krankheit. Die pharmazeutische Industrie, von der man eigentlich große Innovationen bei Vorbeugung und Therapie der Depression erwarten könnte, hat enttäuscht: Große Konzerne haben die Erforschung neuer, antidepressiv wirkender Medikamente eingestellt und warten auf Forschungserfolge akademischer Einrichtungen und Biotechnologie-Firmen. Aber vor allem warten die Bürger, die durch Steuergelder und andere Abgaben die Forschung finanzieren, auf Ergebnisse, die helfen, ihre Gesundheit zu erhalten oder ihnen im Krankheitsfall wirksame Behandlungen zugänglich zu machen. Der Allianz Privaten Krankenversicherung ist für diesen Report zu danken. Sie dokumentiert dadurch, wie ernst auch von Seiten der Kostenträger die Krankheit Depression genommen wird. Insbesondere danke ich Dr. Nilufar Heydari für ihre Unterstützung. Die Veröffentlichung wird dazu beitragen, die Depression in der Öffentlichkeit als das wahrzunehmen, was sie ist: eine äußerst komplexe Krankheit, die ihren Ursprung in Veränderungen von Stoffwechselvorgängen im Gehirn hat. Somit trägt dieser Report auch dazu bei, die Depression als eine „normale“ Krankheit anzusehen. Dies wird den Betroffenen helfen, ohne Sorge vor Stigmatisierung mit ihrer Depression offen umzugehen. Florian Holsboer Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychatrie 7 Inhalt Inhalt Editorial 4 VORWORT 7 Executive Summary 10 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Volkskrankheit Depression Diagnose Depression Die Gefahren der Depression Exkurs − Wenn Depressionen zum Suizid führen Warum der Wunsch zu leben an Kraft verliert Depression ist nicht gleich Depression 13 15 17 17 18 20 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt 24 Direkte Kosten 24 Indirekte Kosten 25 Durch Mortalität verursachte Kosten 26 Durch Erwerbsunfähigkeit verursachte Kosten 27 Durch Arbeitsunfähigkeit verursachte Kosten 28 Durch verminderte Arbeitsfähigkeit am Arbeitsplatz verursachte Kosten 28 Gesamtkosten 29 Exkurs − Depression in Unternehmen 30 Präventionsstrategien 30 Betriebliche Prävention wird immer wichtiger Interview mit Gesundheitsberater Sebastian Krolop, ­ geschäftsführender Gesellschafter der ADMED GmbH 32 3Therapie 3.1 Pharmakotherapie 3.1.1 Antidepressiva 3.1.2Neuroleptika, Lithium und Mood Stabilizer 3.2 Psychotherapie 3.2.1 Verhaltenstherapie 3.2.2 Psychoanalytisch begründete Verfahren 3.2.3 Weitere Maßnahmen zur seelischen Balance, zum Wohlbefinden und für das Gleichgewicht 3.3 Die optimale Therapie Interview mit Prof. Dr. Mathias Berger, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg 3.4 Einblick ins Gehirn 3.5 Fahndung nach Biomarkern 8 34 34 34 36 36 36 37 37 38 41 43 Inhalt 3.6 3.7 3.8 3.9 4 Das soziale Umfeld Interview mit Priv.-Doz. Dr. Dr. Albert Zacher, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg 46 Weniger Schlaf ist oft mehr 48 Depression im Alter 50 Über die Rolle der Privaten Krankenversicherungen Interview mit Dr. Olaf Karitzki, Allianz Private Krankenversicherungs-AG 51 Für eine bessere Depressionstherapie Eine Vision von Prof. Florian Holsboer 54 5 Ratgeber für Betroffene 60 9 Executive Summary Executive Summary Wussten Sie, dass sich in Deutschland jedes Jahr fast doppelt so viele Menschen das Leben nehmen, als im Straßenverkehr umkommen? Dass die Deutschen heute doppelt so viele Antidepressiva nehmen wie noch vor zehn Jahren? Dass hierzulande jedes Jahr fast elf Millionen Tage zusammenkommen, an denen Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, nicht zur Arbeit gehen können? Jeder zwanzigste Deutsche leidet an einer Depression, weltweit sind es nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über 120 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Dabei beschränkt sich die Depression nicht auf einen Lebensbereich: Sie erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Demenzerkrankungen. Sie grenzt die Betroffenen oft aus ihrem sozialen Umfeld, aus ihrem Freundeskreis und ihrer Familie aus. Depressionen sind Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit oder Frühverrentung. Und etwa 7.000 Menschen treibt sie jedes Jahr in den Suizid. Im Jahr 2030 wird die Depression laut einer Prognose der WHO in den Industrienationen die häufigste Krankheit sein. Mit den in diesem Report vorgestellten Therapieansätzen, vor allem den medikamentösen und psychotherapeutischen Verfahren, verfügt die Medizin zwar über Instrumente, die teilweise zu guten klinischen Ergebnissen führen. „Doch ist es der Medizin bis heute nicht gelungen, den genauen Mechanismus dieser Krankheit zu begreifen, um noch gezielter gegen sie vorgehen zu können“, schreibt Prof. Florian Holsboer, Direktor des Münchner Max-PlanckInstituts für Psychiatrie, ab Seite 54. Er arbeitet an der Vision, dass schon bald jede Depression personalisiert behandelt werden kann. Neben der Forschung nach neuen Therapieansätzen gilt es, Prävention und Früherkennung der Krankheit zu verbessern. Immer noch werden Depressionen viel zu oft nicht oder zu spät 10 erkannt und somit nicht oder zu spät behandelt. Dramatisch in diesem Zusammenhang „ist der Mangel an Psychiatern vor allem im ländlichen Raum und ganz besonders in den neuen Bundesländern“, sagt Priv. Doz. Dr. Dr. Albert Zacher, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg. Heute erfolge nur noch jede zehnte Einweisung in psychiatrische Kliniken durch einen Psychiater, sagt Zacher im Interview auf Seite 46. Auch die Unternehmen sind längst nicht ausreichend auf die wachsende Zahl von Arbeitnehmern vorbereitet, die an psychischen Störungen leiden. Dabei kommt den Arbeitgebern beim Kampf gegen Depression eine besondere Rolle zu. „Noch immer ist die Prävention psychischer Erkrankungen in den meisten Unternehmen ein Tabuthema“, sagt Ruth Stock-Homburg, Prof.in für Marketing und Personalmanagement an der Technischen Universität Darmstadt. Nur langsam denken Mittelständler und Großkonzerne um und installieren Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter. „Noch schwieriger ist es bei kleinen und mittleren Betrieben“, sagt StockHomburg (Seite 31). Dort sei oft gar keiner zuständig für Gesundheitsmanagement. Psychische Belastungen, Burn-out oder Depressionen werden zu einem Kostenfaktor, den Unternehmen nicht mehr ignorieren können. Den Unternehmen geht es letztlich um dieselben Fragen wie der gesamten Volkswirtschaft. Wie lässt sich die Krankheit im Idealfall durch kluge Präventionsmaßnahmen vermeiden? Und falls das nicht gelingt, inwieweit wirkt sich dann ein erhöhter Krankenstand auf die Produktionsprozesse aus, wie lässt sich vermeiden, dass wichtiges Know-how verloren geht, und welche Auswirkungen hat all das auf die Wertschöpfung? Welche Kosten die Krankheit verursacht, zeigen die Zahlen, die die Allianz und das Wirtschaftsforschungsinstitut RWI für diesen Report berechnet haben (Seite 24): Danach liegen die direkten und indirek- Executive Summary ten Kosten, die die Krankheit in Deutschland jährlich verursacht, zwischen 15,5 und 21,9 Milliarden Euro, das sind bis zu 0,88 Prozent unserer Wirtschaftsleistung. Allein zwischen 2002 und 2008 sind die direkt durch Depressionen verursachten Krankheitskosten um ein Drittel auf 5,2 Milliarden Euro gestiegen. Mit 10,3 bis 16,7 Milliarden Euro sind die indirekten Kosten dieser Krankheit ungleich höher, unter anderem, weil die depressionsbedingten Fehlzeiten in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben. Aber auch, weil Menschen zur Arbeit gehen, die besser zu Hause bleiben und sich behandeln lassen sollten. Die durch verminderte Produktivität depressiver Arbeitnehmer am Arbeitsplatz verursachten Kosten stellen den mit Abstand größten volkswirtschaftlichen Schaden dar (Seite 28). Umso wichtiger ist es, mit diesem Report einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Depression in unserer Gesellschaft nicht länger tabuisiert und stigmatisiert wird, sondern als das verstanden wird, was sie ist: eine ernst zu nehmende Krankheit. 11 12 Volkskrankheit Depression 1 Volkskrankheit Depression „Unsere Zahlen zeigen, dass Depression im Jahr 2030 in den Industrieländern die am weitesten verbreitete Krankheit sein wird.” die Zahl der Fälle allein zwischen 2004 und 2008 um 23 Prozent gestiegen. Shekhar Saxena, Department of Mental Health der ­Weltgesundheitsorganisation Epidemiologische Studien bestätigen die zunehmende Bedeutung dieser Volkskrankheit: Das Risiko eines in Deutschland lebenden Menschen, zumindest einmal im Leben an einer Depression zu erkranken, die unbedingt behandelt werden muss, liegt bei rund zehn Prozent. Sie tritt in allen Altersschichten und sozialen Gruppen auf. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer, bei schwer verlaufenden Depressionen ist das Verhältnis aber ausgeglichen. Bei einem Drittel der Patienten geht der Erkrankung ein Schicksalsschlag voraus, etwa der Verlust eines nahen Angehörigen oder eine Trennung vom Lebenspartner. Zukunftsprognosen verändern den Blick auf die Gegenwart. Im Jahr 2030 sollen in den Industrienationen mehr Menschen an einer Depression erkrankt sein als an jeder anderen Krankheit. Davon geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus. Nach Schätzungen der UNO leiden weltweit heute rund 450 Millionen Menschen an einer Erkrankung des zentralen Nervensystems. Laut WHO sind bereits 121 Millionen Menschen an einer Depression erkrankt. Nicht einmal jeder vierte Erkrankte hat einen Zugang zu Behandlungsmethoden, in manchen Ländern liegt der Anteil sogar unter zehn Prozent. Von den 466 Millionen Europäern sind laut der „Global Burden of Disease Study“ der Harvard University etwa 20 Millionen Menschen depressiv. In Deutschland sind es einer Studie des Bundesministeriums für Gesundheit zufolge vier Millionen Menschen oder jeder Zwanzigste. Tendenz steigend: Laut einer im März 2010 von der Ersatzkasse KKH-Allianz veröffentlichten Studie ist Häufigkeiten Krankheiten in den Industrienationen im Jahr 2030 1 Depression 2 Ischaemische Herzerkrankungen 3 Alzheimer und andere Demenzen 4 Alkoholbedinge Störungen 5 Diabetes Quelle: WHO Jeder dritte Betroffene erleidet in seinem Leben nur einmal eine Depression, bei zwei von drei Erkrankten allerdings kehren die depressiven Episoden wieder, hat das US-amerikanische National Institute of Mental Health bereits 1989 in einer repräsentativen Studie herausgefunden. Dabei handelt es sich nicht um kurze Phasen: Dem deutschen „Kompetenznetz Depression“ zufolge dauert eine depressive Episode in der Regel zwischen drei und zwölf Monaten, auch wenn es hiervon in der Praxis erhebliche Abweichungen geben kann. Jeder fünfte Bundesbürger war wegen psychischer Beschwerden mindestens einmal beim Arzt, hat die Bertelsmann-Stiftung ermittelt. 2008 gingen rund 60.000 Beschäftigte deshalb vorzeitig in Rente. Die Zahl der psychisch bedingten Fehltage ist in den vergangenen zwölf Jahren um fast 80 Prozent gestiegen. Alarmierender noch ist die Lage bei den Erwerbslosen: Allein in der ersten Jahreshälfte 2010 registrierte die Bundesagentur für Arbeit rund eine Million Arbeitsunfähigkeitsfälle. Die Techniker Krankenkasse berichtet 13 Volkskrankheit Depression Krankenstandsquoten bei Erwerbstätigen und arbeitssuchenden Leistungsbeziehern von ALG I und II (im Mikrozensus 2005: Jahresdurchschnitt) Erwerbstätige Arbeitslosengeld IBezieher Arbeitslosengeld IIBezieher 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % krank /unfallverletzt am Erhebungstag Quelle: DGB für die Jahre 2000 bis 2009 über einen Anstieg der Krankmeldungen Erwerbsloser von 107 Prozent. Inzwischen sei fast jeder vierte Fehltag auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen. Zugenommen hat allerdings auch die Zahl der Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. An Zahlen, die belegen, dass die Depression sich längst zur Volkskrankheit ausgewachsen hat, mangelt es nicht, auch wenn es bisweilen an der nötigen Trennschärfe fehlt und die Unterschiede zwischen psychischen Belastungen, Burn-out und letztlich der Depression im Einzelfall verschwimmen. Tatsache ist, dass die Deutschen weniger krank werden als früher. In den Siebzigerund Achtzigerjahren waren die krankheitsbedingten Ausfallzeiten noch fast doppelt so hoch wie heute. Rückenschmerzen, Magenschmerzen oder Herzleiden halten uns heute viel seltener von der Arbeit ab, doch die Zahl der Depressionsfälle hat zugenommen. Womit aber lässt sich der Anstieg erklären? Ein Grund für die Zunahme der Depression liege auch in der verbesserten Aufklärung 14 der Menschen, sagt Dr. Nilufar Heydari von der Allianz Private KrankenversicherungsAG. „Die Krankheit hat bei der Bevölkerung inzwischen eine höhere Akzeptanz, die Betroffenen sind besser informiert, ihre Selbstwahrnehmung ist geschärft“, sagt Heydari. Der medizinische Fortschritt und Prominente, die sich öffentlich zu ihrer Depression bekannten, hätten dabei sicher auch geholfen. Doch erklärt das nur einen Teil der Entwicklung. Die Wissenschaft führt diese auch auf die veränderten Lebensumstände im globalisierten 21. Jahrhundert zurück. So hat sich der Arbeitsmarkt geteilt: Teilzeitarbeiter und Minijobber auf der einen, Workaholics auf der anderen Seite. Laut einer Studie des Bundesamtes für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin arbeitet heute jeder zehnte Vollzeitbeschäftigte mehr als 60 Stunden in der Woche. Und jenen Teil der Bevölkerung, der immer mehr arbeitet oder arbeiten muss, begleiten die neuen Kommunikationsmittel bis tief in die Freizeit. Handys, Smartphones und soziale Netzwerke im Internet wie Facebook oder Twitter vereinnahmen immer mehr unserer Zeit. Erfolgsdruck im Job und die ständige Suche nach Selbstverwirklichung haben die Volkskrankheit Depression Erwartungen an uns, durch andere wie durch uns selbst, immer weiter erhöht. Menschen, die großem Stress und Druck ausgesetzt sind, leiden doppelt so häufig an Depressionen und Angstzuständen. 1.1 Diagnose Depression „Dass ich eine Depression habe, war mir lange Zeit nicht bewusst. Meistens hat es sich so geäußert, dass ich daran gar nicht dachte: Ich hatte Probleme mit der Verdauung, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Woran ich wirklich erkrankt war, wurde mir erst klar nach der Trennung von meinem ehemaligen Mann nach 23 Jahren Ehe. Um mich abzulenken, arbeitete ich wochenlang sehr viel im Büro, häufig auch am Wochenende. Während ich eine Freundin in Helgoland besuchte, um mich zu erholen und nachzudenken, wurde ich unruhig. Das Leben erschien mir sinnlos und leer, ich dümpelte nur noch kraftlos vor mich hin. Morgens wollte ich nicht aufstehen, abends konnte ich nicht einschlafen. Wozu das alles? Viele Stunden dachte ich darüber nach, mich umzubringen. Zusätzlich machte sich die Erschöpfung vom Arbeiten breit. Dann bin ich noch im Urlaub plötzlich zusammengebrochen. Bald stellten die Ärzte die Diagnose: Depression.“ Maria B., 54 Jahre „Die Leere, die sich bei der Depression einstellt, können sich Gesunde kaum vorstellen“, sagt Prof. Mathias Berger, Ärztlicher Direktor der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg. „Die Depression dagegen ist eine umfassende Erkrankung“, sagt Berger. Dementsprechend vielfältig und lang ist die Liste der Symptome: Schwere Komplikationen können sein: • Gedrückte Stimmung, Gefühl der „Gefühllosigkeit“: Viele Patienten verfallen häufig ganz plötzlich in eine depressive (lateinisch: deprimere = niederdrücken) Stimmung, ohne Auslöser oder Vorzeichen. In anderen Fällen bewirkt ein äußeres Ereignis ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, von dem sich der Betroffene nicht von alleine erholt, sondern in eine Depression abgleitet. • Antriebslosigkeit: Tagsüber sind Erkrankte abgeschlagen, selbst kleinste Aufgaben erscheinen ihnen als unüberwindbare Hürden. Die Zeit will nicht vergehen. Allerdings sind nicht alle an Depression Erkrankten immer nur gehemmt. Bei der sogenannten „agitierten Depression“ erschwert eine diffuse Unruhe jegliche gerichtete Aktivität. Betroffene beschreiben die Getriebenheit häufig als einen inneren Spannungszustand, der sich anfühlt, als würde ihr Kopf jeden Moment „platzen“. • Freudlosigkeit und Interesselosigkeit: Was früher einmal wichtig und interessant war, erscheint gleichgültig und bedeutungslos, die Betroffenen können kaum noch Freude empfinden. • Konzentrationsstörungen: Die Fähigkeit, sich gedanklich auf einzelne Themen zu fokussieren, ist gestört. • Schlafstörungen: Mehr als 90 Prozent der Erkrankten haben Schlafstörungen. Charakteristisch für Depressionen ist dabei, dass die Betroffenen am frühen Morgen aufwachen und danach nicht mehr einschlafen können. • Appetitstörungen, Gewichts- und Libidoverlust: Häufig schmeckt Depressiven das Essen nicht mehr. Manchmal muss der Betroffene sich die Nahrung regelrecht hineinzwingen. Die Folge: Gewichtsverlust. Auch das Interesse an Sexualität geht zurück. Außerdem kommt es zu einer Beeinträchtigung sexueller Funktionen: Erektions- und Ejakulationsstörungen, Schmerzen, trockene Schleimhäute, Lustund Antriebslosigkeit. • Überwertige oder wahnhafte Ideen: Bei schweren Depressionen können Patienten zu Überzeugungen gelangen, die objektiv betrachtet falsch sind. Oft haben sie mit Urängsten zu tun, etwa vor Verarmung oder davor, Schuld auf sich geladen zu haben. • Suizidgedanken: Wenn einem das Leben 15 Volkskrankheit Depression nur noch sinnlos und leer vorkommt, erscheint der Suizid oft als einziger Ausweg. Anfangs nur eine abwegige Idee, bleiben die Gedanken irgendwann an konkreten Bildern und Vorstellungen des Suizids hängen. Die Patienten beginnen damit, einen Suizid konkret vorzubereiten und letztlich auch zu versuchen. Über welchen Zeitraum sich dieser Prozess erstreckt, ist unterschiedlich: Im Einzelfall kann es sich um wenige Stunden handeln, häufig dauert es Wochen oder sogar Monate. s iehe auch: Wenn Depressionen zum Suizid führen, Seite 17 Bekannte Persönlichkeiten mit Depressionserkrankung David Foster Wallace (1962−2008), US-Schriftsteller Bevor der Autor 2008 Selbstmord beging, schrieb er über seine Depression: „Alles ist Teil des Problems, und es gibt keine Lösung. Für den Betroffenen ist es eine Ein-MannHölle.“ Vincent van Gogh (1853−1890), niederländischer Maler Seine bipolare Störung, der Wechsel seiner manischen und depressiven Episoden, lässt sich an den Farben und Stimmungen seiner Bilder ablesen. Ob die Krankheit auch der Grund war, weshalb er sich am Ohr verletzte, ist umstritten: Man geht heute vielmehr davon aus, dass vor allem der Genuss von Absinth und Halluzinationen dafür verantwortlich waren. Winston Churchill (1874−1965), britischer Politiker und Schriftsteller Der ehemalige britische Premierminister beschrieb seine Depression als „Black Dog“, schwarzer Hund. Der Biograf Lord Moran zitiert Churchill über seine Gratwanderung am Abgrund: „Ich vermied es, an der Kante des Bahngleises zu stehen. Ich stand hinter der Plattform, damit zwischen mir und dem Zug ein Abstand war. Wenn ich auf einem Schiff war, vermied ich es, über die Reling ins Wasser zu schauen. Von einer Sekunde auf die andere hätte alles verloren sein können.“ 16 Virginia Woolf (1882−1941), britische Schriftstellerin Im Alter von 13 Jahren durchlebte sie ihre erste Depression, fortan suchte sie die Krankheit immer wieder heim, im Alter von 59 Jahren konnte sie es nicht mehr ertragen: Mit einem schweren Stein im Mantel ertränkte sie sich im Fluss Ouse, ihre Leiche wurde drei Wochen später gefunden. Ihrem Mann hinterließ sie einen Abschiedsbrief, er endete mit den Sätzen: „Ich kann Dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind.“ Ernest Hemingway (1899−1961), US-amerikanischer Schriftsteller Da noch keine Medikamente verfügbar waren, versuchte Hemingway seine manisch-depressive Krankheit im Alkohol zu ertränken. Vergeblich. Im Jahre 1960 ließ er sich mehrfach in der berühmten Mayo-Klinik mit Elektrokrampftherapie behandeln, auch das ohne Erfolg. Schließlich erschoss sich Hemingway ein Jahr später mit einem Jagdgewehr. Auch Hemingways Vater, Bruder, Schwester und seine Enkelin haben ihrem Leben ein Ende gesetzt. Volkskrankheit Depression Besonders bedeutsam sind die drei erstgenannten Symptome, also gedrückte Stimmung, Antriebsstörungen und Freudlosigkeit. Sie gelten nach dem weltweit wichtigsten Diagnose-Klassifikationssystem, der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD), als Hauptsymptome für depressive Episoden. Wenn diese drei Kriterien mindestens über zwei Wochen ununterbrochen vorliegen, und wenn mindestens vier weitere Symptome vorhanden sind, spricht man nach der ICD von einer schweren Depression. So weit die Regel, doch ganz so schablonenhaft lässt sich das nur selten feststellen. Ob ein Patient tatsächlich an einer Depression erkrankt ist, das kann und sollte nur ein Arzt feststellen. Vor allem, weil die klinischen Symptome im Einzelfall völlig unterschiedlich ausfallen können. Bei manchen Fällen dominieren zunächst Verdauungsstörungen, während andere Erkrankte lange Zeit keine körperlichen Beschwerden spüren, sondern unter dem Nachlassen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit, des Gedächtnisses und ihrer Konzentration leiden. Obwohl Ärzte auf ihre Erfahrung und Richtlinien zurückgreifen, fällt die Diagnose Depression im Einzelfall schwer. Die Übergänge sind fließend, die Grenzen unscharf. 1.2 Die Gefahren der Depression „Eine Depression kommt selten allein. Viele ihrer Folgen lassen sich dabei statistisch kaum erfassen.“ Depression erhöht das Risiko für… … Alzheimer 2,0-fach … Parkinson 2,0-fach … Herz-Kreislauf-Erkrankungen 2,0-fach … Diabetes 1,4-fach Diabetes erhöht das Risiko für… … Depression 2,0-fach Quelle: Max-Planck-Institut für Psychiatrie verschiedener Krankheiten sich selten getrennt voneinander betrachten lassen“, sagt Prof. Florian Holsboer, Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Die Depression wirke in Verbindung mit anderen Erkrankungen häufig wie ein Multiplikator: Die Krankheiten begünstigen sich gegenseitig. Der Verlauf der meisten chronischen Erkrankungen verschlechtert sich, wenn die Patienten zusätzlich an einer Depression leiden. Das gilt vor allem für Herz-KreislaufErkrankungen, Asthma und Arthritis, wie Wissenschaftler um Saba Moussavi von der WHO im Jahr 2007 in der Fachzeitschrift „The Lancet“ berichtet haben. So sei Depression etwa als Risikofaktor für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems vergleichbar mit erhöhten Blutfettwerten. All diese Untersuchungen belegen, dass die Depression, abgesehen vom Suizid-Risiko, eine gefährliche Erkrankung ist. Dass die psychische Belastung nicht nur als quälend wahrgenommen wird, sondern auch fatale Folgen haben kann, zeigt aber vor allem die Zahl der Suizide, die sich nahezu immer auf diese Krankheit zurückführen lassen. Prof. Florian Holsboer, Direktor des Münchner Max-PlanckInstituts für Psychiatrie Wer unter Diabetes leidet, erkrankt doppelt so häufig an einer Depression wie ein gesunder Mensch. Umgekehrt ist das Risiko bei einem an Depression Erkrankten um das 1,4-fache erhöht, Diabetes zu bekommen. „Das Beispiel verdeutlicht, dass die Folgen 1.3 Exkurs − Wenn ­Depressionen zum Suizid führen Im Jahr 2009 hat der Fußballspieler Robert Enke (Hannover 96 und Nationalmannschaft) seinem Leben ein Ende gesetzt. Das 17 Volkskrankheit Depression Gefühl, keinen Ausweg mehr zu finden, teilte der Fußball-Nationaltorwart mit etwa 10.000 Menschen, die sich jedes Jahr laut Statistischem Bundesamt das Leben nehmen. Dabei muss gesehen werden, dass die tatsächliche Zahl noch höher ist, denn häufig werden Suizide wegen des damit verbundenen Stigmas, aber auch aus anderen Gründen vertuscht. Realistische Schätzungen gehen deshalb sogar von jährlich etwa 15.000 Suiziden aus. Das heißt, jeden Tag nehmen sich 30 bis 40 Menschen wegen ihrer Depression das Leben. Das sind dreimal mehr Menschen, als im Jahr 2009 bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen. Bei den 15- bis 35-Jährigen steht der Suizid an zweiter Stelle aller Todesursachen. Weltweit begehen laut WHO jährlich 850.000 Menschen Suizid, von denen der überwiegende Teil auf Depressionen zurückzuführen sei. Die Dunkelziffer an Selbstmorden liegt der WHO zufolge noch deutlich höher. Kürzlich ist eine Umfrage im Rahmen des europäischen Suizidpräventionsprojekts OSPI-Europe (Optimizing Suicide Prevention Programmes and their Implementation in Europe) unter 4.000 Teilnehmern aus Deutschland, Irland, Portugal und Ungarn veröffentlicht worden. Fast 24 Prozent der deutschen Teilnehmer gaben an, in ihrem engeren Umfeld einen Menschen mit Depressionen zu kennen. 8,5 Prozent von ihnen wussten von mindestens einem Selbsttötungsversuch, 5,5 Prozent sogar von einem erfolgreichen Suizid. Bis zu 15 Prozent der Patienten mit schweren, wiederkehrenden Depressionen, die unbehandelt bleiben, versterben durch Suizid. Die Zahl der Suizidversuche liegt der Studie zufolge gar um das Zehnfache höher. Fast alle Patienten mit Depression denken während ihrer Erkrankung mindestens einmal daran, sich das Leben zu nehmen, fast jeder Zweite der Erkrankten begeht einmal im Leben einen Suizidversuch. 18 1.4 Warum der Wunsch zu leben an Kraft verliert „Die genauen Ursachen für Depressionen kennen wir immer noch nicht. Aber wir haben inzwischen eine sehr gute Vorstellung von den verschiedenen Krankheitsmechanismen.“ Prof. Florian Holsboer, Direktor des Münchner Max-PlanckInstituts für Psychiatrie Bei der Forschung nach den Ursachen der Depression wurden verschiedene Wege beschritten. Ob man sich aus Sicht der Verhaltensforschung, der Genetik, der Psychologie oder der Nervenheilkunde dem Problem nähert, man wird in jedem Fall die Veränderung von Funktionsabläufen im Gehirn verstehen müssen. Neurobiologische Grundlagen Eine Billion Nervenzellen arbeiten im menschlichen Gehirn; sie kommunizieren miteinander, entfalten ihre Wirkung in Netzwerken. Sie sind über Synapsen miteinander verbunden und geben an diesen Schnittstellen ihre Nachrichten weiter. So läuft etwa eine Information am äußeren Fortsatz einer Nervenzelle (Axon) entlang bis zu ihrem Ende, wo sie in eine Synapse mündet: einen winzigen Spalt, der zwischen dem Fortsatz der einen Nervenzelle und der nächsten Nervenzelle liegt. Jede Nervenzelle bildet mit ihren etwa 10.000 Synapsen Kontakte zu anderen Nervenzellen. Diese unvorstellbar hohe Komplexität ermöglicht, unsere Gedankenwelt zu gestalten, Empfindungen zu haben und das Verhalten zu steuern. Eine Synapse verbindet zwei Zellen miteinander: Die an einer Seite eintreffende Information in Form von elektrischer Ladung bewirkt, dass Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, in den Spalt ausgeschüttet werden. Zu den Neurotransmittern zählen unter anderem Serotonin und Noradrenalin, aber auch Aminosäuren und kleine Eiweißmoleküle, die Peptide. Diese wiederum lagern sich an der anderen Zelle an Rezeptoren an. Das sind Strukturen in der Zellwand oder im Inneren der Zelle, die auf Botenstoffe zugeschnitten sind. Dieser Prozess Volkskrankheit Depression folgt dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: Jeder Rezeptor (Schloss) lässt sich nur mit einer bestimmten Art von Botenstoffen (Schlüssel) aktivieren. Lagern sich die Neurotransmitter an die Rezeptoren, setzt dies eine Kaskade von Prozessen im Zellinnern in Gang. Am Ende entsteht in der Zelle eine neue elektrische Ladung, es werden Neurotransmitter gebildet – die Information wird weitergegeben. „Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass bei einer Depression dieser NeurotransmitterStoffwechsel in speziellen Nervenzellverbänden gestört ist“, sagt Florian Holsboer. Offenbar stehen die Neurotransmitter bei der Erkrankung nicht immer in ausreichendem Verhältnis zueinander. Wie richtig die Forscher liegen, beweist die Wirksamkeit der Antidepressiva: Mit den gezielt auf die Neurotransmitter wirkenden Medikamenten lässt sich das Gleichgewicht im Gehirn offenbar ein Stück weit wieder zurückgewinnen. Neben den Neurotransmittern spielen auch andere Substanzen eine Rolle bei der Entstehung einer Depression. So ist bei Depressiven häufig die Konzentration des Stresshormons Cortisol erhöht. Deshalb gehen Wissenschaftler davon aus, dass zwischen Stress und Depressionen ein Zusammenhang besteht. Die Cortisolmenge wiederum wird von einer Reihe von Hormonen reguliert, die im zentralen Nervensystem ausgeschüttet werden. Verlaufsbeobachtungen mit bildgebenden Verfahren wie Magnetresonanztomographie (MRT) haben ergeben, dass die Veränderungen sogar die Struktur des Gehirns beeinflussen: Bei chronisch Depressiven etwa nimmt die Größe des Hippokampus ab. Der Hippokampus ist eine Region im Gehirn, die eine wesentliche Rolle bei Gedächtnisleistungen spielt. „So lässt sich auch erklären, warum Depressive vor allem dann, wenn sie nicht ausreichend behandelt werden, ein höheres Risiko aufweisen, im Alter an Demenz zu erkranken“, sagt Holsboer. Die Gene – und ihre begrenzte Macht Heute erscheinen weltweit wissenschaftliche Arbeiten, in denen beschrieben wird, welche Veränderungen in Genen womöglich die Entstehung welcher Krankheit begünstigen oder hemmen. Auch die Depression weist eine hohe Erblichkeit auf: Ein eineiiger Zwilling, dessen Geschwister eine Depression hat, muss mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit rechnen, selbst an einer Depression zu erkranken. Das ist auch bei konservativer Betrachtung fünfmal häufiger als in der Normalbevölkerung. Inzwischen hat die Forschung eine Reihe von Genen identifiziert, die womöglich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an Depression zu erkranken. Doch wie groß deren Einfluss tatsächlich ist, darüber kann man nur spekulieren: „Gene spielen bei der Entstehung von Depressionen eine wichtige Rolle, doch alleine verantwortlich für das Entstehen der Krankheit sind sie wohl nur selten. Genetische Veranlagung und äußere Einflüsse greifen ineinander“, sagt Holsboer. Psychologische Erklärungsmodelle Psychologische Erklärungsmodelle gehen davon aus, dass unsere Vergangenheit auch unsere Gegenwart bestimmt. Aufbauend auf dieser Erkenntnis suchen Psychotherapeuten in den „Tiefen des menschlichen Gehirns“, in scheinbar längst vergangenen Zeiten, nach Ursachen für Depressionen. Aktuelle Belastungen mögen zum Ausbruch der Krankheit geführt haben, Stress im Beruf etwa oder eine Trennung, häufig aber nur, weil sie den Mustern früherer Ereignisse ähneln. Denn die eigentliche Ursache der Krankheit liegt weiter zurück, glauben die Vertreter der Tiefenpsychologie. Und denken dabei vor allem an traumatisierende Situationen oder Erkenntnisse, die lange aus dem Bewusstsein verbannt wurden und jetzt unverarbeitet wieder aufbrechen. Die Depression ist dabei als eine Art Notbremse zu verstehen. Tiere beispielsweise versuchen sich zu schützen, indem sie erstarren und alle Körperfunktionen herunterfahren. So sei auch die Depression zu sehen – als eine Art Schutzmechanismus. 19 Volkskrankheit Depression Auch die Verhaltenspsychologie legt bei der Suche nach den Ursachen für Depressionen den Schwerpunkt in die Vergangenheit. Ansätze gibt es dabei viele. Das Modell der erlernten Hilflosigkeit etwa geht davon aus, dass der depressive Mensch in seinem Leben durch schlimme Erfahrungen „gelernt“ hat, dass er der Härte des Lebens im Grunde hilflos ausgeliefert ist. Diese Erkenntnis frustriert und mindert seinen Antrieb. Im kognitiven Modell hingegen wird angenommen, dass aus eigenen negativen Gedanken eine sich selbst erfüllende Prophezeiung zu werden droht. „Die Depression verstärkt sich häufig selbst“, sagt Mathias Berger. Einen ähnlichen Teufelskreis zeigt auch das Verstärkerverlustmodell: Schwierige Zeiten in der Vergangenheit haben den Glauben daran verschwinden lassen, dass man durch sein Verhalten bei anderen positive Reaktionen hervorrufen kann, vermuten die Forscher. 1.5 Depression ist nicht gleich Depression „Die Art der Depression ist entscheidend für das Vorgehen bei der Behandlung..“ Prof. Mathias Berger, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg Während sich die meisten Infektionen eindeutig nach ihren Erregern einteilen lassen, liefert die Klassifikation von Depressionen Wissenschaftlern bis heute keine Klarheit. Depressionen sind nun einmal keine Masern. In der von der WHO aufgelegten Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) werden Depressionen eingeteilt nach groben Kriterien wie Schweregrad, Verlauf oder den Bezug zu ihrem wahrscheinlichen Auslöser. Die Einteilung in endogene Depressionen und reaktive Depressionen (Anpassungsstö- 20 Einteilung von Depressionen Schweregrad • leicht • mittel • schwer Verlauf • einmalig • rezidivierend (wiederkehrend) • chronisch rungen) wird heute nicht mehr verwendet, obgleich die Idee seinerzeit durchaus nachvollziehbar war: Ein traumatisches Ereignis, etwa eine Trennung, der Tod oder Verlust eines nahestehenden Menschen, löst eine reaktive Depression aus. Die endogene Depression entsteht „plötzlich“ und kommt von innen, scheinbar unabhängig von äußeren Umständen und Ereignissen. Doch neue Untersuchungen legen nahe, dass die Komponenten, die bei der Entstehung einer Depression zusammenspielen, sowohl von innen als auch von außen gespeist werden. Es muss dabei nicht einmal ein besonderes Ereignis eintreten, häufig reichen auch schon die äußeren, belastenden Umstände aus. Zusätzlich zu Schwere, Verlauf und Auslöser der Depression lassen sich verschiedene Formen der Krankheit unterscheiden: Die depressive Episode (Major Depression) In der Fachsprache wird die typische Depression als „Major Depression“ (englisch) bezeichnet. Das durchschnittliche Alter bei der erstmaligen Erkrankung liegt bei etwa 25 Jahren. Häufig gehen dem Auftreten der Depression Belastungssituationen voraus, etwa Verlust, Mobbing, Trennungsängste. Auch chronische Krankheiten oder Alkohol- und Tablettenmissbrauch können die Entstehung einer „Major Depression“ begünstigen. Volkskrankheit Depression Die Depression ist eine phasenhaft verlaufende Erkrankung. Nach einer depressiven Episode kann der Patient viele Jahre symptomfrei leben, manchmal kommt es nie wieder zu einer Erkrankungsphase. Häufig kann es nach einer überstandenen depressiven Episode nach längerer Zeit der Beschwerdefreiheit zu einer erneuten Depression kommen. Es gibt Verläufe, in denen sich depressive Episoden nicht vollständig zurückbilden und einige Symptome, zum Beispiel Schlafstörungen oder auch Antriebs- und Konzentrationsstörungen, weiterbestehen. Diese Menschen sind besonders anfällig für Rückfälle. Am Ende der Krankheit steht nicht selten der Tod: Unbehandelt begehen etwa 15 Prozent der an einer Major Depression erkrankten Patienten im Laufe ihres Lebens Suizid. Bei Patienten mit wahnhafter Depression ist die Suizidrate noch höher. Damit die Diagnose gestellt werden kann, muss zudem zutreffen, dass die Beeinträchtigungen im sozialen oder beruflichen Bereich deutlich spürbar sind, die Symptome nicht auf andere Ursachen wie Nebenwirkungen von Medikamenten oder Schilddrüsenunterfunktion zurückzuführen sind und dass die Beschwerden nicht mit einer Trauerreaktion erklärt werden können . Bipolare Störung Wer an einer bipolaren Störung (frühere Bezeichnung: manisch-depressive Erkrankung) leidet, kennt beide Extreme, nicht nur depressive Gefühlslagen, sondern auch übersteigert heitere und erregte Zeiten: himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Dabei werden die manischen Phasen häufig vordergründig gar nicht als Leiden empfunden. Die Betroffenen sind redselig, voller Pläne und schlafen kaum. Unter der Oberfläche jedoch stellt sich häufig schnell Erschöpfung und Leiden ein. Die manischen Abschnitte sind gefährlicher, als sie zunächst scheinen: Oft verlieren die Betroffenen die Kontrolle über ihr Handeln und die Fähigkeit, die Konsequenzen noch zu überblicken. Mal gibt der Patient beim Einkaufen unkontrolliert sehr Major Depression Die von der amerikanischen Psychiatergesellschaft (APA) herausgegebene Klassifikation geht ganz pragmatisch vor. Laut ihrem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – neben ICD eines der wichtigsten Klassifikationssysteme für psychische Krankheiten – liegt eine Major Depression dann vor, wenn mindestens fünf der folgenden Symptome über eine Dauer von mindestens zwei Wochen bestehen: 1 Depressive Verstimmung an fast allen Tagen. 2 Stark vermindertes Interesse oder Freude an allen oder fast allen Aktivitäten. 3 Deutlicher Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme ohne erkennbare Ursachen wie Diät. 2 Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf an fast allen Tagen. 5 Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung. 6 Müdigkeit oder Energieverlust an fast allen Tagen. 7 Gefühle von Wertlosigkeit oder unangemessene Schuldgefühle 8 Verminderte Fähigkeit zu denken oder sich zu konzentrieren. 9 Wiederkehrende Gedanken an den Tod bis hin zu Suizidvorstellungen. viel Geld aus, bewegt sich riskant im Straßenverkehr und schätzt Risiken nicht richtig ein. Viele Patienten trinken in der Manie zu viel Alkohol und probieren Drogen aus. Nicht selten kommt es zu sozialen Verwerfungen aufgrund von distanzlosem Verhalten und 21 Volkskrankheit Depression sexuellen Ausschweifungen. In schweren Fällen ist eine Klinikeinweisung unvermeidlich, um den Patienten vor sich selbst und seinem womöglich fatalen Aktionismus zu schützen. Die bipolare Störung ist nicht streng von der klassischen Depression („Major Depression“) zu trennen. Patienten, die schon viele depressive Episoden erlebt haben und als unipolar klassifiziert wurden, können später im Leben durchaus auch eine manische Episode haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer unipolaren eine bipolare Depression wird, beträgt zeitlebens 1,25 Prozent pro Jahr. Zyklothyme Störung Zyklothyme Störungen sind Stimmungsschwankungen, die ebenfalls in beide Richtungen, also manisch und depressiv, pendeln, allerdings nicht so extrem, dass dabei von Manie oder klassischer Depression gesprochen werden könnte: Viele dieser Störungen bleiben meist unentdeckt und somit unbehandelt, die Erkrankten selbst bemerken sie meist gar nicht, häufig fallen nur Angehörigen die auffallend wechselnden Stimmungslagen auf. 22 Anpassungsstörung (Früher: Reaktive Depression) Eine Anpassungsstörung entsteht als Antwort auf ein belastendes Lebensereignis. Das können Trennungen und Verluste sein, nicht nur von Menschen, sondern auch vom Arbeitsplatz. Mancher Pensionär wird depressiv, wenn er nicht mehr täglich ins Büro gehen kann. Die Anpassungsstörung kann über einige Wochen andauern, sie kann sich aber auch länger hinziehen. Dysthymie: Chronische depressive Störung Die einzelnen Symptome sind nicht derart schwer, doch dafür halten sie lange an, für die Diagnose mindestens zwei Jahre. Volkskrankheit Depression Was noch keine Depression ist Die Depression ist eine Krankheit mit einer ganzen Reihe von Symptomen. Doch nicht alle Beschwerden sind auf eine Depression zurückzuführen. „Jeder Mensch hat auch Phasen, in denen er niedergeschlagen, traurig oder verzagt ist“, sagt Prof. Mathias Berger von der Universitätsklinik Freiburg. „Man fühlt sich unruhig, ängstlich und ohne Energie.“ Solche Gefühle und Zustände gehören zu den Stimmungsschwankungen, die auch abhängig sind von äußeren Einflüssen: etwa die zwischenmenschliche Ebene mit Partner, Freunden und Nachbarn, beruflicher und privater Stress und sogar das Wetter. Auch der Trauerprozess beim Verlust nahestehender Angehöriger wird oft mit einer Depression verwechselt, da sich die Symptome ähneln, besonders während der zweiten Phase des Trauerprozesses, der Verzweiflung, während der Trauernde mit Niedergeschlagenheit und Frustration auf den Verlust des Angehörigen reagiert. Bei Trauer ist eine solche Phase jedoch nicht krankhaft, sondern hilft, Verlust und Trennung zu bewältigen, ohne sich vom Schmerz überwältigen zu lassen. 23 Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt 2 Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt Das persönliche Leid, das Menschen, die an einer Depression leiden, aber auch ihre Familien und Freunde durchmachen, lässt sich gewiss nicht in Zahlen ausdrücken. Und so lassen sich die gesellschaftlichen Lasten, die die Depression jedes Jahr verursacht, niemals beziffern. Berechnen lässt sich allerdings in Ansätzen, was diese Krankheit die deutsche Volkswirtschaft jedes Jahr kostet, zum einen direkt durch die ambulante und stationäre Behandlung, zum anderen indirekt durch den Produktionsausfall, den sie verursacht. Weil erkrankte Arbeitskräfte durch andere Mitarbeiter ersetzt werden müssen, die wiederum erst eingearbeitet werden müssen. Weil Mitarbeiter trotz ihrer depressiven Episoden zur Arbeit gehen, dabei aber in den meisten Fällen deutlich weniger produktiv sind. Weil sich die Krankheit letztlich negativ auf die Produktionsprozesse auswirkt, Wissen und Kompetenz verloren gehen und die Wertschöpfung insgesamt sinkt. Dass diese volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Depression höchst unterschiedlich bewertet und mithin auch berechnet werden können, zeigen schon die verschiedenen Versuche, die direkt mit der Krankheit verbundenen Kosten zu ermitteln. So hat etwa das Schweizer Institut „sciencetransfer“ in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung kürzlich in einer Langzeitstudie die Kosten für die Behandlung psychischer Belastungen in Deutschland auf rund drei Milliarden Euro geschätzt. Das Karolinska-Institut in Stockholm schätzte die durch die rund 21 Millionen Erkrankten direkt verursachten Kosten in 28 europäischen Ländern für das Jahr 2006 auf rund 42 Milliarden Euro und die Gesamtkosten auf 118 Milliarden Euro. Allein für Deutschland schätzte das Institut die jährlichen direkten wie indirekten Kosten pro Patient auf 7.800 Euro; danach wür- 24 den Depressionen jeden Bundesbürger im Durchschnitt 470 Euro kosten. Schon daran lässt sich ablesen, dass die Schätzungen der verschiedenen Untersuchungen zum Teil erheblich variieren. So haben zwei Studien die Pro-Kopf-Kosten in den vergangenen Jahren näher untersucht: Im Rahmen der European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) wurde im Jahr 2005 für die direkten Kosten in Deutschland ein jährlicher Betrag von durchschnittlich 686 Euro pro Patient errechnet. Die zweite Studie „Behandlungskosten von Patienten mit Depressionsdiagnose in haus- und fachärztlicher Versorgung in Deutschland“ aus dem Jahr 2004 kam für die depressionsbezogenen Behandlungskosten auf einen Durchschnittswert von 2.542 Euro pro Kopf und Jahr. „Die Ergebnisse variieren allein schon deshalb, weil Unterschiede in der Definition der Depressionsdiagnose und auch in der Studienpopulation, also in der Bevölkerungsstichprobe, bestehen und unterschiedliche Modelle angewendet wurden, um die Kosten zu berechnen“, sagt Boris Augurzky, Leiter Kompetenzzentrum Gesundheit beim Wirtschaftsinstitut RWI. 2.1 Direkte Kosten Weil derartige Modellrechnungen mit großer Zurückhaltung betrachtet werden müssen, stützen sich die Allianz und das RWI bei der Berechnung der durch Depressionen verursachten volkswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Bereich der direkten Kosten auf die jüngste Krankheitskostenrechnung des Statistischen Bundesamtes. „Die direkten Kosten beschreiben dabei den unmittelbar mit einer medizinischen Heilbehandlung, einer Präventions-, Rehabilitations- oder Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt Pflegemaßnahme verbundenen Ressourcenverbrauch im Gesundheitswesen“, sagt Augurzky. Anhand der Krankheitskostenrechnung schätzt das Statistische Bundesamt (Destatis) seit 2002 alle zwei Jahre die ökonomischen Folgen von Krankheiten für die deutsche Volkswirtschaft. In die Berechnung fließen – neben medizinischen Heilbehandlungen – auch sämtliche Gesundheitsausgaben für Prävention, Rehabilitation und Pflege ein. Diese Kosten werden vom Statistischen Bundesamt erfasst und veröffentlicht, letztmalig im August 2010 für das Jahr 2008. Danach betrugen die Krankheitskosten durch psychische und Verhaltensstörungen insgesamt knapp 28,7 Milliarden Euro. Für etwa die Hälfte dieser Kosten waren nur zwei Diagnosen verantwortlich: 9,4 Milliarden Euro wurden für Demenzerkrankungen ausgegeben. Die Krankheitskosten für Depressionen beliefen sich im Jahr 2008 auf 5,2 Milliarden Euro. Davon verteilten sich rund 1,8 Milliarden Euro auf den ambulanten und 2,9 Milliarden Euro auf den stationären beziehungsweise teilstationären Bereich. Die alle zwei Jahre veröffentlichte Auflistung belegt, dass die durch Depressionen verursachten Krankheitskosten seit 2002 um 1,3 Milliarden Euro gestiegen sind. In nur sechs Jahren ist das ein Anstieg um ein Drittel. Zum Vergleich: Insgesamt sind die Krankheitskosten seit 2002 lediglich um 16 Prozent auf 254,3 Milliarden Euro gestiegen. 2.2 Indirekte Kosten Zur Berechnung der indirekten Kosten hat die Allianz in Zusammenarbeit mit dem RWI ein eigenes Berechnungsmodell entwickelt. Dafür kamen zwei Methoden infrage: Der Humankapitalansatz Berechnet wird dabei der vollständige Verlust an Produktivitätspotenzial infolge von Morbidität und Mortalität. Der Friktionskostenansatz Im Gegensatz zum Humankapitalansatz geht man davon aus, dass der Produktionsausfall durch eine sogenannte Friktionsperiode begrenzt wird, also durch den Zeitraum, der für die Einstellung und die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters eingeplant werden muss. Für die Berechnung des volkswirtschaftlichen Schadens, der indirekt durch Depressionen verursacht wird, geht dieser Report nach der Humankapitalmethode vor und erweitert diesen Ansatz um die Kosten der verminderten Leistungsfähigkeit depressiver Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz. Der Ansatz nach Friktionskosten ist für die Berechnung der indirekten Kosten, die durch Depressionen verursacht werden, weniger geeignet, weil man für die Friktionsdauer einen Durchschnittswert annehmen müsste. In der Praxis aber ist die Zeit, die ein Unternehmen braucht, um gleichwertigen Ersatz für einen erkrankten Mitarbeiter zu finden, von Branche zu Branche und von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz verschieden. Gerade deshalb rät die Fachliteratur, etwa Heiner Vogel vom Institut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie der Universität Würzburg in „Gesundheitsökonomie in Psychiatrie und Psychotherapie“, zur Humankapitalmethode als geeigneterem Verfahren, um die volkswirtschaftlichen Schäden von Krankheiten mit chronischem und lange andauerndem Verlauf zu berechnen. Denn es geht hier um Menschen, deren Produktivität für immer oder sehr lange verloren geht, unabhängig davon, ob sie irgendwann ersetzt werden können oder nicht. Bei Anwendung der Friktionskostenmethode würden die indirekten Kosten niedriger ausfallen als beim Ansatz nach der Humankostenmethode. Andererseits ignorieren beide Modelle den Teil der Bevölkerung, der außerhalb der Arbeitsmarktstatistik produktiv ist, etwa depressive Mütter oder Väter, die ihre Kinder erziehen, oder an Depression erkrankte Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. 25 Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt Der Mangel an zuverlässigen Daten erlaubt es nicht, diese in die Rechnung einzubeziehen, die Gesamtkosten würden sich dadurch allerdings erhöhen. 2.2.1 Durch Mortalität verursachte Kosten Im Jahr 2008 haben sich in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 9.451 Menschen das Leben genommen. Für die Zahl der Suizide ist die Klassifizierung nach ICDs X60-X84 (vorsätzliche Selbstbeschädigung) maßgeblich. 6.129 der Selbsttötungen haben Menschen unter 65 begangen. Weil das Statistische Bundesamt die Krankheitskostenrechnung nur alle zwei Jahre und die Daten für das Jahr 2010 erst im August 2012 veröffentlicht, sind für die weiteren Berechnungen auch die Suizid-Zahlen des Jahres 2008 maßgeblich. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 haben in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 9.571 Menschen Suizid begangen. Die erhebliche Dunkelziffer bei Suiziden kann in dieser Rechnung nicht berücksichtigt werden. Da die Humankapitalmethode den Produktivitätsausfall schätzt, werden die Menschen, die zum Todeszeitpunkt älter als 64 Jahre sind, bei den folgenden Berechnungen nicht berücksichtigt. Die verbleibenden Suizide werden nach Alter und Geschlecht klassifiziert. Das Statistische Bundesamt gruppiert dabei in fünf Jahresaltersgruppen. Für die Berechnungen wurde eine gleichmäßige Verteilung der Fälle innerhalb dieser Gruppen unterstellt. Zudem stützt sich dieser Report bei diesem Modell auf verschiedene Studien, die den Anteil der Suizide, die auf Depressionen zurückzuführen sind, auf 70 Prozent ermittelt hat. Entsprechend diesen Annahmen zeigt die folgende Tabelle, wie viele Suizide im Jahr 2008 in den einzelnen Altersklassen auf eine Depression zurückzuführen waren. Um den volkswirtschaftlichen Schaden bewerten zu können, ist es notwendig, aus den Erwerbseinkommen pro Person den 26 sogenannten Gegenwartswert zu berechnen. Dafür haben Allianz und RWI das Erwerbseinkommen pro Person mit den Wahrscheinlichkeiten gewichtet, dass diese in den entsprechenden Jahren erstens überlebt (Produkt der Überlebensraten) und zweitens noch erwerbstätig ist (Erwerbstätigkeitsquote). Zudem wird das Erwerbseinkommen immer auf den gegenwärtigen Zeitpunkt diskontiert, dafür kalkuliert das Modell der Einfachheit halber mit einem durchschnittlichen Diskontierungszins von fünf Prozent. Die nach Alter und Geschlecht differenzierten Erwerbstätigkeitsquoten für 2008 sind dem Mikrozensus, die Überlebensraten der Sterbetafel 2006 und 2008 entnommen. Als Erwerbseinkommen unterstellt dieser Report den durchschnittlichen jährlichen Bruttolohn aus unselbstständiger Arbeit, der im Jahr 2008 bei 34.208 Euro lag. Dabei unterstellt dieses Modell, dass ein Selbstständiger im Durchschnitt über ein äquivalentes Einkommen verfügt wie ein Angestellter. Es kann dabei angenommen werden, dass die Arbeitsproduktivität bei Selbstständigen und Unselbstständigen in etwa gleich ist, was die monetäre Bewertung mit dem Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit rechtfertigt. Aus diesen Daten errechnet sich ein Gegenwartswert der Arbeitsleistung eines 64-Jährigen von 15.711 Euro. Zum Vergleich: Bei einem 43-Jährigen zum Beispiel beträgt der Gegenwartswert der Arbeitsleistung 355.563 Euro. Um die mortalitätsbedingten indirekten Kosten ermitteln zu können, wurden die alters- und geschlechtsspezifischen Gegenwartswerte mit den jeweiligen alters- und geschlechtsspezifischen Suizidraten multipliziert. Die mortalitätsbedingten indirekten Kosten, die durch Depressionen verursacht werden, belaufen sich nach dieser Rechnung auf jährlich 1,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Jahr 2002 (1,4 Milliarden Euro) sind die durch Mortalität verursachten Kosten damit nahezu unverändert geblieben. Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt 2.2.2 Durch Erwerbsunfähigkeit verursachte Kosten Obwohl der Krankenstand in Deutschland insgesamt sinkt, ist in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Zunahme der durch Depressionen bedingten Arbeitsunfähigkeitstage zu verzeichnen. In ihren Gesundheitsberichten haben verschiedene deutsche Krankenkassen wiederholt auf die steigende Bedeutung psychischer Störungen hinsichtlich des Krankenstandes aufmerksam gemacht. Unter den sechs führenden Hauptdiagnosen beim Krankenstand variiert der Anteil der psychischen Störungen je nach Krankenkasse zwischen sechs Prozent und 13 Prozent. Die Berichte der Krankenkassen belegen zudem, dass unter den affektiven Störungen die Depressionen dominieren und deren Diagnose in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Bei den Frühverrentungen stehen laut Statistischem Bundesamt psychische Erkrankungen inzwischen an erster Stelle, gefolgt von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes sowie Krankheiten des Kreislaufsystems. Das belegen auch die jüngsten Daten der Deutschen Rentenversicherung: Insgesamt seien danach die Zahlen für Frühverrentungen rückläufig, die Rentenzugänge aufgrund psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen hätten jedoch seit Beginn der achtziger Jahre zugenommen. „Diesen Trend bestätigen auch die internen Zahlen der Allianz-Berufsunfähigkeitsversicherung“, sagt Olaf Hottinger, Leiter Risikomanagement der Allianz Lebensversicherungs-AG. Im Jahr 2008 registrierte die Deutsche Rentenversicherung 20.435 Renteneingänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge der Diagnose einer Depression nach den in Kapitel 1 beschriebenen ICD-Kriterien F31 bis F34. Auch hierfür liegen Geschlecht- und Fünf-Jahresaltersgruppen vor. Die folgende Tabelle zeigt die Renteneintritte innerhalb dieser Jahresaltersgruppen, nachdem wir in- Depressionsbedingte Renteneintritte wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 2008 nach Alter und Geschlecht Alter Renteneintritte Männer Diagnose F31-F34 Renteneintritte Frauen Diagnose F31-F34 30 41,6 93,8 31 41,6 93,8 32 41,6 93,8 33 41,6 93,8 34 41,6 93,8 35 69,2 146 36 69,2 146 37 69,2 146 38 69,2 146 39 69,2 146 40 233,4 295,8 41 233,4 295,8 42 233,4 295,8 43 233,4 295,8 44 233,4 295,8 45 285,2 460,8 46 285,2 460,8 47 285,2 460,8 48 285,2 460,8 49 285,2 460,8 50 366,6 736,2 51 366,6 736,2 52 366,6 736,2 53 366,6 736,2 54 366,6 736,2 55 467,6 854,6 56 467,6 854,6 57 467,6 854,6 58 467,6 854,6 59 467,6 854,6 60 82,8 83,8 61 82,8 83,8 62 82,8 83,8 63 82,8 83,8 64 82,8 83,8 27 Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt nerhalb dieser Gruppen einen linearen Verlauf unterstellt haben. Auch hier haben Allianz und RWI die alters- und geschlechtsspezifischen Gegenwartswerte ermittelt und mit den jeweiligen alters- und geschlechtsspezifischen Renteneintritten aus der Tabelle multipliziert. Die Gesamtsumme der erwerbsunfähigkeitsbedingten indirekten Kosten, die durch Depressionen verursacht werden, liegt nach dieser Rechnung für das Jahr 2008 bei 4,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Für das Jahr 2002 beliefen sich die Kosten nach diesem Modell auf 2,6 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von 77 Prozent. 2.2.3 Durch Arbeitsunfähigkeit verursachte Kosten Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beziffert die Zahl der gesamten Arbeitsunfähigkeitstage für das Jahr 2007 auf 456,8 Millionen, im Jahr zuvor waren es lediglich 437,7 Millionen. Zur Berechnung der gesamten depressionsbedingten Arbeitsunfähigkeitstage 2008 orientiert sich dieser Report am Fehlzeitenreport des wissenschaftlichen Instituts der AOK, der für die verschiedenen Branchen für die Arbeitsunfähigkeitsfälle die häufigsten Einzeldiagnosen angibt. So sind etwa im Baugewerbe lediglich 1,1 Prozent aller Fälle auf eine Depression zurückzuführen, bei Banken und Versicherungen sind es dem AOK-Report zufolge hingegen 3,5 Prozent. Für die Berechnung der gesamten depressionsbedingten Arbeitsunfähigkeitstage übernimmt dieser Report den Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent. Für das Jahr 2008 ergibt sich somit die Gesamtzahl depressionsbedingter Arbeitsunfähigkeitstage von 10,60 Millionen − nach 10,15 Millionen im Jahr 2007. Zum Vergleich: Das Bundesministerium für Gesundheit schätzt die pro Jahr durch depressive Erkrankungsfälle anfallenden Arbeitsunfähigkeitstage auf etwa elf Millionen. 28 Bei einer Anzahl von 225 Arbeitstagen im Jahr ergeben sich somit 47.101 arbeitsunfähigkeitsbedingte Jahre verlorener Erwerbstätigkeit für das Jahr 2008. Multipliziert mit dem durchschnittlichen Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit belaufen sich die arbeitsunfähigkeitsbedingten jährlichen Kosten auf 1,61 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Jahr 2002 (1,64 Milliarden Euro) sind die durch Arbeitsunfähigkeit verursachten Kosten damit nahezu unverändert geblieben. Für Selbstständige, die sich krankschreiben lassen, unterstellt dieses Modell im Durchschnitt ein äquivalentes Einkommen, Selbstständige, die sich nicht krankschreiben lassen, sind in dieser Rechnung allerdings noch nicht berücksichtigt, stattdessen fallen sie unter Punkt 2.1.4: durch Präsentismus verursachte Kosten, wenn sie analog zu an Depression erkrankten Angestellten dennoch ihre Arbeit wahrnehmen. 2.2.4 Durch verminderte ­Arbeitsfähigkeit depressiver Arbeitnehmer am Arbeitsplatz verursachte Kosten Nicht alle Menschen, die an einer Depression leiden, sind deshalb arbeitsunfähig, viele flüchten in Arbeit, andere wissen überhaupt nicht, dass sie krank sind. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme können die wenigsten Arbeitnehmer allerdings ihre volle Leistung erbringen. In diesem Zusammenhang spricht die Wissenschaft oft vom sogenannten Präsentismus. Um diesen messbar zu machen, orientiert sich dieser Report mangels seriöser Studien aus dem europäischen Raum auf die Annahmen von drei USamerikanischen Studien, die zwischen 2002 und 2003 erschienen sind. Danach schwankt die Anzahl der Arbeitsstunden, die ein an Depression erkrankter Mitarbeiter im Durchschnitt pro Tag weniger produktiv ist als ein gesunder Kollege, zwischen 34 Minuten (0,56 Stunden) und 108 Minuten (1,8 Stunden). Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt Für die Berechnung dieser depressionsbedingten Kostenkomponente in Deutschland haben Allianz und RWI die erwerbstätige Bevölkerung wiederum nach Alter und Geschlecht gruppiert. Nimmt man für die 22,09 Millionen erwerbstätigen Männer und die 18,32 Millionen erwerbstätigen Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren die von der WHO in der „Global Burden of Disease Study“ berechnete Punktprävalenz depressiver Erkrankungen von 1,9 beziehungsweise 3,2 Prozent an, würden täglich durchschnittlich 419.756 der erwerbstätigen Männer und 586.381 der erwerbstätigen Frauen an einer Depression leiden. Zieht man die rund 47.000 Arbeitnehmer, die täglich wegen einer Depression krankgeschrieben sind, davon ab, verbleiben insgesamt rund 959.000 Menschen, die täglich mit einer Depression belastet zur Arbeit gehen. Bei durchschnittlich 1,8 Stunden Produktivitätsverlust durch depressive Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gingen der deutschen Wirtschaft nach dieser Rechnung jedes Jahr 388 Millionen Stunden produktiver Arbeit verloren. Bei durchschnittlichen 1.433 Arbeitsstunden, die ein Arbeitnehmer jährlich leistet, lässt sich dieses Defizit auch in 271.381 Vollzeitstellen umrechnen. Bewertet mit dem durchschnittlichen jährlichen Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit − für Selbstständige, die trotz einer Depression arbeiten, unterstellt dieses Modell im Durchschnitt ein äquivalentes Einkommen − errechnet sich für das Jahr 2008 daher ein Produktivitätsverlust von 9,28 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Für das Jahr 2002 beliefen sich die Kosten nach diesem Modell auf 8,5 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von knapp zehn Prozent. Allerdings würden die durch Präsentismus verursachten Kosten entsprechend niedriger ausfallen, wenn man die Annahmen der anderen zwei Studien zugrunde legt: bei einem unterstellten Produktivitätsverlust von 0,7 Stunden pro Tag auf 3,6 Milliarden Euro und bei 0,56 Stunden pro Arbeitstag auf 2,9 Milliarden Euro. 2.3 Gesamtkosten Welche Kosten die Depression verursacht, zeigen die Zahlen, die die Allianz und das RWI für diesen Report berechnet haben. Aufgrund der unterschiedlichen Annahmen bei der Berechnung der durch Präsentismus verursachten Kosten schwanken die Gesamtkosten, die die Krankheit in Deutschland 2008 verursachte, zwischen 15,5 und 22,0 Milliarden Euro, was immerhin bis zu 0,88 Prozent unserer Wirtschaftsleistung entspricht. Verglichen mit dem Referenzjahr 2002 sind die direkten und indirekten Kosten je nach Annahme um 3,35 bzw. um 3,90 Milliarden Euro gestiegen, ein Anstieg der Gesamtkosten zwischen 21 und 27 Prozent. Gesamtkosten Depression (berechnet ­mit 1,8 Stunden Produktivitätsverlust durch Präsentismus) durch Depressionen verursachte Kosten ­ 2008 in Mrd. Euro direkte Krankheitskosten Depression 5,2 Kosten durch Mortalität 1,3 Kosten durch Erwerbsunfähigkeit 4,6 Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 1,6 Kosten durch Präsentismus 9,3 Summe durch Depressionen ­verursachte Kosten 22,0 29 Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt Gesamtkosten Depression (berechnet mit 0,7 Stunden Produktivitätsverlust durch Präsentismus) Gesamtkosten Depression (berechnet mit 0,56 Stunden Produktivitätsverlust durch Präsentismus) durch Depressionen verursachte Kosten 2008 in Mrd. Euro durch Depressionen verursachte Kosten 2008 in Mrd. Euro direkte Krankheitskosten Depression 5,2 direkte Krankheitskosten Depression 5,2 Kosten durch Mortalität 1,3 Kosten durch Mortalität 1,3 Kosten durch Erwerbsunfähigkeit 4,6 Kosten durch Erwerbsunfähigkeit 4,6 Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 1,6 Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 1,6 Kosten durch Präsentismus 3,6 Kosten durch Präsentismus 2,9 Summe durch Depressionen verursachte Kosten 16,3 2.4 Exkurs: Depression in Unternehmen 2.4.1 Präventionsstrategien Als die ersten Gastarbeiter in den Sechzigerjahren nach Deutschland kamen, waren die Fehlzeiten in Industrieunternehmen wie Siemens, VW, MTU oder Thyssen meist auf Arbeitsunfälle oder Rückenleiden zurückzuführen. Heute ist jeder Industriearbeiter in Deutschland umhüllt von einem Gesetzes- und Mitbestimmungspolster. Unfälle gibt es noch immer, aber sie gefährden die reibungslose Produktion längst nicht mehr. Die Dienstleistungsrepublik Deutschland ist hingegen zunehmend von Depressionen bedroht. Die Krankheit sorgt inzwischen für die längsten Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Das Bundesministerium für Gesundheit registriert inzwischen 300.000 depressive Erkrankungsfälle pro Jahr, die sich zu rund elf Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen summieren. Doch bei den meisten Unternehmen sind 30 Summe durch Depressionen verursachte Kosten 15,5 Früherkennung und Prävention von Depressionen noch immer ein Thema, das besser gemieden wird. Mittelständler und Großkonzerne denken nur langsam um und suchen nach Maßnahmen zum Schutz ihrer Beschäftigten. Vor allem fragen sie sich, ob die gestiegene Arbeitsbelastung der Grund für den Anstieg der Fallzahlen ist. „Natürlich begünstigen die erhöhten beruflichen und privaten Anforderungen, dass sich Depressionen manifestieren“, sagt Psychologe Jan-Michael Kersting vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. „Wer erschöpft ist, eine Auszeit braucht und danach wieder voll leistungsfähig ins Büro gehen kann, hat aber nicht unbedingt ein Burn-out, geschweige denn gleich eine Depression.“ In vielen Unternehmen, etwa bei der Deutschen Telekom, beim Energieversorger Eon oder bei der Allianz erfahren Angestellte inzwischen in Schulungen, wie sie Depressionen rechtzeitig erkennen; in Personalgesprächen werden Arbeitsbelastung und Zufriedenheit angesprochen. Der Telekommunikationskonzern hat beispielsweise für Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt seine Mitarbeiter eine Notfallhotline eingerichtet, an die sie sich jederzeit wenden können. Eon erklärt seinen Führungskräften in Rollenspielen, wie sie ihren Mitarbeitern im Ernstfall weiterhelfen können. Auch können die Mitarbeiter anonym Gutscheine beantragen, die sie bei einem Coaching-Seminar einlösen können. Und bei der Allianz werden Seminare und Angebote zum Thema Stressmanagement, die der Konzern seinen Mitarbeitern seit einiger Zeit anbietet, sehr nachgefragt. „Wir dürfen Krankheitsursachen als Arbeitgeber nicht erfassen, bekommen aber von unseren Betriebsräten die Rückmeldung, dass die Zahl der Depressionen zugenommen hat“, sagt Claudia Pfeifer, Leiterin Grundsatzfragen im Bereich Personal. Deshalb hat die Allianz kürzlich an zwei ausgewählten Standorten begonnen, wissenschaftlich zu analysieren, wie gefährdet ihre Mitarbeiter sind. In einem umfangreichen Fragebogen fragt der Konzern seine Mitarbeiter anonym nach deren Arbeits- und Lebenszufriedenheit, nach möglichen Rollenkonflikten und der Qualität der Vorgesetzten. „Wir wollen nicht einfach nur Yoga anbieten, sondern überprüfen, welche bestehenden Maßnahmen genutzt werden und welche Angebote wir zusätzlich entwickeln können, um ein mögliches Gesundheitsrisiko einzudämmen“, sagt Pfeifer. Um wieder gesundete Mitarbeiter besser in den Arbeitsalltag zu integrieren, schreibt seit April eine Konzernvereinbarung einen einheitlichen Prozess zur betrieblichen Wiedereingliederung vor. Dafür gibt es an jedem Standort Ansprechpartner, die gemeinsam mit dem betroffenen Mitarbeiter einen Integrationsplan erstellen und ihn während dieser Phase beraten. „Das klare Ziel ist dabei, Mitarbeitern nach langer Krankheit einen sanften Wiedereinstieg zu ermöglichen“, sagt Pfeifer. Unterstützung durch den Arbeitgeber bewirkt deutlich weniger Fehlzeiten, haben das Schweizer Institut „sciencetransfer“ und die Bertelsmann-Stiftung in einer Langzeitstudie herausgefunden. Dirk Hanebuth weiß, wie sinnvoll solche Investitionen sind. Er ist nicht nur Arbeitsund Organisationspsychologe, er leitet auch „sciencetransfer“ in Zürich. Zusammen mit seinem Geschäftspartner hat er ein OnlineWerkzeug zur Gesundheitsüberprüfung entwickelt. Mithilfe eines Fragebogens könnten Führungskräfte und Angestellte binnen einer knappen halben Stunde wissen, ob sie gefährdet sind. Das gelingt durch die präzise Antwort etwa auf die Fragen: „Wie gut können Sie sich während eines typischen Arbeitstages bei Bedarf erholen?“, oder: „Wie groß ist die Unterstützung von Kollegen?“. Eigentlich unverfängliche Fragen, doch über 50 davon ergeben ein ziemlich genaues Psychogramm der Belastung. Dennoch glaubt Hanebuth, dass das Thema Depression und Burn-out zu behutsam verkauft wird: „Unternehmen funktionieren über Zahlen. Effekte einer Gesundheitsberatung müssen sich möglichst noch im gleichen Quartal in Ergebnissen niederschlagen. Erst wenn ein Manager diese kurzfristige Denkweise ablegt, wird es möglich, das Tabuthema in den Griff zu bekommen“, sagt Hanebuth. Die großen Unternehmen scheinen das Problem inzwischen also erkannt zu haben. Schwieriger ist es bei kleinen und mittleren Betrieben, sagt Ruth Stock-Homburg, Prof.in für Marketing und Personalmanagement an der Technischen Universität Darmstadt. „Dort ist oft gar keiner zuständig für Gesundheitsmanagement.“ Für eine gezielte Prävention und eine menschenwürdige Wiedereingliederung braucht es ein Management, das vorlebt, sich mit dem Thema Depression auch tatsächlich beschäftigen zu wollen und es nicht länger zu stigmatisieren, zumal die Unternehmen selbst davon profitieren: Eine intensivere 31 Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt Burn-out Syndrom Dieser moderne Begriff stammt aus der Arbeitspsychologie und beschreibt die Situation von Menschen, die sich im Beruf völlig verausgaben, aber keinen angemessenen Respekt und Anerkennung erhalten. Bei anhaltender Überforderung und mangelnder Belohnung durch den Arbeitgeber oder die Kollegen entstehen Rückzugstendenzen, Verbitterung und Zynismus. Aus dieser Konstellation heraus entwickeln sich häufig Depressionen. Das Burn-out-Syndrom ist keine eigenständige Erkrankung, sondern eine spezifische Entwicklung, die zur Depression führen kann. Häufig sind Pflegekräfte, Lehrer und Ärzte betroffen. Aber auch Persönlichkeiten in Spitzenpositionen können auf diesem Wege an einer Depression erkranken. Vor allem, wenn sie sich immer neue und immer schwerer zu erreichende Ziele setzen, an denen sie letztendlich scheitern. Die Konsequenz, meist eine Depression, muss auch dann, wenn sie aus einem Burn-outSyndrom erwachsen ist, mit Psychotherapie und Antidepressiva behandelt werden. Heute besteht die Tendenz, eine Depression mit Burn-out-Syndrom zu bezeichnen, nicht zuletzt, weil dies als weniger stigmatisierend empfunden wird. 32 2.4.2 „Betriebliche Prävention wird immer wichtiger“ Interview mit Gesundheitsberater Dr. Sebastian Krolop, geschäftsführender Gesellschafter der ADMED GmbH. Herr Krolop, eine Umfrage im Rahmen des europäischen Suizidpräventionsprojekts OSPIEurope kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass in Deutschland jeder achte Befragte im Lauf seines Lebens an einer Depression erkrankt war. Andere Studien sprechen von jedem Zehnten. Fast alle wissenschaftlichen Erhebungen registrieren einen dramatischen Anstieg in den vergangenen Jahren. Wie erklären Sie sich das? Depressionen gibt es seit Menschengedenken. Sie werden aber häufig nicht als solche erkannt oder als solche therapiert. Auch die Schwere der Erkrankung wird oft unterschätzt. Erst mit den klinisch-diagnostischen Leitlinien der WHO von 1990, der „Internationalen Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10“, ist eine einheitliche und verbindliche Diagnosestellung möglich. Im Verlauf der Jahre haben sich die diagnostischen Kriterien vielfach verändert und orientieren sich heute an rein deskriptiven Merkmalen des Querschnittbefundes und des Krankheitsverlaufs. Zusammen mit der Antistigmakampagne der Psychiatrie seit 1985 und dem Fortschritt im Bereich der Psychopharmaka sind Depressionen mehr in das öffentliche Bewusstsein gerückt, vor allem aber durch das Bekanntwerden von Schicksalen depressiver Prominenter. Sicher haben aber auch psychosoziale Belastungsfaktoren in unserer Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung, aber wann sich eine Person psychisch krank fühlt und professionelle Hilfe sucht, unterliegt dem subjektiven Empfinden. Deshalb Wie die Krankheit unsere Volkswirtschaft schwächt werden wir wohl nie klären können, ob Depressionen tatsächlich zunehmen − oder wir diese heute nur anders wahrnehmen. Was bedeutet das für das betriebliche Gesundheitsmanagement von Unternehmen? In allen Unternehmen sollte der psychischen Gesundheit der Mitarbeiter eine höhere Bedeutung zukommen. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird Personal künftig nicht mehr so einfach zu ersetzen sein. Deshalb dürfte das betriebliche Gesundheitsmanagement einen zunehmenden Stellenwert erhalten. Eine Beschränkung auf die körperliche Gesundheit macht in Anbetracht der genannten Zahlen keinen Sinn, so hat die WHO ausdrücklich in der Helsinki-Deklaration 2005 die psychische Gesundheit als untrennbares Element allgemeiner Gesundheit deklariert. Wie bewerten Sie die Präventions- und Wiedereingliederungsstrategien der deutschen Konzerne und Mittelständler? Es gibt keine empirischen Hinweise über die Qualität des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Großbetriebe und Konzerne nehmen hier sicher eine Vorreiterrolle ein, da sie über die nötigen Ressourcen für die Implementierung verfügen. Laut Studien betreibt nur jeder dritte mittelständische Betrieb betriebliches Gesundheitsmanagement. Welche Berufsbilder sind am meisten gefährdet? Wenn man davon absieht, dass Arbeitslose die Gruppe darstellen, die am häufigsten psychisch erkrankt ist, sind die Berufe im Dienstleistungssektor am meisten gefährdet. Eine direkte Zuordnung von einzelnen Berufen ist schwierig, da den Kassen übergreifende Auswertungen fehlen. Telefonisten, Krankenpflegerinnen und Angestellte in Zeitarbeitsfirmen sind insgesamt aber überdurchschnittlich betroffen, am geringsten Berufe im Bauwesen und der Forst- und Landwirtschaft. vertrauensvoller Kontakt zu den Mitarbeitern. Wenn geschulte Vorgesetzte um belastende Ereignisse und Stressfaktoren ihrer Mitarbeiter wissen oder über das Befinden offen sprechen können, kann ein eventuelles Risiko frühzeitig erkannt werden. Auch die Arbeitsintensität ist ein Indikator. Durch gezielte Mitarbeiterbefragungen oder mittels anonymisierter Berichte der Krankenkassen über die im Betrieb vorherrschenden Krankheiten können ebenfalls Rückschlüsse auf das Gefährdungspotenzial gezogen werden. Schrecken die meisten Unternehmen vor entsprechenden Analysen zurück, weil sie Angst haben, dass die Quote überraschend hoch ist? In der Tat haben die meisten Unternehmen vor solchen Analysen Angst. Zudem sind solche Projekte auf den ersten Blick unattraktiv: Sie sind zeitintensiv, erfordern Know-how, verursachen Kosten und könnten bei den Mitarbeitern zu falschen Signalen führen, wie die Sorge etwa, abgestempelt zu werden oder den Arbeitsplatz zu verlieren. Wie in der Finanzkrise das Instrument der „Kurzarbeit“ wird aber in Zukunft die „betriebliche Prävention“ eine maßgebliche Rolle bei der erfolgreichen strategischen Positionierung von Unternehmen spielen. Herr Dr. Krolop, wir danken Ihnen für das Gespräch. Dr. med. Sebastian Krolop, M. Sc., ist geschäftsführender Gesellschafter der ADMED GmbH und hat einen Lehrauftrag „Gesundheitsökonomie“ an der Hochschule Fresenius. Zuvor war er als Arzt an der Universitätsklinik Heidelberg und Berater bei der Boston Consulting Group tätig. Er studierte Medizin und Ökonomie in Deutschland und den USA. Wie kann ein Unternehmen überhaupt identifizieren, ob seine Mitarbeiter gefährdet sind? Das sicherste Instrument ist ein guter und 33 Therapie 3 Therapie Die Ursache erkennen – und heilen, gerade in der Depressionstherapie geht dieser Wunsch leider nur bedingt in Erfüllung. Bis heute sind die Ursachen dieser Krankheit nicht vollständig geklärt. Trotzdem können Ärzte ihre Patienten mit guter Erfolgsaussicht behandeln, denn die klinische Wirkung der Antidepressiva ist wissenschaftlich gesichert, auch wenn ihr genauer Wirkmechanismus, dem die klinischen Effekte zugrunde liegen, bisher nicht bekannt ist. Dieses Phänomen ist jedoch in der Medizin weitverbreitet. Seit jeher wendet man Substanzen an, deren klinischer Nutzen seit Langem bekannt ist, deren Wirkmechanismus dagegen erst viel später geklärt wurde. Wichtig bei der Depression ist eine umfassende Herangehensweise, denn bei der Krankheit bewirken biologische Vorgänge in unserem Gehirn Veränderungen in Befinden und Verhalten: Die Depression drückt sich aus in psychischen Problemen, denen biologische Mechanismen zugrunde liegen. Das zeigen die jüngsten Forschungsergebnisse. Neben psychischen Symptomen finden sich bei der Depression auch viele Veränderungen in biochemischen Laboruntersuchungen. Eine gute Behandlung dieser Krankheit bedient sich sowohl der Erkenntnisse der Pharmakotherapie als auch der Psychotherapie. Welche Methode am besten wirkt oder ob besser eine Kombination aus beiden Therapien sinnvoll ist, das ist von Fall zu Fall verschieden. Psychotherapie ist bei leichten Depressionen häufig gut wirksam, der gewünschte Effekt lässt jedoch mitunter lange auf sich warten. Wiegen die Symptome besonders schwer, setzen Ärzte meist von Anfang an auch Medikamente ein. Tritt eine Depression im Wechsel mit manischen Phasen auf, kommen auch andere Medikamente wie zum Beispiel Neuroleptika 34 oder sogenannte „Mood Stabilizer“ zum Einsatz. Die Schlafentzugsbehandlung, oft auch Wachtherapie genannt, kann manchmal gute vorübergehende Erfolge erzielen. Die Elektrokrampftherapie wird vor allem dann angewendet, wenn der Patient auf keine der anderen Behandlungen anspricht. Die derzeit an einigen Forschungszentren erprobte Tiefenhirnstimulation mit Elektroden, die an definierte Hirnareale vordringen, kann in Zukunft eine Behandlungsmöglichkeit werden, die bei schwersten Depressionen angewendet wird, wenn alle anderen Behandlungsversuche keinen Erfolg brachten. In diesem Kapitel sprechen renommierte Wissenschaftler über ihre Erfahrungen bei der Behandlung depressiver Patienten und gewähren einen Einblick in ihre aktuellen Forschungsergebnisse. Zunächst geben wir allerdings einen Überblick über die erfolgreichsten Behandlungsmethoden. 3.1 Pharmakotherapie 3.1.1 Antidepressiva Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) Alles deutet darauf hin: Der Mangel des Botenstoffes Serotonin im Spalt zwischen zwei Nervenzellverbindungen kann Depressionen verursachen. Und Selektive SerotoninWiederaufnahmehemmer (SSRI) verhindern, dass Serotonin nach Verlassen der Nervenzelle auf dem Weg zum Wirkort wieder in die Zelle, aus er es kommt, zurücktransportiert wird. Auf diese Weise wird die Wirkung von Serotonin verstärkt. Therapie Vor mehr als 20 Jahren kamen die ersten SSRI auf den Markt, trotzdem sind sie im Vergleich zu den trizyklischen Antidepressiva die „Jungen“ unter den Antidepressiva. Mehr als 150 Studien haben inzwischen belegt, dass SSRI nicht nur bei leichten, sondern auch bei schweren Depressionen gut wirken. Heute sind SSRI für die meisten Ärzte die erste Wahl bei der Behandlung von Depressionen. Sie verschreiben sie vor allem deshalb häufig, weil sie wenige Nebenwirkungen haben. Trizyklische Antidepressiva Mit Imipramin hat 1957 alles angefangen. Seitdem ist der Wirkstoff, der zur Gruppe der trizyklischen Antidepressiva gehört, ein wichtiger Bestandteil der Depressionstherapie. Trizyklische Antidepressiva wirken im Gegensatz zu SSRI gleich auf mehrere Botenstoffe im Gehirn, darunter auch Serotonin und Noradrenalin. Die Bandbreite der Therapie ist deshalb größer, allerdings wegen fehlender Selektivität auch das Ausmaß der Nebenwirkungen. Patienten klagen häufig über Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Übelkeit, Blutdruckabsenkung, Sehprobleme oder Müdigkeit, was Patienten mit Schlafstörungen allerdings als angenehm empfinden. Die Wirkung trizyklischer Antidepressiva gegen Depressionen ist hinreichend belegt. Wenn Patienten nicht auf SSRI allein ansprechen, wenden Ärzte Kombinationstherapien aus verschiedenen Antidepressiva und Neuroleptika an oder greifen auf bewährte Wirkstoffe wie Imipramin zurück. MAO-Hemmer MAO-Hemmer blockieren das Enzym Monoaminoxidase (MAO), das für den Abbau von Botenstoffen im Gehirn verantwortlich ist. Dadurch steigt deren Konzentration an. Allerdings vertragen sich MAO-Hemmer in der Regel nicht mit anderen Antidepressiva. Zudem müssen Patienten bei der Einnahme der meisten dieser Medikamente strenge Diätvorschriften beachten, zum Beispiel dürfen sie keinen Käse essen und keinen Burgunderrotwein trinken. Selektive Wirkung an mehreren Systemen Eine wichtige Weiterentwicklung sind Antidepressiva, die auf mehrere Neurotransmitter zugleich einwirken, von denen man sich günstige Effekte erhofft. Diese Neuentwicklungen mindern häufige Nebenwirkungen. So gibt es Antidepressiva, die nur die Wiederaufnahme sowohl von Serotonin als auch von Noradrenalin hemmen, andere wirken selektiv auf Noradrenalin und Dopamin. Auch Medikamente, die eine kombinierte Wirkung an den Neurotransmittersystemen Serotonin und Noradrenalin sowie solchen Rezeptoren im Gehirn haben, deren Aktivierung den Schlaf fördert, stehen als neue Therapieoptionen zur Verfügung. Gerade bei schweren Fällen werden heute fast immer verschiedene Antidepressiva kombiniert. Durch geeignete Kombination von selektiven Noradrenalin- und Serotonin-Wiederaufnahmehemmern lassen sich individuell angepasste Therapieformen gestalten. Auch moderne Neuroleptika werden zunehmend bei antidepressiven Kombinationsbehandlungen verwendet. Die Anwendung mehrerer Antidepressiva in Kombination mit Neuroleptika und auch mit aktivitätssteigernden stimulierenden Substanzen ist gerade bei chronischen Depressionen notwendig. Bei leichten Depressionen Johanniskraut Die Pflanze wirkt tatsächlich gegen Depressionen, allerdings nur gegen leichte und allenfalls mittelschwere Formen. Verantwortlich dafür ist eine Reihe von Bestandteilen, die wiederum an vielen verschiedenen Angriffs- 35 Therapie orten im Nervensystem ansetzen. Dazu zählen auch diejenigen, an denen synthetische Antidepressiva wirken. Auch JohanniskrautPräparate haben deshalb zahlreiche Nebenwirkungen, die teilweise denen der Antidepressiva ähneln. Einen therapeutischen Vorteil gegenüber den synthetischen Antidepressiva bieten sie daher nicht. aber auch als Phasenprophylaxe bei unipolarer und bipolarer Depression eingesetzt werden. Manchmal werden diese Mood Stabilizer auch als Monotherapie während einer depressiven Episode bei Patienten verwendet, bei denen in der Vergangenheit ein Umschwenken aus der Depression in die Manie unter Antidepressiva beobachtet wurde. 3.1.2Neuroleptika, Lithium und Mood Stabilizer 3.2 Psychotherapie Neuroleptika, auch Antipsychotika genannt, werden eigentlich bei der Behandlung von Psychosen, etwa der Schizophrenie, eingesetzt. Sie haben in den vergangenen Jahren eine Indiaktionsausweitung auf manische Episoden erfahren. Neuroleptika werden auch gelegentlich zur Phasenprophylaxe verwendet. Lithiumsalze sind Mittel der Wahl zur Behandlung manischer Episoden und zur Phasenprophylaxe der bipolaren Störung. Wegen ihrer zum Teil erheblichen Nebenwirkungen und dem Risiko einer Intoxikation bei Überdosierung werden diese Medikamente heute seltener gegeben. In Fällen, in denen depressive und manische Phasen sehr häufig aufeinanderfolgend auftreten, sind Lithiumsalze jedoch nach wie vor angezeigt. Die Behandlung depressiver Phasen im Rahmen einer manisch-depressiven Erkrankung erfolgt in Deutschland und anderen europäischen Ländern zumeist mit Antidepressiva. In den Vereinigten Staaten hat sich dagegen die Ansicht durchgesetzt, man riskiere dadurch ein Umschwenken der Depression in die Manie, und favorisiert daher die Gabe von modernen Antipsychotika/ Neuroleptika. Grundsätzlich empfiehlt sich jedoch die Gabe eines sogenannten Stimmungsstabilisators, um das Umschwenken in die Manie zu verhindern. Das sind Substanzen, die ursprünglich als Medikamente gegen Krampfanfälle (Epilepsie) entwickelt wurden, heute 36 Im Bereich der Psychotherapie gelten heute die Kognitive Verhaltenstherapie, die psychoanalytische Psychotherapie und die Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie als anerkannte und etablierte Verfahren. Die beiden zuletzt genannten Methoden gehören zu den psychoanalytisch begründeten Verfahren. 3.2.1 Verhaltenstherapie Mit Erkenntnis und Lernen das eigene Denken so umstrukturieren, dass der Patient seine Probleme selber lösen kann – das ist die Grundidee der Kognitiven Verhaltenstherapie. In Sitzungen setzt sich der Patient mithilfe des Psychiaters oder des Psychotherapeuten mit seinem konkreten Problem auseinander. Dabei bringt ihn der Therapeut mit Fragen dazu, „seine“ Realität infrage zu stellen und so die eigenen Einstellungen und Wahrnehmungen zu korrigieren. So lernt der Patient, sich selbst mit rationaler Distanz zu betrachten. Bei dieser Therapieform geht es darum, seine zentralen Probleme zu erkennen, sie zu benennen und letztlich zu akzeptieren. Automatische und dysfunktionale Gedanken sowie negative Verhaltensmuster werden dem Patienten aufgezeigt und durch die Therapie gedanklich „verändert“. Zudem werden Alltagskompetenzen und positive Ressourcen gefördert, eine Tagesstruktur mit sich verstärkenden positiven Erfahrungen Therapie wird aufgebaut. Der Patient begreift im Idealfall, warum und wie die Krankheit seinen Alltag beeinträchtigt, und welchen Weg er wählen muss, um wieder aktiver sein zu können. „Die Kombination aus Kognitiver Verhaltenstherapie und Pharmakotherapie gilt heute als eine der besten Behandlungsoptionen von Depressionen“, sagt Prof. Mathias Berger, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg. siehe Seite 38 3.2.2 Psychoanalytisch begründete Verfahren Die psychoanalytische Psychotherapie basiert auf der Vorstellung, dass frühkindliche Konflikte im Unterbewusstsein überdauern und zu Störungen führen. Diese ungelösten Konflikte werden als Ursache der Erkrankung angenommen. Diese dem Patienten bewusst zu machen, ist Aufgabe dieser Therapieform. Die psychoanalytische Psychotherapie gehört zu den „aufdeckenden“ Therapien, weil sie unbewusste Zusammenhänge oder „verdrängte“ Situationen als Grund für eine anhaltende Störung in einen Gesamtzusammenhang bringt. Ausgehend von dieser Grundannahme haben sich verschiedene Therapieverfahren entwickelt. Bei der klassischen Psychoanalyse liegt der Erkrankte in vielen Sitzungen auf der Couch und erzählt dem Psychotherapeuten von und aus seinem Leben. Der hört zu, führt seinen Patienten durch behutsames Nachfragen zum Kern des Problems und versucht, es ihm bewusst zu machen. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist etwas kürzer. Aber auch dabei geht es um die Aufdeckung, Bearbeitung und Bewältigung bisher unbewusster Konflikte, die im Zusammenhang mit der Symptomatik des Patienten stehen. 3.2.3 Weitere Maßnahmen zur seelischen Balance, zum Wohlbefinden und für das Gleichgewicht Elektrokrampftherapie „Elektroschockbehandlung“ – als solche ist die Elektrokrampftherapie (EKT) im Volksmund bekannt und hat ein entsprechend schlechtes Image. Tatsächlich wird dabei Strom eingesetzt, unter Vollnarkose wird ein Krampfanfall ausgelöst. Durch den elektrischen Impuls kommt es zu einer Entladung, dabei werden sämtliche Neurotransmitter aktiviert. Die Methode wird vor allem dann eingesetzt, wenn alle anderen Therapieansätze wirkungslos geblieben sind. Eine gewisse Analogie mit der EKT-Behandlung hat die Tiefenhirnstimulation. Dabei wird ein Hirnareal mit einer Elektrode gereizt, wodurch es einer großen Zahl schwer depressiver Patienten, die auf keine der anderen Therapien ansprachen, lange Zeit wesentlich besser geht. Diese Methode befindet sich allerdings noch in einem wissenschaftlichen Erprobungsstadium. Schlafentzugstherapie Depressive beklagen häufig Müdigkeit und Abgeschlagenheit, gleichzeitig können sie nicht ein- und durchschlafen. Fast immer wachen sie früh auf und schlafen nicht mehr ein. Morgens wird die depressive Stimmung als besonders quälend erlebt. Bei Schlafentzug jedoch, so hat sich gezeigt, hellt sich die Stimmung auf. Deshalb bieten viele Kliniken die sogenannte Schlafentzugstherapie als zusätzliche Therapieoption an. Dabei wird zwischen einer partiellen Therapie, bei der die Patienten in der zweiten Nachthälfte wach gehalten werden, und dem vollständigen Schlafentzug unterschieden. Damit es dem Patienten leicht fällt, wach zu bleiben, findet die Therapie häufig in Gruppen statt: Nachts beschäftigen sich die Patienten etwa mit Gesellschaftsspielen oder Spaziergängen. 37 Therapie Körperliche Bewegung Sportliche Betätigung hellt die Stimmung auf, man fühlt sich besser, ist zufrieden. Aber hilft Sport auch bei Depression? Hier muss man unterscheiden: Bei leichten depressiven Verstimmungen ist Sport sicher gut, der Kreislauf wird angeregt, es fließt mehr Blut durch das Gehirn und „Endorphine“, gemeinhin als Glückshormone bekannt, werden vermehrt ausgeschüttet. Einige Studien belegen sogar, dass körperliche Anstrengung durch Sport depressionsmildernd ist. Man darf aber nicht übersehen, dass Menschen mit schweren Depressionen zumeist gar nicht in der Lage sind, sich „aufzuraffen“ und Sport zu treiben. Im Gegenteil, Aufforderungen zu solchen Tätigkeiten können bei Schwerkranken eher dazu führen, dass sie sich nicht ernst genommen und unverstanden fühlen. Sie ziehen sich dann immer mehr zurück und nehmen noch weniger am Geschehen um sie herum teil. Auch Sportler erkranken genauso häufig an einer Depression wie andere Menschen, Sport ist also kein Mittel gegen Depression. Allerdings sollte zu einem geeigneten Zeitpunkt Bewegungstherapie bis hin zu leichten sportlichen Übungen in den Behandlungsplan integriert werden – aber eben nur dann, wenn der Patient dies nicht ablehnt. 3.3 Die optimale Therapie Interview mit Prof. Mathias Berger, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg, über den richtigen Therapieansatz und gezielte Methoden, die die Behandlung der Patienten künftig weiter verbessern „Schlagkräftige Waffe gegen Depression“ Herr Professor Berger, in der ambulanten und stationären Behandlung depressiver Patienten können Ärzte zwischen unzähligen Therapieansätzen wählen, viele scheinen sich nur mit ,,Trial and error" zu helfen zu wissen. Berger: Über die optimale Therapie herrscht mehr Konsens, als es manchmal in der Presse dargestellt wird. In Deutschland existieren inzwischen verbindliche nationale Versorgungsleitlinien, nach denen sich Ärzte und Psychologen zunehmend richten. Am Anfang steht bei leichteren Depressionen das sogenannte „Watchful Waiting“: Der Patient wird über Depressionen und ihre Charakteristika beraten, ohne dass sofort eine spezifische Therapie begonnen wird. Stattdessen verfolgt man zunächst den Verlauf der Stimmungsverschlechterung. Nicht selten entwickeln sich die Dinge nach einer vorübergehenden Entlastung des Patienten von selbst zum Positiven. So verzögert sich allerdings die Behandlung. Nein, „Watchful Waiting“ ist nur für einen Zeitraum von 14 Tagen vorgesehen. In dieser Zeit wird der Patient engmaschig kontrolliert, um eine weitere Verschlechterung oder gar auftretende Suizidgedanken auf keinen Fall zu übersehen. Erst wenn nach zwei Wochen keine Besserung der Symptome auftritt, wird eine gezielte längerfristige Behandlung emp- 38 Therapie fohlen, die dann in der Regel insgesamt ein halbes Jahr umspannen sollte. Wie sollte eine vernünftige Therapie danach ablaufen? Das kommt auf die Schwere der Erkrankung an. Eine leichte Depression versucht man zunächst mit einer sogenannten KurzzeitPsychotherapie zu behandeln. Zweite Wahl bei leichteren Erkrankungsformen sind Medikamente. Sie werden erst eingesetzt, wenn Psychotherapie nicht weiterhilft oder die Patienten eine pharmakologische Behandlung bevorzugen. Dabei treten allerdings häufig Nebenwirkungen wie Übelkeit, Verdauungsbeschwerden oder Mundtrockenheit auf. Seltener sind Schwindel und Kopfschmerzen, oft hingegen kommt es zu sexuellen Funktionsstörungen – das will man dem Patienten natürlich irgendwie ersparen. Immer gilt das Prinzip der partizipativen Entscheidungsfindung, die Ärzte stimmen ihre Therapie mit den Erkrankten ab: Manche Patienten haben schon gute oder schlechte Vorerfahrungen mit einer bestimmten Methode gesammelt, was natürlich berücksichtigt wird. Das kann auch mit Alter und Geschlecht zusammenhängen: Ältere Männer etwa nehmen erfahrungsgemäß lieber Antidepressiva, während jüngere Frauen den Arzneimitteln eher skeptisch gegenüberstehen. Wer ausdrücklich mit Medikamenten behandelt werden möchte, bekommt sie normalerweise auch. Bei schweren Depressionen auch von Anfang an? Ja, aber nach Möglichkeit immer zusammen mit einer Psychotherapie. Bei ausgeprägten Symptomen ist eine Kombination aus Pharmakotherapie und Psychotherapie eine schlagkräftige Waffe. Beide Behandlungsmethoden ergänzen sich: Die Behandlung mit Medikamenten wirkt schnell, aber nicht nachhaltig; ein Effekt der Psychotherapie dagegen stellt sich erst nach längerer Zeit ein, dafür bleibt der Patient häufig dauerhaft stabil. So zeigt die Pharmakotherapie bereits nach zwei bis drei Wochen erste Erfolge, doch der Schutz fällt mit Absetzen der Medikamente weg. Deshalb ist es auch ein Kunstfehler, die Antidepressiva abzusetzen, sobald der Patient beschwerdefrei ist. Das kann schnell zu Rückfällen führen. Daher ist die sogenannte Erhaltungstherapie wichtig: Die Medikamente sollten nach dem Ausklingen der Depression etwa ein halbes Jahr lang weiter genommen und dann vorsichtig abgesetzt werden. Zu welchen Medikamenten raten Sie Ihren Patienten? In der ambulanten Therapie zu Wirkstoffen aus der Gruppe der sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Sie verhindern, dass der Botenstoff Serotonin aus den Synapsen des Gehirns verschwindet, und verlängern und verstärken so seine Wirkung. Dem zugrunde liegt die Hypothese, dass bei Depressiven der Serotonin-Haushalt gestört ist. Bei etwa zwei Dritteln der Patienten schlägt die Therapie mit SSRI nach drei bis sechs Wochen an. Und wie hoch ist die Ansprechrate bei der Psychotherapie? In etwa ebenso hoch. Deutliche Erfolge zeigen sich häufig zwar erst nach acht bis zwölf Wochen, doch die überdauern meist das Behandlungsende. Der Patient lernt, seine Erkrankung zu verstehen, mit ihr umzugehen und sich selbstständig mit ihr auseinanderzusetzen. Im besten Fall kann er sich künftig gewissermaßen selbst behandeln, wenn Symptome erneut auftauchen. Dennoch sollte auch die Psychotherapie einige Monate nach Abklingen der Depression als Erhaltungstherapie fortgeführt werden, häufig entfaltet sie erst nach Jahren ihre nachhaltige Wirkung. Welche Art von Psychotherapie verspricht am ehesten Erfolg? Mit Abstand am besten untersucht ist die Kognitive Verhaltenstherapie. Mehr als 150 Studien belegen ihre Wirksamkeit. Inwieweit allerdings bei langen analytisch begründeten Verfahren der Erfolg tatsächlich mit den angewandten psychotherapeutischen Methoden erreicht wurde, ist nicht immer leicht nachzuweisen. 39 Therapie Das müsste sich doch aber mit Fall-Kontroll-Studien messen lassen, also mit einer Gruppe von Patienten, die behandelt wird, im Vergleich zu einer Gruppe, die nicht therapiert wird. Depressionen sind selbstlimitierende Erkrankungen: Sie klingen, wenn nicht zu starke äußere Belastungen vorliegen, nach ein paar Monaten von selbst wieder ab. Bei langen Formen der Psychotherapien wie bei einer ein- bis zweijährigen Psychoanalyse überschneidet sich aber das spontane Abklingen der Erkrankung mit der Therapiedauer. Daher orientiert man sich bei der Beurteilung einer Behandlungsmethode zunehmend an der Frage, wie gut sie auf Dauer vor Wiedererkrankungen schützt. Bei diesen aufwendigeren Studien kann neben der Kognitiven Verhaltenstherapie vor allem die interpersonelle Psychotherapie deutlich weniger Rückfälle aufweisen. In der interpersonellen Psychotherapie wird nach Ursachen gesucht, die einen Bezug zu anderen Menschen haben… … ja, das können Konflikte in der Familie sein, ein Rollenwechsel wie Pensionierung oder ein Trauerfall. Dass Depressionen häufig interpersonelle Ursachen haben, gilt als sicher, und die Therapie erzielt gute Ergebnisse. Allerdings ist sie in Deutschland bislang ambulant nicht zugelassen. Derzeit läuft ein Antragsverfahren, diese als Kassenleistung offiziell zuzulassen. Wie aufwendig ist eine Psychotherapie? Schreiben die Richtlinien auch die Anzahl der Sitzungen vor? Eine Kognitive Verhaltenstherapie umfasst etwa 25 Sitzungen. Am Anfang ist der Patient jede Woche oder sogar zwei Mal wöchentlich beim Therapeuten, später, in der Erhaltungstherapie, kann man die Abstände zwischen den Sitzungen auf zwei bis drei Wochen vergrößern. Gibt es neben der Kombination von Psychotherapie und Antidepressiva noch andere etablierte Therapieoptionen? Sport ist stets zu empfehlen, egal, wie der 40 Patient sonst behandelt wird und welche Form und Ausprägung die Depression hat. Wohldosierte körperliche Bewegung ist fast immer richtig. Dann ist da noch die Wachtherapie als ernstzunehmende Behandlungsalternative oder -ergänzung. Dabei bleiben Patienten in der zweiten Hälfte der Nacht wach – dann, wenn die Tiefschlafphasen abgeschlafen sind. Tatsächlich kommt es bei bis zu 50 Prozent der Erkrankten vorübergehend zu einer deutlichen Stimmungsaufhellung. Bei schweren Erkrankungen greifen Mediziner zudem auf die Elektrokrampftherapie zurück: Dabei setzen sie den Patienten in Vollnarkose, anschließend durchfluten sie bestimmte Hirnareale mit Strom. Schon wegen des Namens und der Laienvorstellungen hat die Elektrokrampftherapie ein schlechtes Image in der Bevölkerung, doch bei sehr ausgeprägten Depressionen, die sich mit den anderen Methoden nicht behandeln lassen, ist dieser Ansatz oft der einzige Weg. Wie sollten bipolare Depressionen behandelt werden – Erkrankungen also, in denen sich depressive und manische Episoden abwechseln? Die sind schwieriger zu therapieren, weil Psychotherapien weniger wirksam sind. Von Anfang an kommen dabei Medikamente zum Einsatz. Zu den Antidepressiva während der depressiven Episoden gibt man den Patienten in der Manie und zur Verhinderung von Rückfällen häufig Antiepileptika und auch Lithium. Auch atypische Neuroleptika haben sich bewährt. Das Haupterkrankungsalter liegt bei 18-20 Jahren, und meist werfen bipolare Depressionen die Betroffenen, die sich in der Ausbildung oder im Loslösungsprozess vom Elternhaus befinden, völlig aus der Bahn. Beziehungen und Kontakte gehen schneller verloren, das Arbeiten wird unmöglich. Eine engmaschige und gut kontrollierte Therapie ist bei bipolar Depressiven deshalb besonders wichtig. Wie wird sich die Depressionstherapie in Zukunft verändern? Bei der Entwicklung von Antidepressiva sehe ich derzeit wenige Fortschritte. Man sucht Therapie weiter nach völlig neuartigen Therapieprinzipien, doch bisher steht nichts kurz vor der klinischen Anwendung. Deutlich mehr passiert hingegen im Bereich der Psychotherapie. So versucht man die etablierte Kombination von Antidepressiva und einer Psychotherapie durch andere Psychotherapien zu ergänzen. In Freiburg zum Beispiel versuchen wir gerade bei chronisch Depressiven, die schon länger als zwei Jahre erkrankt sind, die Kognitive Verhaltenstherapie mit Elementen der Tiefenpsychologie und mit Verfahren der sogenannten Achtsamkeitstherapie zu kombinieren. Dabei kommen meditative Methoden und Aufmerksamkeitstechniken zur Anwendung. Das ist bislang noch ein Forschungsansatz und noch nicht etabliert, doch aus den USA liegen Hinweise vor, dass diese Kombination bei Langzeitkranken womöglich bessere Ergebnisse liefert als herkömmliche Ansätze allein. Herr Professor Berger, wir danken Ihnen für das Gespräch. Prof. Dr. Mathias Berger ist Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg und Herausgeber des im Verlag Urban und Fischer erschienenen Lehrbuches „Psychische Erkrankungen – Klinik und Therapie“. Er war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) von 2003 bis 2004 und ist Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Versorgungsleitlinien Depression: In den im Interview angesprochenen S3Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) finden sich nicht nur Regeln für die Therapie, sondern auch für die Diagnostik. Eine Kurz- und eine ausführlichere Langfassung finden Sie im Internet unter: http://www.depression.versorgungsleitlinien.de 3.4 Einblick ins Gehirn „Hirnaufnahmen zeigen, dass Psychotherapie sogar die Struktur des Gehirns verändern kann“ Die schlechte Nachricht vorweg: Depressionen lassen sich nicht sichtbar machen. Niemand kann anhand einer Aufnahme des Gehirns mittels Kernspintomografie (MRT, im Medizinerjargon: Prof. Gerhard Gründer, UniversitätsKernspin), Computerklinikum Aachen tomografie (CT) oder Positronenemissionstomografie (PET) sicher sagen, ob der Patient an einer Depression leidet. Die Krankheit bleibt verborgen. „Bislang kennen wir leider keinen Biomarker, keine für Depression charakteristische Substanz, die wir markieren und so auf unseren Aufnahmen darstellen könnten“, sagt Prof. Gerhard Gründer, stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Aachen. Ein weitverbreitetes Problem in seinem Fach: Abgesehen von einigen Demenzerkrankungen sind die meisten Leiden – so auch die Depression – psychopathologische Diagnosen, für die kaum oder keine organische Ursachen bekannt sind. „Ganz blind sind wir bei der Depression aber nun auch wieder nicht“, sagt Gründer. So habe eine Forschergruppe aus Toronto im Jahr 2006 mit Hilfe von PET-Aufnahmen gezeigt, dass die Aktivität des Enzyms Monoaminoxidase (MAO) bei Depressiven häufig erhöht ist. Für die Hirnforschung ein einleuchtendes Ergebnis: MAO baut die Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin ab, die wiederum bei vielen Depressiven zu wenig aktiv sind. Anfang 2010 wiesen die gleichen Forscher nach, dass die Aktivität von MAO 41 Therapie auch bei Frauen in den Wochen nach der Geburt erhöht ist, was Gründer zufolge das erhöhte Risiko einer Depression nach der Geburt eines Kindes (postnatale Depression) erklären könnte. Mithilfe von nuklearmedizinischen Methoden lassen sich auch Serotonin-Transporter markieren, so dass ihre Dichte im Gehirn gemessen werden kann. Die Transporter in den Zellwänden bewirken, dass Serotonin von seinem Wirkort im synaptischen Spalt wieder in die Zelle aufgenommen wird und damit nicht mehr aktiv ist. Man konnte nicht nur zeigen, dass die Zahl der Transporter bei Depressiven erhöht ist. Ihre Dichte schwankt auch bei Gesunden mit den Jahreszeiten, was wahrscheinlich am Lichteinfall liegt: Womöglich liegt hier die neurobiologische Ursache für die sogenannte Winterdepression. Es gibt Menschen, deren depressive Episoden vor allem im Winter auftreten. Inzwischen hat man herausfinden können, wie sensibel die Menge an Serotonin-Transportern auf unterschiedliche Faktoren reagiert. So sind eine Reihe von Genabschnitten identifiziert worden, die die Menge von Serotonin-Transportern beeinflussen. An Affen wiederum zeigten Forscher des amerikanischen National Institute of Mental Health (NIMH) im Jahr 2006, wie anfällig die Regulation der Proteine gegenüber Stress ist: Trennte man die Tiere bald nach der Geburt von der Mutter, wirkte sich das signifikant auf die Dichte der Serotonin-Transporter aus. „Gerade diese Untersuchung zeigt, wie Umweltfaktoren ganz wesentlich genetisch determinierte biologische Funktionen verändern können“, sagt Gründer. Das Gehirn von Depressiven scheint aber nicht nur auf molekularer und funktioneller Ebene von der Krankheit betroffen zu sein. Auch bei einfachen strukturellen Aufnahmen, in denen das Gehirn ohne nennenswerte Vergrößerung dargestellt wird, konnten Forscher Veränderungen nachweisen: „Bei chronisch Depressiven mit lang andauernder Erkrankung nimmt im Laufe der Zeit die 42 Größe des Hippocampus ab“, sagt Gründer. Der Hippocampus wiederum ist ein Hirnareal, das für das Gedächtnis zuständig ist, insbesondere das Langzeitgedächtnis. Zumindest einige Folgen von Depressionen können Wissenschaftler also sichtbar machen. Eine Diagnose jedoch lässt sich daraus noch nicht ableiten. Die Schnittmenge zwischen Gesunden und Erkrankten ist noch zu groß: Was in einem Gehirn als gesundes Muster vorhanden ist, kann in einem anderen Gehirn im Laufe einer Depression erst entstanden sein. „Nur wenn wir eine große Menge an Depressiven mit einer großen Menge an Gesunden vergleichen, finden wir Unterschiede“, sagt Gründer. Anders bei den Auswirkungen einer Therapie: Die lassen sich manchmal auch beim Einzelnen verfolgen. Mithilfe von PET-Aufnahmen können Wissenschaftler beispielsweise den Effekt von Antidepressiva darstellen, die etwa 80 Prozent der Serotonin-Transporter blockieren. Inzwischen ermitteln die Medikamentenhersteller über solche PET-Aufnahmen auch die richtige Dosierung ihrer Wirkstoffe. Und die Psychotherapie? „Bildgebende Verfahren zeigen heute, dass Psychotherapie nicht eine rein ,psychologische' Therapie ist, sondern im Gehirn wirkt und dort tatsächlich zu biologischen Veränderungen führt“, sagt Gründer. Bei entsprechend behandelten Patienten lassen sich nicht nur Veränderungen in der Funktion des Gehirns nachweisen, sondern auch in seiner Struktur. So nimmt etwa die Größe des Hippocampus nach erfolgreicher Psychotherapie nicht mehr nennenswert ab – im Gegensatz zu unbehandelten Patienten. „Wie weit wir in der Therapie inzwischen sind, zeigen unsere Beobachtungen bei der Amygdala“, sagt Gründer. Die auch als „Mandelkern“ bekannte Region im Gehirn gilt als Kerngebiet der Emotionsverarbeitung. Anhand von funktionellen Kernspin-Aufnahmen weiß man längst, dass bei depressiven Patienten die Amygdala vor allem durch Angst auslösende Reize aktiviert wird. Angst wird deshalb verstärkt und übersteigert wahrgenommen. Sowohl durch Therapie Pharmakotherapie als auch durch Psychotherapie lässt sich der Grad der Aktivierung der Amygdala signifikant senken, wie Gründer beweisen konnte. Ein weiterer Etappensieg auf dem Weg, die Depression greifbar zu machen. Der Durchbruch aber fehlt noch: ein für Depression spezifischer Biomarker. Erst damit könnte diagnostische Sicherheit geschaffen werden; die differenzialdiagnostische Abgrenzung zu anderen Erkrankungen wäre möglich, die Therapien ließen sich dann noch gezielter verfolgen und vergleichen. „Immerhin hat die Forschung schon einige Hinweise auf mögliche Biomarker für Depression gefunden“, sagt Gründer. Bis einer zu 100 Prozent identifiziert ist und Patienten in der klinischen Anwendung davon profitieren, dürfte es allerdings noch einige Jahre dauern. Prof. Gerhard Gründer ist stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Aachen. Er leitet die Arbeitsgruppe Molekulare und Klinische Psychopharmakologie und bedient sich im Rahmen seiner Forschungsarbeit moderner bildgebender Verfahren. 3.5 Fahndung nach Biomarkern „Wir sind gar nicht mehr weit davon entfernt, die biologischen Mechanismen, durch die Depressionen entstehen, aufzuklären. Wenn wir das ­geschafft haben, werden sich Diagnostik und Therapie grundlegend verändern: Es wird Biomarker geben, die uns erlauben, die unterschiedlichen Depressionsformen zu identifizieren. “ Prof. Florian Holsboer, seit 1989 Direktor des ­Max-Planck-Instituts für Psychiatrie Wer glaubt, schwanger zu sein, geht in eine Apotheke, kauft sich einen Teststreifen und geht auf die Toilette. Färbt sich der gekennzeichnete Bereich rot, hat man Gewissheit. Wer nach einem Unfall den Arm nicht mehr bewegen kann, lässt sich röntgen und erfährt, ob der Arm gebrochen ist oder nicht. Wer Angst hat, depressiv zu sein, geht zum Arzt und redet mit ihm. Und der Arzt stellt auf Basis des Gespräches die Diagnose. Die ist zwar fundierter und zuverlässiger, als gemeinhin angenommen – gleichzeitig aber auch schwieriger festzulegen, als etwa einen Herzinfarkt oder eben eine Schwangerschaft nachzuweisen. Wie die meisten psychischen Erkrankungen sind Depressionen objektiv noch nicht zu erfassen: „Gelingt es uns, die der Depression zugrunde liegenden biologischen Mechanismen ganz aufzudecken, wird das sowohl Diagnose als auch Therapie revolutionieren“, sagt Prof. Florian Holsboer vom Max-PlanckInstitut für Psychiatrie in München. Ein Stück weit in diese Richtung sind die Neurowissenschaften heute schon gekommen. Dank des technologischen Fortschritts in der Human- 43 Therapie genetik hat man inzwischen Dutzende Gene identifiziert, deren Varianten gehäuft mit Depression assoziiert sind. Für den Einzelnen sind die Korrelationen allerdings wenig hilfreich, er kann sein eigenes Erkrankungsrisiko nicht abschätzen. Die auf unseren Genen kodierte Information zur Synthese von Eiweißmolekülen, den Bausteinen des Lebens, ist nur eine grobe „Blaupause“. So finden zahlreiche Prozesse statt, die zu Eiweißmolekülen führen, die sich in Menge und Struktur unterscheiden, obwohl das Gen unserer Erbsubstanz unverändert geblieben ist. Der wichtigste Prozess, durch den solche Veränderungen der Aktivierbarkeit unserer Gene erfolgen, wird in der Epigenetik erforscht. Hierbei werden als Folge einer durch ein Trauma hervorgerufenen hohen Aktivierung der Nervenzellen mithilfe von Neurotransmittern spezielle Atomanordnungen auf der Erbsubstanz gebunden. Diese chemischen Veränderungen haben die Rolle von „Schaltern“, durch die Genaktivität herauf- oder herunter reguliert werden kann. Solche Genschalter können unter bestimmten Voraussetzungen sogar vererbt werden. 44 -Wird das Medikament von der Leber beschleunigt oder verzögert abgebaut? -Vermag das Medikament die Blut-HirnSchranke zu passieren und in das Gehirn einzudringen? -Existiert eine Genvariante, die generell mit günstigem Therapieansprechen auf ein spezielles Medikament verbunden ist? -Liegt eine Genvariante vor, die das Risiko von Nebenwirkungen erhöht? Diese lebenslang wirkenden Regulierungsprozesse spielen nicht nur eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Krankheiten. Sie sind auch verantwortlich für die Entwicklung biologischer Komplexität, die es den Wissenschaftlern so schwer macht, verlässliche Aussagen zu treffen. „Einzelne mit Depression korrelierende DNA-Abschnitte helfen uns nur begrenzt weiter“, sagt Holsboer. Interessant würden die Erkenntnisse erst, wenn eine Kombination von Genveränderungen identifiziert werden kann, die hilft, den krankheitsverursachenden Mechanismus zu verstehen. Bezüglich der Erkrankungswahrscheinlichkeit, insbesondere bei Depression, lassen sich allein mit diesen Genvariationen noch keine zuverlässigen Aussagen treffen, wie die Forscher inzwischen wissen. Depressionen sind von zu vielen Faktoren abhängig, und die gefundenen Genkombinationen sind immer noch zu unspezifisch. „Um die Spezifität zu erhöhen, brauchen wir zusätzlich dynamische Biomarker“, sagt Holsboer. Messergebnisse also, die an Stoffwechselprozessen unmittelbar beteiligt sind und mit bildgebenden Verfahren dargestellt werden können. Aktivität und Lokalisation ließen sich wie in einem Schnappschuss erfassen. Jede Substanz, die analysiert werden kann, kommt dabei als Biomarker in Betracht. So kann man beispielsweise die Aktivität von Genen unmittelbar messen (Transkriptomik). Die Genaktivität wird nicht nur durch angeborene Eigenheiten der Erbsubstanz bestimmt, sondern auch durch die erwähnten epigenetischen Modifikationen, die sogenannten Genschalter. Auch solche Genschalter lassen sich mit den heutigen Methoden genau bestimmen. Einige solcher aussagekräftigen Gentests, die klinische Entscheidungen erleichtern, gibt es bereits. Die Ergebnisse bieten Medizinern bei der Therapie Entscheidungshilfen bei der Wahl des richtigen Antidepressivums und der Dosierung. So lassen sich mithilfe der Genuntersuchungen folgende Fragen beantworten: Ein besonders vielversprechender Forschungszweig zur Entdeckung von Biomarkern ist die Proteomik, die Analyse aller in unserem Körper vorhandenen Eiweißmoleküle. Es handelt sich um 1,2 Millionen Proteine, die hier dargestellt werden müssen. Eine riesige Zahl von Substanzen, die aus unseren etwa 25.000 Genen entstehen können. Therapie Eine andere Quelle für Biomarker ist die Metabolomik, sie identifiziert alle Moleküle unseres Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels im Blut, der Cerebrospinalflüssigkeit, in die unser Gehirn eingebettet ist, oder auch anderer Gewebe, zum Beispiel unserem Blut. Von der Gehirnstrommessung bis zum Hormonhaushalt können Biomarker im Grunde überall, wo sie aktiv sind, auch nützlich sein. So führte etwa die vermehrte Ausschüttung eines bestimmten Hormons im Gehirn (Corticotropin-releasing Hormone, CRH) bei Tieren zu Verhaltensänderungen, die Ähnlichkeit zur Depression haben. Blockierte man die Wirkorte des ausgeschütteten Hormons, bildeten sich die Symptome zurück. Die Forscher folgerten: Medikamente, die CRH in seiner Wirkung behindern, könnten womöglich eine neue Antidepressiva-Generation werden, natürlich nur bei derjenigen Untergruppe depressiver Patienten, bei denen CRHÜberschuss der krankheitsverursachende Mechanismus ist. Trial and error. Doch auch jede Forschungsarbeit ohne positives Ergebnis ist ein weiterer Baustein auf dem Weg der Erkenntnis. „Der erste große Meilenstein wäre eine Kombination aus Gentests und Biomarkern, die es erlaubt, die unter der Diagnose 'Depression' zusammengefassten Patienten in Untergruppen aufzuteilen, die sich in ihrem krankheitsverursachenden Mechanismus ähneln. Die heutige, rein auf verbal kommunizierte Informationen basierte Diagnostik kann solche 'homogenen' Gruppen nicht identifizieren. Derartige auf Laborergebnisse gestützte Diagnosen werden helfen, das Vorliegen einer Depression zu objektivieren. Neben dem klinischen Nutzen würde eine solche auf Laborergebnisse gestützte Diagnostik auch einen Beitrag zur Entstigmatisierung leisten“, sagt Holsboer. „ Anhand der spezifischen Klassifikationen wiederum kann in einem weiteren Schritt gezielt die richtige Therapie ausgewählt werden.“ Spätestens dann profitiert auch der Patient von der jahrzehntelangen Forschung. Für die Marktzulassung wurden bereits Studien durchgeführt, in denen bei Patienten mit Depression ein Standardantidepressivum mit einem CRH-blockierenden Wirkstoff verglichen wurde, eine dritte Gruppe erhielt ein Placebo. Die Medikamente gegen CRH schnitten dabei schlechter ab als das Standardantidepressivum. „Was nicht verwundert“, sagt Holsboer. „Weil hier ein spezifisch auf einen einzelnen Mechanismus gerichtetes Medikament bei einer hinsichtlich der Krankheitsentstehung höchst heterogenen Patientengruppe eingesetzt wurde. Denn: Je spezifischer wir behandeln, umso mehr müssen wir über die Patienten wissen“, sagt Holsboer. Dies gelingt nur mit Biomarkern, die uns anzeigen, welcher Krankheitsmechanismus beim einzelnen Patienten zur Depression geführt hat. Erste Analysen, die einen Biomarker einsetzten, der CRH-Überaktivität anzeigt, deuten darauf hin, dass in diesem Falle CRH-Blocker auch besser wirken. 45 Therapie 3.6 Das soziale Umfeld Interview mit Priv.-Doz. Dr. Dr. A. Zacher, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg, über die Rolle und Bedeutung der Sozialpsychiatrie bei der Behandlung von Depressionen. „Wir haben zu wenige Psychiater“ Herr Dr. Zacher, warum ist die Sozialpsychiatrie wichtig für die Behandlung psychischer Erkrankungen? Zacher: Ohne das Instrumentarium der Sozialpsychiatrie ließen sich viele psychische Erkrankungen nicht ausreichend therapieren. Zunächst einmal sollte man allerdings unterscheiden zwischen Großer und Kleiner Sozialpsychiatrie. Die Große Sozialpsychiatrie muss bei schweren Fällen wie chronischen Psychosen oder bipolaren affektiven Erkrankungen zum Einsatz kommen. Die Kleine Sozialpsychiatrie ist das, was alle Psychiater und Nervenärzte jeden Tag machen: Gespräche mit Angehörigen führen, mit Betreuern, die Anfragen der Arbeitsagentur, der Rentenversicherung, des medizinischen Dienstes sorgfältig bearbeiten. Auch indem wir Ärzte die Patienten von ihrer Arbeitspflicht entheben, befreien wir sie zumindest während der Krankheit vom Druck ihres beruflichen Umfeldes. Suchen Sie in der sozialen Umgebung des Patienten auch nach Ursachen für eine Depression? Das ist eines der zentralen Prinzipien der Sozialpsychiatrie. Man sieht den Patienten nicht isoliert, sondern als Teil seiner ihn umgebenden sozialen Umwelt. Dort fahnden wir auch nach möglichen Auslösern für die Erkrankung. Im schlechtesten Fall muss der Patient vorübergehend aus der belastenden 46 Situation herausgenommen werden, aber dies ist nicht immer nötig. Oft kann durch die sachliche Information der Angehörigen, durch die Vermittlung von Kontakten zu Beratungsstellen und zu Selbsthilfegruppen viel erreicht werden. Wir arbeiten – und da beginnt die von mir so bezeichnete Große Sozialpsychiatrie – jedoch auch viel mit sozialpsychiatrischen Diensten und ähnlich gelagerten Institutionen zusammen, die eigens für diese Zwecke gegründet wurden. Dort, wo es die entsprechende Infrastruktur dank des großen persönlichen Einsatzes von ärztlichen Kollegen, Psychologen und Sozialarbeitern gibt, ist Elementares für die sozialen Belange psychisch schwer kranker Menschen erreicht. Vergütet wird dieser Aufwand allerdings nur in sehr beschränktem Maße. Haben wir in Deutschland eine vernünftige Infrastruktur für eine psychiatrische Versorgung? Voraussetzung für eine gute ambulante Betreuung ist vor allem eine ausreichend hohe Dichte von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie. Derzeit wird oft von einer Knappheit an Allgemeinmedizinern in strukturschwachen Regionen gesprochen, was leider auch zutrifft. Mindestens ebenso dramatisch jedoch ist der Mangel an Psychiatern besonders in ländlichen Gegenden und ganz besonders in den neuen Bundesländern. Die meisten Einweisungen in psychiatrische Kliniken erfolgen nicht durch Psychiater, sondern durch Hausärzte und andere Ärztegruppen. Lediglich etwa zehn Prozent der Einweisungen stammen von uns Psychiatern. Das hat vermutlich ähnliche Gründe wie bei den Allgemeinmedizinern. Die meisten zieht es nun mal lieber in eine attraktive Stadt ... … ökonomische Kriterien spielen dabei natürlich auch eine wichtige Rolle. Psychiatrische Leistungen werden zu schlecht vergütet? Psychiater gehören zu den am schlechtesten bezahlten Ärzten. Und weil das Abrechnungssystem immer wieder umgestellt wird, gibt es keine Planungssicherheit. Zudem sind Psychopharmaka teuer, was dazu führt, dass Therapie mancher Kollege drei oder vier Jahre nach der Verschreibung plötzlich die Aufforderung erhält, er müsse Geld bezahlen, weil er zu weit vom Durchschnitt abgewichen ist. Dabei hat er ja an den Verordnungen keinen einzigen Cent selber verdient. Dies sind Gründe dafür, warum sich Psychiater zunehmend überlegen, sich nur auf die sogenannte Psychotherapie zurückzuziehen. Der als Psychotherapeut niedergelassene Psychiater wird zu festen Preisen nach Zeit bezahlt und verfügt damit über ein sicheres Einkommen. Meist betreut er nur etwa 40 Patienten, während ein niedergelassener Psychiater inzwischen mehr als 300 Patienten pro Quartal sieht. Die rasant wachsende Nachfrage macht die Knappheit noch dramatischer. Immer mehr Menschen haben immer weniger Probleme, einen Psychiater aufzusuchen. Das ist natürlich sehr begrüßenswert, doch wenn es an der Infrastruktur hapert, ist das System überlastet. In manchen Regionen müssen die Patienten wochenlang auf einen Termin warten. Dann weisen die Hausärzte die Patienten in eine Klinik ein, selbst wenn eine stationäre Behandlung gar nicht unbedingt sein müsste. Manchmal gehen die Patienten sogar selbst an die Klinikpforte und bitten um ihre stationäre Behandlung. In welchen Fällen ist die Einweisung unbedingt notwendig? Wenn so gravierende Symptome bestehen, dass der Patient nicht mehr in seiner Umgebung lebensfähig ist. Wenn es sich zum Beispiel um besonders schwere Fälle von Depression handelt, in denen Suizidgefahr besteht, übernimmt die Klinik den Patienten in ihre Obhut − auch dies ist eine Art sozialpsychiatrischer Maßnahme, weil erst einmal alles Belastende der Umgebung weitgehend ausgesperrt ist. Sie glauben gar nicht, wie viel Druck meist nicht unbedingt vom privaten Umfeld, sondern heute von Arbeitgebern ausgeübt wird. Grundsätzlich gilt: Damit die Patienten wirkungsvoll therapiert werden können, sind meist einige Wochen, manchmal gar Monate notwendig, gerade bei schweren chronifizierten Depressionen. Es wird gelegentlich behauptet, Patienten mit schwerer Depression würden häufig zu spät eingewiesen und blieben dann zu lange. Ersteres mag manchmal vorkommen, aber Letzteres stimmt nicht. Es gibt nun einmal in der Psychiatrie kein „rein in die Klinik – schnell repariert – und wieder raus an den Arbeitsplatz“, wie es in anderen Fachgebieten durchaus möglich sein kann. Wird denn bei der Behandlung in Deutschland auf das soziale Umfeld geachtet? Ja, sicher, aber nur, wenn die entsprechende Kompetenz vorhanden ist. Hier kommt natürlich auch den Hausärzten eine wichtige Rolle zu, und viele von ihnen sind sehr engagiert. Doch ersetzt dies nicht die Arbeit und den Sachverstand des Facharztes und natürlich auch nicht des Sozialarbeiters. Initiativen sind erforderlich, um dem drohenden Mangel entgegenzusteuern. Im Medizinstudium muss den Fächern klinische Psychologie und Psychiatrie die ihnen entsprechende Bedeutung eingeräumt werden und natürlich muss die ökonomische Situation der Psychiater verbessert werden. Das Bild unseres Berufsstandes bedarf in jeglicher Hinsicht dringend einer Aufwertung. Herr Dr. Zacher, wir danken Ihnen für das Gespräch. Privatdozent Dr. Dr. Albert Zacher ist niedergelassener Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg, Leiter der Fortbildungsakademie der Berufsverbände BVDN, BVDP, BDN und Schriftleiter der neurologisch-psychiatrischen Fachzeitschrift. Wie lange dauert ein Klinikaufenthalt normalerweise? Das kommt natürlich auf den Einzelfall an. 47 Therapie Was ist Sozialpsychiatrie? Streng genommen ist die Sozialpsychiatrie kein eigenes Fach, sondern ein Bereich in der Psychiatrie. Sie berücksichtigt, dass bei der Suche nach den Ursachen von psychischen Erkrankungen der Betroffene nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern als Teil seines möglicherweise krank machenden oder seine Erkrankung verstärkenden Umfeldes. Angewandte Sozialpsychiatrie versucht, die Faktoren, die den Patienten krank gemacht haben, zu analysieren und ihm Hilfe anzubieten, damit er wieder in seiner gewohnten Umgebung Fuß fassen kann. Alltägliche sozialpsychiatrische Maßnahmen sind schon, sozialen Druck vom Patienten zu nehmen, ihn in seinen privaten und beruflichen Belangen zu unterstützen, ihn zum Beispiel vorübergehend von einer chronisch überlastenden Arbeitssituation zu befreien. Bei der Sozialpsychiatrie geht es um die Reintegration des psychisch Kranken in sein familiäres, berufliches und soziales Umfeld. Vor allem bei schweren und chronischen Krankheitsfällen ist das Zusammenspiel von Psychiatern, Psychologen und Sozialarbeitern gefordert. 3.7 Weniger Schlaf ist oft mehr „Bei der Behandlung der ­Depression muss immer auch die Bekämpfung begleitender Schlafstörungen berücksichtigt werden“ Wer unbedingt schlafen will, der schafft es gerade deshalb oft nicht. Ein paradoxes Problem, das auch viele Gesunde aus eigener Erfahrung kennen. „Ob man einschläft Prof. Thomas Pollmächer, oder nicht, sollte eiDirektor des Zentrums für nem egal sein. Das ist psychische Gesundheit am eines der ersten Dinge, Klinikum Ingolstadt die ein schlafgestörter Depressiver unter Kognitiver Verhaltenstherapie lernt“, sagt Prof. Thomas Pollmächer, Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt. Schlafstörungen sind häufig das erste Symptom der Depression. Bevor viele Patienten sich niedergeschlagen fühlen, bevor Freudlosigkeit und Interesselosigkeit einsetzen, bevor sie ahnen, was sie haben, leiden sie unter Schlafstörungen. „Der Schlaf ist sehr empfindlich für Störungen der Emotionalität“, sagt Pollmächer. Heute können wir in aller Regel zwar beruhigt wegdämmern: Die Wohnungstür ist abgeschlossen, keiner kann eindringen und uns überraschen. Doch in der Zeit der Jäger und Sammler schützte die Menschen noch keine Tür vor Raubtieren, Feinden oder Räubern, die Gefahr im Wald und in der Steppe war allgegenwärtig. Diese Intuition ist uns geblieben: Wer schläft, begibt sich in eine unsichere und potenziell gefährliche Situation. „Sobald der Körper den Eindruck hat, das kann ich mir nicht leisten, versucht er, darauf zu verzichten.“ Emotionale Probleme bewirken offenbar genau dies. 48 Therapie Schlafstörungen sind deshalb kein spezifisches Zeichen für Depression, sondern ein zentrales Symptom für die meisten psychischen Erkrankungen. Charakteristisch hingegen bei Depressiven ist die Art der Störungen: ein frühmorgendliches Aufwachen; Einschlafen ist danach kaum noch möglich. „Das ist häufig besonders belastend“, sagt Pollmächer. „Diese Menschen liegen besonders lange im Bett, nach dem Motto: ‚Wenn ich lange liege, schlafe ich wenigstens ein bisschen‘.“ Doch das Gegenteil ist der Fall. Häufig geht Zeit für die täglichen Aufgaben verloren, was nur noch zu mehr Problemen führt. In die Behandlung der Depression wird deshalb immer auch die Bekämpfung der Schlafstörungen einbezogen. Bei der Kognitiven Verhaltenstherapie etwa lernen die Patienten Entspannungstechniken und die Fähigkeit, ihre Probleme sachlich und ohne Panik zu analysieren. Schlafpsychoedukation nennen Experten das. „Häufig rate ich den Patienten, einmal für zwei Wochen lang nur maximal sechs Stunden pro Nacht ins Bett zu gehen, egal, wie viel sie dabei schlafen“, sagt Pollmächer. Dieser Schlafentzug habe häufig eine beeindruckende Wirkung. Nicht nur, weil der Patient nach einigen Tagen zumindest ein oder zwei Nächte von selbst einschläft. Der Schlafentzug wirkt offenbar auch positiv gegen die Depression. „Es ist ein paradoxer Effekt“, sagt Pollmächer, „wenn man Depressiven Schlaf entzieht, hellt sich ihre Stimmung häufig auf.“ Entscheidend ist dabei offenbar die zweite Nachthälfte, in der ein Schlafender die sogenannten REM-Phasen durchläuft, die als Traumschlafphasen bekannt sind. Einzelne klinische Zentren bieten auch sogenannte Schlafentzugstherapien an, in denen der Schlaf über ein oder zwei Nächte vollständig entzogen wird. Nicht jede Schlafstörung ist Vorbote einer Depression. Wer Sorgen hat oder aufgekratzt ist, muss nicht gleich eine psychische Erkrankung fürchten. Manch einer kann sogar regelmäßig schlecht einschlafen und ist trotzdem vollkommen gesund. Ab wann sich Schlafstörungen von einer lästigen Eigentümlich- keit zu einem potenziellen Symptom einer psychischen Krankheit auswachsen, ist von Fall zu Fall verschieden. „Wenn jemand immer schläft wie ein Stein, dann aber plötzlich kaum noch einschläft, ist das eher verdächtig, als wenn jemand schon seit seiner Kindheit abends häufig lange wach liegt“, sagt Pollmächer. Als Richtlinie orientieren sich die Ärzte an folgender Definition: Wer mindestens drei Mal in der Woche über mindestens einen Monat lang eine Ein- oder Durchschlafstörung hat, leidet an einer Schlafstörung. Doch wer sagt eigentlich, dass Depressionen zu Schlafstörungen führen? Im Grunde könnte es genauso gut auch umgekehrt sein. „Man ist lange Zeit davon ausgegangen, dass Schlafstörungen das erste Anzeichen einer schon schwelenden, aber noch unbemerkten Depression sind. Das ist auch heute noch die vorherrschende Meinung. Doch es häufen sich Hinweise, dass es auch umgekehrt ablaufen kann“, sagt Pollmächer. So kam eine Studie der New Yorker Columbia University mit 16.000 Schülern zu dem Ergebnis, dass Jugendliche, die häufig nach Mitternacht ins Bett gehen, mit einer 24 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit an Depression erkranken als Gleichaltrige, die regelmäßig vor 22 Uhr einschlafen. Doch ist das noch kein Beweis. „Dieses Ergebnis stützt lediglich die Aussage, dass Schlafstörung und Depression miteinander assoziiert sind. Der Grund für die erhöhte Wahrscheinlichkeit könnte auch in einem unausgeglichenen Leben der ‚späten‘ Jugendlichen oder in ihren sozialen Verhältnissen liegen“, sagt Pollmächer. Andererseits fehlt auch der Gegenbeweis. „Bisher hat man noch nicht zeigen können, dass das frühe Behandeln von Schlafstörungen das Auftreten von Depressionen verhindert“, sagt Pollmächer. Beide Kausalitäten seien daher möglich. Wer über Jahre ernsthafte Schlafstörungen hat, könne auch eher an Depressionen erkranken. Auf der anderen Prof. Thomas Pollmächer ist Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt und international renommierter Experte für Schlafmedizin. 49 Therapie Seite sei bei einer beginnenden Depression der sensitive Schlaf häufig das Erste, was dem Betroffenen auffällt. Letzteres, sagt Pollmächer, sei mit Abstand häufiger der Fall. statt. Da ist der Übergang vom Beruf in die Pension, der Verlust von Partnern, Angehörigen und Freunden“, sagt Hock. Die Perspektive ändert sich. Was hat man noch für Verantwortung? Was gibt es für Aufgaben? Womit sich den ganzen Tag beschäftigen? Wie viel Zeit bleibt noch? 3.8 Depression im Alter Die Wissenschaft geht davon aus, dass ein Großteil der Altersdepressionen nicht erkannt wird. „Je nach Studie schwanken die Zahlen für Depression im Alter zwischen fünf und dreißig Prozent“, sagt Hock. Häufig stehen dabei zunächst typisch körperliche Probleme im Vordergrund: Herzinsuffizienz, Einschränkungen des Bewegungsapparats und der Sensibilität. Auch im Gehirn kommt es zu Veränderungen: Durchblutungsstörungen, kleine Hirninfarkte, Neurodegeneration. „Die Unterscheidung zwischen Demenz und Depression gestaltet sich für den behandelnden Arzt dann häufig als Herausforderung“, sagt Hock. Mithilfe neuropsychologischer Tests versucht er, die beiden Krankheitsbilder voneinander abzugrenzen. Dabei kommt es auf Nuancen an: Wo genau sind die Leistungseinbußen und wie groß sind sie? So ist bei beginnender Demenz eher das episodische Gedächtnis – zum Beispiel Erinnerungen an Lebensereignisse – betroffen, bei Depression hingegen vor allem die Informationsverarbeitung und die Aufmerksamkeit. „Depression im Alter ­unterscheidet sich grundlegend von der Depression in jüngeren Jahren.“ Depression tarnt sich im Alter besonders gut. „Maskierte Depressionen nehmen mit den Jahren zu“, sagt Prof. Christoph Hock, Direktor der gerontopsychiatrischen Prof. Christoph Hock, Klinik der UniversiDirektor der Klinik für tät Zürich. So sind Alterspsychiatrie an der im Alter körperliche Universität Zürich Beschwerden und soziale Veränderungen verbreiteter, auch Schlafstörungen gibt es häufiger. Die Grenze zwischen altersbedingten Veränderungen und Depression verschwimmt oft. Und obwohl die Symptome der Depression ähnlich sind wie bei jüngeren Menschen, sind sie anders verteilt – und damit weniger eindeutig. Viele Depressionen sind subsyndromal, darunter versteht man milde Formen der Erkrankung, bei denen Traurigkeit, Ängste, Schuldgefühle und das Gefühl der Wertlosigkeit im Vordergrund stehen. Zudem überschneiden sich die Körperkrankheiten häufig mit denjenigen Symptomen einer Depression, die auf einzelne Körperregionen bezogen sind, zum Beispiel den MagenDarm-Trakt. Hinzu kommen Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnislücken. „Im Alter findet ein umfassender Rollenwechsel 50 Die Unterscheidung haben in den vergangenen Jahren vor allem neue bildgebende Verfahren erleichtert. „Vor einigen Jahren konnten wir die Gehirnveränderungen etwa bei Alzheimer nur bei der Obduktion nachweisen“, sagt Hock. Heute lassen sich die für Alzheimer typischen Ablagerungen, die sogenannten Amyloid-Plaques, mithilfe von Positronenemissionstomografie (PET) entdecken. Auch die Kernspintomografie (MRT) erlaubt die Messung und Klassifikation von Hirnveränderungen. Alte Menschen mit Depressionen müssen anders behandelt werden als junge. „Die körperlichen Bedingungen bei älteren Menschen sind andere“, sagt Hock. Das beschränkt Therapie sich nicht nur auf die hormonellen Veränderungen, sondern betrifft den gesamten Stoffwechsel. So sinkt zum Beispiel der Körperwasseranteil, der Körperfettanteil steigt, der Patient reagiert empfindlicher auf Nebenwirkungen – die Dosierung muss deshalb vorsichtig gewählt werden, damit es nicht zu belastenden Nebenwirkungen kommt. Zudem nehmen Ältere häufig bereits zahlreiche Medikamente ein, was oft zu Wechselwirkungen mit Antidepressiva führt. „Wir müssen extrem sichere Medikamente einsetzen“, sagt Hock. In der Regel seien das die Wirkstoffe der Gruppe der Selektiven SerotoninWiederaufnahmehemmer (SSRI). Und dann kann es natürlich immer auch sein, dass der Patient Medikamente einnimmt, durch die eine Depression erst mit ausgelöst wird, zum Beispiel das oft bei Rheuma und Asthma eingesetzte Stresshormon Kortison. Wo auch immer der Auslöser zu suchen ist – psychotherapeutische Maßnahmen spielen auch bei der Altersdepression eine wichtige Rolle in der Therapie. „Ältere Menschen haben meist ein ganzes Bündel von Problemen, die nicht verarbeitet sind“, sagt Hock. Das können aktuelle Ängste sein, etwa in Bezug auf die Lebenserwartung, aber auch Altlasten aus der Vergangenheit, Verlustereignisse, Traumata. Schließlich gewinnt noch ein anderer Aspekt an Bedeutung: „Die Plastizität des Gehirns bleibt meist nur erhalten, wenn die Nervenzellen stimuliert werden“, sagt Hock. Dies sollte auf allen Ebenen geschehen. Geistig fordernde Aufgaben oder Hobbys sind ebenso wichtig wie die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte. Auch körperliche Aktivität kommt dem Gehirn zugute. „Sie regt die Durchblutung an, die positive Wirkung körperlicher Anstrengung auf geistige Beweglichkeit ist in unzähligen Studien belegt“, sagt Hock. Die Suizidversuchsrate im Alter nimmt zwar ab, „aber die absolute Zahl der erfolgreichen Suizide steigt“, sagt Christoph Hock. Vor allem alte Männer mit Depressionen wählen häufig den Freitod. Sie haben besonders oft Probleme, auf ihre alten Tage abhängig von anderen zu sein. „Man muss sich pflegen lassen, man ist weniger selbstständig, das ist für viele Männer mit Depressionen offenbar unerträglich“, sagt Hock. „Depressionen im Alter lassen sich aber relativ gut behandeln.“ Antidepressiva, Psychotherapie sowie körperliche und soziale Aktivität müssten nur konsequent angewandt werden. „Ein einzelner Therapieansatz allein hilft nicht“, sagt Hock. Das Wichtigste sei, den therapeutischen Nihilismus im Alter zu vermeiden. Bei gründlicher Diagnostik und altersangepasster Anwendung von Antidepressiva in Kombination mit sozialer Beratung und psychotherapeutischen Maßnahmen seien sehr gute Behandlungserfolge zu verzeichnen. Die Voraussetzung dafür, um ein aktives, unabhängiges und zufriedenes Leben im Alter zu führen. Prof. Dr. Christoph Hock ist Chefarzt für Alterspsychiatrie an der Universität Zürich und beschäftigt sich neben Depression auch intensiv mit Demenzerkrankungen im Alter. 3.9 Über die Rolle der Privaten Krankenversicherungen Interview mit Dr. Olaf Karitzki, Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Fachbereich Leistungs- und Gesundheitsmanagement, Abteilungsleiter ambulante Medizin „Zuwendungsorientierte ­Medizin sollte gestärkt werden“ Wie bewerten Sie die Qualität der Diagnostik und die Depressionstherapie in Deutschland? Ob die Krankheit eines Patienten in seiner individuellen Situation richtig erkannt und 51 Therapie behandelt wird, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Hier wird man jedem Arzt einen Vertrauensvorschuss geben müssen. Begibt man sich aber auf die Ebene der Statistik, zeigt sich, dass Depressionen in erheblichem Umfang zu schwach, zu stark oder mit den falschen Therapien behandelt werden. Worin äußert sich das? Es gibt Studien, die belegen, dass ein Drittel aller Patienten gar keine Therapie erhalten, obwohl sie psychotherapeutisch oder medikamentös behandelt werden sollten. Gleichzeitig werden heutzutage vermehrt leichte Formen einer Depression aufwendig therapiert, die auch ohne Behandlung schnell von allein wieder verschwunden wären. Eine Fehlversorgung äußert sich zum Beispiel darin, dass bei vergleichbaren Krankheitsbildern mal 20 Prozent, mal 70 Prozent der Patienten mit einer Verhaltenstherapie versorgt werden, je nachdem, in welcher Region die Patienten leben. Praktizieren angesichts der steigenden Fallzahlen zu wenige Psychiater, vor allem im ländlichen Raum? Das lässt sich mit Verweis auf die genannten Beispiele pauschal nicht sagen – durch eine andere Verwendung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten könnten mehr Patienten als bislang mit einer geeigneten Therapie versorgt werden. Es ist sicher richtig, dass es in strukturschwachen Gebieten zu wenig Fachärzte und damit auch zu wenig Psychiater gibt. Ich möchte aber auf die Tautologie in dieser Aussage verweisen: „Strukturschwache Gebiete“ zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass dort wesentliche Strukturen, die man in großen Städten vorfindet, nicht vorhanden sind. Das gilt für die ärztliche Versorgung ebenso wie für viele andere Bereiche. Eine solche Aussage kann also nicht automatisch eine Aufforderung an die Politik sein, irgendeine Art von Sonderförderprogramm aufzulegen. Gleichwohl müssen wir versuchen, den dort lebenden Menschen zu helfen – ich denke, dass wir hier zum Beispiel die Möglichkeiten der neuen Medien längst noch nicht ausgeschöpft haben. 52 Priv.-Doz. Dr. Dr. Zacher fordert ein neues Anreizsystem und neue Vergütungsmodelle für Psychiater. Braucht dieser Berufsstand mehr Geld? Ich sehe es tatsächlich so, dass die zuwendungsorientierte Medizin zulasten technikgestützter Diagnosemethoden gestärkt werden sollte. Psychiater würden hiervon tendenziell profitieren. Ich gebe Dr. Zacher auch Recht bei seiner Kritik an der Vergütungspraxis im GKV-System, von Ärzten Rückforderungen zu erheben, weil sie für ihre Patienten mehr Medikamente verschrieben haben als der Durchschnitt. Umso wichtiger ist es, die für die Privatmedizin relevante Struktur der geltenden Gebührenordnung für Ärzte zu modifizieren. Hier finden etliche Fehlsteuerungen statt, etwa wenn Patienten bei manchen Ärzten routinemäßig im MRT untersucht werden, weil diese Leistung höher vergütet wird als ein ausführliches Aufklärungsgespräch, das aber manchmal hilfreicher wäre. Für mich erschließt es sich nicht, warum Ärzte für ähnliche Tätigkeiten unterschiedliche Bezahlungen erhalten, wie das heute die Gebührenordnung vorsieht. Warum nicht alle Zuwendungsleistungen einheitlich honorieren? Das würde die Ärzte auch von dem Vorwurf befreien, manche von ihnen wählten die jeweilige Therapie nach der Honorarhöhe und nicht nach dem Nutzen für den Patienten aus. Inwieweit könnte eine personalisierte Therapie, wie sie Prof. Holsboer fordert, helfen, Kosten zu sparen? Die Vision von Prof. Holsboer ist verführerisch – das Thema einer personalisierten Therapie gilt gemeinhin als der kommende Megatrend in der Medizin, nicht nur bei Depressionen. Ob damit allerdings Kosten gespart werden oder diese sogar nach oben schnellen, das ist offen. Wovon hängt das ab? Nehmen Sie etwa an, die Entwicklung eines neuen Medikaments würde eine Milliarde Euro kosten, nicht zuletzt durch die aufwendigen Studien an einer Vielzahl von Patienten, wie Prof. Holsboer dies anschaulich beschreibt. Wenn dieses Arzneimittel über die Therapie Jahre hinweg eine Million Mal verteilt würde, würde jede Packung 1.000 Euro kosten – abgesehen von den sonstigen Kosten und den Gewinnmargen der Pharmaindustrie. Was würde passieren, wenn künftig in 900.000 Fällen personalisierte Medizin eingesetzt wird? Unter den heutigen Bedingungen würde das Beispielmedikament trotzdem hergestellt und genauso aufwendig getestet werden – die Kosten von einer Milliarde Euro würden schlichtweg auf die jetzt nur noch 100.000 Packungen umgelegt, jede Packung würde dann mit 10.000 Euro zu Buche schlagen. Dazu kämen die Kosten für die personalisierten Arzneimittel der anderen 900.000 Fälle. Die Kosten im Gesundheitswesen würden explodieren. Danach bliebe personalisierte Medizin eine Vision. Nein, wir alle wollen doch von einer höheren Wirksamkeit von Medikamenten profitieren. Wir dürfen eine solche Innovation aber nur bei geänderten Rahmenbedingungen in den Gesundheitsmarkt einführen. Die heutige Praxis der Pharmafirmen, sich den Preis für echte und scheinbare Neuerungen in Deutschland selbst aussuchen zu können, muss dringend reformiert werden, damit im Gesundheitssystem die finanziellen Mittel für wirkliche Innovationen wie die personalisierte Medizin zur Verfügung stehen. In anderen Ländern wird bereits heute viel stärker auf den Zusatznutzen eines Medikaments geachtet, wenn es zugelassen wird. In dem hier skizzierten Beispiel hätte das Medikament keinen Zusatznutzen im Vergleich zur personalisierten Medizin – es wäre daher nicht einzusehen, wieso dieses überteuerte Produkt zulasten von privaten oder gesetzlichen Versichertenkollektiven verordnet werden sollte. ma „Depression“ ohne Tabus, ganz nüchtern und rational behandelt wird, ist das auf jeden Fall ein Gewinn für alle. Gerade im psychiatrischen Bereich ist Patientenautonomie wichtig, und das geht nur auf Basis umfassender Informationen. Ist „lotsen“ nicht nur ein Synonym für „einschränken“? Nein, die freie Arztwahl und die Therapiehoheit von Arzt und Patient sind für uns wichtige Eckpfeiler unseres Gesundheitssystems. Wir wollen informieren und Angebote machen. Im Bereich der Knie- und Hüftendoprothetik zeigt sich, dass unsere Versicherten das freiwillige Angebot annehmen, sich in Kliniken operieren zu lassen, die wir in einem aufwendigen Verfahren als besonders hochwertig ausgewählt haben und bei denen wir exklusive Services anbieten können wie eine Direktabrechnung oder die durchgängige Betreuung durch Fallmanager. Im Bereich der Depression sind wir noch nicht so weit, aber wir arbeiten daran. Dr. Olaf Karitzki leitet seit 2008 die Abteilung für ambulante Medizin bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Er hat sowohl Betriebswirtschaftslehre als auch Philosophie ­studiert und anschließend mehrere Jahre als Unternehmensberater im Gesundheitswesen gearbeitet. Welche Rolle sollen die Krankenversicherungen künftig bei der Depressionsbehandlung spielen? Wir bei der Allianz Private Krankenversicherung sehen uns als Gesundheitslotse für unsere Versicherten, nicht mehr nur als Kostenerstatter wie früher. Dazu gehören Transparenz und Aufklärung – deshalb geben wir auch diese Broschüre heraus. Wenn das The- 53 Für eine bessere Depressionstherapie – eine Vision 4 Für eine bessere Depressionstherapie – eine Vision von Prof. Florian Holsboer Jede Depression ist eine individuelle Krankheit und sollte deshalb auch individuell behandelt werden. Ein Problem ist so groß wie die Reichweite seiner Wirkung. Lässt es sich isolieren, verliert es häufig an Bedeutung. Es wird kleiner, überschaubarer. Derart gesondert betrachtet, findet sich manchmal auch eine schnelle Lösung. Bei begrenzter Isolierbarkeit gestaltet sich die Bekämpfung des Problems in dem Maße dringlicher, als es gleichzeitig schwieriger ist. Depression ist keine Krankheit, die sich auf einzelne Körperteile des Menschen oder einen speziellen Bereich seines Lebens beschränkt. Sie ist eine der Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit oder Frühberentung. Sie begünstigt die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenzen. Sie verursacht sozialen Rückzug im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und in der Familie. Und am Ende kann sie zu jenem letzten, verhängnisvollen Schritt führen, der sich nicht mehr rückgängig machen lässt: dem Suizid. Bis zum 40. Lebensjahr ist Suizid in Deutschland neben dem Unfalltod die häufigste Todesursache. Und der bei Weitem häufigste Grund für einen Selbstmord ist eine Depression. Welche Kosten die Krankheit in unserer Volkswirtschaft verursacht, zeigen die Berechnungen der Allianz und des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, die diesem Report zugrunde liegen: So belaufen sich die direkten und indirekten Kosten, die durch die Krankheit in Deutschland jährlich verursacht werden, auf bis zu 21,9 Milliarden Euro. (Seite 24) Die tatsächlichen Lasten der Depression sind allerdings um ein Vielfaches 54 größer, da sich die meisten Auswirkungen – etwa das persönliche Leid der betroffenen Familien und Freunde – nicht durch Betrachtung der Kosten erfassen lassen. Im Jahr 2030 wird Depression laut einer Prognose der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Industrienationen die am weitesten verbreitete Krankheit sein. Mit den in diesem Report dargestellten Therapiemöglichkeiten werden gute klinische Ergebnisse erzielt. Doch werden sie der Größe des Problems nur begrenzt gerecht. So weisen trotz vieler Verbesserungen auch die neuen Antidepressiva noch immer die alten Nachteile auf: -Es vergeht zu viel Zeit, bis die gewünschte Wirkung einsetzt. -Die Therapie schlägt längst nicht bei allen Patienten an. -Die Medikamente haben zu viele Nebenwirkungen. Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenkassen, Politiker, Wirtschaft – alle Beteiligten im Gesundheitssystem haben die weitreichenden Folgen der Krankheit zwar längst erkannt. Um die enormen Fortschritte in den klinischen Neurowissenschaften in bessere Behandlungsmöglichkeiten umzusetzen, sind aber gemeinsame Anstrengungen notwendig. Ein Aufwand, der sich lohnen würde. Denn angesichts der bevorstehenden Herausforderungen ist jede Verbesserung der Therapie nicht nur ein Gewinn für die Patienten, sie entlastet auch unser Gesundheitssystem. Ein Beispiel: Bei stationärer und teil- Für eine bessere Depressionstherapie – eine Vision stationärer Behandlung, die Schwerkranken und vor allem suizidgefährdeten Patienten vorbehalten ist, ist die Anzahl der Fälle allein in dem Zeitraum zwischen 2000 und 2008 um 60 Prozent gestiegen. Die Krankheitskosten hierfür betrugen im Jahr 2008 rund drei Milliarden Euro. Gelänge es, den stationären Aufenthalt, der heute im Schnitt etwa 30 Tage dauert, durch eine bessere, auf den Patienten individuell zugeschnittene Therapie nur um zehn Prozent, also um drei Tage, zu verkürzen, ließen sich jedes Jahr rund 300 Millionen Euro einsparen. Abschied von Traditionen „Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen.“ Das berühmte Zitat des Physikers und Nobelpreisträgers Max Planck umschreibt die Idee, auf der auch die moderne Medizin basiert. Die Ursache erkennen und behandeln – gerade in der Depressionstherapie geht dieser Wunsch leider bisher nur bedingt in Erfüllung. Seit Jahrzehnten stützt sich die Depressionsforschung auf drei Erkenntnisse: -Die Depression hat eine hohe Erblichkeit. -Die Mehrzahl der an Depression Erkrankten kann mit Antidepressiva, also mit Medikamenten, trotz der eingangs erwähnten Nachteile erfolgreich behandelt werden. -Die Depression manifestiert sich neben psychischen Symptomen in einer Vielzahl von messbaren Laborbefunden. Die Ursachen der Krankheit sind bis heute aber nicht eindeutig geklärt. Trotzdem wenden wir weiter Antidepressiva oft in Kombination mit weiteren Psychopharmaka an, und der Erfolg gibt uns recht. Als der Wirkstoff Imipramin Ende der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts eingeführt wurde, konnte man die positive Wirkung am Patienten zwar zweifelsfrei dokumentieren, wie das Medikament aber wirkte, wusste man nicht. Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, kennen wir zwar viele pharmakologische Eigen- schaften der Antidepressiva und anderer in der Depressionstherapie eingesetzter Medikamente. Doch welchem der verschiedenen Mechanismen die Wirkung zu verdanken ist, wissen wir noch immer nicht mit Sicherheit. Grund dafür ist nicht etwa der mangelnde Forschungseifer der Neurowissenschaftler. Das menschliche Gehirn besitzt nahezu eine Billion Nervenzellen, von denen jede einzelne etwa 10.000 synaptische Verbindungen mit anderen Nervenzellen bildet. Hinzu kommen die Gliazellen, die noch zahlreicher sind als die Nervenzellen, die sie ernähren und stützen. Damit ist das Gehirn sehr viel komplexer als etwa das Herz oder die Bauchspeicheldrüse und lässt sich dementsprechend schwerer ergründen. Umso wichtiger ist eine umfassende Herangehensweise, die bis heute durch die historisch bedingte Trennung zwischen der Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen behindert wird. Beide Fachgebiete, die Neurologie und die Psychiatrie, widmen sich Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Was sich mit objektiven biologischen Befunden charakterisieren lässt, wird der Neurologie zugeordnet, die restlichen Befunde fallen in den Bereich der Psychiatrie. Doch mit jeder neuen Erkenntnis verlagert sich die Zuständigkeit allmählich in Richtung Neurologie. Bestes Beispiel für diese Entwicklung ist die sogenannte Alzheimersche Krankheit, bei der objektivierbare Befunde in Form der „Plaques“ genannten Ablagerungen im Gehirn existieren. Seit Bekanntwerden dieses Sachverhalts wird diese Krankheit zunehmend in das Fachgebiet der Neurologie integriert. Auch aus der Depressionsforschung ist eine Vielzahl von Befunden hervorgegangen, die uns helfen, das Krankheitsbild nicht nur auf der Grundlage psychischer Symptome, sondern auch durch objektive Testergebnisse aus dem Labor zu charakterisieren. Diese auf Labortests gerichtete Forschung ist deswegen so wichtig, weil wir nur so in die Lage versetzt werden, einheitliche Untergruppen der 55 Für eine bessere Depressionstherapie – eine Vision krankheitsverursachenden Mechanismen zu identifizieren. Es ist nicht zu erwarten, dass wir bestehende diagnostische Klassifikationen psychiatrischer Krankheiten, wie bei der Alzheimer-Demenz, mit Biomarkern bestätigen können. Die naturwissenschaftlich arbeitende psychiatrische Forschung hat schon lange erkannt, dass gegenwärtige Diagnoseschemata für die Kausalforschung untauglich sind. Durch Diagnosen wollen wir Entscheidungshilfen für Therapieauswahl und Hinweise für den Verlauf gewinnen. Beides leisten die heutigen Diagnosen nicht. Die von der amerikanischen Psychiatergesellschaft (APA) empfohlene Vorgehensweise, immer dann eine Depression zu diagnostizieren, wenn fünf der neun in einem von der Gesellschaft herausgegebenen Manual aufgeführten Kriterien erfüllt sind, ist pragmatisch. Diese Vorgehensweise hilft der Administration, für die Ursachenforschung hat sie jedoch keinen Wert. Erst wenn Gentests und Biomarker in den diagnostischen Prozess integriert sind, bekommen Diagnosen einen klinischen Nutzen. Hypothesen zur Entstehung von Depression durch Mechanismen auf neurobiologischer Grundlage haben längst breite Akzeptanz erreicht. Das ist Erfolgen in der Genetik, der Biomarkerforschung, in bildgebenden Verfahren, aber auch in der Elektroenzephalografie, also der Messung der elektrischen Aktivität im Wachzustand oder während des Schlafs, zu verdanken. Eine Vorreiterrolle hat dabei die Neuroendokrinologie eingenommen. Diese Forschungsrichtung befasst sich mit der Steuerung unseres Hormonhaushalts durch das Gehirn und analysiert die Effekte der Hormone auf Befinden und Verhalten. Auch biologische Erkenntnisse bei anderen Erkrankungen wie Manie, Panik, Autismus und Sucht zeigen: Die Unterscheidung zwischen körperlichen und psychischen Mechanismen ist überholt, die strenge Trennung zwischen Psychiatrie und Neurologie ist immer weniger haltbar. Entscheidend wird vielmehr sein, den Erkenntnisgewinn in beiden Disziplinen und in deren gemeinsamer Grundlage, den Neurowissenschaften, voran- 56 zutreiben und zielführend zu verknüpfen. Ein neues Diagnosesystem als Basis für eine bessere Therapie Das Klassifikationssystem für psychiatrische Krankheiten ist ein Verdienst des Psychiaters Emil Kraepelin aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Er etablierte es auf Basis genauer psychopathologischer Querschnittsbefunde und versuchte so auch die Depression erstmals zu normieren und damit wissenschaftlich erfassbar zu machen. Er teilte die Krankheiten meist nach den Symptomen und dem Verlauf ein, biologische Ursachen kannte man für psychiatrische Krankheiten damals nur wenige. Kraepelins Leitgedanken und die seiner Schüler bestimmen bis heute die diagnostischen Systeme, wie sie etwa von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) niedergelegt sind. Doch diese Einteilung wird immer häufiger kontrovers diskutiert. Die Zweiteilung zwischen Schizophrenie und manischdepressiver Krankheit etwa steht infrage, seit in humangenetischen Untersuchungen mehrere nahezu identische Genvarianten sowohl bei Patienten mit Schizophrenie als auch bei Manisch-Depressiven identifiziert wurden. Ebenso fanden sich bei Patienten mit unipolarer Depression die gleichen Genvarianten wie bei denen mit einer bipolaren Depression. Wie wenig sinnvoll es womöglich ist, zwischen unipolarer und bipolarer Depression zu unterscheiden, zeigt auch eine Langzeitstudie des Schweizer Psychiaters Jules Angst, die eine konstante Konversionsrate von unipolar zu bipolar von 1,25 Prozent pro Jahr nachwies – was nichts anderes bedeutet, als dass alle unipolar depressiven Patienten irgendwann bipolar werden, wenn sie nur lange genug leben. Bleibt man bei dem weit gefassten Oberbegriff Depression mit beeinträchtigender depressiver Verstimmung als Leitsymptom, kann die Identifizierung von Genvarianten helfen, Untergruppen zu bilden, die hinsichtlich ihrer genetischen Risikomarker einheit- Für eine bessere Depressionstherapie – eine Vision lich sind. Es zeichnet sich ab, dass es für ein so breit definiertes Krankheitsbild wie das der Depression (oder englisch: Major Depression) keine gemeinsame, bei allen Patienten vorkommende Genvariante, ja nicht einmal eine Kombination aus Genvarianten gibt. (Seite 43) Es darf daher nicht verwundern, dass sich das auch in unterschiedlichen krankheitsverursachenden Mechanismen widerspiegelt, die wir mit Biomarkern identifizieren wollen. Dabei ist wichtig zu erkennen, dass zwei Patienten in Bezug auf ihre psychischen Symptome nicht unterscheidbar sein mögen, obwohl ihrem Leiden ganz verschiedene Kausalmechanismen zugrunde liegen. Bei der Bildung von Untergruppen, die hinsichtlich ihrer Genvarianten sehr ähnlich sind, sollte stets auch ihrer funktionellen Bedeutung nachgegangen werden. Hierbei haben sich vor allem die Untersuchungen der Mausgenetik in Bezug auf die Symptome der Tiere bewährt: Sie gestatten, die Folgen genetischer Veränderungen auf das Verhalten zu untersuchen. Doch die Mausmodelle sind nicht immer direkt auf den Menschen übertragbar. Ergebnisse der tierexperimentellen Forschung müssen daher gut mit Informationen aus anderen Forschungsdisziplinen vernetzt werden. Es wird eine der zentralen Herausforderungen sein, neue Methoden zu entwickeln, die den Zusammenhang von Genen und Symptomen weiter klären. Komplexe Erkrankungen wie Depressionen sind eben nicht in ihrer Gänze zu verstehen, wird nur die Seite der Gene zur Grundlage genommen. Ihre Ausprägungen sind immer auch das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen genetischer Disposition und Umwelteinflüssen. Zu Letzteren zählen Stoffwechselvorgänge im Gehirn, die genetische Dispositionen verstärken oder hemmen können. Mithilfe von Biomarkern lassen sich solche Einflüsse heute bereits identifizieren. Die gewonnenen Erkenntnisse über diese biochemischen Vorgänge müssen mit genetischen und pathologischen Befunden zu einem detaillierteren diagnostischen System zusammengeführt werden, das die Voraussetzung für eine spezifischere und damit wirkungsvollere Therapie sein wird. Personalisierte Depressionstherapie Gelingt es, mithilfe von Gentests und Biomarkern spezifischere homogene Patientengruppen zu definieren, ist das für die Betroffenen allerdings nur dann von Wert, wenn sich daraus auch gezielte Therapien ableiten lassen. Die heutigen Behandlungsmethoden sind unspezifisch, auch wenn sie teilweise Bezeichnungen wie SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor – Selektiver SerotoninWiederaufnahmehemmer) tragen, die eine hohe Spezifizierung suggerieren. So wie ein Internist sogenannte Breitbandantibiotika verabreicht, wenn er das krankheitsverursachende Bakterium nicht kennt, geben wir Antidepressiva, ohne im Einzelfall die Ursache einer Depression zu kennen. Ist der Erreger dem Internisten bekannt, kann der Patient mit einem spezifisch wirkenden Antibiotikum besser behandelt werden. Ähnlich wäre es bei Antidepressiva, wenn die Entstehungsmechanismen einer Depression besser charakterisiert werden könnten. Voraussetzung ist natürlich, dass uns entsprechend spezifische Antidepressiva zur Verfügung stehen. Die heute auf dem Markt erhältlichen Antidepressiva werden pharmakologisch recht einfach klassifiziert: Wir versprechen uns von ihnen klinische Wirkung infolge ihrer Effekte auf die sogenannten biogenen Amine wie Serotonin oder Noradrenalin. Die verschiedenen Antidepressiva besitzen neben ihrer Wirkung auf biogene Amine aber eine Vielzahl anderer pharmakologischer Eigenschaften, die erst neuerdings gut verstanden werden. Diese pharmakologischen Unterschiede bleiben unberücksichtigt bei der Entscheidung, welche Therapie angewendet werden soll. Wir stehen noch am Anfang, Gentests und Biomarker zu verwerten, um herauszufinden, welcher Wirkstoff alleine oder in Kombination im jeweiligen Einzelfall 57 Für eine bessere Depressionstherapie – eine Vision die beste Wirksamkeit bei den geringsten Nebenwirkungen erzielt. Im Prinzip könnten wir durch geeignete Kombination verfügbarer Psychopharmaka bereits Personalisierte Depressionstherapie betreiben. Je spezifischer und damit effizienter wir medikamentös behandeln wollen, desto mehr müssen wir über die Kausalmechanismen Bescheid wissen, auf die unsere Therapie gerichtet ist. Um beim Beispiel der Mikrobiologie zu bleiben: Ein für die Bekämpfung eines bestimmten Bakterium spezifisches Antibiotikum, das gegen einen anderen Erreger verabreicht wird, bleibt wirkungslos. Deshalb wird die personalisierte Depressionstherapie der Zukunft auf eine bessere Analyse der Ursachen und detaillierte Kenntnis der Pharmakologie der eingesetzten Medikamente angewiesen sein. Kritiker der personalisierten Behandlung argumentieren häufig, dass für jeden entdeckten Krankheitsmechanismus auch ein neues Medikament entwickelt werden muss. Das sei nicht bezahlbar. Dem ist entgegenzuhalten, dass die wesentlichen Kostentreiber bei der Medikamentenentwicklung die Wirksamkeitsstudien sind, die etwa 80 Prozent der Entwicklungskosten verschlingen. Die Kosten für diesen Bereich können aber gerade mithilfe der personalisierten Medizin besonders wirksam reduziert werden. Falls nämlich in einer klinischen Studie an Patienten mit dem gleichen krankheitsverursachenden Mechanismus das hierauf gezielt gerichtete Medikament nicht bei einem hohen Prozentsatz der Betroffenen wirkt, ist das Ziel der personalisierten Medizin verfehlt. Eine kleine Stichprobe von etwa 20 bis 50 Patienten reicht daher aus, um eine klare Aussage zu treffen und die Entwicklungskosten drastisch zu senken. Personalisierte Medizin ist in der Depressionstherapie keine Utopie mehr. Ein Beispiel aus dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie: Damit ein Antidepressivum in das Gehirn eindringen kann, muss es die Blutgefäße verlassen und die sogenannte Blut-Hirn-Schran- 58 ke überwinden. Dort befinden sich Eiweißmoleküle, P-Glycoproteine genannt, die verhindern, dass bestimmte Antidepressiva ins Hirngewebe eindringen und dort wirken können. Mithilfe eines Gentests lässt sich heute bereits feststellen, wie leicht oder schwer die verschiedenen Antidepressiva aus der Blutbahn ins Hirngewebe des Patienten eindringen. Dementsprechend kann ein geeignetes Medikament zur Behandlung ausgewählt werden. Ein einfacher Gentest also erlaubt in einem bestimmten Bereich schon heute eine genaue Prognose des Therapieergebnisses. Weitere solche Tests befinden sich in der Entwicklung, und ihre Kombination in der klinischen Anwendung sollte zügig geprüft und etabliert werden. Von der Heilung zur Prävention Wenn es gelungen ist, mithilfe entsprechender Gentests und Biomarker krankheitsverursachende Mechanismen zu identifizieren, und die Patienten entsprechend in homogene Gruppen unterteilt werden, stellt sich schließlich die Frage, ob diese Strategie nicht schon bei der Vorsorge, der Präventionstherapie, genutzt werden kann. Dabei muss man sich bewusst machen, dass bei der überwiegenden Zahl der Leiden Krankheitsprozesse in Gang gekommen sind, lange bevor die ersten Symptome auftreten. So müssen etwa 80 Prozent einer bestimmten Sorte von Nervenzellen versagen, bis die Symptome des Morbus Parkinson für den Patienten spürbar werden. Auch die neurodegenerativen Prozesse bei Morbus Alzheimer entstehen oft über mehr als zehn Jahre, bevor klinische Symptome wie erhöhte Vergesslichkeit zu bemerken sind. Wenn wir also in Zukunft in der Lage sind, mit Gentests und Biomarkern pathologische Mechanismen vor Krankheitsbeginn zu entdecken, sollten wir spezifische Therapien frühzeitig auch zur Prävention nutzen. Denn durch eine solch frühe Intervention können die Krankheiten womöglich verhindert, zumindest aber kann ihr Beginn verzögert werden. Für eine bessere Depressionstherapie – eine Vision Für die Depressionsforschung gilt es daher nun, nach Labortests zu suchen, die ein überdurchschnittlich erhöhtes Krankheitsrisiko anzeigen. Es bleibt dem Einzelnen überlassen, welche Konsequenzen er aus dieser Erkenntnis zieht. Sofern Möglichkeiten zur Frühintervention vorliegen, muss abgewogen werden, ob es nicht richtig wäre, hiervon Gebrauch zu machen, sei es sich selbst, den eigenen Angehörigen zuliebe oder auch aus Verantwortung gegenüber der Solidargemeinschaft, die für die Kosten aufkommt. Die Ausweitung der personalisierten Medizin wird alle im Gesundheitswesen Tätigen noch vor große Herausforderungen stellen. Wir haben gelernt, dass die Politik sich in der Vergangenheit in ihren Entscheidungen kurzfristig von aktuellen Stimmungsbildern in der Bevölkerung abhängig machte. Die pharmazeutische Industrie verhält sich eher risikoscheu und strebt in kleinen Schritten Produktverbesserungen an. Die akademische Forschung ist deshalb gefordert, Verantwortung zu übernehmen, aus der Rolle des um Förderung werbenden Bittstellers herauszutreten und zu belegen, dass die Wissenschaft in der Lage ist, die Ergebnisqualität der Therapie selbst derart komplexer Erkrankungen wie der Depression erfolgreich zu verbessern. Die Wissenschaft wird der Öffentlichkeit zeigen, welche Methoden sie entwickelt, um spezifische Krankheitsmechanismen früh zu erkennen und gezielt zu behandeln. Im Idealfall setzt die Behandlung ein, noch bevor es zu klinischen Symptomen kommt. Die Zukunft der Depressionstherapie ist wie in der gesamten Medizin die auf Gentests und Biomarker gestützte Präventionsmedizin. Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Florian Holsboer ist seit 1989 Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Er studierte Chemie und anschließend Medizin; heute ist er unter anderem HonorarProf. an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Ehrendoktor der Universität Leiden. Im Jahr 2009 erschien sein Buch „Biologie für die Seele“, ein Plädoyer für eine personalisierte Medizin. 59 Ratgeber für Betroffene 5 Ratgeber für Betroffene Beim Verdacht auf Depression gehören Betroffene in die Hände eines Facharztes. Für akute Fälle gibt es in den Universitätskliniken und vielen größeren Krankenhäusern psychiatrische Notfallambulanzen. Ein umfangreiches Verzeichnis von Adressen und Telefonnummern der Krisendienste in Deutschland und verschiedener Hotlines findet man auf der Webseite des Kompetenznetzes Depression unter www.kompetenznetz-depression.de ­unter »Für Betroffene/Hilfe und Selbsthilfe«. Zudem können sich Betroffene oder deren Angehörige an die Psychologischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen, an Psychosoziale Beratungsstellen und Sozialpsychiatrische Dienste vor Ort wenden. Hilfe findet man auch bei der Telefonseelsorge: in Deutschland unter den Telefonnummern 0800/1110111 oder 0800/1110222 und www.telefonseelsorge.org; in Österreich unter der Telefonnummer 142 und unter www.telefonseelsorge.at; in der Schweiz unter der Telefonnummer 143 und unter www.tel-143.ch. Das Kinder- und Jugendtelefon in Deutschland ist wochentags von 15 bis 19 Uhr unter der Nummer 0800/1110333 zu erreichen, in der Schweiz unter der Nummer 147 und www.tel-143.ch. Der Psychotherapie-Informationsdienst unter www.psychotherapiesuche.de vermittelt Kontakte zu qualifizierten Psychotherapeuten in der Nähe. Weitere Informationen, Hilfsangebote sowie Veranstaltungshinweise bieten das Regensburger Bündnis für Depression unter www.buendnis-depression.de oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe unter www.deutsche-depressionshilfe.de an, Kontakt: Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Semmelweisstraße 10, 04103 Leipzig, Tel.: 0341/97-24493, Fax: 0341/97-24599 [email protected]. 60 Hilfreiche Links Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde www.dgppn.de Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie www.dgkjp.de Dachverband Psychosozialer Hilfsverein e.V.; Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker www.bapk.de Deutscher Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie (DVGS) e.V. www.dvgs.de NAKOS – Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen www.nakos.de Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. www.der-paritaetische.de Impressum Impressum Depression – wie die Krankheit unsere Seele belastet Februar 2011 Herausgeber Allianz Deutschland AG Fritz-Schäffer-Straße 9 81737 München www.allianzdeutschland.de RWI Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Hohenzollernstraße 1-3 45128 Essen www.rwi-essen.de Ihre Ansprechpartner Allianz Deutschland AG Ulrich Hartmann Tel: 089/3800-12943 [email protected] RWI Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Presse und Information Joachim Schmidt Tel: 0201/8149-292 [email protected] Druck Lohse Druckgesellschaft, München Fotos istockphoto (Richard Simpkins) Rechtliche Hinweise © Allianz Deutschland AG, 2011 Der Report ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Insbesondere bedarf jede ­Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung des Reports, auch in Auszügen oder in bearbeiteter und übersetzter Fassung, der Zustimmung der Allianz Deutschland AG. 61