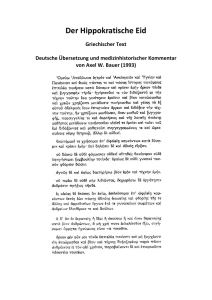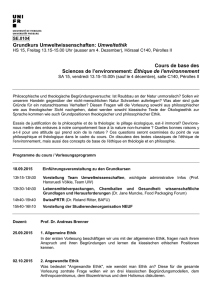Axel W. Bauer (2005): „Realität - Ideal
Werbung
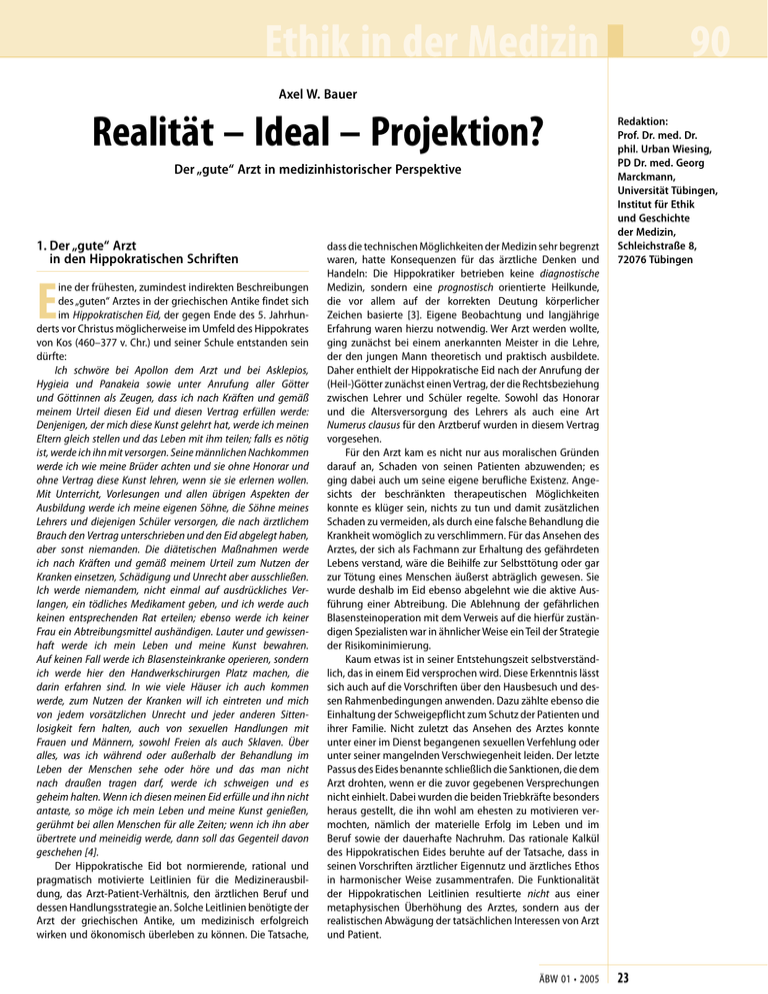
Ethik in der Medizin 90 Axel W. Bauer Realität – Ideal – Projektion? Der „gute“ Arzt in medizinhistorischer Perspektive 1. Der „gute“ Arzt in den Hippokratischen Schriften E ine der frühesten, zumindest indirekten Beschreibungen des „guten“ Arztes in der griechischen Antike findet sich im Hippokratischen Eid, der gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus möglicherweise im Umfeld des Hippokrates von Kos (460–377 v. Chr.) und seiner Schule entstanden sein dürfte: Ich schwöre bei Apollon dem Arzt und bei Asklepios, Hygieia und Panakeia sowie unter Anrufung aller Götter und Göttinnen als Zeugen, dass ich nach Kräften und gemäß meinem Urteil diesen Eid und diesen Vertrag erfüllen werde: Denjenigen, der mich diese Kunst gelehrt hat, werde ich meinen Eltern gleich stellen und das Leben mit ihm teilen; falls es nötig ist, werde ich ihn mit versorgen. Seine männlichen Nachkommen werde ich wie meine Brüder achten und sie ohne Honorar und ohne Vertrag diese Kunst lehren, wenn sie sie erlernen wollen. Mit Unterricht, Vorlesungen und allen übrigen Aspekten der Ausbildung werde ich meine eigenen Söhne, die Söhne meines Lehrers und diejenigen Schüler versorgen, die nach ärztlichem Brauch den Vertrag unterschrieben und den Eid abgelegt haben, aber sonst niemanden. Die diätetischen Maßnahmen werde ich nach Kräften und gemäß meinem Urteil zum Nutzen der Kranken einsetzen, Schädigung und Unrecht aber ausschließen. Ich werde niemandem, nicht einmal auf ausdrückliches Verlangen, ein tödliches Medikament geben, und ich werde auch keinen entsprechenden Rat erteilen; ebenso werde ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel aushändigen. Lauter und gewissenhaft werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Auf keinen Fall werde ich Blasensteinkranke operieren, sondern ich werde hier den Handwerkschirurgen Platz machen, die darin erfahren sind. In wie viele Häuser ich auch kommen werde, zum Nutzen der Kranken will ich eintreten und mich von jedem vorsätzlichen Unrecht und jeder anderen Sittenlosigkeit fern halten, auch von sexuellen Handlungen mit Frauen und Männern, sowohl Freien als auch Sklaven. Über alles, was ich während oder außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen sehe oder höre und das man nicht nach draußen tragen darf, werde ich schweigen und es geheim halten. Wenn ich diesen meinen Eid erfülle und ihn nicht antaste, so möge ich mein Leben und meine Kunst genießen, gerühmt bei allen Menschen für alle Zeiten; wenn ich ihn aber übertrete und meineidig werde, dann soll das Gegenteil davon geschehen [4]. Der Hippokratische Eid bot normierende, rational und pragmatisch motivierte Leitlinien für die Medizinerausbildung, das Arzt-Patient-Verhältnis, den ärztlichen Beruf und dessen Handlungsstrategie an. Solche Leitlinien benötigte der Arzt der griechischen Antike, um medizinisch erfolgreich wirken und ökonomisch überleben zu können. Die Tatsache, dass die technischen Möglichkeiten der Medizin sehr begrenzt waren, hatte Konsequenzen für das ärztliche Denken und Handeln: Die Hippokratiker betrieben keine diagnostische Medizin, sondern eine prognostisch orientierte Heilkunde, die vor allem auf der korrekten Deutung körperlicher Zeichen basierte [3]. Eigene Beobachtung und langjährige Erfahrung waren hierzu notwendig. Wer Arzt werden wollte, ging zunächst bei einem anerkannten Meister in die Lehre, der den jungen Mann theoretisch und praktisch ausbildete. Daher enthielt der Hippokratische Eid nach der Anrufung der (Heil-)Götter zunächst einen Vertrag, der die Rechtsbeziehung zwischen Lehrer und Schüler regelte. Sowohl das Honorar und die Altersversorgung des Lehrers als auch eine Art Numerus clausus für den Arztberuf wurden in diesem Vertrag vorgesehen. Für den Arzt kam es nicht nur aus moralischen Gründen darauf an, Schaden von seinen Patienten abzuwenden; es ging dabei auch um seine eigene berufliche Existenz. Angesichts der beschränkten therapeutischen Möglichkeiten konnte es klüger sein, nichts zu tun und damit zusätzlichen Schaden zu vermeiden, als durch eine falsche Behandlung die Krankheit womöglich zu verschlimmern. Für das Ansehen des Arztes, der sich als Fachmann zur Erhaltung des gefährdeten Lebens verstand, wäre die Beihilfe zur Selbsttötung oder gar zur Tötung eines Menschen äußerst abträglich gewesen. Sie wurde deshalb im Eid ebenso abgelehnt wie die aktive Ausführung einer Abtreibung. Die Ablehnung der gefährlichen Blasensteinoperation mit dem Verweis auf die hierfür zuständigen Spezialisten war in ähnlicher Weise ein Teil der Strategie der Risikominimierung. Kaum etwas ist in seiner Entstehungszeit selbstverständlich, das in einem Eid versprochen wird. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf die Vorschriften über den Hausbesuch und dessen Rahmenbedingungen anwenden. Dazu zählte ebenso die Einhaltung der Schweigepflicht zum Schutz der Patienten und ihrer Familie. Nicht zuletzt das Ansehen des Arztes konnte unter einer im Dienst begangenen sexuellen Verfehlung oder unter seiner mangelnden Verschwiegenheit leiden. Der letzte Passus des Eides benannte schließlich die Sanktionen, die dem Arzt drohten, wenn er die zuvor gegebenen Versprechungen nicht einhielt. Dabei wurden die beiden Triebkräfte besonders heraus gestellt, die ihn wohl am ehesten zu motivieren vermochten, nämlich der materielle Erfolg im Leben und im Beruf sowie der dauerhafte Nachruhm. Das rationale Kalkül des Hippokratischen Eides beruhte auf der Tatsache, dass in seinen Vorschriften ärztlicher Eigennutz und ärztliches Ethos in harmonischer Weise zusammentrafen. Die Funktionalität der Hippokratischen Leitlinien resultierte nicht aus einer metaphysischen Überhöhung des Arztes, sondern aus der realistischen Abwägung der tatsächlichen Interessen von Arzt und Patient. ÄBW 01 • 2005 Redaktion: Prof. Dr. med. Dr. phil. Urban Wiesing, PD Dr. med. Georg Marckmann, Universität Tübingen, Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Schleichstraße 8, 72076 Tübingen 23 Ethik in der Medizin 2. Arztideale von der Frühen Neuzeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts B is ins 18. Jahrhundert bildeten die Aussagen der antiken Ärzte, die im Mittelalter tradiert und kommentiert worden waren, eine wichtige Basis für die Pflichtenlehre der abendländischen Medizin [7]. Doch kamen nun auch neue, wissenschaftstheoretische Überlegungen hinzu. Das Spannungsverhältnis von Spontanheilung und ärztlicher Kunst sah etwa der englische Staatsmann und Wissenschaftstheoretiker Francis Bacon (1561–1626) im Jahre 1623 sehr differenziert: „Wenn fast alle anderen Künste und Wissenschaften nach Vollkommenheit und Verrichtung, nicht aber nach Erfolg oder Mühe beurteilt werden, […] üben der Arzt und vielleicht nur noch der Staatsmann kaum irgendwelche eigentümlichen Wirkungen aus, durch die sie eine Probe ihrer Kunst ablegen, sondern sie ernten Ehre oder Schande hauptsächlich nach dem Erfolg und sind der unbilligsten Beurteilung ausgesetzt. Denn wie wenige Leute wissen, ob es Zufall oder planmäßigem Ratschluss zu danken ist, wenn der Patient gesundet oder stirbt […]. Und so trägt oft der Betrüger die Siegespalme, der Tüchtige den Tadel davon“ [1]. Im Kontrast zur modernen naturwissenschaftlichen Methode, die nur Belege aus einer empirischen Hypothesenprüfung sowie induktiv erschlossene Generalisierungen von einer repräsentativen Stichprobe auf die Grundgesamtheit akzeptiert, erkannte man in der vorexperimentellen Ära als „Beweis“ lediglich deduktiv gewonnene Schlussfolgerungen an. Der „ideale“ wissenschaftliche Arzt argumentierte in der Mitte des 17. Jahrhunderts noch mit den Mitteln der deduktiven Logik, während ihm die besondere Rolle der regelgeleiteten und kritisch evaluierten Erfahrung noch nicht vertraut war. Strategische Gesichtspunkte leiteten die 1718 veröffentlichten Überlegungen des Hallenser Anatomen Georg Daniel Coschwitz (1679–1729) über den ärztlichen Hausbesuch. Coschwitz warnte davor, dass „Ärzte aus übermäßiger Liebe zum Geld, vor allem in den Gegenden, wo die Sitte der Krankenbesuche blüht und das Honorar nach der Zahl der Visiten bezahlt wird, allzu häufig […] die Kranken besuchen […] und gerade dadurch den Kranken […] beschwerlich werden“ [6]. Die angeprangerten Zustände hatten einen realen Hintergrund, gegen den polemisiert wurde. Die Beschreibung des „richtigen“ ärztlichen Verhaltens kann auf diese Weise als kontrastierendes Ideal zur zeitgenössischen Wirklichkeit interpretiert werden. Noch im 17. Jahrhundert wurde vom Arzt eine religiöse Grundhaltung gefordert. Der theologische Einfluss nahm erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts allmählich ab. Im Namen der christlichen Nächstenliebe wurde der Arzt auch zur Hilfe für Randgruppen, für Zahlungsunfähige, Sterbende und Unheilbare aufgefordert. Habgier, Ruhmsucht und Neid auf die Kollegen galten als Kardinalfehler [7]. Vor allem die Vergütung der Ärzte nach Einzelleistungen wurde bereits im 18. Jahrhundert scharf kritisiert. Johann August Unzer (1727–1799) veröffentlichte 1769 in seinem Periodikum „Der Arzt“ mehr oder minder authentische Leserbriefe, die sich dem Thema der Honorierung ärztlicher Leistungen widmeten. So hatte ein gewisser Poltrian Nährlich geschrieben: „Sie und alle Welt sollen über die Unverschämtheit meines Arztes richten. Ich hatte ein wenig Blutspeyen, das in zwey Tagen kaum ein 24 ÄBW 01 • 2005 Eimerchen Blut betrug, welches ich aushustete. Darüber kam er ein Paarmal in der Nacht zugelaufen, weil es mir zu arg wurde, dass ich ihn rufen ließ. Für einen solchen Weg, der doch nur ein Katzensprung ist, setzt er mir einen Reichsthaler an, und läßt sich doch auch seine andern Besuche wie gewöhnlich bezahlen. Ey, wahrhaftig, dies Brodt ist leicht verdient!“. Eine Witwe beklagte sich: „Ist das wohl recht, dass ich für meinen seligen Mann den Doctor bezahlen soll, da er doch gestorben ist, und er ihm nicht geholfen hat? Ich habe es endlich genug, zu bezahlen. Allein ich will doch auch mein Geld nicht auf die Straße werfen. Er hatte die Wassersucht. Dreymal ist ihm das Wasser abgezapft worden, und doch hat alles nichts geholfen“ [15]. Solche Äußerungen lassen Zweifel daran aufkommen, dass die Rollen normierenden Traktate der Gelehrten viel dazu beigetragen hätten, das Ansehen der Ärzte bei den Patienten – ihren Kunden – zu heben. Am Ende seines Lebens als praktizierender Arzt und Hochschullehrer veröffentlichte Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836) ein Vermächtnis seiner langen Berufserfahrung. An den Schluss dieses Werkes stellte Hufeland einen Verhaltenskodex, in dem er die Beziehungen des Arztes zu den Kranken, zur Öffentlichkeit und zu den Kollegen ansprach. Er entwarf ein übersteigertes Arztideal: Leben für Andere, nicht für sich, das sei das Wesen des Arztberufs. Nicht allein Ruhe, Vorteile, Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens, sondern Gesundheit und Leben selbst, Ehre und Ruhm müsse er der Rettung des Lebens und der Gesundheit Anderer aufopfern. Nur ein reiner moralischer Mensch könne Arzt im wahren Sinne des Wortes sein. Hufelands Bild vom Arzt war das des individuell schaffenden Künstlers, der nicht durch „mechanische Geschäftigkeit“, sondern durch das „Aufnehmen des Gegenstandes ins innerste Gemüth“ charakterisiert werde. Jede Kur müsse, wenn sie gut sein solle, nicht etwa nachgeahmt, sondern „neu erfunden“ werden. Hinter dieser Ansicht stand die Auffassung, dass der menschliche Organismus ein zu komplexes Gebilde sei, als dass er durch eine wissenschaftliche Analyse vollkommen erforscht werden könnte [8]. 3. Der Arzt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Naturwissenschaftler und Sozialreformer E twa zehn Jahre nach Hufelands Tod breitete sich die naturwissenschaftliche Methode auch in der deutschen Medizin aus. Für diese Methode trat der junge Berliner Pathologe Rudolf Virchow (1821–1902) erstmals 1847 öffentlich ein. Er beschrieb sie als die experimentelle Überprüfung einer Hypothese, die ein bewusstes Handeln zu einem klar definierten Zweck darstelle [17]. Gegen Ende des Revolutionsjahres 1848 schrieb Virchow mit derselben Überzeugung: „Die Medicin ist eine sociale Wissenschaft, und die Politik ist weiter nichts, als Medicin im Grossen“ [16]. Die fachliche Orientierung der Medizin an den Naturwissenschaften und ihre Ausübung als eine Tätigkeit mit sozialer Verantwortung kennzeichneten erst in ihrer gegenseitigen Verschränkung den reformerischen Impuls, der von Rudolf Virchow ausgehen sollte. Wenn man den Gedanken von der Politik als Medizin im Großen umkehrte, dann konnte man die Medizin als eine Politik im Kleinen interpretieren und daraus zugleich eine neuartige Rolle für den „guten“ Arzt ableiten: Dieser sollte sich Ethik in der Medizin nicht mehr nur auf die Diagnostik und eine wissenschaftlich fundierte Therapie von Krankheiten beschränken, sondern zugleich eine sozialpolitische Aufgabe im Dienst der Patienten und des Staates übernehmen [18]. Virchows politisches Engagement machte den aufstrebenden Wissenschaftler bei der Preußischen Regierung so unbeliebt, dass er 1849 einem Ruf auf den ersten damals in Deutschland bestehenden Lehrstuhl für Pathologische Anatomie an der Universität Würzburg folgte. Dort konzentrierte er seine intellektuellen Kräfte auf die Pathologie, die er als neue Leitdisziplin der naturwissenschaftlichen Medizin formierte. 1855 veröffentlichte er in seinem Archiv einen Aufsatz mit dem Titel Cellular-Pathologie, in dem er die Umrisse eines neuartigen Forschungsparadigmas für die Medizin skizzierte: Das Konzept der Zellularpathologie sah die Zelle als morphologisch wie funktionell kleinste autonome Einheit des gesunden und kranken Lebens an, wodurch Pathologische Anatomie und Pathologische Physiologie einen gemeinsamen Ansatzpunkt erhielten. Als 1858 die Cellularpathologie in monographischer Form erschien, arbeitete Virchow bereits wieder in Berlin, denn 1856 war er Direktor des Pathologischen Instituts der Charité geworden. Zunehmend faszinierte ihn nun wieder die Politik: Seit 1859 war Virchow Berliner Stadtverordneter, 1861 gehörte er zu den Mitbegründern der linksliberalen Deutschen Fortschrittspartei, 1862 wurde er Mitglied des Preußischen Landtages, und von 1880 bis 1893 war er Reichstagsabgeordneter. Sein – unerfüllter – Wunschtraum aber blieb die Konstituierung einer humanen Gesellschaft und einer sozialen Medizin, die auf einer wissenschaftlich fundierten, physiologischen Grundlage entstehen sollte [5]. 4. Arztideale zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus U m die Wende zum 20. Jahrhundert geriet Virchows Ideal des rein naturwissenschaftlich denkenden Arztes in die Kritik. So vertrat der Straßburger Internist Bernhard Naunyn (1839–1925) im Jahre 1900 die Meinung, eine Naturwissenschaft sei die Medizin nicht geworden und werde sie auch schwerlich jemals werden. Dazu sitze ihr die Humanität zu tief im Blut: Der Arzt, der am Krankenbett um das Leben seines Kranken ringe, könne nicht gelassen die Grenze seines Wissens hinnehmen [12]. Im Widerspruch zu diesen Worten stand allerdings eine Überzeugung, die Naunyn 1905 so ausdrückte: „Für mich ist es kein Zweifel, dass das Wort: Die Medizin wird eine Wissenschaft sein, oder sie wird nicht sein auch für die Therapie gelten muss und gilt. […] Mir ist es sonnenklar, dass da, wo die Wissenschaft aufhört, nicht die Kunst anfängt, sondern rohe Empirie und das Handwerk“ [2, 13, 14]. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg gerieten vor allem in Deutschland die geistigen Eliten des Kaiserreichs in eine Sinnkrise, die sie zum Teil auf ihr jeweiliges Arbeitsgebiet projizierten. Häufig reflektiert wurde zu Beginn der 1920er Jahre eine „Krise der Medizin“, die mit einer angeblichen Überbetonung des naturwissenschaftlichen Denkens assoziiert wurde. Auch der Heidelberger Internist Ludolf Krehl (1861– 1937) beschäftigte sich in seinem Lehrbuch Pathologische Physiologie, das 1923 in zwölfter Auflage erschien, mit diesem Thema. „Die Biologie kann“, so meinte Krehl, „für das Verständ- nis der Lebensvorgänge Der Autor mit der Annahme mechanisch-kausaler ZusamProf. Dr. med. Axel W. Bauer menhänge allein nicht studierte Medizin an der Uniauskommen. Sie bedarf versität Freiburg. 1986 habiliweiterer Gedanken. […] tierte er sich an der MediziniMeine Überzeugung ist, schen Fakultät der Universität dass wir eine einheitliche Heidelberg für Geschichte der Auffassung von Mensch, Medizin, 2002 wurde seine Natur und Gott nur wieLehrbefugnis auf die Fächer dergewinnen, wenn wir Geschichte, Theorie und Ethik übermechanische Vorder Medizin erweitert. Seit 1992 ist er Professor am Heigänge, die hinter den Erdelberger Institut für Geschichte der Medizin, seit 2004 scheinungen stecken und zugleich hauptamtlicher Koordinator des Querschnittsbesie leiten, anfangen zu reichs Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der beobachten, zu untersuFakultät für Klinische Medizin Mannheim der Universität chen und in unseren Heidelberg und nebenamtlich Vorsitzender des Klinischen Rechnungen zum Rechte Ethik-Komitees der Klinikum Mannheim gGmbH. In der kommen lassen“ [9]. 14. und 15. Legislaturperiode ist er Mitglied des WissenWas Krehl vernünftischaftlichen Beirates „Bio- und Gentechnologie“ der CDU/ gerweise einforderte, CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages. Zu seinen Forwurde nur zehn Jahre schungsschwerpunkten gehören u. a. die Geschichte der später unter der nationalPathologie, wissenschaftstheoretische Fragen der Medizin sozialistischen Herrschaft sowie ethische Probleme bei der Forschung an menschliin ein mystisch-irrationachen embryonalen Stammzellen, ethische Aspekte der les Arztideal transformiert Therapiebegrenzung in der Intensivmedizin und ethische und pervertiert. Nun chaPrinzipien in der Finanzierung des Gesundheitswesens. rakterisierten einerseits Führerschaft, Priestertum und ethisch-ständisches Denken, andererseits biologistisches Handeln den Arztberuf. So beschrieb 1933 der ehemalige Chirurg Erwin Liek (1878–1935) in seinem Buch Die Welt des Arztes euphorisch den neuen Arzt: „Aus zwei Wurzeln zieht der Arzt seine Kraft: aus der Welt der Erkenntnis, d. h. der Wissenschaft, und aus dem Reich des Irrationalen, des Übersinnlichen. Sind das nicht aber auch die tragenden Gedanken der nationalsozialistischen Weltanschauung? Werden nicht diese Ideen in der Heilkunde unserer Tage Schritt für Schritt durchgesetzt? […] Die Erneuerung der Heilkunde kommt aus dem Geist, nicht aus der Materie. Führer der neuen deutschen Heilkunst wird nicht der Mediziner sein, sondern der Arzt!“ [10]. Wo Ludolf Krehl eine methodische Ergänzung der naturwissenschaftlichen Perspektive gefordert hatte, wucherten nun Spekulation, Mystizismus und autoritärer Führerkult. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 1946/47 während des Nürnberger Ärzteprozesses deutlich, in welchem Ausmaß sich Ärzte während des „Dritten Reiches“ an verbrecherischen Menschenexperimenten vor allem in den Konzentrationslagern beteiligt hatten. Im Urteilsspruch vom 20. August 1947 wurden sieben Angeklagte zum Tode, fünf zu lebenslänglicher Haft und vier zu Zeitstrafen zwischen zehn und zwanzig Jahren verurteilt [11]. Die medizinhistorische Forschung hat seit den 1980er Jahren belegt, dass es weit mehr medizinische NS-Täter insbesondere im Bereich der Sterilisationsoperationen und bei der Beteiligung an den staatlich inszenierten Euthanasie-Morden gab, als man sich dies in der unmittelbaren Nachkriegszeit eingestehen wollte. Diese Verbrechen waren trotz jener zahllosen normativen Beschreibungen des „guten“ Arztes aus den vergangenen zweieinhalb Jahrtausenden verübt worden. ÄBW 01 • 2005 25 Ethik in der Medizin 5. Der „gute“ Arzt der Gegenwart zwischen Gelöbnissen, Deklarationen und Richtlinien Anschrift des Autors Prof. Dr. med. habil. Axel W. Bauer Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Institut für Geschichte der Medizin Universitätsklinikum Heidelberg Im Neuenheimer Feld 327 69120 Heidelberg E-Mail: [email protected] I n Kenntnis der NS-Medizinverbrechen schwand während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Vorstellung, dass sich der „gute“ Arzt in Zukunft noch an den traditionellen normativen Texten würde orientieren können, die zwar oftmals klug formuliert waren, die aber letzten Endes unverbindlich blieben. An ihre Stelle traten nun international verbindliche Dokumente wie das Genfer Ärztegelöbnis (1948) oder die Deklaration von Helsinki (1964), die seither etliche Male überarbeitet und den aktuellen Bedürfnissen angepasst wurden. In den vergangenen Jahren kamen weitere internationale Abkommen zur Medizin- und Bioethik hinzu, so vor allem das Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin (1996) des Europarates und die EU-Biopatentrichtlinie (1998). Auf nationaler Ebene sind neben einschlägigen Gesetzen des Medizinrechts seit den 1990er Jahren zahlreiche Richtlinien, Grundsätze und Empfehlungen der Bundesärztekammer zu aktuellen Themen wie Sterbebegleitung, Hirntodfeststellung, Pränataldiagnostik oder assistierte Reproduktion erlassen worden. Alle diese Dokumente beschreiben den „guten“ Arzt nicht mehr in überkommenen ethischen Kategorien, sondern sie normieren sein Verhalten in präzisen juristischen Termini, die notfalls auch einer gerichtlichen Nachprüfung vom Zivilrecht über das Strafrecht bis hin zum Verfassungsrecht Stand halten sollen. In der globalisierten Welt gibt es kaum noch die Chance zur Formulierung und Durchsetzung einer einheitlichen und für alle Menschen in allen Ländern verbindlichen Moral. An die Stelle früherer umfassender ethischer Verhaltensnormen, die auf einer gemeinsamen Werteordnung beruhten, ist heute die Abfassung konkreter positiv-rechtlicher Gesetze und Richtlinien getreten, die nicht mehr den „guten“ Arzt beschreiben wollen, sondern deren Ziel darin besteht, punktuelle Lösungen für spezifische Problemlagen zu liefern. Als minimale gemeinsame Wertebasis muss dabei das Grundgesetz und seine gültige Interpretation durch das Bundesverfassungsgericht ausreichen. Diese Normierungen setzen also nicht mehr ein anspruchsvolles, homogenes Welt- und Menschenbild voraus, vielmehr begnügen sie sich mit dem Vertrauen auf die Durchsetzungskraft des modernen Rechtsstaates. Der „gute“ Arzt verfügt am Beginn des 21. Jahrhunderts über ein umfangreiches Reservoir an offiziellen Leit- und Richtlinien, das ihm äußerlich eine gewisse professionelle Sicherheit gewährt. Doch das externe rechtsethische Stützkorsett kann ihn nicht vor den inneren Konflikten im Hinblick auf sein ärztliches Selbstverständnis bewahren. Der Arzt der Gegenwart fühlt sich als Akteur im Gesundheitswesen zwischen Patienten, Kollegen, Krankenversicherungen und Politik oftmals tief verunsichert. Vielleicht sind es aber gerade diese Unsicherheit und diese Suche nach neuer Identität, die den heutigen Arzt und die heutige Ärztin nach langen historischen Phasen oftmals falscher Sicherheiten zu einem besseren Arzt und zu einer besseren Ärztin machen können. 26 ÄBW 01 • 2005 Literatur 1 Bacon von Verulam, Francis: Über die Medizin. Ins Deutsche übertragen aus: De dignitate et augmentis scientiarum (1623), Buch IV Kapitel II, von E. Wallach. Sudhoffs Archiv 1926; 18: 112–129. 2 Bauer, Axel: Naturwissenschaftliche Medizin der Jahrhundertwende. Fiktion und Realität um 1900. Deutsche Medizinische Wochenschrift 1989; 114: 1676–1679. 3 Bauer, Axel W.: Die Allgemeine Semiotik als methodisches Instrument in der Medizingeschichte. Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 1994; 12: 75–89. 4 Bauer, Axel W.: Der Hippokratische Eid. Medizinhistorische Neuinterpretation eines (un)bekannten Textes im Kontext der Professionalisierung des griechischen Arztes. Zeitschrift für medizinische Ethik 1995; 41: 141–148. 5 Bauer, Axel W.: Die Medizin ist für Rudolf Virchow immer eine soziale Wissenschaft gewesen. Vor 175 Jahren wurde der Mann geboren, der in Deutschland die Pathologie etabliert hat. Ärzte-Zeitung Nr. 183 vom 11./12. Oktober 1996: 22. 6 Coschwitz, Georg Daniel: Requisita medico ad praxin felicem summa necessaria. Halle 1718. 7 Elkeles, Barbara: Aussagen zu ärztlichen Leitwerten, Pflichten und Verhaltensweisen in berufsvorbereitender Literatur der Frühen Neuzeit. Medizinische Dissertation, Medizinische Hochschule Hannover 1979. 8 Hufeland, Christoph Wilhelm: Enchiridion medicum oder Anleitung zur medizinischen Praxis. Vermächtnis einer funfzigjährigen Erfahrung. 5. Auflage (VII. Abdruck). Berlin 1839. 9 Krehl, Ludolf: Pathologische Physiologie und Arzt. In: Krehl, Ludolf: Pathologische Physiologie. 12. Auflage. Leipzig 1923: 697–706. 10 Liek, Erwin: Die Welt des Arztes. Aus 30 Jahren Praxis. Dresden 1933. 11 Mitscherlich, Alexander und Mielke, Fred (Hrsg.): Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Frankfurt am Main 1978. 12 Naunyn, Bernhard: Die Entwicklung der Inneren Medicin mit Hygiene und Bakteriologie im 19. Jahrhundert. In: Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 72. Versammlung zu Aachen. 16.–22. September 1900. Erster Theil. Leipzig 1901: 59–70. 13 Naunyn, Bernhard: Ärzte und Laien (1905). In: Gesammelte Abhandlungen von Prof. Dr. B. Naunyn, 2. Würzburg 1909: 1327–1355. 14 Pfohl, Gerhard: Und Naunyn hat‘s doch gesagt. Die Medizinische Welt 1987; 38: 597–600. 15 Unzer, Johann August: Von den Belohnungen der Ärzte. (55. Stück). In: Unzer, Johann August: Der Arzt. Eine medicinische Wochenschrift. Zweyter Band. Hamburg, Lüneburg, Leipzig 1769: 30–42. 16 Virchow, Rudolf: Der Armenarzt. In: Die medicinische Reform. Eine Wochenschrift, herausgegeben von Rudolf Virchow und Rudolf Leubuscher. Nr. 18 vom 3. November 1848. Reprint Berlin (DDR) 1983: 125–127. 17 Virchow, Rudolf: Die naturwissenschaftliche Methode und die Standpunkte in der Therapie. (Gelesen bei der Jahressitzung der Gesellschaft für wissenschaftliche Medicin zu Berlin am 20. Decbr. 1847.) Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin 1849; 2: 3–37. 18 Virchow, Rudolf: Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin 1849; 2: 143–322.