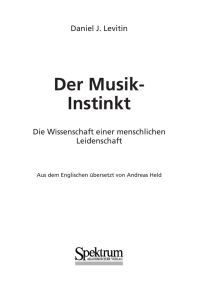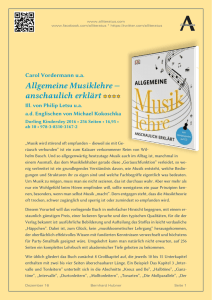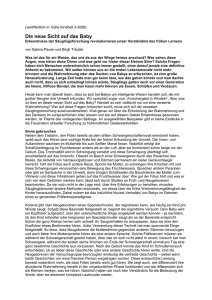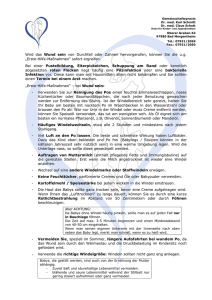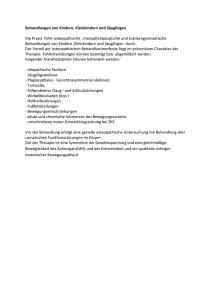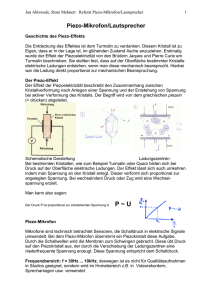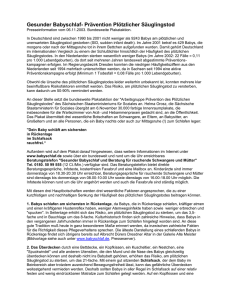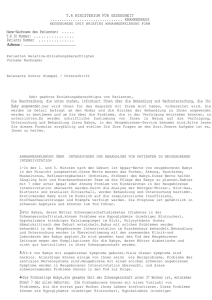Der Musik- Instinkt - beck
Werbung

Daniel J. Levitin Der MusikInstinkt Die Wissenschaft einer menschlichen Leidenschaft Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Held Titel der Originalausgabe: This is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Held Copyright © Daniel J. Levitin, 2006 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Dutton, a member of Penguin Group (USA) Inc. Wichtiger Hinweis für den Benutzer Der Verlag, der Herausgeber und die Autoren haben alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen in diesem Buch zu publizieren. Der Verlag übernimmt weder Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen, für deren Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen bestimmten Zweck. Der Verlag übernimmt keine Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren, Programme usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag hat sich bemüht, sämtliche Rechteinhaber von Abbildungen zu ermitteln. Sollte dem Verlag gegenüber dennoch der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar gezahlt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Springer ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media springer.de © Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 2009 Spektrum Akademischer Verlag ist ein Imprint von Springer 09 10 11 12 13 5 4 3 2 1 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Planung und Lektorat: Frank Wigger, Dr. Meike Barth Redaktion: Martina Wiese Herstellung und Satz: Crest Premedia Solutions (P) Ltd, Pune, Maharashtra, India Umschlaggestaltung: wsp design Werbeagentur GmbH, Heidelberg Titelbild: Fotalia ISBN 978-3-8274-2078-7 Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Was ist Musik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mit den Füßen wippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Hinter den Kulissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Vorausschauendes Hören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 You Know My Name, Look Up the Number . . . . . 159 »Sehen Sie sich die Verbindungen an!« . . . . . . . . 209 Was macht einen Musiker aus? . . . . . . . . . . . . . . . 243 Meine Lieblingslieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Der Musik-Instinkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Anhang A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Anhang B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Literatur mit Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Danksagung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 8 Meine Lieblingslieder Warum mögen wir bestimmte Musiken? Man erwacht aus dem Tiefschlaf und öffnet die Augen. Es ist dunkel. Das entfernte regelmäßige Klopfen am Rande des Hörvermögens ist immer noch zu vernehmen. Man reibt sich die Augen, kann aber weder irgendwelche Umrisse noch Formen ausmachen. Die Zeit vergeht, aber wie lange? Eine halbe Stunde? Eine Stunde? Dann hört man ein anderes, deutlich wahrnehmbares Geräusch – einen amorphen, vibrierenden Klang mit einem schnell schlagenden Pochen, das man in den Füßen spüren kann. Das Geräusch beginnt und stoppt undefiniert. Es baut sich allmählich auf und schwächt sich wieder ab, beides geht ohne eindeutigen Beginn und Ende ineinander über. Diese vertrauten Geräusche sind beruhigend – man hat sie früher schon gehört. Wenn man sie wahrnimmt, hat man eine vage Vorstellung davon, was als Nächstes kommen wird, und das kommt tatsächlich, selbst wenn die Geräusche entfernt und vernebelt bleiben, als würde man sie unter Wasser hören. Bereits in der Gebärmutter, umgeben von Fruchtwasser, hört der Fetus Geräusche. Er hört den Herzschlag seiner Mutter, der sich ab und an beschleunigt, ein anderes Mal wieder verlangsamt. Und der Fetus hört Musik, wie Alexandra 284 Der Musik-Instinkt Lamont von der Keele University in Großbritannien unlängst festgestellt hat. Wie sie herausfand, erkennen und bevorzugen Kinder ein Jahr nach ihrer Geburt Musik, die sie bereits im Mutterleib wahrgenommen haben. Etwa 20 Wochen nach der Befruchtung ist das Gehör des Fetus voll funktionsfähig. In Lamonts Experiment spielten Mütter ihren Babys während der letzten drei Monate der Schwangerschaft immer wieder das gleiche Musikstück vor. Natürlich hörten die Babys – durch das Fruchtwasser in der Gebärmutter gefiltert – auch all die anderen Geräusche im täglichen Leben ihrer Mütter, darunter weitere Musikstücke, Unterhaltungen und Geräusche aus der Umwelt. Für jedes Baby wurde jedoch ein bestimmtes Musikstück ausgewählt, das ihm regelmäßig vorgespielt wurde. Zu den ausgewählten Stücken zählten sowohl Klassik (Mozart, Vivaldi), Hits aus den Top 40 (Five, Backstreet Boys), Reggae (UB40, Ken Boothe) und Weltmusik (Spirits of Nature). Nach der Geburt durften die Mütter ihren Kindern das ausgewählte Stück nicht mehr vorspielen. Erst ein Jahr später spielte Lamont den Babys wieder die Musik vor, die sie bereits im Mutterleib gehört hatten, zusammen mit einem weiteren Musikstück in gleichem Stil und Tempo. So präsentierte man einem Baby, welches das Reggaestück Many Rivers to Cross von UB40 gehört hatte, ein Jahr später erneut dieses Stück und dazu Stop Loving You von dem Reggaeinterpreten Freddie McGregor. Dabei registrierte Lamont jeweils, welches der Stücke die Babys bevorzugten. Wie lässt sich feststellen, welchen von zwei Reizen ein Kind bevorzugt, das noch nicht sprechen kann? Die meisten Wissenschaftler, die sich mit solchen Säuglingen befassen, verwenden dazu eine bestimmte Technik, das sogenannte „konditionierte Hinwenden des Kopfes“, das in den 1960erJahren von Robert Fantz entwickelt und später von John Columbo, Anne Fernald, dem verstorbenen Peter Jusczyk und 8 Meine Lieblingslieder 285 ihren Mitarbeitern verfeinert wurde. Dazu werden im Labor zwei Lautsprecher aufgestellt und das Kind wird zwischen die beiden Lautsprecher gesetzt (in der Regel auf den Schoß seiner Mutter). Schaut das Kind zu einem der Lautsprecher, beginnt dieser eine Musik oder irgendein anderes Geräusch zu spielen; schaut es zu dem anderen Lautsprecher, kommt daraus eine andere Musik oder ein anderes Geräusch. Das Kind lernt schnell, dass es durch seine Blickrichtung steuern kann, was gespielt wird. Es lernt also, dass es die Bedingungen des Versuchs unter Kontrolle hat. Die Versuchsleiter achten darauf, dass die verschiedenen Reize in einem ausgeglichenen Verhältnis (nach dem Zufallsprinzip) aus den beiden Lautsprechern kommen: Zur Hälfte ertönt der untersuchte Reiz aus dem einen Lautsprecher und zur Hälfte aus dem anderen. Als Lamont dieses Experiment mit den Säuglingen durchführte, stellte sie fest, dass diese tendenziell länger zu dem Lautsprecher hinschauten, aus dem die Musik erklang, die sie bereits im Mutterleib gehört hatten. Dies bestätigte, dass sie die Musik bevorzugten, die sie bereits vor der Geburt kennengelernt hatten. Eine Kontrollgruppe von Einjährigen, die keines der beiden Musikstücke schon einmal gehört hatten, zeigte keine Präferenz – damit stand fest, dass nicht irgendeine Eigenschaft der Musik selbst dieses Resultat bewirkt hatte. Weiterhin fand Lamont heraus, dass die Säuglinge unter ansonsten gleichen Bedingungen schnelle, fröhliche Musik lieber hörten als langsame. Diese Ergebnisse widersprechen der lange vorherrschenden Theorie der infantilen Amnesie – dass man erst ab einem Alter von etwa fünf Jahren wahrheitsgetreue Erinnerungen haben kann. Viele Menschen behaupten, Erinnerungen an ihre frühe Kindheit im Alter von zwei bis drei Jahren zu besitzen. Allerdings ist nur schwer festzustellen, ob es sich dabei um echte Erinnerungen an das Originalereignis handelt oder 286 Der Musik-Instinkt vielmehr um Erinnerungen an das, was eine andere Person später über dieses Ereignis erzählt hat. Das Gehirn von Kleinkindern ist noch unentwickelt, seine funktionelle Spezialisierung noch nicht abgeschlossen, und die Nervenbahnen sind noch im Aufbau begriffen. Der Geist des Kindes versucht in möglichst kurzer Zeit so viel Information wie möglich aufzunehmen. Verständnis, Bewusstsein oder Gedächtnis des Kindes für Ereignisse weisen normalerweise noch große Lücken auf, denn es hat noch nicht gelernt, wichtige Ereignisse von unwichtigen zu unterscheiden oder Erlebnisse systematisch zu codieren. Damit ist ein Kleinkind prädestiniert für Suggestion und könnte unbewusst Geschichten, die ihm über sich selbst erzählt werden, als seine eigenen Erinnerungen abspeichern. Was jedoch Musik angeht, werden anscheinend selbst vorgeburtliche Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert und können auch ohne Sprache oder explizites Bewusstsein der Erinnerung abgerufen werden. Vor einigen Jahren gelangte eine Studie in die Schlagzeilen der Zeitungen und die morgendlichen Talkshows, der zufolge es intelligenter macht, wenn man täglich zehn Minuten lang Mozart hört (der sogenannte „Mozart-Effekt“). Das Hören von Musik könne, so wurde behauptet, die Leistung bei unmittelbar nach dem Hören erteilten Aufgaben zum räumlichen Vorstellungsvermögen verbessern (einige Journalisten dachten, dies würde auch mathematische Fähigkeiten einschließen). Mitglieder des amerikanischen Kongresses verabschiedeten Resolutionen, und der Gouverneur von Georgia bewilligte Gelder zum Kauf einer Mozart-CD für jedes neugeborene Baby in Georgia. Die meisten Wissenschaftler fühlten sich nicht ganz wohl in ihrer Haut. Zwar gehen wir intuitiv davon aus, dass Musik andere kognitive Fähigkeiten verbessern kann, und würden es alle begrüßen, wenn die Regierung den Musikunterricht an den Schulen finanziell unterstützen 8 Meine Lieblingslieder 287 würde; die betreffende Studie, die diese Behauptung aufstellte, enthielt jedoch zahlreiche wissenschaftliche Mängel. Sie stellte einige richtige Behauptungen auf, aber die Begründung war fehlerhaft. Ich persönlich fand das ganze Tamtam etwas abstoßend, weil es implizierte, dass man sich nicht mit Musik um ihrer selbst willen beschäftigen sollte, sondern nur dann, wenn sie dazu beitrug, dass man bei anderen, „wichtigeren“ Dingen bessere Leistungen erzielte. Stellen Sie sich vor, wie absurd es klänge, wenn man den Spieß umdrehen würde. Wenn ich behauptete, Mathematik zu lernen, verbessere die musikalischen Fähigkeiten – würden Politiker deswegen die Mathematik mit Finanzspritzen fördern? In staatlichen Schulen wird Musik oftmals stiefmütterlich behandelt und bei finanziellen Engpässen als erstes Fach geopfert. Häufig wird versucht, Musik aufgrund ihrer positiven Begleiterscheinungen zu rechtfertigen, anstatt ihre Daseinsberechtigung darin zu sehen, dass sie an sich ein Gewinn ist. Das Problem bei der „Musik macht intelligenter“-Studie lag auf der Hand: Die Kontrollen bei den Experimenten waren unzureichend. Wie Nachforschungen von Bill Thompson, Glenn Schellenberg und anderen ergaben, waren die geringfügigen Unterschiede im räumlichen Vorstellungsvermögen zwischen den beiden Gruppen allein durch die Auswahl der Kontrollaufgaben bedingt. Verglichen damit, einfach nur in einem Raum zu sitzen und nichts zu tun, schnitt Musikhören recht gut ab. Erhielten die Versuchspersonen der Kontrollgruppe jedoch auch nur eine leichte geistige Anregung – etwa durch Lesen oder das Hören eines Hörbuches –, war Musikhören nicht mehr von Vorteil. Als weiterer Mangel der Studie erwies sich, dass kein plausibler Mechanismus für diesen funktionellen Zusammenhang vorgeschlagen wurde: Wie könnte das Hören von Musik die Leistungen bei räumlichen Aufgaben verbessern? 288 Der Musik-Instinkt Glenn Schellenberg hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, kurzfristige Effekte von Musik von langfristigen zu unterscheiden. Der Mozart-Effekt bezog sich auf einen unmittelbaren Nutzen; andere Forschungen haben jedoch tatsächlich bestätigt, dass sich musikalische Aktivitäten auch langfristig auswirken. Durch das Hören von Musik werden bestimmte neuronale Schaltkreise verändert oder ausgebaut. Unter anderem ist davon die Dichte der dendritischen Verbindungen in der primären Hörrinde betroffen. Wie der Neurowissenschaftler Gottfried Schlaug von der Harvard University gezeigt hat, ist der vordere Teil des Corpus callosum – der auch als Balken bezeichneten Masse aus Nervenfasern, welche die beiden Großhirnhemisphären miteinander verbindet – bei Musikern signifikant größer als bei Nichtmusikern, und zwar insbesondere bei Musikern, die bereits früh mit der musikalischen Ausbildung begonnen haben. Dies spricht dafür, dass die Verarbeitung von Musik mit zunehmender Übung immer stärker auf beide Gehirnhälften verteilt wird, denn Musiker rufen neuronale Strukturen aus der linken und der rechten Hemisphäre ab und koordinieren sie. In mehreren Studien ließen sich nach dem Erwerb motorischer Fähigkeiten, wie sie sich beispielsweise Musiker aneignen, mikrostrukturelle Veränderungen im Kleinhirn nachweisen, darunter eine größere Zahl und Dichte von Synapsen. Schlaug zufolge besaßen Musiker zumeist ein größeres Kleinhirn als Nichtmusiker sowie eine erhöhte Konzentration grauer Substanz. Die graue Substanz ist jener Teil des Gehirns, der die Zellkörper, Axone und Dendriten enthält und in dem vermutlich die Informationsverarbeitung erfolgt; die weiße Substanz hingegen ist für die Übertragung von Informationen zuständig. Ob diese strukturellen Veränderungen im Gehirn auch die Fähigkeiten auf nichtmusikalischen Gebieten verbessern, 8 Meine Lieblingslieder 289 ist bislang noch nicht bestätigt. Nachgewiesen ist allerdings, dass sich durch Musikhören und Musiktherapie eine ganze Reihe von psychischen und physischen Problemen überwinden lassen. Aber kommen wir zu einem fruchtbareren Forschungsgegenstand, dem Musikgeschmack, zurück … Lamonts Ergebnisse sind insofern von Bedeutung, als sie beweisen, dass das Gehirn bereits vor und kurz nach der Geburt Erinnerungen speichern und diese noch nach langer Zeit abrufen kann. Konkreter zeigen diese Ergebnisse, dass die Umwelt – selbst wenn sie durch das Fruchtwasser und die Gebärmutter gedämpft wird – die Entwicklung und Vorlieben eines Kindes beeinflussen kann. Der Boden für musikalische Vorlieben wird also bereits im Mutterleib bereitet. Das kann aber noch nicht alles sein, denn sonst würden Kinder sich einfach nur zu der Musik hingezogen fühlen, die ihren Müttern gefällt oder die in Geburtsvorbereitungskursen gespielt wird. Man kann sagen, dass die musikalischen Vorlieben durch das in der Gebärmutter Gehörte beeinflusst, aber nicht festgelegt werden. Hinzu kommt eine längere Phase der kulturellen Anpassung, während der das Kleinkind die Musik der Kultur aufnimmt, in die es hineingeboren wurde. Vor einigen Jahren tauchten Berichte auf, nach denen Kleinkinder, bevor sie sich an die Musik einer (für uns) fremden Kultur gewöhnen, ungeachtet ihrer Kultur oder Rassenzugehörigkeit westliche Musik anderer Musik vorziehen. Diese Ergebnisse wurden jedoch nicht bestätigt; vielmehr stellte man fest, dass Kleinkinder lieber Konsonanzen als Dissonanzen hören. Dissonanzen lernt man erst später im Leben zu schätzen, wobei der Grad an Dissonanz, den verschiedene Menschen tolerieren, variiert. Das hat wahrscheinlich neuronale Gründe. Konsonante und dissonante Intervalle werden in der Hörrinde über unterschiedliche Mechanismen verarbeitet. Kürzlich hat man die 290 Der Musik-Instinkt elektrophysiologischen Reaktionen von Menschen und Affen auf wahrgenommene Dissonanzen untersucht (also auf Akkorde, die aufgrund ihres Frequenzverhältnisses dissonant klingen, nicht wegen des harmonischen oder musikalischen Kontextes). Dabei zeigte sich, dass Neuronen in der primären Hörrinde – der ersten Ebene der cortikalen Verarbeitung von Tönen – ihre Feuerungsraten bei dissonanten Akkorden synchronisieren, nicht jedoch bei konsonanten Akkorden. Warum das eine Vorliebe für Konsonanz hervorruft, ist allerdings noch nicht klar. Über die Hörwelt von Kleinkindern ist einiges bekannt. Die Ohren von Kindern sind zwar schon vier Monate vor der Geburt voll funktionsfähig, das sich entwickelnde Gehirn braucht jedoch Monate oder Jahre, um die vollständige Verarbeitungsfähigkeit für akustische Reize zu erlangen. Säuglinge erkennen Transpositionen von Tonhöhe und Zeit (Tempoveränderungen). Das lässt darauf schließen, dass sie zu relationaler Verarbeitung imstande sind – was selbst die fortschrittlichsten Computer immer noch nicht besonders gut beherrschen. Jenny Saffran von der University of Wisconsin und Laurel Trainor von der McMaster University haben Belege dafür zusammengetragen, dass Säuglinge auch auf die absolute Tonhöhe achten können, wenn eine Aufgabe dies erfordert. Das deutet auf eine zuvor nicht bekannte kognitive Flexibilität hin: Schon ganz kleine Kinder können je nach Bedarf verschiedene Verarbeitungsmethoden anwenden – die vermutlich über unterschiedliche neuronale Verschaltungen ablaufen. Wie Trehub, Dowling und andere gezeigt haben, ist die Melodielinie für Babys die hervorstechendste musikalische Eigenschaft; sie können Ähnlichkeiten und Unterschiede selbst nach 30 Sekunden Retentionszeit feststellen. Erinnern wir uns, dass man als Melodielinie oder Kontur den Verlauf der 8 Meine Lieblingslieder 291 Tonhöhen einer Melodie bezeichnet – das Auf und Ab der Melodie –, wobei die Größe der Intervalle keine Rolle spielt. Achtet jemand ausschließlich auf die Melodielinie, so codiert er beispielsweise nur, dass die Melodie nach oben führt, aber nicht, wie weit. Die Sensitivität von Säuglingen für die Melodielinie ähnelt der Sensitivität für die Satzmelodie, die zum Beispiel Fragen von Ausrufen unterscheidet und unter den linguistischen Oberbegriff der Prosodie fällt. Fernald und Trehub haben dokumentiert, dass Eltern mit Säuglingen anders sprechen als mit älteren Kindern und Erwachsenen, und zwar in allen Kulturen. Sie sprechen langsamer, mit einem erweiterten Tonhöhenspektrum und in einer insgesamt höheren Tonlage. Mütter (in geringerem Maße auch Väter) tun dies praktisch von Natur aus, ohne spezielle Anleitung; Wissenschaftler bezeichnen diese übertriebene Betonung als Ammen- oder Babysprache oder auch als Mutterisch. Unserer Ansicht nach hilft die Ammensprache, die Aufmerksamkeit des Babys auf die Stimme der Mutter zu richten und die Wörter eines Satzes voneinander zu unterscheiden. Statt wie zu einem Erwachsenen zu sagen: „Das ist ein Ball“, würde man in der Ammensprache etwa sagen: „WAS ist das?“ (mit Betonung auf dem Fragewort). „Ist das ein BAAALLL?“ (mit stärkeren Tonhöhenschwankungen und einem deutlichen Anstieg am Ende von Ball ). Oft signalisiert die Satzmelodie bei solchen Äußerungen besonders deutlich, ob die Mutter eine Frage stellt oder eine Aussage macht; durch Übertreibung der Unterschiede zwischen einer ansteigenden und einer abfallenden Satzmelodie lenkt die Mutter die Aufmerksamkeit darauf. Sie erzeugt im Grunde einen Prototyp für eine Frage und einen Prototyp für eine Aussage, die leicht zu unterscheiden sind. Schimpft die Mutter, so erzeugt sie von Natur aus – ebenfalls ohne spezielle Anleitung – eine dritte prototypische Form der Äußerung, kurz und knapp, ohne große Variationen 292 Der Musik-Instinkt der Tonhöhe: „Nein!“ (Pause) „Nein! Bah!“ (Pause) „Ich sagte, nein!“ Die Babys besitzen offenbar eine angeborene Fähigkeit, die Satzmelodie zu registrieren und, bevorzugt über bestimmte Tonhöhenintervalle hinweg, zu verfolgen. Zudem können Kleinkinder, wie Trehub zeigte, konsonante Intervalle wie die reine Quarte und die reine Quinte besser codieren als dissonante wie den Tritonus. Trehub zufolge erleichtern es die ungleichen Schritte unserer Tonleiter, bereits in früher Kindheit Intervalle zu verarbeiten. Zusammen mit ihren Mitarbeitern spielte sie neun Monate alten Säuglingen die reguläre, aus sieben Tönen bestehende Dur-Tonleiter sowie zwei von ihr selbst erfundene Tonleitern vor. Bei einer dieser erfundenen Tonleitern unterteilte sie die Oktave in elf gleich große Schritte und wählte dann sieben Töne aus, die sie mit ein oder zwei Schritten Abstand einfügte. Bei der anderen Tonleiter unterteilte sie die Oktave in sieben gleich große Schritte. Die Aufgabe für die Kinder lautete, einen falschen Ton herauszufinden. Erwachsene schnitten bei der Dur-Tonleiter gut ab, bei den beiden künstlichen, noch nie zuvor gehörten Tonleitern jedoch schlecht. Die Babys hingegen erzielten bei beiden Tonleitern mit ungleichen Tonabständen gute Ergebnisse, bei der Tonleiter mit regelmäßigen Abständen jedoch deutlich schlechtere. Aufgrund früherer Arbeiten geht man davon aus, dass neun Monate alte Säuglinge noch kein geistiges Schema für die Dur-Tonleiter verinnerlicht haben. Somit legen Trehubs Ergebnisse nahe, dass ungleiche Schritte, wie sie auch bei der Dur-Tonleiter vorkommen, ganz allgemein leichter zu verarbeiten sind. Es sieht, mit anderen Worten, so aus, als hätten sich das menschliche Gehirn und die gängigen musikalischen Tonleitern in Koevolution entwickelt. Die seltsame, unregelmäßige Anordnung der Töne der Dur-Tonleiter ist kein Zufall: Melodien mit dieser Anordnung, die sich aus der Physik der