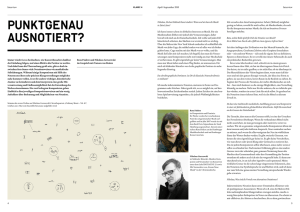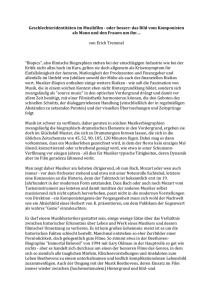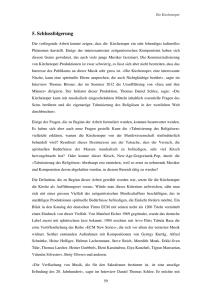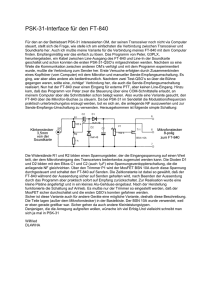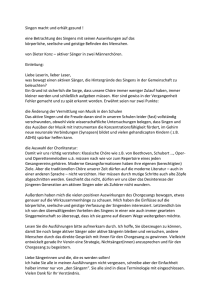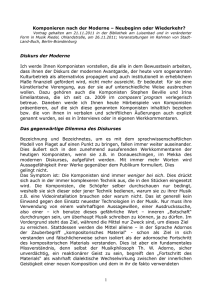full text pdf
Werbung

Reinmar Emans Wechselspiele: Auftraggeber – Komponist – Spieler – Sänger – Publikum und das musikalische Werk* Was Sie gerade eben gehört haben,1 ist – trotz aller deutlichen Unterschiede – unzweifelhaft das gleiche Stück. Ob es sich auch um das gleiche Werk oder ob es sich aufgrund der im Vermittlungsbereich veränderten Bedingungen vielmehr gar um zwei Werke handelt, muß vielleicht an dieser Stelle nicht zwingend diskutiert werden.2 Der edierte Notentext, auf den beide Aufnahmen zurückgehen, ist jedenfalls identisch;3 die Komposition als solche liegt in einer den Bachschen Originalquellen kritisch folgenden Edition vor. Die Unterschiede der Einspielungen liegen also primär in der Interpretation des letztlich als authentisch angesehenen Notentextes. Sekundär (oder ist dies vielleicht gar das Primäre?) resultieren die Unterschiede aber auch ganz einfach daraus, daß die Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeiten entstanden und mithin die stets zeitgebundene Interpretation dadurch bereits verändert ist. Oder liegt es vielmehr daran, daß sowohl Sänger als auch Instrumentalisten jeweils andere sind? Die Eigenschaften des Aufnahmeraums könnten ebenfalls manche Veränderungen bewirkt haben. Berücksichtigt werden müßte zudem, daß die Tonmeister eine unterschiedliche Klangphilosophie auf diesen Platten verwirklicht haben können; zusätzlich wäre zu bedenken, ob die beiden Labels unterschiedliche Käufergruppen ins Visier genommen haben. Zuletzt könnte sich der Rezipient auch die Frage stellen, ob die hörbar geringere Besetzung und das schnellere Tempo in der letzten der beiden Aufnahmen schlicht darum gewählt wurden, um Kosten zu sparen und die Gewinnspanne beim Verkauf zu vergrößern – in diesem Fall sicherlich eine haltlose Unterstellung. Natürlich verändert sich durch die unterschiedlichen Voraussetzungen beider Aufnahmen der eigentliche Notentext an sich nicht, lediglich die Ergebnisse. Auch Vortrag, gehalten auf der Tagung „Produktion und Kontext“ der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition in Den Haag (4. – 7. 3. 1998) 1 Als Klangbeispiel wurde Satz 10 aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147) von Johann Sebastian Bach in zwei unterschiedlichen Aufnahmen vorangestellt: 1. Frankfurter Kantorei, Bach-Collegium Stuttgart unter der Leitung von Helmuth Rilling (laudate 98863), 2. The Bach Ensemble unter Leitung von Joshua Rifkin (L’Oiseau-Lyre 455706-2). 2 Zu den prominenten Vertretern für die These, das Werk werde zu einem solchen erst in der Ausführung – hier allerdings auf das Schauspiel bezogen –, zählt Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Tübingen 41975, S. 110–112. Zu Umfeld und Diskussion des Werkbegriffs siehe Walter Wiora: Das musikalische Kunstwerk. Tutzingen 1983. 3 Joshua Rifkin hat sich allerdings darüberhinaus auch die Originalquellen angesehen. * editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 2 Reinmar Emans auf der Ebene der Werkgenese dürften ganz ähnliche Kalkulationen der Machbarkeit unter den damals vorherrschenden Bedingungen dazu geführt haben, daß Bach diesen Satz so und nicht anders komponiert hat. Er kannte den Zeitpunkt für die Aufführung und wußte, mit welchen Sängern und Spielern er zu rechnen hatte. Entsprechend dürfte er deren Fähigkeiten mit ins Kalkül gezogen haben, als er diesen Satz schrieb. Möglicherweise mußte er auch mitunter Kostenfaktoren in seiner Planung berücksichtigen. Immerhin konnten seine allsonntäglichen Kantatenaufführungen oft nur dadurch zustande kommen, daß auch Studenten und Stadtpfeifer verpflichtet wurden; zumindest für die ersteren wiederum entstanden Kosten, die je nach Finanzsituation der Stadt minimiert werden mußten. Inwieweit die unterschiedlichen akustischen Verhältnisse der beiden Hauptkirchen Leipzigs, in denen Werke Bachs aufgeführt wurden, Auswirkungen auf das Werkkonzept hatten, ist eine offene Frage.4 Ohnehin dürfte es in der Regel unmöglich sein, die obengenannten Faktoren aus dem durch die autographe Partitur repräsentierten ,Werk‘ selbst zu rekonstruieren. Sie gehören unmittelbar zur Werkkonzeption und dessen Disposition, die in der Regel nicht schriftlich fixiert wurden. Gleichwohl lassen sich zumindest exemplarisch Belege dafür finden, daß die Komponisten sehr wohl die genannten Kontexte berücksichtigten, zumindest dann, wenn ihnen an einer Aufführung ihrer Kompositionen gelegen war. Berücksichtigung des Aufführungsortes Joseph Haydn antwortete 1787 auf eine Anfrage aus Prag: Sie verlangen eine Opera buffa von mir, recht herzlich gern, [...]. Aber um sie auf dem Theater zu Prag aufzuführen, kann ich Ihnen dießfalls nicht dienen, weil alle meine Opern zu viel auf unser Personale (zu Eszterház in Ungarn) gebunden sind, und außerdem nie die Wirkung hervorbringen würden, die ich nach der Lokalität berechnet habe. Ganz was anders wäre es, wenn ich das unschätzbare Glück hätte, ein ganz neues Buch für das dasige Theater zu komponiren [...].5 Daß Haydn bei seiner am 6. 12. 1779 uraufgeführten Oper L’Isola disabitata auf prächtige Bühnenbilder und opulente Handlungsstränge verzichtete, hatte seinen Grund in dem einen Monat zuvor erfolgten Brand des Esterhazyschen Opernhauses. Behelfsmäßig mußte man sich mit Aufführungen im Marionettentheater beVgl. hierzu Armin Schneiderheinze: Zu den aufführungspraktischen Bedingungen in der Thomaskirche zur Amtszeit Bachs. In: Beiträge zur Bachforschung 6. Leipzig 1988, S. 82–91. Schneiderheinze belegt hier, daß die Raumakustik der Thomaskirche so beschaffen war, daß sie durchaus auch mit kleinen Besetzungen zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat, und zudem, daß die Akustik ein relativ schnelles Aufführungstempo ermöglichte. 5 Undatiertes Brieffragment (wohl Dezember 1787) an den Oberverpflegs-Verwalter Franz Rott in Prag. Zitiert nach: Joseph Haydn. Gesammelte Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. von Dénes Bartha. Kassel, Basel usw. 1965, S. 185. 4 editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 3 Wechselspiele gnügen. Derartige Belege zur Berücksichtigung der Topographie des Aufführungsortes sind eher selten. Doch steht beispielsweise außer Zweifel, daß für die Entstehung und Ausbreitung der Doppel-und Mehrchörigkeit im 16. Jahrhundert nicht nur grundlegende musikalische Erwägungen, sondern auch die engen Emporen von Santa Maria Maggiore in Bergamo und San Marco in Venedig verantwortlich waren. Ebenso leitete sich die Verwendung von Blechblasinstrumenten bei Aufführungen im Freien eher von den akustischen Voraussetzungen bzw. Problemen ab als von künstlerischen Entscheidungen. Sängerpersonal Besser belegbar sind strategische Vorentscheidungen, die durch die Auswahl des Sängerpersonals vorgegeben waren. Hier waren vom Komponisten Stimmambitus, Virtuosität und besondere Vorlieben ebenso zu berücksichtigen wie eine adäquate Rollencharakterisierung. So einleuchtend diese Vorentscheidungen im einzelnen sein mögen, von besonderer Relevanz und nachträglicher Erkennbarkeit sind sie in der Regel nur dann, wenn der jeweilige Sänger einen besonderen Stimmambitus aufweist, den die Komposition auch wirklich füllt, wie dies beispielsweise in der Baßpartie für Francesco de Carli in Händels Agrippina durch das tiefe C belegt ist.6 Ebenso steht die für das 17. Jahrhundert ganz ungewöhnlich virtuose Baßbaritonpartie in Antonio Sartorios 1672 in Venedig uraufgeführten Oper Orfeo nachweislich im Zusammenhang mit Nicola Gratianini, einem Sänger, der wie Sartorio selbst im Dienst von Herzog Johann Friedrich in Hannover stand.7 Derartige, ganz speziell auf einen bestimmten Sänger zugeschnittene Partien hatten freilich den Nachteil, daß sie nicht ohne weiteres in einem anderen kontextuellen Zusammenhang wieder verwendet werden konnten. Vor gewisse Rätsel gestellt sieht man sich bei den sehr anspruchsvollen Vokalpartien in Johann Sebastian Bachs Kantaten, da von ihm gleichzeitig Zeugnisse überliefert sind, in denen er über die unzureichenden Fähigkeiten seiner Sänger und Instrumentalisten Klage führt. Auf der anderen Seite lassen Umarbeitungen erkennen, daß auch er sich sehr wohl den Möglichkeiten der Ausführenden hat beugen müssen. So weist die ursprüngliche Fassung von Kantate BWV 194 aus dem Jahre 1723 in den Baßrezitativen einen sehr großen Ambitus vor allem in der Höhe auf. Als die Kantate 1724 erneut aufgeführt wurde, stand offenbar nicht mehr der gleiche Sänger zur Verfügung, die hohen Töne lagen außerhalb des vom neuen Sänger produzierbaren Tonvorrats und mußten vermieAuf die ausgeprägte Idiomatik der Partie des Claudius verweist Winton Dean: Humour with Human Commitment. Handel’s „Agrippina“. Booklet zu Philips 438 009-2 (1997), S. 22 bzw. 29f. 7 Vgl. hierzu Reinmar Emans: Die beiden Fassungen von Antonio Sartorios Oper L’Adelaide unter besonderer Berücksichtigung des in Hannover verwahrten Autographs. In: Il melodramma italiano in Italia e in Germania nell’etá barocca. Atti del V Convegno internazionale sulla musica italiana nel secolo XVII. Como 1995, S. 57–79. 6 editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 4 Reinmar Emans den werden; die dadurch erforderlichen Änderungen in der Stimme wurden allerdings nicht ganz konsequent durchgeführt, so daß einzelne der Spitzentöne stehen blieben. Ob nun der Sänger versuchte, diese Töne trotz aller offenkundiger Probleme so, wie sie da standen, zu singen, oder ob er seinem Ambitus gemäß die Spitzentöne eine Oktave tiefer intonierte, muß genauso offen bleiben wie die Ausführung zahlreicher vorgeschriebener Töne in den Bachschen Kantaten, die auf den jeweiligen Instrumenten nicht spielbar waren. Auf der anderen Seite könnte es genauso im Kalkül des Komponisten gelegen haben, eine sängerische Partie eben nicht auf einen bestimmten Sänger zuzuschneiden und dadurch die Möglichkeiten einer Wiederaufführung an einem anderen Ort zu vergrößern. Und in der Tat zeigt sich eine derartige Differenzierung im Konzeptionellen bereits im gewissen Rahmen bei der Überlieferung der Werke. Allgemeiner verwendbare und damit in aller Regel auch technisch weniger anspruchsvolle Kompositionen wurden bis ins 19. Jahrhundert hinein eher gedruckt als virtuose, die mit einem komplizierten Aufführungsapparat rechneten. Instrumentalisten Zusätzlich zu den oben bereits erwähnten kontextuellen Bedingtheiten wird eine Komposition auch determiniert von den Möglichkeiten der einzelnen Instrumente. Es ist ja nicht nur so, daß manche Instrumente gewisse Tonarten fordern, da sie sonst nicht in vollem Umfang einsetzbar sind, sondern auch ihr Tonvorrat ist häufig recht begrenzt. Jeder Komponist, der seine Instrumentalpartie idiomatisch auf die Möglichkeiten des jeweiligen Instruments einrichtete, lief entsprechend Gefahr, daß seine Komposition nicht überall oder zumindest nicht ohne einschneidende Veränderungen aufgeführt werden konnte. Daß die Bachrenaissance im 19. Jahrhundert hinsichtlich der Vokalmusik so zögerlich verlaufen ist, lag eben nicht zuletzt daran, daß man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr alle verlangten Instrumente zur Verfügung hatte (wie z. B. die Oboe d’amore); man mußte sich im wahrsten Sinne des Wortes zu „behelfen“ wissen. Aber auch Wiederaufführungen eines Werkes noch unter Bach selbst bereiteten u. U. Probleme. Der in einigen BachKantaten verwendete Flauto piccolo beispielsweise stand Bach offenbar bei manchen Wiederaufführungen nicht mehr zur Verfügung;8 daher mußte entweder der gesamte Satz vollkommen neu konzipiert werden, oder aber der fehlende Flauto piccolo wurde durch ein anderes Instrument besetzt, was je nach neuer Instrumentenwahl nur eine mehr oder weniger geringe Umdisposition zur Folge hatte. 8 Vgl. beispielsweise Neue Bach-Ausgabe I/11.2. Kritischer Bericht. Kassel, Leipzig 1989, S. 55f. editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 5 Wechselspiele Die Überlieferungssituation musikalischer Texte Der musikalische Text bot und bietet immer wieder zahlreiche Ansätze, um nach den Schreibstrategien des jeweiligen Komponisten zu fragen. Entsprechende Anmerkungen in den Kritischen Berichten der Gesamtausgabe beziehen sich in der Regel auf den Einzelfall und werden – sicherlich zu Recht – als der Werkgenese zugehörig behandelt. Eine zusammenfassende Diskussion und Einordnung der unterschiedlichen Auffälligkeiten jedoch findet zumeist nicht statt. Gewisse Probleme bereitet im Vorfeld allerdings auch schon die musikalische Überlieferung eines Werkes, die zugleich aber auch den Blick auf unser Problemfeld weiten kann. Normalerweise nämlich liegt uns – zumindest im Idealfall – die vom Komponisten geschriebene Partitur vor, deren Korrekturen bereits manche Interpretationen hinsichtlich einer kontextuellen Gebundenheit signalisieren können. Wenn Bach beispielsweise im sechsten Satz seiner Kantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67, zunächst in seiner Partitur neun Takte mit der Besetzungsgabe „Violino“, die offenbar sofort zu „Corno“ geändert wurde, eintrug,9 dann scheint die Frage berechtigt, warum Bach diese neun Takte ersatzlos tilgte und für den gesamten Satz auf das „Corno“ verzichtete. Immerhin hatte der Corno-Spieler bereits in den Sätzen 1 und 4 und zudem noch in Satz 7 überaus schwere Aufgaben zu bewältigen, die ihn an die Grenzen der physischen Belastbarkeit geführt haben dürften, so daß seine Mitwirkung auch in Satz 6 vielleicht den Zusammenbruch des Spielers und mithin der gesamten Aufführung bewirkt hätte. Gewiß, derartige allein aus der autographen Kompositionspartitur gewonnene Überlegungen können nicht viel mehr sein als Hypothesen zu Werkgenese und -konzeption von mehr oder weniger großer Plausibilität. Genauer rücken derartige kontextuelle Gegebenheiten in den Blick durch den Umstand, daß die Partitur im Grunde nur zur Aufzeichnung des musikalisch Allernötigsten geschrieben wurde und eine Aufführung des Werkes erst durch die Herstellung eines Stimmensatzes ermöglicht wurde, in dem meist genauere Handlungsanweisungen für die Interpreten gegeben wurden. Derartige originale Stimmensätze wurden zwar oft nicht vom Komponisten selbst, sondern von Schülern oder auch Berufskopisten geschrieben, meist aber läßt sich voraussetzen, daß der Komponist die Stimmen revidierte und daß mithin Abweichungen von Partitur und Stimmen durch den Komponisten legitimiert sind. So konnte es nicht nur passieren, daß einzelne Notenkorrekturen erst im Stimmensatz Eingang fanden, sondern auch, daß kurzfristig einzelne Instrumente nachkomponiert wurden, deren Partien in der Partitur noch nicht enthalten waren – mutmaßlich, weil mit dem Einsatz dieses Instrumentalisten erst nach Fertigstellen der Partitur zu rechnen war. So zeigt beispielsweise die Stim9 Vgl. Neue Bach-Ausgabe I/11.1. Kritischer Bericht. Kassel, Leipzig 1989, S. 23, sowie Alfred Dürr: Zur Bach-Kantate „Halt im Gedächtnis Jesum Christ“ BWV 67. Zuletzt gedruckt in Alfred Dürr: Im Mittelpunkt Bach. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Hrsg. vom Kollegium des Johann-Sebastian-Bach-Instituts Göttingen. Kassel usw. 1988, S. 244–247. editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 6 Reinmar Emans me für Traversflöte zu der oben genannten Kantate, wie Bach im Zeitraum zwischen Partiturniederschrift und Ausschreiben der Stimmen die Besetzungskonzeption noch änderte: Für den ersten Satz der Kantate war in der Partitur die Mitwirkung eines Traversspielers zunächst noch nicht vorgesehen.10 Bach beauftragte einen seiner fähigeren Schüler und Kopisten, Johann Andreas Kuhnau, damit, eine geeignete Stimme aus den Parts von Violino I, Oboe d’amore I und Tenore zu kompilieren. Und auch der zweite Satz war ursprünglich ohne die Mitwirkung des Traversspielers konzipiert. Diesen Satz trug nun Bach selbst in die Stimme ein, obwohl der Notentext identisch ist mit dem Part von Oboe d’amore I. Erklungen ist die Komposition entsprechend mit Traversflöte – welche Bedeutung aber kommt dann der autographen Partitur für eine Edition zu? Nur selten freilich dürfte das Aufführungsmaterial alles das mitteilen, was die Sänger und Instrumentalisten bei der Aufführung gemacht haben. Dies liegt vor allem daran, daß bis in das 19. Jahrhundert hinein und verstärkt auch wieder in unserem Jahrhundert die Notentexte dem Aufführenden zahlreiche Freiheiten ließen.11 Die Fixierung der Musik in Form eines Notentextes erfolgte in der Regel im Hinblick auf den Vortrag, durch den die niedergeschriebene Musik erst zur Realität wird – ganz ähnlich im übrigen wie ein Kochrezept erst durch mehr oder weniger genaues Befolgen der darin enthaltenen Handlungsanweisungen zu einem kulinarischen Genuß führen kann. Die regulative Idee der Identität eines musikalischen (wie auch kulinarischen) Werkes ist nicht primär angestrebt (Carl Dahlhaus),12 was sich letztlich für das Musikstück ja auch schon in der Aufsplitterung von Partitur und Aufführungsstimmen zeigt. Zu einer Konkretisierung findet das Werk nicht durch die Partitur, sondern durch die Stimmen. Eine derartige Aufspaltung erleichterte zudem die zielgerichtete Einrichtung der Musik für eine konkrete Gegebenheit, für eine ganz bestimmte Aufführung. Dabei konnten die in der Zeit als selbstverständlich vorauszusetzenden Konventionen unfixiert und dem Aufführenden überlassen bleiben. Hierzu gehörten durch Improvisationen auszufüllende Verzierungen oder Kadenzen ebenso wie die akkordische Auffüllung der BassoContinuo-Stimme, die sich geradezu durch die improvisatorischen Freiräume definierte. Die angestrebte Einzigartigkeit des Kunstwerkes verdankte sich der einzelnen, so nicht wiederholbaren Aufführung, bei der Veränderungen des Werkes einkalkuliert waren. Eine Normierung erfuhren derartige Aufführungen allenfalls durch Aufführungstraditionen und diverse auf die Vortragskunst zugeschnittene Lehrwerke, die jedoch wiederum nicht nur zeitgebunden, sondern auch regional zu unterschiedlichen Ergebnissen führen mußten. Erst mit dem Aufkommen der Neue Bach-Ausgabe I/11.1. Kritischer Bericht. Kassel, Leipzig 1989, S. 30 und 42f. Einen Extremfall bieten John Cage’s Handlungsanweisungen zu Europeras 3, nach denen die sechs Sänger ihre Arien aus Opern des 18. und 19. Jahrhunderts selbst aussuchen sollen, damit sie diese auch wirklich gerne und überzeugend singen. 12 Vgl. hierzu auch das musiksoziologische Schrifttum, etwa Christian Kaden: Musiksoziologie. Berlin 1984, etwa S. 83 oder S. 106ff. 10 11 editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 7 Wechselspiele Genieästhetik versuchte man bewußt, dieser Aufführungstradition entgegenzuwirken: zum einen dadurch, daß man verstärkt die aufführungspraktischen Dimensionen in das jeweilige Notat einzubinden versuchte und zum integralen Bestandteil des Notentextes machte, zum anderen dadurch, daß in manchen musikalischen Bereichen wieder – wie auch schon gut 150 Jahre zuvor – die Personalunion von Komponist und Interpret angestrebt wurde. Zumindest aber sollte der Interpret in der Lage sein, sich in die Gefühlssituation des Komponisten hineinzuversetzen. Daß dabei die für das ausgehende 18. Jahrhundert beliebte Gattung der Klavierfantasie wiederum in scheinbarer Tradition das eigentlich Unfixierbare in den Vordergrund rückte, sei lediglich am Rande vermerkt. Derartige auktoriale Reproduktionsvorschriften führten jedoch nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen, wie dies besonders deutlich der Fall Max Reger zeigt. Dessen Notentexte waren derart mit Vortragsanweisungen gespickt, daß aus ihnen im Grunde neue Probleme sowohl des interpretatorischen Verständnisses als auch der klanglichen Umsetzung resultieren mußten. In einem gewissen Widerspruch zu einer derartig akribischen Festlegung auch des Akzidentellen steht Regers Bearbeitungstechnik, die, wie Susanne Shigihara13 und Rainer Cadenbach14 gezeigt haben, mitunter scheinbar beliebig und ohne Berücksichtigung zusammenhängender Strukturen vorgenommen wurde. Die Anregung von Karl Straube, die Vertonung des 100. Psalms doch etwas zu kürzen, wurde von Reger insofern befolgt, als daß er geradezu trotzig einfach zwei Seiten strich und mit der wohl an Straube adressierten lakonischen Bemerkung versah: „Siehst Du nun?“15 Aber nicht nur Aufführungen unterlagen einem historischen Wandel, sondern manchmal auch die auktoriale Aufführungstradition. Bei der Aufführung des Beethovenschen Quintetts op. 16 im Jahre 1816 folgte der Beethovenschüler Carl Czerny der Aufführungstradition, die zur Zeit der Werkentstehung vorausgesetzt werden mußte. Die daraus resultierenden improvisatorischen Zusätze durch die Interpreten aber entsprachen zwar vielleicht der Werkfaktur des 20 Jahre zuvor entstandenen Quintetts, nicht aber der offenkundig gewandelten Intention des darauf nun mit scharfer Kritik reagierenden Komponisten.16 Das Bewußtsein, daß nicht Susanne Shigihara: Zum Problem der Streichungen in den Reinschrift-Autographen Max Regers. In: Reger-Studien 3. Analysen und Quellenstudien. Hrsg. von Susanne Popp und Susanne Shigihara. Wiesbaden 1988 (Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts. Bd. IV), S. 201–226, sowie dies.: Plädoyer für ein Monstrum. Zur Rezeption von Regers Violinkonzert A-Dur op. 101. In: Beiträge zur Geschichte des Konzerts. Festschrift Siegfried Kross zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Reinmar Emans und Matthias Wendt. Bonn 1990, S. 331–342. 14 Rainer Cadenbach: Konzept und Prozeß. Zur Spannung zwischen Werkbegriff und Werkerstellung bei Max Reger. In: Vom Einfall zum Kunstwerk. Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Hermann Danuser und Günter Katzenberger. Laaber 1993 (Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Bd. 4), S. 103–137. 15 Siehe hierzu Cadenbach 1993, vgl. Anm. 14, S. 129. 16 Vgl. hierzu Eva Badura-Skoda: Performance Conventions in Beethoven’s Early Works. In: Beethoven, Performers, and Critics. The International Beethoven Congress Detroit 1977. Hrsg. von Robert Winter und Bruce Carr. Detroit 1980, S. 61ff. 13 editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 8 Reinmar Emans alles, ja vielleicht gerade das musikalisch Wesentliche trotz aller Bemühungen nicht bezeichnet werden konnte, dürfte Mahler zu seinem Apercu „das Beste der Musik steht nicht in den Noten“ verleitet haben. Im gleichen Tenor äußerte sich Franz Liszt in der Vorrede zu einer Symphonischen Dichtung auf einen Text Victor Hugos (Ce qu’on entend sur la montagne): Obschon ich bemüht war, durch genaue Anzeichnungen meine Intentionen zu verdeutlichen, so verhehle ich doch nicht, daß Manches, ja sogar das Wesentlichste, sich nicht zu Papier bringen läßt, und nur durch das künstlerische Vermögen, durch sympathisch schwungvolles Reproduzieren, sowohl des Dirigenten als der Aufführenden, zur durchgreifenden Wirkung gelangen kann. Dem Wohlwollen meiner Kunstgenossen sei es daher überlassen, das Meiste und Vorzüglichste an meinen Werken zu vollbringen.17 Ausschlaggebend für diese beinahe resignative Haltung des großen Klaviervirtuosen dürfte die Erkenntnis gewesen sein, daß seine virtuose Überzeugungskraft nicht unwesentlich daraus resultierte, daß er sich als ausübender Musiker spontan und zum Teil improvisatorisch auf die jeweilige Aufführungssituation und das Publikum einstellen konnte und mußte. Eine adäquate Reproduzierbarkeit durch einen anderen Künstler setzt eben die gleiche Flexibilität voraus, eine Flexibilität, die im Notentext selbst wiederum keine Spuren hinterläßt. Proben und Uraufführung als Kontrollinstanzen des Machbaren Obwohl man bei den Komponisten eine ziemlich genaue Klangvorstellung voraussetzen kann, war die Uraufführung eines Werkes stets nicht nur Prüfstein, sondern auch Regulans der musikalischen Machbarkeit. Dies zeigen nicht nur die Aufführungsmaterialien, in denen – oft von den ausführenden Musikern – Korrekturen angebracht worden sind, die als Reaktionen auf die Proben oder aber auch auf die Uraufführung zu deuten sind. Zumindest in Einzelfällen übersteigt die in Noten mitgeteilte Klangvorstellung des Komponisten die Fähigkeiten des Instruments bzw. des Instrumentalisten, wie beispielsweise in Richard Wagners Walküre. Bei der Probe habe Wagner – laut Richard Strauss – auf die Bemerkung des Harfenisten, seine Stimme des Feuerzaubers sei unspielbar, geantwortet: „Ich bin kein Harfenist. Sie sehen doch, was ich haben will. Ihre Aufgabe ist es, die Stimme so einzurichten, daß es klingt, wie ich es mir vorstelle.“18 Das Moment der Unspielbarkeit wurde in der Vergangenheit – man denke nur an Bach und Beethoven – wohl häufig ad hoc behoben. Immer dann, wenn eine Drucklegung oder weitere Aufführungen erfolgen sollten, forderte der Verleger bzw. der Veranstalter die Spielbarkeit ein. Auch im 20. Jahrhundert mußte sich ein Bernd Alois ZimmerZitiert nach Musikalische Interpretation. Hrsg. von Hermann Danuser. Laaber 1992 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 11), S. 38. 18 Zitiert nach Ulrich Siegeles Artikel: Vortrag. In: Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 14. Kassel usw. 1968, Sp. 21. 17 editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 9 Wechselspiele mann derartigen Forderungen beugen, da er ansonsten hätte befürchten müssen, daß seine Oper Die Soldaten nicht wieder aufgeführt worden wäre, weil die Musiker und die Veranstalter sowohl die technischen Anforderungen als auch die Koordinationsprobleme scheuten. Er selbst wies in einem Brief vom 10. 11. 1965 auf die durch die Umarbeiten erfolgten Erleichterungen hin: Die Hauptschwierigkeit ist in der revidierten Fassung beseitigt: es ist alles unter die guten, Ordnung stiftenden und soliden, geraden Taktstriche gebracht worden. Solange unsere Orchestermusiker nicht gelernt haben, in absoluten Tempi zu denken, und es sieht nicht so aus, als ob man ihnen das auf unseren Musikhochschulen beibringen will: auch in Zukunft nicht – solange bleibt dem einsichtigen Komponisten nichts anderes zu tun übrig, als gewissermaßen eine aufführungspraktische Ausgabe seines Opus herzustellen.19 Auf die Relevanz der Probenerfahrung verwies in jüngster Zeit aufs deutlichste Alfred Koerppen, der den Interpreten als Partner des Autors anerkennt und ihm zugleich größte Autorität zuweist: Die Musiker, die mein Stück üben und proben, haben die intimste Kenntnis der Musik, sie beschäftigen sich am längsten mit ihr, sehr viel gründlicher, als Publikum und Kritik dies tun, die freilich, unterm Eindruck der ersten Begegnung und mit dem Vorteil des frischen Blicks auch eine gewisse, andere Kompetenz haben [...]. Die Interpreten, die sich um das Werk bemühen [...] haben mein Ohr, und ihr Urteil interessiert mich.20 Insofern ist es ausgesprochen plausibel, daß Koerppen gerne an der Tradition festhält, für die Uraufführung das Manuskript zugrundezulegen, das dann, nach diesen Erfahrungen, erst zum Druck gegeben wird. Auf diese Weise lassen sich ohne Probleme noch Änderungen und Korrekturen durchführen. Auftraggeber Anders als beim literarischen Werk, für das ein Auftraggeber bereits inhaltliche Vorstellungen geltend machen kann,21 beziehen sich Vorgaben beim musikalischen Zitiert nach Wulf Konold: Bernd Alois Zimmermann. In: Vom Einfall zum Kunstwerk. Der Kompositionsprozeß der Musik des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Hermann Danuser und Günter Katzenberger. Laaber 1993 (Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Bd. 4), S. 300. 20 Alfred Koerppen: Enthusiasmus und Kalkül. In: Vom Einfall zum Kunstwerk. Der Kompositionsprozeß der Musik des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Hermann Danuser und Günter Katzenberger. Laaber 1993 (Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Bd. 4), S. 392. 21 Man denke nur beispielsweise an die Vorgaben, die Johann Christoph Gottsched indirekt gemacht bekam, als er für den Hof zu Weißenfels 1733 ein Libretto schreiben wollte: „Zuförderst wollte ich zu einiger Nachricht melden, dass Ser. nicht gerne das Wort Wonne und die Reime, so sich auf Sachsen, Wachsen, Achsen endigen, haben mögen, ob[wohl] die beyden nämlichen Sachsen und Wachsen, ausser damit zu reimen, mit einfliessen können.“ (Zitiert nach Arno Werner: Städtische und fürstliche Musikpflege in Weissenfels bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig 1911, S. 143.) So jedenfalls informierte der fürstliche Bibliothekar Poley den Schriftsteller über die Vorlieben seines Herzogs. 19 editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 10 Reinmar Emans Werk meist auf Angaben zur Besetzung. In gewisser Weise ebenfalls als Auftragskompositionen zu werten sind auch die Werke, die für einen bestimmten Sänger oder Instrumentalisten geschrieben werden, wobei freilich verstärkt auf die Fähigkeiten eines solchen Auftraggebers oder Widmungsträgers eingegangen werden muß.22 Daß Haydn in seinen Kompositionen für Baryton, ein Instrument, welches Fürst Esterhazy spielte, über weite Strecken das Baryton mit der Violine parallel führt, wodurch kleinere Patzer gut überdeckt werden können, beispielsweise scheint Kalkül. Berücksichtigung erfährt auch des Fürsten Wunsch, daß die Stücke nicht mehr als drei Vorzeichen haben sollten. Beschränkungen ganz anderer Art erforderten die Kompositionen, die für den Pianisten Paul Wittgenstein geschrieben wurden. Wittgenstein hatte im 1. Weltkrieg seinen rechten Arm verloren, konnte aber gleichwohl zahlreiche Komponisten dazu anregen, für ihn Klaviermusik zu schreiben. Daß er selbst jedoch Sergej Prokofjews 4. Klavierkonzert (für die linke Hand) nicht aufgeführt hat, steht auf einem anderen Blatt. Ansonsten hatte der Komponist bei der Erfüllung seines Auftrages wohl relativ große Freiräume. Lag ein auftragsgebundener Text zur Vertonung vor, mußte dieser unter Beachtung der Aufführungsmöglichkeiten nach den jeweils zeittypischen Usancen in Musik umgesetzt werden. Da der Wort-Ton-Bezug selten wirklich eindeutig ist, tangierte in der Regel weniger der Textinhalt als seine Rhythmik und Metrik das musikalische Ergebnis. Daß die Affektebenen eingehalten werden mußten, versteht sich von selbst und dürfte kaum als eine künstlerische Begrenzung empfunden worden sein. Eine Trauermusik, egal, welche Besetzung und welche Aufführungsbedingungen zum Tragen kamen, mußte und muß wohl immer noch – soll sie nicht als mißglückt eingestuft werden – den Affekt der Trauer ausdrücken. Problematischer hingegen ist die Vereinnahmung der Musik durch Diktaturen; Auftragskompositionen hatten hier in der Regel eine zielgerichtete Bestimmung, die nicht immer mit der Überzeugung des Komponisten zusammentraf. Will man Alfred Koerppen Glauben schenken, so stellt heute ein Auftrag „kaum mehr strenge Bedingungen. Manchmal ist nur die Besetzung vorgegeben. Auftraggeber und Mäzene haben gelernt, daß Künstler sich gegen ,Vereinnahmung‘ wehren, sie sei gesellschaftlicher, ökonomischer oder ideologischer Art. “23 Fazit Bei der kritischen Edition eines musikalischen Werkes müssen selbstverständlich alle diese von außen kommenden Bedingtheiten so weit eben möglich mit berücksichtigt oder erschlossen werden. Sie sind jedoch stets auf das einzelne Werk bezogen und sperren sich gegen eine Systematisierung. Eine Sozialgeschichte des Kom22 23 Vgl. hierzu beispielsweise Karl Geiringer: Joseph Haydn. Mainz 1959. Koerppen 1993, vgl. Anm. 20, S. 375. editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM 11 Wechselspiele ponierens bleibt somit in weiter Ferne. Gleichwohl ist die Fragestellung nach den von außen diktierten Schreibstrategien nicht nur gerechtfertigt, sondern ermöglicht auch einen geschärften analytischen Zugang zu den Werkstrukturen. Überbewerten allerdings sollte man den kontextuellen Aspekt für die Edition selbst nicht. Dies zeigt ein Beispiel, bei dem wir nur zufällig über dessen kontextuelle Bedingtheit informiert sind. Dmitrij Schostakovitschs Cello-Sonate d-moll, op. 40, liegt als Notentext vor, der vom Komponisten autorisiert ist, zudem aber auch als Schallaufnahme mit Schostakovich am Klavier und Mstislaw Rostropovich am Cello. Besonders hinsichtlich des Tempos würde die Schallaufnahme bei einer kritischen Edition Berücksichtigung finden müssen, spiegelt diese doch die Autorintention am besten wider. Zum Glück aber hat Rostropovich über das Zustandekommen dieser Aufnahme ,geplaudert‘: Als wir die Sonate aufnahmen, war herrliches Wetter. Er [Schostakowitsch] hatte es eilig, irgendwohin zu Besuch aufs Land zu fahren. Deshalb gibt es in der Sonate Stellen, die in wahnsinnig schnellem Tempo gespielt sind.24 Also: Autorintention? Ja oder nein? Oder gehört dieser Aspekt unmittelbar zu dem Komplex, den Paul Valéry aphoristisch auf den Punkt gebracht hat und dem für das heutige Verständnis der Werkedition als einem Vollzug der Werkgenese so große Bedeutung zukommt: „Das unfertige Werk ist nichts, das fertige Werk ist tot.“? Abstract The process of composing musical works is depending on various prerequisites beyond the work itself. There are, for instance, the acoustic conditions of the performance place, the performers’ abilities and qualifications, the instruments’ sound ambitus (Tonvorrat), the casting, the public and the respective client. As soon as, on occasion of another performance, another client is involved, the prerequisites will change and can stimulate the conception of a different version of the work. If the composition is printed, some limitations and restrictions are dropped; the composer, however, must then develop a specific strategy to keep the composition acessible to a certain group of users. In the 17 th and 18 th century this often causes a reduction of the performance’s preoccupations. The argument is consisting of an explanation and discussion of the conditions and prerequisites related to musical practice – with a special attention to the difference between literary and musical works. Some examples are given to illustrate in how far the investigation on compositional strategies can lead to analytical results concerning the work itself as well as to biographical discoveries. 24 Mstislav Rostropovich: The Russian Years. Booklet 1977 zu EMI 7243 5 72016 2 9 (1977), S. 45. editio 12, 1998 Unauthenticated Download Date | 5/11/16 8:13 PM