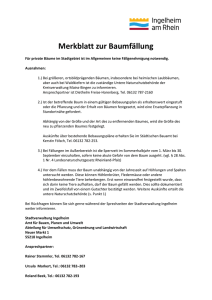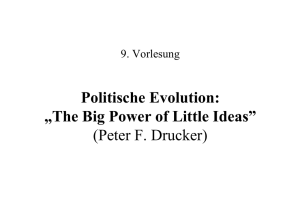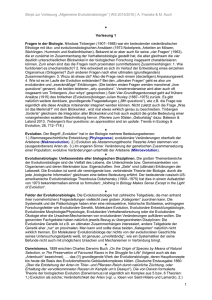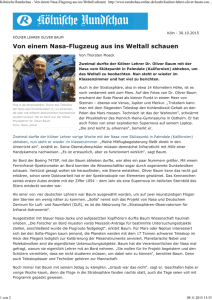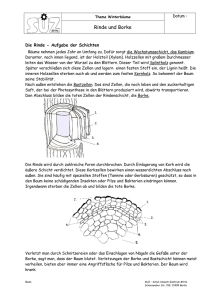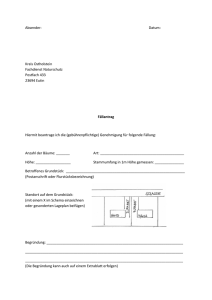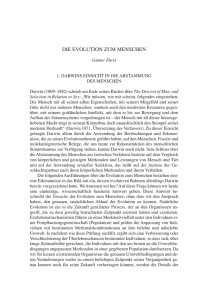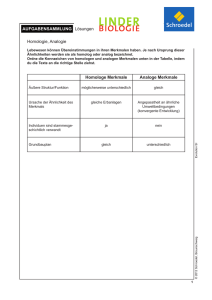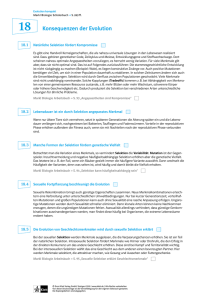Baum des Lebens, Baum der Sprache
Werbung
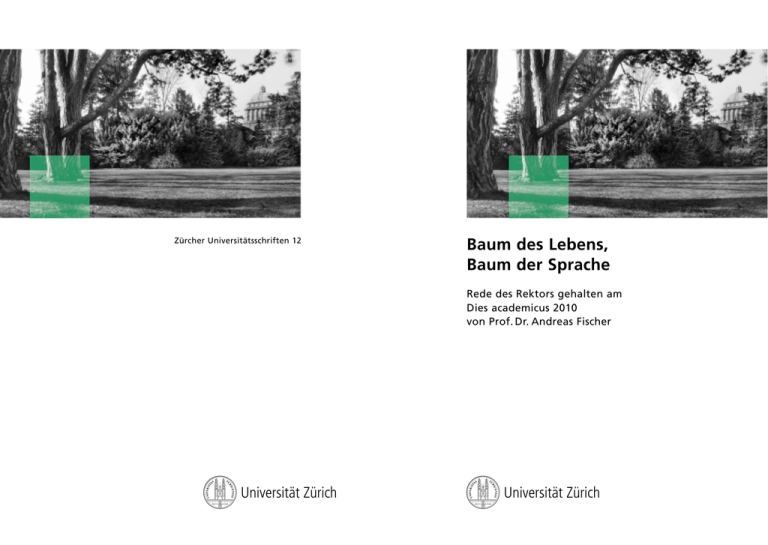
Zürcher Universitätsschriften 12 Baum des Lebens, Baum der Sprache Rede des Rektors gehalten am Dies academicus 2010 von Prof. Dr. Andreas Fischer L L Universität Zürich Rede des Rektors zum Dies academicus 2010 Universität Zürich Baum des Lebens, Baum der Sprache Rede des Rektors Prof. Dr. Andreas Fischer Dies academicus 2010 Anlässlich der 177. Stiftungsfeier der Universität Zürich R.T. Pritchett, Die H.M.S. Beagle an der Küste Südamerikas (1860) Abbildung 1 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 I M D EZEMBER 1831 stach die H.M.S. Beagle vom englischen Hafen Devonport aus in See und nahm Kurs Richtung Südamerika (Abbildung 1). Das Vermessungsschiff der Royal Navy hatte den Auftrag, kartografisch schlecht erfasste Gebiete zu erkunden. An Bord war diesmal auch ein junger Naturforscher namens Charles Darwin. Für ihn wurde die fast fünfjährige Reise auf der Beagle und besonders der Aufenthalt auf den Galapagosinseln 1835 zu einem Schlüsselerlebnis. Ungefähr ein Jahr nach der Rückkehr zeichnete er eine abstrakte Skizze in sein Notizbuch, die er mit «I think» überschrieb und wie folgt kommentierte (Abbildung 2): «So besteht zwischen A und B ein immens grosser Abstand, zwischen C und B ein sehr geringer und zwischen B und D ein beträchtlicher.»1 Alles Leben, so suggeriert der berühmte Notizbucheintrag, geht auf einen einzigen Ursprung zurück, der in der Skizze mit der Zahl 1 markiert ist. Von hier aus verzweigt sich das Leben in seine verschiedenen Erscheinungsformen, wobei sich Ähnlichkeiten und Unterschiede durch den Abstand vom Ursprung und von anderen Formen des Lebens erklären lassen. 22 Jahre später, in Darwins Hauptwerk On the Origin of Species von 1859,2 findet sich eine noch immer abstrakte, aber viel detailliertere Darstellung der gleichen Idee (Abbildung 3). Die konkrete, anschauliche Umsetzung zur Erklärung der Herkunft des Menschen, die der deutsche Biologe Ernst Haeckel (1834–1919) 1874 veröffentlichte (Abbildung 4), führte schliesslich zur griffigen Metapher vom «Baum des Lebens», die bald zum allgemein akzeptierten Modell der Evolution organischen Lebens werden sollte.3 Fast gleichzeitig mit Darwins Origin of Species postulierte der Sprachforscher August Schleicher (1821–1868) einen «Baum der Sprache», oder genauer gesagt, einen Baum 7 Charles Darwin, «I think» (1837) Abbildung 2 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 der indogermanischen Sprachen. Die Vorstellung eines Sprachbaums findet sich zum ersten Mal in einem Aufsatz Schleichers von 1853 mit dem Titel «Die ersten Spaltungen des indogermanischen Urvolkes» (Abbildung 5).4 Den Stamm des Baumes bildet das «Urvolk» der Indogermanen; nach oben hin verzweigt er sich in Äste, die die Nachfahren der Indogermanen darstellen. Sie reichen von den Kelten im Westen Europas bis zu den Iranern und Indern in Südasien. Modifizierte, erweiterte Versionen des Schleicherschen Baumes finden sich in Publikationen von 1860 und 1863 (Abbildung 6).5 Beide Bäume, der Lebensbaum Darwins und der Sprachbaum Schleichers, markieren die Ablösung des Denkschemas «Schöpfung» durch das Denkschema «Evolution». Nach der biblischen Vorstellung sind Pflanzen, Tiere und Menschen (samt ihrer Sprache) das Produkt eines Schöpfungsakts. Nachzulesen ist dies im 1. Buch Mose in den Kapiteln 1 und 2.6 Interessant ist in unserem Zusammenhang aber auch Kapitel 11, die Geschichte des Turmbaus von Babel (Abbildung 7). Im Unterschied zur Erschaffung von Pflanzen, Tieren und Menschen in der Schöpfungsgeschichte wird die Schaffung von Sprachenvielfalt in der Bibel nicht als etwas Positives, sondern als Strafe Gottes für den Übermut der Menschen dargestellt: «Und der Herr sprach: Siehe, sie [die Erbauer des Turms] sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns; nunmehr wird ihnen nichts unmöglich sein, was immer sie sich vornehmen. Wohlan, lasst uns hinabfahren und daselbst ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr des andern Sprache verstehe» (1. Mose 11,6–7).7 Ganz anders die Idee, die dem Denkschema «Evolution» zu Grunde liegt: Organismen und Sprachen sind das Resultat eines natürlichen Entwicklungsprozesses, 9 Charles Darwin, Baum des Lebens (1859) Abbildung 3 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 der durch die zwei Mechanismen Variation und Selektion gesteuert wird. Über den Baum des Lebens wurde im Darwin-Jahr 2009 viel geschrieben; auch Nichtbiologen leuchtet seine Modellhaftigkeit für die Entwicklung der Artenvielfalt ein. Doch wie kam die Sprachwissenschaft dazu, ebenfalls mit der Baummetapher zu operieren, und wie weit trägt sie? Diesen Fragen will ich mich im Folgenden zuwenden. So wie Darwin auf Ideen von Vorgängern und Zeitgenossen aufbaute, so war auch Schleicher nicht der Erste, der die genetische Verwandtschaft von Sprachen propagierte. Die Spur führt zu Sir William Jones (1746–1794), einem in Indien tätigen englischen Richter. Als Absolvent einer «public school» und der Universität Oxford beherrschte er neben dem Englischen auch das Lateinische und das Griechische; überdies kam er in Indien mit dem Sanskrit, der ältesten überlieferten Sprache Indiens, in Kontakt. Jones bemerkte eine überraschende Ähnlichkeit all dieser zeitlich und geografisch weit auseinanderliegenden Sprachen. In seinem Third Anniversary Discourse (1786) bemerkte er: «Das Sanskrit, unabhängig davon, wie alt es sein mag, hat eine wunderbare Struktur: Es ist vollendeter als das Griechische, reichhaltiger als das Lateinische und ausserordentlich raffinierter als beide. Dennoch sind sich diese Sprachen so ähnlich, sowohl in Bezug auf die Wurzeln von Verben wie auch in den Formen der Grammatik, dass die Ähnlichkeit kein Produkt des Zufalls sein kann.» Und an dieser Stelle zog Jones eine radikal neue Schlussfolgerung: «Die Ähnlichkeit ist so gross, dass kein Philologe sie untersuchen kann, ohne zum Schluss zu kommen, dass sie von einer gemeinsamen Quelle abstammen, die vielleicht nicht mehr existiert.»8 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Jones’ Idee von 11 Ernst Haeckel, Stammbaum des Menschen (1874) Abbildung 4 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 Sprachforschern wie Franz Bopp, Rasmus Rask oder Jacob Grimm aufgenommen, bestätigt und verfeinert.9 Die genannten Sprachen sind in der Tat verwandt, und sie gehen auf eine gemeinsame, nicht mehr existierende Vorform zurück, die den Namen Indogermanisch oder Indoeuropäisch erhalten sollte. Schleicher war es, der die sprachlichen Verwandtschaftsverhältnisse erstmals in der Form eines Baums der indogermanischen Sprachen darstellte. W AS HABEN NUN D ARWINS B AUM DES L EBENS und Schleichers Baum der Sprache miteinander gemein, wo gibt es Unterschiede? Gemeinsam sind ihnen drei grundlegende Ideen: erstens die Idee, dass alles Leben und alle (indogermanischen) Sprachen auf eine Urform zurückgehen; zweitens die Idee, dass frühere, nicht mehr «lebende» Formen auffindbar oder wenigstens rekonstruierbar sind; und drittens die Idee, dass die Entwicklung von der Urform bis zu den heutigen Ausprägungen nach bestimmten Prinzipien abläuft. Wenn dies alles zutrifft, lassen sich schrittweise Stammbäume (re)konstruieren: Ausgehend von der Feststellung, dass gewisse Organismen (zum Beispiel Gorillas und Schimpansen) oder gewisse Sprachen (zum Beispiel das Sanskrit und das Altgriechische) sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufweisen, werden ihre Verwandtschaftsbeziehungen methodisch bestimmt und schliesslich Vorformen konstruiert. Dies geschieht mit Hilfe der vergleichenden Rekonstruktion auf der Basis von überlieferten Beweisstücken. Im Fall der Biologie sind die Beweisstücke Knochen und andere Fossilien, einschliesslich konserviertes organisches Material (man denke an Mammute im ewigen Eis, an in Bernstein eingeschlossene Insekten oder an die in der DNA enthaltene 13 August Schleicher, Spaltungen des indogermanischen Urvolkes (1853) Abbildung 5 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 genetische Information). Beweisstücke der Sprachwissenschaft sind Schriftzeugnisse aus früheren Epochen. Ich will den Prozess der vergleichenden Rekonstruktion in der Sprachwissenschaft anhand eines stark vereinfachten Beispiels zeigen: *IE *ghostis *Germ. *gastiz Got. gasts Run. gastiR An. gestr * = nicht belegt, rekonstruiert *IE = Indoeuropäisch Lat. = Lateinisch Lat. hostis Ae. giest As. gast Got. = Gotisch Run. = Runisch An. = Altnordisch Ahd. gast Ae. = Altenglisch As. = Altsächsisch Ahd. = Althochdeutsch Das deutsche Wort Gast hat Parallelen in vielen anderen lebenden germanischen Sprachen. In der Übersicht sind einige linguistische «Fossilien» aufgeführt, schriftlich bezeugte Formen dieses Wortes aus dem 4. bis 12. Jahrhundert n. Chr., wobei die jeweils älteste belegte Form im Gotischen, Runischen, Altnordischen, Altenglischen, Altsächsischen und Althochdeutschen aufgeführt ist.10 Mit der Methode der vergleichenden Rekonstruktion ist es nun möglich, die nicht belegte gemeinsame Vorform im Germanischen (*gastiz) und, wenn wir noch weiter zurückgehen, im Indoeuropäischen (*ghostis) zu erschliessen. Historische Linguisten verwenden dabei mehrere heuristische Prinzipien. Eines ist die Häufigkeit: Da die meisten Formen in den altgermanischen Sprachen mit der Lauftfolge ga beginnen, kann man 15 August Schleicher, Stammbaum der indogermanischen Sprachen (1860) Abbildung 6 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 diese Laute auch für das Germanische annehmen. Ein zweites Prinzip kann man so formulieren: Es ist leichter, etwas wegzulassen, als etwas hinzuzufügen; längere Formen sind demnach aussagekräftiger als kürzere. Nach diesem Prinzip rekonstruieren wir aus dem gotischen gasts, dem runischen gastiR und dem altnordischen gestr ein germanisches *gastiz. Das dritte Prinzip schliesslich ist phonetische Plausibilität: Das gotische stimmlose s, das runische R und das altnordische r lassen sich am plausibelsten aus einem germanischen stimmhaften *z ableiten. Nach dem Prinzip der Plausibilität rekonstruiert man auch das indogermanische *gh aus dem germanischen g und dem lateinischen h. Wie in der Biologie gibt es also auch in der Sprachwissenschaft Fossilien, und wie in der Biologie gibt es Lücken in der Überlieferung, die sich durch Rekonstruktion füllen lassen. E IN OFFENSICHTLICHER U NTERSCHIED zwischen Biologie und Sprache besteht in der zeitlichen Tiefe der Rekonstruierbarkeit (Abbildung 8). In der Biologie kann der Baum des Lebens praktisch in seiner ganzen Länge rekonstruiert werden: Die ältesten Fossilien sind Stromatolithen, versteinerte Formen von aus ein- und vielzelligen Algenarten bestehenden Bakterienfilmen, die zu den ersten photosynthetisierenden Lebewesen gehörten. Sie sind 3,45 Milliarden Jahre alt und damit «nur» etwa eine Milliarde Jahre jünger als die Erde selbst.11 Wir kennen den Baum des Lebens also praktisch bis hin zu seiner Wurzel. Anders beim Baum der Sprache: Nach dem heutigen Wissensstand entwickelten sich der homo habilis und dann der homo erectus in Ostafrika vor zwei beziehungsweise anderthalb Millionen Jahren. Erst viel später jedoch, beim homo sapiens vor mehr als 200 000 Jahren, begann sich Sprache herauszubilden.12 Als dann besagter 17 Gustave Doré, Der Turm von Babel (1865) Abbildung 7 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 homo sapiens vor vielleicht 100 000 Jahren aus Afrika auszuwandern begann, war die Sprache Teil des Rüstzeugs, das ihm die Besiedlung der ganzen Welt ermöglichen sollte.13 Von diesen frühen Formen der Sprache, die existiert haben müssen, wissen wir allerdings gar nichts. Überlieferte Zeugnisse – also linguistische «Fossilien» – gibt es erst aus viel späterer Zeit, nämlich seit der Erfindung der Schrift im Zweistromland vor rund 5000 Jahren.14 Mit den Mitteln der vergleichenden Rekonstruktion ist es möglich, etwas über Sprache(n) vor rund 10 000 Jahren auszusagen, aber weiter zurück reicht unser Blick nicht. Im Unterschied zum Baum des Lebens ist vom Baum der Sprache also nur gerade ein Zehntel seiner Höhe sichtbar, nämlich die jüngsten 10 000 von 100 000 Jahren.15 Dies hat eine weitere Konsequenz: Während wir den Baum des Lebens als ein zusammenhängendes Ganzes verstehen können, ist dies beim Baum der Sprache weniger gut möglich: Linguisten gruppieren die ungefähr 6000 Sprachen der Welt in gegen 30 verschiedene Sprachfamilien.16 Wenn man davon ausgeht, dass sie alle letztlich auf die Sprache des homo sapiens zurückgehen, müsste es möglich sein, die 30 Sprachfamilienbäume zu einem einzigen Baum der Sprache zusammenzufügen.17 Wie dessen Stamm aussehen könnte, bleibt aber im Dunkeln. Variation und (natürliche) Selektion sind die Prinzipien, nach denen sich die Äste und Zweige in Darwins Baum des Lebens entwickeln. Als Variation bezeichnen wir die Tatsache, dass die Angehörigen von biologischen Einheiten nicht in all ihren Merkmalen identisch sind; auch innerhalb einer Art sind Unterschiede zwischen den Individuen zu beobachten. Wenn bestimmte Variationen den entsprechenden Individuen Vorteile verschaffen (etwa bei der Nahrungsbeschaffung oder Partnersuche), können sie sich über viele 19 Menschen Dinosaurier Amphibien Insekten Landpflanzen 0 Känozoikum 5000 10 000 Mesozoikum erste schriftliche Zeugnisse erste rekonstruierte Sprachen 500 Paläozoikum 1000 100 000 Jahre Sprache des homo sapiens? 1500 2000 Cyanobakterien Sauerstoffproduktion 2500 3000 Bakterienfossilien Älteste Stromatolithen 3500 4000 Entstehung der Erde in Millionen Jahren 4500 Präkambrium Die Entstehung des Lebens und der Sprache Abbildung 8 Vorformen von Sprache R E D E D E S R E K T O R S 2 010 Generationen hinweg zu distinktiven Merkmalen verfestigen und so zur Entstehung neuer Arten führen. Bei jenen Säugetieren, die vom festen Boden ins Wasser wechselten, boten beispielsweise oben (statt vorne) liegende Nasenlöcher und breite, zum Paddeln geeignete Extremitäten einen evolutiven Vorteil: Daher finden wir diese Merkmale bei Meeressäugern wie den Delfinen und den Walen.18 Der unterschiedliche Erfolg von Individuen mit verschiedenen Merkmalen ist unter dem oft missverstandenen Etikett «survival of the fittest» bekannt geworden. Gemeint ist damit nicht, dass nur die Stärksten überleben. Gemeint ist vielmehr, dass sich langfristig in der Evolution jene Merkmale durchsetzen, die den Individuen in einem bestimmten Lebensraum die besten Chancen für das Überleben und die Fortpflanzung bieten. Diesen Mechanismus bezeichnet man als natürliche Selektion. Die Frage ist nun, ob die Grundmechanismen der Variation und der Selektion ähnlich auch für die Evolution von Sprachen gelten. Im Falle der Variation beziehungsweise der Variabilität ist die Frage klar mit Ja zu beantworten: Sprache ist inhärent variabel, und zwar von der Lautebene über die Formebene bis hin zur Bedeutungsebene.19 Ich gebe drei einfache Beispiele: Das englische Wort für Parkplatz (car park) wird in England mit einem offenen langen a, in Australien und Neuseeland mit einem ganz hellen, dem ä-Laut nahen und in Südafrika mit einem dunklen, dem o-Laut nahen a ausgesprochen. Bei der englischen Version des Ausdrucks «die Frau, die ich liebe» haben Sprecher die Wahl zwischen drei Varianten des Relativanschlusses: the woman whom I love, the woman that I love, the woman I love. Und schliesslich heisst ein Mobiltelefon in England mobile (phone), in Amerika dagegen cell (phone). Es muss gesagt werden, dass 21 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 die von mir genannten Varianten alles Beispiele bedingter Variation sind; sie sind zwar bedeutungsgleich, können aber nicht ganz beliebig verwendet werden. So sind die verschiedenen Aussprachen von car park geografisch bedingt, während sich die Formen des Relativanschlusses durch ihren Grad an Formalität unterscheiden. Daneben gibt es aber auch unzählige Beispiele freier Variation.20 Grundsätzlich wäre es möglich, dass die Variation stabil bliebe, dass also Sprecher über viele Generationen hinweg wählen könnten zwischen the woman whom I love, the woman that I love und the woman I love. Solch stabile Vielfalt kommt in der Tat vor. Häufig ist es aber so, dass gewisse Varianten im Verlauf der Zeit häufiger gebraucht werden als andere, was man im Darwinschen Sinn als Selektion und damit als Voraussetzung für Wandel, für Entwicklung, für Evolution bezeichnen könnte. Auf die Sprachwissenschaft übertragen bedeutet Evolution Sprachwandel, und der Entwicklung neuer Arten entspricht die Herausbildung neuer Sprachen. Beim früher präsentierten Gast-Beispiel ist aus dem (rekonstruierten) indogermanischen *gh-Laut durch Variation und Selektion im Germanischen ein *g (*gastiz) und im Lateinischen ein h (hostis) geworden. Ich gebe ein zweites, ebenfalls lautliches Beispiel sprachlicher Evolution:21 Lateinisch cantare carum caelum centum Italienisch cantare caro cielo cento Spanisch cantar caro cielo cien Französisch chanter chèr ciel cent Man nimmt an, dass die vier lateinischen Wörter cantare ‹singen›, carum ‹lieb›, caelum ‹Himmel› und centum ‹hundert› im klassischen Altertum mit etwa dem gleichen Anlaut k 22 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 ausgesprochen wurden, doch zeigen die Reflexe in den Tochtersprachen, dass es einen Unterschied (das heisst: eine Variation) zwischen dem k vor a (cantare, carum) und dem k vor den helleren Lauten ae und e (caelum, centum) gegeben haben muss. Aus dieser Variation haben sich durch Selektion die Laute der Tochtersprachen Italienisch (/ k / und / t∫ /), Spanisch (/ k / und / ç /) und Französisch (/ ∫ / und / s /) entwickelt, und die Summe solcher Selektionsprozesse hat zur Entstehung neuer Arten (das heisst hier: Sprachen) geführt. Variation ist also im Baum des Lebens und im Baum der Sprache gleichermassen anzutreffen. Ist nun aber auch die Selektion vergleichbar? Selektion in der Biologie, wie vorher am Beispiel der Meeressäuger gezeigt, basiert auf dem Prinzip des evolutionären Vorteils. Ein ähnliches Prinzip scheint für Sprachen nicht zu gelten. Ich wage die Behauptung, dass sämtliche Sprachen der Welt von ihrer Komplexität und von ihrer Funktion her grundsätzlich gleich sind, dass man also nicht «fittere» von «weniger fitten» Sprachen unterscheiden kann. Sprachen funktionieren als Mittel der Kommunikation, egal wie sie strukturiert sind, egal wo und von wem sie gesprochen werden. Ob eine Sprache über zwanzig oder vierzig Laute verfügt, ob sie bestimmte und unbestimmte Artikel hat oder nicht, ob sie eine isolative oder eine flektierende Sprache ist – keines dieser Strukturmerkmale lässt sich als klarer evolutiver Vor- oder Nachteil interpretieren. Keines dieser Merkmale sichert einer Sprache das Überleben, keines führt dazu, dass eine Sprache zwar für das südliche Afrika, nicht aber für Skandinavien geeignet wäre. Beim Wortschatz liegen die Dinge etwas anders, denn wir brauchen passende Wörter, um eine bestimmte Lebenswelt mit ihren kulturellen Praktiken abzubilden und uns darin zurechtzufinden. Hier erweisen sich Sprachen als sehr adap- 23 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 tiv: Als englische Kolonisten Nordamerika und, etwas später, Australien und Neuseeland besiedelten, mussten sie nicht etwa die Sprache der jeweiligen Ureinwohner übernehmen, um in der neuen Umgebung zu überleben. Sie mussten auch ihr Englisch strukturell in keiner Weise anpassen. Sie mussten bloss den Wortschatz so erweitern, dass er auch für die Benennung zusätzlicher Objekte taugte: Orts- und Landschaftsmerkmale, Fauna, Flora, indigene Gegenstände und Gebräuche.22 Wenn bei Sprachen das Prinzip des «survival of the fittest» also nicht gilt, nach welchem Prinzip erfolgt dann die Selektion, die zur Herausbildung neuer Sprachen führt? Dies ist eine der Grundfragen der historischen Sprachwissenschaft, die ich hier nicht ausführlich diskutieren, geschweige denn beantworten kann. Verweisen möchte ich auf den Begriff drift (Entwicklungstendenz), der vom amerikanischen Linguisten Edward Sapir (1884–1939) geprägt wurde. Sapir betont, dass Variation an sich richtungslos ist, dass Veränderungen aber in eine bestimmte Richtung weisen müssen, damit aus blosser sprachlicher Variation sprachlicher Wandel wird. Er schreibt: «Drift, linguistische Entwicklungstendenz, hat Richtung. Mit anderen Worten wird drift nur beeinflusst von jenen individuellen Varianten, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen [...]. Drift besteht darin, dass die Sprecher einer Sprache unbewusst jene ihrer individuellen Varianten wählen, die kumulativ in eine bestimmte Richtung weisen.» 23 Unbeantwortet bleibt bei dieser Definition, welche Faktoren für die Auswahl jener «individuellen Varianten» verantwortlich sind, «die kumulativ in eine bestimmte Richtung weisen». Sapir veranschaulicht das Wirken von drifts am englischen Fragewort whom, das zunehmend durch who ersetzt wird: Aus Whom did you 24 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 see? wird Who did you see? Der Autor interpretiert das langsame Verschwinden von whom als Resultat von mindestens drei drifts, die er in der Entwicklung des Englischen zu erkennen glaubt: der Tendenz, den Unterschied zwischen Subjekt und Objekt zu verwischen, der Tendenz, die Wortstellung zu fixieren, und schliesslich der Tendenz zum unveränderbaren Wort.24 Sapirs Illustration ist überzeugend, wir sehen aber auch, dass sie uns bei der Frage nach dem «survival of the fittest» nicht weiterbringt. Wenn das Englische in seiner Langzeitentwicklung von einer losen zu einer festen Wortstellung übergeht, und wenn Wörter ihre Flexionsendungen mehr und mehr verlieren, dann ist das ein Wandel der Systematik,25 nicht aber ein Wandel hin zu einer Sprache, die unter bestimmten Umweltbedingungen besser funktioniert als eine andere. Die Frage, welchen Prinzipien die Selektion beim Sprachwandel folgt, muss offen bleiben, und wir müssen akzeptieren, dass die Analogie zwischen biologischer und sprachlicher Evolution hier an ihre Grenzen stösst. I CH KOMME ZU EINEM ZWEITEN U NTERSCHIED zwischen Biologie und Sprache, und zwar geht es nun um die Frage, wie Einheiten (Arten, Sprachen) überhaupt definiert werden. In beiden Gebieten geschieht Evolution durch Variation und Selektion – zunächst in kleinsten Schritten, die dann über längere Zeiträume hinweg zur Entstehung neuer Arten beziehungsweise Sprachen führen können: Aus dem homo erectus entwickeln sich der homo neanderthalensis und der homo sapiens, aus dem Lateinischen das Italienische und das Französische. Biologen sprechen von einer neuen Art, wenn aus Varianten einer gemeinsamen Ausgangsform schliesslich eine Gruppe von Individuen hervorgeht, die einander in 25 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 Körperbau, Färbung, Verhalten oder sonstigen Eigenschaften ähnlich sind, sich aber in ihrem spezifischen Bündel von Merkmalen deutlich von anderen Nachkommen derselben Ausgangsform unterscheiden. Aufgrund dieser Unterschiede kommt es in der Regel nur noch innerhalb der eigenen Gruppe zu erfolgreichen Paarungen, wodurch die Unterschiede weiter verstärkt werden. Welche Kriterien verwenden Linguisten, um den Übergang von blossen Varianten zu einer neuen Sprache zu definieren? Wann wurde aus dem Vulgärlatein des frühen Mittelalters das Altfranzösische, das Italienische und das Spanische, wann aus dem Germanischen das Altenglische, wann – wenn überhaupt – wird aus dem in Amerika gesprochenen Englisch eine eigene Sprache, das Amerikanische? Die Linguistik stützt sich bei der Abgrenzung eigenständiger Sprachen hauptsächlich auf drei Kriterien: strukturelle Unterschiede, die sich beschreiben lassen; die gegenseitige Verständlichkeit (mutual intelligibility) innerhalb einer Sprechergruppe beziehungsweise die fehlende Verständlichkeit über die Sprachgrenze hinweg; und schliesslich das Selbstverständnis und der politische Wille einer Sprachgemeinschaft. Das erste Kriterium, die strukturellen Unterschiede, entspricht etwa dem distinktiven Bündel von Merkmalen in der Biologie. Für die anderen beiden Kriterien ist eine biologische Analogie schwieriger oder gar nicht zu finden. Die gegenseitige Verständlichkeit wäre vielleicht mit der Paarungsfähigkeit in der Biologie vergleichbar. Zu einer bestimmten Art gehören all diejenigen Lebewesen, die sich fruchtbar miteinander paaren können; eine gemeinsame Sprache sprechen all diejenigen, die sich im Medium dieser Sprache gegenseitig verständigen können. Doch bei genauerem Besehen taugt dieses Kriterium weniger, als es auf den 26 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 ersten Blick erscheinen mag: Schweden und Norweger verstehen sich recht gut, obwohl sie eigentlich zwei verschiedene Sprachen sprechen. Umgekehrt verstehen sich Norddeutsche und Walliser kaum oder gar nicht, obwohl beide dieselbe Sprache (nämlich Deutsch) sprechen. Hier kommt nun das dritte Kriterium ins Spiel: Für die Definition einer Sprache kommt es auch auf das Selbstverständnis einer Sprachgemeinschaft an. Dazu gehört das Bekenntnis zu einer gemeinsamen Sprache, dazu gehören unter Umständen aber auch gemeinsame politische Grenzen sowie der politische Wille, eine Gemeinschaft sprachlich zu legitimieren.26 Die Holländer in Südafrika sprachen jahrhundertelang Holländisch beziehungsweise eine Variante des Holländischen. Erst 1925 wurde durch einen politischen Willensakt aus dem Holländischen die neue Sprache Afrikaans. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Situation auf der Iberischen Halbinsel (Abbildung 9): Aus linguistischer Sicht werden dort drei romanische Sprachen gesprochen: das Portugiesische, das Spanische und das Katalanische. Unter General Franco wurden die sprachlichen Minderheiten unterdrückt, und es war zeitweise verboten, Katalanisch zu schreiben oder sogar zu sprechen. Erst nach dem Tod Francos im Jahr 1975 erlangte das Katalanische seine Autonomie zurück und hat seit 1979 sogar den Status einer kooffiziellen Sprache.27 Nicht immer führt politische Selbständigkeit und Nationalstaatlichkeit jedoch zur Etablierung selbständiger Sprachen: Deutschland, Österreich und die (deutschsprachige) Schweiz sind durch die gemeinsame Standard- und Schriftsprache Deutsch verbunden; den nationalen Grenzen entsprechen keine sprachlichen. Diese Beispiele zeigen, dass bei der Frage nach der Distinktivität von Sprachen ein Faktor mitspielt, den es in der Biologie so nicht gibt: die Selbstde- 27 FRANKREICH ANDORRA SPANIEN Spanisch POR PO RTUGAL BALEAREN Katalanisch Baskisch Galicisch 0 100 200km Portugiesisch Die Sprachen auf der Iberischen Halbinsel (vereinfacht) Abbildung 9 RUMÄNIEN SERBIEN BOSNIENHERZEGOWINA MONTENEGRO BULGARIEN KOSOVO MAZEDONIEN Slavische Sprachen ALBANIEN Albanisch GRIECHENLAND 0 100 200km Rumänisch Die Sprachen auf dem Balkan (vereinfacht) Abbildung 10 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 finition und das Bewusstsein einer Gruppe, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, die sich von anderen Sprachen unterscheidet. E INE DRITTE D IFFERENZ zwischen biologischen Arten und Sprachen betrifft ihre Vermischbarkeit beziehungsweise Hybridisierung. Hybridisierungen zwischen verschiedenen biologischen Arten kommen zwar vor, sind aber selten; wenn sie vorkommen, sind die entstehenden Nachkommen in der Regel weniger lebensfähig, unfruchtbar oder beides. Maulesel und Maultiere, die aus Kreuzungen von Pferd und Esel entstehen, sind bekannte Beispiele für unfruchtbare Hybriden und damit für die begrenzte Möglichkeit der wechselseitigen genetischen Beeinflussung zwischen verschiedenen Arten. Zumindest im Tierreich sind Hybriden also meist evolutive Sackgassen. Anders verhält es sich bei den Sprachen. Sie können sich unabhängig von ihrer «genetischen» Herkunft ohne Schwierigkeiten durch gegenseitigen Kontakt auf vielfältige Weise beeinflussen und tun das auch oft. Sprachkontakte und ihre Konsequenzen sind den Linguisten seit langem vertraut. In der historischen Sprachwissenschaft unterscheidet man heute sogar explizit zwischen dem klassischen, genetischen und dem durch Kontakt bewirkten Sprachwandel.28 Beispiele für kontaktbedingte, klar nichtgenetische Sprachentwicklungen sind Entlehnungen, Angleichungen im Rahmen von Sprachbünden oder die Pidginund Kreolsprachen. Die einfachsten Produkte von Sprachkontakten sind Entlehnungen. Ihre Art und ihr Umfang hängen von Länge und Intensität des Kontakts ab, nicht aber von der genetischen Nähe der Sprachen. Die Wörter Kaffee, Kakao und Tee beispielsweise sind alles Lehnwörter, und zwar aus dem 29 KUBA Spanisch DOMINIKANISCHE REPUBLIK JAMAIKA HAITI 0 PUERTO RICO 250 500 km Englisch und jamaikanisches Kreol Französisch und haitianisches Kreol Die Sprachen in der Karibik (vereinfacht) Abbildung 11 SCHOTTLAND SchottischGälisch NORDIRLAND ISLE OF MAN REPUBLIK IRLAND IrischGälisch ENGLAND WALES W ALES Walisisch Kornisch † 0 100 200km Manx † Die keltischen Sprachen auf den Britischen Inseln (vereinfacht) Abbildung 12 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 Arabischen (via das Türkische), aus dem Aztekischen (via das Spanische) und aus dem Chinesischen (via das Malaiische). Dass das Deutsche mit keiner der genannten Gebersprachen verwandt ist, spielt keine Rolle. Unter einem Sprachbund versteht man eine Gruppe von Sprachen, die nahe beisammen in einer Region gesprochen werden und auffällige Ähnlichkeiten aufweisen, die sie von anderen Sprachen unterscheiden. Im Unterschied zu einer Sprachfamilie sind die in einem Sprachbund vereinten Sprachen jedoch genetisch nicht oder nur entfernt verwandt. Bekanntestes Beispiel ist der Sprachbund auf dem Balkan, dem eine Reihe von ganz unterschiedlichen (indogermanischen) Sprachen angehören (Abbildung 10): das Albanische, das Rumänische (eine romanische Sprache) sowie slawische Sprachen wie Mazedonisch oder Bulgarisch. Im Rumänischen und Albanischen, aber auch im Bulgarischen und Mazedonischen findet sich als Merkmal der nachgestellte Artikel. Auf Rumänisch heisst lup ‹Wolf›, lupul dagegen ‹der Wolf›, dies parallel zum Albanischen, wo qen ‹Hund›, qeni dagegen ‹der Hund› heisst. Die Verbreitung dieses Merkmals ist nicht durch genetische Verwandtschaft bedingt, sondern allein durch geografische Nähe und intensiven Kontakt. Eine maximale Beeinflussung über genetische Grenzen hinweg zeigt sich bei den sogenannten Pidgin- und Kreolsprachen, die aus einer Vermischung von mindestens zwei nicht verwandten Sprachen hervorgehen. Beispiele dafür sind das auf dem Englischen basierende Kreol von Jamaika und das auf dem Französischen basierende Kreol von Haiti (Abbildung 11). Entlehnungen, Sprachbundphänomene und Kreolsprachen sind Beispiele von Hybridisierung. In der Biologie ist sie eher selten und noch seltener von weitreichender Bedeutung, bei Sprachen kommt sie jedoch sehr häufig vor und ist eher die Regel als die Ausnahme. 31 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 N OCH EIN W ORT ZUM V ERSCHWINDEN UND A USSTERBEN . Biolo- gische Arten verschwinden, wenn sich die Umwelt so rasch verändert, dass die Zeit für Anpassung durch Variation und Selektion fehlt. Das wird besonders dort deutlich, wo der Mensch relativ abrupt in die Natur eingreift. So hat zum Beispiel die Einschleppung von Ratten, Katzen, Ziegen, Eseln und auch fremden Pflanzenarten die Umwelt einiger Galapagosinseln so schnell und stark verändert, dass manche einheimische Arten, die Darwin bei seinem Besuch 1835 noch vorfand, heute ausgestorben sind. Gilt dies auch für Sprachen? Im Gegensatz zu Organismen existieren Sprachen ja nicht aus sich selbst heraus, und sie perpetuieren sich auch nicht durch Fortpflanzung. Sprachen leben dadurch, dass Gemeinschaften von Sprechenden sie als Muttersprachen verwenden und an ihre Nachkommen weitergeben. Sprachen «sterben», wenn es keine Menschen mehr gibt, die sie sprechen. Dies kann eintreten, wenn ethnische Gruppen aussterben oder vernichtet werden. In vormaligen Kolonien wie Nordamerika oder Australien verschwanden viele indigene Sprachen, weil die sie sprechenden Völker ausgerottet wurden. In Australien zum Beispiel gab es beim Eintreffen der Engländer rund 200 verschiedene Sprachen. Heute sind rund 50 von ihnen ausgestorben, weitere 100 sind vom Verschwinden bedroht.29 Häufiger sterben Sprachen aber an dem, was Linguisten als Sprachwechsel bezeichnen: Hier werden Gesellschaften von Sprechenden nicht physisch dezimiert, sondern sie geben – freiwillig oder unfreiwillig – ihre eigene Sprache auf und übernehmen eine andere. In grossen Teilen der Britischen Inseln etwa wurden noch vor tausend Jahren verschiedene keltische Sprachen gesprochen (Abbildung 12). Zwei davon sind mittlerweile ausgestorben: das in Cornwall gesprochene Kornische (zuletzt gesprochen im 18. Jahrhun- 32 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 dert) und das auf der Isle of Man gesprochene Manx (zuletzt gesprochen im 20. Jahrhundert). Drei weitere keltische Sprachen leben noch, doch geht die Zahl ihrer Sprecher ständig zurück: das Irisch-Gälische in der Republik Irland, das Schottisch-Gälische im Nordwesten Schottlands und das Walisische in Wales.30 Auch in diesen Fällen lässt sich der Niedergang teilweise auf Verfolgung, Unterdrückung und Ausrottung, teilweise aber eben auch auf Sprachwechsel zurückführen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sprach man in Irland noch weitgehend Gälisch. 1801 wurde die Insel Teil des Vereinigten Königreichs.31 Im 19. Jahrhundert führte eine Kartoffelseuche zu Hungersnöten, die viele Todesopfer forderten und zahlreiche Iren zur Auswanderung zwangen. Die Zahl der Sprecher des Gälischen wurde damit durch äussere Gewalt vermindert. Dazu kam, dass viele der in Irland bleibenden Iren durch Sprachwechsel zum Englischen übergingen, unter anderem weil die Unterrichtssprache in der 1831 eingeführten Volksschule nur Englisch war. In der Republik Irland wird das Irisch-Gälische zwar heute noch gesprochen, es ist aber eine gefährdete Minderheitensprache.32 I CH KOMME ZUM S CHLUSS . Evolution führt zu Vielfalt: Aus einzelligen Lebewesen haben sich unzählige Arten von Pflanzen und Tieren entwickelt, aus der «Ursprache» des homo sapiens die rund 6000 verschiedenen Sprachen, die heute auf der Welt gesprochen werden. Die organische Vielfalt, die Biodiversität, ist eine funktionelle Notwendigkeit: Es ist kaum vorstellbar, dass die ganze Welt von einer einzigen Pflanzenart bedeckt oder von einer einzigen Tierart bewohnt wird; die Pflanzen- und Tierwelt variiert in einer Weise, die als Anpassung an die jeweiligen geografischen, klimatischen und sonstigen ökologischen Bedingungen verstanden 33 August Schleicher, Stammbaum der indogermanischen Sprachen (1863) Abbildung 13 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 werden muss. Die verschiedenen Arten erfüllen in ihrer jeweiligen Umwelt spezifische unverzichtbare Funktionen, z. B. als Nahrung, Raubfeind, Krankheitserreger oder Symbiont. Auch Sprachen haben sich durch Evolution entwickelt, doch gibt es im Unterschied zur organischen Welt bei der Sprache keine funktionelle Notwendigkeit für Vielfalt. Es ist mindestens theoretisch denkbar, dass auf der ganzen Welt nur eine einzige Sprache (mit regional verschiedenen Dialekten) gesprochen würde. Um im Bild zu bleiben: Von den 6000 Sprachen sind 5999 nach rein biologisch-evolutionären Begriffen verzichtbar. Die Vielfalt der Sprachen, dessen bin ich mir als Linguist natürlich bewusst, ist jedoch auf einer anderen Ebene höchst bedeutsam. Sprachen sind Ausdruck und Träger der kulturellen Diversität, die ein zentrales Kennzeichen der menschlichen Lebensformen auf dieser Welt ist. Sie sind gleichzeitig Merkmale von Identität, weil Gemeinschaften sich durch Sprache ihrer selbst vergewissern. Ohne Sprachendiversität gäbe es weniger kulturelle Vielfalt und weniger kulturelle Identität. Dies zu vertiefen, könnte Gegenstand einer weiteren Rede sein.33 35 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 Anmerkungen 1 Meine Übersetzung. Original (zitiert nach Paul H. Barrett, Peter U. Gautrey, Sandra Herbert, David Kohn and Sydney Smith [transcr. and ed.], Charles Darwin’s Notebooks, 1836–1844: Geology, Transmutation of Species, Metaphysical Enquiries [Cambridge: British Museum / Cambridge University Press, 1987], S. 36): «Thus between A & B immens gap of relation, C & B the finest gradation, B & D rather greater distinction. Thus genera would be formed.» 2 Der vollständige Titel des Werks lautet On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (London: John Murray, 1859). Das «On» fiel ab der 6. Ausgabe (1872) weg. 3 Ernst Haeckel, Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen, 3. umgearbeitete Auflage (Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1877). 4 August Schleicher, «Die ersten Spaltungen des indogermanischen Urvol- 5 August Schleicher, Die Deutsche Sprache (Stuttgart: J. G. Cotta’scher kes», Allgemeine Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur, August 1853. Verlag, 1860); ders., Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft: Offenes Sendschreiben an Herrn Dr. Ernst Häckel, a.o. Professor der Zoologie und Director des zoologischen Museums an der Universität Jena (Weimar: Hermann Böhlau, 1863). 6 In den Kapiteln 1 und 2 ist Sprache nicht erwähnt, wohl aber in der zweiten Version der Schöpfungsgeschichte, die sich im Kapitel 3 findet: «Da bildete Gott der Herr aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und ganz wie der Mensch sie nennen würde, so sollten sie heissen. Und der Mensch gab allem Vieh und allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen; [...].» Alle Bibelstellen sind nach der Zürcher Bibel von 1961 zitiert. 7 Temporär rückgängig gemacht wird die babylonische Sprachverwirrung durch das Pfingstwunder (Apostelgeschichte, Kapitel 2): «Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie [die Apostel] alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie sassen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten, wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem heiligen Geist erfüllt und fingen an, in andern Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. [...] Als aber dieses Getöse 37 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 sich erhob, lief die Menge zusammen, und sie wurde verwirrt; denn jeder hörte sie in seiner eignen Sprache reden.» 8 Meine Übersetzung. Original (zitiert nach David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language [Cambridge: Cambridge University Press, 1987], S. 296): «The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists.» 9 Franz Bopp, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Altslawischen, Gothischen und Deutschen (Berlin: Ferdinand Dümmler, 1833–1852); Rasmus Rask, Über das Alter und die Echtheit der Zend-Sprache und des Zend-Avesta, und Herstellung des ZendAlphabets; nebst einer Übersicht des gesammten Sprachstammes, übersetzt von Friedr. Heinrich von der Hagen (Berlin: Duncker und Humblot, 1826); Jacob Grimm, Deutsche Grammatik (Göttingen: Dieterich, 1819–1834). 10 Das – heute nicht mehr gesprochene – Gotische ist durch eine von ca. 400 n. Chr. stammende Bibelübersetzung dokumentiert; Runisch ist belegt durch Runeninschriften in Skandinavien vom 4. bis zum 8. Jhdt.; die ältesten erhaltenen altnordischen Texte in lateinischer Schrift stammen aus dem 12. Jhdt.; Altenglisch ist vom 7. Jhdt. an belegt, Altsächsich und Althochdeutsch vom 8. Jhdt. an. 11 Vgl. den Führer zur Ausstellung «Der Baum des Lebens: Vielfalt und Einheit», die – kuratiert von der Universität Zürich, der ETH Zürich und «Life Science Zürich» – vom 4. bis 6. September 2009 in der Halle des Hauptbahnhofs Zürich stattfand, S. 36f. 12 Damit sich Sprache entwickeln konnte, mussten neben einem gut entwickelten Gehirn auch gewisse physiologische Bedingungen erfüllt sein: Eine Rolle spielen beispielsweise die Lage des Kehlkopfs, wie sie nur bei aufrecht gehenden Primaten vorkommt, sowie die Form des Zungenbeins, das die Bewegung der Zunge kontrolliert. 13 Vgl. Jean Aitchison, The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), Kap. 5 «The family tree». 14 Die älteste bekannte Schrift ist die sumerische Keilschrift von etwa 15 «Our earliest written records [of any language] are around 5000 years 3000 v. Chr. old, though most are more recent. By comparing different early 38 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 languages, we can reconstruct what some languages may have been like up to 10 000 years ago, according to the standard view. Yet language must have evolved at least 50 000 years ago, and most researchers propose a date around 100 000 years ago.» (Aitchison, The Seeds of Speech [wie Anmerkung 13], S. 4). 16 Nach David Crystal (The Cambridge Encyclopedia of Language [Cambridge: Cambridge University Press, 1987], S. 294f.) unterscheidet man weltweit 29 Sprachfamilien. 17 Vgl. Merritt Ruhlen, The Origin of Language: Tracing the Evolution of the 18 Vgl. Ausstellungsführer (wie Anmerkung 11), S. 204f. 19 Für die Evolution relevante Variation in der Biologie ist genetisch bedingt, Mother Tongue (New York: John Wiley, 1994). Variation in der Sprache durch die Sprachproduktion. Man vergleiche Ferdinand de Saussures Unterscheidung zwischen langue (dem potentiell festen Sprachsystem) und parole (der potentiell variablen Realisation): «En séparant la langue de la parole, on sépare du même coup: 1° ce qui est social de ce qui est individuel; 2° ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel.» (Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale [1915] [Paris: Payot, 1982], S. 30). 20 Variation ist der zentrale Gegenstand der Soziolinguistik. 21 Zitiert nach James M. Anderson, Structural Aspects of Language Change, Longman Linguistics Library 13 (London: Longman, 1973), S. 18. 22 In Kolonien gesprochene Sprachen der jeweiligen Kolonialländer sind freilich auch ein Beispiel dafür, dass Sprache nicht nur adaptiv ist, sondern als Instrument kultureller Hegemonie selber neue Realitäten schafft. 23 Meine Übersetzung. Original (zitiert nach Edward Sapir, Language: An Introduction to the Study of Speech [1921] [London: Granada, 1963], S. 155): «The linguistic drift has direction. In other words, only those individual variations embody it or carry it which move in a certain direction, just as only certain wave movements in the bay outline the tide. The drift of a language is constituted by the unconscious selection on the part of its speakers of those individual variations that are cumulative in some special direction.» 24 Sapir, Language (wie Anmerkung 23), S. 156–170. 25 In der Sprachwissenschaft werden Unterschiede in der Systematik von 26 Auf den Punkt gebracht wird diese politische Legitimierung einer Sprache Sprachen unter dem Stichwort Typologie untersucht. durch den vom Linguisten Max Weinreich (1894–1969) in Umlauf gebrachten Aphorismus: «A language is a dialect with an army and a navy» (1945, ursprünglich auf Yiddisch). 39 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 27 Kooffizielle Sprachen sind in Spanien auch das historisch gesehen mit dem Portugiesischen verwandte Galicische und das mit den romanischen Sprachen nicht verwandte Baskische. Zu den auf der Iberischen Halbinsel gesprochenen Sprachen vgl. Georg Bossong, Die romanischen Sprachen: Eine vergleichende Einführung (Hamburg: Buske, 2008). 28 Vgl. Sarah Grey Thomason und Terrence Kaufman, Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics (Berkeley: University of California Press, 1988). 29 Tom McArthur (ed.), The Oxford Companion to the English Language 30 Dazu kommt das Bretonische in Frankreich. 31 Erst 1912, nach einem langen Freiheitskampf, erlangte der grössere Teil 32 Gestärkt wird es durch die Tatsache, dass es neben dem Englischen (Oxford: Oxford University Press, 1992), s.v. «Australian Languages». Irlands, die heutige Republik Irland, wieder die Unabhängigkeit. Nationalsprache der Republik Irland ist und als solche in den Schulen unterrichtet wird. Für die Mehrzahl der Iren ist das Gälische nicht Muttersprache, sondern in der Schule gelernte Zweitsprache. 33 Folgenden Personen danke ich für Anregungen, Ratschläge und konstruktive Kritik: Dr. Peter Collmer, Prof. Dr. George Dunkel, Dr. Sandra Engler, Prof. Dr. Heinz-Ulrich Reyer, Prof. Dr. Carolus van Schaik. 40 R E D E D E S R E K T O R S 2 010 Bildnachweis Abb. 1 Abb. 2 R.T. Pritchett, Die H.M.S. Beagle an der Küste Südamerikas (1860), Keystone. Charles Darwin, Notebook B, Transcr. by Kees Rookmaaker, Darwin Online, http://darwin-online.org.uk. Abb. 3 Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (London: John Murray, 1859), zwischen S. 117 und S. 118. Abb. 4 Ernst Haeckel, Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen, 3. umgearbeitete Auflage (Leipzig: Verlag von Wilhlem Engelmann, 1877), Tafel XV, zwischen S. 526 und S. 527. Abb. 5 Robert J. Richards, «The Linguistic Creation of Man: Charles Darwin, August Schleicher, Ernst Haeckel, and the Missing Link in Nineteenth-Century Evolutionary Theory», in Matthias Dörries (Hrsg.), Experimenting in Tongues: Studies in Science and Language (Stanford: Stanford University Press, 2002), S. 35. Abb. 6 August Schleicher, Die Deutsche Sprache (Stuttgart: J. G. Cotta’scher Verlag, 1860), S. 81. Abb. 7 Abb. 8–12 Abb. 13 Gustave Doré, Der Turm von Babel (1865), istockphoto. UZH, Grafische Umsetzung: Peter Schuppisser, Philipp Tschirren, Zürich. August Schleicher, Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft (Weimar: Hermann Böhlau, 1863), Faltdiagramm am Ende des Buches. 41 IMPRESSUM Herausgeberin Beauftragte Publishing Gestaltung Titelbild Druck Auflage Erscheinungsdatum Adresse Zürcher Universitätsschriften Nr. 12 Universitätsleitung der Universität Zürich Dr. Peter Collmer, Dr. Sandra Engler Kommunikation Roger Nickl (Redaktion) Atelier Versal, 8044 Gockhausen Peter Schuppisser Tschirren Ursula Meisser NZZ Fretz AG, Schlieren 2700 April 2010 Rektorat der Universität Zürich, Künstlergasse 15, 8001 Zürich Telefon 044 634 22 11 Fax 044 634 22 12 E-Mail [email protected] Zürcher Universitätsschriften 12 Baum des Lebens, Baum der Sprache Rede des Rektors gehalten am Dies academicus 2010 von Prof. Dr. Andreas Fischer L L