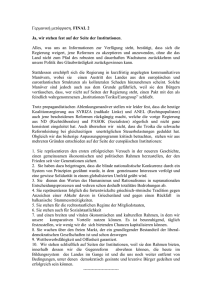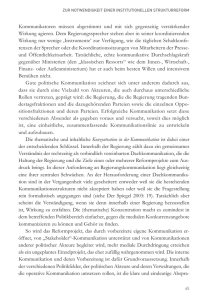world report - Human Rights Watch
Werbung

H U M A N R I G H T S WORLD REPORT | 2014 W A T C H E R E I G N I SS E VO N 2 0 13 Auszüge auf Deutsch HUMAN RIGHTS WATCH Human Rights Watch ist eine weltweit führende, unabhängige Nichtregierungsorganisation, die sich für den Schutz und die Verteidigung der Menschenrechte einsetzt. Indem wir die internationale Öffentlichkeit auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen, geben wir den Opfern eine Stimme und ziehen die Verantwortlichen zur Rechenschaft. Durch unsere unabhängigen Untersuchungen und die gezielte Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger üben wir Druck aus, um Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Human Rights Watch daran, die rechtlichen und moralischen Grundlagen für dauerhaften Wandel zu schaffen sowie Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Menschen weltweit einzufordern. Human Rights Watch Neue Promenade 5, 10178 Berlin T: +49 (0)30 259306-0 F: +49 (0)30 722-399-588 E: [email protected] W: www.hrw.org/de H U M A N R I G H T S W A T C H WORLD REPORT 2014 E R E I G N I SS E VO N 2 0 13 Inhalt Der Kampf um die Menschenrechte 2013 Massengewalt, Einschüchterung von Minderheiten und Verstöße im Anti-Terror-Kampf beenden Einleitung von Kenneth Roth 5 Die überfällige Rückkehr eines Rechts Privatsphäre im Zeitalter der Überwachung Essay von Dinah Pokempner 19 Menschenrechte in der Europäischen Union 26 Einwanderungs- und Asylpolitik der EU Diskriminierung und Intoleranz Terrorismusbekämpfung Außenpolitik der EU Menschenrechtsfragen in EU-Mitgliedsstaaten 26 27 27 28 29 Deutschland 29 Frankreich 29 Griechenland 30 Großbritannien 32 Italien 33 Kroatien 35 Niederlande 36 Polen 36 Rumänien 37 Spanien 37 Ungarn 38 Anhang Internationale Grundsätze für die Anwendung der Menschenrechte in der Kommunikationsüberwachung 40 40 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Essay: Der Kampf um die Menschenrechte 2013 Massengewalt, Einschüchterung von Minderheiten und Verstöße im Anti-Terror-Kampf beenden Von Kenneth Roth Wie hat sich 2013 die Lage der Menschenrechte entwickelt? Mehrere Themen stechen hier hervor. Das unkontrollierte Töten von Zivilisten in Syrien hat weltweit für Schrecken gesorgt, doch nicht so stark, dass sich ausländische Staats- und Regierungschefs zum Eingreifen genötigt sahen. Einige Beobachter verkündeten daraufhin das Aus des hoch gelobten Prinzips der Schutzverantwortung. Auf diese hatten sich Regierungen aus vielen Ländern vor weniger als einem Jahrzehnt verständigt, um die Menschen vor Massengewalt zu schützen. Doch man sollte das Prinzip der Schutzverantwortung noch nicht abschreiben, wie sich Ende des Jahres zeigte. Da nämlich kam dieses Konzept in der Zentralafrikanischen Republik, im Südsudan und in der Demokratischen Republik Kongo zum Einsatz, als dort Gräueltaten in großem Umfang drohten. In mehreren Ländern hat die Demokratie Rückschläge erlitten, aber nicht, weil sich die Machthaber offen von ihr abwandten. Viele Anführer fühlen sich weiterhin stark genötigt, Lippenbekenntnisse für den demokratischen Gedanken abgeben zu müssen. Aber einige vergleichsweise junge Regierungen, etwa in Ägypten oder Burma, haben sich auf die alleroberflächlichste Form der Demokratie festgelegt: Sie halten Wahlen ab oder erahnen irgendwie die Präferenzen der Mehrheit, doch sie begrenzen nicht die Macht der Mehrheit, wie es bei jeder echten Demokratie der Fall sein sollte. Dieser Missbrauch des Mehrheitsprinzips findet auch dann statt, wenn Regierungen friedliche Kritik unterdrücken, Minderheiten ausgrenzen oder ihren Bürgern streng definierte kulturelle Regeln aufzwingen. Doch in keinem dieser Fälle nahm die Öffentlichkeit diesen Missbrauch der Demokratie widerstandslos hin. Im Kampf gegen den Terrorismus wurde seit dem 11. September 2001 auch gegen die Menschenrechte verstoßen. Vor allem zwei Antiterrormaßnahmen der USA wurden vergangenes Jahr öffentlich diskutiert: die elektronische globale Massenüberwachung und die gezielten Tötungen durch Drohnen. Jahrelang hatte sich Washington hinter die Notwendigkeit der Geheimhaltung zurückgezogen und es so vermieden, diesen Programmen einen eindeutigen rechtlichen Rahmen zu geben. Diese Strategie wurde zum einen durch die Enthüllungen von Whistleblower Edward Snowden zum Überwachungsprogramm zunichte gemacht, zum anderen dadurch, dass Augenzeugen zivile Opfer bei Drohneneinsätzen meldeten. Beide Programme stehen nun sehr stark im Rampenlicht. Aber das globale System zum Schutz der Menschenrechte hat bei allem Aufruhr auch wichtige Fortschritte erzielen können. Nach zähem und enttäuschendem Start zeigte der UN-Menschenrechtsrat endlich, was in ihm steckt, beispielsweise als er starken Druck auf Nordkorea und Sri Lanka ausübte. Zudem gibt es zwei neue internationale Abkommen, die einigen der am stärksten marginalisierten Gruppen der Welt neuen Mut machen – den Hausangestellten und den Kleinbergbauern, die sich beim unregulierten Arbeiten mit Quecksilber vergiften. Schutzverantwortung: Angeschlagen, aber noch wirkungsvoll 2005 trafen Regierungen aus aller Welt eine historische Übereinkunft: Sollte ein Land Massengewalt nicht verhindern, würden die Völkergemeinschaft einschreiten. Seit damals hat die Völkergemeinschaft dieses Prinzip erfolgreich zum Schutz von Menschenleben angewandt, vor 5 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch allem 2007/2008 in Kenia und 2011 in der Elfenbeinküste. Nach dem Eingreifen der Nato 2011 in Libyen geriet das Konzept jedoch in die Kritik, weil das Bündnis nach Ansicht vieler nicht nur Zivilisten schützte, sondern auch auf einen Regimewechsel hinarbeitete. Die negativen Reaktionen vergifteten die weltweiten Debatten darüber, wie man auf die Massengewalt in Syrien reagieren solle. Noch immer werden syrische Zivilisten ungebremst abgeschlachtet und dass hier überhaupt nichts geschehen ist, hat die Sorge geweckt, dass die Doktrin am Ende ist. Das Versagen in Syrien ist zu verurteilen, sollte jedoch nicht überschatten, dass sich das Prinzip der Schutzverantwortung 2013 in einigen Fällen als ausgesprochen lebendig erwies. In der Zentralafrikanischen Republik und im Südsudan haben Afrikanische Union und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen rasch reagiert und Friedenstruppen entsandt, um ethnisch oder religiös motivierte Morde an Zivilisten zu verhindern. Und im Osten der Demokratischen Republik Kongo entzog Ruanda auf ausländischen Druck Rebellen, die in dieser leidgeplagten Region Massengewalt verübten, die Unterstützung. Syrien Syrien war 2013 Schauplatz des mit Abstand tödlichsten bewaffneten Konflikts. Der aus einem Aufstand erwachsene Bürgerkrieg ging in sein drittes Jahr und stach durch die Rücksichtslosigkeit hervor, die die Regierung militärisch an den Tag legte. Es wurden keineswegs nur gegnerische Kämpfer ins Visier genommen, wie es das humanitäre Völkerrecht vorschreibt, stattdessen griff die Regierung ohne jede Rücksicht in den von der bewaffneten Opposition kontrollierten Gebieten auch Zivilisten an. Ein Hauptziel der Regierung scheint es zu sein, möglichst viele Zivilisten in die Flucht zu schlagen, damit die Rebellenkräfte keine Zuflucht unter ihnen finden oder auf eine funktionierende Wirtschaft zurückgreifen können. Kollektive Bestrafung wurde zudem als Mittel genutzt, um die Bevölkerung gegen die Opposition aufzubringen und allen Syrern eine Botschaft zu senden: „Lasst ihr die Opposition schalten und walten, werdet ihr dafür büßen!” Das ungeheuerlichste Beispiel für diese Strategie war der Sarin-Angriff vom 21. August auf Ghuta, einen von der Opposition kontrollierten Vorort von Damaskus. Die Beweislage spricht sehr stark dafür, dass dieser Angriff von Regierungstruppen ausging. Hunderte Zivilisten starben in dieser Nacht, darunter viele Kinder in ihren Schlafanzügen. Örtliche Beobachter melden, dass jeden Monat rund 5000 Menschen durch konventionelle Waffen sterben und viele Todesfälle Verstöße gegen das 6 Kriegsrecht darstellen. Rund 35 Prozent dieser Toten sollen Zivilisten sein. Auch Oppositionstruppen waren für Gräueltaten verantwortlich und ihr Verhalten gibt Anlass zu wachsender Sorge, seit islamistische Extremisten an Einfluss gewinnen, darunter auch solche mit Verbindungen zu al-Kaida. Doch der Großteil der zivilen Opfer geht auf das Konto der Regierung. Syrische Truppen haben wahllos bewohnte Gegenden in Oppositionsgebieten angegriffen und dabei ballistische Raketen eingesetzt, Artilleriegeschosse, Streumunition, Brandbomben, Aerosolbomben, Fassbomben und herkömmliche Sprengbomben sowie chemische Waffen. Teilweise wurden gezielt funktionierende Bäckereien, medizinische Einrichtungen, Schulen und andere zivile Einrichtungen angegriffen. Regierungstruppen haben darüber hinaus in ihrer Obhut befindliche Zivilisten und Kämpfer abgeschlachtet. Es kursieren Horrorgeschichten über das Schicksal der zahllosen Menschen, die willkürlich festgenommen wurden und in syrischen Gefängnissen gefoltert und teilweise auch getötet wurden. Ein immer größerer Anteil der syrischen Bevölkerung ist inzwischen vertrieben (schätzungsweise 2,3 Millionen Menschen im Ausland und 6,5 Millionen im Land) und notleidend (geschätzte zehn Millionen benötigen humanitäre Hilfe), aber die Regierung stellt der Versorgung der Zivilisten in den Oppositionsgebieten zahllose Hindernisse in den Weg, obwohl der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Oktober freien Zugang einforderte. Es schmerzt, dass die Völkergemeinschaft auf die Massaker und das Leid nur begrenzt reagierte. USPräsident Barack Obama hatte den Einsatz von Chemiewaffen als Überschreiten einer roten Linie bezeichnet und mit einem Militäreinsatz gedroht. Während Beobachter noch fragten, ob er nun reagieren würde, handelten die USA und Russland im September eine Vereinbarung aus, der zufolge Syrien sein Arsenal chemischer Waffen herausgeben soll. Berichten zufolge scheint Syrien größtenteils zu kooperieren, doch der Vertrag befasst sich mit einer einzigen Waffenart, noch dazu einer, die nur für einen Bruchteil der zivilen Opfer in diesem Konflikt verantwortlich ist. Es wird nicht genügend Druck auf Syrien ausgeübt, das Töten von Zivilisten auch mit herkömmlichen Waffen aufzugeben und Hilfsorganisationen Zugang zu belagerten Städten zu gewähren, und zwar auch grenzüberschreitend, da viele Notleidende in Oppositionsgebieten so am einfachsten und sichersten zu erreichen wären. In den vergangenen Monaten haben sich die Bemühungen um eine Lösung des Syrien-Konflikts vor allem auf die als „Genf-2” bekannten Friedensgespräche Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH 7 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch 8 Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH konzentriert, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass auf diplomatischem Weg in naher Zukunft eine Schlichtung zwischen den Kriegsparteien gelingt. Die Sorge, Damaskus werde die Teilnahme an „Genf-2” absagen, diente als jüngste Ausrede dafür, dass man nicht massiv auf Syrien einwirkt, die Ermordung von Zivilisten einzustellen und humanitäre Hilfe ungehindert fließen zu lassen. Die USA zögern zudem, Syriens zentralen und einflussreichsten Verbündeten Russland unter Druck zu setzen. Das hängt mit anderen Prioritäten zusammen, zuletzt damit, dass man Russlands Hilfe bei der Umsetzung der Chemiewaffen-Vereinbarung benötigte. Nur so konnte Präsident Obama vermeiden, dass wieder lauthals das von ihm ungeliebte militärische Eingreifen in Syrien gefordert wird. Der Iran unterstützt Syriens Präsidenten Baschar al-Assad, aber dieser Umstand rückte angesichts der Verhandlungen über Teherans Atomwaffenprogramm in den Hintergrund. Das Resultat: Auf diplomatischer Ebene gibt man sich selbstzufrieden, obwohl die syrische Regierung weiterhin größtenteils ungehindert Zivilisten ermordet. Welche Form von Druck wäre nötig, um dem Schlachten ein Ende zu bereiten? Bislang zeigen sich Regierungen aus dem Westen und arabischen Ländern unwillig, auf die aggressiveren Sanktionen gegen Banken zurückzugreifen, die sich an anderer Stelle als so erfolgreich erwiesen haben. Russland war nicht bereit, Syrien vom Sicherheitsrat vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) anklagen zu lassen, ein Waffenembargo zu verhängen oder auch nur die Massenmorde der syrischen Regierung zu verurteilen. Auch Washington hat sich öffentlich bislang nicht für ein Einschalten des IStGH ausgesprochen. Grund ist wohl offenbar auch, dass man vermeiden will, dass Vertreter Israels dafür angeklagt werden, Menschen in die relativ statischen Siedlungen auf den israelisch besetzen Golanhöhen gebracht zu haben. (Die expandierenden Siedlungen im Westjordanland sind eine andere Angelegenheit, aber eine Klage gegen Syrien vor dem IStGH wäre hiervon nicht berührt.) Auch die Nachbarn waren keine Hilfe. Libanon, Irak und Ägypten haben sich angeblich geweigert, die Sanktionen der Arabischen Liga umzusetzen. Sie schicken weiterhin Öl, das Syriens Tötungsmaschinerie am Laufen hält. Die Golf-Staaten, inklusive Saudi-Arabien und Katar, haben Berichten zufolge für Gräueltaten verantwortliche Extremistengruppen mit Geld und Waffen ausgerüstet und - genauso wie Kuwait – weggesehen, wenn ihre Bürger Geld spenden. Iran und Hisbollah unterstützen weiterhin die syrische Regierung. Die Völkergemeinschaft scheint nur allzu gern bereit, die Ermordung syrischer Zivilisten andauern zu lassen. Einige Regierungen bekräftigen sich in ihrer Apathie noch, indem sie verbreiten, dass sich hier rücksichtslose Kämpfer gegenseitig umbringen, sei es das syrische Militär, die Hisbollah oder Dschihadisten. Arabische Regierungen – ganz besonders solche aus der Golfregion – sehen den Konflikt vor allem unter dem Aspekt der Beziehungen zwischen Schiiten und Sunniten und dem schwelenden Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und Iran um die regionale Oberhoheit. Doch in erschreckend hohem Ausmaß ist dies ein Krieg gegen Zivilisten. Statt Selbstgefälligkeit wäre hier Dringlichkeit angesagt. Zentralafrikanische Republik und Südsudan In Syrien mag sie gescheitert sein, aber in den letzten Monaten des vergangenen Jahres zeigte das Prinzip der Schutzverantwortung ihre noch immer beträchtliche Kraft. Als in der Zentralafrikanischen Republik religiös motivierte Massenmorde ausbrachen, entsandten Frankreich und die Afrikanische Union (AU) Truppen zur Unterstützung der überforderten AU-Friedenstruppen. Die USA stellten über 100 Mio. Dollar bereit, die UN begann, eine eigene, dringend benötigte Blauhelm-Mission vorzubereiten. Um das Land vom Rand der Katastrophe zurückzuführen, ist noch sehr viel mehr nötig, aber die Völkergemeinschaft hat mehr Willen gezeigt, sich ihrer Verpflichtung zu stellen. Mitte Dezember starben im benachbarten Südsudan Hunderte Menschen, als sich ein politischer Konflikt zu ethnisch motivierten Angriffen auf Zivilisten und einen ausgewachsenen Bürgerkrieg ausweitete. Innerhalb weniger Tage genehmigte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusätzliche 5500 Blauhelme für den Südsudan. Das mag nicht ausreichen, um die Massenmorde zu unterbinden oder die brisante Lage zu stabilisieren, aber die rasche Reaktion zeigt, dass unter den richtigen Umständen weiterhin mit der Anwendung des Prinzips der Schutzverantwortung zu rechnen ist. In allen Fällen ging es bei der Intervention darum, das Abschlachten von Zivilisten durch Regierungstruppen und Milizen ebenso zu stoppen wie von Rebellen verübte Massaker – eine der kontroversesten Aufgaben des Konzepts. Ruanda und die Demokratische Republik Kongo Auch im Osten des Kongo reagierte die Völkergemeinschaft effektiv. Ruanda unterstützt dort seit Langem Rebellengruppen, die durch Misshandlungen 9 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch aufgefallen sind. Ruandas Hilfe hat zu den massiven Verlusten an Menschenleben der vergangenen zwei Jahrzehnte beigetragen. Bislang kam Präsident Paul Kagame damit durch, weil die Völkergemeinschaft sich schuldig fühlt, 1994 den Völkermord in Ruanda nicht unterbunden zu haben, und weil sie den wirtschaftlichen Fortschritt bewundert, der Ruanda unter Kagame gelang. Erst im Juni 2012 begannen sich die Dinge zu ändern. Da konnten Human Rights Watch und Experten der Vereinten Nationen zwingende Beweise dafür vorlegen, dass Ruanda die Rebellenorganisation M23 im Ost-Kongo unterstützt, obwohl die Gruppe für Gräueltaten bekannt ist. Erstmals kritisierten die westlichen Mächte öffentlich Ruandas Regierung und setzten sogar einige Hilfszahlungen aus. Mit den USA und Großbritannien gehörten die wichtigsten Unterstützer Ruandas zu den Kritikern. Dass es Ruanda rundweg bestritt, M23 zu unterstützen, schadete der Glaubwürdigkeit der Regierung und machte es nur noch wichtiger, den Druck zu erhöhen, bis die Unterstützung endet. Ein erster Erfolg: M23 zog sich aus Goma zurück, der wichtigsten Stadt der Region. Dennoch machte M23 weiter Jagd auf die Bewohner der Region. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen reagierte: Die militärischen Möglichkeiten der im Osten Kongos stationierten Blauhelme wurden beträchtlich aufgestockt. Als M23 dann im Oktober 2013 – weiterhin mit ruandischer Unterstützung – eine Offensive startete, riefen USAußenminister John Kerry und sein britischer Amtskollege William Hague bei Kagame an und sagten ihm, er solle das unterbinden. Dieses Mal schien die Kombination aus Druck und erhöhter militärischer Schlagkraft zu funktionieren. Ohne militärische Rückendeckung aus Ruanda zerfiel M23 angesichts des verstärkten Widerstands der Blauhelme innerhalb weniger Tage. Andere bewaffnete Gruppen und auch die Armee des Kongos verüben weiterhin Angriffe auf Zivilisten, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint der Osten Kongos erstmals seit Jahren frei zu sein von bewaffneten Gruppen, die mit Unterstützung Ruandas der Bevölkerung zusetzen. Missbrauch des Mehrheitsprinzips Zur Demokratie gehören drei zentrale Bestandteile: regelmäßige Wahlen, ein Rechtsstaat und Respekt gegenüber den Menschenrechten. Viele Diktaturen haben Angst davor, so etwas wie freie und gerechte Wahlen zuzulassen, aber wie autoritäre Regierungen gelernt haben, kann man Demokratie auch dem Namen nach zulassen. So erlauben sie beispielsweise Wahlen, häufig unter kontrollierten Bedingungen, und sonst nichts. Diese vorgetäuschte Demokratie lehnt grundlegende Prinzipien 10 ab: Man unterwirft sich nicht der Rechtsstaatlichkeit, achtet die für Minderheiten geltenden Menschenrechte nicht und muss auch keine offen und dauerhaft geführten öffentlichen Debatten erdulden. Viele vergleichsweise junge Regierungen haben vergangenes Jahr auf diese Weise das Mehrheitsprinzip missbraucht. Die Mehrheit – die manchmal durch Wahlen zustande kam, manchmal durch eigene Einschätzung - zu vertreten, dies war ihnen wichtiger als die Grundrechte zu respektieren, die innerhalb einer Demokratie funktionieren sollten. Einige Staats- und Regierungschefs verfolgten auch eine angenehm auf ihre Belange zugeschnittene Form der Demokratie, bei der es nur auf die Stimme am Wahltag ankam. Die restliche Zeit über waren öffentliche Debatten nicht willkommen. Das übliche Geben und Nehmen des Politikalltags war ihnen zuwider, also wurde versucht, öffentliche Proteste und Kritik in Presse und sozialen Medien zu unterdrücken, obwohl auch diese Bestandteil dessen sind, was eine echte Demokratie ausmacht. Am augenscheinlichsten war dies in Ägypten zu beobachten. Zunächst regierte die Muslimbrüderschaft um Präsident Mohammed Mursi auf eine Art und Weise, bei der sich Minderheiten und säkulare Gruppen ausgeschlossen fühlten. Nachdem die Armee im Juli Mursi stürzte, leitete die vom Militär dominierte Regierung von General Abdel Fattah al-Sisi eine Repressionspolitik ein, wie sie Ägypten seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Hunderte Demonstranten der Muslimbrüderschaft wurden getötet. Mursi hatte 2012 die Präsidentschaftswahlen nur knapp gewonnen, in der ersten Runde kam er auf 25 Prozent, in der Stichwahl auf 51,7 Prozent der Stimmen. Dennoch regierte er, als seien die Rechte der Minderheit nicht von Belang. Er rief eine verfassungsgebende Versammlung ein, in der nach Ansicht vieler die nicht zur Muslimbrüderschaft gehörenden Vertreter unterrepräsentiert waren. Dann boxte er per Referendum eine Verfassung durch, bei der nach Ansicht vieler die islamistische Lesart zulasten der Grundrechte ging, speziell der Rechte von Frauen und religiöser Minderheiten. Er verlieh sich selbst kurzzeitig Sonderbefugnisse, die ihn bei „Angelegenheiten der Souveränität“ über das Rechtssystem stellten. Und er tat wenig, um die Sicherheitskräfte zur Verantwortung zu ziehen, dabei waren sie für Tötungen, Folter und willkürliche Verhaftungen verantwortlich. In der Tat hatte das Militär unter Mursi mehr Spielraum, als es je unter Präsident Hosni Mubarak hatte, einem Ex-General. Es war der fehlgeleitete Versuch, die Stimmung nicht zu vergiften. Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Als im Juni 2013 Millionen Ägypter für Neuwahlen demonstrierten, nahm das Militär dies als Freibrief, Mursi zu stürzen. Man handle für die Bevölkerungsmehrheit, behauptete das Militär, ohne dass dies durch Wahlen untermauert war. Dann missachteten die Generäle die Grundrechte noch stärker, als es Mursi je gewagt hätte. Sie legten eine Verfassung vor, die Frauen und religiösen Minderheiten mehr Schutz ihrer Rechte versprach, doch die Militärgerichte für Zivilisten blieben erhalten, außerdem wurde das Militär stärker der Überwachung durch Zivilisten entzogen. Anschließend handelte das Militär, als unterliege man überhaupt keinen gesetzlichen Verpflichtungen. wurden aus dem Verfassungsentwurf gestrichen, ebenso das Bestrafen von Angriffen auf „heilige Werte“ – ein schwammiger Passus, der zur Bestrafung friedlicher Meinungsfreiheit hätte dienen können. Ein Gesetzentwurf zur „Immunisierung der Revolution“ wurde fallen gelassen, hätte das Gesetz doch Menschen von politischer Aktivität ausschließen können, die sich außer der Zugehörigkeit zur falschen Partei nichts zuschulden hatten kommen lassen. Auch in anderen Ländern behauptete man, für die Mehrheit zu sprechen, und ließ dabei Menschenrechte außer Acht. In der Türkei hat Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan wiederholt eine parlamentarische Mehrheit erringen können, aber seine Mit exzessiver und brutaler Gewalt zerschlugen die von Regierungsmethoden scheinen immer autokratischer zu Militärs gesteuerten Behörden Protestlager der werden. Er zeigt abnehmende Bereitschaft, Muslimbruderschaft in Kairo. Bis zu 1000 Menschen Widersachern, Kritikern oder Rivalen zuzuhören. wurden dabei getötet, wahllos und in einigen Fällen Wendepunkt war Erdogans Vorhaben, einen der wenigen vorsätzlich. Tausende Anführer und Gefolgsleute der Parks im Stadtzentrum von Istanbul durch ein Muslimbruderschaft wurden zusammengetrieben und Einkaufszentrum zu ersetzen. Als die Polizei im Mai einen inhaftiert. Manchmal wurde die Verhaftung offiziell dementiert, nicht selten waren die Anklagepunkte an den kleinen Sit-in gegen das Projekt mit Gewalt zerschlug, löste das eine deutlich größere Besetzung des Parks und Haaren herbeigezogen oder es gab erst gar keine Massendemonstrationen in anderen Städten des Landes Anklage. Die Muslimbruderschaft wurde offiziell zur aus. Erdogan behandelte die Demonstrationen wie eine Terrororganisation erklärt, die Mitglieder wurden strafpersönliche Beleidigung und entsandte wiederholt rechtlich belangt und teils zum Tode verurteilt, ihr Polizei, die die Proteste auflösen sollte. Die Polizisten Vermögen wurde beschlagnahmt. Auch die gingen mit übermäßiger Gewalt vor und beschossen Vermögenswerte angeschlossener medizinischer Einrichtungen wurden eingefroren; es gab Drohungen, die Demonstranten gezielt mit Tränengaskanistern, was Tote und Schwerverletzte nach sich zog. Auch nachdem die Moscheen der Bruderschaft zu übernehmen und die Proteste abebbten, übten Erdogan und sein Zirkel starken Geistlichen auszutauschen. Druck auf Medienunternehmen aus, die nach Erdogans Die Regierung verabschiedete ein Gesetz, das Meinung zu freundlich mit der politischen Opposition Demonstrationen nur mit offizieller Genehmigung umgingen. Obwohl er die Polizei sehr für ihren Umgang erlaubte – aber Genehmigungen wurden nicht erteilt. mit den Demonstranten lobte, zögerte Erdogan nicht, als Dann wurde die Unabhängigkeit des Militärs über alles ein Korruptionsskandal Regierungsminister und seinen hinaus ausgeweitet, was Mubarak zugelassen hatte, und Sohn zu erreichen drohte. Dutzende Beamte und sogar sogar noch über Mursis Freizügigkeit hinaus. Obwohl ein Staatsanwalt wurden degradiert. viele fehlgeleitete Liberale diese Maßnahmen unterIn Burma schrieb die Regierung um Präsident Thein Sein stützten, fing die Regierung an, die säkularen Aktivisten zu unterdrücken, die drei Jahre zuvor die Speerspitze der sich Reformen auf die Fahnen geschrieben, aber noch immer bleiben Fragen, inwieweit die Regierung bereit ist, Tahrir-Platz-Bewegung gebildet hatten. Seit Mubaraks offenen politischen Wettbewerb zu erlauben – und etwa Sturz im Februar 2011 wird Ägypten das zweite Mal von Oppositionsführerin Aung San Sui Kyi für die einer Regierung beherrscht, die wenig motiviert scheint, sich einzuschränken und grundlegende Rechte zu achten. Präsidentschaftswahlen zuzulassen. Besonders enttäuschend war die Reaktion der Regierung auf die Tunesien zeigt, welch anderen Weg Ägypten hätte Gewalttaten, die buddhistische Extremisten gegen nehmen können. 2011 ging die islamistische EnnahdhaRohingya und andere Muslime verübten: Häufig sahen Partei aus den ersten freien Wahlen zur Sicherheitskräfte tatenlos zu, während der Mob angriff, Nationalversammlung als deutlicher Sieger hervor. Die und es wurde wenig unternommen, Übeltäter der Justiz Wirtschaft war am Boden, die politischen Lager zuzuführen. Sicherheitskräfte, die bei den verschiedenen gespalten, aber dennoch verständigten sich die großen ethnisch motivierten Bürgerkriegen in den Randgebieten Parteien auf Kompromisse, die wichtige Rechte des Lands Kriegsverbrechen begangen hatten, mussten bewahren. Passagen zur „ergänzenden“ Rolle der Frau sich nicht vor Gericht verantworten. 11 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Aber auch Aung San Suu Kyi hat enttäuscht. Wohlwissend, dass die Armee über ihre Kandidatur entscheidet, hat sie die Menschenrechtsverletzungen der Militärs nicht angeprangert. Und weil die verletzlichen und staatenlosen Rohingya in Burma so unbeliebt sind, hat sie sich geweigert, ihnen, als sie gewaltsam angegriffen wurden, verbal zu Hilfe zu eilen. Die Nobelpreisträgerin verteidigt ihre Haltung damit, dass sie immer eine Politikerin war und es auch weiterhin sei. Die Welt ist offenbar einem Irrtum aufgesessen, als sie glaubte, dass ein Opfer von Menschenrechtsverletzungen diese Rechte auch gewissenhaft verteidigen würde. In Thailand nutzte die Regierung von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ihre Stimmenmehrheit für ein Amnestiegesetz, von dem – nicht zufällig – ihr älterer Bruder profitiert hätte, der ehemalige Premier Thaksin Shinawatra, der seit 2006 im Exil lebt, weil ihm in Thailand wegen Korruption der Prozess gemacht werden soll. Die Ministerpräsidentin hat es jedoch mit ihrer Stimmenmehrheit übertrieben und damit zahlreiche Demonstrationen ausgelöst. Viele Oppositionelle wollen jedoch scheinbar einen Staatsstreich erzwingen, weil sie fürchten, bei Neuwahlen erneut zu verlieren. Eine derartige Strategie stünde im Widerspruch zu demokratischen Prinzipien: Ein Wahlsieg ist kein Freibrief für Verstöße gegen Menschenrechte, aber Wahlen sind nun einmal die Grundvoraussetzung für Demokratie. In Kenia hatte die Regierung um Präsident Uhuru Kenyatta und dessen Stellvertreter William Ruto die Wahlen mit 50,07 Prozent der Stimmen hauchdünn gewonnen und konnte so einer Stichwahl entgehen. Seitdem setzt die Regierung alles daran zu verhindern, dass Kenyatta und Ruto wegen der Rolle, die sie bei der Gewaltwelle nach den Wahlen 2007/2008 gespielt haben sollen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. Ruto hat ebenso wie Kenyattas Anhänger dagegen angekämpft, dass sich ein kenianisches Sondertribunal mit der Gewalt befasst. Sie bauten darauf, dass der IStGH nicht aktiv werden würde. Falsch gedacht. Nun hat der IStGH Kenyatta und Ruto angeklagt und die beiden beschweren sich über diese „Einmischung in ihre Regierungsfähigkeit”. Das gilt umso mehr, seit im Oktober die islamistische Al-Schabab-Miliz ein Einkaufszentrum in Nairobi angriff. Weiter monieren die beiden, dass sich der IStGH ihrer Meinung nach ausschließlich auf afrikanische Verdächtige konzentriere – was aber doch gleichzeitig bedeutet, dass das Augenmerk auf Opfern in Afrika liegt! Als Alternative bieten sie nicht etwa eine Gerichtsverhandlung auf nationaler Ebene an, sondern wollen Straffreiheit. Unausgesprochen und fälschlicherweise nehmen sie an, 12 ihr Wahlsieg wiege mehr als das Recht der Opfer und ihrer Familien auf Gerechtigkeit. Der Versuch von Kenyatta und Ruto, afrikanische Staaten zu einem Massenrückzug vom IStGH zu bewegen, ist gescheitert, aber es gelang ihnen, bei ihrem Streben nach Straffreiheit die Afrikanische Union einzuschalten. Man kann nur hoffen, dass anderen afrikanischen Staats- und Regierungschefs die afrikanischen Opfer wichtiger sind als die Mächtigen, die die Menschen zu Opfern machen. In Russland war Präsident Wladimir Putin augenscheinlich aufgerüttelt von dem Ausmaß, in dem die Bürger 2011 und 2012 protestierten, weil sich Putins Partei angeblich den Sieg bei den Parlamentswahlen ergaunert hatte. Seit damals hat die Regierung einiges unternommen, um zu verhindern, dass die Opposition weiteren Widerstand leistet. So wurden Protestmöglichkeiten eingeschränkt, Abweichler bestraft und kritische Nichtregierungsorganisationen, die Mittel aus dem Ausland erhalten, als „Agenten des Auslands“ diskreditiert. Darüber hinaus hat der Kreml seiner konservativen Basis zuliebe Maßnahmen verabschiedet, die gegen Menschenrechte verstoßen. So wurde, unter dem Deckmäntelchen des Kinderschutzes, „homosexuelle Propaganda“ verboten und es wurden Aktivisten wie die Punkband „Pussy Riot“ und die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit unangemessen harten Anklagen belegt. Offenbar in dem Versuch, im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Sotschi ausländische Kritik zu umgehen, begnadigte Putin dann viele von Russlands bekanntesten Gefangenen. Aber das zeigte in erster Linie nur, wie willkürlich seine Herrschaft ist, denn das harte Durchgreifen gegen Regierungskritiker endete damit nicht. So wurden neue Opfer in die Drehtür des von der Politik gesteuerten russischen Justizapparats gezogen. In der Ukraine beschloss Präsident Viktor Janukowitsch, sein Land nicht näher an die Europäische Union zu führen. Die Folge waren Massendemonstrationen in Kiew. Die Behörden ließen die Proteste größtenteils zu und als Fälle von Polizeibrutalität gegen Demonstranten und berichtende Journalisten weitergehende Proteste im Rest des Landes auslösten, sagten die Behörden zu, die Verantwortlichen für die Gewalt zur Rechenschaft zu ziehen. Bislang haben sie jedoch vor allem versucht, Demonstranten einzuschüchtern, die sich über stockende Ermittlungen beschweren. In Venezuela wurde Nicolás Maduro im April zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt. Die Opposition zweifelte das Wahlergebnis allerdings an. Daraufhin verprügelten staatliche Sicherheitskräfte Anhänger von Maduros Widersacher Henrique Capriles, die Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH 13 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Protestaktionen gegen den Staat durchführten. Es kam zu willkürlichen Verhaftungen. Einige der Verhafteten berichteten, man habe sie gefragt, wer ihr Präsident sei. Antworteten sie nicht „Nicolás Maduro“, wurden sie geschlagen. Trotz glaubwürdiger Berichte über Missbrauchsfälle ging die Staatsanwaltschaft dem jedoch nicht nach. Als Capriles zu einer friedlichen Demonstration in der Hauptstadt aufrief, sagte Maduro, er werde das nicht zulassen und gegen derartigen „Faschismus“ „mit eiserner Faust“ durchgreifen. Alle Schuld für Gewalttaten nach der Wahl liege bei Capriles. Als die Opposition eine Neuauszählung der Stimmen forderte, verweigerte der Präsident der Nationalversammlung – ein Parteigenosse Maduros – anderen Abgeordneten so lange das Rederecht, bis sie einzeln Maduros Wahlsieg anerkannten. Maduros Wohnungsbauminister drohte, alle Behördenmitarbeiter zu feuern, die sich kritisch über die Regierung äußerten. Auf Geheiß Maduros verabschiedeten Mitglieder der Partei des Präsidenten im November ein Gesetz, das ihm weitreichende Machtbefugnisse einräumt und erlaubt, per Dekret zu regieren. Noch immer werden Medienunternehmen, die sich kritisch über die Regierungspolitik äußern, eingeschüchtert und sanktioniert. Menschenrechtlern wurden Klagen angedroht und die Finanzierungsmöglichkeiten beschnitten. Internet blockieren, taugt jedoch nicht dafür, den Austausch zu verhindern, den Social-Media-Websites wie Sina Weibo den Chinesen untereinander ermöglichen. Geschätzte 400 Millionen Chinesen nutzen inzwischen soziale Medien, Tendenz steigend. Da fällt es selbst einer mit Zensoren so gut ausgerüsteten Regierung wie der chinesischen schwer, Schritt zu halten. Soziale Medien haben den Bürgern Chinas neue Wege eröffnet, Fehlverhalten des Staats und der Behörden anzuprangern. Gelegentlich bleibt der Regierung kein anderer Weg, als dem tatsächlich nachgehen zu müssen. Nicht nur bei Wahlen, auch auf kultureller Ebene wird das Mehrheitsprinzip missbraucht. Sei es, dass in SaudiArabien oder Afghanistan die Rechte der Frauen beschnitten werden, sei es, dass in Uganda oder Russland die Rechte von Schwulen und Lesben untergraben werden – Politiker, die Missbrauch verüben, sprechen häufig von einer dominanten oder traditionellen Kultur, als ob dies rechtfertige, die Rechte derjenigen zu verletzen, die von dieser Kultur abweichen, oder die Diskriminierung dieser Personen voranzutreiben. Diese Politiker tun normalerweise so, als würden ihnen die Alternativen zu ihren Traditionen von außen aufgezwungen, als ob alle Homosexuellen in ihrem Land importiert seien oder alle Frauen, die sich gegen Diskriminierung wehren, Umsiedler seien. Der einzige Zwang dabei geht von den dominanten Eliten dieser In China traut sich die Regierung nicht einmal, ranghohe Länder aus und ist gegen jene gerichtet, die es wagen, Beamte wählen zu lassen, behauptet jedoch, die selbst anders zu sein oder für ihre Rechte einzutreten. Niemand ernannte Führung der Kommunistischen Partei spreche beharrt darauf, dass eine bestimmte Frau geschlechtsstellvertretend für die Bevölkerungsmehrheit. Die neue spezifische Rollen ablehnt oder dass bestimmte Schwule Regierung unter Präsident Xi Jinping hat einige bescheidene Reformen durchgeführt. So wurde die „Umerziehung oder Lesben ihrer eigenen Sexualität folgen anstatt den Vorstellungen der Regierung. Tun sie es dennoch, lassen durch Arbeit“ abgeschafft, doch andere Methoden, Menschen ohne Gerichtsverhandlung wegzusperren, exis- ihnen die Bestimmungen zur Vermeidung von Diskriminierung die Wahl. Es ist ihre Wahl, nicht die einer tieren weiter. Auch wurden die Bedingungen für chinesiRegierung. Die Völkergemeinschaft wird aktiv, wenn eine sche Paare gelockert, ein zweites Kind zu bekommen, doch der offizielle Zwang und die Einmischung des Staats Regierung diese Wahlmöglichkeit verhindert, nicht, um jemandem eine bestimmte Wahl aufzuzwingen. in derart persönliche Angelegenheiten dauern an. Beibehalten hat die neue Regierung auch die Intoleranz gegenüber organisierter Kritik. Vergeltungsmaßnahmen Nationale Sicherheit: Vorwand für sahen sich sogar Journalisten ausgesetzt, die bei Rechtsverletzung Medienunternehmen arbeiten, die sich mit heiklen Im Januar 2013 begann für Präsident Obama die zweite Themen wie dem unerklärlichen gewaltigen Reichtum Amtszeit. An seinen enttäuschenden Leistungen in befassten, zu dem die chinesische Staatsführung und Sachen nationale Sicherheit hat sich seitdem wenig ihre Familien gekommen sind. Nobelpreisträger Liu geändert. Zugutehalten muss man ihm, dass er nach Xiaobo sitzt weiterhin im Gefängnis eine elfjährige Strafe seinem Amtsantritt Folter untersagte und CIA-Gefängnisse ab, weil er für Demokratie eingetreten ist; seine Frau Liu schließen ließ, in denen Verdächtige spurlos für Monate Xia steht weiterhin widerrechtlich unter Hausarrest. oder Jahre verschwanden. So endeten zwei der schändScheinbar die größte Bedrohung für die chinesische lichsten Praktiken, die die Bush-Regierung als Reaktion Führung ist der Aufstieg der sozialen Medien, untergräbt auf die Anschläge vom 11. September 2001 begonnen er doch ihr Monopol auf die öffentliche Meinung. Chinas hatte. Doch Obama hat sich auch geweigert, jemanden „Great Firewall“ soll den Zugang zum ausländischen 14 Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH 15 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch für diese Menschenrechtsverstöße anklagen zu lassen. Er hat Bemühungen verhindert, diese Verstöße zu untersuchen und den Opfern Wiedergutmachung zukommen zu lassen. befolgt werden. Noch immer sterben Zivilisten und die Regierung Obama weigert sich bis auf wenige Ausnahmen, öffentlich Verantwortung für die Angriffe zu übernehmen. Darüber hinaus hat Obama wenig für sein Versprechen getan, das Gefangenenlager Guantanamo Bay zu schließen. Auch ließ er weiter Verdächtige vor Militärgerichte bringen, obwohl diese Gerichte grundlegend fehlerhaft sind und ihre Bilanz kläglich ist. In zwei Bereichen, bei gezielten Tötungen – häufig durch Drohnen – und bei der elektronischen Massenüberwachung, hat er die Programme seines Vorgängers aufgestockt und erweitert. Washington scheint es überhaupt nicht eilig damit zu haben, zu zeigen, dass die Verwendung von Drohnen für Angriffe rechtmäßig ist. Momentan ist die US-Regierung praktisch die einzige, die Drohnen für diesen Zweck nutzt. Aber das wird sich ändern und Washington wird zweifelsohne bedauern, Präzedenzfälle geschaffen zu haben. Regierungen können nun jeden, den sie als Bedrohung ansehen, als „Kämpfer“ bezeichnen, mit dem nach den Regeln der Kriegsführung umgegangen werden kann anstatt nach den strengeren Bestimmungen internatioanler Menschenrechtskonventionen. Bei ihrer Drohnenpolitik hat die Regierung Obama weder ihre eigene zu Protokoll gegebene Strategie eingehalten noch deutlich gemacht, welche rechtliche Grundlage ihrer Meinung nach spezielle Angriffe rechtfertigt. Formell hat die Regierung Obama dem von der Vorgängerregierung ausgerufenen „globalen Krieg gegen den Terror“ abgeschworen. Dennoch beteuert sie, man stehe in einem bewaffneten, geographisch nicht eingegrenzten Konflikt mit den Taliban, al-Kaida und deren Verbündeten. Die Regierung hat gezielte Tötungen in Pakistan, dem Jemen und in Somalia durchgeführt und erklärt, man stehe im Krieg mit diesen bewaffneten Gruppen, oder sich auf die nationale Sicherheit berufen. Doch berücksichtigt man, dass an vielen dieser Orte die Gewalt gegenüber den Vereinigten Staaten bestenfalls sporadisch ist, scheint es alles andere als eindeutig, dass hier überhaupt die freizügigeren Gesetze der Kriegsführung anzuwenden sind. Selbst wenn: Auf dieser Rechtsgrundlage wurden unrechtmäßig Zivilisten getötet, ohne dass die USA dies untersucht hätten oder dass Entschädigungsleistungen an die Opfer oder deren Familien bekannt wurden. Auch internationale Menschenrechtsstandards lassen den Einsatz tödlicher Gewalt zu, allerdings nur unter einem deutlich enger gesteckten Rahmen, nämlich nur dann, wenn die Gewalt absolut notwendig ist, um eine unmittelbare tödliche Bedrohung abzuwenden. So betrachtet wären noch deutlich mehr Opfer der Drohnenangriffe unrechtmäßig ums Leben gekommen. Obama deutete in einer Rede im Mai an, dass die Regeln zur Kriegsführung ab einem nicht näher spezifizierten Zeitpunkt nicht mehr gelten sollten. Weiter skizzierte er Regeln, die bei Drohnenangriffen die Opfer unter Zivilisten reduzieren sollen – Regeln, die in vielerlei Hinsicht Menschenrechtsstandards näher sind als den Bestimmungen zur Kriegsführung, auf die sich CIA und Militär berufen. Aber es ist alles andere als eindeutig, dass diese angekündigten Strategien auch tatsächlich 16 Dank der Enthüllungen von Whistleblower Edward Snowden weiß die Welt nun von der praktisch uneingeschränkten elektronischen Massenüberwachung, die die US-Regierung gemeinsam mit einigen Verbündeten durchführt, speziell mit Großbritannien. Niemand stellt in Frage, dass Regierungen aus Gründen der nationalen Sicherheit nach Vorlage ihrer Beweise manchmal zielgerichtet überwachen müssen. Aber die Massenüberwachung, die die USA ohne derartige Einschränkungen durchführen, hat in einer modernen Welt, in der elektronische Kommunikationsmöglichkeiten praktisch unverzichtbar sind, das Recht auf Privatsphäre größtenteils ausgelöscht. Zur Rechtfertigung ihres Verhaltens beruft sich die USRegierung auf einige rechtliche Annahmen, die einer ernsten Überprüfung nicht standhalten, auch wenn die meisten von einem geheimen und respektvollen Foreign Intelligence Surveillance Court ratifiziert wurden, einem Gericht, dem nur die Argumentation der Regierung vorgetragen wird. So hat die Regierung keinerlei Hemmungen, Metadaten über möglichst alle Telefonanrufe in den USA zu führen, weil gemäß stark veralteter Bestimmungen niemand ein rechtmäßiges Anrecht auf Privatsphäre hat, was diese Informationen anbelangt. Schließlich teile man diese Informationen ohnehin mit seinem Telefonanbieter. Obwohl ein hoher Prozentsatz der globalen Online- und Telefonkommunikation über die USA läuft, stellt sich die Regierung auf den Standpunkt, dass nicht in den USA lebende Ausländer keinerlei Recht auf Privatsphäre haben – nicht einmal, was den Inhalt ihrer Kommunikation anbelangt. Und die Regierung macht es sich bequem: Das Recht auf Privatsphäre sei nicht betroffen, so lange man Kommunikationsinformationen nur sammle. Es greife erst, wenn man die Daten prüfe! Als sei es okay, wenn die Regierung die Schlafzimmer aller Menschen per Videokamera überwache, die Aufnahmen Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH speichere und sich nur dann ansehe, wenn ein zwingender Grund vorliegt. Die weltweite Empörung über das Herumtrampeln auf der Privatsphäre lässt hoffen, dass ein Wandel eintritt. So haben Brasilien und Deutschland beispielsweise eine Resolution bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen eingebracht. In dem einstimmig verabschiedeten Aufruf heißt es, Verletzungen der Privatsphäre müssten weiter geprüft werden im Kontext inländischer und extraterritorialer Überwachung und auch auf Massenebene. Diese Entwicklung ist begrüßenswert, gibt es doch wenig Transparenz, inwieweit neben den USA und ihren engsten Verbündeten auch andere Regierungen Überwachungsmaßnahmen vorgenommen haben. Trotz aller Proteste ist es beunruhigend, dass Länder, die sich an die Menschenrechte halten, so wenig Bereitschaft zeigen, dem Informanten Snowdon Unterschlupf vor den Bemühungen der USA zu gewähren, ihn wegen Spionage vor Gericht zu bringen. Genutzt hat das leider Russland: Das Land hat Snowden vorläufiges Asyl gewährt und präsentiert sich nun als Vorkämpfer für den Schutz der Privatsphäre. Man muss Obama zugutehalten, dass er einen Reformausschuss ins Leben gerufen hat, der auch 46 Änderungen der Strategie vorschlug – ein sehr guter Ausgangspunkt für eine Reform. So forderte der Ausschuss unter anderem, dass die Regierung nicht länger massenhaft Metadaten sammelt, dass die Privatsphäre von Nicht-US-Bürgern besser geschützt wird und dass ihr Handeln transparenter wird. Noch ist jedoch unklar, ob irgendeine dieser Empfehlungen umgesetzt wird. Die USA sind zu weit gegangen und nun besteht die Gefahr, dass andere Regierungen – teilweise auch solche mit wenig Achtung vor den Menschenrechten – erzwingen, dass Nutzerdaten innerhalb ihrer eigenen Grenzen bleiben. Das Potenzial für mehr Internetzensur nimmt so zu. Mehr Schutz für die Menschenrechte Der Schutz der Menschenrechte hängt von vielen Elementen ab: Die Szene der Aktivisten und NGOs muss lebendig sein, die Öffentlichkeit muss an die Bedeutung von Grundrechten glauben, Regierungen müssen dafür eintreten, diese Prinzipien zu bewahren. Außerdem ist eine internationale Infrastruktur entstanden, die den Schutz der Menschenrechte stärken soll. Zwei Entwicklungen aus dem vergangenen Jahr sind dabei besonders hervorzuheben: Erstens wird der UNMenschenrechtsrat in Genf wie erhofft immer stärker zu einer führenden multilateralen Institution, die für den Schutz der Menschenrechte eintritt. Zweitens wurden zwei neue Abkommen beschlossen, die den Schutz einiger der am stärksten gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen verbessern sollten. UN-Menschenrechtsrat macht Mut Nach furchtbarem Start zeigte der Rat im vergangenen Jahr mehr Potenzial. 2006 war der Menschenrechtsrat als Nachfolger der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen gegründet worden. Die Kommission hatte an Glaubwürdigkeit verloren, nachdem ihr repressive Regierungen in Scharen beitraten und versuchten, mit ihren Stimmen Rügen abzuwenden. Beim Rat sind die Aufnahmebedingungen strenger, aber in den ersten Jahren war er dennoch wenig erfolgreicher als sein Vorgänger. In den vergangenen Jahren hat der Rat jedoch gezeigt, was in ihm steckt. Wichtig war, dass die USA dem Rat beigetreten sind, nachdem Obamas Vorgänger Bush das Gremium hatte links liegen lassen. Auch andere Regierungen spielten eine wichtige Rolle, beispielsweise Mexiko, die Schweiz, Chile, Botswana, Brasilien, Argentinien, Mauritius, Benin, die Malediven, Costa Rica sowie mehrere EU-Staaten. Gemeinsam konnten sie politische Gräben überwinden und die Apathie abschütteln, die in der Vergangenheit oft ein effektives Arbeiten verhindert hatte. Selbst traditionell eher zurückhaltendere Länder wie Nigeria und Thailand konnten zu mehr Produktivität bewegt werden. Die positivsten Ergebnisse zeigten sich im Fall Sri Lankas. 2009 starben dort zum Ende des Konflikts mit den Tamil Tigers rund 40 000 Zivilisten. Was machte der Rat? Er gratulierte der Regierung als erstes zu ihrem Sieg. Doch in den vergangenen zwei Jahren wurde die Regierung Sri Lankas gedrängt, ihr Versprechen einzuhalten, Kriegsverbrechen beider Seiten zu untersuchen und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Ein weiterer von mehreren positiven Schritten: Im März 2013 wurde ein Untersuchungsausschuss gegründet, der Beweise für Menschenrechtsverbrechen Nordkoreas sammelt. Das ist der erste Schritt hin zu einer möglichen Anklage der Verantwortlichen. Diese und ähnliche Schritte zeigen, dass im Rat eine Mehrheit existiert, die für den Schutz der Menschenrechte eintritt. Daran ändert auch nichts, dass Ende 2013 Länder wie China, Kuba, Russland und SaudiArabien in den Rat gewählt wurden, die in der Vergangenheit einer strikten Einhaltung der Menschenrechte ablehnend gegenüberstanden. Mit den richtigen diplomatischen Anstrengungen kann diese 17 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Mehrheit aktiviert werden, um auf die schwersten Menschenrechtskrisen zu reagieren. Zwei neue Abkommen zum Schutz der Menschenrechte Zu den schutzbedürftigsten Arbeitnehmern gehören die Abermillionen Frauen und Mädchen, die weltweit als Reinigungskräfte und Pflegepersonal in Haushalten arbeiten. Sie arbeiten isoliert und seit jeher abgeschnitten von dem grundlegenden Schutz, der den meisten anderen Arbeitnehmern durch nationales Recht gewährt wird. Das Risiko, wirtschaftlich ausgebeutet zu werden, ist bei ihnen hoch, ebenso das Risiko des körperlichen oder sexuellen Missbrauchs und des Menschenhandels. Viele Regierungen zögern bislang, die Arbeitsbedingungen in Privathaushalten zu regulieren, und die Arbeitgeber tischen gerne das Märchen auf, dass diese Arbeiter wie Familienmitglieder behandelt werden. Diese Zustände sollten sich im Rahmen des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte ändern, das seit September 2013 gilt. Das Abkommen schützt Arbeitnehmer vor Missbrauch und Schikane und gewährt ihnen zentrale Rechte wie einen freien Tag pro Woche, eine Begrenzung der Arbeitszeit und einen Mindestlohn. Hauspersonal, Gewerkschaften, Migrantenorganisationen und Menschenrechtsaktivisten nutzen die Konvention als Hebel, um nationale Reformen zu fordern. Seit das Übereinkommen vor zwei Jahren verabschiedet wurde, haben Dutzende Länder wichtige Reformen beschlossen, von weitreichenden neuen Gesetzen in den Philippinen und Argentinien bis zu neuen Schutzmaßnahmen in der Verfassung Brasiliens. Noch ist viel zu tun, aber der bisherige Zustand, dass Hausangestellte im Landesrecht als Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt werden, ändert sich. Fortschritte hat die Welt auch beim Umgang mit Quecksilber und den Gefahren der Quecksilbervergiftung erzielt. Hier herrscht Einigkeit, dass die Menschen das Recht auf die bestmöglichen Gesundheitsstandards haben. Beim Großteil des weltweiten Kleinbergbaus wird Gold mithilfe von Quecksilber gewonnen. Quecksilber ist giftig und besonders für Kinder schädlich, es kann zu lebenslangen körperlichen und geistigen Schäden führen. Im Oktober wurde ein Abkommen verabschiedet, das Regierungen verpflichtet, die gefährlichsten Verwendungszwecke von Quecksilber im Bergbau abzuschaffen und andere, quecksilberfreie Arten des Goldschürfens zu fördern. 18 Zusammenfassung 2013 war ein unruhiges Jahr mit zahlreichen Gräueltaten in einigen Ländern und einem Vormarsch von Repressalien in anderen Staaten. Dennoch war 2013 auch ein Jahr, in dem die Befürworter der Menschenrechte sich vehement widersetzten. In einigen Fällen konnten sie einen Sieg davontragen. Häufig führten die Auseinandersetzungen nicht sofort zu einem Sieg, aber erschwerten den Missbrauch zumindest – eine Strategie, die langfristig eher dazu führt, dass die Menschenrechtsverletzungen abklingen. Das Prinzip der Schutzverantwortung stand zweifelsohne unter Druck. Der Preis, den die syrische Bevölkerung dafür bezahlen musste, war unsäglich hoch. Aber die Doktrin zeigte sich als so widerstandsfähig, dass sie von Massenverfolgung bedrohten Menschen in mehreren afrikanischen Ländern Unterstützung brachte. Eine beträchtliche Zahl von Staats- und Regierungschefs beschloss, die Mehrheitsverhältnisse nach eigenem Gusto zu messen und entsprechend zu regieren, ohne dabei diejenigen Rechte zu respektieren, die die Beteiligung aller Teile der Gesellschaft am politischen Leben vorsehen oder es zumindest allen Bürgern ermöglichen, frei von Missbrauch durch den Staat zu leben. Öffentliche Proteste führten allerdings dazu, dass den Staats- und Regierungschefs die erhoffte Legitimierung ihres Vorgehens versagt blieb. Das altbekannte Problem, das im Namen der Terrorbekämpfung Menschenrechte verletzt werden, verlagerte sich auf die elektronische Massenüberwachung und gezielte Tötungen durch Drohnen. Der traditionelle Versuch, rechtliche Fragen mit dem Verweis auf die nationale Sicherheit abzuwürgen, ist ganz klar gescheitert. Das Jahr brachte alles in allem mehr als genug Leid, bot jedoch auch die Hoffnung, dass daran gearbeitet wird, diese Menschenrechtsverletzungen einzudämmen. Kenneth Roth ist Executive Director von Human Rights Watch Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Essay: Die überfällige Rückkehr eines Rechts Privatsphäre im Zeitalter der Überwachung Von Dinah PoKempner „Technik ist in die heiligen Abschnitte des Privatlebens eingedrungen. Unerwünschte Enthüllungen gefährden unsere Sicherheit, unsere Würde und unsere grundlegendsten Werte. Das Gesetz muss sich dieser Herausforderung stellen und unsere Rechte schützen.“ Klingt das nicht vertraut? Dabei stammt das Zitat von Samuel Warren und Louis Brandeis, die 1890 in einem Artikel für den „Harvard Law Review“ das „Recht auf Privatsphäre“ verkündeten. Heute stehen wir wieder an einem derartigen Scheideweg. Bei den technischen Neuerungen, die ihnen damals als Bedrohung erschienen, handelt es sich um Fotografie und den Aufstieg der Massenpublikationen. Das mag uns eher antiquiert vorkommen, doch die Bedrohung, die unerwünschte Enthüllungen für die emotionale, geistige und sogar körperliche Gesundheit darstellen, war damals scheinbar genauso groß wie im digitalen Zeitalter. Unsere neue Anfälligkeit kommt in einer Phase, in der nahezu alle Aspekte des täglichen gesellschaftlichen Lebens ins Internet umziehen. Parallel dazu sind Firmen und Regierungen inzwischen in erschreckendem Maße imstande, diese Flut digitaler Informationen anzuhäufen und zu durchsuchen. Das verleiht ihnen die Macht, uns außergewöhnlich detailliert zu „kennen“. Wir leben in einer Welt, in der wir unser Leben über soziale Medien mit anderen teilen und immense Mengen an persönlichen Informationen preisgeben im Tausch für eine möglichst reibungslose und bequeme OnlineErfahrung. Einige Fragen inzwischen, ob da Privatsphäre als Konzept überhaupt noch Relevanz hat. Aber es ist nicht nur relevant, sondern auch von zentraler Wichtigkeit. Privatsphäre ist ein Schlüsselrecht. Von ihm hängt ab, inwieweit wir nahezu jedes andere Recht ausüben können, nicht zuletzt das Recht, uns mit den Menschen unserer Wahl auszutauschen und zu umgeben, politische Entscheidungen zu fällen, unsere Religion auszuüben, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, Bildungsangebote zu nutzen, herauszufinden, wen wir lieben, und unser Familienleben zu gestalten. Privatsphäre ist nichts weniger als der Schutzraum, in dem wir herausfinden, was wir denken und wer wir sind. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Autonomie als Individuum. Privatsphäre ist ein Recht, das wir oftmals als gegeben ansehen. Wie wichtig sie ist, hat sich 2013 durch das Bekanntwerden amerikanischer Regierungsunterlagen gezeigt. Edward Snowden, ein ehemaliger Mitarbeiter der National Security Agency (NSA), veröffentlichte einen steten Strom an Enthüllungen, die im „Guardian“ und anderen führenden Nachrichtenpublikationen aus aller Welt abgedruckt wurden. Diese von Geheimdokumenten gestützten Enthüllungen zeigten, dass die USA, Großbritannien und andere Regierungen flächendeckend weltweit Daten abfingen, größtenteils frei von rechtlichen Zwängen oder gesetzlichen Kontrollen. Das ganze erfolgte ohne Rücksicht auf die Rechte von Millionen unbescholtener Menschen, denen nichts vorgeworfen wurde. Der große Reiz des digitalen Zeitalters besteht in der Aussicht, Informationen mühelos und grenzüberschreitend teilen zu können. Das ist gleichzeitig seine große Gefahr. Während das Wissen der Welt sich in den Cyberspace verlagert, steigen entsprechend die Überwachungsmöglichkeiten. Die USA sind führend, was das Abfischen der globalen Datenströme anbelangt, aber andere Länder und Akteure dürften aufholen. Schon jetzt fordern einige, dass mehr Daten in ihrer Reichweite bleiben. Letztlich wird es keinen sicheren Ort geben, wenn Privatsphäre als strikt nationales Thema angesehen wird, das vielen Ausnahmeregelungen unterliegt und lasch beziehungsweise gar nicht reguliert wird. Human Rights Watch äußerte sich 2013 wiederholt zu den Folgen, die Snowdens Enthüllungen zu Massenüberwachung für die Menschenrechte haben, ebenso zur Notwendigkeit, Whistleblower zu schützen. In diesem Essay untersuchen wir, wie sich die Gesetzgebung in Sachen Privatsphäre entwickelte und wie es heute weitergehen muss, damit Privatsphäre weltweit und für alle Menschen von den Regierungen respektiert wird. Das globale, massenhafte Sammeln von Daten 19 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch bedroht die Menschenrechte und die Demokratie. Wieder muss sich das Gesetz der Herausforderung stellen. Ein Konzept entsteht: Das Recht, „in Ruhe gelassen zu werden“ In vielen Staaten wurden seit langem die Werte anerkannt, auf denen das gesetzliche Recht auf Privatsphäre basiert: Ehre, ein guter Ruf, die Unantastbarkeit von Heim und Familienleben. Doch es waren die Vereinigten Staaten, wo sich nach dem Aufruf von Warren und Brandeis das Recht herauskristallisierte, auf Schutz der Privatsphäre zu klagen. Richter Cooley beschrieb 1882 Privatsphäre als das Recht, „in Ruhe gelassen zu werden“. Im Lauf des nächsten Jahrhunderts ließ das Deliktrecht Klagen gegen unerwünschte öffentliche Enthüllungen oder die nicht in beiderseitigem Einverständnis erfolgende Nutzung privater Informationen zu. Viele der Kläger waren Berühmtheiten oder Menschen, die diesen Status vermeiden wollten. Die entstehende Rechtsdoktrin zielte darauf ab, guten Ruf und Ehre des Einzelnen zu schützen. Rasch kollidierte sie mit der Pressefreiheit und dem Recht der Öffentlichkeit auf Information – vor allem dann, wenn Zeitungen über Themen von allgemeinem öffentlichen Interesse berichten wollten und peinliche Enthüllungen über öffentliche Personen dabei eine Rolle spielten. Die Rechtsprechung in den USA ging respektvoll mit den Bedenken der Meinungsfreiheit um und ließ den Medien in der Praxis viel Freiraum. In Europa lag der Schwerpunkt eher auf dem Schutz des guten Rufs und der Wahrung persönlicher Informationen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gewann Privatsphäre mit dem Aufkommen des modernen Überwachungsstaats an Boden als Abgrenzung vor dem Eindringen der Regierung. Das „Dritte Reich“ nutzte bei der Verfolgung stark Volkszählungsdaten, während viele kommunistische Staaten ausgeklügelte Systeme zur Überwachung und Datensammlung entwickelten, um ihre Bevölkerung kontrollieren und Dissens im Keim ersticken zu können. Derartige Einschränkungen existieren heute in China, Vietnam, Nordkorea, Turkmenistan und Kuba. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt das Recht auf Privatsphäre Einzug in vielen internationalen Menschenrechtsinstrumenten und nationalen Verfassungen. Häufig wurde es dabei formuliert als Verbot der Einmischung in „Privatsphäre, Familie, Heim oder Korrespondenz“ sowie dem traditionelleren Schutz vor Angriffen auf „Ehre und guten Ruf“. Privatsphäre galt nie als absolutes Recht. Im Völkerrecht kann es vermindert oder eingeschränkt werden, wenn 20 eine schwere öffentliche Notlage das Überleben eines Landes gefährdet. Selbst dann jedoch muss der Notfall öffentlich verkündet werden und die Einschränkungen dürfen nicht größer sein, als es die Bedrohung erfordert. Sie müssen diskriminierungsfrei sein und mit dem Völkerrecht im Einklang stehen, darunter auch der Wahrung der Menschenrechte. Ohne derartigen Notfall darf ein Eindringen in Privatsphäre, Familie, Heim und Korrespondenz nicht willkürlich erfolgen. Es muss gesetzlich geregelt werden und eindeutig dargelegt sein, wie und wann diese Gesetze voraussichtlich zur Anwendung kommen. Die Gesetze müssen legitime Interessen in einer demokratischen Gesellschaft schützen, etwa die öffentliche oder nationale Sicherheit. Sie müssen für diesen Zweck notwendig und angemessen sein sowie gerichtlicher Kontrolle und Rechtsmitteln unterliegen. Diese Grundprinzipien finden sich in den meisten gerichtlichen Bewertungen unterschiedlicher Aspekte der Privatsphäre wieder. Neue Technologien und „vernünftige“ Erwartungen Wie der Staat – meist im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen – Durchsuchungen vornehmen darf, hat einen wichtigen Aspekt des Schutzes der Privatsphäre mitgestaltet. Für Durchsuchungen wurde die Zustimmung eines Richters nötig, und in einigen Rechtssystemen gelten nicht genehmigte Durchsuchungen als Verbrechen. Das Briefgeheimnis wurde um neue Technologien wie das Telefon erweitert und Gesetze legen fest, wann die Behörden Verdächtige abhören dürfen. Doch der Schutz der Privatsphäre hinkt oftmals dem technischen Wandel hinterher. Im „Olmstead“-Fall von 1928 urteilte der Oberste Gerichtshof der USA, dass es nicht gegen das Verfassungsrecht auf Schutz von Person, Heim, Dokumenten und Eigentum verstößt, wenn in einem Strafrechtsfall Beweise vorgelegt werden, die aus einer nicht genehmigten Abhöraktion stammen. 1967 schlug der Gerichtshof einen anderen Kurs ein und legte fest, dass ein Mensch vernünftigerweise Privatsphäre erwarten könne, wenn er in einer öffentlichen Telefonzelle telefoniere. Aus diesem Beispiel von gesundem Menschenverstand entwickelte sich eine Doktrin, wann die Macht des Staats, Durchsuchungen auch ohne entsprechenden richterlichen Beschluss durchzuführen, zu beschränken sei. Während im amerikanischen Recht das eigene Heim größtenteils unantastbar bleibt, gilt dies nicht für Dinge, die außerhalb des Hauses oder öffentlich einsehbar sind (an der Straße stehende Mülleimer, der Rücksitz eines Autos). Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Bei der Frage, was vernünftigerweise als Privatsphäre angesehen werden kann, hat die Rechtsauffassung häufig nicht Schritt halten können mit raschen technologischen Veränderungen oder auch nur den Erwartungen der Öffentlichkeit. Brandeis, der später an den Obersten Gerichtshof berufen wurde, sah dieses Problem kommen. In seinem berühmten „Olmstead-Sondervotum“ sagte er voraus: „Eines Tages mag es Möglichkeiten geben, wie die Regierung Dokumente vor Gericht reproduzieren kann, ohne sie vorher aus Geheimfächern zu ziehen, Dokumente, die es möglich machen, den Geschworenen die intimsten Ereignisse des Heims zu eröffnen.“ Und weiter schrieb er: „Kann es sein, dass die Verfassung vor derartigen Verletzungen der Sicherheit des Einzelnen keinen Schutz bietet?“ In unserer Zeit, da massenhaft Daten abgefangen werden, ist Brandeis’ Sorge absolut berechtigt. Für Abhörmaßnahmen wurden schließlich richterliche Anordnungen notwendig, aber da neue Gesetzen für viele Formen digitaler Informationen nur lasche Standards vorgeben, metastasierte die Überwachung im 21. Jahrhundert. Privatsphäre: Geheimhaltung oder Selbstbestimmung? Die Doktrin von der vernünftigerweise zu erwartenden Privatsphäre führte in der US-Rechtsprechung dazu, dass viele Arten von Geschäftsunterlagen nicht vor einer Durchsuchung ohne richterliche Anordnung geschützt sind. Die Logik dahinter besagt, dass jemand, der Informationen freiwillig mit Dritten teilt, keinen Einwand erheben darf, wenn die Informationen publik werden. Es wird gerne erwidert, dass man zwar einem Unternehmen persönliche Informationen mitteilen kann, daran aber nicht zwingend die Erwartung gekoppelt ist, dass diese Daten dem Staat vorgelegt werden. Ganz im Gegenteil: Normalerweise erwarten wir bei unseren geschäftlichen Transaktionen ein gewisses Maß an Diskretion und Vertraulichkeit. Berücksichtigt man, wie viele notwendige Transaktionen des modernen Lebens ein beträchtliches Maß an Offenlegung erfordern, ist es auch nicht ganz richtig zu behaupten, die Preisgabe persönlicher Informationen im Zuge geschäftlicher Unterlagen erfolge völlig „freiwillig“. Das US-Gesetz setzt den Schutz der Kommunikation inzwischen mit Geheimhaltung gleich. Dieser Ansatz sei für das digitale Zeitalter schlecht geeignet, sagte kürzlich Richterin Sonia Sotomayor. In Europa ist das Gesetz einen anderen Weg gegangen, angeführt vom deutschen Persönlichkeitsrecht, das dem Schutz der Menschenwürde und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit dient. 1983 kippte das Bundesverfassungsgericht das Volkszählungsgesetz und formulierte das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Der europäische Ansatz ging von der Ansicht aus, der Einzelne habe das Recht, die von verschiedenen Institutionen gehaltenen Daten einzusehen und zu korrigieren. Letztlich habe er auch das Recht, über die Verwendung und die Löschung dieser Daten zu bestimmen. Ineinandergreifende regionale Richtlinien und Standards entwickelten sich, unterlagen aber nationalen Unterschieden in der gesetzlichen Formulierung und der Anwendung. In den USA dagegen setzt sich der Datenschutz aus einer Vielzahl schwer durchschaubarer Landesgesetze und Gesetze zur Regelung bestimmter Branchen zusammen. Häufig stehen dabei eher Datenmissbrauch und Datenbetrug im Mittelpunkt als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Doch auch der europäische Weg ist nicht frei von Kritik: Damit der Staat gegebenenfalls darauf zugreifen kann, müssen Firmen Daten über den von ihnen für nötig erachteten Zeitraum hinaus speichern. Die Kontrolle des Staats unterliegt dabei von Land zu Land unterschiedlichen Standards. Es wird immer komplizierter, die Kontrolle über die eigenen persönlichen Daten zu behalten, denn die Datensammlung findet nicht länger an zentralen Orten statt, sondern in der „Datenwolke“, wodurch noch mehr Jurisdiktionen, Akteure und Gesetze beteiligt sind. Anonymität als ultimativer Datenschutz Eine der sichersten Methoden, die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten, besteht darin, bei der Kommunikation die eigene Identität zu verschleiern. Dieser Ansatz fand in den USA schneller Zuspruch als andernorts, was wohl auch der Historie geschuldet ist: Viele der Gründer der Nation veröffentlichten revolutionäre Aufrufe unter Pseudonym. Nun galt Anonymität nie als absolutes oder eigenständiges Recht, aber der Oberste Gerichtshof der USA hat sie schon vor Langem als in hohem Maße schützenswerten Teil der Redefreiheit anerkannt. Das hängt auch damit zusammen, dass Anonymität die Meinungsäußerung fördern kann, wie Richter John Paul Stevens 1995 schrieb: „Anonymität (…) bietet persönlich unbeliebten Autoren die Möglichkeit, dass die Leserschaft die Botschaft nicht deshalb schon verurteilt, weil sie die Verfechter nicht mag.“ Angesichts der wachsenden Menge online verfügbarer Daten und den Fortschritten, die beim Sammeln und 21 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Durchsuchen von Datenbanken erzielt wurden, wird Anonymität immer wertvoller – und gefährdeter. Sie ist von zentraler Bedeutung dafür, dass Menschen Ideen öffentlich ohne Furcht vor Vergeltung oder Verfolgung teilen können. Im April 2013 schrieb Frank LaRue, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, über den „ernüchternden Effekt“, den Einschränkungen der Anonymität auf die freie Äußerung von Informationen und Ideen haben. Fordern Firmen die tatsächlichen Namen für die Anmeldung, um persönliche Informationen sammeln und durchsuchen zu können, übernehmen sie laut LaRue ein hohes Maß an Verantwortung dafür, derartige Informationen zu schützen und geheim zu halten. lassen. Ihnen werde das Recht zu heiraten verwehrt, sie würden am Arbeitsplatz diskriminiert und ihnen würden Sozialleistungen vorenthalten. Privatsphäre ist laut Gerichtshof das Recht, Einzelheiten der eigenen Identität als menschliches Individuum festzulegen. Transsexuelle haben dem Gericht zufolge im selben Maße, wie sie andere Gesellschaftsgruppen genießen, das Recht auf Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und eine körperliche und moralische Sicherheit. Die Denkweise hinter „Toonen“ und „Goodwin“ fließt auch in zwei Themen ein, mit denen sich Human Rights Watch zuletzt schwerpunktartig befasst hat: Unsere Forderung, einfachen Besitz und Konsum von Drogen zu legalisieren sowie unsere Forderung, freiwillige Sexarbeit Erwachsener zu entkriminalisieren. Drogenkonsum und auch freiwillige Sexarbeit können Gesundheit und Sicherheit ernsthaft gefährden (und auch das Risiko von HIV und Aids erhöhen), aber treibt man die Personengruppen in den Untergrund, ist das normaDas Beispiel Durchsuchungsrecht zeigt, wie sich die lerweise ausgesprochen kontraproduktiv bei den Interpretation von Privatsphäre in der realen Welt auf die Bemühungen, Schaden zu behandeln, zu lindern oder zu Anwendung in der virtuellen Welt auswirkt. Die Gesetze, vermeiden. In beiden Fällen kann eine Kriminalisierung die die persönlichsten körperlichen Attribute und eine ganze Reihe nachrangiger Verstöße gegen das Entscheidungen eines Menschen betreffen – etwa Menschenrecht verursachen oder noch erschweren, sei Wahlfreiheit bei Heirat, Abtreibungen, das Gründen einer es die Anfälligkeit für Gewalt durch Privatpersonen, Familie oder medizinische Behandlung, definieren Polizeimissbrauch, diskriminierende Umsetzung von Privatsphäre als Möglichkeit, die eigene körperliche Gesetzen sowie Anfälligkeit für Erpressung, Kontrolle und Autonomie und bevorzugte Identität zu wahren, nicht als Missbrauch durch Kriminelle. Das sind schwere und Isolierung oder Geheimhaltung. Insofern sind diese häufig auftretende Folgen. Zusammen mit dem starken Gesetze auch für den Schutz von Autonomie und Identität persönlichen Interesse, das die Menschen daran haben, im Cyberspace von Bedeutung. eigene Entscheidungen ihren Körper betreffend fällen zu Eine wichtige Entscheidung mit Blick auf die Sicherheit können, bedeutet dies, dass es für den Staat übertrieben der Person ist der Fall „Nicholas Toonen gegen und nicht angemessen ist, gegen beide Praktiken mithilfe Australien“ von 1994. Der UN-Menschenrechtsausschuss des Strafrechts vorzugehen. ist für die Auslegung des Internationalen Pakts über Das Vorgehen bei der körperlichen Selbstbestimmung bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) zuständig. Er birgt direkte Relevanz für die Privatsphäre in der Onlinewies damals Tasmaniens Strafrecht in Bezug auf Sodomie Welt. Die reale und die virtuelle Welt sind natürlich miteizurück und erklärte, es stehe außer Frage, dass sexuelle nander verwoben: Entscheidungen, die wir offline in Handlungen, die in beiderseitigem Einvernehmen und Bezug auf unsere Freunde, Arbeit, sexuelle Identität privat zwischen Erwachsenen erfolgen, unter das Konzept sowie unsere religiösen und politischen Ansichten der Privatsphäre fallen. Die Argumentation, das Gesetz treffen, spiegeln sich in unseren Online-Daten und diene dazu, die Verbreitung von HIV und Aids einzuunserer Internet-Kommunikation. Die unerwünschte dämmen, wurde zurückgewiesen, weil es zu diesem Offenlegung unserer Privatdaten kann die körperliche Zweck weder vernünftig noch angemessen sei und eher und moralische Sicherheit untergraben, die, wie im dazu führe, dass eine anfällige Bevölkerungsgruppe in „Goodwin“-Urteil dargelegt, ein zentrales Ziel des den Untergrund getrieben werde. Schutzes der Privatsphäre ist. Offenlegung kann uns Ähnlich verwies der Europäische Gerichtshof für daran hindern, uns frei von Zwängen persönlich zu Menschenrechte 2002 bei „Goodwin gegen das entfalten. Derartige Abwägungen führten überhaupt erst Vereinigte Königreich“ darauf, wie Transsexuelle nach dazu, dass Gesetze zum Datenschutz verabschiedet einer Geschlechtsumwandlung leiden müssen, können wurden. sie das Geschlecht auf ihrer Geburtsurkunde nicht ändern Sicherheit der Person: Autonomie, Schutz und Identität 22 Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Das „goldene Zeitalter“ der Überwachung Zwei wichtige Entwicklungen haben die Diskussionen über Privatsphäre stark beeinflusst und eine Phase eingeläutet, die einige als „goldenes Zeitalter der Überwachung“ bezeichnen. Das war zum einen die Verlagerung fast aller Aspekte des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens in die OnlineWelt. Ein Angriff auf Online-Aktivitäten – oder eine Überwachung dieser Aktivitäten – kann praktisch jedes Menschenrecht gefährden, sei es bürgerrechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Natur. eingebaut haben, um vergleichsweise freie Hand bei der Erfassung von Massendaten zu haben. Das erste große Schlupfloch: Die USA gewähren im Ausland lebenden Ausländern keine Verfassungsrechte, sei es Schutz vor willkürlicher Durchsuchung, sei es Datenschutz oder Meinungsfreiheit (bis hin zu anonymer Meinungsäußerung). Auch erkennen die USA nicht an, dass Verpflichtungen, die sich aus dem Zivilpakt ergeben, auch exterritorial anzuwenden sein sollen. Das US-Recht lässt es vielmehr zu, Auslandsaufklärung auch ohne richterliche Anordnung durchzuführen. Voraussetzung ist eine Zustimmung des Geheimgerichts Zum anderen sind hier die enormen Fortschritte gemeint, FISC zu Maßnahmen, die das Sammeln von Informationen die bei unserer Fähigkeit gemacht wurden, mit miniim Ausland zum Ziel haben. Das Sammeln von malem Aufwand und geringen Kosten Daten zu speichern, Kommunikationsdaten von US-Bürgern oder in den USA zu durchsuchen, zu ordnen und zu analysieren. Das hat lebenden Ausländern soll dabei möglichst minimiert große Auswirkungen für das Sammeln und Speichern von werden. Ausländer haben überhaupt keinen Schutz vor Daten und stellt einen gewaltigen Anreiz zum Horten von dem Sammeln von Informationen, aber es gibt darüber Informationen dar - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da hinaus auch zahlreiche Ausnahmen, die es der USweite Teile unseres Lebens durch online gestellte Daten Regierung erlauben, Daten ihrer eigenen Bürger zu speioffen gelegt werden können. Regierungen wie die americhern – darunter auch verschlüsselte Kommunikation kanische wenden darüber hinaus beträchtliche und Kommunikation zwischen Anwalt und Klient. Ressourcen dafür auf, stets Zugriff auf unsere Daten zu Das zweite große Schlupfloch: Nach Auffassung der UShaben. Sie arbeiten mit Hintertüren bei Technologie und Regierungen sind Metadaten – also die zu jeder Datensammelpunkten und knacken starke Botschaft gehörenden Informationen wie Datum, Zeit, Verschlüsselungsmethoden. Ort, Sender, Empfänger – Geschäftsunterlagen, die Schon bevor Edward Snowden ab Juni 2013 enthüllte, in gegenüber Dritten offengelegt werden und damit einem welch massivem und globalen Umfang die amerikanische deutlich geringeren Schutz unterliegen als der eigentliche National Security Agency (NSA) überwacht, gab es Sorgen Inhalt, und zwar sowohl durch die Verfassung als auch über den Schutz von Online-Kommunikation und digidurch Abschnitt 215 des Bundesgesetzes „Patriot Act“. talen Informationen. Aber seit Snowden an die Doch Metadaten können auf längere Sicht ein unglaubÖffentlichkeit ging, gibt es heftige Debatten zu der Frage, lich detailliertes Bild davon zeichnen, wo sich jemand ob eine Massenüberwachung jemals gerechtfertigt ist bewegt, mit wem er spricht, mit wem er interagiert und und ob sich die Privatsphäre überhaupt wirksam vor was ihn beschäftigt. Regierungen und Firmen schützen lässt, die unbedingt Allein schon diese beiden Ausnahmen lassen gewaltigen bespitzeln wollen. Freiraum für Massenüberwachung, aber die Regierung Wieder einmal stellen wir fest, dass Gesetz und Gerichte legt selbst die ohnehin schon großzügigen Gesetze noch nicht Schritt gehalten haben. sehr flexibel aus. Bei der Erteilung eines Auftrags zur Auslandsaufklärung müssen weder bestimmte Rechtliche Schlupflöcher für Überwachung Ermittlungen oder Personen genannt werden, sondern nur allgemeine Ziele. Und die zielgerichtete Überwachung In den meisten Rechtssystemen ist Spionage eine Straftat, im Völkerrecht jedoch ist sie nicht verboten und setzt voraus, dass man sich zu 51 Prozent sicher ist, dass die Personen, deren Daten gesammelt werden sollen, im die meisten Regierungen praktizieren sie bis zu einem Ausland lebende Ausländer sind. Bei 51 Prozent ist die gewissen Maß. Die USA sind allerdings in einer einmaTrefferquote nur marginal höher als bei einem Münzwurf. ligen Position, eine weltweite Überwachung durchzuFISC hat festgelegt, dass sämtliche Metadaten-Unterlagen führen – Geburtsort des Internets und Heimat wichtiger großer amerikanischer Telefonunternehmen wie Verizon Internetbranchen, außerdem läuft ein Großteil der weltfür Geheimdienst- oder Spionageermittlungen relevant weiten Onlinekommunikation durch Amerikas Territorium sein könnten – eine gelinde gesagt interessante und Einrichtungen. Insofern lohnt es, sich anzusehen, Auslegung des Begriffs „relevanto“. welche Schlupflöcher die USA in ihre Rechtsdoktrinen 23 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Und es gibt noch ein großes Schlupfloch gegenüber den nationalen und internationalen Rechtsverpflichtungen: Durch Abkommen zum Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse lassen sich eigene rechtliche Zwänge bei der Datensammlung gut umgehen. Das scheint bei der Zusammenarbeit von USA und Großbritannien der Fall gewesen zu sein. Inwieweit das Datensammeln europäischer Staaten, darunter auch die NSA-Partner, mit der Europäischen Menschenrechtskonvention verträglich ist, wurde noch nicht überprüft. Der Fall „Klass gegen Deutschland“ zeigt jedoch, dass eine gründlichere Überprüfung folgen könnte. Im genannten Fall betonte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, es müsse „adäquate und effektive“ Garantien gegen Missbrauch geben, damit bei der Überwachung das Recht auf Privatsphäre gewahrt bleibe. Wegen der Gefahr, die Geheimüberwachung für die Demokratie darstelle, sollen Staaten im Namen des Kampfs gegen Spionage und Terrorismus nicht jede Maßnahme einführen dürfen, die ihnen als angemessen erscheint, so das Gericht. Dem US-Kongress liegen Reformpläne für die rechtlichen Grundlagen der Massenüberwachung vor, aber bislang würde kein Gesetzentwurf die Privatsphäre im Ausland lebender Ausländer schützen. Doch in einer Welt, in der Kommunikation und Überwachung global ist, müssen allgemeingültige Standards greifen, die nicht zu schnell umgangen oder gebeugt werden können. Entwickelt sich der Schutz der Privatsphäre als Recht nicht weiter und stopft diese Lücken, könnte das Recht durchaus obsolet werden. Globale Kommunikationen, globale Verpflichtungen Was also ist zu tun? Man müsse einfach mit der Realität einer alles durchdringenden Onlineüberwachung leben, argumentieren einige. Die Öffentlichkeit habe geringere Erwartungen, was Privatsphäre anbelange, heißt es. Aber das ist weder zutreffend noch dispositiv. Unser Verständnis von Privatsphäre ist gewachsen, weit hinaus über das „Recht, allein gelassen zu werden“, und hin zum Recht auf freie Entfaltung. Es umfasst das Recht, wählen zu können, mit wem wir Intima teilen und welche Identität wir gegenüber unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen vermitteln. Übertragen auf die digitale Welt verleiht uns die Privatsphäre etwas Schutz vor unerwünschten Beobachtern. Sie bringt die grundlegende Freiheit mit sich, sich frei entfalten und unabhängige Gedanken formulieren zu können. 24 Auf die globale Überwachung muss umfassend und global reagiert werden. Als weltweit führende Nation in Sachen Cybertechnologie und Massenüberwachung fällt vor allem den USA eine besondere Verantwortung zu. Wie Edward Snowden enthüllt hat, sind sie deutlich zu weit gegangen. Die USA müssen damit. Zu den Schritten, die Human Rights Watch fordert, gehört, dass für die Erfassung von Metadaten eine richterliche Zustimmung vorliegen muss. Es muss eingesehen werden, dass schon beim Sammeln von Daten (und nicht erst beim Betrachten oder Verwenden) die Privatsphäre verletzt wird. Es muss das FISC-Gericht so reformiert werden, dass es die Arbeit der NSA ausgewogener und transparenter kontrollieren kann. Es müssen Whistleblower geschützt werden, die unrechtmäßige geheimdienstliche Praktiken aufdecken. Die Pflicht, Rechte in einer Welt globaler Kommunikation zu schützen, darf nicht an der Grenze stoppen. Das müssen wir anerkennen. Im 20. Jahrhundert ging das Völkerrecht davon aus, ein Staat müsse in erster Linie die Rechte aller Menschen gewährleisten, die sich in seinem Territorium aufhalten oder unter seiner Jurisdiktion beziehungsweise seiner wirksamen Kontrolle stehen. Das ist auch schlüssig, denn ein Staat kann nicht die Rechte von Menschen im Ausland schützen, ohne die Souveränität eines anderen Lands zu verletzen. Aber es gibt Umstände, in denen eine Regierung ihre Verpflichtungen gegenüber den Menschenrechten über ihre Grenzen hinaus tragen muss – zum Beispiel dann, wenn ihre Polizei oder ihr Militär im Ausland eine Person einfängt. Was jedoch, wenn sie die Kommunikation von Millionen Menschen im In- und Ausland einfängt? Gesammelte und archivierte persönliche Daten verleihen mit der Zeit eine derartige Macht, das Leben der Menschen zu verfolgen, zu analysieren und öffentlich zu machen, dass man argumentieren könnte, das sei eine Form wirksamer Kontrolle. Manchen von uns mag es egal sein, wer ihre Facebook-Einträge sieht, aber die Sicherheit und die Menschenwürde vieler Menschen aus aller Welt hängt davon ab, dass man einschränken kann, wer über ihre politischen Präferenzen, ihre sexuellen Neigungen, ihre religiöse Haltung und andere persönliche Dinge Bescheid weiß. Vorsätzlich schädliche Handlungen wie Erpressung, die gezielte Verfolgung mit Drohnen oder Nötigung setzen voraus, dass man über persönliche Informationen des Gegenübers verfügt. Selbst achtloser Umgang mit Daten oder falsche Interpretation kann furchtbaren Schaden anrichten. Sammelt ein Staat ohne guten Grund massenhaft Kommunikationsdaten von Bürgern eines anderen Staats, schadet er ihrer Sicherheit, ihrer Autonomie und Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH ihrem Recht, Grundrechte auszuüben. Regierungen sollten allen Personen, in deren Privatsphäre sie eindringen, denselben rechtlichen Schutz wie ihren Bürgern gewähren. Das wäre das Mindeste. Die Gesetzentwürfe, die derzeit dem Kongress vorliegen, wollen einiges von dem Missbrauch beenden, den die Massenüberwachung durch die NSA angerichtet hat. Allerdings zwingt kein Entwurf die USA, die Privatsphäre im Ausland lebender Ausländer zu schützen. Die europäischen Regierungen waren schnell dabei, die Exzesse der NSA zu verurteilen, haben bislang jedoch nicht die eigenen Praktiken der Massenüberwachung im In- und Ausland einer grundlegenden Überprüfung unterzogen – auch nicht mit Blick auf die Frage, in welchem Maße sie bei der Datenerhebung der USA mitgeholfen haben oder davon profitierten. angeregt, auch mit Blick auf Auswirkungen der exterritorialen Überwachung. Passend dazu fordern Akteure der Zivilgesellschaft, die staatlichen Überwachungsmethoden einer Reform zu unterziehen. Das geht von einer gemeinsamen Erklärung führender Internetfirmen bis zu einer Petition, in der sich 562 bekannte Autoren aus 80 Ländern an Staats- und Regierungschefs wenden. Derartige Entwicklungen können den internationalen Konsens in rechtlichen Fragen stärken und die Machtverhältnisse wieder zugunsten des Individuums verschieben. Das Jahr 2013 könnte als Jahr der Wende in die Geschichte eingehen, als das Jahr, in dem in aller Welt Menschen aufstanden, um ihr Recht auf Privatsphäre einzufordern. Das kann jedoch nur dann geschehen, wenn die Debatten in globale Standards und umsetzbare, wirkungsvolle nationale Gesetze münden. Wir können Bis Einigkeit erzielt wird, dass alle Staaten mit exterritonicht darauf warten, dass Einzelne wie Edward Snowden rialen Überwachungsfähigkeiten in der Pflicht sind, die Dinge enthüllen; wir müssen gründlichere Ermittlungen Privatsphäre aller in ihrer Reichweite befindlichen fordern, die das volle Ausmaß transparent machen, in Personen zu wahren, wird noch Zeit nötig sein, aber es dem Regierungen und Firmen Daten sammeln und gibt mehrere ermutigende Signale, dass das Ziel erreicht auswerten. Jeder Staat sollte sich verpflichten, seine werden kann. 2009 forderte Martin Scheinin, UNPraktiken und Gesetze auf transparente und öffentliche Sonderberichterstatter für Menschenrechte im Kampf Weise kontrollieren zu lassen. Ziel muss es sein, sowohl gegen den Terrorismus, Soft Laws (nicht rechtsverbindPrivatsphäre und Sicherheit als auch technische liche Übereinkünfte) für Datenschutz und Innovation voranzutreiben, damit wir besser leben Datenüberwachung. 2013 bekräftigte können und unsere Rechte als Menschen geachtet Sonderberichterstatter LaRue die Notwendigkeit, dass der werden. Menschenrechtsauschuss der Vereinten Nationen seinen Beim Recht auf Privatsphäre geht es nicht einfach darum, General Comment mit Blick auf das Recht auf die Menschen in Ruhe zu lassen; es geht auch darum, Privatsphäre überarbeitet. dass sie nach eigenen Vorstellungen kommunizieren, Bürgerrechtsexperten haben kürzlich mögliche sprechen, denken und leben können, ohne dass sich der Grundlagen für einen Konsens veröffentlicht. Zum einen Staat willkürlich einmischt. Die technologische die „Tshwane Principles on National Security and the Revolution ist überall und wir müssen unser Bestes Right to Information“ (Tshwane-Prinzipien zu nationaler geben, damit das Gesetz Schritt halten kann – wieder Sicherheit und dem Recht auf Information), die vom einmal. Rechtsausschuss der Parlamentarischen Versammlung Dinah PoKempner ist General Counsel von Human Rights Watch. des Europarats unterstützt werden. Zum anderen die „International Principles on the Application of Human Rights to Communications Surveillance“ (Internationale Prinzipien zur Anwendung der Menschenrechte bei der Kommunikationsüberwachung), größtenteils eine Sammlung und Neuformulierung grundlegender Prinzipien im Zusammenhang mit dem Recht auf Privatsphäre, Transparenz und die Regulierung von Überwachung im Völkerrecht. Im November 2013 legten Brasilien und Deutschland in der Uno-Vollversammlung eine Resolution vor, die einen Konsens bei Verstößen gegen den Datenschutz bei digitaler Überwachung in In- und Ausland herbeiführen soll. In der Resolution werden fortlaufende Berichte über Massenüberwachung und das Recht auf Privatsphäre 25 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Menschenrechte in der Europäischen Union Inmitten von Wirtschaftskrise und kontroversen Sparmaßnahmen stellten Diskriminierung, Rassismus und Homophobie in der Europäischen Union (EU) auch im vergangenen Jahr ein erhebliches Problem dar. Besonders Roma, Migranten und Asylsuchende waren von Ausgrenzung betroffen. Der Rat der Europäischen Union hat erstmals anerkannt, dass weitaus mehr getan werden muss, um zu gewährleisten, dass die EU angemessen auf Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Union reagiert. Es wird weiterhin diskutiert, mit welchen politischen Mitteln die EU antworten soll, wenn ein Rechtsstaat in die Krise gerät. Unterdessen bedienten sich zahlreiche Mitgliedsstaaten weiter menschenrechtswidriger Praktiken, ohne dass die EUInstitutionen und andere Mitgliedsstaaten mit angemessenen Maßnahmen reagierten. Einwanderungs- und Asylpolitik der EU Mit der Verabschiedung eines Asyl-Pakets durch das Europäische Parlament, mit dem die Dublin-Vorschriften sowie die Richtlinien zu Asylverfahren und Aufnahmebedingungen überarbeitet wurden, unternahm die EU im Juni letzte Schritte zur Einrichtung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Das Asyl-Paket enthielt zwar eine Reihe von Verbesserungen, schafft jedoch auch eine breite Grundlage für die Inhaftierung von Asylsuchenden. Zudem verpflichtet es die Mitgliedsstaaten nicht, eine kostenlose Rechtsberatung zur Verfügung zu stellen und nimmt auch besonders schutzbedürftige Asylsuchende wie Folteropfer und unbegleitete Kinder nicht von den beschleunigten Prozeduren aus. Die im Juli in Kraft getretenen Dublin III-Vorschriften halten an der Grundregel fest, dass das Ersteinreiseland innerhalb der EU für die Bearbeitung des Asylantrags verantwortlich ist. Verbessert wurden einige Schutzbestimmungen, darunter das Recht auf Information, eine persönliche Befragung und Beschwerdemöglichkeiten im Falle einer Verlegung. Vor einer Überführung in einen anderen EU-Staat müssen die Mitgliedsstaaten nunmehr prüfen, ob den Betroffenen dort eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung. Im Juni entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), 26 dass ein Mitgliedsstaat die Asylansprüche unbegleiteter Kinder auch dann prüfen muss, wenn diese bereits in anderen Ländern einen Antrag gestellt haben. Im November entschied der EuGH, die sexuelle Orientierung eines Antragstellers/einer Antragstellerin könne als Asylgrund genügen, wenn diese/r aus einem Land stamme, in dem gleichgeschlechtliches Sexualverhalten strafrechtlich verfolgt wird. Dabei betonte das Gericht, dass von keinem Menschen erwartet werden dürfe, seine sexuelle Orientierung zu verheimlichen. Die EU-Mitgliedsstaaten gingen sehr unterschiedlich mit Asylsuchenden aus Syrien um. Beispielsweise versprach die schwedische Regierung, allen Menschen aus Syrien, die bislang einen befristeten Aufenthaltstitel erhalten haben, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen zu erteilen. Demgegenüber versuchte Griechenland, syrische Asylsuchende in die Türkei abzuschieben. Während Deutschland und Österreich sagten zu, 5.000 beziehungsweise 500 syrische Geflüchtete aufzunehmen. Kamen die meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht über symbolische Zusagen hinaus. Im Juni forderten die Europäische Kommission und die EU-Außenbeauftragte eine konzertierte Reaktion auf die Krise in Syrien mit Schwerpunkt auf der humanitären Versorgung der Geflüchteten in den Nachbarstaaten. Sie unterstrichen die Notwendigkeit eines abgestimmten Vorgehens der Mitgliedsstaaten. Die Zahl der Migranten, die Europa auf dem Seeweg erreichten, stieg im vergangenen Jahr an. Bis Ende Oktober kamen mehr als 35.000 Migranten und Asylsuchende auf Booten an. Schätzungsweise 500 Menschen kamen bei der Überfahrt ums Leben, allein 360 von ihnen bei einem Bootsunglück im Oktober. Im Juli verbot der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Malta, eine Gruppe Somalier nach Libyen abzuschieben. Bei Redaktionsschluss dauerten die Verhandlungen über neue Richtlinien für die EU-Grenzschutzagentur Frontex an. Ein Vorschlag der Europäischen Kommission soll die Rolle von Frontex bei Such- und Rettungsaktionen auf See und bei Ausschiffungen klären. Allerdings sieht er auch vor, dass die Agentur auf hoher See aufgegriffene Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Personen nach einer oberflächlichen Prüfung ihres Schutzanspruchs sowie der Situation im betreffenden Land in Drittstaaten abschieben kann. Im April empfahl der damalige europäische Bürgerbeauftragte nach einer Untersuchung, die Rechtsgrundlagen für Frontex-Einsätze und die Verantwortung der Agentur für Rechtsbrüche zu klären. Im September forderte das Europäische Parlament neue, über den Aktionsplan der Europäischen Kommission hinausgehende strategische Richtlinien für den Schutz unbegleiteter Kinder. Auch der Menschenrechtskommissar des Europarats Nils Muižnieks erinnerte die Staatengemeinschaft daran, dass das Interesse der Kinder bei der Umsetzung einwanderungspolitischer Vorschriften Vorrang habe. Der UN-Sonderberichterstatter für die Rechte von Migranten François Crépeau kritisierte, dass die Einwanderungspolitik der EU von Sicherheitsbedenken geprägt sei und sich einseitig auf die Sicherung der Außengrenzen sowie auf Haft und Abschiebung konzentriere. In einem im April veröffentlichten Bericht empfahl Crépeau, Schutzmaßnahmen zu verbessern, unter anderem durch Alternativen zur Haft und die Aufnahme von Menschenrechtsregeln in Kooperationsabkommen mit nicht-EU-Staaten im Bereich Migration. Er appellierte zudem an die Europäische Kommission, Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedsstaaten einzuleiten, welche die Rechte von Migranten verletzen. Politiker in Großbritannien und die Behörden im spanischen Katalonien schlugen vor, muslimische Gesichtsschleier zu verbieten. Im Schweizer Kanton Tessin (nicht der EU zugehörig) stimmten die Wähler bei einem Referendum im September für ein Verbot. Im November befasst sich der EGMR mit der Klage einer Frau, die sich gegen Frankreichs Verbot von Gesichtsschleiern in der Öffentlichkeit richtete. Sie machte geltend, das Gesetz verstoße gegen ihr Recht auf Privat- und Familienleben und gegen ihre Religions- und Meinungsfreiheit. Eine im Mai veröffentlichte Umfrage der EUGrundrechteagentur kam zu dem Ergebnis, dass 47 Prozent der lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen Teilnehmenden in den vergangenen 12 Monaten diskriminiert oder belästigt worden waren. 25 Prozent gaben an, sie seien in den vorausgegangenen fünf Jahren gewaltsam angegriffen worden oder ihnen sei Gewalt angedroht worden. Aus einer anderen Umfrage der Grundrechteagentur im November ging hervor, dass 21 Prozent der jüdischen Befragten in den vorausgegangenen 12 Monaten antisemitische Beleidigungen erlebt hatten oder belästigt worden waren, während zwei Prozent angaben, sie seien im gleichen Zeitraum körperlich angegriffen worden. Roma litten überall in der EU unter Diskriminierung und Armut. Im Juni veröffentlichte die Europäische Kommission Empfehlungen zur wirksamen Umsetzung von Strategien für die Integration von Roma in den Mitgliedsstaaten. Im September behauptete der französiDiskriminierung und Intoleranz sche Innenminister, die meisten Roma wollten sich nicht Die EU-Institutionen und der Europarat zeigten sich integrieren. Im gleichen Monat wurde bekannt, dass die besorgt über fremdenfeindliche Ressentiments und schwedische Polizei mit illegalen Roma-Registern Gewalt. Im März forderte das EP in einer Resolution, soge- arbeitet. Nachdem zahlreiche Medien fälschlicherweise nannte Hassverbrechen angemessen zu dokumentieren, berichteten, in Griechenland und Irland seien blonde, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen. Zudem solle blauäugige Kinder von Roma-Familien entführt worden, für die Betreuung, den Schutz und die Entschädigung der warnte der Menschenrechtskommissar des Europarats Opfer gesorgt werden. Im Juni sprach sich der Rat der EU Muižnieks im Oktober vor verantwortungsloser dafür aus, extreme Formen der Intoleranz wie Rassismus, Berichterstattung. Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Homophobie Im Februar ratifizierte Portugal als erster EUstärker zu bekämpfen. Im Mai forderte der Mitgliedsstaat die Konvention des Europarats zur Menschenrechtskommissar des Europarats Muižnieks, Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen Polizei, Staatsanwälte und Richter systematisch und und häuslicher Gewalt. Italien folgte im September. kontinuierlich aus- und weiterzubilden, um Vorurteile innerhalb der Strafverfolgungsbehörden wirksam zu bekämpfen. Nachdem es in Italien wiederholt zu rassistischen Anfeindungen gegen einen dunkelhäutigen Minister gekommen war, unterzeichneten im September 17 EUMinister eine Erklärung, in der sie Intoleranz und Extremismus verurteilen. Im November urteilte der EGMR, Griechenland verstoße gegen das Diskriminierungsverbot und das Recht der Beschwerdeführer auf Schutz von Privat- und Familienleben, weil es gleichgeschlechtliche Paare von eingetragenen Lebenspartnerschaften ausschließe. 27 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Terrorismusbekämpfung Im Dezember 2012 sprach der EGMR sein erstes Urteil über die europäische Mitverantwortung am Verschleppungs- und Haftprogramm der CIA. Das Gericht entschied, Mazedonien habe gegen das Folterverbot verstoßen und die Rechte des deutschen Staatsbürgers Khaled el-Masri auf Freiheit und Sicherheit, einen wirksamen Rechtsbehelf und Schutz von Privat- und Familienleben verletzt. Die mazedonischen Behörden hatten el-Masri im Jahr 2003 widerrechtlich festgehalten, in US-Gewahrsam übergeben und seine Misshandlungsvorwürfe nicht angemessen untersucht. In zwei ähnlichen Fällen war bei Redaktionsschluss noch kein Urteil ergangen: Die Klagen der ehemaligen Guantánamo-Häftlinge Abu Zubaydah (gegen Polen und Litauen) und Abd al-Rahim al-Nashiri (gegen Polen und Rumänien). Der Menschenrechtskommissar des Europarats Muižnieks und das Europäische Parlament wiederholten im September beziehungsweise Oktober ihre Forderung, die Verantwortlichen für die Zusammenarbeit europäischer Staaten mit der CIA zur Rechenschaft zu ziehen. Zudem forderten sie die USA auf, bei den Ermittlungen zu kooperieren. Im September initiierte das EP eine Untersuchung der Auswirkungen des Überwachungsprogramms der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA (National Security Agency, NSA) auf die Privatsphäre von EUBürgern. Voraussichtlich im Januar 2014 wird das Parlament in dieser Frage seine Schlussfolgerungen und Empfehlungen verabschieden. Außenpolitik der EU Die EU-Mitgliedsstaaten und -Institutionen setzten im Laufe des Jahres 2013 einige erfreuliche Initiativen um. So richteten sie den Europäischen Fonds für Demokratie ein und schufen zwei neue EU-Richtlinien über LGBTIRechte sowie zur Religions- und Glaubensfreiheit. Insgesamt legten sie in Menschenrechtsfragen jedoch nicht das Engagement und die Einigkeit an den Tag, die vor der Verabschiedung des Strategischen Rahmens für Menschenrechte und Demokratie durch die EUAußenminister im Juni 2012 zu beobachten waren. Die 28 Mitgliedsstaaten der EU und ihre Institutionen machen weiterhin nicht von ihrer gemeinsamen Verhandlungsmacht Gebrauch. In Menschenrechtsfragen vermochten sie es nicht, gegenüber strategischen Partnern wie Russland und China mit einer Stimme zu sprechen und einen gemeinsamen Ansatz zu finden, obwohl das Europäische Parlament sie ebendies angemahnt hatte. Zwar sprach die EU-Außenbeauftragte in 28 einigen Stellungnahmen Probleme an, ein prinzipientreues und einheitliches Vorgehen der EU, das Menschenrechtsbedenken auf höchster Ebene in politischen Dialogen und öffentlichen Debatten mit Russland und China verankert, war jedoch nicht zu erkennen. Die EU war auch im letzten Jahr der größte humanitäre Geber in Syrien. Doch obwohl sich die Union erklärtermaßen zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und zum Prinzip der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei schweren Verbrechen bekennt, sorgte die Außenbeauftragte nicht dafür, dass die Union mit gemeinsamer Stimme und Strategie auftritt. Beides könnte dazu beitragen, dass die Verbrechen in Syrien vor den IStGH gebracht werden. 27 EU-Mitgliedsstaaten – alle außer Schweden – schlossen sich einer Initiative der Schweiz an, die den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu auffordert, den IStGH mit der Untersuchung der Lage in Syrien zu beauftragen. Nachdem bewaffnete islamistische Gruppen Gebiete im Norden Malis besetzt hatten, kam Frankreich dem Gesuch des malischen Präsidenten um militärische Unterstützung nach und leitete die „Operation Serval“ ein. Wenig später entsandte auch die EU eine Mission, die malische Sicherheitskräfte ausbilden und beraten soll. Die Schulungen beinhalten auch eine Komponente „Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht“. Im Jahr 2013 begann eine neue Ära in den Beziehungen zwischen der EU und Burma. Im April hob die EU alle Sanktionen gegen Mitglieder und Beschaffungsstellen der burmesischen Armee und Regierung auf, mit Ausnahme des Exportverbots für Waffen. Im Juli billigten die EU-Außenminister eine Rahmenvereinbarung über die Politik der EU gegenüber Burma und über Hilfen an das Land. Im gleichen Monat verurteilte das Europäische Parlament in einer Resolution die „schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und die Gewalt gegen die muslimischen Rohingya in Burma/Myanmar“. Die Europäische Kommission stellte 14,5 Millionen Euro für humanitäre Unterstützung bereit, zusätzlich zu den 5,5 Millionen Euro, die bereits im Dezember 2012 vergeben worden waren. Diese Gelder sollen vor allem im Rakhaing- bzw. Kachin-Staat und in den östlichen Grenzregionen zugutekommen. Im UN-Menschenrechtsrat und in der Generalversammlung unterstützte die EU weiterhin kritische Resolutionen zu Burma. Beim Ministertreffen des EU-Golfkooperationsrats in Bahrain im Juni wurden Menschenrechtsfragen offenbar ausgeklammert. Trotz wiederholter Apelle des Europäischen Parlaments und aus den Reihen der Zivilgesellschaft, versäumten die EU-Außenbeauftragte und die Mitgliedstaaten es, ihren gemeinsamen Einfluss Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH geltend zu machen und sich deutlich und öffentlich für die sofortige und bedingungslose Freilassung inhaftierter bahrainischer Aktivisten stark zu machen. Drei der Inhaftierten besitzen neben der bahrainischen auch eine EU-Staatsbürgerschaft. Während des gesamten Jahres 2013 erweckte die EU den Eindruck, als verfüge sie über keinerlei Strategie, um auf Fortschritte in Ländern hinzuwirken, in denen die Menschenrechte systematisch verletzt werden, etwa in Äthiopien, Usbekistan, Turkmenistan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi Arabien. Im Umgang mit Menschenrechtsproblemen in Zentralasien, im Kaukasus und Nicht-EU-Staaten in Osteuropa verfolgte die EU unterschiedliche, teilweise widersprüchliche Ansätze. So hob sie ein seit 2011 geltendes Einreiseverbot für den weißrussischen Außenminister auf, damit dieser im Juli als erster weißrussischer Spitzenpolitiker seit 2010 nach Brüssel reisen konnte. Zugleich betonte die EU im Jahresverlauf wiederholt, dass der Dialog nur dann wieder aufgenommen werde, wenn Weißrussland die Zielvorgaben der EU in Bereich der Menschenrechte erreiche, einschließlich der unverzüglichen Entlassung politischer Gefangener. Menschenrechtsfragen in EU-Mitgliedsstaaten Deutschland Asylsuchende und Geflüchtete initiierten im ganzen Jahr Proteste und Hungerstreiks gegen die schlechten Bedingungen in den Aufnahmeeinrichtungen und die Einschränkungen ihrer Freizügigkeit und ihres Arbeitsmarktzugangs. abgeschoben werden können. Dennoch schoben die Behörden im April 127 und im Juli erneut 90 Personen nach Serbien und Mazedonien ab. Mindestens drei Bundesländer schoben Roma weiter ohne angemessene Risikoüberprüfung in den Kosovo ab, obwohl sie dort diskriminiert werden und die Integrationsmaßnahmen unzureichend sind. Das Deutsche Institut für Menschenrechte berichtete im Juni, dass die Praxis des Ethnic Profiling, also polizeilicher Personenkontrollen auf Grund ethnischer Merkmalen, weit verbreitet ist, insbesondere zum Zweck der Einreisekontrolle an Verkehrskontenpunkten. Das Institut empfahl, die entsprechenden Gesetze und politischen Richtlinien zu reformieren. Obwohl gegenteilige Informationen veröffentlicht wurden, wies die Regierung wies Vorwürfe zurück, die deutschen Geheimdienste und die Polizei hätten von der Überwachungstechnologie der USA profitiert und mit ihren Geheimdiensten zusammengearbeitet. Im September ratifizierte Deutschland die ILO-Konvention über die Rechte von Hausangestellten. Im Dezember billigte der Bundestag ein Gesetz, mit dem klargestellt wurde, dass Eltern das Recht haben, ihre Söhne aus religiösen Gründen beschneiden zu lassen, solange dabei medizinische Standards gewahrt werden. Frankreich Das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma und die Liga für Menschenrechte berichteten, dass zwischen Januar und September 13.400 Roma aus informellen Siedlungen vertrieben wurden. Im Vorjahr betrafen die Zwangsräumungen insgesamt 9.400 Personen. Im August bezeichnete die Nationale Beratungsausschuss für Menschenrechte es als „administrative Belästigung“, dass die französischen Behörden massenhaft Abschiebungsanordnungen gegen Roma ausgestellt hatten. Die Kommission forderte die Regierung auf, die Zwangsräumungen von Armenvierteln und besetzten Häusern zu beenden, solange den Betroffenen keine adäquaten Ersatzunterkünfte angeboten werden. Zudem solle die Regierung die Reisefreiheit und Freizügigkeit von EU-Bürgern respektieren. Im Mai begann der Prozess gegen eine mutmaßliche Angehörige und vier mutmaßliche Komplizen einer Neonazi-Zelle, der die Ermordung von neun Migranten und einer Polizistin zur Last gelegt wird. Eine nationale Untersuchungskommission empfahl im August, die Praktiken der deutschen Polizei zu verbessern. Insbesondere mahnte sie an, Hassverbrechen größere Aufmerksamkeit zu schenken, die Diversität innerhalb der Polizei zu verbessern und bei der Ausbildung von Polizisten einen Schwerpunkt auf die Menschenrechte zu legen. Gesetzentwürfe, mit denen das Strafmaß für rassistisch motivierte Verbrechen erhöht beziehungsweise „Hassverbrechen“ als spezifischer Tatbestand eingeführt werden sollte, lehnte der Bundestag ab. Im Oktober befand der EGMR, Frankreich habe das Recht auf Privat- und Familienleben einer Gruppe französischer Roma verletzt, als die Behörden deren Vertreibung von einem Grundstück anordneten, auf dem sie jahrelang gelebt hatten. Im April trat in Baden-Württemberg eine Verordnung in Kraft, nach der eine individuelle Risikoüberprüfung durchgeführt werden muss, bevor Roma in den Kosovo Im Rahmen der UPR-Prüfung durch den UNMenschenrechtsrat akzeptierte Frankreich im Juni die Empfehlung Rates, ethnisch selektive 29 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Personenkontrollen, sogenanntes Ethnic Profiling, zu beenden. Die Regierung kündigte an, den Verhaltenskodex von Polizei und Gendarmerie zu überarbeiten, unternahm jedoch keine zusätzlichen Schritte, um diskriminierende Identitätskontrollen zu verhindern. Im Oktober wies ein Pariser Gericht die Beschwerde mehrerer Personen ab, die gegen Ethnic Profiling geklagt hatten. Die Richter führten als Begründung an, Nichtdiskriminierungsnormen seien in diesem Fall nicht anwendbar. Im Mai äußerte sich das UN-Komitee gegen das Verschwindenlassen besorgt darüber, dass in Frankreich bei beschleunigten Asylverfahren keine Möglichkeit besteht, eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung einzureichen. Dadurch komme es zu Abschiebungen in Länder, in denen den Betroffenen eine Verschleppung drohe. Das Komitee kritisierte zudem, dass zu häufig Personen in Polizeigewahrsam genommen würden. Im Juli kam es im Pariser Vorort Trappes zu Unruhen, nachdem die Polizei eine Frau angehalten hatte, die einen Gesichtsschleier trug. Ein 14-Jähriger verlor ein Auge, als er offenbar von einem Gummigeschoss der Polizei getroffen wurde. Menschenrechtsorganisationen verzeichneten eine Zunahme der Anzahl von Übergriffen auf Muslime, insbesondere auf muslimische Frauen. Im April äußerte sich der französische Ombudsmann besorgt über die etwa 3.000 unbegleiteten Flüchtlingskinder im Übersee-Departement Mayotte, von denen Hunderte völlig auf sich allein gestellt sind. Im Juli änderte das Parlament den Tatbestand der Präsidentenbeleidigung, nachdem der EGMR im März entschieden hatte, dass dieser die Meinungsfreiheit unzulässig einschränke. In April stellte das Parlament gleichgeschlechtliche Ehen gesetzlich gleich. SOS Homophobie, eine Organisation, die sich gegen homophobe Diskriminierung und Gewalt einsetzt, verzeichnete bis November über 3.200 homophobe Vorfälle, vergleichen mit insgesamt rund 2.000 im gesamten Jahr 2012. Im März kündigte die Regierung an, ab 2014 Statistiken zu homophober Gewalt zu veröffentlichen. Im August führte die Regierung den Tatbestand der „Versklavung“ gesetzlich ein, mit dem Zwangsarbeit, Versklavung und die Ausbeutung von versklavten Personen unter Strafe gestellt werden. In zwei unabhängigen Fällen urteilte der EGMR im September und November, dass Frankreich gegen das Folterverbot verstoßen würde, falls das Land nicht von der Abschiebung eines abgewiesenen, tamilischen 30 Asylsuchenden nach Sri Lanka bzw. eines kongolesischen Staatsbürgers in die Demokratische Republik Kongo absehe. Nach Berichten über das massenhafte Abfangen von Kommunikationsdaten durch US-amerikanische und britische Geheimdienste stritt Premierminister Ayrault in einem im Juli veröffentlichten Artikel in der Zeitung Le Monde ab, dass die französischen Geheimdienste in Frankreich systematisch Kommunikationsdaten sammeln. Bei Redaktionsschluss prüfte das Parlament einen Gesetzesentwurf, der die Kontrolle der Geheimdienste geringfügig verbessern soll. Griechenland Das dritte Jahr der Wirtschaftskrise in Griechenland war geprägt von politischer Unsicherheit. Im Mai warnte der Unabhängige Experte der UN für Auslandsschulden und Menschenrechte, die Bedingungen des Eurorettungspakets könnten die Achtung der Menschenrechte untergraben. Die plötzliche Schließung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt im Juni weckte Bedenken hinsichtlich der Medienfreiheit und führte zu einer Regierungsumbildung. Obwohl die Polizei im Januar Sondereinheiten gegen rassistische Straftaten bildete und einige Täter verhaftet wurden, dauerten die Angriffe auf Migranten und Asylsuchende an. Ein Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen verzeichnete bis Ende August 104 Vorfälle. Augenscheinlich nahmen auch die gewaltsamen Angriffe auf Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender zu. Der griechische Ombudsmann warnte im September, rassistische Gewalt und die Straffreiheit für die Täter gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Rechtsstaatlichkeit. Im November legte die Regierung einen Gesetzentwurf vor, der zwar Hassrede und Anstiftung zu Gewalt unter Strafe stellt, die Probleme in der bestehenden Gesetzgebung und Rechtspraxis im Hinblick auf rassistische Gewalt jedoch nicht löst. Im gleichen Monat wurden zwei Angeklagte nach einem im Jahr 2008 in Kraft getretenen Gesetz verurteilt, das eine rassistische Motivation als erschwerenden Tatumstand berücksichtigt. Im September erstach ein mutmaßliches Mitglied der Partei „Goldene Morgenröte“ in Athen einen linken Aktivisten. Die Regierung reagierte mit einem massiven Polizeieinsatz gegen die Partei, ließ den Parteiführer und fünf Parlamentsabgeordnete verhaften und klagte sie wegen der Führung einer kriminellen Vereinigung an. Eine interne Untersuchung der Polizei kam im Oktober zu dem Ergebnis, dass zehn griechische Polizeibeamte Verbindungen zu Goldene Morgenröte unterhielten. Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH 31 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Im Juni begann die neue Asylbehörde in Athen mit der Bearbeitung von Anträgen. Im Rest des Landes und in den Hafteinrichtungen blieb der Zugang zu Asyl schwierig. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Zahlen zeigen, dass der Anteil der in erster Instanz anerkannten Im April wurden drei griechische Vorarbeiter verhaftet, die Schutzgesuche in Griechenland der geringste in der auf 100 bis 200 bangladeschische Erdbeersammler ganzen EU war (0,9 Prozent im Jahr 2012). geschossen hatten, als diese ihre nicht ausgezahlten Im Mai urteilte der EGMR zum dritten Mal seit 2008, dass Löhne eingefordert hatten. Die 35 verletzen Personen die Segregation von Roma in Griechenlands Schulen eine erhielten aus humanitären Gründen eine unzulässige Diskriminierung darstellt. Der Aufenthaltsgenehmigung. Die Vorarbeiter und der Menschenrechtskommissar des Europarats Muižnieks Besitzer der Plantage befinden sich derzeit in äußerte sich besorgt zu den anhaltenden Berichten über Untersuchungshaft. Misshandlungen von Roma durch die Im Juli kritisierte das Gemeinsame Programm der Strafverfolgungsbehörden. In den ersten neun Monaten Vereinten Nationen zur Bekämpfung von HIV/AIDS, die des Jahres gab es 1.131 Polizeieinsätze in Roma-Camps Wiedereinführung eines Gesetzes zum im ganzen Land, was Bedenken laut werden ließ, die Gesundheitsschutz, das in der Vergangenheit dazu Polizei selektiere Zielpersonen nach ethnischen Kriterien. genutzt wurde, mutmaßliche Sexarbeiter zu verhaften Im März äußerte das UN-Komitee zur Beseitigung der und zwangsweise auf HIV zu testen. Zudem ist weiterhin ein Gesetz in Kraft, das der Polizei ermöglicht, Ausländer Diskriminierung von Frauen (CEDAW) Bedenken über Griechenlands Umgang mit Gewalt gegen Frauen. auf der Grundlage vage definierter Risiken für den Insbesondere kritisierte der Ausschuss, dass statistische Gesundheitsschutz festzunehmen. Daten fehlten. Weiter forderte er die Behörden auf, zu Im Oktober stellte der EGMR fest, das oberste griechische gewährleisten, dass die Betroffenen rasch entschädigt Gericht habe gegen das Recht eines HIV-Infizierten auf und geschützt und die Täter verfolgt und bestraft werden. Nichtdiskriminierung und Schutz des Privatlebens verletzt, weil es der Klage des Mannes gegen seinen Großbritannien Arbeitgeber nicht stattgegeben habe. Das Unternehmen Führende Minister übten immer wieder heftige Kritik am hatte den Kläger auf Grund seiner Krankheit entlassen. britischen Menschenrechtsgesetz (Human Rights Act) und Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze zur am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Türkei zwangen irreguläre Migranten und Asylsuchende, Innenministerin Teresa May kündigte an, die konservative insbesondere Menschen aus Syrien, über Inseln im Partei werde das Gesetz im Falle ihrer Wiederwahl im Jahr Ägäischen Meer einzureisen. Bei der Überfahrt starben 2015 streichen und möglicherweise aus der Europäischen mindestens zehn Personen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk Menschenrechtskonvention austreten. äußerte sich besorgt über die Vorwürfe, die griechischen Rückschritte gab es auch bei der strafrechtlichen Behörden hätten Migranten, darunter auch Flüchtlinge Verantwortlichkeit für Antiterrormaßnahmen und aus Syrien, zur Umkehr zurück in die Türkei gezwungen. Menschenrechtsverletzungen in Übersee. Ein im April Die UN-Arbeitsgruppe zu Willkürlicher Inhaftierung, der verabschiedetes Gesetz erweiterte die Möglichkeiten, aus UN-Sonderberichterstatter Crépeau und der Gründen der nationalen Sicherheit geheime Anhörungen Menschenrechtskommissar des Europarats Muižnieks vor Zivilgerichten durchzuführen. Die Regierung verankritisierten menschenrechtswidrige Polizeikontrollen und lasste keine weitere Untersuchung der britischen willkürliche Verhaftungen im Zuge der andauernden Beteiligung am CIA-Programm für Polizeioperation „Xenios Zeus“ gegen irreguläre Gefangenenüberstellungen und die Folter von Migranten. Sie wiesen zudem darauf hin, dass Migranten Verdächtigen in Übersee. Auch der Zwischenbericht der und Asylsuchende unter unwürdigen Bedingungen festge- abgebrochenen Gibson-Untersuchung wurde bislang halten und oft systematisch und überzogen lange inhafnicht veröffentlicht. tiert würden. Der EGMR verurteilte Griechenland in drei Der UN-Ausschuss gegen Folter forderte Großbritannien getrennten Fällen wegen unmenschlicher und erniedriim Mai auf, die Vorwürfe wegen Folter und anderer gender Behandlung in der Abschiebe- und Einreisehaft. In Misshandlung während der Militärintervention im Irak in der Einrichtung in Amgydalia kam es im August zu einem den Jahren von 2003 bis 2009 umfassend zu untersuHäftlingsaufstand. chen. Im selben Monat stellte das Oberste Gericht fest, dass nur in einem einzigen Fall der Tod eines irakischen Im November wurden zwei Mitglieder der Goldenen Morgenröte vor einem Parteibüro in Athen ermordet, ein dritter wurde schwer verletzt. Bislang hat Vorfall noch keine Verhaftung nach sich gezogen. 32 Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Staatsbürgers in britischer Gefangenschaft angemessen untersucht wurde. In einer zweiten Entscheidung im Oktober ordnete es eine öffentliche Untersuchung mutmaßlicher Tötungen von Irakern durch britische Streitkräfte an. Im März begann eine öffentliche, von einem Richter geleitete Untersuchung der Folter- und Hinrichtungsvorwürfe gegen britische Soldaten, die im Jahr 2004 bis zu 20 Iraker getötet haben sollen. Im November verurteilte ein Militärgericht einen britischen Marinesoldaten, der im September 2011 einen verletzen afghanischen Gefangenen in Afghanistan getötet hatte. Der jordanische Geistliche Abu Qatada wurde im Juli an Jordanien ausgeliefert, wo er wegen Terrorismusvorwürfen angeklagt ist. Die Abschiebung erfolgte auf der Grundlage eines Vertrags, der Qatada ein faires Gerichtsverfahren zusichert. Dennoch bleibt zu befürchten, dass in dem Verfahren unter Folter erpresste Beweise verwendet werden. Antiterrorgesetz zulässige Dauer. Das Oberste Gericht prüfte Mirandas Beschwerde gegen seine Inhaftierung im November. Im Oktober erwähnte Premierminister David Cameron ausdrücklich den Guardian, als er drohte, die Regierung könne unbestimmte Maßnahmen gegen Zeitungen ergreifen, die bei ihrer Berichterstattung über die Massenüberwachung keine „soziale Verantwortung“ zeigten. Im Mai forderte der UN-Ausschuss gegen Folter einen „umfassenden Rahmen für die Übergangsjustiz“ in Nordirland. Eine interfraktionelle Gruppe der nordirischen Exekutive plante, zum Jahresende Empfehlungen zu den noch strittigen Themen zu veröffentlichen. Im Februar setzte das Oberste Gericht Abschiebungen von Tamilen nach Sri Lanka aus, bis die Überarbeitung der Länderrichtlinien zu Sri Lanka durch das Einwanderungstribunal abgeschlossen sei. Die im Juli veröffentlichten neuen Richtlinien erkannten Folter, Bestechung und fehlende Behandlungsmöglichkeiten für Im Juli wurde die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. geistige Erkrankungen als wichtige Faktoren an, reduIm November begann der Prozess gegen zwei Männer, die zierten jedoch gleichzeitig den Personenkreis ein, deren den britischen Soldaten Lee Rigby im Mai in London Asylanträge Aussicht auf Erfolg haben. brutal ermordet haben sollen. In den Monaten nach seiner Verhaftung kam es vermehrt zu Angriffen gegen Italien Muslime und islamische Einrichtungen, darunter auch Bis zum Oktober hatten mehr als 35.000 Personen Italien Brandanschläge. In London verzeichnete die Polizei bis auf dem Seeweg erreicht, deutlich mehr als im verganzum Oktober einen Anstieg der Straftaten gegen Muslime genen Jahr. Ein Viertel der Flüchtlinge und Migranten um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. stammte aus Syrien. Verschiedene Stellen berichteten, Im Juli forderte der UN-Ausschuss für die Beseitigung der die Regierung habe angeordnet, Handelsschiffe sollten Diskriminierung der Frau die britische Regierung auf, den aus Seenot gerettete Migranten in libysche Häfen negativen Auswirkungen der Budgetkürzungen bei staatli- bringen, sofern diese die nächstgelegenen seien. Dabei chen Leistungen für Frauen entgegenzuwirken, insbeson- könnte es sich um Refoulement handeln. dere bei Frauen mit Behinderungen und älteren Frauen. Am 31. März lief der Nordafrika-Notfallplan zur Aufnahme Im September kritisierte der UN-Sonderberichterstatter von Migranten offiziell aus, der im Jahr 2011 während des über das Recht auf Wohnraum Raquel Rolnik die Folgen Konflikts in Libyen initiiert und später mehrmals verländer Sparmaßnahmen. Er betonte, dass Beweise dafür gert worden war. Dies führte zur Schließung von vorliegen, dass Roma, Migranten und Asylsuchende auf Notunterkünften. Abgewiesene Asylsuchende durften dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden. sich entweder erneut bewerben oder erhielten eine Menschenrechtsgruppen beklagten eine Zunahme der einjährige Aufenthaltsgenehmigung und 500 Euro. Viele Menschenrechtsverletzungen gegen Migranten, die als reisten in andere europäische Staaten. Im September Hausangestellte arbeiten, seit dieser Gruppe im Jahr 2012 kündigte die Regierung an, die Zahl der Plätze in das Recht abgesprochen wurde, den Arbeitgeber zu Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und wechseln. Geflüchtete von 3.000 auf 16.000 zu erhöhen. Das UNIm September forderten die UN-Sonderberichterstatter für Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR), das den Schritt begrüßte, hatte bereits im Juli betont, dass das italieniMeinungsfreiheit bzw. Menschenrechte und sche Aufnahmesystem umfassend reformiert werden Terrorismusbekämpfung Auskunft über die Festnahme muss, um die völlig unzureichenden Hilfsmaßnahmen für von David Miranda im August. Miranda ist der Partner Flüchtlinge zu verbessern. eines Guardian-Reporters, der über die Überwachungsprogramme der USA berichtet hatte. Er wurde neun Stunden lang am Flughafen Heathrow festgehalten, die maximale, nach dem britischen Im April kritisierte UN-Sonderberichterstatter Crépeau die italienische Einwanderungshaft, insbesondere die schlechten Lebensbedingungen und den unzureichenden 33 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch 34 Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Zugang zur Justiz. Inhaftierte protestierten in mehreren Einrichtungen, unter anderem nach dem Tod eines Marokkaners in der Aufnahmeeinrichtung in Crotone im August. Crépeau kritisierte erneut die automatischen Sammelabschiebungen nach Griechenland und das Fehlen von Schutzbestimmungen in Abkommen über „schnelle Rückführungen“ mit Tunesien und Ägypten. Weiterhin forderten er und das UNHCR Italien auf, ein effektives Verfahren zur Altersfeststellung einzuführen und zu gewährleisten, dass Kinder angemessen geschützt werden. Drei UN-Experten äußerten sich besorgt über die illegale Abschiebung der Frau und der Tochter des kasachischen Regierungskritikers Mukhtar Ablyazov aus Rom im Mai und kritisierten den Vorgang als „außerordentliche Überstellung“. Im Juli erkannte die Regierung an, dass die kasachischen Behörden in unzulässiger Weise an der Abschiebung beteiligt waren, und hob die Abschiebeanordnung auf. Allerdings befinden sich die Frau und das Kind derzeit noch immer in Kasachstan, wo sie Reisebeschränkungen unterliegen. Im November kritisierte ein Bericht des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter die Überbelegung von Gefängnissen sowie Misshandlungen, vor allem von Ausländern, durch Polizei und Carabinieri. Die Abgeordnetenkammer des Parlaments billigte im September die Ausweitung der Schutzbestimmungen gegen Hasskriminalität auf Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LGBT). LGBT-Organisationen kritisierten eine Bestimmung der neuen Vorschrift, die noch vom Senat bestätigt werden muss und vorsieht, dass eine Reihe von Organisationen nicht wegen krimineller Hassrede belangt werden können. Im Februar verurteilte ein Berufungsgericht drei USBürger, darunter den ehemaligen Leiter der CIAAußenstelle in Rom, weil sie an der Entführung eines ägyptischen Geistlichen im Jahr 2003 in Mailand beteiligt waren. Damit hob das Gericht die frühere Entscheidung auf, die Verantwortlichen auf Grund ihrer diplomatischen Immunität nicht zu verfolgen. Unabhängig davon sprach das Gericht auch fünf Mitarbeiter des italienischen Geheimdiensts schuldig, deren Beteiligung im Rahmen des Staatsgeheimnisses verschleiert worden war. Im Januar ratifizierte Italien als erster EU-Mitgliedsstaat die ILO-Konvention zur menschenwürdigen Arbeit für Hausangestellte. Im Oktober gab das Parlament einem Erlass der Regierung aus dem August Gesetzeskraft, und schuf damit neue rechtliche Handhabe gegen häusliche Gewalt und Stalking, einschließlich höherer Strafen in bestimmten Fällen und der Erteilung humanitärer Visa für Opfer ohne Aufenthaltstitel. Der UN-Experte Joy Ngozi Ezeilo forderte die Regierung im September auf, alle Formen des Menschenhandels mit einem landesweiten Vorgehen zu bekämpfen, insbesondere Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung oder zur Beschaffung von Arbeitskräften. Kroatien Kroatien trat im Juli trotz weiterhin bestehender Menschenrechtsbedenken der EU bei. Im März forderte die Europäische Kommission Verbesserungen in den Bereichen Justiz, Strafverfolgung von Kriegsverbrechen und Minderheitenschutz. Die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen wurde auf nationaler und internationaler Ebene fortgesetzt. Im Januar verurteilte ein Bezirksgericht den kroatischen Staat zur Entschädigung der serbischen Kinder, die bei dem Angriff auf Varivode im Rahmen der „Operation Sturm“ im Jahr 1995 ihre Eltern verloren hatten. Die Zahl freiwilliger Rückkehrer nach Kroatien stieg im vergangenen Jahr an. In den ersten fünf Monaten des Jahres kamen 358 Menschen zurück, im gesamten Jahr 2012 waren es 132. Dabei blieb die Reintegration von Angehörigen der serbischen Minderheit problematisch. In einigen Regionen des Landes wurden sie weiterhin diskriminiert, waren Anfeindungen ausgesetzt und konnten ihr Recht auf Wohnraum nicht geltend machen. Im November stoppte der Stadtrat von Vukovar die Einführung der Zweisprachigkeit, nachdem es zu Protesten gegen Straßenschilder in kyrillischer Schrift gekommen war. Roma, insbesondere staatenlose Roma, begegneten weiter erheblichen Schwierigkeiten beim Zugang zu grundlegenden staatlichen Leistungen wie Gesundheitsversorgung, soziale Unterstützung und Bildung. Nur wenige Menschen beantragten in Kroatien Asyl, bis Mitte Oktober betrug ihre Zahl 928. Die drittgrößte Gruppe waren Personen aus Syrien. Trotz der geringen Zahlen waren die Aufnahmeeinrichtungen überfüllt und es gab Berichte, wonach Asylsuchende in geschlossenen Hafteinrichtungen untergebracht wurden. Insbesondere unbegleitete Kinder wurden unzureichend geschützt. Ihre staatlich ernannten Vormunde waren oft schlecht geschult und wohnten weit entfernt von den Einrichtungen, in denen die Kinder lebten und die als Unterkünfte oftmals ungeeignet waren. Das Wahlrecht von Menschen mit geistigen Behinderungen wurde im Dezember 2012 wiedereingeführt. Aber selbst die Pläne, Tausende Menschen aus der Abhängigkeit von ihrem gesetzlichen Vormund zu 35 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch befreien, sahen vor, dass Gerichte die Rechtsfähigkeit der Betroffenen massiv einschränken können. Das im Jahr 2011 eingeleitete Vorhaben, die Versorgung von Personen mit geistigen Behinderungen aus Krankenhäusern auszulagern, wurde nur schleppend umgesetzt. Im Mai begannen zwei Projekte mit insgesamt 400 Teilnehmern, während weiterhin fast 9.000 Menschen mit geistigen Behinderungen in geschlossenen Einrichtungen leben. Infolge eines Urteils des Obersten Gerichtshofs im Dezember 2012 wurde die türkische Journalistin Vicdan Özerdem aus der Haft entlassen und nach Deutschland überführt, wo sie politisches Asyl erhielt. Özerdem befand sich seit Mitte 2012 in Haft, weil sie in die Türkei abgeschoben werden sollte, wo sie als Terroristin verfolgt wird. Dieses Vorgehen der kroatischen Behörden war international auf Kritik gestoßen. Niederlande Die Einwanderungs- und Asylpolitik der Niederlande gibt weiterhin Anlass zu Kritik. Im Juni kritisierte das UNKomitee gegen Folter, dass unbegleitete Kinder und Familien mit Kindern, deren Alter behördlich festgestellt werden muss, oft länger als die gesetzlich erlaubten 18 Monate in Einreisehaft blieben. Das Komitee beanstandete zudem die Haftbedingungen und die Behandlung der Inhaftierten. Es empfahl der niederländischen Regierung, konsequent auf Alternativen zur Haft zurückzugreifen. Im Mai traten in Rotterdam und am Flughafen Schiphol inhaftierte Migranten in den Hungerstreik, um gegen die schlechte Behandlung zu protestieren. Bei Redaktionsschluss prüfte das Parlament einen Gesetzesentwurf, der irregulären Aufenthalt im Land zu einer Straftat erklärt, die mit Bußgeldern von bis zu 3.900 € bzw. bis zu sechs Monaten Haft für Wiederholungstäter geahndet werden kann. Das Ministerium für Sicherheit und Justiz formulierte für die Polizei die Zielvorgabe, jährlich 4.000 irreguläre Migranten festzunehmen. Noch im Juni wurden auch Asylanträge, die von unbegleiteten Kindern gestellt wurden, im beschleunigten Asylverfahren bearbeitet. Antragssteller im Alter von über 16 Jahren, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, konnten mit sofortiger Wirkung abgeschoben werden. Ausnahmen von dieser Regelung waren nur möglich, wenn im Herkunftsland keine angemessene Betreuung zur Verfügung stand oder wenn das Kind nicht in der Lage war, für sich selbst zu sorgen. Der niederländische Beauftragte für Kinderrechte kritisierte, in diesem Verfahren werde das Interesse des Kindes nicht angemessen berücksichtigt. Im April bestätigte die Regierung, dass fast 300 Personen trotz laufender Asylverfahren fälschlicherweise als 36 „abschiebefähig“ eingestuft wurden. Unter ihnen befand sich auch ein Russe, der im Januar in Abschiebehaft Selbstmord beging. Im September kündigte die Regierung an, die Inhaftierung von Asylsuchenden künftig einzuschränken. Im gleichen Monat gewährte die Regierung 620 Kindern (und 690 Angehörigen) eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, die seit mindestens fünf Jahren in den Niederlanden gelebt und Asylanträge gestellt hatten. Damit wurde jedoch nur die Hälfte der Anträge, die im Rahmen der Maßnahme eingereicht wurden, bewilligt. Die niederländische Regierung hatte Ende 2012 entschieden, dass abgelehnte Asylbewerber nach Somalia abgeschoben werden dürfen. Dennoch verhinderten Berufungsgerichte solche Abschiebungen über das gesamte letzte Jahr. Im September, unmittelbar nachdem der EGMR in einem Verfahren gegen Schweden entschieden hatte, dass Rückführungen aufgrund der verbesserten Sicherheitslage in der somalischen Hauptstadt zulässig seien, führten die Niederlande erste Abschiebungen nach Somalia durch. Im November wurde ein Somalier drei Tage nach seiner Abschiebung durch eine Bombenexplosion in Mogadischu verletzt. Bei Redaktionsschluss prüfte der Senat einen Gesetzesentwurf, mit dem die operative Geschlechtsumwandlung als Voraussetzung für die Änderung des Geschlechtseintrags in Ausweisdokumenten abgeschafft werden soll. Die erste Kammer hatte den Entwurf bereits im Februar angenommen. Polen Die seit fünf Jahren laufenden Ermittlungen zu CIAGeheimgefängnissen in Polen wurden fortgesetzt und blieben intransparent. Im November drängte das UNKomitee gegen Folter darauf, die Untersuchung in einem angemessenen Zeitraum abzuschließen. Im Frühjahr wurde bekannt, dass die Anklage gegen den ehemaligen Leiter des polnischen Geheimdienstes, welche nie offiziell bestätigt worden war, fallen gelassen werden sollte. Im Oktober erkannte die Generalstaatsanwaltschaft einen in Guantánamo inhaftierten jemenitischen Staatsbürger offiziell als Opfer an. Im Januar sprach ein Berufungsgericht den Betreiber der Website Antykomor.pl von dem Vorwurf frei, den Präsidenten diffamiert zu haben. Nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung im September 2012 hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die polnische Regierung aufgefordert, den Straftatbestand der Verleumdung abzuschaffen. Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Im Februar verurteilte der EGMR Polen wegen Verstoßes gegen das Verbot unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, weil die polnischen Behörden eine querschnittsgelähmte Person in einem Gefängnis festgehalten haben, das für Menschen mit Behinderungen ungeeignet war. besorgt über die Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf schutzbedürftige Gruppen wie Kinder und Menschen mit Behinderungen. Er kritisierte auch die Straflosigkeit für Angehörige der Strafverfolgungsbehörden, denen Misshandlungen und Folter vorgeworfen werden. Das Parlament lehnte zwar ein von zivilgesellschaftlichen Gruppen gefordertes Gesetz zum Erlass von Hypothekenschulden ab, verabschiedete im Mai jedoch einige Maßnahmen zur Eindämmung der Immobilienkrise, die eine bessere juristische Prüfung von Hypothekenverträge erlauben. Damit reagierte die Der Senat prüft ein neues Gesetz zur Einrichtung von Regierung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, Hochsicherheitsgefängnissen für Straftäter, die als der im Mai befunden hatte, die bestehenden Gesetze Bedrohung für das Leben, die Gesundheit oder die sexuverletzten EU-Verbraucherschutzrichtlinien. Die neuen elle Freiheit ihrer Mitbürger bzw. von Kindern eingestuft Vorschriften sehen zudem Maßnahmen zur Minderung werden. Obwohl der Gesetzentwurf Schutzbestimmungen von Hypothekenschulden vor und erweitern das enthält, könnte er zu einer unbegrenzten Inhaftierung von Moratorium für Zwangsräumungen. Personen führen, die ihre Strafe bereits verbüßt haben. Der spanische Bürgerbeauftragte rief die Polizei im Mai Rumänien auf bei Personenkontrollen schriftliche Belege auszuIm Januar stellte die Europäische Kommission fest, mit stellen, welche die ethnische Herkunft und/oder der Umsetzung ihrer Empfehlungen habe Rumänien die Nationalität der kontrollierten Person sowie die Gründe Verfassungskrise des Jahres 2012 zwar abgewendet, die der Kontrolle dokumentieren. Im Juni erklärte der Probleme in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Vertreter der Zentralregierung im katalonischen Lleida, Unabhängigkeit der Gerichte und Stabilität bestünden die Polizei gehe bei einwanderungsbezogenen jedoch fort und gingen zumindest teilweise auf die Personenkontrollen auch nach ethnischen Einschüchterung und Belästigung von Richtern zurück. Auswahlkriterien vor. Das Parlament prüft derzeit einen Gesetzentwurf, der vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Gender-Identität schützen und den Tatbestand der Belästigung erweitern soll. Roma wurden auch im vergangenen Jahr diskriminiert und waren von Zwangsräumungen betroffen, die oft kurzfristig und ohne Bereitstellung von Ersatzunterkünften durchgeführt wurden. Im August zerstörten die Behörden 15 Unterkünfte in der Roma-Siedlung in Craica nahe der Stadt Baia Mare. Die Räumung der verbleibenden 15 Familien stand bei Redaktionsschluss noch aus. Im September vertrieben die Lokalbehörden in Eforie Sud 100 Roma aus ihren Unterkünften, darunter 60 Kinder. Im selben Monat erklärte der Staatssekretär für Minderheiten, er würde seine Kinder nicht auf Schule mit hohem Roma-Anteil schicken. Damit verstärkte er Vorurteile und lieferte Argumente für die Ausgrenzung im Bildungswesen. Spanien Im Januar kritisierte der UN-Sonderberichterstatter für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Mutuma Ruteere, dass sich die Situation von Migranten in Spanien verschlechtert habe. Viele seien arbeitslos, hätten nur eingeschränkt Zugang zu Gesundheitsversorgung. Wohngebiete mit hohem Migrantenanteil würden de facto ausgegrenzt, Ressentiments gegen Roma seien weiter verbreitet. Im Oktober äußerte sich der Menschenrechtskommissar des Europarats Muižnieks Im Oktober forderte ein argentinisches Gericht unter Berufung auf die universelle Gerichtsbarkeit die Auslieferung zweier wegen Folter gesuchter ehemaliger Beamter des Franco-Regimes. Im November rief der UNAusschuss über das Verschwindenlassen die spanische Regierung auf, alle Fälle zu untersuchen, unabhängig davon, wann die betroffenen Personen verschwunden sind. Der Ausschuss betonte, Isolationshaft verletze das Verbot von geheimer Inhaftierung im Rahmen der UNKonvention gegen das Verschwindenlassen. Im Februar erklärte der spanische Oberste Gerichtshof einen Erlass der Stadtverwaltung von Lleida in Katalonien für ungültig, der das Tragen gesichtsverdeckender Schleier verboten hatte. Das Dekret verletzte nach Einschätzung der Richter die Religionsfreiheit. Die Regionalregierung gab im Juli bekannt, Gesichtsbedeckungen in der Öffentlichkeit aus Sicherheitsgründen verbieten zu wollen. Im August wurde bekannt, dass die katalonische Polizei Daten über vollverschleierte Frauen sammelt. Das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter äußerte sich im April besorgt über die mutmaßliche Misshandlung von Terrorverdächtigen in Isolationshaft bzw. von Personen in Polizeigewahrsam. Das Komitee 37 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch kritisierte auch die Bedingungen in den Gefängnissen und die „gefängnisähnliche“ Atmosphäre in Aufnahmeeinrichtungen für Migranten. Im Oktober bestätigte der EGMR sein Urteil aus dem Jahr 2012, wonach die rückwirkende Verlängerungen von Gefängnisstrafen und die Einschränkung der Bewährungsfähigkeit von Personen, die wegen terroristischer Vergehen verurteilt wurden, die Verfahrensrechte der Betroffenen verletzt. In Folge des Urteils wurden bis Mitte November 31 Gefangene entlassen, darunter auch 24 Mitglieder der ETA. Das Innenministerium berichtete im September, seit Januar hätten rund 3.000 Migranten versucht, in die spanische Enklave Melilla zu gelangen – doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Mehr als Dreiviertel von ihnen seien an der Einreise gehindert worden. Den spanischen Strafverfolgungsbehörden wird weiter vorgeworfen, sie führten Sofortabschiebungen durch und lieferten die Migranten so dem Risiko der Misshandlung durch die marokkanische Polizei aus. Ungarn noch hoben sie die Einschränkungen für politische Werbung in privaten Medien vollständig auf. Roma begegneten auch im vergangenen Jahr Diskriminierung und Belästigung. Der Bürgermeister der Stadt Ozd im Norden Ungarns ließ Roma-Siedlungen mit schätzungsweise 500 Familien vom öffentlichen Wassernetz trennen. Im Januar befand der EGMR Ungarn für schuldig, zwei Roma-Schüler diskriminiert zu haben, weil die Behörden diese in Sonderschulen eingewiesen hatten. Im Juli bestätigte das Gericht das von einem ungarischen Gericht erlassene Verbot der Ungarischen Garde, einer Roma- und Juden-feindlichen Gruppierung. Im August verurteilte ein Budapester Gericht vier Männer wegen Mordes, die an rassistischen Übergriffen in den Jahren 2008 und 2009 beteiligt gewesen waren, bei denen sechs Roma getötet wurden, darunter auch ein Kind. Der Antisemitismus in Ungarn bleibt problematisch. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Übergriffs auf den Präsidenten der Raoul Wallenberg-Stiftung am Rande eines Fußballspiels im April, bei dem auch „Sieg Heil“Rufe laut geworden waren. Die Regierung nahm erneut Gesetzesänderungen vor, welche die Rechtsstaatlichkeit bedrohen und den Schutz der Menschenrechte schwächen. Durch die im März verabschiedeten Verfassungsänderungen wurde die Unabhängigkeit der Justiz weiter ausgehöhlt, wichtige Kompetenzen des Verfassungsgerichts beschnitten und Bestimmungen eingeführt, die zuvor verfassungswidrig gewesen wären. Im März forderte der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau die ungarischen Behörden auf, den gesetzlichen Schutz für die Opfer häuslicher Gewalt zu verbessern und die Kapazität der Aufnahmeeinrichtungen zu erhöhen. Im Juli wurde häusliche Gewalt als Straftatbestand eingeführt, was härtere Strafen ermöglicht und die Strafverfolgung der Täter erleichtert. Die Regelung schließt zudem Paare ohne Obwohl im März geringfügige Änderungen im gemeinsamen Wohnsitz und ohne gemeinsame Kinder Medienrecht vorgenommen wurden, ist die zentrale aus und gilt nur bei wiederholtem Missbrauch. Im Kontrollinstanz, der Medienrat, weiterhin nicht politisch September empfahl der UN-Ausschuss für die Rechte von unabhängig. Journalisten können auch weiterhin mit Menschen mit Behinderung, eine Regelung in der überzogenen Bußgeldern sanktioniert werden. Die Verfassung zu überarbeiten, die das Wahlrecht von Kriterien, nach denen Medieninhalte reguliert werden, Menschen einschränkt, die von einem rechtlichen sind immer noch unklar. Im März konnte der unabhängige Vormund vertreten werden. In sechs Fällen forderte der Nachrichtensender Klubradio nach vier positiven Ausschuss, Personen wieder ins Wahlregister aufzuGerichtsentscheiden seine Lizenz erneuern. nehmen. In Reaktion auf die internationale Kritik und nahm die Regierung im September einige kosmetische Verfassungsänderungen vor. Dem vorausgegangen waren eine ausführliche Stellungnahme der VenedigKommission des Europarats und ein vernichtender Bericht des Europäischen Parlaments, die Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz, der rechtlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften und politischer Werbekampagnen geäußert hatten. Die Verfassungsänderungen setzten jedoch weder der Diskriminierung von Religionsgemeinschaften ein Ende 38 Im Juli führte die Regierung die Möglichkeit wieder ein, Asylsuchende aufgrund übermäßig weit gefasster Umstände zu inhaftieren. Im Oktober forderte die UNArbeitsgruppe zu Willkürlicher Inhaftierung wirksamere Maßnahmen, um die willkürliche Inhaftierung von Asylsuchenden und irregulären Migranten zu verhindern. Bis Ende August hatten 15.069 Personen in Ungarn Asyl beantragt, darunter 588 Menschen aus Syrien. Dies entspricht einem erheblichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem die Zahl der Asylanträge nur 1.195 betragen hatte. Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH 39 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch Anhang Internationale Grundsätze für die Anwendung der Menschenrechte in der Kommunikationsüberwachung Translation revised by Digitalcourage e.V ENDGÜLTIGE VERSION VOM 10. JULI 2013 Im September nahm das Parlament ein Gesetz an, das den Regionalbehörden regionalen Regierungen ermöglicht, Obdachlosigkeit mit Bußgeldern, Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit oder sogar Gefängnisstrafen zu ahnden. Während die Technologien, welche die staatliche Kommunikationsüberwachung unterstützen, verbessert werden, vernachlässigen die Staaten sicherzustellen, dass Gesetze und Verordnungen in Bezug auf Kommunikationsüberwachung in Einklang mit internationalen Menschenrechten stehen und die Rechte auf Privatsphäre und Meinungsfreiheit beachtet werden. Dieses Dokument versucht zu erklären, wie internationale Menschenrechte in der aktuellen digitalen Umgebung anwendbar sind, besonders vor dem Hintergrund des Wachstums und des Wandels der Technologien und Methoden der Kommunikationsüberwachung. Diese Grundsätze können zivilgesellschaftlichen Gruppen, der Wirtschaft, Staaten und anderen einen Rahmen liefern, mit dem sie bewerten können, ob aktuelle oder geplante Überwachungsgesetze oder -praktiken im Einklang mit den Menschenrechten stehen. Diese Grundsätze sind das Ergebnis einer globalen Beratung mit Gruppen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und internationalen Experten für Recht, Politik und Technologien in der Kommunikationsüberwachung. Einleitung Privatsphäre ist ein Grundrecht, das wesentlich ist für den Erhalt von demokratischen Gesellschaften. Es ist grundlegend für die menschliche Würde und verstärkt andere Rechte, wie Meinungs-, Informations- und Versammlungsfreiheit, und es ist nach internationalen Menschenrechtsgesetzen anerkannt.[1]Aktivitäten, die 40 das Recht auf Privatsphäre begrenzen, einschließlich Kommunikationsüberwachung, können nur dann als gerechtfertigt gelten, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind, sie notwendig sind, um ein legitimes Ziel zu erreichen, und sie dem Ziel, welches sie verfolgen, angemessen sind.[2] Vor der öffentlichen Einführung des Internets schufen fest etablierte legale Grundsätze und der Kommunikationsüberwachung innewohnende logistische Hürden Grenzen für die staatliche Kommunikationsüberwachung. In gegenwärtigen Dekaden haben die logistischen Barrieren der Überwachung abgenommen und die Anwendung der gesetzlichen Grundsätze in neuen technologischen Kontexten sind unklarer geworden. Die Explosion der Inhalte digitaler Kommunikation und Information über Kommunikation, sogenannte „Verbindungsdaten“ Informationen über die Kommunikation eines Individuums oder Nutzung elektronischer Geräte - die sinkenden Kosten der Speicherung und des Dataminings und die Bereitstellung von persönlichen Inhalten durch Drittanbieter machen staatliche Überwachung in einem beispiellosen Ausmaß möglich[3]Dabei haben Konzeptualisierungen der bestehenden Menschenrechtsgesetze nicht Schritt gehalten mit den modernen und sich verändernden Möglichkeiten der Kommunikationsüberwachung des Staates, der Fähigkeit des Staates, aus verschiedenen Überwachungstechniken gewonnene Informationen zu kombinieren und zu organisieren, oder der erhöhten Sensibilität der Informationen, die zugänglich werden. Die Häufigkeit, mit der Staaten Zugang zu Kommunikationsinhalten und –metadaten suchen, steigt dramatisch - ohne angemessene Kontrolle.[4] Wenn Kommunikationsmetadaten aufgerufen und analysiert werden, kann damit ein Profil einer Person, einschließlich des Gesundheitszustandes, politischer und religiöser Ansichten, Verbindungen, Interaktionen und Interessen, Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH Traditionell wurde die Invasivität der Kommunikationsüberwachung auf Basis von künstlichen und formalen Kategorien bewertet. Bestehende rechtliche Rahmenbedingungen unterscheiden zwischen „Inhalt“ oder „Nicht-Inhalt“, „Teilnehmerinformation“ oder „Metadaten“, gespeicherten Daten oder Übertragungsdaten, Daten, die zuhause gespeichert werden oder die im Besitz eines dritten Diensteanbieters sind.[7] Allerdings sind diese Unterscheidungen nicht mehr geeignet, den Grad des Eindringens der Kommunikationsüberwachung in das Privatleben von Einzelpersonen und Verbänden zu messen. Während seit Damit Staaten tatsächlich ihren internationalen Langem Einigkeit darin besteht, dass menschenrechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf Kommunikationsinhalte per Gesetz signifikanten Schutz Kommunikationsüberwachung nachkommen, müssen sie verdienen wegen ihrer Fähigkeit, sensible Informationen den im Folgenden genannten Grundsätzen entsprechen. zu offenbaren, ist es nun klar, dass andere Informationen Diese Grundsätze gelten für die Überwachung der aus der Kommunikation - Metadaten und andere Formen eigenen Bürger eines Staates, die in seinem eigenen der nicht-inhaltlichen Daten - vielleicht sogar mehr über Hoheitsgebiet ausgeführt wird, sowie der Überwachung eine Einzelperson enthüllen können, als der Inhalt selbst anderer in anderen Gebieten. Die Grundsätze gelten und verdienen daher einen gleichwertigen Schutz. Heute außerdem unabhängig vom Zweck der Überwachung könnte jede dieser Informationsarten für sich allein oder Strafverfolgung, nationale Sicherheit oder sonstige gemeinsam analysiert die Identität einer Person, deren behördliche Ziele. Zudem gelten sie sowohl für die Verhalten, Verbindungen, physischen oder gesundheitliAufgabe des Staates, die Rechte des Einzelnen zu respekchen Zustand, Rasse, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, tieren und zu erfüllen, als auch für die Verpflichtung, die nationale Herkunft oder Meinungen enthüllen, oder die Rechte des Einzelnen vor Missbrauch durch nicht-staatAbbildung einer Person mithilfe der Standortbestimmung, liche Akteure, einschließlich der Wirtschaft, zu ihrer Bewegungen oder Interaktionen über einen schützen.[6] Der private Sektor trägt die gleiche Zeitraum,[8] ermöglichen oder auch von allen Menschen Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte, an einem bestimmten Ort, zum Beispiel bei einer öffentliinsbesondere in Anbetracht der Schlüsselrolle, die sie bei chen Demonstration oder anderen politischen der Konzeption, Entwicklung und Verbreitung von Veranstaltung. Als Ergebnis sollten alle Informationen, Technologien spielt, und damit Kommunikation ermögwelche sich aus der Kommunikation einer Person licht und bereitstellt und - wo erforderlich - mit staatliergeben, diese beinhalten, reflektieren, oder über diese chen Überwachungsmaßnahmen zusammenarbeitet. Person stattfinden, und welche nicht öffentlich verfügbar Dennoch ist der Umfang der vorliegenden Grundsätze auf und leicht zugänglich für die allgemeine Öffentlichkeit die Pflichten des Staates beschränkt. sind, als „geschützte Informationen“ angesehen werden. Ihnen sollte dementsprechend der höchste gesetzliche Veränderte Technologie und Definitionen Schutz gewährt werden. erstellt werden. So werden genauso viele oder sogar noch mehr Details offengelegt, als aus dem Inhalt der Kommunikation erkennbar wäre.[5] Trotz des riesigen Potenzials für das Eindringen in das Leben eines Menschen und der abschreckenden Wirkung auf politische und andere Vereinigungen, weisen rechtliche und politische Instrumente oft ein niedrigeres Schutzniveau für Kommunikationsmetadaten auf und führen keine ausreichenden Beschränkungen dafür ein, wie sie später von Behörden verwendet werden, einschließlich wie sie gewonnen, geteilt und gespeichert werden. „Kommunikationsüberwachung“ umfasst heutzutage Überwachung, Abhören, Sammlung, Analyse, Nutzung, Konservierung und Aufbewahrung von, Eingriff in oder Zugang zu Informationen, welche die Kommunikation einer Person in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft beinhaltet, reflektiert oder sich daraus ergibt. “Kommunikation“ beinhaltet Aktivitäten, Interaktionen und Transaktionen, die über elektronische Medien übertragen werden, wie z. B. Inhalt der Kommunikation, die Identität der an der Kommunikation Beteiligten, die Standort-Tracking, einschließlich IP-Adressen, die Uhrzeit und die Dauer der Kommunikation und Kennungen von Kommunikationsgeräten, die während der Kommunikation verwendet werden. Bei der Beurteilung der Invasivität der staatlichen Kommunikationsüberwachung, ist es notwendig, dass beides betrachtet wird: sowohl das Potenzial der Überwachung, geschützte Informationen offenzulegen, sowie der Zweck, zu der Staat die Information sammel.. Kommunikationsüberwachung, die voraussichtlich zur Offenlegung von geschützten Informationen führt, die eine Person dem Risiko der Ermittlung, Diskriminierung oder Verletzung der Menschenrechte aussetzen kann, wird eine ernsthafte Verletzung des Rechts des Einzelnen auf Privatsphäre darstellen und außerdem die Nutzung anderer Grundrechte untergraben, unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und politische Partizipation. Dies liegt darin begründet, 41 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch dass diese Rechte erfordern, dass Menschen in der Lage sind, frei von der abschreckenden Wirkung der staatlichen Überwachung zu kommunizieren. Eine Festlegung sowohl des Charakters als auch der Einsatzmöglichkeiten der gesuchten Informationen wird somit in jedem Einzelfall notwendig. Bei der Annahme einer neuen Technik der Kommunikationsüberwachung oder der Ausweitung des Anwendungsbereichs einer bestehenden Technik sollte der Staat sicherstellen, ob die Informationen, die wahrscheinlich beschafft werden, in den Bereich der „geschützten Informationen“ fällt, bevor er sie einholt, und sie zur Kontrolle der Justiz oder anderen demokratischen Kontrollorganen vorlegen. Wenn man bedenkt, ob eine Information, die man mithilfe von Kommunikationsüberwachung erhalten hat, auf die Ebene der „geschützten Informationen“ aufsteigt, sind sowohl die Form als auch der Umfang und die Dauer der Überwachung relevante Faktoren. Weil tiefgreifende oder systematische Überwachung die Fähigkeit hat, private Informationen weit über seine einzelnen Teile hinaus zu offenbaren, kann es Überwachung der nicht geschützten Informationen auf ein Niveau von Invasivität heben, das starken Schutz verlangt.[9] Die Festlegung, ob der Staat die Kommunikationsüberwachung, die geschützte Informationen betrifft, durchführen darf, muss im Einklang mit den folgenden Grundsätzen stehen. Die Grundsätze Gesetzmäßigkeit: Jede Beschränkung des Rechtes auf Privatsphäre muss gesetzlich vorgeschrieben sein. Der Staat darf in Abwesenheit eines bestehenden öffentlich verfügbaren Rechtsaktes, welcher den Standard der Klarheit und Genauigkeit erfüllt, und der ausreicht, um sicherzustellen, dass Einzelne eine Benachrichtigung erhalten und seine Anwendung vorhersehen können, keine Maßnahmen einführen oder durchsetzen, die das Recht auf Privatsphäre beeinträchtigen. Angesichts der Geschwindigkeit des technologischen Wandels sollten Gesetze, die das Recht auf Privatsphäre beschränken, regelmäßig durch Instrumente eines partizipativen legislativen und behördlichen Prozesses überprüft werden. Rechtmäßiges Ziel: Gesetze sollten nur Kommunikationsüberwachung durch spezifizierte Behörden erlauben, um ein legitimes Ziel zu erreichen, welches einem überragend wichtigen Rechtsgut, das in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist, entspricht. Es darf keine Maßnahme angewendet werden, die auf der Grundlage von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 42 Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder des sonstigen Status diskriminiert. Notwendigkeit: Gesetze, die Kommunikationsüberwachung durch den Staat erlauben, müssen die Überwachung darauf begrenzen, was zweifellos und nachweislich notwendig ist, um das legitime Ziel zu erreichen. Kommunikationsüberwachung darf nur durchgeführt werden, wenn es das einzige Mittel zur Erreichung eines rechtmäßigen Ziels ist, oder wenn es mehrere Mittel gibt, es das Mittel ist, welches am unwahrscheinlichsten die Menschenrechte verletzt. Der Nachweis der Begründung dieser Rechtfertigung in gerichtlichen sowie in Gesetzgebungsverfahren liegt beim Staat. Angemessenheit: Jeder Fall der gesetzlich autorisierten Kommunikationsüberwachung muss geeignet sein, das spezifische legitime Ziel, welches festgelegt wurde, zu erfüllen. Verhältnismäßigkeit: Kommunikationsüberwachung sollte als hochgradig invasive / (or: eindringende) Handlung angesehen werden, die in das Recht auf Privatsphäre und die Freiheit der Meinungsäußerung eingreift und die Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft bedroht. Entscheidungen über Kommunikationsüberwachung müssen durch Abwägen der gesuchten Vorteile gegen die Schäden, die den Rechten des Einzelnen und anderen konkurrierenden Interessen zugefügt würden, getroffen werden, und sollten eine Betrachtung der Sensibilität der Informationen und der Schwere der Verletzung des Rechts auf Privatsphäre einbeziehen. Dies erfordert insbesondere: Sollte ein Staat Zugang zu oder die Nutzung von geschützten Informationen anstreben, die durch Kommunikationsüberwachung im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung gesammelt wurden, dann muss dies auf der zuständigen, unabhängigen und unparteiischen gerichtlichen Entscheidung begründet sein, dass: 1. es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde oder begangen werden wird; 2. der Beweis eines solchen Verbrechens durch den Zugriff auf die geschützten Daten erhalten werden würde; 3. andere verfügbare und weniger invasive Ermittlungsmethoden ausgeschöpft sind; 4. die abgerufenen Informationen in vernünftiger Weise auf diejenigen begrenzt werden, die für die Januar 2014 | HUMAN RGHTS WATCH mutmaßliche Straftat relevant sind, und jede weitere gesammelte Information sofort vernichtet oder zurückgegeben wird; und 5. Informationen nur von der festgelegten Behörde abgerufen und nur für den Zweck, für den die Genehmigung erteilt wurde, verwendet werden. Wenn der Staat mit Kommunikationsüberwachung Zugang zu geschützten Informationen zu einem Zweck erlangen will, der eine Person nicht der Strafverfolgung, Ermittlung, Diskriminierung oder Verletzung der Menschenrechte aussetzt, muss der Staat einer unabhängigen, unparteiischen und zuständigen Behörde Folgendes nachweisen: 1. andere verfügbare und weniger invasive Ermittlungsmethoden wurden in Betracht gezogen; 2. die abgerufenen Informationen werden in vernünftiger Weise auf die relevanten begrenzt und jede zusätzlich gesammelte Information wird sofort vernichtet oder dem betroffenen Individuum zurückgegeben; und 3. Informationen werden nur von der festgelegten Behörde abgerufen und nur für den Zweck verwendet, für den die Genehmigung erteilt wurde. Zuständige gerichtliche Behörden: Bestimmungen in Bezug auf die Kommunikationsüberwachung müssen von zuständigen gerichtlichen Behörden, die unparteiisch und unabhängig sind, festgelegt werden. Die Behörde muss: 1. getrennt sein von der Behörde, welche die Kommunikationsüberwachung durchführt, 2. vertraut sein mit den relevanten Themen und fähig sein, eine gerichtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Kommunikationsüberwachung, die benutzte Technologie und Menschenrechte zu treffen, und Gericht,[10] außer in Notfällen, wenn für Menschenleben Gefahr in Verzug ist. In solchen Fällen, muss innerhalb einer vernünftigen und realisierbaren Frist eine rückwirkende Autorisierung eingeholt werden. Lediglich das Risiko der Flucht oder Zerstörung von Beweismitteln soll niemals als ausreichend für eine rückwirkende Autorisierung angesehen werden. Benachrichtigung des Nutzers: Personen sollten über die Entscheidung der Autorisierung einer Kommunikationsüberwachung informiert werden. Es sollten ausreichend Zeit und Informationen zur Verfügung gestellt werden, so dass die Person die Entscheidung anfechten kann. Des Weiteren sollte sie Zugang zu dem Material bekommen, welches für den Antrag der Autorisierung vorgelegt wurde. Eine Verzögerung der Benachrichtigung ist nur unter folgenden Bedingungen gerechtfertigt: 1. Die Benachrichtigung würde den Zweck, für den die Überwachung genehmigt ist, ernsthaft gefährden oder es besteht eine unmittelbare Gefahr für Menschenleben, oder 2. Die Erlaubnis einer Verzögerung der Benachrichtigung wird durch die zuständige Justizbehörde zum Zeitpunkt der Genehmigung der Überwachung erteilt; und 3. Die betroffene Person wird benachrichtigt, sobald die Gefahr aufgehoben ist, oder innerhalb einer vernünftigen realisierbaren Frist, je nachdem, welches zuerst zutrifft, aber in jeden Fall zu dem Zeitpunkt zu dem die Kommunikationsüberwachung abgeschlossen ist. Die Verpflichtung zur Benachrichtigung liegt beim Staat, aber in dem Fall, dass der Staat dem nicht nachkommt, sollten Kommunikationsdiensteanbieter die Freiheit haben, Personen über die Kommunikationsüberwachung freiwillig oder auf Anfrage zu benachrichtigen. Transparenz: Staaten sollten bezüglich der Nutzung und des Umfangs der Techniken und Befugnisse der Kommunikationsüberwachung transparent sein. Sie Rechtsstaatliches Verfahren: Ein rechtsstaatliches sollten mindestens die gesammelten Informationen über Verfahren verlangt, dass Staaten die Menschenrechte die Anzahl der genehmigten und abgelehnten Anfragen, jedes Einzelnen respektieren und garantieren, indem sie eine Aufschlüsselung der Anfragen nach Dienstanbieter rechtmäßige Prozesse versichern, die jegliche und nach Ermittlungsart und -zweck veröffentlichen. Beeinträchtigung der Menschenrechte ordnungsgemäß Staaten sollten Personen genügend Informationen liefern, und gesetzlich spezifiziert regeln, die konsistent durchge- um zu gewährleisten, dass sie den Umfang, die Art und führt werden, und die der allgemeinen Öffentlichkeit Anwendung der Gesetze, welche die zugänglich sind. Insbesondere bei der Bestimmung Kommunikationsüberwachung erlauben, zu verstehen. seiner oder ihrer Menschenrechte hat jeder das Recht auf Staaten sollten Diensteanbieter befähigen, die von ihnen ein faires und öffentliches Verfahren innerhalb einer angewendeten Prozesse zu veröffentlichen, wenn sie angemessenen Frist von einem unabhängigen, zustänstaatliche Kommunikationsüberwachung bearbeiten, an digen und unparteiischen rechtmäßig gegründeten 3. über entsprechende Ressourcen verfügen, um die ihr übertragenen Aufgaben auszuführen. 43 WORLD REPORT 2014 | Auszüge auf Deutsch diesen Prozessen festzuhalten und Berichte der staatlichen Kommunikationsüberwachung zu veröffentlichen. Öffentliche Aufsicht: Staaten sollten unabhängige Aufsichtsmechanismen schaffen, die Transparenz und Verantwortung der Kommunikationsüberwachung gewährleisten.[11] Aufsichtsmechanismen sollten die Befugnis haben, auf alle potenziell relevanten Informationen über staatliche Maßnahmen, wenn notwendig auch auf geheime oder als Verschlusssachen gekennzeichnete Informationen zuzugreifen; zu beurteilen, ob der Staat seine rechtmäßigen Fähigkeiten legitim nutzt; zu beurteilen, ob der Staat die Informationen über den Einsatz und den Umfang der Techniken und Befugnisse der Kommunikationsüberwachung transparent und genau veröffentlicht hat; und regelmäßige Berichte und andere für die Kommunikationsüberwachung relevante Informationen zu veröffentlichen. Unabhängige Kontrollmechanismen sollten in Ergänzung zur Aufsicht geschaffen werden, die bereits über einen anderen Teil der Regierung zur Verfügung steht. Integrität der Kommunikation und der Systeme: Um die Integrität, Sicherheit und Privatsphäre der Kommunikationssysteme zu gewährleisten, und in Anerkennung der Tatsache, dass Abstriche bei der Sicherheit für staatliche Zwecke fast immer die Sicherheit im Allgemeinen infrage stellen, sollten Staaten die Dienstleister oder Hardware- oder Softwarehändler nicht zwingen, Überwachungs- oder Beobachtungsfunktionen in ihre Systeme einzubauen oder bestimmte Informationen lediglich für Zwecke der staatlichen Überwachung zu sammeln oder zu speichern. A priori Vorratsdatenspeicherung oder Sammlung sollte nie von Dienstleistern gefordert werden. Personen haben das Recht, sich anonym zu äußern; Staaten sollten daher auf die zwingende Identifizierung der Nutzer als Voraussetzung für die Leistungserbringung verzichten.[12] Schutzmaßnahmen für die internationale Zusammenarbeit: Als Reaktion auf die Veränderungen der Informationsflüsse und Kommunikationstechnologien und -dienstleistungen, kann es notwendig sein, dass Staaten Hilfe von einem ausländischen Dienstleister anfordern. Dementsprechend sollten die gemeinsamen Rechtshilfeverträge und andere Vereinbarungen, die von den Staaten eingegangen wurden, sicherstellen, dass in Fällen, in denen die Gesetze mehr als eines Staates für die Kommunikationsüberwachung angewendet werden können, derjenige verfügbare Standard mit dem höheren Schutzniveau für den Einzelnen angewendet wird. Wo Staaten Unterstützung für Zwecke der Strafverfolgung 44 suchen, sollte der Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit angewendet werden. Staaten dürfen gemeinsame Rechtshilfeprozesse und ausländische Anfragen nach geschützten Informationen nicht nutzen, um inländische gesetzliche Beschränkungen der Kommunikationsüberwachung zu umgehen. Gemeinsame Rechtshilfeprozesse und andere Vereinbarungen sollten klar dokumentiert werden, öffentlich zugänglich sein und dem Schutz des fairen Verfahrens unterliegen. Schutzmaßnahmen gegen unrechtmäßigen Zugang: Die Staaten sollten Gesetze erlassen, welche illegale Kommunikationsüberwachung durch öffentliche oder private Akteure kriminalisieren. Die Gesetze sollten ausreichende und erhebliche zivil-und strafrechtliche Sanktionen, Schutz für Whistleblower und Wege für die Wiedergutmachung von Betroffenen enthalten. Die Gesetze sollten vorsehen, dass alle Informationen, welche in einer Weise gesammelt wurden, die mit diesen Grundsätzen unvereinbar ist, in einem Verfahren als Beweise unzulässig sind, genauso wie Beweise, die von solchen Informationen abgeleitet sind. Die Staaten sollten außerdem Gesetze erlassen mit der Maßgabe, dass das Material zerstört oder der Person zurückgegeben werden muss, nachdem das durch Kommunikationsüberwachung gesammelte Material, zu dem Zweck genutzt wurde, zu welchem es bereitgestellt wurde. Diese Grundsätze finden Sie auch im Internet unter: https://de.necessaryandproportionate.org H U M A N R I G H T S W A T C H Titelfoto: Syrien — Zwei Jungen in einem Schulgebäude in Aleppo, das durch einen Angriff der Regierungstruppen beschädigt wurde. Februar 2013. © 2013 Nish Nalbandian/Redux Foto Rückseite: Südsudan — Ein unverheiratetes Mädchen inmitten einer Rinderherde in der Nähe von Bor, der Hauptstadt des Bundesstaats Jonglei. Rinder haben in der Landbevölkerung im Südsudan eine große soziale, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung. Die Tiere werden als Mitgift bei Eheschließungen genutzt, was entscheidend zum Problem der Kinderehen beiträgt. Februar 2013. © 2013 Brent Stirton/Reportage. Getty Images für Human Rights Watch HUMAN RIGHTS WATCH Neue Promenade 5 10178 Berlin www.hrw.org/de E R E I G N I SS E VO N 2 0 13 WORLD REPORT | 2014 Grafik Design: Rafael Jiménez Dieser 24. Jahresbericht fasst die wichtigsten Menschenrechtsentwicklungen des Jahres 2013 in über 90 Staaten und Territorien weltweit zusammen. Er basiert auf den umfangreichen Recherchen der Mitarbeiter von Human Rights Watch im vergangenen Jahr, die meist in enger Kooperation mit regionalen Menschenrechtsorganisationen durchgeführt wurden. Auszüge auf Deutsch