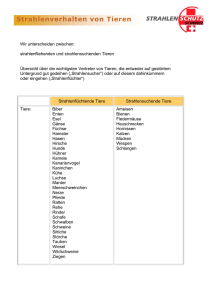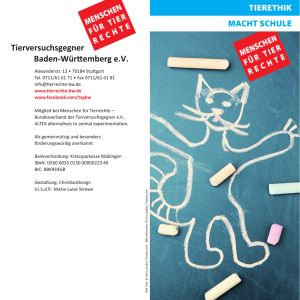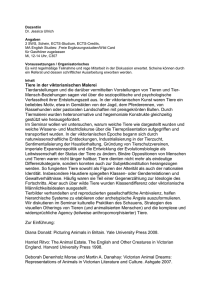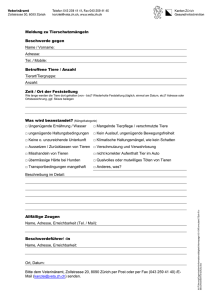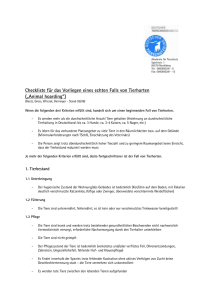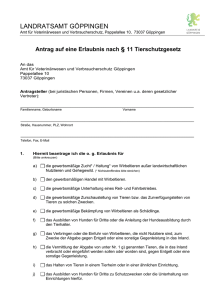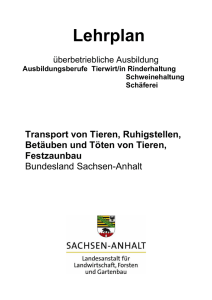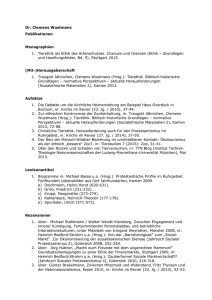Literaturbericht 1/2013 - TIERethik - Zeitschrift zur Mensch
Werbung

LITERATURBERICHT TIERethik 5. Jahrgang 2013/1 Heft 6, S. 169-206 Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt Literaturbericht 1/2013 Petra Mayr, Regina Binder, Dieter Birnbacher, Arianna Ferrari, Kathrin Herrmann, Claudia Leitner, Alina Omerbasic, Klaus Petrus, Florian L. Wüstholz Inhalt Vorbemerkung ................................................................................................ 170 1. Allgemeines zum Tierschutz ................................................................... 172 1.1 Andreas Grabolle: Kein Fleisch macht glücklich ...................................... 172 2. Philosophische Ethik ................................................................................ 174 2.1 Ursula Wolf: Ethik der Mensch-Tier-Beziehung ....................................... 174 2.2 Elisa Aaltola: Animal Suffering: Philosophy and Culture ......................... 177 2.3 Christopher La Barbera: States of Nature. Animality and the Polis ........... 181 2.4 Mark Rowlands: Can Animals Be Moral? .................................................. 184 3. Tierethik interdisziplinär ........................................................................ 189 3.1 Helmut Segner: Fish. Nociception and Pain. A Biological Perspective ..... 189 3.2 Markus Wild: Fische. Kognition, Bewusstsein und Schmerz. Eine philosophische Perspektive ........................................................................ 189 4. Tiere und Gesellschaft ............................................................................. 192 4.1 Herwig Grimm und Carola Otterstedt (Hrsg.): Das Tier an sich. Disziplinübergreifende Perspektiven für neue Wege im wissenschaftsbasierten Tierschutz ................................................................................... 192 4.2 Bernd-Udo Rinas: Veganismus. Ein postmoderner Anarchismus bei Jugendlichen?............................................................................................. 196 5. Rechtsfragen und Rechtsentwicklung .................................................... 200 5.1 Sabine Lennck: Die Kodifikation des Tierschutzrechts ............................. 200 6. Tierethik und Kulturwissenschaft .......................................................... 201 6.1 Randy Malamud: An Introduction to Animals and Visual Culture ............ 201 Literatur .......................................................................................................... 206 Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 169 | | Petra Mayr et al. Vorbemerkung Die Leidensfähigkeit ist nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt in vielen tierethischen Positionen; sie ist zugleich auch das wesentliche Kriterium bei der Frage des gesetzlich verankerten Tierschutzes. In dieser Hinsicht sind auch die Ergebnisse empirischer Forschung relevant. Da sich fremdpsychische Bewusstseinszustände bestenfalls vermuten, nicht aber beweisen lassen werden, wird immer eine Unsicherheit bei der Frage bleiben, welche Tiere wie empfinden und vor allem was sie empfinden. Für den Großteil der Säugetiere und Vögel, um die es im Agrartierschutz geht, ist die Frage nach der Leidensfähigkeit allerdings längst geklärt. Nun scheint sich der Kreis, derer, die es in dieser Hinsicht zu berücksichtigen gilt, auch auf Fische auszuweiten. Die Frage, ob sie leidensfähig sind, wird schon seit Langem kontrovers diskutiert. In letzter Zeit gibt es immer mehr Studien, die mit sehr unterschiedlichen Forschungsansätzen in diese Richtung weisen. Auch die Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich hat zwei Studien zur Frage nach Bewusstsein, Kognition und Schmerzempfinden von Fischen in Auftrag gegeben. Diese sollten sich sowohl aus biologischer als auch aus philosophischer Perspektive der Frage nähern. In seiner Untersuchung Fish. Nociception and Pain. A Biological Perspective verweist der Biologe Helmut Segner darauf, dass bei Fischen, obgleich ihnen die Gehirnareale fehlen, die bei Säugetieren maßgeblich an der Schmerzwahrnehmung beteiligt sind, dennoch Schmerzempfindung zwar nicht bewiesen, aber angenommen werden könne, da Fische Gehirnareale besitzen, die denen von Säugern in funktionaler Hinsicht gleichen. Der Philosoph Markus Wild bearbeitete die gleiche Fragestellung. In seiner begrifflich ausgerichteten Untersuchung Fische. Kognition, Bewusstsein und Schmerz. Eine philosophische Perspektive kommt er zu einem weiterreichenden Ergebnis als Segner. Wild zufolge ist Fischen Schmerzempfindlichkeit in jedem Falle zuzusprechen. In einer Hinsicht sind sich beide Autoren einig: Das Bild von Fischen muss sich ändern. Wilds Ausführungen liefern aber auch ein anschauliches Beispiel für die nicht unerheblichen fachdisziplinären Reibungsverluste, die aus den je spezifischen Methoden und Begrifflichkeiten resultieren. Wild kritisiert in seiner Studie den Fischereibiologen Robert Arlinghaus, der sich bei der Frage des Tierschutzes in der Sportfischerei auf zwei strikt getrennte Ansätze bezieht. Der Wohlergehensansatz (fishwelfare) frage, wie stark die Gesundheit der Fische durch die Sportfischerei beeinträchtigt | 170 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | werde und was getan werden könne, um Gefährdungen zu vermeiden. Beim leidzentrierten Ansatz (suffering-centred approach) erscheinen Praktiken des Sportfischens als nicht akzeptabel, da sie den Tieren unnötige Schmerzen zufügen. Der Fischereibiologe präferiert den Wohlergehensansatz, da dieser pragmatisch sei, objektiv messbare Daten liefere und die Sportfischerei nicht in Frage stelle. Demgegenüber sei der leidzentrierte Ansatz konfliktgeladen, sorge für Spannung und verhindere den Dialog. Wild kritisiert diese Trennung zu Recht als tendenziös. Eine solche strikte Trennung von Ansätzen, die trennen, was untrennbar ist, und Wohlergehen und Leid als eindimensionale Kategorien betrachten, sei nicht nur unterkomplex, sie grenze die ethische Dimension schlichtweg aus. Wenn es um Tierschutz geht, lässt sich also das Kriterium der Leidensfähigkeit nicht wegdenken. Die finnische Tierrechts-Philosophin Elisa Aaltola kritisiert eine „animal welfare science“, die sich nicht am Leiden, sondern am Wohlergehen orientiert, weil sie befürchtet, dass damit die Nutzung von Tieren als gerechtfertigt angesehen werden könne. In ihrem Buch Animal Suffering: Philosophy and Culture verweist sie darauf anzuerkennen, dass Tiere aufgrund ihrer unterschiedlichen phänomenologischen Anlagen möglicherweise Schmerzen oder Leiden in anderer Weise empfinden. Phänomenologische Ansätze wie dieser versuchen, Tiere nicht nur als Träger bestimmter messbarer oder nicht messbarer Bewusstseinszustände zu begreifen, sondern sie in ihrer Andersartigkeit wahrzunehmen. Vielleicht trifft Aaltola mit ihrer Vermutung den wunden Punkt: Vielleicht sind es doch noch die Nachwirkungen von Descartes’ mechanistischer Auffassung von Tieren, dass bei der Frage der Anerkennung von Leidensfähigkeit noch immer oft die Skepsis regiert. Petra Mayr Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 171 | | Petra Mayr et al. 1. Allgemeines zum Tierschutz 1.1 Andreas Grabolle: Kein Fleisch macht glücklich. Mit gutem Gefühl essen und genießen 416 S., München: Goldmann, 2012, 9,95 EUR Die Frage nach der ethisch richtigen Ernährung scheint ein Trend geworden zu sein. Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer war mit seinem Buch Tiere essen vor ein paar Jahren der Vorreiter. Mit Gewissensbissen knüpfte die deutsche Schriftstellerin Karen Duve an. Nun fragt sich der Biologe und Wissenschaftsjournalist Andreas Grabolle: Tiere essen – oder lieber nicht?, begibt sich auf eine ethische Entwicklungsreise und kommt zu dem Ergebnis: „Kein Fleisch macht glücklich“. Es sind bei den meisten Büchern, bei denen die Frage des Fleischessens thematisiert wird, nicht rein tierethische Überlegungen, die das eigene gesellschaftlich geprägte Ernährungsmodell in Frage stellen lassen, sondern vielmehr auch ökologische oder gesundheitliche Aspekte des Verzehrs von Fleisch und anderen tierischen Produkten. Eine fleischlose Ernährung schützt nicht nur das Leben von Tieren, sondern auch unseren Lebensraum mit seinen endlichen Ressourcen und unsere eigene Gesundheit, so meist der Tenor. Das ist die durchaus einleuchtende Argumentation. Die Recherchen des Autors, auch das liegt ganz Trend eines „biographischen Entwicklungstextes“, führen ihn u.a. in eine Putenmastanlage und auf einen Tierschutzkongress. Er interviewt Ernährungswissenschaftler, Landwirte, Jäger, Tierärzte, Agrarwissenschaftler, Experten für nachhaltige Entwicklung und Tierschützer. Man gewinnt den Eindruck, dass gerade im Zeitalter mit multimedialer Informationszugänglichkeit wieder eine Form der Direktheit gesucht wird, die aus rein informeller Absicht nicht unbedingt notwendig wäre. Vielleicht ist sie aber, neben dem Material, dass für das Buch gesammelt wird, auch für die eigene Entscheidungsfindung bedeutsam. Vielleicht stehen solche Bücher als Zeichen des aufgeklärten Bürgers, der sich höchstselbst Einblick in ein System verschafft, in dem er sich einzig als umworbener, aber vielfach leider auch getäuschter Konsument sieht. Es ist nicht nur der lockere Schreibstil des Autors, sondern auch seine undogmatische Distanz zur eigenen fleischorientierten Sozialisation, die das Buch lesenswert macht. „An gänzlich fleischlose Gerichte, außer natürlich Fisch, kann ich mich nicht erinnern. Da ich Fleisch so gerne aß, | 172 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | machte meine Mutter selbst zum Gulasch noch Hackbällchen.“ ( 14) Der ehemalige Fleisch- und Wurst-Fan beschreibt besonders authentisch seine biographischen Wendepunkte mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung. Und es sind eben diese Passagen, die das Buch für alle wertvoll machen, die erste Zweifel an der Ernährungstradition hegen, in der sie aufgewachsen sind. Denn erste Zweifel, so meint die Psychologie, können der Anstoß sein für zukünftige Veränderungen. Grabolle durchforstet alles, was mit dem Thema Fleisch zu tun hat, und liefert eine Menge Fakten. Er beleuchtet viele Aspekte und Auswirkungen des Konsums tierischer Produkte: Er zeigt, wie die lebensmittelliefernden Tiere gezüchtet, gehalten und geschlachtet werden. Er deckt die Strukturen auf, die dazu führen, dass die industrialisierte Tierproduktion maßgeblich zur Vergrößerung des Welthungers beiträgt. Er zeigt auf, warum in der agrarindustriellen Haltung von Tieren der Nährboden für die Entstehung und Ausbreitung von neuen Zoonoseerregern zu sehen ist, und erinnert daran, dass es gegen viele Erreger schon jetzt keine wirksamen Antibiotika mehr gibt. Viele Daten und Zahlen sind in Schaukästen untergebracht. Der Autor lässt nahezu kein Feld außen vor. Philosophische Theorien zur Tierethik werden ebenso bemüht wie etwa das sozialpsychologische Erklärungsmodell des „Karnismus“ von Melanie Joy, das zu erklären versucht, warum es uns möglich ist, eine dezidierte Auswahl von Tieren als Nahrungsmittel zu betrachten, andere dagegen nicht. Sein persönlicher Anstoß, letztlich vegan zu leben, ist ethischer Natur. „Was ich esse, beeinflusst nicht nur mein eigenes Wohlbefinden, sondern auch das von anderen – Menschen wie Tieren. Auch wenn ich unausweichlich auf Kosten anderer Lebewesen leben muss, kann ich täglich entscheiden, wer welchen Preis dafür bezahlen muss.“ (389) Für alle, die mehr wissen wollen über tierische und pflanzliche Nahrungsmittel und deren Einfluss auf unsere Gesundheit, und für alle, die etwas für den Schutz von Tieren tun möchten, ist Kein Fleisch macht glücklich eine absolut empfehlenswerte Lektüre: ein Buch, das viele Facetten anspricht, tradierte Handlungsmuster in Frage stellt, persönliche Unsicherheiten auslotet, für globale Verantwortung sensibilisiert, Rücksichtnahme einfordert und damit den Menschen als moralischen Akteur in die Pflicht nimmt. Zweifelssohne eine Pflicht, die nicht jeder und jedem behagt, und ein Mitgefühl, das nicht jeder und jedem zu eigen ist. Aber ein Apell, dass sich mit Verzicht manchmal mehr bewegen lässt als mit Aktivismus. Kathrin Herrmann, Petra Mayr Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 173 | | Petra Mayr et al. 2. Philosophische Ethik 2.1 Ursula Wolf: Ethik der Mensch-TierBeziehung 185 S., Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 2012, 16,80 EUR Der rechtliche Status von Tieren hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten erheblich verbessert. Praktische Konsequenzen der Leidverringerung, die daraus zu resultieren hätten, sind jedoch kaum zu erkennen. Auch die ethische Frage nach dem Status von Tieren wird noch immer kontrovers diskutiert. Das ist Wolfs nüchterne Bilanz und zugleich auch ihr Ausgangspunkt für neue Überlegungen. Ihr aktuelles Buch unterscheidet sich in dieser Hinsicht von ihrem 1990 erschienen Werk Das Tier in der Moral. In diesem hat sie ausschließlich die philosophisch-akademische Debatte betrachtet. In der Ethik der Mensch-TierBeziehung nimmt sie neben den moralphilosophischen Positionen auch die rechtlichen Veränderungen in den Blick, vor allem aber untersucht sie eben jene daraus entstehenden Diskrepanzen. Der Spannungsbogen, der moralphilosophische Betrachtungen auf ihre Konsistenz und Praktizierbarkeit hin untersucht und vor allem in Beziehung zu rechtlichen Neuerungen setzt, macht das Buch nicht nur aus philosophischer Warte interessant. Oft sind es gerade die Seitenpfade, die bislang unbeachtete Strukturen aufdecken und zu neuen Erkenntnissen führen. In einem kurzen Exkurs mit dem Titel „Tierwürde ohne Rechte. Ein Blick auf die deutschsprachige Verfassungsdebatte“ beispielsweise fasst die Autorin noch einmal die rechtlichen Veränderungen zur Stellung der Tiere zusammen und betont dabei, dass gesetzliche Veränderungen „starke Rechtfertigungen“ verlangen – so auch die Änderung der deutschen Verfassung. Die Verfassungsänderung wird von Seiten vieler Tierschützer heute aber als zu schwach in ihren Konsequenzen bewertet, obgleich sie dazu führte, dass das Thema Tierschutz im deutschen Grundgesetz zum Staatsziel erklärt wurde. Die letztlich noch immer geringe Durchschlagkraft der Verfassungsänderung mag aber im zentralen Grund für die Verfassungsänderung selbst zu finden sein, auf den Wolf verweist. Auslöser war das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das Anfang 2002 einem muslimischen Metzger das betäubungslose Schlachten erlaubte und damit einen Sturm des Protestes hervorrief. Hier scheint es, dass eben jener Anlass zu | 174 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | erklären vermag, weshalb sich die Fortschritte in der Tierschutzpraxis trotz der neuen Verfassungsänderung in Grenzen halten. Das betäubungslose Schlachten war als ein Rückschritt hinter das deutsche Tierschutzgesetz und den Konsens, dass das Quälen von Tieren sowohl gesetzlich verboten als auch gesellschaftlich geächtet ist, bewertet worden. Die erwünschte Aufwertung des Tierschutzes in den Status des Verfassungsrangs kann mit dem Anlass, der „lediglich“ einen Rückschritt verhindern sollte, nur schwer erreicht werden. Konsens gibt es in Recht und Gesellschaft darüber, dass Tiere nicht gequält werden sollten – das, so könnte man meinen, zeigt dieses Beispiel. Dennoch hat der Status einer grundgesetzlichen Verankerung des Tierschutzes appellativen Charakter, der darüber hinausgeht. Um eine tierethische Position zu entwickeln, die den vielfältigen Problemen der Ethik im Allgemeinen und dem Umgang mit Tieren im Besonderen gerecht wird, spannt Wolf einen großen Bogen. Sie widmet sich zunächst einmal den grundlegenden Methodenfragen der angewandten Ethik und nimmt dann philosophische Positionen in den Blick, die sich mit der Frage nach dem richtigen Umgang mit Tieren beschäftigen. Nach einer Analyse tierethischer Positionen kommt sie zu dem Ergebnis, dass die klassischen Moraltheorien, die von nur einem Grundprinzip getragen werden, den vielschichtigen Dimensionen von Moral nicht gerecht werden können. Demgegenüber hätten Ansätze, die sich auf mehrere Kriterien beziehen und damit von mehreren Grundlagen der Moral ausgehen, eine Form der Offenheit, die unserer Lebenswelt eher gerecht wird. Für die Frage nach dem richtigen Umgang mit Tieren muss zunächst geklärt werden, was Tiere zu Objekten der Moral macht. Konsens sowohl in ethischer als auch in rechtlicher Hinsicht herrscht darüber, dass die Empfindungsfähigkeit bei Tieren ein zentrales Kriterium ihrer ethischen Berücksichtigung ist. Und diese Eigenschaft lässt sich, positiv betrachtet, als die Fähigkeit bezeichnen, ein Leben in Wohlbefinden zu leben. Wolf verweist hierbei auf ein Missverständnis in der Bewertung der Empfindungsfähigkeit von Lebewesen im aktuellen tierethischen Diskurs. Die Tatsache, dass es Tieren gut oder schlecht gehen kann verweist nicht etwa, wie oft angenommen wird, auf einen besonderen Status, macht diese also nicht zu etwas Besonderem. Vielmehr sei eben jene Eigenschaft „lediglich“ als Kriterium dafür zu betrachten, was Lebewesen zu Objekten der Moral macht. „Die heute im Focus der Tierethikdebatte stehende Frage, ob Tiere den gleichen moralischen Status haben wie Menschen oder einen schwächeren, sollte man nach dem gesagten besser Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 175 | | Petra Mayr et al. in eine andere übersetzen: wie verschiedene moralische Normen, die wir alle unterschreiben, zu gewichten sind“ (86). In jener Gewichtungsfrage liegt ein zentrales Problem im Umgang mit Tieren. Um nun eine Position zu entwerfen, die praktizierbare Akzeptanz finden kann, ist es Wolf zufolge sinnvoll, einen Blick auf das Beziehungsverhältnis zwischen Menschen und Tieren zu werfen, das in rechtlicher Hinsicht bereits existiert. Eine solche Reflexion, so wird beim Lesen des Buches deutlich, hat mehrere Vorteile. Ethische Normen, die in Gesetze geflossen sind, können zum einen als Konsens gelten, auf dem aufgebaut werden kann. Zum anderen werden ethische Normen auf diese Weise überhaupt erst deutlicher sichtbar, und man kann sich fragen, ob ihr rechtlicher Status zu einer Umsetzung geführt hat. Wolf fragt sich nun also zunächst, welche Form der Rücksichtnahme Tieren gegenüber sich in Gesetzen wiederfindet, und in einem zweiten Schritt, wie die Form der Rücksichtnahme im Hinblick auf ihre ethische Reichweite zu bewerten ist. Wolf umreißt hier zwei Konzeptionen: Das sind zum einen die Übernahme von Verantwortung für Tiere und zum anderen die der Betrachtung von Tieren als Mitgeschöpfe. Zunächst einmal betrachten beide Konzeptionen Tiere als Objekte der Moral. Aber Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, das wird schnell klar, stellt ein ungleich engeres Beziehungsverhältnis her und hat deshalb ungleich mehr Implikationen, als ihm „lediglich“ die Rolle eines Mitgeschöpfes zuzuweisen. Beide Konzeptionen, das wird deutlich, zielen in ihrem Kern also auf unterschiedliche ethische Verpflichtungen ab und legen damit unterschiedliche ethische Gewichtungen zugrunde. Dem Kernproblem der Gewichtung von moralischen Normen einer Tierethik begegnet Wolf mit der Analyse der vielfältigen Beziehungen, die Menschen zu Tieren haben. Sie verweist hierbei auf die derzeit populären Ausführungen einer Zoopolis von Sue Donaldson und Will Kymlicka. Ob Menschen mit Tiergefährten zusammenleben, ob sie Tiere essen, ihnen in der Natur begegnen, sie jagen, sie im Zoo halten oder an ihnen Medikamente testen, macht in Bezug auf die ethische Gewichtung einen Unterschied. Überträgt man hier wiederum die beiden juristisch verankerten Konzeptionen von Verantwortung für Tiere und ihrer Betrachtung als Mitgeschöpfe, so kommt Wolf zu folgendem Ergebnis: Für die Tiere, die in direkter Beziehung zu uns stehen und die wir in der Gesellschaft nutzen, sei es als Gefährten oder als Nutztiere, haben wir Verantwortung und damit Fürsorgepflichten. Die Vorstellung einer Mitgeschöpflichkeit greife hier nicht weit genug, reiche aber in Bezug auf den Umgang mit freilebenden Tieren aus. | 176 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Wolf schließt ihr sehr empfehlenswertes Buch mit einem Gedanken, der das eminent Humane des Menschen betont: „Hinter dem moralischen Kern der Beachtung des Wohlbefindens eines jeden fühlenden Wesens steht jedoch nicht das Ideal einer heilen Welt allgemeinen Glücks, sondern nur die bescheidene Vorstellung, man könnte wenigstens dasjenige Leiden vermeiden, das durch moralische Akteure in die Welt kommt.“ (170) Petra Mayr 2.2 Elisa Aaltola: Animal Suffering: Philosophy and Culture 272 S., Hampshire: Palgrave MacMillan, 2012, 69,99 EUR Macht es heutzutage angesichts der vielfältigen Daten aus der ethologischen Forschung und nach der immer reicheren Debatte in der Tierethik überhaupt noch Sinn, ein Buch über Leiden von Tieren zu schreiben? Ja, lautet die Antwort, nachdem man dieses gut strukturierte, sehr informative und bereichernde Buch von der finnischen TierrechtsPhilosophin und -Aktivistin Elisa Aaltola gelesen hat: nicht nur, weil Skeptizismus gegenüber tierischem Leiden heute noch immer auf der theoretischen Ebene vertreten wird, sondern vor allem auch weil in unserer Gesellschaft das Leiden von Millionen von Tieren, die von der Tierindustrie im Bereich der Nahrung, der experimentellen Forschung sowie der Unterhaltung systematisch genutzt werden, ignoriert wird. Das Buch möchte nicht nur die wichtigsten Theorien und offenen Fragestellungen in Bezug auf das Thema Leiden und Schmerzen bei Tieren kritisch erläutern, sondern es stellt eine solide theoretische Begründung der Notwendigkeit eines empathischen Verhaltens gegenüber von Tieren sowie ein Plädoyer für mehr aktives Engagement dar, um das Leiden von Tieren zu minimieren. Die Autorin beginnt mit einer kurzen historischen Darlegung der wichtigsten Positionen in der Kulturgeschichte in Bezug auf das Leiden von Tieren. Obwohl bereits seit einigen Jahrzehnten genügend wissenschaftliche Daten gesammelt worden sind, die die Schmerzfähigkeit von zahlreichen Tierarten bestätigen, bleibt die Frage nach dem Leiden von Tieren immer noch kontrovers. Das, was Leiden tatsächlich ist zu definieren, bleibt schwierig, auch im menschlichen Bereich, weil es sowohl eine physische als auch eine psychische Dimension involviert. Während die Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 177 | | Petra Mayr et al. physische Dimension zum größten Teil auch „gemessen“ und deshalb (durch Instrumente oder analytische Verfahren) objektiviert werden kann, impliziert die psychische Dimension immer auch eine subjektive Komponente, die dann auch bei Menschen zuletzt immer einen unvermeidbar unzugänglichen Teil enthält. Wenn es wahr ist, dass das Verständnis von Leiden auch im Zusammenhang mit bestimmten kognitiven Fähigkeiten stehen kann (und darüber streiten sich heutzutage Neurowissenschaftler, Ethologen und theoretische PhilosophInnen), soll laut Aaltola in Kauf genommen werden, dass Tiere gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen phänomenologischen Ausstattung Formen von Schmerzen und Leiden empfinden können, die wir so gar nicht verstehen: „Instead of concentrating on whether non-human animals share all the types of suffering human beings are capable of, it may be worthwhile to pay attention to the specific forms of non-human suffering that thus far have gone unnoted“ (vgl. 20). Obwohl die so genannte „animal welfare science“ die Frage nach dem Leiden von Tieren an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis untersucht, spielt sie der Autorin zufolge heutzutage eine problematische Rolle: Indem sie das Wohlergehen und nicht das Leiden von Tieren ins Zentrum stellt, neigt sie dazu, die Nutzung von Tieren zu akzeptieren und nicht grundsätzlich in Frage zu stellen (vgl. 21). Anschließend wird die skeptische Position, die entweder das Leiden von Tieren leugnet oder diesem eine fundamental ontologisch unterschiedliche Bedeutung im Vergleich mit dem menschlichen Leiden gibt, kritisch erläutert. Wenn es auch wahr ist, dass ein gewisser Rest an Unzugänglichkeit des tierischen Leidens bleibt, gibt es heutzutage genügend Evidenz dafür, dass es existiert. Außerdem trägt eine skeptische Haltung gegenüber Leiden zu einer Marginalisierung der Subjekte bei, die leiden können, und das gilt auch für den menschlichen Bereich. Die skeptische Haltung verbirgt eine mechanistische Auffassung von Tieren, die grundsätzlich vom Bild des Tieres bei Descartes (das Tier als Maschine, die nicht leiden kann) zurückgeblieben ist und die die Ausbeutung von Tieren de facto rechtfertigt. Aaltola plädiert hier für eine phänomenologische Auffassung, die dem Tier die zentrale Rolle wiedergibt: Bei der Frage nach dem tierischen Leiden sollte man nicht nach einem objektivierbaren Bild von dem, was ein Tier ist, streben, sondern nach seinen erlebten Erfahrungen. Damit wird das Tier auch in der Ethologie nicht mehr als Untersuchungsobjekt wahrgenommen, sondern als Subjekt, das uns gegenüber steht, als „Du“ (67). Aaltola skizziert eine historische Rekonstruktion unterschiedlicher Positionen der tierethischen Debatte, die die Leidensfähigkeit der Tiere | 178 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | als zentralen Begriff in ihrer Begründung verwendet haben. Dabei erläutert sie auch, wie die jeweiligen Theorien mit einer bestimmten Empfindsamkeit gegenüber tierischem Leiden in den jeweiligen Epochen in Zusammenhang stehen. Besonders interessant sind ihre Anmerkungen in Bezug auf die Entwicklung der zeitgenössischen Tierschutz- bzw. Tierrechtsdebatte. Obwohl die Leidensfähigkeit einen wichtigen Teil des Tierschutzes darstellt (indem dessen Hauptidee im Vermeiden von unnötigem Tierleid liegt), spielt es auch für die Tierrechtsbewegung aus zwei Gründen eine entscheidende Rolle: zum einen, weil diese Bewegung unabhängig von der Verteidigung normativer rechtlicher Positionen für Tiere sehr aktiv war in der Denunzierung des von der Tierindustrie verursachten Leidens, zum anderen, weil die Tierrechtsbewegung neue Unterschiede im Verständnis von tierischem Leiden hervorgebracht hat, wie u.a. den Unterschied zwischen „Tierschutz“ (animal welfarism) und „Tierbefreiung“ (animal liberation): Die Frage lautet nicht mehr, ob das Leiden von Tieren überhaupt zählt, sondern ob das der erste Punkt in einer Diskussion über die Nutzung von Tieren sein sollte (vgl. 95). Auch eine kritische Analyse der zeitgenössischen Diskussion über tierisches Leiden in der analytischen Philosophie präsentiert Aaltola. Sie diskutiert kritisch die Hauptidee des Tierschutzes und betont die Doppeldeutigkeit eines Bezugs auf „unnötiges“ Leiden. Sie plädiert für eine Auffassung, die die Leidensfähigkeit der Tiere als zentrales relevantes Merkmal anerkennt und somit eine individualistische Perspektive gegenüber anderen biozentrischen oder holistischen Ansätzen vertritt. Aaltola betont jedoch, wie diese Fähigkeit immer im jeweiligen Kontext auch kritisch zu erläutern ist. Dieser Punkt wird besonders relevant in der Diskussion über das Problem des Leidens von Wildtieren in der Natur, das heutzutage immer häufiger thematisiert wird. Gegen die Auffassung, die karnivore Tiere bzw. Raubtiere in ihrem natürlichen Verhalten als verwerflich und damit als zu verändernde betrachtet, argumentiert Aaltola aus einer phänomenologischen Perspektive: Im Gegensatz zu Menschen, die bei der Nutzung von Tieren die Wahl haben, sind Raubtiere von ihrer Ausstattung her zur Jagd bestimmt. Darüber hinaus betont sie die Notwendigkeit, gegenüber Eingriffen in die Natur vorsichtig zu sein, da diese das gesamte Ökosystem verändern können. Die Leidensfähigkeit ist für sie nicht nur passiv, sondern auch aktiv zu betrachten, weil das leidensfähige Wesen, wenn es leidet, negative Erfahrungen macht und darauf reagiert: „[…] suffering cannot be pinpointed as either passivity or activity, but, rather, concerns our whole spectrum of experience in all ist openness and potency. This duality of sentience and suffering means that other animals are neither entirely pasLiteraturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 179 | | Petra Mayr et al. sive, incapable creatures nor perfect agents. They, like human beings, lurk somewhere between these two extremes“ (135). Obwohl Aaltola sehr vertraut mit der analytischen ethischen Tradition ist, diskutiert sie auch den Beitrag der sogenannten kontinentalen Philosophie. Sie betont die Relevanz von Autoren wie Levinas, Agamben oder Derrida für die Anerkennung der Andersheit von Tieren als Basis für eine genuine Ethik und somit auch als geeignete Perspektive, um die Frage nach dem Leiden von Tieren zu betrachten. Jenseits des Mangels einer propositionalen Sprache gibt es eine phänomenologische Welt bei Tieren, die zu entdecken ist und die uns Menschen, vor allem in dem Ausdruck von Leid und Schmerz, direkt anspricht. Leider bleibt hier meines Erachtens die Auseinandersetzung insbesondere mit Derrida und Agamben zu unkritisch, indem Aaltola auf die problematischen Stellen dieser Autoren nicht explizit verweist, wie etwa die stark ablehnende Haltung Derridas gegenüber Vegetarismus und den mangelnden Bezug bei Agamben zu den Implikationen der Tiernutzung. Aaltola diskutiert drei grundlegende Elemente einer ethischen Theorie: Emotion, Empathie und Intersubjektivität. Obwohl Emotionen lange vor allem in der analytischen Ethik kritisiert worden sind, spielen sie für die Autorin eine entscheidende Rolle, gerade im Hinblick auf die Andersheit von Tieren: Wenn einer distanzierten ethischen Theorie zu viel Platz gegeben wird, läuft man Gefahr, den Blick auf das tatsächliche Leiden von Tieren und somit ein Verständnis für dieses zu verlieren (vgl. 160). Da Empathie eher auf Verstand und Imagination als nur auf Emotionen basiert, funktioniert sie wie eine „Lampe“, die die Erfahrungen von Anderen erleuchtet, und somit löst sie Vorurteile gegenüber Diversität auf und erweitert den Horizont der eigenen Subjektivität (vgl. 167). Intersubjektivität ermöglicht dann den Schritt von der Berücksichtigung des einzelnen Individuums zum System der Haltung und Nutzung von Tieren und hilft somit dabei, vom Tierschutz zu Tierbefreiungs-Positionen zu kommen. Obwohl die theoretische Auseinandersetzung mit der ethischen Dimension ein wichtiger Bestandteil der Reflexion bleibt, gerade eine phänomenologische Perspektive, die versucht, das Tier als Anderes wahrzunehmen und zu würdigen, muss sie notwendigerweise praktische Implikationen haben (vgl. 7. Kapitel). Die Hauptbotschaft des Buches, die im abschließenden kurzen Kapitel enthalten ist, lautet dann: Durch Emotionen, Empathie und Intersubjektivität können wir uns an die Vielfalt der Erfahrungen von Tieren annähern und somit die Arroganz des Menschen, der im Anthropozentrismus | 180 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | steckt, überwinden. Solche Gefühle und Wahrnehmungen sind aber auch in konkrete Aktionen zu kanalisieren, sowohl in Form von alltäglichen Interaktionen mit Tieren als auch in Form von indirekter Unterstützung bzw. Boykott von Tierindustrien (vgl. 209). Das Buch ist für Jedermann eine empfehlenswerte Lektüre: für Skeptiker, die immer noch dazu tendieren, das Leiden von Tieren zu relativieren bzw. zu leugnen; für Aktivistinnen und Aktivisten, die philosophisch begründete Antworten auf die vorherrschende skeptische Haltung suchen; für die Menschen, die im Tierschutz tätig sind, um etwas für die Verminderung des Leidens von Tieren tun. Arianna Ferrari 2.3 Christopher La Barbera: States of Nature. Animality and the Polis 123 S., New York: Peter Lang Publishing, 2012, 66,99 EUR Das allmähliche Verschwinden des Tieres und der menschlichen Tiernatur aus der Gesellschaft und der politischen Philosophie ist das Thema dieses Buches. Der Autor stützt sich auf die Annahme einer belebenden Kraft, der anima, welche die Natur aller Lebewesen verbindet, und damit auf die These, dass eine scharfe Trennung zwischen Mensch und Tier nicht zu finden sei. Ziel des Philosophen ist es, ein Umdenken in der Beziehung zwischen menschlichem und tierischem Leben zu erreichen, um so die Basis für einen neuen „Animal-Advocacy“-Ansatz zu erarbeiten, der sich auf die Gemeinsamkeiten von und die Interdependenz zwischen Mensch, Tier und Natur konzentriert. Es geht ihm insbesondere darum, den Menschen dazu aufzufordern, sich wieder auf den gemeinsamen Kern allen Lebens und somit auf seinen „State of Nature“ zu besinnen, um sich seiner Verantwortung und Verpflichtung gegenüber seiner belebten Umwelt bewusst zu werden. Zunächst verdeutlicht La Barbera, welche Rolle Tiere im platonischen Staatsideal eingenommen haben und wie sie bei Descartes zu unbelebten und demnach zu moralisch irrelevanten Entitäten geworden sind. Anschließend untersucht er, stellvertretend an Hobbes, Locke und Rousseau, verschiedene Konzepte des Naturzustandes – also eines Zustandes vor aller Gesetzgebung und Zivilisation – und damit einhergehende AnsichLiteraturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 181 | | Petra Mayr et al. ten über die Beschaffenheit, Wohlgesonnenheit oder Feindseligkeit der menschlichen Natur. Was hat den Menschen dazu getrieben, dem Naturzustand den Rücken zu kehren, Gesellschaften zu bilden und sich somit von früheren Lebensformen und gewissen „animal qualities“ menschlichen Lebens abzuwenden? Gemeinsamer Kern der meisten traditionellen Vertragstheorien besteht La Barbera zufolge nicht nur in dem Ausschluss nicht-menschlicher Lebewesen, sondern auch in der Unterdrückung des natürlichen Charakters, der „Tierheit“ der menschlichen Spezies. Nicht ohne auf einige damit einhergehende Inkonsistenzen der Theorie hinzuweisen, beschreibt er, wie Hobbes den Menschen im Naturzustand als egoistischen und feindseligen Alleingänger darstellt und somit die Dringlichkeit, sich zu seiner eigenen Sicherheit einer Gesellschaftsordnung zu unterwerfen, unterstreicht. Die Hobbessche Darstellung der menschlichen Natur ist laut La Barbera zu Recht zu hinterfragen und letztlich als eine „convenient fiction“ zu betrachten, welche nur dazu dient, die Gründung eines absoluten Souveräns, des Leviathan, als „Beschützer“ des Gemeinwesens zu rechtfertigen. Auf der Fiktion einer gewaltbereiten, egoistischen Natur der menschlichen Spezies beruhe auch Hobbes’ Distanzierung des Menschen von der nicht-menschlichen Natur. Dies hat jedoch wenig mit der wahren Natur des Menschen zu tun und verkennt, so La Barbera, die inhärenten sozialen Neigungen des natürlichen Lebens. Einen ähnlichen Hang zur exzessiven Unterwerfung und Kontrolle nicht nur der menschlichen Natur diagnostiziert der Autor auch bei John Locke. Locke zufolge können natürliche Dinge durch „Arbeit“ in Privateigentum überführt werden, sodass seine Eigentumstheorie einen Schlüsselpunkt markiert, seit dem Lebewesen der außermenschlichen Natur nur noch als Objekte aufgefasst würden, deren Leben und Bedürfnisse schlichtweg irrelevant seien und die – abgesehen von ihrem möglichen Nutzen für den Menschen – keinen inhärenten Wert hätten. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur bleibe also auch bei Locke eines von Herr und Sklave. Anders als bei Hobbes sei der Naturzustand hier jedoch als ein Ort primitiven Friedens der Menschen untereinander zu verstehen, der den Ausgangspunkt kollektiver Arbeit und des Zusammenhalts bilde. Wenn sich im Naturzustand tatsächlich die Grundbedingungen einer zumindest primitiven Form der Ethik finden lassen, dann können wir laut La Barbera zu diesem Zustand zurückkehren und lernen, eine gütigere Gesellschaft zu werden, frei von externen Einschränkungen und aufoktroyierten Autoritäten. Grund zur Hoffnung biete hier Jean-Jacques Rousseau. Dieser bezweifelte, dass die Herrschaft des Menschen über die Natur | 182 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | wirklich durch ein bis dato wenig hinterfragtes Gesetz der Natur gerechtfertigt werden könne. Rousseau war La Barbera zufolge davon überzeugt, dass die Natur des Menschen sich durch einen „ethical instinct“ und primitive politische Strukturen auszeichne, die nicht auf künstlichen Gesetzen, sondern auf natürlichen „relationships of need“ beruhten. In diesem vorzivilisatorischen Zustand hätten auch die Bedürfnisse nicht-menschlicher Lebewesen moralisches Gewicht. Obwohl Tiere auch hier dem Menschen unterstellt seien, würden sie nicht mehr als bloße Objekte aufgefasst. Tiere hätten ihren moralischen Subjektstatus in dem Moment verloren, in dem die Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum zu rein menschlichen Ansprüchen im politischen Diskurs erklärt worden seien, so La Barbera. Seit dem würden sie – im Grunde die gesamte außermenschliche Natur – als passive Ressourcen angesehen. Ob und wie sie ihren Subjektstatus wiedererlangen können, beschäftige Umweltethiker bis heute. In Anlehnung an Holmes Rolston III. und Donna Haraway stellt La Barbera abschließend seinen eigenen Ansatz vor, welcher – anders als bisherige Umweltethiken – auf der Anerkennung der Lebendigkeit, also der anima, der außermenschlichen Natur beruht. Sowohl ein Mammutbaum als auch ein Grizzlybär haben La Barbera zufolge Interessen, nicht weil beide empfindungsfähig sind, sondern weil sie lebendig sind. Als Subjekte eines Lebens, als organische Systeme, deren Lebensprozesse eher fortdauern als beendet werden sollten, können beide ihrer Umwelt gegenüber Ansprüche erheben. Es seien zwar durchaus Situationen denkbar, in denen man die „vital interests“ eines Lebewesens übergehen könne, dies solle jedoch nur mit dem Bewusstsein geschehen, dass hier gewichtige Interessen verletzt oder gar ein Leben beendet werden. Mit States of Nature bietet La Barbera einen recht kurzweiligen Einblick in die historischen Ursprünge der Mensch-Tier-Spaltung und in die unterschiedlichen Vorstellungen von der menschlichen Natur. Besonders deutlich sind die Gegenüberstellung von Hobbes’ und Rousseaus Auffassung des Naturzustandes und die Darstellung einerseits der Rechtfertigung des Gesellschaftsvertrags, andererseits der Bedenken ihm gegenüber. Während sich die menschliche Natur für Hobbes durch Brutalität und Egoismus – ihren blanken Trieb nach Selbsterhaltung – auszeichnet, dem nur die Gründung einer Gesellschaft, die Durchsetzung politischer Ordnung und die Unterwerfung der Natur Einhalt gebieten können, sehnt sich Rousseau nach einem Leben abseits der Zwänge und Beschränkungen der Moderne zurück – eine Sehnsucht, die sich gut 250 Jahre später vielleicht noch verstärkt hat. Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 183 | | Petra Mayr et al. La Barbera geht es bei seiner Darstellung und Diskussion der verschiedenen Konzepte des Naturzustandes und der Begründungen, warum es Menschen als notwendig erachteten, Gesellschaften zu bilden, nicht nur darum zu zeigen, dass sich Menschen durch den Gesellschaftsvertrag abgesondert und in hohem Maße über die außermenschliche Natur erhoben haben. Er will zeigen, dass der Übergang in eine gesellschaftliche Lebensform in gewisser Weise immer mit einem Verlust, genauer mit einer Leugnung der menschlichen Tiernatur einherging. Der Mensch müsse sich nicht nur wieder auf seine eigene Natur besinnen, sondern auch darauf, dass er seine Lebenskraft mit der außermenschlichen Natur teile. Die Einsicht, dass der Mensch ein Lebewesen unter anderen Lebewesen sei, könnte La Barbera zufolge dazu führen, der außermenschlichen Natur ihren moralischen Subjektstatus zurückzugeben. Am Ende des Buches drängt sich zunehmend die Frage auf, ob La Barberas „Vital-Ethics“-Ansatz, der stark an die Ethik Albert Schweitzers erinnert, die vornehmliche Durchschlagskraft hat, Tieren und gar der Flora einen unstrittigen Platz als moralische Subjekte zu sichern und den von ihm nur am Rand kritisierten modernen Ethiken – wie denen Peter Singers oder Tom Regans – so deutlich vorzuziehen ist. La Barbera, das wird deutlich, vertritt also einen biozentrischen Ansatz. Einige Ausführungen dazu, wie es möglich wäre, gewisse Probleme und Schwächen, an denen ein jeder Biozentrismus krankt, zu überwinden, hätten seiner Untersuchung sicher gut getan. Alina Omerbasic 2.4 Mark Rowlands: Can Animals Be Moral? 272 S., Oxford/New York: Oxford University Press, 2012, 23,99 EUR Können Tiere moralisch handeln? In der Tierethik gilt beinahe schon der Standard, diese Frage negativ zu beantworten. Nicht zuletzt basieren viele tierethische Positionen darauf, dass Tiere lediglich „moral patients“ sein können. Das heißt, dass sie zwar Objekte der Moral sein können, aber nicht selbst auch zu moralischen Handlungen fähig sind, während Menschen hingegen als „moral agents“, also moralische Akteure, aus moralischen Gründen handeln können und damit eine Verpflichtung haben, die Interessen von Tieren zu berücksichtigen. Der Philosoph | 184 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Mark Rowlands argumentiert nun in seinem neuen Buch Can Animals be Moral? dafür, dass wir die Möglichkeit ernst nehmen müssen, dass auch manche Tiere moralisch handeln können: „Animals can be moral subjects in the sense that they can act on the basis of moral reasons, where these reasons take the form of emotions with identifiable moral content.“ (35) Um diese Position zu illustrieren, bedient er sich anfangs verschiedenster Beispiele aus der Tierwelt. Diese zeigen eindrücklich, dass viele Tiere ein Verhalten zeigen, welches dem von moralisch handelnden Menschen frappant ähnelt. Tiere helfen verletzten Artgenossen, sie trauern um verstorbene Angehörige, oder sie hungern, um anderen Schmerzen zu ersparen. Rowlands führt diese Beispiele jedoch nicht zu dem Zweck an, um dafür zu argumentieren, dass es sich bei solchen Wesen um moralische Akteurinnen („moral agents“) handelt. Wie viele andere ist er der Auffassung, dass es unangebracht sei, Tiere für ihre Handlungen zu loben oder zu tadeln. Ebenfalls gibt er den ethologischen Daten in seinem Buch wenig argumentatives Gewicht. Stattdessen nutzt er sie als Sprungbrett, um nach einer Möglichkeit zu suchen, die festgefahrene begriffliche Trennung zwischen moralischen Akteurinnen („moral agents“) und solchen Wesen, die nicht die Fähigkeit zu moralischem Handeln besitzen („moral patients“), aufzubrechen. Er macht damit Platz für eine dritte Kategorie, die er als moralische Subjekte („moral subjects“) bezeichnet. Mit dieser „neuen“ Kategorie versucht Rowlands, eine Art Zwischenstatus zu etablieren. Er will in seinem Buch nun dafür argumentieren, dass moralische Subjekte zwar (wie „moral patients“) nicht für ihre Handlungen ethisch verantwortlich gemacht werden können, aber dennoch (wie „moral agents“) aus moralischen Gründen handeln können. Die Stoßrichtung des Buches ist damit festgelegt: Es geht um begriffliche Argumente und Beziehungen. Wie hängen moralische mit motivierenden Gründen oder die Fähigkeit, eigene Gedanken zu reflektieren und zu kritisieren, mit Normativität und Moral zusammen? Aus den Antworten, die Rowlands auf diese Fragen gibt, spinnt er ein komplexes Konstrukt, welches kaum einen Stein auf dem anderen lässt. In dieser Hinsicht hebt sich Kapitel zwei hervor, in dem Rowlands dafür argumentiert, Tieren Emotionen mit moralischem Gehalt zuzuschreiben. Er versucht dabei, einen komplexen begrifflichen Zusammenhang zu rekonstruieren, der nur schwer verständlich ist. Manche Emotionen sind unangemessen, zum Beispiel, wenn ich wegen einer unbeabsichtigten Nichtigkeit eines Freundes herumschreie. Sofern eine Emotion in einem spezifischen Kontext jedoch angemessen ist, „spürt sie gleichzeitig eine Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 185 | | Petra Mayr et al. evaluative Proposition auf“ („tracks an evaluative proposition“), welche dadurch der Emotion moralisches Gehalt verleiht. Sehe ich zum Beispiel jemanden mit schmerzverzerrtem Gesicht, dann ist es unter Umständen angemessen, Mitleid zu verspüren. Ist dies der Fall, dann spürt mein Mitleid, so Rowlands’ Idee, eine evaluative Proposition auf, zum Beispiel „Schmerzen sind schlecht“. Dadurch ist meine Emotion „moralisch aufgeladen“ („morally laden“) (69). Rowlands geht dann auf die bereits erwähnte Unterscheidung zwischen „moral patients“, „moral agents“ und „moral subjects“ ein. Die, wie schon oben erwähnt, neue Klassifizierung wird durch den Begriff des „moral subject“ erweitert. Rowlands zufolge können Tiere zwar keine „moral agents“ in dem Sinne sein, wie es Menschen sind. Aber – und hier „kreiert“ er eine neue Kategorie – sie können Subjekte der Moral sein, indem sie, wie im oben beschriebenen Prozess, „moralisch“ handeln können. Im Gegensatz zu „moral agents“ können sie aber nicht für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden. Dabei steht Rowlands These zur Debatte, dass moralische Subjekte aus moralischen Gründen handeln können, ohne dass diese psychologisch tatsächlich vom Subjekt erfasst werden, d.h. ohne dass dieses den Tieren in einer Weise bewusst ist, wie dies bei Menschen angenommen werden kann. Die logischen und historischen Einwände (von zum Beispiel Kant und Aristoteles) gegen diese These basieren auf einer Verknüpfung zwischen der Fähigkeit, seine eigenen Motivationen zu reflektieren („scrutinize“) und diese dadurch zu kontrollieren („control“). Rowlands nennt dies die Reflection Condition. Nur dadurch, dass moralische Akteurinnen ihre eigenen Motivationen kontrollieren können, erhalten diese überhaupt erst normatives Gewicht. Da nun moralische Gründe gemäß Kant und Anderen notwendigerweise normatives Gewicht haben und Tiere nicht fähig sind, ihre eigenen Motivationen zu reflektieren, befinden sie sich außerhalb des „space of moral reasons“ (170). Der Rest des Buches ist nun zwei Aufgaben gewidmet: der Widerlegung dieser klassischen begrifflichen Verknüpfung und der Darstellung einer plausibleren Alternative. Es wird argumentiert, dass die Reflektion eigener motivationaler Zustände nicht hinreichend sei, um Kontrolle über diese zu erlangen. „I shall argue that we have no viable understanding of the way in which a subject’s ability to engage in critical moral scrutiny of its motivations could give that subject control over those motivations.“ (154) Phänomenologisch mag es zwar so scheinen, als ob Reflektion das Subjekt mit Kontrolle über die eigene Motivation ausstatte. Jedoch impliziert diese phä| 186 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | nomenologische Tatsache nicht, dass dies auch tatsächlich der Fall ist, was wiederum bedeutet, dass die Verknüpfung nur an anderer Stelle gesucht werden kann. Ein Kandidat dafür ist das metakognitive Element, welches in der Reflektion enthalten ist. Dass Metakognition die nötige Kontrolle bringen kann, entspringt gemäß Rowlands jedoch einer Art magischem Denken, dem „miracle-of-the-meta“ (171). Ein typisches Beispiel für diese Art der Magie ist gemäß Rowlands die „higher-order thought theory of consciousness“. Höherstufige Zustände statten niedrigstufige Zustände mit gewissen Eigenschaften (z.B. Bewusstsein oder Normativität) aus, welche diesen normalerweise fehlen. Auch die Idee Kants basiert auf dieser Art des Denkens: Reflektion auf höherer Stufe stattet die Motivationen auf niedriger Stufe mit normativer Kraft aus. Nun will Rowlands jedoch zeigen, dass dies das Problem nicht wirklich löst, sondern einfach auf die nächste Stufe verschiebt, ad infinitum. Damit bleibt es völlig rätselhaft, wie jemals normative Kraft ins Spiel kommen könnte. „Somewhere, the miracle tells us, we will find a level that is immune to the tribulations of the lower order. But there are no miracles, and there is no such level.“ (187) Daraus schließt Rowlands, dass die klassische Idee, Reflektion könne normative Kraft generieren, schlussendlich auf Wunschdenken basiert und damit verworfen werden muss. Dieses Kapitel ist leider etwas unklar, und es bleibt schleierhaft, wie genau die angegriffenen Philosophen auf das „miracle“ angewiesen sind. Schlussendlich bleibt die Vermutung, dass neben der Metaebene auch andere Gründe bei diesen Positionen im Spiel sind, welche aber von Rowlands außer Acht gelassen werden. Einer letzten Möglichkeit, wie versucht wird, Tiere aus dem Kreis der moralischen Subjekte auszuschließen, widmet er sich dann in Kapitel acht. Da Tiere nicht Teil einer moralischen Praxis, also einer Gemeinschaft, in welcher moralische Urteile gefällt werden, sein können, so die weitverbreitete Vorstellung, können sie auch nicht aus moralischen Gründen handeln. Aber auch hier zeigt Rowlands, dass es keinen Grund gibt, Tieren prinzipiell den Status als Subjekte der Moral abzusprechen. Entweder basiert ihr Ausschluss auf einem nicht haltbaren Wittgensteinianischen Praxisbegriff, oder er bezieht sich letztendlich wieder auf das vorhin beschriebene magische Denken. Daraus schließt Rowlands, dass auch der letzte Versuch, Tiere nicht als moralische Subjekte zuzulassen, scheitert. Da in den vorhergehenden Kapiteln verschiedene Möglichkeiten, wie Handlungen normative Kraft gewinnen können, verworfen wurden, stellt sich nun die Frage, wie schließlich Normativität wieder ins Spiel kommt Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 187 | | Petra Mayr et al. und damit moralische Handlungskraft wieder möglich wird. Hier verteidigt Rowlands einen externalistischen Konsequentialismus, welcher gewisse Handlungen aufgrund spezifischer Eigenschaften von Situationen objektiv moralisch richtig oder falsch macht. Sofern ein Wesen einen verlässlichen Mechanismus besitzt, welcher diese Eigenschaften „aufspürt“, spricht nichts dagegen, dieses Wesen als moralisch zu bezeichnen. Ob es sich dabei bloß um ein „moral subject“ oder einen „moral agent“ handelt, ist eine graduelle Angelegenheit und hängt gemäß Rowlands davon ab, inwiefern das Wesen fähig ist, diese Eigenschaften und ihre Funktion im moralischen Kontext zu verstehen. „Agency, on this view, comes in degrees – because this sort of understanding comes in degrees.“ (240) Can Animals Be Moral? ist ein komplexes Buch, das sich primär an Philosophinnen und Philosophie-Interessierte mit einem Faible für begriffliche Argumente und Zusammenhänge richtet. Rowlands verteidigt seine außergewöhnliche These mit viel Argumentationsgeschick und fast ohne Inkonsistenz. Fast? Ja, denn im Laufe der Lektüre drängen sich doch einige Zweifel auf, ob das Konstrukt tatsächlich trägt. Zwei davon sollen hier dargestellt werden: Einerseits bleibt offen, inwiefern der externalistische Konsequentialismus (angenommen, man akzeptiert ihn) dem Subjekt Handlungsgründe liefern kann, ohne dass diese irgendwie in ihm instantiiert sein müssen. Rowlands verweist zu diesem Zweck auf die Funktion externer Gründe, ohne dabei aber weiter auf die damit verbundene Problematik einzugehen. Es bleibt der Leserin fast nichts anderes übrig, als die Kraft externer Gründe, dem Subjekt moralische Gründe für seine Handlungen zu liefern, beinahe blind hinzunehmen. Insbesondere in der Dialektik des Buches, wo die Grundlage für die objektive moralische Bewertung einer Handlung erst zum Schluss eingeführt wird, wirkt dieses Argumentationsmuster wie ein geschickt eingefädelter Taschenspielertrick. Andererseits drängt sich die Vermutung auf, dass Rowlands selbst in der Erklärung von Normativität und Handlungskraft dem miracle-of-themeta auf den Leim geht. Subjekte werden zu Akteurinnen, indem sie moralische Eigenschaften zu verstehen lernen. Und dies wiederum tun sie kraft ihrer meta-kognitiven Fähigkeiten (238–239). Warum jedoch die meta-kognitiven Fähigkeiten dies ermöglichen, bleibt leider offen. Dies hängt wohl auch mit den zuvor schon bemerkten Zweifeln, worum es sich beim „miracle“ genau handelt, zusammen. So bleibt im Endeffekt eine Mischung aus der Überzeugung, dass Rowlands zwar ein interessantes Problem aufwirft und eine ungewöhnli| 188 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | che Position geschickt verteidigt, und dem bitteren Nachgeschmack, dass dabei nicht ganz sauber argumentiert und gewisse Probleme unter den Teppich gekehrt wurden. Florian Leonhard Wüstholz 3. Tierethik interdisziplinär 3.1 Helmut Segner: Fish. Nociception and Pain. A Biological Perspective 94 S., Bern: Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich, 2012, 12,00 CHF 3.2 Markus Wild: Fische. Kognition, Bewusstsein und Schmerz. Eine philosophische Perspektive 187 S., Bern: Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich, 2012, 12,00 CHF Die Frage, ob bzw. wie weit Fische über phänomenales Bewusstsein verfügen und insbesondere wie weit sie Schmerzen fühlen können, ist nicht nur hochgradig kontrovers, sie ist angesichts ihrer Reichweite auch von gleichermaßen hohem wissenschaftstheoretischem und ethischem Interesse. Wissenschaftstheoretisch wirft sie die Frage nach den Kriterien auf, an denen sich Urteile über Bewusstseinsfähigkeit bei evolutionär vom Menschen entfernten Tiergattungen orientieren können, sollen oder müssen. Ethisch hätte eine bejahende Antwort auf die Frage Do fish feel pain? – so der Titel eines für die Debatte wichtigen Buchs von Victoria Braithwaite (Oxford 2010) – massive Konsequenzen für den gegenwärtig praktizierten Umgang mit Fischen: vom Sportangeln bis zum Fischfang im industriellen Maßstab, bei dem der größte Teil der Fische einen längerdauernden Erstickungstod erleidet. Eine weitere Frage (die in beiden Beiträgen allerdings nur beiläufig aufgeworfen wird) ist die, welches Verhalten angemessen ist, wenn für die Schmerzfähigkeit von Fischen zwar Indizien sprechen, diese aber lediglich Vermutungen begründen: Sollten wir den Fischen den „benefit of the doubt“ gewähren und für praktische Zwecke davon ausgehen, dass Fische Schmerzen empfinden, wenn ein Haken Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 189 | | Petra Mayr et al. ihr Maul oder ihre Augen durchbohrt, oder sollten wir sie, wie Vertreter konservativer Positionen gelegentlich argumentieren, wegen des verbleibenden Restzweifels umgekehrt nur nachrangig schützen, d.h. nur so weit, wie der Schutz nicht mit anderen, insbesondere ökonomischen Interessen konfligiert? Hintergrund und Anlass der vorliegenden – sich komplementär zueinander verhaltenden – Bände sind die spektakulären, in der Öffentlichkeit allerdings wenig beachteten Befunde der letzten 20 Jahre über die bemerkenswerten kognitiven Leistungen einzelner Fischgattungen. Beobachtungen und Versuche an Regenbogenforelle, Zebrafisch und anderen haben das herkömmliche Bild der Fische als „3-Sekunden-Wesen“ mit minimalem Gedächtnis und minimaler Lernfähigkeit erschüttert. Beide Autoren argumentieren vor diesem Hintergrund für ein „neues Bild“ vom Fisch als Wesen, dessen kognitive Leistungen in wesentlichen Hinsichten denen von Säugetieren entsprechen. Die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden, müsse ihnen zumindest insoweit zugesprochen werden, als die Beweislast bei denen liegt, die ihnen diese abstreiten. Fische verfügen, wie der Berner Biologe Segner überzeugend darlegt, nicht nur über Nociceptoren, die von außen induzierte Gewebeschäden detektieren (über diese verfügen auch Wirbellose wie Insekten und Würmer), sondern auch über analoge afferente Reizleitungen und dieselben an der Schmerzwahrnehmung beteiligten Gehirnareale, mit dem Unterschied allerdings, dass Fische ähnlich wie Reptilien und Vögel keinen Neokortex aufweisen. Dieser ist bei Säugetieren an der Schmerzwahrnehmung maßgeblich beteiligt – das Hauptargument für Skeptiker wie den amerikanischen Forscher J.D. Rose dafür, die Zuschreibung von subjektiven Schmerzempfindungen bei Fischen als Anthropomorphismus abzutun. Wie viele andere geht Rose davon aus, dass das, was für Säugetiere gilt, auch für alle evolutionär „älteren“ Tiergattungen gilt. Diese Annahme ist, wie beide Autoren feststellen, bezweifelbar. Entscheidend für die Frage der Schmerzfähigkeit ist nicht, ob ein Wesen die bei den Säugetieren notwendigen Komponenten für Schmerzempfindungen besitzt, sondern wie weit es über Gehirnareale verfügt, die dem Neokortex bei Säugetieren in funktionaler Hinsicht äquivalent sind. Das sind möglicherweise genaue jene Areale, aus denen sich bei Säugetieren evolutionär der Neokortex entwickelt hat, also das Pallium, das bei Fischen und Vögeln das Gehirn „nach oben hin“ abschließt. Die Tatsache, dass zumindest Vögeln im Allgemeinen die Fähigkeit zu visuellen und Schmerzempfindungen zugesprochen wird (ausgehend von der Vermutung, dass der „Wulst“, der vordere Teil des Pallium, die Funktionen übernimmt, die bei Säugetieren Teile des | 190 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Neokortex übernehmen), kann zumindest als Indiz dafür gelten, dass der Analogieschluss vom Menschen bzw. von den Säugetieren auf andere Wirbeltiere keine genaue neuroanatomische Entsprechung erfordert. Auf der anderen Seite sprechen Befunde bei Menschen mit Störungen oder Defiziten der betreffenden neokortikalen Funktionen dafür, dass diese zwar weder für die Wahrnehmung von Schmerzen noch für die mit Schmerzen zusammengehenden Verhaltens- und Ausdrucksweisen notwendig sind, wohl aber für die affektive Bewertung von Schmerz und die Furcht vor zukünftigen Schmerzen. Das Argument, mit dem beide Autoren die Annahme von Schmerzempfindlichkeit und Schmerzaversion bei Fischen stützen, sind angesichts dieses Patts die Befunde über die teilweise erstaunlichen kognitiven Leistungen sowohl einiger Fisch- wie einiger Vogelarten: Zahlengedächtnis, schlussfolgerndes Denken, mentale Landkarten komplexer Wegstrecken, flexible Verhaltensanpassung an neuartige Situationen und kooperatives Jagen, auch vorgängig zur Wahrnehmung einer geeigneten Beute („intentionales“ statt „opportunistisches“ gemeinsames Jagen) und zusammen mit Individuen anderer Spezies. Außerdem werden bei beiden Wirbeltiergattungen ebenso wie bei Säugetieren die Betätigung dieser Funktionen und normale Verhaltensroutinen durch noxische Stimulationen beeinträchtigt. Insofern glauben sich beide Autoren zu der Annahme berechtigt, dass wie bei der Entwicklung und Betätigung dieser komplexen Verhaltensweisen auch bei der Schmerzwahrnehmung eine Beteiligung des Neokortex bei Vögeln und Fischen gleichermaßen entbehrlich ist. Allerdings zieht der Philosoph Wild weitergehende Schlussfolgerungen als der Biologe Segner. Für diesen sprechen zwar gute Gründe für die Empfindungsfähigkeit, aber keine schlüssigen. Wild geht weiter und hält die vorliegenden Belege für ausreichend, betont allerdings die Angewiesenheit der Debatte auf weitere empirische Forschungen. FischSchmerz sei eher ein Forschungsprogramm als gesichertes Wissen. Auch sage die These, dass Fische Schmerzen haben können (die „Verteilungsfrage“), nur wenig darüber aus, wie sich Schmerzen für die Fische anfühlen (die „Anfühlfrage“) – abgesehen davon, dass sie unangenehm und möglichst zu vermeiden sind. Anders als Braithwaite, die in dem abschließenden Kapitel ihres Buchs („Looking to the Future“) die sich den aus dieser Lage ergebenden Fragen an die Praxis des Fischfangs und des Experimentierens mit Fischen zuwendet, deutet der Band von Wild diese Folgeprobleme lediglich an. Hier wäre für die Tierethik noch viel zu tun. Das Gespann Segner/Wild kann dafür als Modell einer erfolgreichen Interdisziplinarität gelten. Dieter Birnbacher Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 191 | | Petra Mayr et al. 4. Tiere und Gesellschaft 4.1 Herwig Grimm und Carola Otterstedt (Hrsg.): Das Tier an sich. Disziplinübergreifende Perspektiven für neue Wege im wissenschaftsbasierten Tierschutz 388 S., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, 39,99 EUR Der Sammelband wird mit einem theologischen Beitrag von Michael Rosenberger eröffnet. In seinem Text mit dem Titel „Mit Noah auf der Arche und mit Jesus im Paradies“ wird die Mensch-TierBeziehung vor dem Hintergrund christlicher Moraltheorie als durch Empathie und Mitleid gekennzeichnet dargestellt. Das Tier wird hier zum Mitgeschöpf erklärt, dem gegenüber man sich empathisch zu verhalten habe, da es darauf ankomme, gemeinsam mit allen Mitgeschöpfen in einer Welt begrenzter natürlicher Ressourcen zusammenzuleben. Dementsprechend gehe es darum, dieses Zusammenleben moraltheologisch begründet zu ordnen. Nach den anfänglichen Hinweisen auf Empathie und Mitleid irritiert dann allerdings die Bezugnahme zur Todesfrage, die zur Tötungsfrage mutiert: „Das ungemein schwierige Problem der Abwägung von Gütern zwischen Mensch und Tier hat definitiv seine Spitze in der Frage nach der Legitimität der Tiertötung: Dürfen wir Menschen – unter der Voraussetzung maximaler Leidvermeidung – Tiere für unseren Nutzen töten? Und wenn ja, für welchen Nutzen? Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es den Menschen absolut unmöglich ist, ganz ohne die Tötung von Lebewesen (!) auszukommen.“ ( 30f.) Hier wird die Frage, wie innerhalb eines begrenzten Ökosystems zusammen gelebt werden soll, einseitig zulasten der Tiere aufgelöst. In hohem Maße irritierend ist dabei die moraltheologische Legitimationsstrategie, die in einem weiteren Aufsatz des Autors Rosenberger zusammen mit Peter Kunzmann unter dem Titel „Ethik der Jagd und Fischerei“ herangezogen wird. In diesem erscheint die Jagd durch Lustgewinn gerechtfertigt, sodass eine nahezu „polymorph-perverse tierethische Theodizee“ der Lust des Tötens entwickelt wird: „Mehr als viele anderen Betätigungen des Menschen scheint es der Jagd eigen zu sein, dass sie im Jagenden starke Emotionen hervorruft und große Lust [Hervorhebung im Original] erzeugt. Das ist keineswegs schlecht oder verwerflich, im Gegenteil: Wenn jemand sein Handwerk mit Freude tut, ist das grundsätzlich zu begrüßen. | 192 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Allerdings gilt es, die Aspekte der Lust oder Freude ehrlich wahrzunehmen. Denn gerade Emotionen bedürfen im moralisch guten Leben einer ständigen Formung. Sie müssen gelenkt und gestaltet und manchmal auch begrenzt werden, damit sie zum Guten führen. Um sie aber gestalten zu können, muss man sie erst einmal wahrnehmen und ehrlich zugeben.“ (300) Die anfangs noch als harmonisches Zusammenleben konzipierte Mensch-Tier-Beziehung zeigt sich hier als vollkommen ambivalent, indem wildlebende Tiere nun als Konkurrenten und Lustobjekte, aber nicht mehr als Mitgeschöpfe erscheinen. Der Text spiegelt augenscheinlich den Kampf mit der Sublimierung einer „Lust am Töten“, so dass der ganze Beitrag – wohl ungewollt – zum Psychogramm einer gestörten MenschTier-Beziehung gerät. Ziel des Buchprojektes der Herausgeber sollte es sein, „Bezugspunkte des verantwortlichen Umgangs mit Tieren aufzuzeigen und aus Sicht relevanter wissenschaftlicher Disziplinen systematisch zusammenzustellen.“ (11) Ein ernüchterndes Bild zur Lage des verantwortungsvollen Umgangs mit Tieren zeigen u.a. die Beiträge von Christoph Maisack zum Tierschutzrecht bei der Haltung von Nutztieren und von Johanna Moritz und Erik Schmid zur Verantwortung von Behörden und Gesellschaft auf. Maisack, Jurist und stellvertretender Landestierschutzbeauftragter von Baden-Württemberg, moniert, dass Tierschutzbelange nicht vor Gericht eingeklagt werden können, dass aber die Tiernutzer immer gegen ein vermeintliches Zuviel an Tierschutz klagen könnten. In diesem Ungleichgewicht liege eine fundamentale Ursache für die Geringschätzung und Zurücksetzung von Tierschutzbelangen beim Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsakten und -handlungen nach dem Tierschutzgesetz. Die bundesweite Einführung des Verbandsklagerechts, welches Tierschutzvereinen ermöglicht, für die Belange von Tieren zu klagen, sei dringend angezeigt, um dem Tierschutz die notwendige Aufwertung zu geben und um gegen die starken wirtschaftlichen Interessen der Tiernutzer anzukommen. Maisack zeigt, dass die gängigen Haltungspraktiken von sogenannten Nutztieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegen die Grundvorschriften zur Tierhaltung verstoßen. Zahlreiche Grundbedürfnisse können die Tiere in den gängigen Haltungssystemen nicht ausleben, was in Deutschland einen eindeutigen Verstoß gegen § 2 TierSchG darstellt. Dieser regelt, dass Tiere ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen sind. Eines der vielen Beispiele für besonders gravierende Gesetzesverstöße sei die wochenlange Fixierung von Sauen im Kastenstand, in dem sich die Tiere nicht einmal umdrehen können. Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 193 | | Petra Mayr et al. Auch wird erläutert, warum die Masthühnerhaltung mit bis zu 30 kg Lebendendgewicht pro m² tierschutzwidrig ist. Es folgen weitere Beispiele zur Haltung von Schweinen, Hühnern und Enten. Gibt es Wege, um die festgestellten Gesetzesverstöße zu beseitigen? Die entscheidende Schwäche des Tierschutzes liege nicht in erster Linie im materiellen Recht, sondern das Problem sei der mangelhafte Vollzug des Rechts. In Deutschland sei ein Verstoß gegen die gesetzlichen Grundvorschriften für die Tierhaltung (§ 2 TierSchG) nicht einmal strafbar. Erst wenn weitere, oftmals schwer nachweisbare Voraussetzungen (länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen und Leiden) für eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit bewiesen werden können, könne gegen Tierhaltungsverstöße gerichtlich vorgegangen werden. Jedoch setze Strafe ein Unrechtsbewusstsein und den Vorsatz voraus, was angesichts von tierquälerischen Haltungsformen, die durch untergesetzliche Rechtsnormen gebilligt und von den Überwachungsbehörden toleriert werden, nur schwer zu erzeugen bzw. nachzuweisen sei. Wenn die überwachenden Behörden die Tierschutzwidrigkeit der Rechtsverordnungen zur Tierhaltung nicht erkennen, werden sie auch nicht dagegen vorgehen. Sogenannte Normenkontrollverfahren seien notwendig, um die Nichtigkeit von Rechtsnormen durch das Bundesverfassungsgericht feststellen zu lassen. Jedoch können nur Landesregierungen, die Bundesregierung oder ein Drittel der Bundestagsmitglieder einen Antrag zur Einleitung des Verfahrens einreichen, nicht jedoch Tierschutzorganisationen oder gar einzelne Tierschützer, weshalb es ein solches in Deutschland bislang nur zweimal gab. Um den Tieren schnell und effektiv helfen zu können, fordert Maisack neben dem wichtigsten Mittel, dem Verbandsklagerecht, auch die flächendeckende Bestellung von Landestierschutzbeauftragten, die auch Klagerechte gegen untätige Behörden haben, und die Bestellung von Tieranwälten für Strafverfahren nach dem TierSchG, die die Belange der Tiere wahrnehmen können. Über die gesellschaftliche Verantwortung und die Wichtigkeit einer funktionierenden behördlichen Tierschutzaufsicht, die das Tierschutzgesetz auch konsequent umsetzt, schreiben Moritz und Schmid in ihrem Beitrag. Die Ausgangslage sei durch die Verankerung des Tierschutzes als Staatsziel im Grundgesetz im Jahr 2002 sehr gut. Aber der daraus resultierende Handlungsauftrag, Tiere vor nicht artgerechter Haltung, vor vermeidbaren Schäden und vor der Zerstörung ihrer Lebensräume zu schützen, werde bereits im Tierschutzgesetz und auch in den untergeordneten Verordnungen aufgeweicht, indem Praktiken wie z.B. das Kupieren von Schwänzen bei Mastschweinen erlaubt seien. Diese gängigen tier| 194 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | schutzwidrigen Praktiken machten die Haltung von Tieren in nicht tiergerechten Haltungssystemen erst möglich. Hinzu komme, dass das Tierschutzrecht vermehrt auf EU-Ebene diktiert werde und unzureichende Mindestanforderungen festgesetzt würden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, orientieren sich die meisten Mitgliedsländer dann an den Mindeststandards aus Brüssel. Tierschutzorganisationen hätten eine wichtige Rolle beim Aufzeigen von Missständen und Einfordern von staatlichem Handeln. Auch die Rolle anderer Interessenvertreter und der Medien wird diskutiert. Das Food and Veterinary Office, das im Auftrag der EU-Kommission kontrolliert, ob die Mitgliedsstaaten die Rechtsnormen vollziehen, sei ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Tierschutzaufsicht der Mitgliedsländer, da Mängel zu Strafzahlungen führen. Beim Vorliegen von Missständen sind die Behörde und damit der Amtstierarzt zum Handeln verpflichtet. Eine Unterlassung wäre eine Straftat. Die Verfahren seien aber meist langwierig und arbeitsintensiv und scheitern oftmals an formalen Fehlern, was häufig zu Resignation beim Vollzugspersonal führe. Die meisten leitenden Amtstierärzte seien nur schlecht im Tierschutz ausgebildet. Auch fehlten oft eingehende Kenntnisse des Verwaltungsrechts, die den Vollzug erst möglich machten. So seien viele Amtstierärzte angesichts der Vielzahl an weiteren Aufgaben neben dem Tierschutz überfordert. Außerdem monieren die Autoren, dass zu wenig Personal zur Bewältigung aller Aufgaben zur Verfügung steht. Lösungsansätze dafür, dass die Behörde und somit die Amtstierärzte ihrer Aufgabe und Verantwortung nachkommen können, seien u.a. die Einrichtung von personell und fachlich gut ausgestatteten Tierschutz-Fachzentren, fachspezifische Fort- und Weiterbildung, die Einrichtung von Tierschutzombudsstellen und eigene Staatsanwaltschaften für den Bereich Tierschutz. Auch dringend notwendig sei die Einrichtung einer Prüfstelle, die serienmäßig hergestellte Tierhaltungssysteme für Heim- und Nutztiere auf ihre Tauglichkeit im Hinblick auf den Schutz der Tiere überprüft. Moritz und Schmid stellen richtig fest, dass dem Amtstierarzt auch in Zukunft eine Schlüsselrolle zukommen wird. Tierärzte, die im Tierschutz arbeiten wollen, müssten über sehr gute Fachkenntnisse verfügen, hoch motiviert sein, über gute „soft skills“ verfügen und Konflikte aushalten und bewältigen können. „Im Tierschutz arbeiten heißt ,dicke Bretter bohren‘.“ (373) Abschließend fordern die Autoren die Tierärzteschaft auf, sich endlich klar zum Thema Tierschutz zu positionieren und ihrer Rolle als berufene Schützer der Tiere endlich gerecht zu werden. Darüber hinaus treffe uns alle eine moralische Verantwortung, Tiere zu schützen. Der Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 195 | | Petra Mayr et al. Schutz von Tieren sei eine Frage unseres eigenen Kulturfortschritts und damit eine Bildungsaufgabe. „Wer den Tierschutz ernst nimmt, muss sein Verhalten ändern – als Fleischesser und Forscher, aber auch als Tierliebhaber.“ (374) Eine Stärke des Sammelbandes ist seine breit angelegte Auswahl an Beiträgen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen, wie etwa der Philosophie, der Biologie, aber auch der Geschichtswissenschaften. Der Sammelband Das Tier an sich geht nicht nur auf die unterschiedlichen Beziehungs- und Nutzungsformen ein, die Menschen mit Tieren eingehen, er spiegelt zugleich auch in beispielhafter Weise die Vielfalt der divergierenden Haltungen, die Menschen Tieren gegenüber einnehmen. Kathrin Herrmann, Petra Mayr 4.2 Bernd-Udo Rinas: Veganismus. Ein postmoderner Anarchismus bei Jugendlichen? 311 S., Berlin: Archiv der Jugendkulturen Verlag AG, 2012, 18,00 EUR Was hat Anarchismus mit Postmodernismus und Veganismus zu tun? Sehr viel, ist der Sozialwissenschaftler Bernd-Udo Rinas überzeugt. Seiner Ansicht nach sollte die anarchistische Bewegung, will sie für künftige Generationen attraktiv bleiben, endlich die eigenen theoretischen Annahmen hinterfragen; darin sieht der Autor den Bezug zum Postmodernismus. Und dazu gehört, dass die einseitig auf den Menschen ausgerichtete – oder, wenn man das grimmige Gesicht des Humanismus nimmt, speziesistische – Ideologie überwunden werden muss, worin die Verknüpfung mit dem Veganismus zu sehen ist. Wie man sich den Zusammenhang zwischen diesen drei -Ismen konkret vorzustellen hat bzw. wie er sich, gut postmodernistisch, konstruieren lässt, ist das eigentliche Ziel dieser Dissertation. Nach einigen allgemeinen Ausführungen zur Soziologie der Jugend(-kulturen) (Kap. I) bietet Rinas einen historisch-systematischen Überblick über die „vegane Bewegung“ (Kap. II); er nennt die zentralen Merkmale des Postmodernismus (Kap. III.1) und diskutiert unterschiedliche Ausprägungen des klassischen wie des „neuen“ Anarchismus (Kap. III.2). Im Anschluss daran wird sozusagen das politische Potenzial des Veganismus entfaltet, wobei für Rinas v.a. die Idee von Bedeutung ist, Ausbeutung und Herrschaft nicht bloß dann zu kritisieren, wenn sie Menschen betrifft, sondern | 196 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Unterdrückungsverhältnisse allgemein (unity of oppression) in den Blick zu nehmen (Kap. III.3). Schließlich werden die vielfältigen und bisweilen weit verzweigten Diskussionsstränge, die in dieser Arbeit verfolgt werden, zu der These verdichtet, dass sich der Veganismus in einen „postmodernen Anarchismus“ transformieren lässt (Kap. IV). Im Grunde sind Rinas’ Thesen nicht neu. Möglichkeiten und Grenzen einer postmodernistischen Umdeutung des klassischen Anarchismus werden seit vielen Jahren u.a. unter dem Stichwort „Postanarchism“ ausführlich diskutiert. Auch gibt es bereits seit geraumer Zeit einen Zweig der Tierrechts- oder – genauer – der Tierbefreiungsbewegung, der einen dezidiert herrschaftskritischen Ansatz vertritt und für den die vegane Lebensweise zumindest auf der persönlichen Ebene ein Akt der Solidarität mit allen empfindsamen Lebewesen darstellt. Rinas’ Anspruch besteht denn auch primär darin, den theoretischen Rahmen zu setzen, innerhalb dessen Konzepte wie „Postanarchismus“ und „Veganarchismus“ fruchtbar aufeinander bezogen werden können. Ob ihm dies tatsächlich gelingt, ist jedoch zu bezweifeln. Zwar befasst sich Rinas recht ausführlich mit dem Postmodernismus im Allgemeinen, doch fehlt eine eingehende und vor allem kritische Auseinandersetzung mit postanarchistischen Ansätzen etwa von Todd May, Saul Newman oder Lewis Call, um (neben Richard Day, den Rinas summarisch nennt) bloß die bekanntesten anzuführen. Dieses Defizit dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass sich Rinas weitgehend auf Literatur verlässt, die in deutscher Sprache verfügbar ist. So oder so wäre es interessant gewesen zu erfahren, wie Rinas den Vorwurf an den postmodernistischen Anarchismus, er sei geschichts- sowie theoriefeindlich, bewertet und allenfalls kontert. Denn davon hängt auch ab, inwieweit Konzepte, die der anarchistischen Tradition entlehnt sind, in einem modifizierten Theorierahmen überhaupt noch verfügbar sind. Rinas selbst scheint der Meinung zu sein, dass dem so ist, wie er (in Anlehnung an Day) am Begriff der Solidarität zu zeigen versucht ( 150, 173, 203, 269). Solidarisches Handeln entspringe nämlich der Einsicht, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen den eigenen Privilegien und der Unterdrückung Anderer und dass zu diesen „Anderen“ eben auch nichtmenschliche Tiere gehörten. Diese Neudeutung des Begriffs der Solidarität lässt sich aber auch ohne postmodernistische Umwege bewerkstelligen. Man hat ‚lediglich‘ Argumente dafür zu liefern, dass nichtmenschliche Tiere zu den Kandidaten von Entitäten gehören, die durch die Ausübung meiner Privilegien geschädigt werden können. Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 197 | | Petra Mayr et al. Und damit zu einem zweiten Punkt, der in Rinas’ Arbeit zwar immer wieder angedeutet, aber kaum ausgearbeitet wird: Welche Gründe sollten AnarchistInnen eigentlich haben, ihre Thesen und Begrifflichkeiten auf den außerhumanen Bereich auszuweiten? Aus Sicht der VeganerInnen (zumindest, wie Rinas sie porträtiert, s.u.) bietet sich hier der Rekurs auf basale Grundsätze der traditionellen Moralphilosophie an, wie z.B. das Gleichheitsprinzip (wie das Peter Singer vorschlägt) oder die Verleihung moralischer (sowie juridischer) Rechte auf der Basis der Zuschreibung eines intrinsischen Werts (wie das Tom Regan im Sinn hat). Gegenüber beiden Ansätzen dürften AnarchistInnen jedoch ihre Vorbehalte haben. Was letzteren betrifft, sind sie bekanntlich skeptisch gegenüber dem Begriff des Rechts. Für viele sind Rechte bloß ein Instrument in den Händen mächtiger Ideologien oder Instanzen (wie z.B. des Staates), mit denen Herrschaftsverhältnisse weiter zementiert werden. Und was ein auf alle Tiere ausgeweitetes Gleichheitsprinzip à la Singer angeht, sind viele AnarchistInnen der Ansicht, es werde hier der Mensch auf eine biologische Entität reduziert (auf ein Wesen mit Empfindungsfähigkeit), womit außer Acht gerate, was uns in erster Linie ausmache, nämlich: dass wir primär soziale Lebewesen seien. Nicht, dass es gegen diese traditionellen Auffassungen keine Einwände gibt: So wurde (von Feministinnen wie Carol Adams oder von Anarchisten wie Brian A. Dominick) scharfe Kritik an traditionellen Moraltheorien geübt und Konzepten wie Gerechtigkeit, gleiche Rücksichtnahme, Rechte oder Würde eine Ethik der Fürsorge und des Mitgefühls gegenübergestellt. Oder es wurde (z.B. von Ted Benton) zu zeigen versucht, dass auch (viele) nichtmenschliche Tiere ein ausgeprägtes soziales Leben führen. Schließlich gibt es Ansätze (wie z.B. denjenigen des Anarchisten Bob Torres), welche extreme Formen der Ausbeutung an den Besitzstatus von Lebewesen knüpfen und eine Ausweitung von Begriffen wie Herrschaft oder Unterdrückung auf nichtmenschliche Tiere damit begründen, dass diese Lebewesen nach wie vor Eigentum des Menschen seien bzw. deren Wert auf eine ökonomische Größe reduziert werde. Auch in diesem Fall wäre es interessant gewesen zu sehen, wie Rinas solche Ansätze beurteilt, zumal sie ganz konkret Argumente liefern für seine These, der (soziale) Anarchismus habe die eigenen Annahmen kritisch zu reflektieren – Argumente, die in Rinas’ Arbeit weitgehend fehlen. Schließlich ein dritter Punkt: Rinas ist sich zwar bewusst, dass er von einem reichlich eingeschränkten Verständnis von „Veganismus“ ausgeht. Dennoch muten einige seiner Aussagen etwas irreführend an – so etwa, wenn er den Veganismus als eine dezidiert nicht-anthropozentrische Le| 198 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | bensweise porträtiert. Zumindest für Menschen, die aus überwiegend gesundheitlichen oder ökologischen Gründen vegan leben (und das sind, wenn man empirischen Studien aus den USA glauben will, nicht wenige), trifft dies so nicht zu. Und auch jene, die vornehmlich ethische Gründe für ihren Veganismus anführen, vertreten nicht schon eo ipso einen antispeziesistischen oder gar herrschaftskritischen Standpunkt – genau diese Art von Veganismus aber hat Rinas ausschließlich im Blick. Geht man davon aus, dass die Zahl vegan lebender Menschen in vielen Ländern nach wie vor im Promillebereich liegt, dürften die von Rinas gemeinten „AnarchoveganerInnen“ de facto einen äußerst kleinen Kreis ausmachen. Für sich genommen ist das nicht weiter schlimm; allenfalls wird damit die These vom Veganismus als zukunftsweisendem Lebensstil arg relativiert. Systematisch eher ins Gewicht dürfte die Tatsache fallen, dass der Veganismus gerade von jenen Menschen aus der Tierbefreiungsbewegung äußerst scharf kritisiert wird, die eine herrschaftskritische Position vertreten. Für sie (die selber vegan leben) ist der Veganismus zunächst bloß ein individueller lifestyle ohne politische Dimension. Einer der Gründe besteht darin, dass sie den Speziesismus gerade nicht als persönliches Vorurteil betrachten, das sich mit einigen philosophischen Argumenten kurieren lässt (wie das die von Rinas immer wieder erwähnten Moralphilosophen Singer und Kaplan meinen), sondern als Teil einer Ideologie, die in unserer Kultur fest verankert ist und die (wie der Soziologe David Nibert herausgearbeitet hat) einer ganz bestimmten Verwertungslogik folgt, die darauf angelegt ist, empfindsame Lebewesen in ökonomisch rentable Konsumgüter zu transformieren. Mit anderen Worten sieht es danach aus, als ob der (auch ethisch motivierte) Veganismus selbst für jene Menschen nicht von herausragender politischer Bedeutung ist, die Rinas primär im Auge hat. Was im Grunde nicht weiter tragisch ist, denn kaum jemand vertritt wirklich die Ansicht, dass der Veganismus für alles und jede das allein selig machende Mittel ist – dies, und zum Glück, auch für den Anarchismus nicht. Klaus Petrus Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 199 | | Petra Mayr et al. 5. Rechtsfragen und Rechtsentwicklung 5.1 Sabine Lennck: Die Kodifikation des Tierschutzrechts 321 S., Baden-Baden: Nomos, 2012, 79,00 EUR Die Autorin setzt sich in ihrer 2010 an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg entstandenen und als Band 8 der vom Verlag Nomos herausgegebenen Reihe „Das Recht der Tiere und der Landwirtschaft“ veröffentlichten Dissertation Die Kodifikation des Tierschutzrechts. Modellvorstellungen aus rechtsvergleichender Perspektive mit den Tierschutzgesetzen des deutschsprachigen Raumes, Neuseelands und Südafrikas auseinander. Dabei entwickelt sie auf der Grundlage der daraus gewonnenen Erkenntnisse ein Modell für ein neues Tierschutzgesetz der Republik der Seychellen. Die Arbeit vermittelt nicht nur einen akribisch recherchierten Überblick über Entstehung, Aufbau und Regelungsinhalt der behandelten Tierschutzgesetze, sondern beleuchtet auch die wichtigsten privatrechtlichen Bestimmungen, die für die Mensch-Tier-Beziehung von Bedeutung sind. Grundlegende Fragen wie die Verankerung des Tierschutzes als Rechtsgut im Verfassungsrang und die Diskussion über die Möglichkeit, (bestimmten) Tieren Rechtspersönlichkeit bzw. subjektive Rechte zuzuerkennen, werden wiederholt aufgegriffen, jedoch nicht dogmatisch vertieft. Im Rahmen ihrer Untersuchung gelangt die Autorin zu dem Schluss, dass das österreichische Tierschutzgesetz „schon beinahe als mustergültig“ zu betrachten sei. Dies mag zwar auf das Tierschutzgesetz selbst zutreffen, doch müssten schon die Verordnungen, insbesondere die für die Nutztierhaltung geltenden Mindestanforderungen, die aus der Betrachtung völlig ausgeklammert werden, dieses Ergebnis relativieren. Zwar fließen die Verordnungen deshalb nicht in die Untersuchung ein, weil der (intensiven) Nutztierhaltung auf den Seychellen keine Bedeutung zukommt, doch zeigt diese Lücke in unbeabsichtigter Weise auch, dass die Qualität einer Tierschutzgesetzgebung keineswegs allein auf der Grundlage des jeweiligen Tierschutzgesetzes, sondern stets nur unter Einbeziehung der Durchführungsbestimmungen und unter Bedachtnahme auf die Rechtswirklichkeit, d.h. auf die Effektivität der Vollziehung, beurteilt werden kann. | 200 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | Im Hauptteil der Untersuchung unternimmt die Autorin den Versuch, ein neues Tierschutzgesetz („Modellgesetz“) für die Republik der Seychellen zu entwerfen. Obwohl wiederholt betont wird, dass gerade die Gesetzgebung im Bereich des Tierschutzes auf die jeweiligen regionalen Gegebenheiten, z.B. auf besondere kulturell bedingte Tierschutzprobleme, und auf die ökonomische Bedeutung verschiedener Arten der Tiernutzung Bedacht nehmen müsse, entspricht der im Anhang I abgedruckte Gesetzesentwurf über weite Strecken dem österreichischen Tierschutzgesetz. Schließlich muss im Hinblick auf den Titel der Arbeit auch die Frage aufgeworfen werden, ob ein Tierschutzgesetz, das sich wie das österreichische auf die Regelung „allgemeiner“ Tierschutzangelegenheiten beschränkt und daher weder Tierversuche noch den Transport von Tieren regelt, als „Kodifikation“ des Tierschutzrechts bezeichnet werden kann, die definitionsgemäß den Anspruch erheben müsste, die Rechtsmaterie abschließend zu regeln. Trotz des durchaus interessanten Ansatzes der Rechtsvergleichung mutet die theoretische Bemühung, einen Gesetzesentwurf im „Elfenbeinturm“ zu entwickeln, insgesamt etwas realitätsfern an. Die Arbeit sei dennoch all jenen empfohlen, die sich einen aktuellen Überblick über die Rechtslage im Bereich des Tierschutz- bzw. auch des Tierrechts in Österreich, Deutschland und der Schweiz verschaffen möchten und an rechtsvergleichenden Betrachtungen interessiert sind. Regina Binder 6. Tierethik und Kulturwissenschaft 6.1 Randy Malamud: An Introduction to Animals and Visual Culture 176 S., Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012, 35,78 EUR In einer veritablen Tour de force vergegenwärtigt Randy Malamuds Studie, wie sehr unsere von modernen Bildmedien geprägte Kultur auf Tier-Repräsentationen setzt und welch düsteren Auswirkungen damit einhergehende Praktiken nicht nur auf tierliches Image und Wohlergehen im Konkreten, sondern insgesamt auf unser Verständnis von Welt und Natur haben können. Das Werk – Teil einer mittlerweile beachtlichen Anzahl von Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 201 | | Petra Mayr et al. Publikationen aus der von Andrew Linzey und Priscilla N. Cohn herausgegebenen Tierethik-Reihe des Verlags Palgrave Macmillan in Zusammenarbeit mit dem Oxford Centre for Animal Ethics – versteht sich als Plädoyer für eine ‚ethisch akkuratere‘ Haltung gegenüber nichtmenschlichen Tieren und damit auch als Hinterfragung der Allmacht, die Menschen sich gerade im visuellen Zugriff auf Tiere anmaßen. Randy Malamud, Professor für englische Literatur an der Georgia State University in den USA, hat sich bereits mit seinen Büchern Reading Zoos: Representations of Animals and Captivity (1998) und Poetic Animals and Animal Souls (2003) sowie als Herausgeber von A Cultural History of Animals in the Modern Age (2007) einen einschlägigen Namen gemacht. Über kulturwissenschaftliche Fachbereiche hinaus bekannt mag ihn schließlich das Vorwort gemacht haben, das er für den von Linda Kalof und Amy Fitzgerald herausgegebenen multidisziplinären Band The Animals Reader (2007; vgl. dazu die Rezension in ALTEX 25.4, 2008) verfasste. Auch der Fotokünstlerin Britta Jaschinski, deren Tierbilder den Animals Reader eröffnen und strukturieren, begegnen wir in An Introduction to Animals and Visual Culture an prominenter Stelle wieder: Jaschinski liefert nicht nur abermals das Cover-Bild (ein Beluga-Wal, fotografiert im Aquarium), sondern auch fünf weitere der insgesamt 16 Abbildungen, mit denen Malamud seine Studie illustriert. Die meisten Bilder stammen aus Jaschinskis Fotoserie Zoo (1996). Aus den Konvergenzen mit Malamuds Schwerpunktsetzungen sind, wie Malamud selbst thematisiert, diverse gemeinsame Projekte entstanden (vgl. S. 50), und viel Aufmerksamkeit widmet er Jaschinski denn auch im vorliegenden Werk – als Repräsentantin eines „ethically potent endpoint of animal photography“ (61). Angelegt als Kombination aus „close-up case studies and broader theoretical hypotheses about what these portrayals mean“ (4) besteht An Introduction to Animals and Visual Culture aus insgesamt sieben Kapiteln, deren Einteilung keinem einheitlichen Klassifikationsschema folgt: „1. Introduction: Framed Animals“ – „2. Famous Animals“ – „3. Photographic Animals“ – „4. Film Animals“ – „5. Pornographic Animals“ – „6. Zoo Animals“ – „7. Weird Animals“. Angeschlossen sind Anmerkungen und eine Bibliografie – beide Bereiche erstaunlich knapp gehalten – sowie ein sehr genau gearbeiteter, hilfreicher Index. Jedes Kapitel ist damit in sich geschlossen und gut für sich allein lesbar (tatsächlich sind nicht näher ausgewiesene Teile des Buchs bereits als Artikel in Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden erschienen); wer allerdings eine Einführung im herkömmlichen Sinne erwartet, die behutsam, ausgewo| 202 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | gen und sukzessiv vertiefend Themen, Problemstellungen, Begrifflichkeiten, Theorie-Werkzeuge und Forschungslandschaft aufbereitet, wird enttäuscht werden. Ausgeblendet bleibt so mancher Star der kulturwissenschaftlichen Animal Studies. Kann ein Einführungswerk zu Tieren und visueller Kultur Donna Haraways Anmerkungen etwa zum Zusammenhang von Sehen und Ansehen, von respecere und Respekt so völlig ignorieren? Sollte Jacques Derridas tierethische Fragestellungen re-animierender Blickwechsel mit „seiner“ Katze nicht zumindest einen Satz wert sein? Angeschlossen wird hingegen an Michel Foucaults bekannte, in Überwachen und Strafen getroffene Gleichsetzung von Vision und Macht. Und als Gewährsmänner eines Ideals „for the ecological and cultural prosperity of animals“ (46) werden wiederholt und etwas einseitig Deleuze und Guattari bemüht: Das ‚wirkliche‘ – im Sinne von: authentische, ganzheitliche – Tier sei immer ‚multipel‘ (vgl. 11, 36), wild, im ‚Pack‘ unterwegs und in Transformation begriffen (vgl. 46-47). Hier lassen sich Zweifel daran anmelden, wie vereinbar Deleuze und Guattari mit einer Argumentation sind, die immer wieder puristisch auf einer ‚Essenz‘ des Tieres besteht. Vor allem aber erzeugt ein derartiger Referenzrahmen ein antivisuelles Moment, das moderne Bildtechnologien prinzipiell unter Verdacht stellt. Der Akt des framing selbst – technischer Terminus für Kadrierung, die Definition des Bildausschnitts – wird Gefangennahme, Domestizierung und Verfremdung gleichgesetzt: „We do not like to think much about wild, natural animals because we have just about extinguished wildness and nature. We prefer our animals framed, domesticated, dressed up for our spectacles.“ (72) Man mag in Malamuds Fokus auf Zoos, Gefangenschaft und Inauthentizität eine Fortführung, ja Radikalisierung der einflussreichen Thesen des Schriftstellers, Malers und Kunsthistorikers John Berger aus den späten 1970ern sehen, die Anfang der 1980er-Jahre unter dem Titel Why look at animals? zusammengefasst publiziert wurden. Wie Berger führt Malamud die Dynamik zwischen Tieren und visueller Repräsentation auf unser Verhältnis zur Natur zurück, und wie Berger insistiert er auf dem prägenden Einfluss visueller Repräsentation für unser Naturverständnis. Bergers ebenso berühmte wie pessimistische Konfiguration von Tieren als Schwundformen der technischen Moderne, die das Verschwinden ‚realer‘ Tiere aus der Kultur des Kapitalismus mit ihrem Ersatz durch Repräsentationen und Artefakte in Verbindung setzt, findet sich bei Malamud nicht nur gebührend gewürdigt („Berger launched into fascinating rambles about all the improper ways in which people looked at aniLiteraturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 203 | | Petra Mayr et al. mals“, (84) – sie durchläuft gleichsam eine medienhistorische Aktualisierung durch stets skeptische Verweise auf neue und neueste Bildformate und -praktiken, die sich zwischen uns und die Natur drängen: „All these beeping, blinking, omnipresent media supplant a direct engagement with the natural world and its creatures.“ ( 73) Und sie erfährt Zuspitzung durch eine Argumentation, die rigide zwischen (wenigen) akzeptablen und (vielen) nicht-akzeptablen Formen der Visualisierung von Tieren unterscheidet und sich bisweilen gar einem „ethos of not seeing“ (114) verschreibt. So gibt es kaum visuelle Praktiken, die vor Malamuds Sichtung bestehen: Jaschinskis zookritisches Oeuvre; fotografische und filmische Dokumentationen über das Leid in Tierfabriken; „Wildlife“-Tierfilme, die auf Distanz und Subversion von Sehererwartungen setzen. All dies aber markiert Malamud als Nischenprogramm; den hoffnungsvollen Weg in den Mainstream westlicher Popularkultur sieht er allein HollywoodProduktionen im Bereich der „animated movies“ nehmen, mit Zeichentrickfilmen, die wie Ratatouille, Chicken Run, Happy Feet oder Bee Movie auf die Inwertsetzung tierlicher Integrität und auf ökologische Botschaften setzen. Insgesamt jedoch sieht er „visual animals“ in unserer Kultur einer gewaltigen Trivialisierungs-, Verzerrungs- und Vernichtungsmaschinerie unterworfen: ein Pessimismus, der im abschließenden Kapitel „Weird Animals“ – also ‚seltsame, unheimliche Tiere‘ – kulminiert. Hier manifestiert sich aber auch noch einmal ein notorischer toter Winkel in Malamuds Perspektive: Wo Spektakel und framing unter Generalverdacht stehen, kann ein anders gelagertes, tierethisch relevantes Problem nicht adäquat reflektiert werden – das Problem der Ausblendung von Tiertötung und Tierquälerei in unseren Gesellschaften. Die eminente Bedeutung technisch fabrizierter und in Zirkulation versetzter Bilder, um Anliegen des Tier-Aktivismus (von Singer bis PETA) zu positionieren, skizziert Malamud in gerade einmal einem Absatz im Kapitel zu „Famous Animals“ an; das Argument wird später nicht weiterentwickelt. Wo dann aber im Kapitel „Weird Animals“ die Rede auf zeitgenössische Kunstformen kommt, die Aspekte des Tiertötens und -verwertens (vom Schlachten bis zum Experimentieren) eben auf spektakuläre Weise zum Thema machen, reagiert Malamud mit Abblocken: Die für ihn unethischen Vorgehensweisen sanktioniert er gar durch Aberkennung des Künstlerstatus – Kaliber wie Eduardo Kac, Damien Hirst, Pinar Yolaçan sind für Malamud dann eben nur „artists“ unter Anführungszeichen. Wie kurz Malamuds Argumentation etwa im Fall der biokybernetischen Kunst | 204 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht Die Mensch-Tier-Beziehung unter ethischem Aspekt | von Kac greift, weiß, wer die einschlägigen Studien von Steve Baker (den Malamud immerhin zitiert), W.J.T. Mitchell oder jüngst Giovanni Aloi (Art and Animals. London: Tauris 2012) heranzieht. Zusammenfassend: Malamuds Buch macht betroffen – und das ist ja wohl auch ein intendierter Effekt. Seine vehemente Botschaft vermittelt es anschaulich, wortgewandt, erfrischend selbstreflexiv, mitunter mit bereichernden Ausflügen in die Literatur, speziell die Dichtkunst. Besonders spannend ist das Werk dort, wo es historisch ausholt und auf die zentrale Beanspruchung von Tieren gerade am Beginn der technischen Moderne verweist – etwa bei den Ausführungen zur Chronofotografie des Fotopioniers Eadweard Muybridge. Die versprochenen close-up-Fallstudien geraten jedoch recht ungleich; vieles bleibt eher kursorisch behandelt. Und in die Betroffenheit ob des wirkungsvoll vermittelten schieren Ausmaßes an menschlicher Grausamkeit und Ignoranz im Umgang mit Tieren mischt sich schließlich auch Ungeduld, wenn allzu rasch von physischer auf symbolische Gewalt (und umgekehrt) geschlossen wird: Sieht Malamud das populäre und weitestgehend belanglose „The Infinite Cat Project“ im Internet (Katzen beim Betrachten von PC-Bildschirmen mit Bildern von Katzen) ernsthaft als „logical culmination“ (38) von Edisons Kurzfilm Electrocuting an Elephant aus dem Jahr 1903? – Ein lesenswertes Buch, doch gerade wo es als Introduction zum Thema Tiere und visuelle Kultur gelesen wird, sei ergänzende, ausgleichende Begleitlektüre anempfohlen. Claudia Leitner Literaturbericht TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) | 205 | | Petra Mayr et al. Literatur Aaltola, Elisa (2012). Animal Suffering: Philosophy and Culture. Hampshire: Palgrave MacMillan, 272 S., ISBN-13: 978-0230283916, 69,99 EUR Grabolle, Andreas (2012). Kein Fleisch macht glücklich. Mit gutem Gefühl essen und genießen. München: Goldmann, 416 S., ISBN-13: 978-3442173167, 9,95 EUR Grimm, Herwig/Otterstedt, Carola (Hrsg.) (2012). Das Tier an sich. Disziplinübergreifende Perspektiven für neue Wege im wissenschaftsbasierten Tierschutz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 388 S., ISBN-13: 978-3525404478, 39,99 EUR La Barbera, Christopher (2012). States of Nature. Animality and the Polis. New York: Peter Lang Publishing, 123 S., ISBN-13: 978-1433115677, 66,99 EUR Lennck, Sabine (2012). Die Kodifikation des Tierschutzrechts. Baden-Baden: Nomos, 321 S., ISBN-13: 9783832969424, 79,00 EUR Malamud, Randy (2012). An Introduction to Animals and Visual Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 176 S., ISBN-13: 978-1137009838, 35,78 EUR Rinas, Bernd-Udo (2012). Veganismus. Ein postmoderner Anarchismus bei Jugendlichen? Berlin: Archiv der Jugendkulturen Verlag AG, 311 S., ISBN-13: 9783940213716, 18,00 EUR Rowlands, Mark (2012). Can Animals be Moral? Oxford/New York: Oxford University Press, 272 S., ISBN-13: 978-0199842001, 23,99 EUR Segner, Helmut (2012). Fish. Nociception and Pain. A Biological Perspective. Bern: Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich. Beiträge zur Ethik und Biotechnologie, Band 9, 94 S., ISBN: 978-3905782080, 12,00 CHF, Gratis-Download: www.ekah.admin.ch Wild, Markus (2012). Fische. Kognition, Bewusstsein und Schmerz. Eine philosophische Perspektive. Bern: Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Außerhumanbereich. Beiträge zur Ethik und Biotechnologie, Band 10, 187 S., ISBN: 978-3905782097, 12,00 CHF, Gratis-Download: www.ekah.admin.ch Wolf, Ursula (2012). Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 185 S., ISBN-13: 978-3465041610, 16,80 EUR Korrespondenzadresse Dr. phil. Petra Mayr Deisterstraße 25 B 31848 Bad Münder am Deister E-Mail: [email protected] | 206 | TIERethik, 5. Jg. 6(2013/1) Literaturbericht