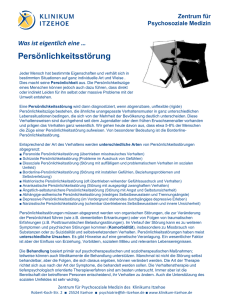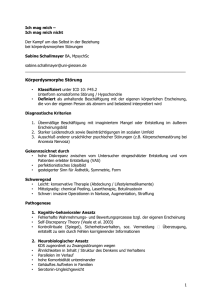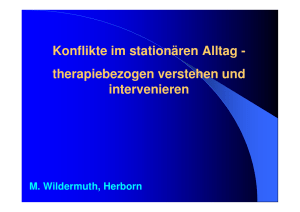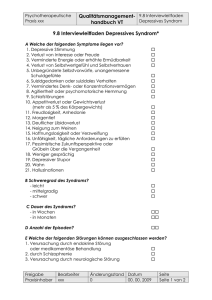Entwicklungspsychopathologie und Entwicklungsepidemiologie
Werbung
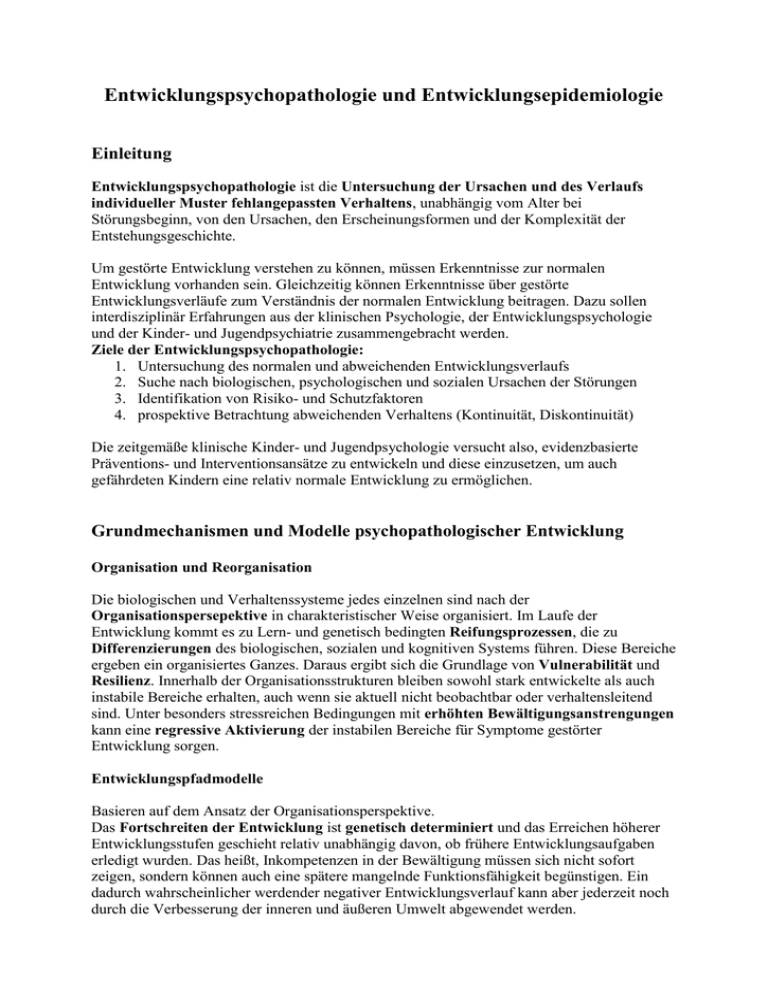
Entwicklungspsychopathologie und Entwicklungsepidemiologie Einleitung Entwicklungspsychopathologie ist die Untersuchung der Ursachen und des Verlaufs individueller Muster fehlangepassten Verhaltens, unabhängig vom Alter bei Störungsbeginn, von den Ursachen, den Erscheinungsformen und der Komplexität der Entstehungsgeschichte. Um gestörte Entwicklung verstehen zu können, müssen Erkenntnisse zur normalen Entwicklung vorhanden sein. Gleichzeitig können Erkenntnisse über gestörte Entwicklungsverläufe zum Verständnis der normalen Entwicklung beitragen. Dazu sollen interdisziplinär Erfahrungen aus der klinischen Psychologie, der Entwicklungspsychologie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammengebracht werden. Ziele der Entwicklungspsychopathologie: 1. Untersuchung des normalen und abweichenden Entwicklungsverlaufs 2. Suche nach biologischen, psychologischen und sozialen Ursachen der Störungen 3. Identifikation von Risiko- und Schutzfaktoren 4. prospektive Betrachtung abweichenden Verhaltens (Kontinuität, Diskontinuität) Die zeitgemäße klinische Kinder- und Jugendpsychologie versucht also, evidenzbasierte Präventions- und Interventionsansätze zu entwickeln und diese einzusetzen, um auch gefährdeten Kindern eine relativ normale Entwicklung zu ermöglichen. Grundmechanismen und Modelle psychopathologischer Entwicklung Organisation und Reorganisation Die biologischen und Verhaltenssysteme jedes einzelnen sind nach der Organisationspersepektive in charakteristischer Weise organisiert. Im Laufe der Entwicklung kommt es zu Lern- und genetisch bedingten Reifungsprozessen, die zu Differenzierungen des biologischen, sozialen und kognitiven Systems führen. Diese Bereiche ergeben ein organisiertes Ganzes. Daraus ergibt sich die Grundlage von Vulnerabilität und Resilienz. Innerhalb der Organisationsstrukturen bleiben sowohl stark entwickelte als auch instabile Bereiche erhalten, auch wenn sie aktuell nicht beobachtbar oder verhaltensleitend sind. Unter besonders stressreichen Bedingungen mit erhöhten Bewältigungsanstrengungen kann eine regressive Aktivierung der instabilen Bereiche für Symptome gestörter Entwicklung sorgen. Entwicklungspfadmodelle Basieren auf dem Ansatz der Organisationsperspektive. Das Fortschreiten der Entwicklung ist genetisch determiniert und das Erreichen höherer Entwicklungsstufen geschieht relativ unabhängig davon, ob frühere Entwicklungsaufgaben erledigt wurden. Das heißt, Inkompetenzen in der Bewältigung müssen sich nicht sofort zeigen, sondern können auch eine spätere mangelnde Funktionsfähigkeit begünstigen. Ein dadurch wahrscheinlicher werdender negativer Entwicklungsverlauf kann aber jederzeit noch durch die Verbesserung der inneren und äußeren Umwelt abgewendet werden. Das Modell der Entwicklungspfade liefert eine Beschreibung potenziell möglicher Entwicklungsrichtungen, die zu jeder Zeit von biologischen, genetischen und sozialen Erfahrungen gelenkt werden. Die fünf Hauptannahmen: 1. Psychopathologie entsteht aus Fehlanpassungen, die das Individuum auf einen Entwicklungspfad lenken, der zu einer Störung führt. 2. Das Prinzip der Äquifinalität besagt, dass ein bestimmter Entwicklungsausgang über verschiedene Pfade erreicht werden kann. 3. Multifinalität bedeutet, dass ein Entwicklungsausgang über verschiedene Verläufe erreicht werden kann. 4. Eine Veränderung der eingeschlagenen Entwicklungsrichtung ist immer möglich. 5. Langfristig verfolgte fehlangepasste Entwicklungspfade verringern die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs. Psychopathologie kann also als fortschreitende Verzweigung gesehen werden, die das Kind von Pfaden abbringt, die zu kompetentem Verhalten führen. Eine Fehlanpassung wird hier eher als Entwicklungsprozess und nicht als Krankheit gesehen. Entwicklungsmodelle Darstellung der Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt auf einer abstrakteren Ebene. Dispositionsmodelle gehen davon aus, dass die Disposition entscheidend für die Entwicklung von Psychopathologie ist. Es werden z. T. Wechselwirkungen mit der Umwelt, die zum Ausbruch der Störung führen angenommen, z. T. aber auch, dass die Umwelt kaum eine Rolle spielt. Umweltmodelle betonen die Einflüsse des Entwicklungskontextes und der Lernprozesse. Das Individuum und sein Verhalten werden als eine Folge der äußeren Umstände verstanden. Ökologische Modelle postulieren miteinander in Wechselwirkung stehende Systeme, die sich mehr oder weniger direkt auf die Entwicklung des Individuums auswirken. Die unmittelbare Umgebung des Menschen ist der Kernpunkt der Betrachtung, allerdings kann man diese auf verschiedenen Abstraktionsebenen bis hin zum kulturellen Kontext einordnen. Bronfenbrenner geht davon aus, dass verschiedene Umweltvariablen zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich stark auf die Entwicklung des Individuums einwirken. Die verschiedenen Systeme: 1. Mikrosystem: unmittelbare Umgebung des Kindes (Familie) 2. Mesosystem: Beziehungen, die sich aus den Gruppenzugehörigkeiten des Mikrosystems ergeben 3. Exosystem: Dinge, die sich indirekt auf die Entwicklung des Kindes auswirken (Gefüge der sozialen Unterstützung der Eltern, Peergroup der Geschwister) 4. Makrosystem: politisches System, Ökonomie, Kultur (also auch Normen und Werte und damit die Entscheidung, ob die Entwicklung normal oder pathologisch ist) Es handelt sich um ein „Goodness-of-fit“- Modell, bei dem von einer Interaktion zwischen Kind und Unwelt ausgegangen wird (also das Kind beeinflusst auch seine Umwelt). Risiko- und Schutzfaktoren psychopathologischer Entwicklung Risikofaktorenforschung Zuerst muss geklärt werden, ob es eine statistisch signifikante Korrelation zwischen der psychischen Störung und dem Risikofaktor gibt. Allerdings ist dann natürlich nicht entschieden, ob es wirklich ein Risikofaktor ist oder Konsequenz bzw. Begleiterscheinung. Es könnte auch einen dritten Faktor geben, der sowohl Störung als auch den „Risikofaktor“ verursacht hat. Um als Risikofaktor zu gelten, muss er zeitlich vor der Störung auftreten (Jaja, correlation does not prove causation und so…). Außerdem muss die Störungshäufigkeit mit der Veränderung der Exposition variieren (also muss in einer Gruppe, die dem Faktor intensiver ausgesetzt ist, die Störung häufiger auftreten). Der Risikofaktor teilt also die Bevölkerung in eine Hoch- und eine Niedrigrisikogruppe. Der Faktor „Verlust einer wichtigen Bezugsperson in den letzten 5 Jahren“ könnte die Bevölkerung z.B in Gruppen mit hohem und niedrigem Depressionsrisiko aufteilen. Neben kausalen Risikofaktoren gibt es noch die festen Marker, unveränderliche Eigenschaften wie Geschlecht oder Geburtsjahr, die nicht manipuliert werden können aber trotzdem mit der Störung korrelieren. Man kann neben den Risikofaktoren für das Auftreten von Störungen noch Risikofaktoren für die Persistanz der Störung und für einen Rückfall zur Störung untersuchen. Bisher gefundene Risikofaktoren Tabelle Seite 18 mit Faktoren (tippe ich nicht ab, sind auch die üblichen) Es wurden hauptsächlich unspezifische Faktoren gefunden. Prä- und perinatale Faktoren haben scheinbar nur schwache Einflüsse (Längsschnittsstudien). Psychosoziale Einflüsse sind oft hoch konfundiert. Man sollte zwischen Prozessen und Indikatoren risikoreicher Entwicklung unterscheiden; z.B. wäre ein Indikator ein zerrüttetes Elternhaus, während der Prozess, der die Störung vermittelt, in häufigen Streits in der Familie zu entdecken ist. Es wurden insgesamt wenige spezifische kausale Risikofaktoren für spezifische Störungen gefunden, so dass man meist von multifaktorieller Verursachung ausgeht. Ein weiterer wichtiger Beitrag zum Verständnis der Wirkung von Risikofaktoren ist die Analyse der Einflüsse von Expositionszeitpunkt, -dauer, und -intensität; z.B. ist der Kontakt zu kriminellen Peers Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer antisozialen Persönlichkeit, aber nur, wenn er im frühen Jugendalter stattfindet. Zur Intensität ist zu sagen, dass die meisten Kinder mit einem einzelnen Risikofaktor umgehen können, aber sich oft Störungen zeigen, wenn diese kumuliert auftreten (was häufig der Fall ist; die Wahrscheinlichkeit für weitere Risikofaktoren steigt, wenn man bereits einem ausgesetzt ist). In einer Studie an Achtjährigen zeigte sich das einfache Prinzip: Je mehr Risikofaktoren, desto häufiger zeigten sich Erkrankungen. Schutzfaktorenforschung Schutzfaktoren sind Einflüsse, die potenziell schädliche Auswirkungen von Belastungen ausgleichen können. Sie können die Manifestation einer Störung verzögern, abmildern oder verhindern. Beispiele: Temperament, Eltern-Kind-Interaktion, Schulleistung, Selbstwirksamkeit, weniger Stress, / mehr Unterstützung Methodenkritisch ist anzumerken, dass es an einer genauen Definition eines Schutzfaktors mangelt und oft einfach das Fehlen oder Gegenteil von Risikofaktoren zum Schutzfaktor erklärt wird. Anforderungen an einen Schutzfaktor (Versuch einer Definition): a) Schutzfaktoren dürfen nicht lediglich einem Risikofaktor entgegengesetzt definiert werden. Es muss also kontrolliert werden, ob Kinder mit besserem Entwicklungsverlauf diesen nicht nur aufgrund einer geringeren Risikobelastung haben. b) Schutzfaktoren müssen sich speziell auf bestimmte Risikofaktoren auswirken, deren Einfluss sie verringern oder verhindern. Sie sollten also nur zum Tragen kommen, wenn auch ein bestimmtes Risiko vorliegt und nicht zu einer generell besseren Entwicklung führen. c) Zeitlich muss der Schutzfaktor vor dem Risikofaktor auftreten, da er dessen Wirkung abschwächt oder verhindert. d) Entwicklungsergebnis und vermeintlich schützendes Merkmal dürfen nicht auf derselben Dimension erhoben werden, da man sonst die Stabilität des Merkmals erfasst. Vulnerabilität und Resilienz Disposition als genetisch bedingte Empfänglichkeit für eine Krankheit im Gegensatz zu einer durch psychosoziale Einflüsse, Drogen, physikalische Einwirkungen erworbenen Vulnerabilität. Beide begünstigen das Auftreten einer Störung. Demgegenüber steht die Resilienz, die auf das Schutzfaktorenkonzept zurückgeht. Personen gelten als resilient, wenn sie sich recht schnell und aus eigener Kraft von Störungen erholen oder wenn sie stark risikobelastete Lebensabschnitte ohne psychische Erkrankungen überstehen. Auch dieses Konzept ist umstritten. Da kein Faktor sicher zu einer Erkrankung führt, beweist eine Nichterkrankung unter Risikoeinfluss keine besonderen Schutzfaktoren. Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen Untersuchung der Verteilung von Krankheiten oder gesundheitsrelevanten Zuständen bzw. Ereignissen in Bevölkerungsgruppen. Grundbegriffe der Epidemiologie Die despriptive Epidemiologie beschäftigt sich mit der räumlichen und zeitlichen Verteilung psychischer Störung in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Wichtige Begriffe sind hier Prävalenz und Inzidenz (kennen wir ja). Die Prävalenz ist abhängig vom Erkrankungsrisiko, von der Inzidenz, der Krankheitsdauer und der Lebenserwartung. Bei Studien, die die Prävalenz erfassen, sollte darauf geachtet werden, dass sie den wichtigsten methodischen Ansprüchen an epidemiologische Studien genügen (z.B. Stichprobengröße, erfasste Zeiträume). Die Inzidenz kann nur mit mindestens 2 Messzeitpunkten erfasst werden (Längsschnitt) und ist vom Beobachtungszeitraum, der Anzahl der Neuerkrankten und der Ausgangsstichprobe abhängig. Die analytische Epidemiologie untersucht die Frage nach den Ursachen der ermittelten Krankheitsverteilung. Hier werden Risiken für eine Erkrankung ermittelt, wobei Risiko die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, mit der eine Person innerhalb eines definierten Zeitraums an einer bestimmten Störung erkranken wird. Der einfachste Fall ist der Vergleich des Risikos einer einem Risikofaktor exponierten Gruppe mit dem Risiko einer nicht exponierten Gruppe. Die Auswertung solcher Vergleiche erfolgt unter anderem mit dem Odds Ratio. Fragestellungen der Entwicklungsepidemiologie - Wie häufig sind Störungen im Kindes- und Jugendalter? 6-Monats-Prävalenz: 15-22 % - Welche Störungen? Angststörungen, aggressiv- dissoziale Störung, hyperkinetische Störung, Depression - Komorbidität? Ähnlich hoch wie bei Erwachsenen (ca. 50%); besonders oft Depression und Angst sowie hyperkinetisch und dissozial Wie verändern sich Häufigkeiten und Erscheinungsformen psychischer Störungen in Abhängigkeit vom Geschlecht und im Verlauf der Entwicklung? Die Inzidenz nimmt vom Kindergartenalter bis zur Jugend stetig zu; besonders bei den internalisierenden Störungen (Essstörung, Depression). Angststörungen nehmen eher ab, wobei erst mit dem Beginn der Jugend soziale Phobien das Spektrum erweitern. Die Häufigkeit externalisierender Störungen steigt bis in die Jugend an und lässt dann nach. Bis zum Alter von 13 Jahren sind häufiger Jungen von Störungen betroffen (vor allem externalisierende), wobei sich die Raten in der Jugend dann angleichen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Verteilung der Störungen nehmen mit steigendem Alter zu. Mädchen zeigen sehr viel Persistenz bei emotionalen Störungen, aber nicht bei Verhaltensstörungen. Bei Jungen ist es genau umgekehrt. Außerdem sind Jungen deutlich öfter von Entwicklungsstörungen, Lernstörungen und Intelligenzminderung betroffen. Wie stabil sind Störungen in Kindheit und Jugend und im Übergang zum Erwachsenenalter? Die Persistenzrate beträgt etwa 50 %, was dafür spricht, dass es sich nicht um entwicklungsbezogene, vorübergehende Phänomene handelt, sondern um ernstzunehmende Störungen. Sind die Störungen überdauernd und betreffen wichtige Entwicklungsphasen, steigt die Chance, dass die Kinder oder Jugendlichen keine mit anderen Jugendlichen vergleichbaren Bewältigungsstrategien entwickeln und auch im weiteren Leben nicht dasselbe Funktionsniveau erreichen können.