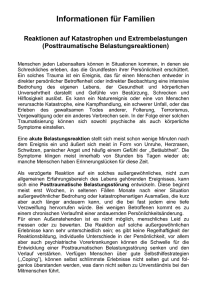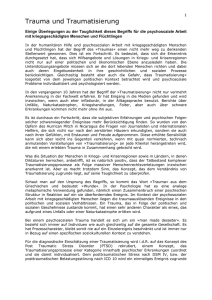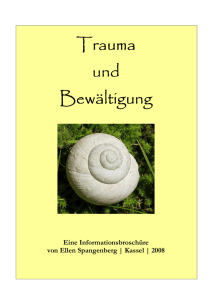Volker Dittmar
Werbung
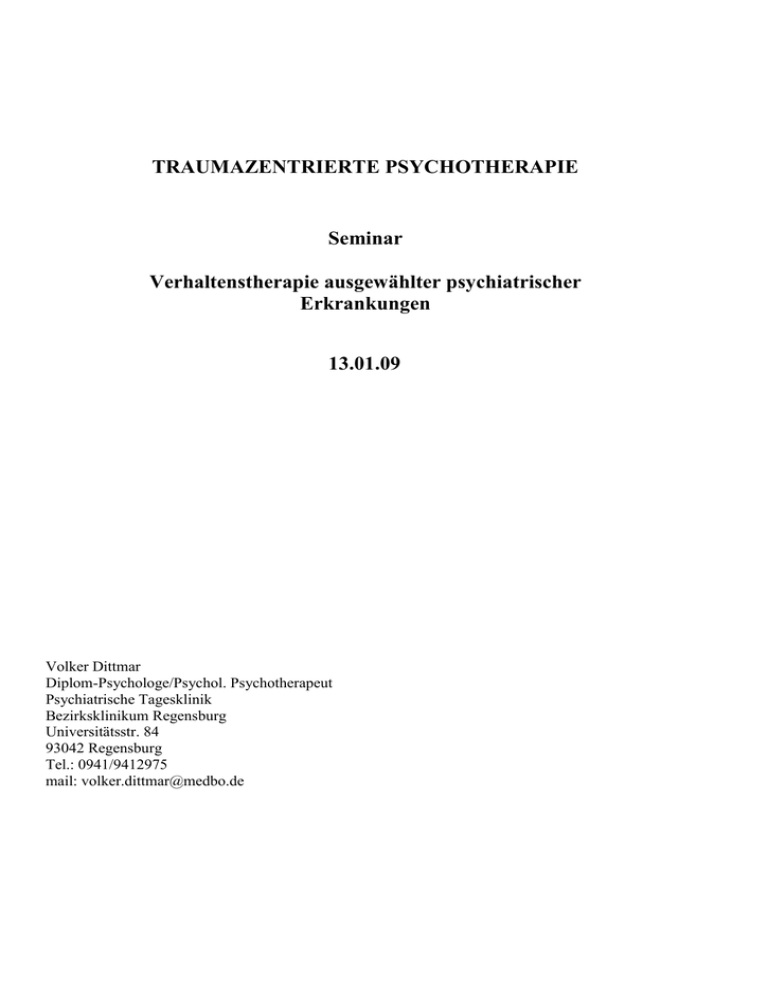
TRAUMAZENTRIERTE PSYCHOTHERAPIE Seminar Verhaltenstherapie ausgewählter psychiatrischer Erkrankungen 13.01.09 Volker Dittmar Diplom-Psychologe/Psychol. Psychotherapeut Psychiatrische Tagesklinik Bezirksklinikum Regensburg Universitätsstr. 84 93042 Regensburg Tel.: 0941/9412975 mail: [email protected] TRAUMAZENTRIERTE PSYCHOTHERAPIE Gewalttaten verbannt man aus dem Bewusstsein – das ist eine normale Reaktion. Bestimmte Verletzungen des Gesellschaftsvertrages sind zu schrecklich, als dass man sie laut aussprechen könnte: Das ist mit dem Wort „unsagbar“ gemeint. Doch Gewalttaten lassen sich nicht einfach begraben. Dem Wunsch, etwas Schreckliches zu verleugnen, steht die Gewissheit entgegen, das Verleugnung unmöglich ist. Viele Sagen und Märchen berichten von Geistern, die nicht in ihren Gräbern ruhen wollen bis ihre Geschichten erzählt sind. Mord muss ans Tageslicht. Die Erinnerung an furchtbare Ereignisse und das Aussprechen der grässlichen Wahrheit sind Vorbedingungen für die Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ordnung, für die Genesung der Opfer. „Die unter extremen emotionalen Bedingungen gemachten Erfahrungen werden anders als andere nichttraumatische Erlebnisse im Gedächtnis abgespeichert. Da die Erfahrungen nicht in den vorhandenen Erfahrungsschatz des Individuums integriert werden können, kommt es zu einer Desintegration und Fragmentierung des Bewusstseins. Die Erfahrungen werden in dissoziierter fragmentierter Form abgespeichert. Die dissoziierten fragmentierten Anteile entziehen sich dann oft dem persönlichen Bewusstsein. Für traumatisierte Menschen ist das traumatische Ereignis nicht „bewusst“ geworden. Bewusst werden bedeutet, das Ereignis in Worte zu fassen, es als Begebenheit zu erzählen, die Erfahrung innerhalb der eigenen Person zu versöhnen und dadurch die Kontinuität der eigenen Geschichte wieder herzustellen.“ Dieser Text könnte in jedem neuen Lehrbuch über Psychotraumatologie oder posttraumatische Belastungsstörungen stehen. Er stammt jedoch aus dem Jahre 1889 von Pierre Janet aus „L’Automatisme Psychologique“. Freud und Janet stießen mit ihren Forschungen insgesamt am weitesten in die unbekannte Wirklichkeit vor. Mit der Entdeckung, dass sexueller Missbrauch in der Kindheit eine Wurzel der Hysterie war, überschritt Freud allerdings zu seiner Zeit die äußersten Grenzen gesellschaftlicher Glaubwürdigkeit. In einem Vortrag über die Ätiologie der Hysterie gehalten 1896 und in seinen gesammelten Werken veröffentlicht, schreibt Freud „ich stelle also die Behauptung auf, zugrunde jedes Falles von Hysterie befinde sich – durch die analytische Arbeit reproduzierbar trotz des Dezennien umfassenden Zeitintervalls - eine oder mehrere Erlebnisse von vorzeitiger sexueller Erfahrung, die der frühesten Jugend angehören.“ Freud stellte also die Hysterie als Resultat von sexuellem Kindesmissbrauch dar. Dieser Vortrag gilt als Ursprung der Überlegungen, dass psychische Symptome das Resultat traumatischer Erfahrungen sein können. Freuds Entdeckung konnte keine Anerkennung finden, so lange ein politisches und gesellschaftliches Umfeld fehlte, das die Erforschung der Hysterie unterstützte, gleichgültig zu welchen Ergebnissen man dabei kam. Ein solches Umfeld hatte es in Wien nie gegeben und in Frankreich löste es sich rasch auf. Freuds Kollege Janet, der seine Traumatheorie der Hysterie nie aufgab und immer zu seinen hysterischen Patientinnen hielt, musste erleben wie seine Arbeiten vergessen und seine Ideen missachtet wurden. Nachdem vor allem in den USA, aber auch in Japan die Forschung an Holocaust-Opfern bzw. an den Opfern des Atombombenabwurfs ähnliche Ergebnisse über Traumatisierungen brachte, kam es nach dem Vietnamkrieg zum endgültigen Durchbruch in der Traumaforschung. Nachdem ca. 1 Million damals gesunder weißer Mittelklasse-Amerikaner, die mit Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet waren, traumatisiert aus dem Krieg zurückgekehrt waren und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten, wurde die Existenz und die Erforschung von Traumatisierungen endgültig gesellschaftsfähig. Zusätzlich war ab 1975 auch die Beschäftigung mit innergesellschaftlicher Gewalt gegen Frauen als Folge zunehmender Emanzipationsbemühungen der Frauen möglich geworden. Auch die 2 Auswirkungen von Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit konnten schließlich genauer betrachtet werden, so dass 1993 erstmalig das „International Handbook of Traumatic Stress Syndromes“ erscheinen konnte. Nachdem also deutlich geworden war, dass die Überlebenden aus Konzentrations- und Vernichtungslagern ganz spezifische Symptome zeigten, entdeckte man, dass auch die Opfer von sexueller Gewalt ein vergleichbares psychisches Störungsbild aufwiesen. Diese verschiedenen klinischen Beobachtungen führten zu der Annahme, dass es nach dem Erleben von Extremsituationen ein gemeinsames klinisches Bild von posttraumatischen Belastungsstörungen gibt. Im Jahr 1980 hat die American Psychiatric Association die posttraumatische Belastungsstörung in ihr Krankheitsklassifikationssystem (DSM-III) aufgenommen, um dem inzwischen gewonnenen klinischen Wissen Rechnung zu tragen. Seit den frühen 90-er-Jahren ist die Diagnose auch im ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation vertreten. Die fünf Hauptkriterien der posttraumatischen Belastungsstörung sind: Erlebnis eines Traumas – wird auch als Ereigniskriterium bezeichnet: „Die Person erlebte oder beobachtete ein oder mehrere Ereignisse, in der eine potentielle oder reale Todesbedrohung, ernsthafte Verletzung oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit bei sich oder anderen geschah. Die Person reagierte mit Furcht, Hilflosigkeit oder Schrecken.“ Intrusionen (=unwillkürliche belastende Erinnerungen an das Trauma) Vermeidungsverhalten und allgemeiner emotionaler Taubheitszustand anhaltendes physiologisches Hyperarousal (=Übererregung) die Symptome dauern länger als einen Monat Das letztgenannte Kriterium weist darauf hin, dass die zeitlich unmittelbaren psychischen Folgen nach einem traumatischen Ereignis (nach Stunden bzw. einigen Tagen) nicht als posttraumatische Belastungsstörungen aufgefasst werden. Sie werden hingegen als akute Belastungsreaktion oder akute Belastungsstörung diagnostiziert. Traumadefinition Im ICD-10 werden als Traumen „kurz oder lang anhaltende Ereignisse oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei Jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würden“ definiert. Im DSM-IV heißt es: „potentielle oder reale Todesbedrohungen, ernsthafte Verletzungen oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit bei sich oder anderen auf die mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Schrecken reagiert wird“. Deistler und Vogler (2002) verstehen unter einem psychischen Trauma „das Ergebnis psychischer Prozesse, die auf ein traumatisierendes Ereignis folgen. Traumatische Erfahrungen sind mit Ereignissen verbunden, die außerhalb des Rahmens normaler menschlicher Erfahrungen liegen und die für fast jeden Menschen seelisch belastend und qualvoll sind. Wenn also eine Erfahrung so extrem und existentiell bedrohlich ist, dass unsere 3 normalen psychischen Schutzmechanismen nicht mehr ausreichen, um dieses Erlebnis zu bewältigen und zu verarbeiten, entsteht ein psychisches Trauma“. Fischer und Riedesser (1999) sprechen in ihrem Lehrbuch der Psychotraumatologie von einem „vitalen Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einher geht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“. Klassifikation von Traumen Die vielen unterschiedlichen traumatischen Ereignisse auf die solche Definitionen zutreffen, lassen sich nach verschiedenen Kriterien zusammenstellen bzw. einteilen. Bewährt haben sich Einteilungen nach menschlich verursachten versus zufälligen Traumen und nach kurzversus langfristigen Traumen. menschlich verursachte Traumen („man made disasters“) - sexuelle und körperliche Misshandlungen in der Kindheit - kriminelle und familiäre Gewalt - Vergewaltigungen - Kriegserlebnisse - zivile Gewalterlebnisse, z. B. Geiselnahme - Folter und politische Inhaftierung - Massenvernichtung (KZ, Vernichtungslagerhaft) Katastrophen, berufsbedingte und Unfalltraumen - Naturkatastrophen - technische Katastrophen z. B. Giftgaskatastrophen - berufsbedingte (z. B. Militär, Polizei, Feuerwehr) - Arbeitsunfälle, z. B. Grubenunglück - Verkehrsunfälle Für weitere schwere Lebensereignisse wie z. B. schwere Erkrankungen oder Suicide in der Familie, die nicht oder nur schlecht in diese Einteilung passen, wird diskutiert, ob sie als Traumen im Sinne der Definition des Störungskonzeptes aufgefasst werden sollten oder ob für sie eine eigene Kategorie gefunden werden sollte. Dies gilt besonders für lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs, Aids oder den Ausfall eines Organs oder Körperteils, da diese Krankheiten oftmals von typischen posttraumatischen Symptomen begleitet werden. kurzdauernde traumatische Ereignisse (Typ-I-Traumen) - Naturkatastrophen - Unfälle - technische Katastrophen - kriminelle Gewalttaten wie Überfälle, Schusswechsel. Die Typ-I-Traumen sind häufig durch akute Lebensgefahr, Plötzlichkeit sowie Überraschung gekennzeichnet. 4 längerdauernde wiederholte Traumen (Typ-II-Traumen) - Geiselhaft - wiederholte Folter - Kriegsgefangenschaft - KZ-Haft - wiederholte sexuelle oder körperliche Gewalt in Form von Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung sowie wiederholten Vergewaltigungen. Die Typ-II-Traumen sind durch Serien verschiedener traumatischer Einzelereignisse und durch geringe Vorhersagbarkeit des weiteren traumatischen Geschehens gekennzeichnet. Für alle genannten Traumen sind die gleichen psychischen Symptome beschrieben worden wie sie in den Hauptkriterien der posttraumatischen Belastungsstörung definiert wurden (Intrusionen, Vermeidung, emotionale Taubheit, Hyperarousal). Allerdings hat sich heraus gestellt, dass einerseits die willentlich durch Menschen verursachten Traumen und andererseits die zeitlich länger andauernden Typ-II-Traumen in vielen Fällen zu stärkerer Beeinträchtigung und chronischeren psychischen Folgen führen können als die anderen Formen. So gelten Folter, wiederholter Missbrauch oder Vergewaltigung sowie Geiselhaft zu den Ereignissen, die mit deutlich überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit zu lang anhaltenden Traumafolgestörungen führen. Die drei Hauptsymptomgruppen der posttraumatischen Belastungsstörung nämlich Intrusion, Vermeidung und Hyperarousal können jeweils in Form sehr vieler unterschiedlicher Einzelsymptome bzw. Einzelbeschwerden auftreten. Intrusionen sind wiederkehrende und belastende Erinnerungen an das schreckliche Erlebte. Sie werden auch als Nachhallerinnerungen oder Flashbacks bezeichnet und können in sehr unterschiedlicher Form auftreten. Vermeidung bedeutet, die Betroffenen versuchen oft mit aller Macht, die sie überflutenden Gedanken „abzuschalten“, d. h., nicht mehr an das Geschehene zu denken. Auch kann möglicherweise extremes Bemühen oder bestimmte automatisierte Einstellungen, die bedrängenden Erinnerungen abzuschalten, zu dissoziativen Zuständen sowie Teilamnesien führen. Verknüpft mit den Vermeidungssymptomen ist das emotionale Betäubungsgefühl. Die Betroffenen beklagen eine Gefühlseinschränkung, so dass die Erinnerung an ein traumatisches Ereignis manchmal nur als kognitive Erinnerung bestehen bleibt. Unter Betäubungsgefühlen versteht man auch das anhaltende Gefühl der Entfremdung von anderen Menschen, den allgemeinen sozialen Rückzug, das Gefühl der eingeschränkten Zukunft. Hyperarousal bedeutet, die Erregungsschwelle des autonomen Nervensystems senkt sich, d. h. Belastungen wirken früher und nachhaltiger. Der Körper ist sozusagen noch dauernd im „Alarmzustand“. Tabelle 1 , angelehnt an Maercker (2003) beschreibt diese Symptome analog der Reihenfolge in der sie im DSM aufgelistet sind. 5 Einzelsymptome der posttraumatischen Belastungsstörung Kurzbezeichnung Erläuterungen (an DSM-IV angelehnt) Intrusionen/ Wiedererleben Ungewollt wiederkehrende und belastende Erinnerungen oder Erinnerungsbruchstücke, treten spontan auf (außer wenn durch Schlüsselreize hervorgerufen). Ihre Intensität reicht von Einzelerinnerungen bis zum Überwältigtwerden von der Erinnerung. Belastende Träume bzw. Alpträume Wiederkehrende Träume, die Erinnerungen oder Erinnerungsbruchstücke des Traumas beinhalten. In Alpträumen können die Erinnerungen sehr verzerrt sein. Verlaufen oft jahrelang nach dem gleichen Muster. Erinnerungsattacken Engl. »flash-backs«. Erinnerungsattacken, die durch die Plötzlichkeit und Lebendigkeit gekennzeichnet sind. Sind meist nur kurzdauernd und gehen mit dem Gefühl einher, das traumatische Ereignis noch einmal zu durchleben. Nähe zu Illusionen, Halluzinationen und dissoziativen Verkennungszuständen. Belastung durch symbolisierte Auslöser Schlüsselreize wie gleiche Gegenstände, Geräusche, Düfte rufen regelmäßig belastende Erinnerungen an das Trauma wach. Zu den Schlüsselreizen gehören auch Jahrestage und Darstellungen des Schicksals anderer (z. B. im Film). Physiologische Reaktionen bei Erinnerung Unwillkürliche Körperreaktion wie Schwitzen, Zittern, Atembeschwerden, Herzklopfen oder –rasen, Übelkeit, MagenDarmbeschwerden oder starke Ängste beim plötzlichen Konfrontiertwerden mit traumatischen Schlüsselreizen sowie Erinnerungen bzw. Erinnerungsbruchstücke. Gedanken- und Gefühlsvermeidung Bewusstes Vermeiden von Gedanken und Gefühlen, die an das Trauma erinnern (z. B. eigene Gedankenstoppversuche bzw. Selbstkommentare: »Ich mache mich sonst nur selbst verrückt«). Unabhängig vom Erfolg der Vermeidungsbemühungen. Aktivitäts- oder Situationsvermeidung Phobisches Vermeiden von Aktivitäten oder Situationen, die Erinnerungen an das Trauma bewirken (z. B. Ort des Traumas umgehen; nicht mehr aus dem Haus gehen zur Tageszeit, an dem das Trauma passierte). (Teil-) Amnesien Wichtige Elemente des traumatischen Geschehens können nicht mehr erinnert werden (z. B. von Ort x nach Ort y gekommen zu sein). Im Extremfall kann das ganze traumatische Geschehen nicht mehr erinnert werden; es herrschen nur unscharfe Erinnerungen oder Erinnerungsbruchstücke vor. Die Amnesien dürfen nicht durch einfache Vergesslichkeit oder durch organische Ursachen (z. B. Schädelhirntrauma) erklärbar sein. Interesseverminderung Deutlich vermindertes Interesse an wichtigen Aktivitäten des täglichen Lebens oder an individuell vor dem traumatischen Erlebnis gern ausgeführten Aktivitäten (z. B. Karrierebemühungen, Hobbys). 6 Erläuterungen (an DSM IV angelehnt) Entfremdungsgefühl Gefühl der Losgelöstheit oder Fremdheit von anderen Personen, die nicht das gleiche traumatische Ereignis erlebt haben. Subjektiv unüberwindlich empfundene Kluft zwischen den anderen und einem selbst (und entsprechenden Leidensgefährten). Selbst Familienmitgliedern gegenüber herrscht das Entfremdungsgefühl vor. Eingeschränkter Affektspielraum Empfindung, dass das Trauma das eigene Gefühlsleben zerstört hat, z. B. die Fähigkeit jemanden zu lieben, sich zu freuen aber auch die Fähigkeit zu Trauer oder Mitleid. Die Betroffenen fühlen sich wie erstarrt oder wie abgestumpft. Eingeschränkte Zukunft Sowohl das Gefühl, dass nichts Wichtiges mehr im eigenen Leben passieren kann, als auch das Gefühl, das Trauma bzw. seine Verursacher haben Jahre (oder »die beste Zeit«) des Lebens zerstört und diese können nie wieder ersetzt werden. Zukunftspläne werden nicht mehr gemacht. Ein- und Durchschlafschwierigkeiten Nach dem Trauma einsetzende Schlafstörungen beider Arten, teilweise – aber nicht notwendigerweise – im Zusammenhang mit Intrusionen bzw. belastenden Träumen oder Alpträumen. Erhöhte Reizbarkeit Leichtes »auf 180« kommen, oftmals Wutausbrüche, wozu vor dem Trauma noch keine Neigung bestand. Kann oft von den Betreffenden schlecht selbst beurteilt werden und ist nur indirekt über die Frage »Würden Ihre Angehörigen das so sehen« zu explorieren. Konzentrationsschwierigkeiten Ausgeprägte Schwierigkeiten, sich auf einfache Abläufe zu konzentrieren (z. B. Buch lesen, Film sehen, Formular ausfüllen). Den Betroffenen kann klar oder auch selbst unklar sein, dass sie in solchen Momenten intrusive Erinnerungsschübe haben. Übermäßige Wachsamkeit Fachwort: Hypervigilanz: ständiges Gefühl des Nicht-TrauenKönnens. Fortdauerndes und unrealistisches Gefährdungsgefühl. Kann (nach durch Menschen verursachten Traumen) dazu führen, dass Waffen zur möglichen Verteidigung mitgeführt werden bzw. Überwachungseinrichtungen installiert werden. Übermäßige Schreckreaktion Nach dem Trauma vorhandene, sehr leichte Erschreckbarkeit, die schon durch leichte Geräusche und Bewegungen ausgelöst werden kann. 7 Eine traumatische Erfahrung geht also stets einher mit dem Erleben intensiver Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das für ein pychisches Trauma typische Erleben von absolutem Kontrollverlust entsteht, wenn eine Situation durch drei gleichzeitig auftretende Faktoren gekennzeichnet ist, nämlich: 1. Informationsüberflutung mit aversiven Reizen 2. keine Möglichkeit der Gegenwehr 3. keine Fluchtmöglichkeit. Das Trauma wirkt als unterbrochene Handlung, die nicht zum Ziel führt, aber innerlich vegetativ aufgrund einer Höchstalarmstufe Stresshormone hervor ruft, das Zeitempfinden ausdehnt sowie zu einer chronischen Muskelanspannung führt. In bedrohlichen Situationen sind wir, wie andere Säugetiere, biologisch gut darauf vorbereitet, uns entweder zu wehren („fight“) oder die Flucht zu ergreifen („flight“). Ist jedoch keine der beiden Reaktionen erfolgversprechend, bleibt uns nur die Möglichkeit des Totstellens, der Erstarrung („freeze“) bzw. das innere Aussteigen aus der Situation (peritraumatische Dissoziation). „Freeze“ bedeutet Einfrieren, gemeint ist eine Lähmungsreaktion. Es ist als ob das Gehirn sich sagt: Ich bringe den Organismus nicht aus der Situation heraus und ich kann den aggressiven Reiz nicht niederringen, also muss ich genau dies intern tun. Ich mache den aggressiven Reiz unschädlich und erlaube dem Organismus, sich innerlich davon zu distanzieren. Eine Flut von Endorphinen hilft diesem „geistigen Wegtreten“ und der Neutralisierung akuter Todesangst. Oft bedeutet die Freeze-Reaktion nichts anderes als eine Entfremdung vom Geschehen. Zusätzlich zum Freeze kommt noch das Mittel des Fragmentierens hinzu. Die Erfahrung wird zersplittert und diese Splitter werden so weg gedrückt, dass das äußere Ereignis nicht mehr zusammenhängend wahrgenommen oder erinnert werden kann. 8 Erscheinungsbild der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung: Symptome und Symptomkonstellationen der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (zusammengefasst und modifiziert nach Herman, 1992) Kurzbezeichnung Erläuterungen (an DSM-IV angelehnt) Gestörte AffektKeine Feinabstufung der Gefühlsausdrücke möglich. Leichte und Impulsregulation Erregbarkeit in zwischenmenschlichen Situationen und Kommunikationen. Ärger und Zorn dominiert. Eigene selbstzerstörerische Tendenzen (z. B. erhöhte Suizidneigung). Dissoziative Tendenzen Anhaltende Aufmerksamkeitsstörungen und wiederholte psychogene Bewusstseinstrübungen. Häufige Amnesien und zeitweises Depersonalisationserleben. Somatisierungsstörungen und körperliche Erkrankungen Häufige psychogene Beeinträchtigungen bzw. manifeste Krankheiten, z. B. Verdauungsstörungen, chronische Schmerzen, kardiopulmonale Symptome, Konversionssymptome und gestörte Sexualität. Beeinträchtigtes Identitätsgefühl Ausgeprägte Überzeugung, ein beschädigtes Leben zu führen, das nicht mehr zu reparieren ist bzw. ausgeprägte Überzeugungen, im Leben etwas falsch gemacht zu haben, dafür verantwortlich zu sein. Permanente Schuld- und Schamgefühle anderen Personen gegenüber. Interpersonelle Störungen Gestörte Wahrnehmung des Täters / Angreifers bis hin zu dessen Idealisierung. Exzessive Beschäftigung mit Rachephantasien. Unfähigkeit zur gleichberechtigten partnerschaftlichen Interaktion. Anfälligkeit für überspannte Ansichten. Reviktimisierungsneigung Exzessives Risikoverhalten erzeugt häufige Gefährdungssituationen mit der gleichen Traumatisierungsgefahr (z. B. wieder vergewaltigt zu werden; wieder Gewaltopfer zu werden). Drang, die Plätze zu besuchen, an denen das Trauma geschah und die immer noch gefährlich sein können. Mögliche Tendenz, andere zu Opfern zu machen (z. B. Vergewaltigungsopfer werden später zu Vergewaltigern). Allgemeiner Sinnverlust Verlust früherer Orientierungen, Hoffnungen, Motivstrukturen und persönlichkeitsstabilisierender Überzeugungen. 9 Epidemiologie Epidemiologische Forschungsergebnisse können nicht vom soziokulturellen Kontext sowie den Strömungen des Zeitgeists losgelöst betrachtet werden. So muss man in den epidemiologischen Angaben zu PTB zwischen älteren Zahlen (80-er Jahre) und neueren (90er Jahre) unterscheiden. Vor 1980 geben Untersuchungen noch eine Lebenszeitpraevalenz von 1 bis 2 Prozent für die amerikanische Allgemeinbevölkerung an. Praevalenzraten der neueren internationalen Studien liegen deutlich höher als die früheren Untersuchungen. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 1995 fand eine Lebenspraevalenz von 7,8 Prozent mit einem starken Geschlechtsunterschied, nämlich bei Frauen 10,4 Prozent, bei Männern 5 Prozent. Besonders Vergewaltigung und sexuelle Belästigung stellen für Frauen ein erhebliches Risiko dar, eine Traumatisierung zu erleben. In einer neueren deutschen Studie werden 60 Prozent aller Männer und 50 Prozent der Frauen im Verlaufe ihres Lebens mindestens einmal mit einem Trauma konfrontiert, das die Stressorkriterien der posttraumatischen Belastungsstörung erfüllt (Kessler 1995). Daraus lässt sich folgern, dass die posttraumatische Belastungsstörung eine der häufigsten psychischen Störungen ist. In neueren epidemiologischen Untersuchungen wurde über Lebenszeitpraevalenzen von 8 bis 9 Prozent berichtet. Frauen tragen bei vergleichbarer lebenslanger Traumaexposition ein etwa doppelt so hohes Risiko an einer PTSD zu erkranken. Nicht alle Menschen erkranken nach einem traumatischen Erlebnis. Gemäß einer jüngeren Übersichtsarbeit entwickelt aber immerhin etwa ein Viertel der Betroffenen das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung. Je nach Art des Traumas ist das Erkrankungsrisiko allerdings sehr unterschiedlich. Folter, Kriegsteilnahme, aber auch Vergewaltigung, Misshandlung in der Kindheit und Vernachlässigung in der Kindheit sind die Ereignisse, die das höchste Risiko beinhalten für die Betroffenen an einer PTB zu erkranken. Komorbidität Je nach Untersuchung wird angegeben, dass bei 50 bis 100 Prozent der PTB-Patienten komorbide Störungen vorliegen. Meist haben PTB Patienten mehr als eine weitere komorbide Störung. Auch kommen komplex traumatisierte Menschen nicht mit einer Traumadiagnose in die Behandlung, sondern mit einem bestimmten Syndrom, das dann die einzige Hauptdiagnose zu werden droht. Traumapatienten können daher mit den klaren Symptomen einer depressiven Störung, mit einer Angsterkrankung, einer körperlichen Beschwerdesymptomatik, die sich nach organischer Abklärung als Somatisierungsstörung entpuppt sowie Suchtstörungen, Essstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder sozialen Auffälligkeiten wie selbstverletzendem Verhalten in eine Behandlung kommen. Von Bedeutung ist daher für einen dauerhaften Therapieerfolg die zugrunde liegende Traumastörung festzustellen und in der Diagnose zu benennen. Die Ähnlichkeit einiger Symptome mit psychotischem Erleben hatte vor einigen Jahren dazu geführt, dass nicht wenige Vietnam-Veteranen mit PTB die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie erhielten. Ihre intrusiven Erinnerungsbilder wurden als Halluzinationen bewertet, die erhöhte Wutbereitschaft der ehemaligen Soldaten auf paranoide Ideen zurückgeführt. Erst die Aufnahme der PTB in das DSM-III-Manual hat diese Fehldiagnosen reduziert. Komorbide Störungen bei posttraumatischen Belastungsstörungen können also sein: - Angststörungen Depressionen Suicidalität Medikamenten-, Alkohol- und Drogenmissbrauch oder Sucht Somatisierungsstörungen Herz-/Kreislauferkrankungen. 10 Verlauf Fischer und Ridesser (1999) haben ein allgemeines zeitliches Verlaufsmodell der psychischen Reaktion auf ein traumatisches Ereignis entwickelt, indem sie drei Phasen unterscheiden. 1. Die Schockphase: Sie dauert eine Stunde bis eine Woche. Charakteristisch ist ein Gefühl der Unwirklichkeit, später erfolgt häufig eine Verleugnung. Das Opfer kann nicht glauben was geschehen ist. Kennzeichen der Schockphase sind z. B. die Veränderung des Zeiterlebens oder eine veränderte Wahrnehmung. 2. Die Einwirkungsphase: Sie beginnt einige Zeit nach dem Ereignis und kann bis zu zwei Wochen anhalten. Die stärkste Erregung ist zwar abgeklungen, die Betroffenen sind jedoch von den Ereignissen innerlich völlig in Anspruch genommen. Charakteristisch für diese Phase sind z. B. Ärger, Selbstzweifel, Selbstanklagen, häufig auch Depressionen und Gefühle der Hoffnungslosigkeit, Einschlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen und Intrusionen wie Albträume und Flashbacks. 3. Die Erholungsphase: Nach 14 Tagen, manchmal auch erst nach vier Wochen beginnen sich einige Betroffene vom Trauma zu erholen. Das Interesse am normalen Leben und an anderen Personen kehrt zurück, die Zukunftspläne werden positiver gesehen. In der erfolgreichen Erholungsphase bildet das Trauma für viele Menschen einen Anlass über das bisherige Leben zu reflektieren und ihre Zukunftsplanungen zu überdenken. Fischer und Ridesser schlagen vor, in dieser Zeit Alkohol und Drogen zu vermeiden und sich auch räumlich aus der traumatischen Situation zu entfernen. Bleibt jedoch die dritte Phase aus, besteht die Gefahr, eine posttraumatische Belastungsstörung zu erleiden. Sowohl die intrusiven Wiederholungen als auch die Verleugnung und emotionale Erstarrung können entweder gleichzeitig oder in Phasen nacheinander ablaufen. Eine Zusammenfassung dieser Prozesse findet sich in dem bekannt gewordenen Modell von Horowitz (1997). Der Autor beschreibt in diesem Modell sowohl normale Reaktionsphasen auf eine Traumatisierung, als auch pathologische Reaktionsphasen. Die normale Reaktion ist ein Wechsel zwischen intrusiven und konstriktiven Symptomen, durch deren Durcharbeitung die Integration in die Persönlichkeit gelingen kann. Dann ist das Trauma bewältigt und der Mensch in der Lage, seine Biographie in angemessener und selbstbestimmter Weise fortzusetzen. Die pathologische Reaktion beginnt mit dem Erleben von Überwältigt- und Ausgeliefertsein, die entsprechende Erfahrung kann nicht integriert werden. Intrusive Symptome, wie ständiges Wiedererleben und damit erzwungene Nähe zum Trauma durch flash-backs, Albträume und Panikattacken wechseln mit extremen Vermeidungsverhalten. Die Menschen fühlen sich unfähig, ihr Leben zu kontrollieren, entwickeln weitere Folgestörungen wie Somatisierungs- und Persönlichkeitsstörungen. 11 Normale Reaktion Reaktion Pathologische Ereignis Aufschrei: Angst, Trauer, Wut Überwältigtsein Panikgefühle oder Erschöpfung Abwehr: A Vermeidung, sich den Erinnerungen AAA an das Unglück zu stellen Extreme Vermeidung Intrusionen: ungebetene Gedanken vom Ereignis Überflutung Durcharbeiten: Realität des Geschehenen anerkennen Psychosomatische Reaktionen Abschluß: Fortsetzung des Lebenswegs Persönlichkeitsveränderungen Abb. 1: Das Modell normaler und pathologischer Phasen posttraumatischer Reaktionen nach Horowitz (1997. S 147). 12 Traumareaktionen Ereignisse nach denen besonders schwere Traumareaktionen zu erwarten sind 1. Dauern sehr lange. 2. Wiederholen sich häufig. 3. Lassen das Opfer mit schwereren körperlichen Verletzungen zurück. 4. Sind vom Opfer schwerer zu verstehen. 5. Beinhalten zwischenmenschliche Gewalt. 6. Der Täter ist ein nahe stehender Mensch. 7. Das Opfer möchte (mag) den Täter. 8. Das Opfer fühlt sich mitschuldig. 9. Die Persönlichkeit ist noch nicht gefestigt oder gestört. 10.Beinhalten sexuelle Gewalt. 11.Beinhalten sadistische Folter. 12.Haben mehrere Täter das Opfer zugerichtet 13.Hatte das Opfer starke Dissoziationen 14.Hat niemand dem Opfer unmittelbar danach beigestanden 15.Hat niemand nach der Tat darüber mit dem Opfer gesprochen (Huber 2003) Schutzfaktoren gegen chronische Folgen von Traumatisierungen sind - soziale Unterstützung, - kommunikative Kompetenz, - kohärentes Weltbild. 13 Risikofaktoren Bestimmte Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person nach einem Trauma eine PTSD entwickeln wird. a) Faktoren vor dem traumatischen Ereignis: geringe soziale Unterstützung Schicksalsschläge Armut der Eltern vorherige Misshandlungen in der Kindheit dysfunktionale Familienstrukturen familial-genetische Geschichte psychischer Störungen Introversion oder extrem gehemmtes Verhalten. Geschlecht: weiblich schlechte körperliche Gesundheit vorherige psychische Störung b) Faktoren während des Traumas: Länge und Ausmaß und Wiederholung der traumatischen Einwirkung subjektives Bedrohungsgefühl (z. B. häufig akute Todesangst) andere, damit verbundene Traumata (Zeuge der Misshandlung anderer werden, zum Täter an anderen Opfern werden) c) Faktoren nach dem Trauma mangelnde soziale Unterstützung fortgesetzte negative Lebensereignisse mangelnde Anerkennung des Traumas durch andere sekundäre Stressfaktoren wie Schulwechsel, Umzug, Zerstörung des Zuhauses, wiederholte Bedrohungen, Angst vor dem Täter und finanzielle Probleme (Huber 2003) 14 Beurteilungskriterien für das Vorliegen einer PTB »Wiederkehrende und eindringliche Erinnerungen« Das Symptom liegt vor, wenn sich die Erinnerungen ungewollt – und in der Regel unkontrollierbar – immer wieder aufdrängen und vom Patienten als belastend erlebt werden. Erinnerungen, die willentlich hervorgerufen werden, erfüllen das Kriterium nicht. »Wiederkehrende Träume« Wiederkehrende Träume sind diagnostisch relevant, wenn sie in Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis stehen und den Patienten stark belasten. Alpträume, die in keinem erkennbaren direkten Zusammenhang mit dem traumatischen Erlebnis stehen, erfüllen das Kriterium nicht. »Plötzliches Handeln oder Fühlen, als ob das Ereignis wiederkehre« Hierzu gehören das Gefühl, das traumatische Ereignis noch einmal zu durchleben, Illusionen, Halluzinationen und dissoziationsartige Episoden. Diese Symptome sind zu unterscheiden von wiederkehrenden Gedanken, in denen sich der Patient der Tatsache bewusst ist, dass er das traumatische Ereignis erinnert. »Psychische Belastung bei Ereignissen, die das Trauma symbolisieren oder ihm ähnlich sind, Jahrestage eingeschlossen« Das Symptom liegt vor, wenn die psychische Belastung intensiv ist und den Patienten zumindest kurzfristig in seiner Alltagsbewältigung beeinträchtigt. »Bewusstes Vermeiden von Gedanken oder Gefühlen, die mit dem Trauma assoziiert sind« Das Symptom liegt vor, wenn der Patient bestrebt ist, mit dem traumatischen Ereignis in Verbindung stehende Gedanken oder Gefühle zu vermeiden – unabhängig davon, ob ihm dies tatsächlich gelingt. »Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten oder Situationen, die Erinnerungen an das Trauma bewirken« Das Vermeiden von Aktivitäten oder Situationen, die nicht in Zusammenhang mit dem traumatischen Ereignis stehen, erfüllt das Kriterium nicht. »Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern« Hauptmerkmal der psychogenen Amnesie ist, dass der Patient sich wichtiger Dinge nicht mehr erinnern kann. Die Erinnerungslücken sind zu groß, als dass man sie mit normaler Vergesslichkeit oder Erschöpfung erklären könnte. Organische Ursachen der Unfähigkeit zu erinnern sind auszuschließen. »Deutlich verringertes Interesse an wichtigen Aktivitäten« Die Beurteilung dieses Symptoms erfordert, dass das vor dem traumatischen Ereignis bestehende Interesse an wichtigen Aktivitäten retrospektiv erfasst wird. Das Symptom liegt vor, wenn dass Interesse an objektiv wichtigen Aktivitäten deutlich nachgelassen hat oder vorher subjektiv für den Patienten wichtige Aktivitäten (z. B. Hobby) nicht mehr interessieren. 15 »Gefühl der Losgelöstheit oder Fremdheit von anderen« Das Symptom wird als vorhanden kodiert, wenn nach dem Trauma ein Gefühl der Entfremdung und der sozialen Isolierung erlebt wird. Für die Kodierung als vorhanden ist nicht ausreichend, wenn der Patient meint, nur von einem ähnlichen traumatischen Erlebnis betroffene Personen könnten seine peritraumatischen und posttraumatischen Reaktionen verstehen. »Eingeschränkter Affektspielraum, z. B. Unfähigkeit zu Liebesgefühlen« Das Symptom liegt vor, wenn die Gefühle des Patienten »stumpf«, »erstarrt« sind und der Patient die Gefühle, die er meint ausdrücken zu müssen, nicht ausdrücken kann. Dies schließt die Unfähigkeit zu Liebesgefühlen ein, aber auch die Unfähigkeit zu Trauer oder Mitleid. »Eindruck einer eingeschränkten Zukunft (z. B. keine Karriere, Kinder, Ehe, kein langes Leben« Die Zukunft traumatisierter Personen kann im Vergleich zu der vor der Traumatisierung antizipierten Zukunft tatsächlich eingeschränkt sein, z. B. wenn schwerwiegende körperliche Schädigungen als Folge des traumatischen Ereignisses vorliegen. Das Symptom liegt vor, wenn die Erwartungen des Patienten unrealistisch sind. Das Symptom drückt sich häufig darin aus, dass der Patient keine Zukunftspläne mehr schmiedet. »Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen« Schlafstörungen sind diagnostisch relevant, wenn sie nicht bereits vor dem traumatischen Ereignis in der beobachteten Ausprägung auftraten. »Reizbarkeit, Wutausbrüche« Um das Item beurteilen zu können, muss das prätraumatische Ärgerausdrucksverhalten erfasst werden. Das Symptom liegt vor, wenn Reizbarkeit und Wutausbrüche in der Folge des Ereignisses vermehrt auftraten. »Konzentrationsschwierigkeiten« Konzentrationsschwierigkeiten sind im Zusammenhang mit der vor dem traumatischen Ereignis vorhandenen Konzentrationsfähigkeit zu beurteilen. Organische Ursachen der Konzentrationsschwierigkeiten sind auszuschließen. »Übermäßige Wachsamkeit« Das Symptom liegt vor, wenn der Patient seit seiner traumatischen Erfahrung externen Stimuli mehr Aufmerksamkeit widmet, als für deren realistische Bewertung notwendig wäre. »Übermäßige Schreckreaktionen« Eine übermäßige Schreckhaftigkeit wird als »vorhanden« kodiert, wenn sie in Folge des traumatischen Ereignisses vermehrt auftritt. Schreckreaktionen können nicht selten während der Interviewführung beobachtet werden. »Physiologische Reaktionen (Schwitzen, Zittern etc.) bei Konfrontation mit Ereignissen, die das Trauma symbolisieren oder an Aspekte desselben erinnern« Physiologische Reaktionen können sich in einer Vielzahl von quälenden Symptomen manifestieren: In Atemschwierigkeiten, Herzklopfen oder –rasen, Erstickungs- oder Beklemmungsgefühlen; in Übelkeit oder Magen- und Darmbeschwerden; in Todesangst oder der Angst, etwas Unkontrolliertes zu tun. Das Kriterium ist nicht erfüllt, wenn diese körperlichen Beschwerden nicht in Zusammenhang stehen mit Erinnerungen an das Ereignis oder bestimmte Situationen, die mit dem Ereignis in Beziehung stehen. 16 Neurophysiologische Grundlagen der Traumaverarbeitung Für das Gehirn ist eine lebenslange neuronale Plastizität typisch. Wachstum und Differenzierung von Neuronen und Synapsen und damit eine strukturelle Veränderung neuronaler Netzwerke sind abhängig vom Nutzungsgrad. Besonders prägend sind die frühen Beziehungserfahrungen. Diese erfahrungsabhängige Veränderung der Hirnstruktur ist die Grundlage von Lernen und Gedächtnis. Lernen beginnt bereits im Mutterleib, am prägendsten und damit später am schwersten zu verändern sind die sehr frühen Erfahrungen. Erleben einer unsicheren Bindung an die primären Bezugspersonen und frühe Stresserfahrungen sind Risikofaktoren, die zu psychischen Erkrankungen wie Persönlichkeitsstörungen, aber auch Jahrzehnte später zu somatischen Krankheiten wie koronare Herzkrankheit und chronisch obstruktive Lungenerkrankung disponieren können. Das Stressverarbeitungssystem wird durch frühe unkontrollierbare Stress-Situationen so geprägt, dass daraus lebenslang Einschränkungen der Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit, eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit und Somatisierungstendenz resultieren können. Es gibt verschiedene Gedächtnissysteme: Das explizit-deklarative Gedächtnis ist im medio-frontalen Temporallappen und Hippokampus lokalisiert, umfasst alles, was bewusst gedacht oder gesprochen werden kann. Es enthält zwei Formen: - ein episodisches Gedächtnis, zeitlich und örtlich zugeordnet, mit Bezug zum Selbst und - ein autobiographisches Gedächtnis besonders im präfrontalen Kortex Das implizit-prozedurale Gedächtnis beinhaltet unbewusstes Wissen ohne zeitlich-räumliche Zuordnung oder Zuordnung zum Selbst, nicht verbal, sondern emotional-sensorisch; es ist besonders in Amygdala und Kleinhirn lokalisiert. Im Alltag verarbeiten wir alle Informationen und Sinneseindrücke, auf verschiedenen hierarchischen Ebenen des Gehirns. Sie werden dort nach Wichtigkeit geordnet, gefiltert und ausgewählt. Besonders beteiligt daran ist das Limbische System. Folgende Gehirnzentren sind für die Aufnahme und das Abrufen von Informationen wesentlich: 1. Der Thalamus Er gilt als Schaltstelle mit Filterfunktion für alle eintreffenden sensorischen Sinneseindrücke. 2. Der Hippocampus (Seepferdchen) Er ist für die faktisch-kognitive und räumliche Zuordnung und Kontextualisierung zuständig, dies ist Voraussetzung für die Überführung in das deklarativ-explizite Gedächtnis und die semantisch verfügbaren Erinnerungen. Die Erinnerungen werden dann als zum Selbst gehörig und „damals“ erlebt. 3. Die Amygdala (Mandelkern) Sie beurteilt die emotionale Wichtigkeit oder Bedrohlichkeit einer Information und kann in einer sehr schnellen Schaltung Angst, Flucht und Kampfbereitschaft mobilisieren. 17 4. Der Frontallappen der Großhirnrinde Er sorgt für die Integration der Informationen auf höherer kortikaler und damit bewusster Ebene, ist für die Planung zukünftiger Handlungen und die Aufmerksamkeitsfokussierung zuständig. Besonders der sog. präfrontale Kortex ist über die Hemmung der Amygdala entscheidend für die Stressverarbeitung, Impulskontrolle und jedes Lernen. In traumatischen Situationen wird die hierarchische Informationsverarbeitung unterbrochen. Dies ist evolutionär als äußerst sinnvolle Reaktion in lebensbedrohlichen Situationen zu verstehen: Die Priorität ist zu überleben, also schnell über die Ausschüttung von Stresshormonen den Organismus in Kampf- oder Fluchtbereitschaft zu versetzen. Die Bewertung der sensorischen Information durch die Amygdala geschieht in weniger als einer halben Sekunde, lange bevor wir einen Reiz bewusst erkennen und einordnen können. Je bedeutsamer die Information von der Amygdala eingestuft wird, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt die Information vom Hippokampus und desto ausgeprägter wird die Erinnerung. So weiß jeder, wo er sich am 11.9.2001 aufhielt, aber nicht für das gleiche Datum eines beliebigen anderen Jahres. Bei Extrem-Stress (=Trauma) werden die informationsverarbeitenden Zentren entkoppelt, die Amygdala (Feuerwehr) speichert emotionale und körperliche Reaktionen, fragmentiert im ursprünglichen Zustand, ohne Verbindung zu zeitlich-räumlicher Zuordnung durch den Hippokampus und sprachlicher Verarbeitung im Broca-Zentrum sowie autobiographischer Einordnung im präfrontalen Kortex. Die Erinnerung bleibt im Sinne der peritraumatischen Dissoziation stecken und kann durch banale Hinweisreize (Trigger) jederzeit im ursprünglichen Zustand wieder aktiviert werden, als geschehe das Trauma jetzt. So ist keine weitere Verarbeitung in den neuronalen Netzwerken möglich, das Geschehene kann nicht zu einer nutzbaren Lernerfahrung werden. Hirnphysiologische Untersuchungen (z.B. van der Kolk) mit PET oder fMRT zeigen, dass Glukoseverbrauch und regionale Durchblutung bei traumatischen Erinnerungen in der rechtshirnigen Amygdala verstärkt und parallel im Hippokampus und linkshirnigen Frontallappen und Broca-Areal reduziert sind. Traumatische Erfahrungen werden also über Körpererinnerungen, Gerüche und Geräusche gespeichert und von der normalen Erfahrung losgelöst erlebt. Sie können durch beliebige Reize wieder „getriggert“ werden. Dies läuft unbewusst ab und wird deshalb als aus „heiterem Himmel“ und sehr beängstigend erlebt. Ein wesentliches Ziel einer traumaspezifischen Therapie muss deshalb sein, dass implizite Erinnerungen ins explizite autobiographische Gedächtnis „umsortiert“ werden. Oder wie Reddemann und Sachsse formulieren: „Wo Intrusionen sind, sollen Erinnerungen werden“. Eine Traumatherapie muss die beschriebenen Besonderheiten der neurobiologischen Stressverarbeitung berücksichtigen und sollte deshalb in drei Phasen erfolgen: 1. Stabilisierung 2. Traumakonfrontation 3. Reintegration 18 Psychotherapie der Traumaverarbeitung Sowie die Entwicklung eines Traumas in verschiedenen Phasen verläuft, so hat sich auch in der Behandlung traumatisierter Patienten eine phasenorientierte Behandlung bewährt. Mehrere amerikanische und europäische Autoren haben phasenorientierte Behandlungsmodelle beschrieben und unter unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen erfolgreich praktiziert. Das erste Phasenmodell der Traumatherapie wurde bereits 1889 von Janet entwickelt und unterschied drei Phasen: 1. Stabilisierung 2. Traumabearbeitung 3. Reintegration. Auch moderne Modelle gehen überwiegend und schulübergreifend von einem Drei-PhasenModell aus. Herman (1993) unterscheidet beispielsweise die Phasen Sicherheit, Erinnern und Trauern sowie Wiederanknüpfung, die im wesentlichen Janets Modell entsprechen. Herman nennt als Grundlage diesen Stufenmodells die Annahme, dass bei der Erfahrung des interpersonellen Traumas die Gefühle von Hilflosigkeit, Bedeutungslosigkeit und des inneren Getrenntseins von sich selbst und den anderen zentral sind. Der Erholungsprozess wie er sich über die drei Phasen sich entfaltet, basiert auf der Stärkung des Opfers, der Schaffung neuer Beziehungsstrukturen und neuer Sinnerfahrung. Die dreiphasige Grundstruktur der Traumatherapie nach Judith Herman, wie sie aber auch von Reddemann und anderen führenden deutschsprachigen Vertretern der Traumatherapie vertreten wird, soll nun genauer dargestellt werden: Die dreiphasige Grundstruktur der Traumatherapie 1. Die Phase der Sicherheit und Stabilisierung: Aufbau einer stabilen Bindungserfahrung mit dem behandelnden Therapeuten / Behandlungsteam. Aktives Beziehungsangebot im Sinne einer neuen Beziehungserfahrung von Schutz und Empathie. Kontrolle über den eigenen Körper wiedererlangen, körperbezogene Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, körperliche Bewegung usw. autonom befriedigen. In Abgrenzung zur Außenwelt einen sicheren Lebensraum etablieren; die Fähigkeit zum Selbstschutz rangiert an erster Stelle. Erlernen von Selbstberuhigungsstrategien (therapeutische Technik mit der Befähigung zur Selbstberuhigung, Selbstliebe und Selbstakzeptanz). Die Strategien sind imaginative Stabilisierungsübungen wie sicherer Ort und innere Helfer, aber auch imaginative Distanzierungstechniken wie Tresor, Leinwand und Beobachtung. Erlernen von Techniken zum Flashback-Stop und Dissoziations-Stop. Erlernen von Affektkontrolle. Eigenverantwortung förderndes, antiregressiv rahmenorientiertes Vorgehen mit Verträgen. Real bedrohliches Äußeres von inneren Gefahren / altem Film unterscheiden lernen. Differenzierte Körperwahrnehmung und liebevollen Umgang mit dem Körper lernen. 19 Erlernen eines kontrollierten Umgangs mit traumatischem Material. Vorsichtiger Gebrauch von Entspannungstechniken sowie Achtsamkeitsübungen. Kognitive Strategien, der Gebrauch von Tagebüchern, die Definition von Hausaufgaben für das Management dieser Gefühle und die Entwicklung konkreter Pläne, um eigenständige Sicherheit zu gewinnen. „Erwachsener“ Umgang mit verlässlichen Absprachen in Bezug auf Zeitstruktur, Stationsregeln und Therapievereinbarungen. Gebrauch von Übergangsobjekten oder Erinnerungssymbolen als Angebote zur positiven Identifikation und die Entwicklung selbststabilisierender Fähigkeiten Ressourcenorientierung und Stressreduktion in allen Interventionen Kognitive Informationen und Psychoedukation wie Wissen über Traumafolgen, „Normalität“ der Symptome, Wissen über Täterintrojektion usw. Therapeutische Haltung der Inneren-Kind-Arbeit. Ziele der ersten Phase der Sicherheit und Stabilisierung sind das - Wiedergewinnen der Selbstkontrolle - Stärkung des Selbstmanagements - Reduzieren von Vermeidungsverhalten - Nutzung des kreativen Ressourcenpotentials - Selbstberuhigung und Selbsttröstung - Reduktion des traumatischen Stress - Förderung von Kontrolle und Wahlmöglichkeiten sowie Selbstregulation und Alltagsstabilität. 2. Die Therapiephase der Traumakonfrontationsphase: eigentlichen Traumabearbeitung / Fokus auf eine aktive und tiefergehende Erforschung der traumatischen Erfahrungen nach Aufbau einer tragfähigen Beziehung und eigenregulatorischer Fähigkeiten. Ausdrückliche Zustimmung der Patientinnen zur Traumaarbeit; Unterteilung des aufdeckenden Prozesses in verdaubare Unterabschnitte; Stärkung der Patientinnen, die Kontrolle für die Temporegulierung und die Intensivierung des Prozesses soweit wie möglich zu übernehmen. Einsatz von gezielten Dissoziationstechniken in der Traumabegegnung z. B. Bildschirmtechnik, Beobachtertechnik. Ziel der aufdeckenden Arbeit ist nicht primär die Katharsis, sondern vielmehr eine Integration der traumatischen Erfahrungen in das Spektrum der Gesamtpersönlichkeit. Nicht verarbeitetes traumatisches Material wegpacken. Inneren Trost anregen. Nach jeder Traumakonfrontation Stabilisierung anstreben. Schwere depressive Krisen, die sich aufgrund der sich jetzt intensivierenden Trauerarbeit anschließen, können durch den Aufenthalt in einer peergroup gemildert werden. 20 3. Die Phase der Wiederherstellung der Beziehung zu anderen Die Phase der Trauer und Reintegration: Schon in jeder Stunde der Traumakonfrontationsphase muss Zeit für Trauer und Trost des inneren Kindes und des erwachsenen Ichs bleiben. Der Fokus der letzten Phase liegt auf dem Trauern um das Versäumte und die zerstörte Kindheit, aber auch auf dem Annehmen des eigenen Lebensschicksals. Wiederherstellung sozialer Kontakte und Unterstützung in beruflicher Orientierung. Erweitern gewonnener Einsichten in den Charakter ausbeuterischer Beziehungen und der damit verbundenen Gewalt und Hilflosigkeitserfahrung auf dem bestehenden familiären Kontext oder andere soziale Kontakte. Grenzsetzung gegen Beziehungen mit ausbeuterischem Charakter – nicht ausbeuterische Beziehungen sollen gestärkt werden. Lernen neuer Coping-Strategien für das heutige Leben. Nach Erstarken des Ichs und Freiwerden der Energie, die früher in Traumasymptome und deren Abwehr investiert wurde, ist jetzt auch konflikt- und übertragungszentrierte Psychotherapie möglich. In den Untersuchungen zur Wirksamkeit der Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung hat sich gezeigt, dass eine Reihe von psychotherapeutischen Verfahren nachgewiesene Wirksamkeit für sich beanspruchen können. Als sehr gut wirksame Verfahren gelten - die kognitive Verhaltenstherapie, das EMDR, die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie nach Reddemann, das hypnotherapeutische Vorgehen. Grundprinzipen der Psychodynamisch-Imaginativen Traumatherapie (PITT) Der von Luise Reddemann entwickelte Ansatz umfasst die typischen 3 Phasen der Traumatherapie, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Stabilisierungsphase liegt. Reddemann verwendet die Konzepte der Inneren Bühne und des Teile-Modells der Persönlichkeit im Sinne des Ego-State-Konzeptes. Vorrangig ist die Etablierung einer stabilen Arbeitsbeziehung zwischen dem erwachsenen Ich des Patienten und der Therapeutin, die sich gemeinsam empathisch um die verletzten jüngeren Ich-Anteile kümmern, die sich in den Symptomen und Ängsten und regressiven Übertragungsmustern ausdrücken, in der Berechtigung dieser alten Gefühle und Ängste und deren Bewältigungsstrategien wahrgenommen und wertgeschätzt werden müssen. Regressive Bedürfnisse werden auf der inneren Bühne bearbeitet, die Regression soll sich nicht in der therapeutischen Beziehung und der aktuellen Realität ausbreiten in Form einer Ich-Regression, die das Ich schwächen und das Arbeitsbündnis gefährden würde. Die 21 therapeutische Beziehung soll möglichst frei von traumatischem Stress bleiben. Die Bedürfnisse der jüngeren Ichs werden psychodynamisch gedeutet, dann aber auf der inneren Bühne für Beruhigung und Befriedigung dieser Bedürfnisse gesorgt durch Ausbau der Fähigkeiten zur Selbstberuhigung und Selbstfürsorge und der Förderung des Selbstkontaktes. Imaginative Selbstberuhigungs- und Distanzierungstechniken sollen von den Patienten selbständig geübt und eingesetzt werden. Hierbei wird die Fähigkeit zur Dissoziation als Ressource genutzt. Das verletzte innere Kind beruhigen und imaginativ in die Gegenwart an einen sicheren Ort holen zu können, oder sich imaginativ von traumaassoziierten Inhalten distanzieren zu können, diese z.B. in einen Tresor packen zu können, sind wesentliche Voraussetzungen dafür, sich in der späteren Traumakonfrontationsphase den traumatischen Erinnerungen annähern und diese integrieren zu können. Diese Phase der Traumakonfrontation ist nicht unbedingt Ziel der Therapie, auch in der Trauma-Begegnung sollen möglichst schonende Techniken wie die imaginative Beobachtertechnik oder die Leinwandtechnik eingesetzt werden. Die Integration der fragmentierten Trauma-Erinnerungen scheint auch aus beobachtender Distanz, in der die Patienten sich sicher und nicht überwältigt fühlen, zu gelingen. In der Stabilisierungsphase kommen eine Menge kreativer imaginativer Übungen zur Anwendung, Patienten erschaffen sich z.B. phantasiereich ihre eigenen „inneren Helfer“, beraten sich mit ihrem „inneren Team“ oder ihrer „inneren Weisheit“. Zentrale Berücksichtigung findet die frühe Beziehungstraumatisierung. Das vernachlässigte oder verletzte innere Kind oder die Ego-States in verschiedenen Altersstufen werden in ihren berechtigten Anliegen und Gefühlen gewürdigt und bekommen imaginativ, was sie damals so sehr gebraucht hätten und noch heute brauchen, da sie wie eingefroren immer noch im Damals feststecken. Dies entspricht der Theorie der dissoziierten neuronalen Netzwerke, die traumatisierten Ego-States fanden keinen Anschluss an die weitere Entwicklung, werden in ihrem ursprünglichen Leid getriggert und machen sich im Jetzt als Symptome, Ängste oder ähnliche „Hilferufe“ bemerkbar. Auch „Widerstände“ werden als Ressource gewürdigt. Sie sind eventuell auf Täter-Introjekte zurückzuführen, deren ursprünglich überlebensnotwendige Schutzfunktion gewürdigt wird. Danach wird angestrebt, sie als wertvolle Mitglieder in das innere Team zu integrieren und auf möglichst heute angemessenere Weise ihre positive Absicht umzusetzen. Dies ist wie die Innere-Kind-Arbeit eine Form der Ego-State-Arbeit. Bei anhaltendem „Widerstand“ ist auch zu prüfen, ob das Arbeitsbündnis und der Auftrag stimmen. Patienten werden jeweils als erwachsene, verantwortliche Personen wahrgenommen, deren Einverständnis zu jedem Schritt einzuholen ist, die potentiell alle zur Heilung notwendigen Ressourcen in sich tragen. Psychoedukative Informationen über Trauma-Verarbeitung und Trauma-Folgen und den theoretischen Hintergrund der Arbeit bilden die Basis, um im Patient einen gleichberechtigten Therapiepartner zu haben. Zu achten ist stets auf äußere Sicherheit, Sicherheit in der therapeutischen Beziehung und innere Sicherheit. Speziell bei Täter-Kontakt sind Innere-Kind-Arbeit, Täter-Introjekt-Arbeit und Traumakonfrontation kontraindiziert. Auch negativen therapeutischen Reaktionen oder dem Misslingen der Etablierung eines imaginativen sicheren Ortes liegt oft ein Mangel an äußerer Sicherheit zugrunde. Der Fokus der Arbeit liegt auf achtsamem Beobachten statt Erleben. In der Traumabegegnungsphase werden aus dieser beobachtenden Distanz die Traumafragmente i.S. des BASK-Modells (Verhalten, Affekt, Kognitionen, Körpersensationen) zusammengefügt und integriert. Das Trauma kann so als ganzheitliche Gestalt erlebt und zu einer integrierten 22 Erinnerung werden. „Integrierte Erinnerungen sind Ereignisse, an die ich mich erinnern kann, ohne von ihnen überwältigt zu werden oder Intrusionen zu bekommen“ (Sachsse). Ein vorrangiges Prinzip ist in der PITT stets, dass der Patient die Kontrolle behält. Stress muß vermieden werden, da Ohnmacht und Stress Trigger für traumaassoziierten Stress und damit retraumatisierend sind. Die Innere-Kind-Arbeit zielt auch darauf, die als unterbrochene Handlung zu verstehende Beziehungstraumatisierung „zu einem guten Ende“ zu bringen, der empathische Kontakt zum eigenen inneren Kind und damit zum Selbst ermöglicht, dass alter Schmerz verkraftbar und vor allem innerer Trost möglich wird. Bezüglich des frühen Beziehungstraumas dürfte dies essentieller und heilsamer sein als das unbedingte Ziel einer Traumakonfrontation. Reddemann betont auch die Wichtigkeit der 3. Phase, der Phase der Integration und Trauer. Erst nach der Phase der Traumasynthese seien Patienten im üblichen Sinne therapiefähig, wodurch tiefere Trauerarbeit und auch konfliktzentriertes Vorgehen ermöglicht wird. Vorgehen in der Einleitungsphase Seien Sie freundlich und zugewandt und denken Sie daran, dass jede Therapie von einer hilfreichen Beziehung lebt. Fühlen Sie sich für die Beziehung verantwortlich. Klären sie den Auftrag der Patientin / des Patienten an Sie explizit und frühestmöglich. Erheben Sie die Anamnese ohne Belastungen zu fokussieren oder durch Betonung schwieriger Themen zu belasten. Führen Sie ggf. sofort eine Distanzierungstechnik (innerer Beobachter, Bildschirm) ein. Fragen Sie immer auch nach Ressourcen und verstärken Sie diese. Erklären Sie, warum Sie das tun. Klären Sie die Lebensziele der erwachsenen Person. Daraus ergeben sich die Therapieziele. Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen Auftrag / Zielen und Beschwerden frühestmöglich her. Regen Sie die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung an. Regen Sie an, dass die Patientin einen „Krisenbewältigungszettel“ anlegt und verdeutlichen Sie, dass es wichtig ist, dass sie diesen Zettel zu Rate zieht und sich nach ihm richtet, falls sie sich unwohl fühlt. Weisen Sie darauf hin, dass Sie nicht immer erreichbar sind, vereinbaren Sie Telefonzeiten. Geben Sie ressourcenorientierte Hausaufgaben (z. B. „Bitte achten Sie bis zu unserem nächsten Termin auf alles was Ihnen gut tut und notieren sie es“). 23 Therapiestrategien aus dem Bereich kognitiver Verhaltenstherapie Ziel der Verhaltenstherapie ist es, einen Therapieplan als eine aufeinander abgestimmte Abfolge von kognitiven Umstrukturierungsprozessen zu entwerfen. Neben der Unterstützung des Selbstmanagements und weiterer Bewältigungsfertigkeiten werden Verfahren des Gegenkonditionierens eingesetzt, um Panikattacken, Ängste, aber auch Flashback-Situationen zu meistern. Eine wesentliche Arbeit gilt der Integration des Traumaerlebens in das kognitive Selbstkonzept mit dem Ziel, persistierendes Vermeidungsverhalten auf Dauer zu reduzieren. Dazu werden verschiedene Therapiebausteine miteinander kombiniert. Die Konfrontationstherapie besteht aus einer Reihe von Techniken, denen allen gemeinsam ist, dass sie den Patienten helfen, sich gefürchteten Situationen stellen zu können. Bei spezifischen phobischen Ängsten ist die Konfrontationstherapie die effektivste Intervention. Angstbewältigungstraining und kognitive Verfahren werden sehr häufig bei chronischen Ängsten wie der generalisierten Angststörung eingesetzt. Daher waren Konfrontationstherapie und Angstbewältigungstherapie auch die ersten kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionen, die bei PTB Anwendung fanden. Die Konfrontationsbehandlung beinhaltet gewöhnlich ein mehrmaliges imaginatives Wiedererleben der traumatischen Ereignisse sowie eine wiederholte Konfrontation mit sicheren, jedoch vom Patienten vermiedenen Situationen durch welche Erinnerungen an das Trauma ausgelöst werden. Ziel einer solchen Konfrontation ist es, die Verarbeitung der Erinnerungen zu fördern, die bei Traumaopfern mit chronischer PTB vermutlich beeinträchtigt ist. Die Technik der sogenannten lang andauernden Konfrontation besteht aus ca. neun Sitzungen, die zweimal wöchentlich in Einzeltherapie durchgeführt werden, jede Sitzung dauert 90 Minuten. In den meisten Sitzungen erhalten die Opfer die Aufgabe, ihr traumatisches Erlebnis in der Vorstellung erneut zu durchleben und es laut zu beschreiben „als geschehe es gerade jetzt“. Mitunter wird die Konfrontation auch auf einer Cassette aufgenommen, damit die Patienten als Hausaufgabe die imaginative Konfrontation üben können, indem sie sich das Band anhören. Eine weitere Hausaufgabe besteht für die Opfer darin, sich von ihnen gefürchteten Situationen zu nähern, die realistisch betrachtet, gefahrlos sind. Das Angstbewältigungstraining wurde ursprünglich entwickelt, um aufkommende Angst und innere Unruhe bei Traumaopfern bewältigen zu können. Der Schwerpunkt liegt darauf, dem Patienten Bewältigungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Angstbewältigungstrainings beinhalten verschiedene therapeutische Techniken wie Biofeedback, Entspannung und kognitive Umstrukturierung. Von den verschiedenen Angstbewältigungstrainings hat das Stress-Impfungstraining die größte Aufmerksamkeit gewonnen. Hauptfokus des Stressimpfungstrainings liegt im Erlernen von Bewältigungstechniken wie Tiefenentspannung, Gedankenstop, kognitive Umstrukturierung, Vorbereitung auf eine belastende Situation, verdecktes Modelllernen und Rollenspiel. Diese Fertigkeiten werden jeweilig erst auf ein Beispiel angewendet, das nicht mit dem Trauma in Zusammenhang steht und erst danach auf ein mit dem Trauma zusammenhängendes Beispiel. Auch beim Stressimpfungstraining besteht ein wichtiger Teil der Therapie im Einüben des Erlernens in der häuslichen Umgebung. Patienten werden aufgefordert, die Bewältigungstechniken regelmäßig Zuhause zu üben. Die kognitive Therapie ist bei der Behandlung der PTB darauf ausgerichtet, mit dem Trauma verbundene irrationale, unangemessene Überzeugungen, die die posttraumatischen Reaktionen aufrecht erhalten, zu erkennen und zu modifizieren. Die kognitive Umstrukturierung basiert z. Teil auf der kognitiven Therapie der Depression von Beck et al. (1979). Sie konzentriert sich auf Funktionsbereiche, von denen angenommen wird, dass diese 24 durch Opfererfahrung gestört sind. Diese Bereiche umfassen Sicherheit, Vertrauen, Macht, Achtung und Intimität. Die Problematik der Konfrontationstherapie liegt darin, dass sich einige Patienten nur sehr widerstrebend auf das Wiedererleben ihres Traumas einlassen wollen, auch wenn sie von der Notwendigkeit überzeugt sind. Auch fühlen sich Therapeuten oftmals unwohl dabei, eine Behandlungsmethode anwenden zu wollen, die bei dem Patienten intensiven emotionalen Schmerz auslöst. Nur wenn der Therapeut davon überzeugt ist, dass kurzzeitiges Leiden langanhaltenden Nutzen nach sich zieht und er diese Überzeugung dem Patienten glaubhaft vermitteln kann, sollte er von dieser Technik Gebrauch machen. Ein weiterer kritischer Punkt der kognitiven Strategien ist der geringe Zeitraum für den Aufbau von vorangehenden Stabilisierungstechniken. Ein gutes Anwendungsbeispiel für therapeutische Konzepte und Interventionsstrategien im Bereich kognitiver verhaltenstherapeutischer Strategien ist das von Marsha M. Linehan publizierte Handbuch der Therapie von Borderline-Störungen (Linehan, 1996) sowie das Trainingsmanual zur dialektisch-behavioralen Therapie der Borderline-Störung. Linehan versteht die umfangreichen dysfunktionalen Verhaltensmuster wie selbstschädigendes Verhalten, Impulskontrollverluste und schwere dissoziative Phänomene als erlernte Problembewältigungsversuche. Daher steht im Mittelpunkt ihres therapeutischen Konzeptes fortwährend die Balance zwischen der Notwendigkeit, die Sinnhaftigkeit maladaptiver Verhaltensmuster im intrapsychischen und interaktionellen Kontext zu akzeptieren und gleichzeitig an deren Veränderung zu arbeiten. Die Therapiephase, in der die Bearbeitung des posttraumatischen Stresssyndroms stattfindet, setzt zunächst eine stabile belastbare therapeutische Beziehung voraus sowie den Rückgang suicidalen und parasuicidalen Verhaltens, eine höhere Stressbelastbarkeit und einen Rückgang selbstschädigenden Verhaltens (alles Ziele der ersten Therapiephase). In der zweiten Therapiephase werden insgesamt vier verschiedene Schritte verwendet: a) Akzeptanz der Tatsache des erlebten Traumas b) Verminderung des Gefühls der Stigmatisierung und Selbstbeschuldigung c) Bearbeitung bisheriger Verleugnung und der damit verbundenen Vermeidung von traumaasoziierten Situationen und d) Behandlung des gespaltenen Denkens über die traumatische Situation, die sog. Missbrauchsdichotomie. Psychologische Frühintervention – Psychologisches Debriefing Das sogenannte psychologische Debriefing hat seinen Ursprung im militärischen Bereich. Soldaten in den beiden Weltkriegen wurden zeitnah psychologisch beraten, um ihre Gefechtsbereitschaft zu erhalten. Gegenstand des Debriefings ist die traumatische Erfahrung. Die Teilnehmer werden ermutigt und angeleitet über ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen zu berichten. Das ursprünglich für Gruppen entwickelte Konzept ist auch im Einzelsetting möglich, Debriefing ist heute eine häufig angewendete Intervention nach kritischen und traumatischen Ereignissen. Es wird in einer Sitzung zeitnah zum Ereignis durchgeführt, im ursprünglichen Konzept innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Es umfasst die Rekonstruktion der Erfahrungen auf der Fakten-, Kognitions- und Emotionsebene, Psychoedukation über Traumafolgen und Behandlungsstrategien, die Aktivierung von Ressourcen und Bewältigungsstrategien sowie die Sicherung der mittel- und langfristigen Versorgung. 25 Der Debriefing-Prozess ist standardisiert und strukturiert, es werden zumeist sechs Phasen durchlaufen: 1. Einführung, Zielsetzung und Ablauf; 2. Bericht über die Fakten: Ablauf der Ereignisse; 3. Bericht über Gedanken und Eindrücke mit Fokus auf die wichtigsten Gedanken; 4. Bericht über Reaktionen, Gefühle und Symptome (schlimmster Moment, peri- und posttraumatische Belastungsreaktionen); 5. Vermittlung von Informationen und Bewältigungsstrategien; 6. Abschluss der Sitzung und Möglichkeiten der Weiterversorgung. Die am häufigsten eingesetzte Form des Debriefings ist das Critical Incident Stress Debriefing (CISD) von Mitchell. Es wurde speziell 1983 für Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes entwickelt. Untersuchungsergebnisse über die Wirkung des Debriefings fallen sehr unterschiedlich aus. Debriefings sind eine eingeführte und häufig angewandte Frühintervention nach belastenden Ereignissen. Sie werden von verschiedenen Personen mit unterschiedlicher psychotraumatologischer Kompetenz bei verschiedenen Notfallsituationen und Schadenslagen zur psychologischen Erstversorgung von Traumaopfern eingesetzt. Einzelne Komponenten des Konzepts sind unbestritten und vergleichbar mit Elementen anderer Frühinterventionen. Das formalisierte Vorgehen mit einer zeitnahen Rekonstruktioin der Erfahrungen und die Begrenzung auf nur eine Sitzung muss jedoch kritisch beurteilt werden. Es besteht die Gefahr, dass bei nur einmaliger Sitzung die psychische Belastung und vegetative Erregung eher gesteigert werden, ohne dass ausreichend Zeit für eine Löschung zur Verfügung steht. Determinanten psychologischer Debriefings: Ein Debriefing sollte nicht in der Einwirkungszeit und auch nicht zeitnah zum Ereignis in den ersten Tagen nach dem Trauma durchgeführt werden. Es ist sehr wahrscheinlich nicht geeignet für Personen mit hoher prätraumatischer Belastung und Risikofaktoren sowie für Personen mit dissoziativen Symptomen. In jedem Fall muss eine niederschwellige weiterführende Versorgung sichergestellt und erreichbar sein. Debriefings können nicht bei Typ II-Traumen eingesetzt werden. Wird die Indikation auf sekundär Betroffene wie z.B. Einsatzkräfte eingeschränkt, so ist nach der Zielsetzung der Intervention zu fragen: Wenn sie primär die Gruppenkohäsion und die Einsatzbereitschaft fördert, ist sie nicht automatisch präventiv im Hinblick auf posttraumatische Belastungsstörungen. Für die Durchführung in der Gruppe sind besondere Risiken zu bedenken: Der Gruppendruck kann zu zusätzlichen Belastungen bei den Teilnehmern führen, besonders stark belastete Teilnehmer werden nicht identifiziert und/oder nicht ausreichend betreut. Die weite Verbreitung des Debriefing beruht auf der relativ hohen Standardisierung und macht diese Methode daher auch für Nicht-Psychologen interessant und (scheinbar) schnell und leicht erlernbar. 26 Weitere Möglichkeiten der Traumakonfrontation und Traumabearbeitung Die Traumabearbeitung mit EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Diese manualisierte Therapie-Methode wurde Ende der 80-iger Jahre von Francine Shapiro entwickelt und seither ausdifferenziert und in vielen Studien in ihrer Wirksamkeit belegt. EMDR ist ein hoch wirksames therapeutisches Werkzeug, das in einen Gesamtbehandlungsplan integriert werden muss. Der Wirkmechanismus ist noch nicht genau geklärt, scheint aber ähnlich der Verarbeitungsfunktion des REM-Schlafes zu sein. Bilaterale Stimulation durch Augenbewegungen, auditive oder taktile Reize könnte die blockierte Informationsverarbeitung der als dissoziierte Traumafragmente gespeicherten impliziten Erinnerungen wieder in Gang bringen. Mit erfolgreicher Verarbeitung wird die Erinnerung quasi in das explizite Gedächtnis „umsortiert“, so zu einer erzählbaren und der Vergangenheit angehörigen Erinnerung, die nicht mehr weiter belastende Symptome in der Gegenwart auslöst. Zudem verändern sich typische posttraumatische negative Überzeugungen zum Selbstbild („ich bin schlecht“, „ich bin selbst schuld“), diese werden im Sinne einer kognitiven Umstrukturierung neu bewertet. Nach Erstellen einer Trauma-Landkarte und ausgiebiger Vorbereitung analog der Stabilisierungsphase wird ein Trauma fokussiert, indem visuelle, kognitive, emotionale Anteile, Körpersensationen sowie die zugehörige negative Kognition geklärt und somit getriggert werden. Durch gleichzeitige Aufmerksamkeit auf den Fokus (der ausgewählten Traumasituation) und die bilaterale Stimulation wird der Verarbeitungsprozesse katalysiert. EMDR scheint den Informationsverarbeitungsprozess auf hirnphysiologischer Ebene zu beschleunigen, die unverbundenen Trauma-Netzwerke miteinander und mit RessourcenNetzwerken zu verbinden. Der Ablauf ähnelt oft psychoanalytischen Assoziationsketten. Das sogenannte EMDR-Protokoll enthält 8 Phasen: 1. Anamnese und Behandlungsplanung: Erhebung der biographischen und speziell der Trauma-Anamnese Prüfung der Eignung der Pat. für EMDR: Psychotherapiefähigkeit, Ressourcen, IchStärke, Diagnostik inkl. Tests und Gesamtbehandlungsplanung, in der EMDR nur ein Teil darstellt. 2. Vorbereitung der Patienten und Stabilisierungsphase: Erklärung der Theorie von EMDR und Trauma-Verarbeitung, Ausbau von Ressourcen mit dem Ziel der Selbststabilisierung und Distanzierung von posttraumatischen Inhalten, Aufbau einer therapeutischen Beziehung. 3. Bewertung des Traumas: Hier wird der Fokus (die ausgewählte Traumatisierung) in allen Facetten erarbeitet: Ein repräsentatives Bild der traumatischen Szene, eine noch heute gültige negative Kognition dazu (z.B. „ich bin schuld“), die dazugehörige erwünschte positive Zielkognition, deren Stimmigkeit auf einer Skala eingeschätzt wird, dann der Grad der Belastung, den die traumaassoziierten Gefühle noch heute haben, und das Körperempfinden. Mit diesen bisher getrennt gespeicherten Fragmenten ist die Trauma-Erinnerung „getriggert“. 27 4. Desensibilisierung und Reprozessieren: Das nun aktivierte Trauma-Netzwerk wird hier unter Einsatz bilateraler Stimulation durchgearbeitet, bei Blockaden können unterstützende Interventionen oder Ressourcen durch den Therapeuten „eingewebt“ werden. Die Belastung sollte auf 0 sinken, nach komplexer Traumatisierung ist dies oft nicht erreichbar. 5. Verankerung der positiven Kognition: Die positive Kognition wird mit dem ursprünglichen Trauma-Netzwerk verankert und steht in Zukunft im Vordergrund. 6. Körpertests: Hier werden mögliche Reste sensorischer Belastung erfasst und verarbeitet. 7. Abschluss: Nachbesprechung mit Erfassen der erreichten Erfolge, Hinweis auf mögliche Nachverarbeitung in Träumen und Auftauchen neuer Erinnerungen, die „weggepackt“ werden sollen und in der nächsten Sitzung verarbeitet werden können; gegebenenfalls kann ein Tagebuch über die auftauchenden Erinnerungen oder Gedanken geführt werden. 8. Nachevaluation: In der nächsten Stunde wird der Fokus erneut überprüft, die Belastung kann weiter abgenommen haben oder aber angestiegen sein, dann wird der Fokus weiter bearbeitet, sonst ein neuer gewählt. Neurolinguistisches Programmieren (NLP) in der Traumatherapie Das neurolinguistische Programmieren entstand Anfang der 70er Jahre aus der systematischen Beobachtung und Analyse der praktischen Arbeit herausragender Therapeuten, wie Virginia Satir (Familientherapie), F. Perls (Gestalttherapie) und M. Erickson (Hypnotherapie). Aus unterschiedlichen Theorien wurden grundlegende gemeinsame Strukturen und Kommunikationsmuster entdeckt, die maßgeblich sind für effektive Kommunikation und Veränderung und die von den Begründern Bandler und Grinder und anderen in ein lern- und lehrbares Modell gebracht wurden. NLP als ressourcen- und zielorientiertes Modell wurde und wird ständig weiterentwickelt und in vielfältigen Bereichen angewendet. So entstand eine große Zahl von Techniken, die sich in empirischen Untersuchungen als effizient erwiesen haben. Bedeutung des NLPs für die Traumatherapie a) Klar strukturierte Zieldefinitionen anstelle Suche nach der Ursache sowie Ressourcenorientierung b) Ankern Ankern ist eine sehr hilfreiche Möglichkeit, um den Verlauf eines Prozesses zu unterstützen und um in erforderlichen Situationen einen ressourcevollen Zustand herzustellen. So können z. B. die wichtigsten Imaginationsübungen zur Vorbereitung der Traumaexposition in allen Repräsentationssystemen geankert werden. 28 c) Repräsentationssysteme Jeder Mensch nimmt mit Hilfe seiner Sinnesorgane äußere Gegebenheiten wahr. Dabei bevorzugen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sinneskanäle und es lässt sich zunächst herausfinden, welches Wahrnehmungssystem (visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch) vom jeweiligen Menschen bevorzugt wird. Bei den Imaginationsübungen kann die Benutzung der richtigen Repräsentationssysteme für das Gelingen von großer Bedeutung sein. d) Arbeit mit Glaubenssätzen Glaubenssätze sind individuell herausgebildete Verallgemeinerungen über die Beziehung zwischen Erfahrungen, die einer logischen Argumentation gegenüber nicht offen für Veränderung sind. Sie orientieren sich an der subjektiven individuell-selektiven Wahrnehmung von Erfahrung, ihre Bewertung und Integration in Beziehungssysteme. Sie machen sich bemerkbar, wenn geplante Veränderungen überraschenderweise nicht funktionieren. Dann können einschränkende Glaubenssätze für dieses Problem verantwortlich sein. NLP bietet verschiedene Modelle an, wie mit Glaubenssätzen erfolgreich gearbeitet werden kann und neue Glaubenssätze entwickelt werden können. e) Submodalitäten Submodalitäten bilden die Form und Qualität der Sinneswahrnehmung, so z. B. beim visuellen Kanal die Kriterien Helligkeit, Farbe, Größe und Bewegung. Sie nehmen Einfluss auf die gefühlsmäßige Bewertung des sinnesspezifischen Erlebens. So verändert sich die subjektiv empfundene emotionale Qualität eines Bildes mit der Darstellung in schwarz-weiß oder Farbe oder die eines Musikstücks mit der Tonlage in der es gespielt wird. Auf diese Weise lassen sich bedrohliche Bilder durch Veränderung ihrer visuellen Qualitäten in ihrer Bedrohung deutlich abschwächen. f) Das Phobiemodell Mit Hilfe eine doppelten bzw. dreifachen Dissoziation kann die Patientin sich während einer Traumaexposition von außen betrachten, wie sie das traumatische Ereignis mittels Traumaverarbeitungstechniken bearbeitet. Auch wird durch die mehrfache Dissoziation während der Erinnerung an ein traumatisches Ereignis fast immer eine genügend notwendige Distanz erreicht, um nicht von den Affekten überflutet zu werden (siehe Screen-Technik). g) Time-Line Arbeit Über die Arbeit an der persönlichen Zeitlinie lassen sich sowohl für die Vergangenheit wie auch für die Zukunft neue Sichtweisen erarbeiten wie auch die Bedeutung von Lebensereignissen aus einer anderen und heilsamen Perspektive erleben. h) Kombination von EMDR und NLP z.B. zur Gewinnung von Ressourcen 29 Literaturliste Bradshaw John, „Das Kind in uns“, Knauer Taschenbuch, 2000 Callahan R. und Callahan J., “Den Spuk beenden”, Klopfakupressur bei posttraumatischem Stress, VAK-Verlag, 2001 Chopich E. J. und Paul M., „Aussöhnung mit dem inneren Kind“ Deistler I. und Vogler A., „Einführung in die Dissoziative Identitätsstörung“, Junfermann, 2002 Eckhardt-Horn A., Hoffmann S. O., „Dissoziative Bewusstseinsstörungen“, Schattauer, 2004 Egle, Hoffmann, Joraschky: „Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung“, Schattauer, 2004 Fischer G., „Mehrdimensionale Psychodynamische Traumatherapie MPTT“ Asanger, 2000 Fischer G., „Neue Wege aus dem Trauma, erste Hilfe bei schweren seelischen Belastungen“, Walter, 2003 Flatten G., Gast U., Hofmann A., „Posttraumatische Belastungsstörung“, Schattauer, 2004 Fischer G. und Riedesser P., „Lehrbuch der Psychotraumatologie“, Reinhardt, 1999 Grawe K., „Neuropsychotherapie“, Hogrefe, 2004 Herman J., „Die Narben der Gewalt“, Junfermann, 2003 Huber M., „Trauma und die Folgen, Trauma und Traumabehandlung Teil 1“, Junfermann, 2003 Huber M., „Wege der Traumabehandlung, Trauma und Traumabehandlung Teil 2“, Junfermann, 2003 Huber M., „Der innere Garten“, Junfermann 2005 30 Hofmann A., „EMDR in der Therapie psychotraumatischer Belastungssyndrome“, Thieme, 1999 Van der Kolk et al., „Traumatic Stress“, Junfermann, 2000 Klein S., Die Glücksformel, Rowohlt, 2004 Levine P., Trauma-Heilung, Synthesis, 1998 Lukas B., Das Gefühl, ein NO-BODY zu sein. Junfermann, 2003 Matsakis A., „Wie kann ich es nur überwinden?“ Junfermann, 2004 Maercker A., Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung, Springer, 2003 Mosetter K., und Mosetter R., „Kraft in der Dehnung“ Walter 1998 Peichl J., „Die inneren Traumalandschaften“, Schattauer, 2006 Phillips M., Frederick C., “Handbuch der Hypnotherapie bei posttraumatischen und dissoziativen Störungen, Carl-Auer-Verlag 2003 Putnam F., „DIS Diagnose und Behandlung der Dissoziativen Identitätsstörung“, Junfermann, 2003 Reddemann L., „Imagination als heilsame Kraft“, Pfeiffer, 2002 Reddemann L., „Psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, PITT – Das Manual“, Pfeiffer, 2004 Reddemann L., Dehner-Rau, C., „Trauma – Folgen erkennen, überwinden, an ihnen wachsen“, Trias, 2004 Reddemann L., Hofmann A., Gast U., Psychotherapie der dissoziativen Störungen Thieme, 2004 Reddemann L., Sachsse U., „Traumazentierte Psychotherapie I“, Persönlichkeitsstörungen, 3/97 Reddemann L., Sachsse „Traumazentrierte U., Persönlichkeitsstörungen 2/98 Rothschild B., „Der Körper erinnert sich“. Synthesis, 2002 31 Psychotherapie II“, Rudolf G., „Strukturbezogene Psychotherapie. Leitfaden zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen“, Schattauer, 2004 Sachsse U. et al., „Traumatherapie – Was ist erfolgreich?“, Van den Hoeck und Rupprecht, 2002 Sachsse U., „Traumazentrierte Psychotherapie“, Schattauer, 2005 Schulz v. Thun F., „Miteinander reden (das innere Team) Teil 3“, Rowohlt Taschenbuch, 1998 Watkins J. und Watkins H., „Ego-States Theorie und Therapie“, Karl Auer, 2003 Wöller W., „Trauma und Persönlichkeitsstörungen“, Schattauer, 2006 32