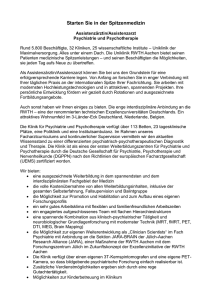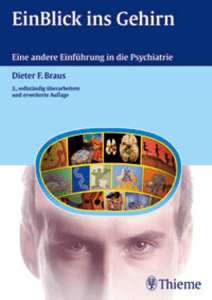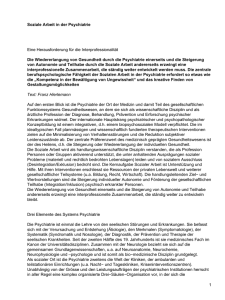2004-02-02_Wagner - la:sf Lehranstalt für systemische
Werbung

Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie ELISABETH WAGNER SYSTEMKOMPETENZ IN DER FORENSISCHEN PSYCHIATRIE EINLEITUNG Wenn systemische Therapie nicht in privater Praxis oder in Beratungsstellen, wo ein klassisches Therapiesetting mit den konstituierenden Merkmalen von Freiwilligkeit und Verschwiegenheit besteht, sondern in öffentlichen Institutionen wie Psychiatrischen Krankenhäusern, Suchtkliniken, Jugendämtern, Gefängnissen, zur Anwendung kommt, müssen die der systemischen Therapie zugrunde liegenden Konzepte kritisch reflektiert und differenziert werden. Da öffentliche soziale Institutionen immer auch die Schutz- und Ordnungsinteressen der durch den Staat repräsentierten Öffentlichkeit vertreten, haben sie neben einem Hilfsauch einen Ordnungs- und Kontrollauftrag zu erfüllen (vgl. Brandl-Nebehay, Russinger 1995); es geht um gesellschaftliche Macht, aber auch um die schutzwürdigen Bedürfnisse von Dritten. Der Staat übernimmt Verantwortung, drohende Gefahren abzuwenden und bedient sich dabei der professionellen Arbeit von BeraterInnen und/oder TherapeutInnen. Daraus ergibt sich das typische Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle, zwischen Therapie und Strafe (vgl. Russinger, Wagner 1999) Nach einer einführenden Darstellung des Arbeitskontextes Maßnahmenvollzug soll in diesem Beitrag aufgezeigt werden, wie eine unkritische Anwendung zentraler systemischer Konzepte wie Auftragsfokussierung, Lösungs- und Ressourcenorientierung den Erfordernissen einer verantwortungsvollen therapeutischen Arbeit in der Forensischen Psychiatrie zuwiderläuft, während die kritische Reflexion dieser Konzepte unter Einbeziehung der Systemtheorie als Theorie sozialer Systeme und als Metatheorie des Beobachtens und Unterscheidens eine besondere Kompetenz des systemischen Therapeuten darstellen kann. Da diese Kompetenz nicht wesentlich aus der Anwendung klinischen Wissens (dem Wissen über gesunde versus pathologische seelische Phänomene) erwächst, möchte ich sie unter dem Begriff „Systemkompetenz“ diskutieren. Das Konstrukt Systemkompetenz wurde von Schiepek eingeführt (Manteufel & Schiepek, 1998) und beinhaltet neben dem Verständnis für allgemeine Charakteristika dynamischer Systeme (z.B. Rückkopplung, Nichtlinearität, Selbstorganisation usw.) und der Fähigkeit zu kompetentem selbstreflexiven Handeln beim Eingreifen in komplexe Systeme auch ein fundiertes Fachwissen über das jeweils spezifische komplexe System (d.h. über die Vernetzung relevanter Systemelemente und Einflussfaktoren). „Systemkompetenz“, definiert als Kompetenz im Umgang mit komplexen dynamischen Systemen, besteht damit aus einem allgemeinen bereichsübergreifenden und einem speziellen bereichsspezifischen Anteil. Einerseits sind situationsbezogenes und domainspezifisches Wissen und Handlungskompetenzen notwendig, um mit den in der speziellen Anforderungssituation relevanten Systemen und Systemelementen angemessen umzugehen. Andererseits wird postuliert, dass auch eine „allgemeine“, bereichsübergreifende Systemkompetenz entwickelt werden kann. Diese übergreifenden Wissens- und Fähigkeitskomponenten helfen Personen in verschiedenen komplexen Problemsituationen beim Management von Systemprozessen (Kriz 2000). FÜR DIE AUSEINANDERSETZUNG mit dem Arbeitskontext Forensische Psychiatrie möchte ich die anzustrebende „Systemkompetenz“ auf drei Ebenen explizieren: a) die Ebene der angemessenen Konzeptualisierung des institutionellen Kontextes vor dem Hintergrund der Theorie Luhmanns, b) die Ebene der angemessenen erkenntnistheoretischen Fundierung von Expertenwissen in der forensischen Psychiatrie und c) die Ebene der angemessenen Definition der therapeutischen Beziehung in Hinblick auf das Teilhaben an der institutionellen Macht der Vollzugsanstalt. Seite 1 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie Zunächst soll aber der Arbeitskontext Forensische Psychiatrie in seinen Grundzügen vorgestellt und die grundsätzliche Schwierigkeit der Anwendung systemischer Konzepte diskutiert werden. ZUM ARBEITSKONTEXT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Voraussetzung für die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Täters, somit für dessen Schuldfähigkeit, ist dessen Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat. Wer nicht in der Lage ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen und entsprechend diesem Urteil zu handeln, der handelt nicht schuldhaft und kann nicht bestraft werden. Wenn jedoch zu befürchten ist, dass jemand, der „unter dem Einfluss einer geistigen oder seelischen Abartigkeit höheren Grades“ ein Delikt begangen hat, unter dem Einfluss dieser „Abartigkeit“ eine weitere strafbare Handlung mit schweren Folgen begehen könnte, erfolgt die Einweisung in den Maßnahmenvollzug. Aus dem Rechtsbrecher wird ein Patient der Forensischen Psychiatrie, der behandelt wird, bis seine Gefährlichkeit abgebaut ist und dann mit einer gerichtlichen Behandlungsweisung bedingt entlassen werden kann. Die Unterbringung im Maßnahmenvollzug ist als „vorbeugende Maßnahme“ definiert, die dem Abbau der spezifischen Gefährlichkeit und damit der Abwendung künftiger Gefahren, die vom Untergebrachten ausgehen, dient. Zweck der Unterbringung ist, den Zustand des Untergebrachten soweit zu bessern, dass von ihm die Begehung weiterer Straftaten nicht mehr zu erwarten ist, und „den Untergebrachten zu einer rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung zu verhelfen“. Zur Erreichung der Vollzugszwecke sind die Untergebrachten „entsprechend ihrem Zustand ärztlich, insbesondere psychotherapeutisch, psychohygienisch und erzieherisch zu betreuen“. ● Ohne hier auf die Details der Unterbringung in der „vorbeugenden Maßnahme“ eingehen zu wollen, sollen doch die wesentlichen Charakteristika genannt sein: ● Die Unterbringung erfolgt, was das Ausmaß an Freiheitseinschränkung betrifft, unter haftähnlichen Bedingungen, unabhängig davon, ob sie an spezialisierten forensischen Abteilungen psychiatrischer Krankenhäusern oder in spezialisierten Justizanstalten vollzogen wird. ● Die Unterbringung erfolgt zeitlich unbegrenzt. Da es sich unabhängig von der Schwere des Delikts um eine „vorbeugende Maßnahme zum Abbau der spezifischen Gefährlichkeit“ handelt, ist die Entlassung an den Behandlungserfolg und die damit verbundene günstige Prognose geknüpft. ● Die Überprüfung der Notwendigkeit der weiteren Anhaltung erfolgt in der Regel einmal jährlich. ● Die Entscheidung über die Entlassung fällt das Gericht. In der Regel werden dafür positive Stellungnahmen der Behandelnden und ein positives Gutachten eines externen Sachverständigen benötigt. ● Bei der Entlassung handelt es sich immer um eine bedingte Entlassung, d. h. die Entlassung ist an Bedingungen (meist die Fortführung einer bestimmten Art der Betreuung oder Behandlung) geknüpft. Aus diesen Eckdaten wird ersichtlich, dass die Entstehung des Maßnahmenvollzuges untrennbar mit dem Auftreten einer Fachdisziplin, der Forensischen Psychiatrie, verknüpft war, die den Anspruch erhob, über prognostisches Wissen zur Gefährlichkeitseinschätzung und behandlungstechnische Kompetenz zum „Abbau der spezifischen Gefährlichkeit“ zu verfügen. Dieser Anspruch erscheint z.B. beim paranoidpsychotischen Patienten, der im Rahmen eines Verfolgungswahnes seinen vermeintlichen Verfolger umgebracht hat und durch antipsychotische Behandlung von seinem Wahn distanziert ist, relativ unproblematisch. Nach erfolgter psychopathologischer Stabilisierung kann er unter der Auflage, dass er sich Seite 2 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie weiterhin einer medikamentösen Therapie unterzieht, entlassen werden. Diese (relative) Eindeutigkeit psychiatrischer Kategorien fehlt jedoch z.B. beim impulsiven Vergewaltiger, dessen „seelische Abartigkeit höheren Grades“ sich nicht in einem psychiatrisch gut definierten Krankheitsbild (paranoide Psychose) sondern in einem unabhängig vom Delikt häufig schlecht identifizierbaren Verhaltens- bzw. Persönlichkeitsmerkmal manifestiert. Zur Konzeptualisierung dieser pathologischen Persönlichkeitsentwicklungen sind in der Forensischen Psychiatrie zunächst vor allem psychoanalytische Konzepte verfolgt worden, welche sich aus mehreren Gründen für diesen Kontext eignen: Sie bieten das mit Abstand reichhaltigste theoretische Repertoire an Erklärungsmustern für abweichendes Erleben und Verhalten. Sie stimmen darüber hinaus in ihrem Umgang mit Kausalität, Zeit und Geschichtlichkeit mit den Grundannahmen des Maßnahmevollzugs überein: Das Delikt ist Ausdruck (Symptom) einer Störung, diese Störung kann in einem langwierigen therapeutischen Prozess behandelt werden. In den letzten Jahren haben sich in der Forensischen Psychiatrie hingegen zunehmend kognitiv- behaviorale und psychoedukative Behandlungsstrategien verbreitet, die wegen der Zielgerichtetheit ihrer Interventionen und ihrer empirisch nachgewiesenen Wirksamkeit punkten konnten. In einem Rückfallpräventionsprogramm lernt der Täter, den eigenen Entscheidungsprozess und damit zusammenhängende Risikofaktoren zu identifizieren und Kontrolle über diesen Entscheidungsprozess zu übernehmen. Im Zentrum der Behandlung steht die Arbeit am Deliktszenario, die erst abgeschlossen ist, wenn der Täter die für ihn typische Abfolge von Situationen, Gefühlen, Gedanken und Handlungen kennt, die dazu führen können, dass er wieder ein Delikt begeht. Trotz aller inhaltlicher Unterschiede zwischen einem psychoanalytischen und einem kognitiv-behavioralen Therapieansatz (vgl. Parfy, Wagner 1999) weisen diese Modelle doch auch gewisse Gemeinsamkeiten auf, die sie andererseits von einem systemischen Therapieverständnis unterscheiden: beide Theorien haben ausgefeilte Störungsmodelle, rechnen mit der Möglichkeit zielgerichteter Interventionen und konzeptualisieren eher kontinuierliche Veränderungsprozesse („Durcharbeiten der Konflikte in der Übertragungsbeziehung“ bzw. „Arbeit am Deliktszenario“). Dieses Bekenntnis zu linearer Kausalität, dieser Umgang mit Zeit und Geschichtlichkeit sind mit den Grundannahmen des Maßnahmenvollzugs gut kompatibel. Daraus ergibt sich aber auch die grundsätzliche Schwierigkeit bei der Anwendung systemischkonstruktivistischer Konzepte in diesem Kontext. SystemikerInnen konzeptualisieren keine „zugrundeliegenden Störungen“, sie verstehen Therapie nicht als langwierigen therapeutischen Prozess, in dem der Klient wie in den psychodynamischen Therapien im Wege der Durcharbeitung der Übertragung seine psychische Struktur verändert oder wie in einem psychoedukativen Programm schrittweise an die Übernahme von Eigenverantwortung herangeführt wird. Systemische Modelle verweisen im Gegensatz dazu auf die Nicht-Instruierbarkeit psychischer oder sozialer Systeme, legen eher diskontinuierliche Veränderungen nahe (Was würde wohl ein Gutachter von einer single-session-therapy eines Gewalttäters halten?) und rufen zur Skepsis gegenüber jedem diagnostischen und prognostischen Wissen auf. SIND SYSTEMISCHE KONZEPTE FÜR DIE ARBEIT IN ZWANGSKONTEXTEN GRUNDSÄTZLICH UNPASSEND? In einer Vielzahl kritischer Artikel (Herington 1993, Levold 1993, Levold et al 1993, Pleyer 1996) werden die konstituierenden Charakteristika systemisch-therapeutischen Arbeitens für den Kontext von Gewalt und sozialer Kontrolle zumindest kontroversiell diskutiert. Diese Diskussion wurde andernorts ausführlich dargestellt (Russinger, Wagner 1999) und soll daher in diesem Beitrag nur mit wenigen Sätzen angerissen werden. Ein grundlegendes Charakteristikum systemischen Denkens – die Infragestellung linearer Kausalität und die Fokussierung auf Zirkularität – erscheint vielen Autoren problematisch, wenn es zu schweren Gewalttaten Seite 3 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie gekommen ist. Vor allem aus feministischer Perspektive wurde kritisiert, dass durch die Konstruktion zirkulärer Zusammenhänge dem Opfer der Gewalttat implizit Schuld zugewiesen wird. Was für einen Beratungs- oder Therapiekontext, in dem ein Paar aktiv an Veränderung des problematischen evtl. auch gewalttätigen Verhaltens arbeitet, hilfreich ist, kann in der Einzelarbeit mit verleugnenden Tätern höchst problematisch sein. Allzu bereitwillig können inhaftierte Gewalttäter die „Provokation“ durch das Opfer nicht nur als Auslöser sondern als ausreichende Erklärung (und Entschuldigung) für das Delikt heranziehen, wodurch die Übernahme von Verantwortung und die Erarbeitung sozial akzeptierter Verhaltensweisen erschwert wird. Auch durch die Ablehnung einer „objektiven Realität“, durch eine undifferenzierte, „neutrale Haltung“ gegenüber dem inkriminierten Verhalten und durch eine strikte Auftragsfokussierung (wenn nämlich nur der Therapieauftrag des Klienten berücksichtigt wird) können systemische TherapeutInnen in eine unheilvolle Koalition mit den Verleugnungstendenzen des Täters geraten. Dass bei angemessener Differenzierungs- und Reflexionsleistung systemische Konzepte auch in der Arbeit mit Gewalttätern verantwortungsvoll angewandt werden können, wurde in dem Beitrag „Gewalt – Zwang – System“ (Russinger, Wagner 1999) ausführlich dargestellt. LeserInnen, die sich für die Anwendung systemi scher Konzepte, die nötige Adaptierung und Begrenzung für die Arbeit in Zwangskontexten interessieren, seien auf diese Arbeit verwiesen. In diesem Beitrag sollen nun drei Ebenen der „Systemkompetenz“ erläutert werden. DREI EBENEN DER SYSTEMKOMPETENZ IN DER FORENSISCHEN PSYCHIATRIE A) SYSTEMKOMPETENZ BEI DER THEORETISCHEN BETRACHTUNG DES INSTITUTIONELLEN KONTEXTES Luhmanns Konzept der funktionalen Differenzierung gesellschaftlicher Subsysteme und die Umwandlung von Gefahren in Risken durch die Kopplung an eine Entscheidung In einer systemtheoretischen Betrachtungsweise drängt sich die Formulierung auf, dass im Maßnahmenvollzug Komplexität entlang zweier verschiedener Leitdifferenzen reduziert wird: gesund/krank im medizinisch-therapeutischen Bereich, Recht/Unrecht im Bereich der Justizverwaltung. Dass es sich dabei nicht nur um eine abstrakte, der soziologischen Reflexion entsprungene Unterscheidung handelt, sondern diese in hohem Ausmaß die tägliche Zusammenarbeit der Berufsgruppen bestimmt, ist zumindest den dort Beschäftigten schmerzhaft bewusst. Bei jeder Teamentscheidung über Vollzugslockerungen, bei der der Psychiater über den zu rehabilitierenden Kranken, der Beamte über den zu bewachenden Rechtsbrecher spricht, kann diese Differenz der Unterscheidung deutlich werden. Das „Warum“ einer Vollzugslockerung bedarf für den Arzt oder Therapeuten keiner Begründung, wohl aber muss das „Warum nicht“ (Gefährlichkeit, Rückfallgefahr) kritisch bedacht werden. Der Justizwachebeamte, der nicht von therapeutischen Idealen geleitet ist, sondern im Insassen den Rechtsbrecher sieht, vor dem die Gesellschaft geschützt werden will, mag nicht nur die Gefährlichkeit anders einschätzen (meiner Erfahrung nach ist bei der Beantwortung des „Warum nicht“ relativ leicht Einigung zu erzielen) – er stellt vor allem die viel grundsätzlichere Frage des „Warum“ einer Vollzugslockerung, die er zunächst als vermeidbares Risiko ansieht. In der Forensischen Psychiatrie treffen damit regelmäßig zwei verschiedene „Systemlogiken“ aufeinander, und alle Entscheidungsträger sind aufgefordert, die Berechtigung der jeweils anderen Logik und die daraus erwachsende Argumentation zu würdigen. Neben dem vertieften Verständnis für die unterschiedlichen Leitdifferenzen und den daraus erwachsenden Konfliktlinien hat mir die Auseinandersetzung mit Luhmanns Werk noch eine andere wichtige Denkfigur eröffnet, welche die Entwicklung von einem kustodialen zu einem therapeutischem Vollzug in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang stellt. Luhmann (1991) hat darauf hingewiesen, dass in der modernen Gesellschaft zunehmend Gefahren in Risken umgewandelt werden, indem sie Entscheidungen Seite 4 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie zugerechnet werden. Dies geschieht auch in der Entwicklung des Strafvollzugs von einem kustodialen zu einem therapeutischen: Vollzugslockerungen und die Entlassung aus dem therapeutischen Vollzug basieren auf Entscheidungen, an denen zumeist die „professionellen Helfer“, also Psychiater, Psychotherapeuten etc. mit ihren jeweiligen handlungsleitenden Fachtheorien beteiligt sind. Durch die Zurechnung auf eine Entscheidung wird aus der Gefahr einer neuerlichen Straftat in Luhmanns Terminologie ein Risiko, das im Gegensatz zu den „schicksalhaften“ Gefahren verantwortet werden muss. Deshalb wird der therapeutische Vollzug – im Vergleich zum kustodialen Vollzug – weit mehr daran gemessen, wie sich die Insassen nach der Entlassung bzw. während der Vollzugslockerungen verhalten. Die Entwicklung des therapeutischen Vollzugs ist somit auch in Zusammenhang mit dem Auftreten einer wissenschaftlichen Disziplin, in unserem Fall der Forensischen Psychiatrie, zu sehen, die sich anbietet, mit Hilfe ihrer fachspezifischen Theorie das Risiko zu konzeptualisieren und abzuschätzen. Die adäquate epistemologische Fundierung dieser fachspezifischen Theorien soll nach der Konzeptualisierung des institutionellen Kontextes mit Hilfe Luhmanns Theorie der funktional differenzierten Gesellschaft als zweite Ebene von Systemkompetenz diskutiert werden. B) ERKENNTNISTHEORETISCHE KOMPETENZ IM UMGANG MIT FACHSPEZIFISCHEN THEORIEN Da auch psychotherapeutisch geschulte Fachdienste in die regelmäßig erforderliche Risikoeinschätzung im Zusammenhang mit Freigängen, Lockerungen oder Entlassungen eingebunden sind, fließen hier auch verschiedene schulenspezifische Theorien ein. Therapeuten strukturieren ihre Überlegungen entsprechend psychotherapeutischer Konzepte und formulieren sie in Begriffen, die sich aus den komplexen und günstigen Falls empirisch abgesicherten therapeutischen Theoriengebäuden ableiten. Auf diese Weise werden einzelne Ereignisse, z.B. „gefährliche Drohungen“ im Rahmen verbaler Auseinandersetzungen, in einen klinisch-biographischen und diagnostischen Rahmen gestellt und differentiell beurteilt. Was bei einem als aggressiv-gehemmt eingeschätzten Patienten als Fortschritt gesehen werden kann, mag bei einem anderen eine unerfreuliche Wiederholung eines pathologischen Musters darstellen. Bereits dieses triviale Beispiel macht den Unterschied zum kustodialen Vollzugswesen deutlich, wo Regelverstöße eindeutig definiert sind und vorhersagbare Folgen nach sich ziehen. Die Beurteilung von Verhalten vor dem Hintergrund einer psychotherapeutischen Theorie erhöht zunächst Komplexität durch das Einführen der Dimension „Bedeutung“ (vgl. Parfy, Wagner 1999). Dadurch muss es freilich noch nicht zu „besseren“ Entscheidungen kommen; gegenüber einer fixen Kopplung von einzelnen Verhaltensweisen an konkrete Entscheidungen wird zunächst ein Mehr an Variabilität einge führt, wodurch der Entscheidungsspielraum und damit der Argumentationsbedarf erhöht wird. Wenn Entscheidungen nicht willkürlich oder zufällig getroffen werden sollen, ist zu fordern, dass das der Entscheidung zugrundeliegende Verständnis psychosozialer Zusammenhänge (evtl. vor dem Hintergrund eines psychotherapeutischen Konzeptes) expliziert werden kann. Diese Argumentation muss auch für Außenstehende nachvollziehbar und darüber hinaus geeignet sein, die Problemlage differenzierter darzustellen. Insbesondere nach Fehlentscheidungen kann dies von großer Wichtigkeit sein, da so der Vorwurf, es habe Schlamperei und Willkür geherrscht, durch eine klare und theoriegeleitete Begründung entkräftet und gegenüber der Fachöffentlichkeit die Rationalität der getroffenen Entscheidung begründet werden kann. Eine auf psychotherapeutische Vorstellungen gestützte Argumentation verlässt allerdings auch den Boden alltagspsychologischer oder allgemeinmedizinischer Verbindlichkeiten und betritt das Feld der teils konkurrierenden psychotherapeutischen Modellbildungen – und zwar meist, ohne die alternativen Strukturierungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, die sich aus anderen Konzepten ableiten lassen würden. Seite 5 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie Ich weise auf diesen Punkt hin, weil hier nicht mehr nach dem Analogieschluss entschieden („gute Führung innerhalb der Anstalt erlaubt Ausgang“) sondern auf fachliche Einschätzungen zurückgegriffen wird, die einer bestimmten theoretischen Konzeptualisierung von Menschen, Störungen oder Krankheiten und der damit verbundenen Gefährlichkeit entspringen. Es ist ein Unterschied, ob meiner Einschätzung von Gefährlichkeit das Konzept „Aggressionstrieb“ oder „maligner Narzißmus“ zugrunde liegt, oder ob ich eine Gewalttat in einem zirkulären Verständnis als Teil einer Interaktionssequenz verstehe. Es gibt also im Bereich der forensischen Psychiatrie neben der Aufgabe, therapeutisch zu handeln, auch die Aufgabe, aus dieser Expertenposition Entscheidungen, die nicht die Therapie im engeren Sinne, sondern die „Lebenswelt“ des Patienten betreffen, mitzuformulieren und rational zu begründen. Das Verfügbarmachen einer rationalen Entscheidungsgrundlage, die letztlich auf dem Erahnen künftigen Verhaltens eines Menschen beruht, erwächst jedoch keineswegs direkt aus der therapeutischen Kompetenz, zumindest nicht aus der Kompetenz einer systemischen Therapeutin, deren klinische Theorie von autopoietischen Systemen und deren funktionaler Geschlossenheit ausgeht und damit eher die Nicht-Voraussagbarkeit menschlichen Verhaltens impliziert. Wenn es darum geht, auf der Basis einer ausdifferenzierten klinischen Theorie über den Patienten sprechen und ihn betreffende Entscheidungen begründen zu können, bietet das Theoriengebäude der Systemischen Therapie weniger Hilfestellung als eine pathologie- und konfliktorientierte Theorie, die neben der initialen Diagnostik auch die Beschreibung von Therapiefortschritten erlaubt. Die Ausbildung in einer bestimmten Therapieschule kann als Sozialisationsprozess begriffen werden, der dazu befähigt, die Komplexität klinischer Phänomene mit Hilfe bestimmter Modellbildungen zu reduzieren (vgl. Wagner 1996). Therapeuten verschiedener Schulen unterscheiden sich dann darin, für die Erkennung welcher Muster sie eine besondere Sensibilität entwickelt haben. So wie Ressourcenorientierung dabei hilft, Ressourcen aufzuspüren und diese im therapeutischen Prozess zu nützen, darf man wohl davon ausgehen, dass Konfliktorientierung eine ähnliche Sensibilität für nicht offen thematisierte Konflikte schafft. Ohne die Ressourcenorientierung und das „Gehör für Lösungsmelodien“ (vgl. de Shazer 1992) in der Arbeit mit geistig abnormen Rechtsbrechern missen zu wollen, scheint mir hier eine gewisse Expertise betreffend (Persönlichkeits-)Pathologie doch unabdingbar, um verantwortungsvolle Entscheidungen mitgestalten zu können. Wenn nun die Systemische Therapeutin durch das Fehlen einer pathologieorientierten klinischen Theorie für die genaue diagnostische Erfassung von psychopathologischen Phänomenen, für die differenzierte Beschreibung von deren Veränderungen und die daraus abgeleitete Prognose schon auf Expertenwissen anderer Disziplinen zurückgreifen muss, bietet doch die durch die Systemtheorie vermittelte erkenntniskritische Grundhaltung ein hohes Maß an Sensibilität dafür, wie mittels einer spezifischen psychotherapeutischen oder klinisch – psychologischen Theorie und ihrer Leitdifferenzen jeweils spezifische Unterschiede und damit Realitäten erzeugt werden. „Die Theorie bestimmt, was wir sehen können“ – im Falle der Systemtheorie, als einer Metatheorie des Beobachtens, gelingt häufig das Sichtbarmachen der getroffenen Unterscheidungen und damit auch die Identifikation der „blinden Flecke“ verschiedener Theorien. Damit soll die Nutzung von Expertenwissen, von klinischen Theorien verschiedener Provenienz keineswegs in Frage gestellt werden: Entsprechend einem Verständnis von Systemtheorie als einer Theorie der Beobachtung zweiter Ordnung ist die Nutzung von solch spezifischem „Wissen“ solange legitim, als eine exakte, logische Buchhaltung sicherstellt, dass Beobachtungen erster und zweiter Ordnung unterschieden werden. Expertenwissen kann es immer nur bei der Beobachtung erster Ordnung geben. Der wertvolle Beitrag, den systemische TherapeutInnen in solchen Fachdiskussionen leisten können, ist weniger die Formulierung einer zusätzlichen klinischen Theorie als die Anregung jener Reflexionsleistung, die nachzeichnet, in welcher Art der vor dem Hintergrund einer bestimmten Theorie erhobene Befund von der Theorie und damit vom Beobachter und nicht vom Beobachteten beeinflusst wird. Wichtig ist dabei, dass es gelingt, dies nicht als Entwertung der fachspezifischen Theorien im Sinne einer Radikalinfragestellung von Erkenntnismöglichkeit, sondern als Methode zur selbstreflexiven Vertiefung des Erkenntnisaktes zu formulieren. Seite 6 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie C) SYSTEMKOMPETENZ IM UMGANG MIT DEN KONTEXTABHÄNGIGEN SCHWIERIGKEITEN DES MASSNAHMENVOLLZUGS Bei diesen kontextabhängigen Schwierigkeiten handelt es sich vor allem um die Vermischung der Therapeutenrolle mit Aspekten der sozialen Kontrolle und das Teilhaben des Therapeuten an der institutionellen Macht der Vollzugsanstalt. Es scheint nahezuliegen, das Problem der Rollenverquickung aus sozialer Kontrolle und Therapie zu lösen, indem man externe (institutionsfremde) oder semi-integrierte Therapeuten mit der psychotherapeutischen Versorgung beauftragt. Gleichzeitig würde man aber auf diese Weise auf die Vorteile verzichten, die eine therapeutische Institution bietet: der Therapeut verliert seinen Einfluss auf das Geschehen in der Institution, es können die anderen Mitarbeiter nicht in den therapeutischen Prozess miteinbezogen werden, wodurch das Risiko inkonsistenten Verhaltens verschiedener Berufsgruppen wächst. Gleichzeitig werden Spaltungsprozesse bei den Insassen („guter Therapeut“, „böse Anstalt“) gefördert. In der systemischen Literatur hat die Auseinandersetzung mit therapeutischen Institutionen eine erst kurze Tradition. Die Übernahme von Kontrollfunktion wird dabei kontroversiell beurteilt. Während einige Autoren an ihrer Expertenschaft für Kommunikation festhalten und sich dementsprechend als Gäste im Zwangskontext definieren, sprechen sich andere für die explizite Übernahme einer parentalen Funktion aus (vgl. Pleyer 1996). Die Pioniere auf dem Gebiet der therapeutischen Institutionen – August Aichhorn, Fritz Redl, Edward Glover oder Tilman Moser – stehen einem psychodynamischen Therapieverständnis nahe und prägten Begriffe wie „therapeutisches Milieu“, „hygienische Atmosphäre“ (für die Ausschaltung aller krankmachenden Umweltfaktoren) und „aufgeteilte Übertragung“ für Übertragungsphänomene, die sich unter mehreren Mitgliedern des therapeutischen Teams aufteilten. Für die genannten Autoren war eine innige Zusammenarbeit von Psychotherapeuten und Betreuungspersonal eine conditio sine qua non therapeutischer Institutionen. Die Implikationen der dabei auftretenden Rollenkonfusion von sozialer Kontrolle und Therapie für den Therapieauftrag und die therapeutische Beziehung, vor allem aber die Möglichkeiten, damit in einer systemischen Perspektive konstruktiv umzugehen, ist Inhalt meiner weiteren Ausführungen. Laut Ludewig führt nur explizites Hilfesuchen bei der Lösung eines veränderungswürdigen und veränderbaren Problems zu Therapie. Für Psychotherapie im Zwangskontext ist hingegen eine „gemischte Auftragslage“ charakteristisch. Aber auch in der familientherapeutischen Praxis ist das Ideal der völlig freiwilligen Therapie mit hoher Eigenmotivation aller Beteiligten nicht immer gegeben. Häufig kommen Kinder, Jugendliche oder einer der Partner nur auf Bestreben eines Familienmitgliedes. In anderen Fällen besteht nur ein diffuser Leidensdruck, und die Klienten gelangen durch Überweisung in die Therapie. Ludewig (1992) unterscheidet daher Anleitung, Beratung, Therapie und Begleitung, was dem „Helfer“ erleichtern soll, im Interesse des Hilfesuchenden, also „auftragsgerecht“ zu arbeiten. Ludewig berücksichtigt damit die offensichtlich nicht nur im Maßnahmenvollzug relevante Tatsache, dass in einem therapeutischen Kontext von Klienten nicht ausschließlich (oder nicht einmal überwiegend?) „Therapieaufträge“ im engeren Sinn geäußert werden. Auch die Unterscheidung von Besuchern, Klägern und Kunden, wie sie de Shazer (1993) vornimmt, zielt nicht auf eine Motivationstypologie ab, sondern beschreibt aktuelle Beziehungsmuster, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Der Sinn dieser Unterscheidung besteht dann nicht darin, die „guten“ – weil gut motivierten – von den „schlechten“ – weil schlecht motivierten – Klienten zu trennen, sondern darin, dem Therapeuten bei der Auswahl geeigneter Interventionen zu helfen. Auch der Insasse einer Vollzugsanstalt wird in vielen Phasen Besucher oder Kläger sein, doch ist auch damit zu rechnen, dass er in Bezug auf gewisse Ziele zum Kunden werden kann, der explizit Hilfe für die Lösung veränderungswürdiger und veränderbarer Probleme sucht. Aus diesem Grunde erscheint es mir wie auch anderen in diesem Kontext Arbeitenden (vgl. Drewes, Krott 1996) nicht hilfreich, den „Therapiestatus“ Seite 7 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie in diesem Kontext radikal in Abrede zu stellen, da dies auch den Therapeuten von der Verantwortung befreien würde, sich immer wieder um einen Therapieauftrag bzw. eine therapeutische Haltung zu bemühen. Gefordert wäre hingegen eine hohe Sensibilität in bezug auf das jeweils aktualisierte Beziehungsmuster, wobei im besonderen die Aspekte sozialer Kontrolle berücksichtigt werden müssen. Neben der potentiell zu weiteren Beschränkungen führenden Einschätzung des Therapeuten wird gerade in Maßnahmenvollzugsanstalten der Therapeut häufig als Fürsprecher oder Anwalt des Klienten wahrgenommen – und zwar sowohl von den anderen Bediensteten als auch von den Insassen selbst. Psychotherapie wird auch im Maßnahmenvollzug also keineswegs als Zwangsmaßnahme im engeren Sinn wie z.B. ein Umerziehungsplan gesehen. Häufig besteht eine ambivalente Haltung – entweder ein latentes Misstrauen oder, noch typischer, ein Schwanken zwischen Idealisierung („Sie sind mein einziger Gesprächspartner“ und den damit verbundenen Hoffnungen „Sie helfen mir da raus“ oder „Mit Ihrer Hilfe werde ich ein anderer Mensch“) und tiefstem Misstrauen und Entwertung. Es gilt hier also zunächst einmal für sich selbst, dann aber auch mit dem Klienten, die Auftragslage zu klären: Welchen Auftrag hat der Gesetzgeber an die Institution, welchen Auftrag hat die Institution an den Therapeuten? In manchen Institutionen soll der Umgang mit Insassen erleichtert werden, in anderen erwartet man sich vom Psychotherapeuten Verständnis- und Entscheidungshilfen. Es muss nicht jeder Auftrag angenommen oder gar erfüllt werden, doch sollte das Feld nach mehr oder weniger explizit formulierten Erwartungen (oder Einschätzungen von Erwartungen) abgetastet werden. Dieses Vorgehen wird dem Umstand gerecht, dass therapeutische Beziehungen im Zwangskontext als triadisch zu konzeptualisieren sind: der „Auftraggeber“ als machtvolle Instanz, die den Zwang ausübt, muss berücksichtigt werden (vgl. Peyer 1996). Gerade hier bieten die in der Systemischen Therapie üblichen Fragen zur Auftragsklärung gegenüber anderen Therapieschulen einen erheblichen Startvorteil bezüglich Transparenz und Kontextsensitivität: Was erwartet x? Woran würde x merken, dass sein Auftrag erfüllt ist? Woran würde x merken, dass wir an seinem Auftrag (nicht) arbeiten? Welches Bild hat x von Ihrem Problem, dass er eine Therapie empfiehlt? All diese Fragen sind in Bezug auf die relevanten Entscheidungsinstanzen (Anstaltsleiter, Sachverständigengutachter, Richter, Angehörige) aber auch in Bezug auf die eigenen verschiedenen Rollen und die daraus erwachsende „gemischte Auftragslage“ anzuwenden: Woran würde der Gutachter/der Richter merken, dass Ihre Gefährlichkeit abgebaut ist? Welches Bild hat der Richter von Ihrer Störung, dass er eine Unterbringung in einer therapeutischen Institution veranlasste? Was müssten Sie mir als Therapeutin Ihrer Meinung nach erzählen, damit ich zu der Meinung komme, dass Ihre Gefährlichkeit abgebaut ist? Was müssten Sie mir Ihrer Einschätzung nach erzählen, damit ich von Vollzugslockerungen abrate? Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass Gefängnisinsassen mehrheitlich die Überzeugung hegen, dass Psychotherapie geeignet ist, ihre Probleme zu lösen. Wären sie dieser Überzeugung, hätten sie eventuell schon vor der Inhaftierung versucht, auf diesem Weg Veränderungen zu erzielen. Es ist daher zumeist Aufgabe des Therapeuten, statt den vielfach fatalistischen Weltentwürfen der Insassen Problemdefinitionen zu entwickeln, die den Klienten und erst dadurch auch den Therapeuten handlungsfähig machen. Die Konzeptualisierung von „Therapiemotivation“ als eindimensionale Personeneigenschaft widerspricht nicht nur systemischem Denken, sondern ist vor allem im Bereich der Forensik, wo antitherapeutische Strukturen einer entsprechenden Selbstdefinition der Betroffenen entgegenwirken, durch ein interaktives Person-Angebot-Konzept zu ersetzen (vgl. Steller 1994). Als Nicht-Gefängnis-Insasse könnte man vermuten, dass der wesentliche Auftrag des Klienten lautet: „Hilf mir, dass ich so schnell wie Seite 8 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie möglich entlassen werde“. Meiner Erfahrung nach haben Insassen jedoch keineswegs zwingend die Tendenz, die Therapie laufend in Zusammenhang mit der Entlassung zu sehen. „Was muß hier geschehen, damit ich entlassen werde“ wird zumindest explizit kaum gefragt. Der Klient wechselt von einem „Was werden oder können Sie für meine Entlassung tun“ am Anfang der Therapie häufig unerwartet schnell zu einem scheinbar absichtslosen „Wenigstens Sie verstehen mich“, um dann eventuell wieder in Zorn und bittere Enttäuschung darüber zu verfallen, dass der Therapeut nicht genug für die Entlassung getan hat. Man kann sich als Therapeut also keineswegs darauf verlassen, dass der Klient konsequent die Therapie im Hinblick auf die Entlassung nützt. Häufig neigen Insassen dazu, sich als Opfer ihrer Tat bzw. des Justizsystems zu fühlen und schreiben sich selbst wenig Veränderungsmöglichkeiten zu. Die Therapie dient dann eher dazu, die widrigen Umstände der Haft besser zu ertragen, was ein typisches Beispiel für „Begleitung“ darstellen würde. Auch diesen Auftrag kann man ernst- und annehmen. Bei allem Respekt für diesen Auftrag thematisiere ich aber immer wieder den Unterschied zwischen dem, was dann hier geschieht und den Erwartungen der „Überweiser“. Das kann dann z.B. so klingen: „Ich verstehe, dass Sie in einer sehr schwierigen Situation sind und Hilfe brauchen, um all diese Belastungen besser auszuhalten,....ich frage mich nur, wie sich diese Art von Hilfestellung für den Gutachter oder den Richter darstellt, die ja mit dieser Einweisung in eine therapeutische Einrichtung des Strafvollzuges deutlich gemacht haben, dass sie von Ihnen eine Veränderung erwarten......... Es kann aber auch so klingen: „Ich verstehe, dass Sie in einer sehr schwierigen Situation sind und am liebsten diese Stunden verwenden würden, um über die Probleme zu sprechen, die erst durch die Inhaftierung auf Sie zugekommen sind. Aber andererseits ist die Therapie hier keine Abmachung zwischen uns beiden, bezahlt werde ich vom Staat – und zwar nicht dafür, – würde der Richter sagen, Ihnen die Haft erträglich zu machen, sondern dafür, dass diese Stunden etwas dazu beitragen, dass ihre Gefährlichkeit abgebaut wird. Glauben Sie, dass es dazu kommen kann, wenn wir nur über Ihre Schwierigkeiten hier im Gefängnis sprechen?“ Diese Berufung auf den Kontext, das Thematisieren der triadischen Auftragslage kann so an ungeliebte (unbewußte?) ausgeblendete Themen heranführen und bietet damit eine pragmatische und mit systemischen Konzepten kompatible Alternative zu dem, was andere Therapieschulen als „Arbeit am Widerstand“ bezeichnen. Auch wenn im obengenannten Beispiel der Therapeut durch zirkuläres Fragen die Kontrollfunktion auf Gutachter und/oder Richter überträgt und dadurch für die therapeutische Arbeit eine neutrale Reflexionsposition sichert, muss in diesem Kontext die Vermengung von Psychotherapie mit Elementen sozialer Kontrolle doch auch offen thematisiert werden. In der systemischen Literatur wird dieses Thema für den ambulanten Bereich (z.B. Kinderschutz) breit diskutiert. Vielfach wird dabei eine Trennung von Kontrolle und Hilfe postuliert, aber auch die Gegenposition ist bekannt: Tom Levold (1993) hält diese Trennung für eine Scheinlösung – besser sei ein offener (oder offensiver) Umgang mit der Kontrollfunktion und der damit vereinbarten Machtposition, welche mit der „Selbstbescheidung als Experte für Kommunikation“ nicht auszufüllen ist. Levold fordert eine „parentale Position“: Die reale Machtposition muss offen thematisiert werden. Der Rückzug auf die therapeutische Verschwiegenheit kann häufig als Etikettenschwindel entlarvt werden, wenn z.B. Therapeuten keine Stellungnahmen schreiben, aber ihrem Vorgesetzten unter dem Titel „Supervision“ die dafür nötigen Informationen geben. Ich bevorzuge hier ein Modell der „doppelten Transparenz“, wie es auch von Vertretern der Mailänder Schule (Cirillo et al 1992) vorgestellt wurde: Ich bin als Therapeutin transparent gegenüber der Institution, indem ich über wesentliche Faktoren des Seite 9 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie Therapieverlaufes berichte, bin aber in dieser Transparenz wieder gegenüber dem Patienten transparent, indem ich ihm alle Stellungnahmen vorlese und mit ihm bespreche. Auch Virginia Goldner (1993) hält die Trennung von systemischer Arbeit und sozialer Kontrolle für eine Illusion und die „formalistische Spaltung in moralische und klinische Kategorien für theoretisch bedeutungslos und psychologisch unglaubwürdig. Die Alternative besteht darin, in der Therapie moralische Fragen aufzuwerfen, z.B. auf die psychischen Aspekte moralischer Konflikte und auf die moralischen Aspekte psychischer Konflikte hinzuweisen.“ Ein wesentlicher Faktor ist dabei natürlich der Umgang mit Lüge und Verleugnung. Der Aspekt sozialer Kontrolle äußert sich innerhalb der Therapie nicht darin, dass man Detektiv spielen muß, um die Wahrheit ans Licht zu bringen sondern in der Berücksichtigung der Tatsache, dass der Klient häufig gute Gründe hat zu lügen, was wiederholt thematisiert werden sollte: Gesetzt den Fall, das ist die Wahrheit, was erwarten Sie, was ich mit dieser Information anfange? Was würde passieren, wenn ich Ihnen nicht glaube? Gesetzt den Fall, das ist nicht die Wahrheit, was erwarten Sie von mir, wie ich mit dieser Information umgehe? Wie würde es sich auf Ihr Bild von mir auswirken, wenn ich Ihnen trotzdem glaube: Würde Sie das für mich einnehmen oder würde ich in Ihrem Ansehen sinken?... Es wäre ein Mißverständnis systemisch-konstruktivisti scher Arbeit, jede Aussage, jede Selbstbeschreibung als subjektive Realitätskonstruktion unhinterfragt stehen zu lassen. Es geht in der systemischen Therapie ja gerade und sehr explizit um das Hinterfragen der individuellen Wirklichkeitsbeschreibungen. Dass in der Art der Fragestellung der Kontext berücksichtigt wird, liegt nahe. Statt von Lügen und Verleugnung könnte man dann auch – weniger wertend und schuldzuschreibend - von kontextspezifischen Interessen des Klienten sprechen. Diese kontextspezifischen Interessen können als Störung des therapeutischen Prozesses wahrgenommen werden – hier empfiehlt es sich, diese „Störung“ zum Thema zu machen – denn das Reden über eine Störung ist etwas anderes als die Störung. RESUMÉE „Systemkompetenz“ in der Forensischen Psychiatrie besteht neben einer angemessenen Konzeptualisierung des institutionellen Kontextes also auf theoretischer Ebene darin, die Kontextabhängigkeit von Verhalten und die Beobachterabhängigkeit von Beschreibungen im Bewußtsein zu halten und für die Leitdifferenzen und damit auch für die blinden Flecken anderer klinischer Konzepte zu sensibilisieren. Auf einer praktischen Ebene ermöglicht Systemkompetenz eine therapeutische Haltung, die das explizite Thematisieren von Rollenverquickungen nahelegt und in der damit verbundenen Offenheit und Transparenz (nicht in der unkritischen Akzeptanz jeder Selbstbeschreibung) auch Respekt gegenüber dem zur Therapie Gezwungenen ausdrückt. LITERATURVERZEICHNIS BRANDL-NEBEHAY A., RUSSINGER U. (1995): Systemische Ansätze im Jugendamt – Pfade zwischen Beratung, Hilfe und Kontrolle. Z.system.Ther. 13(2); 90–104 CIRILLO D., DI BLASIO P. (1992): Familiengewalt. Klett Cotta, Stuttgart DE SHAZER S. (1992): Den Klienten zuhören. In: Z. system. Ther. 10 (4), 279–288 DE SHAZER, S. (1993): Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie. Carl Auer, Heidelberg DREWES M., KROTT E. (1996): Der Schlüssel zum Glück? Zwang als konstruktiver Beitrag zur Gestaltung von Beziehungen. In: Z. system. Ther. 14 (3): 197–202 GOLDNER, V- (1993): Sowohl als auch. In: Familiendynamik 18 (3), 207–222 HERINGTON S. (1993): Konstruktivismus und Kindesmißhandlung. Fam Dynamik 18: 255–263 KRIZ, J. (2000): Lernziel: Systemkompetenz. Planspiele als Trainingsmethode. Göttingen 2000. LEVOLD, TOM (1993): Systemische Therapie zwischen Konstruktivismus und Inquisition. In Kontext, 23,1, 26–35 Seite 10 von 11 Systemische Notizen 02/04 Forensische Psychiatrie LEVOLD, TOM, WEDEKIND, E. & GEORGI H. (1993): Gewalt in Familien. Systemdynamik und therapeutische Perspektiven. Familiendynamik S 286–311 LUDEWIG K. (1992): Systemische Therapie. Grundlagen klinischer Theorie und Praxis. Klett Cotta, Stuttgart LUHMANN N. (1991) Soziologie des Risikos. Berlin: deGruyter. MANTEUFEL, A., SCHIEPEK, G. (1997): Systemkompetenz als Modell klinischer Professionalität. In: Kontext (28) 1, 60–77. PARFY E., WAGNER E. (1999): Ich seh, ich seh, was du nicht siehst. Gedanken zur Schulenvielfalt in der Forensischen Psychiatrie. In: Wagner E, Werdenich W (Hg): Forensische Psychotherapie, Facultas PLEYER K.H. (1996) Schöne Dialoge in hässlichen Spielen? Überlegungen zum Zwang als Rahmen für Therapie. In: Z. system. Ther. 14 (3), 186–196 RUSSINGER U., WAGNER, E. (1999) Gewalt – Zwang – System. Systemisch-konstruktivistische Konzepte in institutionellen Zwangskontexten. Z. system. Ther. Jg 17, 144–156 STELLER M. (1994): Behandlung und Behandlungsforschung. In: Steller M, Dahle KP, Basqué M (Hrsgb) Straftäterbehandlung. Centaurus, Pfaffenweiler WAGNER, E. (1996): Psychotherapie als Wissenschaft in Abgrenzung von der Medizin, in Pritz, A. (Hrsg): Psychotherapie – die neue Wissenschaft vom Menschen“, Springer, Wien, New York, 219–247 DR. ELISABETH WAGNER ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Psychotherapeutin in systemischer Familientherapie in freier Praxis, Lehrtherapeutin für systemische Familientherapie i.A.; sie leitet die psychiatrische Abteilung der Justizanstalt Favoriten und hat langjährige Erfahrung in instutiioneller Psychotherapie. Seite 11 von 11