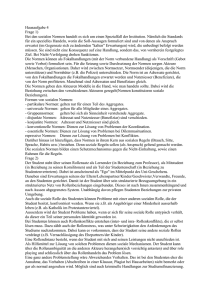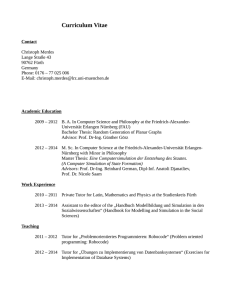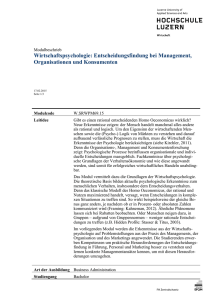1 Problemorientiertes, fallbasiertes und situatives
Werbung

1 Christof Daetwyler M.D. (IML [email protected] Dartouth College Medical School) chris- Hintergrund How can Computers assist the Students in the learning of clinical Medicine? Wie können Computer den Studenten in seinem Bestreben unterstützen, klinische Medizin zu lernen? Summary Zusammenfassung When Howard S. Barrows discovered in 1969 that "medical students and residents, for the most part, did not seem to think at all",he introduced as a consequence the "Problem Based Learning". In 1984 he adopted together with Feltovich the "script" concept to medical education. These "Illness-scripts", which are mainly generated through reflection on patient encounters, are supposed to be the underlying structures of the clinical reasonning processes. Bereits 1969 kam Howard S. Barrows zum Schluss, dass die klinische medizinische Ausbildung im argen liegt - und begann als Konsequenz den problemorientierten Unterricht einzuführen. 1984 führte ebenfalls Barrows zusammen mit Feltovich den Begriff des "Illness-scripts" in die medizinische Ausbildung ein. Diese werden vor allem durch reflektierte Patientenkontakte erzeugt. Sie bilden die eigentliche Grundlage der klinischen Entscheidungsfindung. In this article, I'll show how and under what circumstances computer assisted learning programs assist the construction of those "illness scripts" and therefore could be a valuable aid in the preparation of the students for "real clinical life". Im folgenden Artikel werden computerunterstützte Lernprogramme propagiert, mit deren Hilfe solche "Illnessscripts" erzeugt und vertieft werden können, und die dadurch in der Lage sein könnten, Studierende auf die "wirkliche" Klinik vorzubereiten. Seit mehr als 7 Jahren befasse ich mich mit der Realisation und Implementation von computerunterstützten medizinischen Lernprogrammen. Ausgelöst wurde dieses noch immer anhaltende Interesse durch das Programm „Laennec“ von Raphaël Bonvin1. In diesem Programm wurde Theorie nicht bloss multimedial aufgemotzt elektronisch dargestellt, sondern man konnte an „simulierten“ Patienten eine Anamnese abfragen, Hypothesen aufstellen und diese überprüfen lassen – und schliesslich sogar eine simulierte Untersuchung mit dem Stethoskop ausführen. Mir wurde klar, dass dies der Anfang einer neuen Art des Lernens und Lehrens sein konnte, denn mit diesem Programm vermochte ich zu lernen, was mir an der Universiät nicht hatte beigebracht werden können: Das Heraushören und Interpretieren von Lungengeräuschen am Patienten mit einer klinischen Fragestellung im Hintergrund. Da ich damals gerade erst das Medizinstudium abgeschlossen hatte, erwuchs der Wunsch in mir, in derselben Art und Weise Programme zu entwickeln um dort zu substituieren, wo ich als Student solche Lernwerkzeuge vermisst habe. Warum aber sollte es für Studierende etwas bringen, Programme in der Form von fallbasierten Simulationen zur Verfügung zu haben. Allein die Tatsache, dass es mir gefällt und ich es eine wunderbare Sache finde genügt nicht, um diese Frage zu beantworten. Reichen die bekannten Lehrbücher, Tonbildschauen, Vorlesungen, Videos und direkten Patientenkontakte denn nicht aus? Was rechtfertigt den Aufwand an personellen und finanziellen Mitteln, den eine solche Produktion bedeutet? 1 Problemorientiertes, fallbasiertes und situatives Lernen Bereits 1969 testete Howard S. Barrows Medizinstudenten der McMasters Universität: „I discovered that medical students and residents, for the most part, did not seem to think at all. Some gathered data ritualistically and then tried to add it up afterwards, while others came up with a diagnosis based on some symptom or sign, never considering possible alternatives.“2 (Barrows H.R., Twomblyn R.M.; 1980) Ihm wurde deutlich, dass die Ausbildung nicht das erbracht hatte, was von ihr erhofft wurde. Abhilfe wurde gesucht, indem das Curriculum problemorientiert gestaltet wurde, zudem wurden Wissen und Fertigkeiten in ähnlicher Umgebung erlernt und geübt, in der sie dann auch angewendet werden sollten. Der klinische Unterricht wurde anhand von Patienten problemorientiert durchgeführt mit dem Ziel, dadurch die klinischen Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Die Mittel, die damals zur Verfügung standen, waren echte Patienten und Papierfälle. Obwohl es für einen zukünftigen Arzt nichts motivierenderes gibt, als mit echten Patienten zu arbeiten und diese Art des Studiums durch 2 nichts zu ersetzen ist, haben auch die Papierfälle ihre Berechtigung. Überlegungen, die hierzu anzustellen sind3 (Barrows H.R., Twomblyn R.M.; 1980): Der „richtige“ Patient ist oft nicht dann zur Stelle, wenn das Curriculum danach verlangt. Der „wirkliche“ Patient kann unkooperativ sein und/oder sich als blosses Versuchskaninchen für die Bedürfnisse der Lehre empfinden. Viele ausbildungsrelevante Probleme sind zu heikel als dass Studierende damit üben könnten, da deren Dringlichkeit oder Komplexheit dies verbietet. Geeignete Patienten werden manchmal so oft den Studierenden „vorgeführt“, dass sie zu schlechten Schauspielern ihres eigenen Falles werden können. Heutzutage kommt noch dazu, dass es immer mehr Studenten gibt für eine bleibende Anzahl Patienten, deren Verweilzeit im Spital jedoch immer kürzer wird, was zur Folge hat, dass deren Verfügbarkeit für die Ausbildung geringer wird. 1.1 Die Wichtigkeit von Fallbeispielen Charlin, Tardif und Boshuizen beschreiben in „Scripts and Medical Diagnostic Knowledge: Theory and Application for Clinical Reasoning Instruction and Research“ 4 im Jahr 2000, wie Barrows bereits 1984 zusammen mit Feltovich5 den Begriff des „scripts“ (oder „illness scripts“) in die medizinische Ausbildung einführte. Dieser Begriff, der aus der kognitiven Psychologie stammt, bezeichnet ein Konzept, welches erklärt, wie medizinisches diagnostisches Wissen verarbeitet wird um diagnostische Problemlösungen zu ermöglichen. Dabei soll Wissen über die verschiedenen Kranheitsbilder jeweilen als „Werte-Cluster“b für jeden Aspekt abgespeichert vorliegen. Bei der klinischen Diagnosefindung werden die vorgefundenen Werte mit diesen „WerteClustern“ verglichen und daraufhin untersucht, ob sie sich mit ihnen vertragen oder nicht. Jedoch... Papierfälle sind unrealistisch und abstrakta. Sie fördern keineswegs die Fähigkeiten der Anamneseerhebung und der körperlichen Untersuchung. Sie steigern auch nicht die Fähigkeit, eigene Beobachtungen am Patienten zu machen und daraus das weitere Vorgehen abzuleiten. Die Nützlichkeit von Papierfällen ist also sehr beschränkt – und wirkt zudem nicht sehr motivierend auf die Studierenden. Barrows erkannte dies und forderte „simulierte“ (bzw. standardisierte) Patienten. Dabei handelt es sich um Schauspieler, die eine oder mehrere Krankheitsbilder darstellen können. Nun, wie wir wissen hat sich die Prüfungsform des OSCE (Objectiv Structurated Clinical Exam) an den Universitäten der USA und Canadas bereits seit längerem etabliert. Auch hier im deutschsprachigen Europa möchten wir gerne OSCE einführen – nicht nur, um die Studierenden summativ zu evaluieren, sondern auch um ihnen während des Studiums ein Self-Assessment ihrer Fähigkeiten zu ermöglichen. Leider fehlt uns jedoch dazu (noch) das Geld. Der Sender einer Information will einen Empfänger errichen. Darüber sollte sich ein Informatiker, der Software für Mediziner schreibt, klar sein und versuchen, die Informationen für Mediziner zugänglich darzustellen. Nach Piaget und Gardner gibt es ja nicht nur eine Art der Intelligenz, sondern verschiedene Intelligenz-Schwerpunkte je nach Person, Gruppe und Umfeld. Programme von Informatikern sind bezeichnenderweise oft etwas sehr textlastig und lassen sogar Bilder nur wenig Platz - da diese in abstrakten Begriffen zu denken geübt sind. Auf der anderen Seite haben wir es bei den Medizinern mit einer Zielgruppe zu tun, wovon sich nur 20% je im Bereich der Forschung bewegen - die grosse Mehrheit ist direkt in der Patientenversorgung tätig und trainiert dementsprechend v.a. die Mustererkennung und die Interpretation taktiler und auditiver Sensationen. a Abb 1: Abstrakte Darstellung dreier Illness-Scripts. Im ersten (obersten) Kriterium stimmen alle drei Cluster überein. Im zweiten Kriterium nur der linke mit dem mittleren, im dritten dann wieder der mittlere mit dem rechten. Falls sie sich nicht vertragen, wird danach ein anderes Script aktiviert, wobei diese Aktivierung beim Erfahrenen eigentlich unbewusst erfolgt, während sie der Unerfahrene noch rational deduktiv herbeiführen muss.6 Es findet also ein Reifungsprozess statt. Dieser äussert sich modellhaft darin, dass Studenten, die nach einem Patientenkontakt gebeten werden, relevante Beobachtungen sinnvoll zu präsentieren, dies nicht vermögen; für erfahrene Kliniker hingegen bildet dies in der Regel kein Problem.7 „Illness-scripts“ werden vor allem durch moderierte Patientenkontakte erzeugt4 und verfeinert – und an dieser Stelle setzen nun die multimedialen, fallbasierten, interaktiven Lernprogramme ein. Denn mit Hilfe des Computers können Fallbeispiele geschaffen werden, die nicht statisch und auch nicht textbasiert sind. Seit Mitte der 90er Jahre vermögen Computer sowohl Farbbilder als auch Film- und Tonsequenzen in akzeptierbarer Geschwindigkeit wiederzugeben. Diese multimedia„Werte-Cluster“ bezeichnet hierbei ein Netzwerk verschiedener Parameter, die innerhalb bestimmter Werte liegen müssen, um für einen Script charakteristisch zu sein. b len Möglichkeiten - gekoppelt mit programmierten Feedback-Mechanismen - erlauben es, Modellpatienten im Computer so nachzubilden, dass sie dem Studierenden audiovisuell und interaktiv entgegentreten. 1.2 Die Wichtigkeit der Lernumgebung Wie effizient Lernen erfolgt, ist jedoch lange nicht nur abhängig von den didaktischen Fertigkeiten des Lehrers bzw. Programmes, sondern in grossem Ausmass auch von der Umgebung, wo Lernen stattfindet. Godden und Baddeley8 stellten dazu 1975 folgendes Experiment an: Mitgliedern eines universitären Tauchclubs aus Schottland wurden jeweilen 36 zwei- bis dreisilbige, aus einer Liste zufällig ausgewählte Wörter per Funk vorgelesen - dabei befanden sich die Studierenden entweder 6 Meter unter Wasser oder an Land (Taucherbrille offen, Füsse im Wasser). Das freie Erinnerungsvermögen wurde dann 4 Minuten später unter Wasser und an Land getestet. Tabelle 1: Darstellung der experimentellen Ergebnisse von Godden & Baddeley, wobei möglichst viele von 36 Wörtern zu erinnern waren. Lern-Umgebung Erinnerungs - Umgebung An Land Unter Wasser An Land 13.5 8.6 Unter Wasser 8.4 11.4 Die Auswertung zeigte dabei deutlich, dass die Aufnahme von Inhalten unabhängig vom Umfeld ista - deren Erinnerung jedoch wesentlich besser funktioniert, wenn sie im gleichen Umfeld stattfindet, in dem die Inhalte gelernt wurden. In weiteren Experimenten wurden die Unterschiede der beiden Umgebungen immer mehr angeglichen, bis es sich nur noch um verschiedene Räume im selben Gebäude handelte - sogar dann blieben die Unterschiede signifikant. Es ist aber nicht nur, dass die äussere Umgebung bei der Erinnerung eine Rolle spielt; auch die innere Verfassung und Faktoren wie Hunger, Durst, Müdigkeit etc. spielen eine Rolle: was hungrig gelernt wurde, wird hungrig am ehesten wieder erinnert.b Eine Annäherung der Lernsituation an diejenige, wo das Wissen gebraucht wird, ist also sehr günstig. Im Idealfall soll dort gelernt und geübt werden, wo das Wissen und die Fertigkeiten gebraucht werden. In den Fällen, wo man nicht am Handlungsort üben kann, stellt sich die Frage, welche Teile des Handlungsumfeldes - und auf welche Art - diese nachgestellt werden soll. Lynne Reder und Roberta Klatzky9 untersuchAngenommen, die Autoren wollten beweisen, dass man an Land besser lernt als unter Wasser, wäre ihnen das gelungen - wenn sie beide Gruppen nur an Land auf die Erinnerung getestet hätten. Dies sei ihnen natürlich nicht unterschoben - der Gedanke aber reizte mich, anhand dieses Beispieles wieder einmal aufzuzeigen, wie vorsichtig experimentelle Designs zu beurteilen sind. b Eventuell lassen sich Prüfungsresultate verbessern, indem man beim Lernen und bei der Prüfung Kaugummi kaut - natürlich beide male die selbe Geschmacksrichtung. a 3 ten das Problem und versuchten die Elemente zu identifizieren, die notwendigerweise identisch sein müssen, um den Transfer zu ermöglichen. Sie vermochten jedoch keine Algorythmen zu bilden, welche die objektive Herleitung solcher kritischer Elemente erlaubte. Ich selbst neige dazu, die lange Erfahrung und das Feingefühl eines guten Lehrers dafür einzusetzen - und im Dialog mit ihm herauszuarbeiten, was wohl "simulationswürdig" ist und was nicht. Ich kann leider nicht weiter auf diese sehr interessante Problemstellung eingehen, da mir dazu das Wissen und die Erfahrung mangelt. Ich nehme jedoch daraus mit, dass es nebst dem "was" sehr wohl eine Rolle spielt, "wie", "wann" und "wo" man etwas lernt. Darauf möchte ich im nächsten Abschnitt eingehen. 2 Diskussion verschiedener Lernkategorien und der Möglichkeiten ihrer Umsetzung Tab 2: Folgende Tabelle10 veranschaulicht verschiedene Lernkategorien: Kategorie Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Umsetzung Drill & Practice Tutoriertes Lernen Fallbasiertes Lernen Entdeckendes Lernen Apprenticeship Reciprocal Teaching Projektorientiertes Lernen Wissen wird abgelagert verarbeitet Konstruiert (situativ) eine korrekte Input-/OutputRelation Richtige Antworten Korrekte kognitive Konzepte, formale Operationen richtige Methoden zur Antwortfindung Beobachten und helfen Wissen ist Lernziele Strategie lehren Die Lehr- Autorität, person ist Instruktor Tutor Feedback wird extern vorgegeben extern vorgegeben mit einer Situation operieren zu können komplexe Situationen bewältigen kooperieren Coach, Spieler, Trainer intern modelliert – daher primär unkontrolliert - Wichtige Rolle der Kommunikation! 4 2.1.1 Klassische Konditionierung: Drill & Practice Mit der Methode des „Drill & Practice“ werden die Lernenden darauf dressiert, „richtig“ und schnell, am besten reflexartig, zu reagieren. Das zugrundeliegende Paradima ist jenes der klassischen Konditionierung nach Pawlowa. Es gibt medizinische Fertigkeiten, die reflexartig beherrscht werden sollten – so zum Beispiel die notfallmässige korrekte Behandlung von Unfallopfern. Diese Dinge müssen so lange geübt werden, bis sie dem Übenden in „Fleisch und Blut“ übergegangen sind und sich quasi völlig vom Neocortex losgelöst haben – wobei sie sich dabei auch der bewussten Auseinandersetzung entziehen können. Es ist sinnvoll, vorgegebene Abläufe mithilfe von Computern zu üben – dieser „ermüdet“ nicht, ein menschlicher Instruktor jedoch schon. Die Möglichkeiten des durch Konditionierung Vermittelbaren sind jedoch eng gesetzt und enden bei der Übertragung symbolischer Inhalte. Beispiele für die Umsetzung in Lernprogrammen: Vokabeltrainer (Fremdsprachen): Wörter werden angezeigt und müssen in der zu lernenden Sprache eingegeben werden. Dies immer wieder, bis keine Fehler mehr vorkommen. Flugzeugerkennung (Militär): Nur Sekunden dauernde Filmsequenzen von Flugzeugen werden eingeblendet. Es muss zwischen eigen und fremd entschieden und der Flugzeugtyp bestimmt werden. Auch hier geht die Übung solange, bis keine Fehler mehr gemacht werden. 2.1.2 Tutoriertes Lernen Beim tutorierten Lernen versucht das System einen Lehrer zu simulieren, der dem Lernenden das zu vermittelnde Material nach didaktischen Gesichtspunkten präsentiert. Dabei wurden bisher zwei Wege eingeschlagen: In der üblichen Methode wird eine Lernumgebung hergestellt, wo der Tutor als Coach das Lösen von Aufgaben hilfreich unterstützt, wogegen mit der Methode des „Sokratischen Dialoges“ dem Lernenden immer wieder Fragen gestellt werden und er so zur Analyse der eigenen Fehler angehalten wird.11 Gerade weil das Konzept versucht, einen leibhaftigen Lehrer zu simulieren, läuft es leicht in Gefahr, zur programmierten Lerneinheit zu verkommen, die dann erfahrungsgemäss von den Studierendenb abgelehnt wird. Schuld daran ist, Aldous Huxley schildert in seinem berühmten Roman „Brave new world“ eine Gesellschaft, die durch Konditionierung geformt wurde. Anthony Burgess schilderte in seinem Roman „Clockwork Orange“, der von Stanley Kubrick verfilmt wurde, wie ein brutaler Verbrecher dazu konditioniert wird, keinerlei Aggression mehr ausüben zu können. b Hierbei liegt die Betonung auf "Studierende". Gerade im Bankensektor wird programmiertes Lernen recht oft gebraucht - und zwar um schnell, effizient und nachkontrollierbar eine grosse Anzahl Mitarbeiter zu instruieren. dass der Tutor, wenn er auf ein paar programmierbare Algorythmen und Paradigmen zusammengeschrumpft wird, seines Wissens um die Struktur der Situation und die Regeln der Lehrer-Schüler-Interaktion beraubt wird.12 Wird diese Gefahr jedoch berücksichtigt, so lassen sich bereits heute sehr „lebendige“ Tutorensysteme programmieren. Wie das gemacht werden kann, werde ich in der „Beispiel-Sektion“ dieses Aufsatzes abhandeln. Auch der nebenstehende Artikel von Dino Carl Novak „InterSim: Ein selbstbestimmtes Lernsystem mit interaktiver Führung und Autorenkomponente“ geht auf die obengenannte Problematik ein. 2.1.3 Fallbasiertes entdeckendes Lernen Bei der Vorbereitung von Studenten darauf, komplexe (klinische) Situationen bewältigen zu können, bietet sich der Einbezug des „Entdeckenden Lernens“ an13. Dabei geht es prinzipiell darum, dass der Lernende lernt, weil er die Welt verstehen und sich in ihr bewähren möchte. Dieser Prozess erfolgt in dauerndem Austausch mit der Umwelt. Besonders wichtig ist dabei, dass Fehler nicht nur gemacht werden können, sondern sogar müssen – denn es wird auch gelernt, indem Fehler als solche erkannt und vermieden werden.c Die Fehler werden dabei nicht aufgrund von falschen Assoziationend gemacht, sondern auf der Basis unrichtiger Annahmen. Diese werden nun verfeinert und korrigiert, indem sie an die „Wirklichkeit“ stossen. Es ist offensichtlich, dass es im Falle der Medizin nicht statthaft ist, wenn ein Student sein Wissen und Können nach der „Trial and Error“-Methode lernt, denn davon wären reale Patienten betroffen. Dennoch ist dies heute bei der ärztlichen Ausbildung an vielen Orten der Fall. Es gibt bisher nur wenige Programme, die eine simulierte klinische Situation schaffen, welche ein fallbasiertes und entdeckendes Lernen ermöglichen. Dies liegt sicher unter anderem daran, dass es sehr aufwendig ist, ein solches Lernsystem zu schaffen. Neben den simulierten Patienten müssen auch programmierte Tutoren geschaffen werden, damit die Studierenden sich nicht in der Freiheit verlieren. Zudem muss ein akkurates Self-Assessment sicherstellen, dass sich die konstruierten Konzepte innerhalb einer gewissen Spannweite bewegene. Wie diesen Forderungen genüge getan werden kann, versuche ich dann in der "Beispiel" Sektion aufzuzeigen. 2.1.4 Einbeziehung der psychischen Komponente a Der hier verwendete Begriff „Assoziation“ bezeichnet die durch eine Konditionierung erzeugte und nicht die sogenannt „freie Assoziation“. e Vgl. dazu die obenstehende Tabelle, worin behauptet wird, dass der Feedback beim konstruktivistischen Ansatz "Intern modelliert" wird. d 5 Joe Henderson14 streicht heraus, dass Programme, die lediglich die Komponenten „Wissen“ und „Fertigkeiten“ des Arztberufes vermitteln, keineswegs auf die wirkliche Klinik vorbereiten, da hier vor allem die „Haltung“ gefragt ist. In der Zusammenfassung zu seinem Artikel über dieses Thema beschreibt er die herrschenden Zustände folgendermassen: "For the most part...practice is viewed as technically rational and mechanistic, addressable by the application of theory-based facts and rules. This restricted model of health care largely ignores the psychosocial dimensions of health and illness. It does not prepare students to deal effectively with the real swamp of professional practice, particularly in the majority of cases where the variability of human behaviour and human situations plays a role." Aus dieser Feststellung folgert eine weitere Forderung an Programme, die fallbasiertes Entdeckendes Lernen ermöglichen: Die simulierten Patienten sollten sich je nachdem, wie der Lernende mit ihnen umgeht, entsprechend verhalten - eventuell sogar "launisch" sein und sich möglichst wie richtige Menschen benehmen, um dadurch dem Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich auf die Wirklichkeit vorzubereiten. Denn was bereits durchdacht worden ist, hat die möglichen Verhaltensnormen verändert und erweitert. Im fiktiven Beispiel kann das dann so aussehen, dass der Student gefragt wird, wie er die Mitteilung überbringen würde, dass der Patient todkrank ist und wohl bald sterben wird. Als Möglichkeiten können wir uns vorstellen, dass der Patient verharmlosend, sehr sachlich oder überaus mitfühlend über seine Krankheit informiert wird. Wählt der Student nun die überaus mitfühlende Varianten, so bricht der Patient vielleicht haltlos zusammen - bei der sehr sachlichen dagegen packt diesen die Wut gegen die Krankheit und den "überbringenden" Arzt und reagiert aggressiv. 3 Beispiele 3.1 Computerunterstützte Umsetzung der Anamnese am Beispiel des Lern-programmes "Kopfschmerz interaktiv" Unter der Anamnese verstehen wir das ärztliche Patientengespräch. Die Zielsetzungen dabei beinhalten nebst der Kontaktaufname die Erkundung des aktuelle Leidens und der medizinischen Vorgeschichte sowie das Erkennen eventuell vorhandener familiärer und sozialer prädisponierender oder mitwirkender Faktoren. Es mag den medizischen Laien erstaunen, dass in ca. 80% der Fälle die richtige Diagnose bereits mit der Anamnese gestellt werden kann. Dabei muss bedacht werden, dass zusätzlich zur anamnestisch erhobenen viele nicht verbalisierbare Informationen dazukommen, die der erfahrene Arzt aus dem Gang, dem Geruch, dem Aussehen dem Gesamteindruck oder "Aspekt" also - erfahren kann. Es gibt sogar Disziplinen in der Medizin, wo die Diagnose zu fast 100% durch eine korrekte Anamnese gestellt werden kann. Dies ist zum Beispiel bei der Diagnose verschiedener Kopfschmerzleiden der Fall. Mit dem Programm "Kopfschmerz interaktiv"16 habe ich zusammen mit Marco Mumenthaler ein Modell erarbeitet, mit welchem die Kunst der Anamneseerhebung computerunterstützt erlernt und geübt werden kanna. Im folgenden möchte ich auf die mir wichtig scheinenden Aspekte etwas eingehen und diese auch illustrieren. 3.1.1 Der Fallorientierte Einstieg You have never a second chance for a first impression. So ist es auch bei Lernprogrammen. Der erste Eindruck, der erste "screen", gibt vor was folgen wird. Im Falle des fallbasierten Kopfschmerz-Programmes bedeutet dies einen direkten Zugang über die Portraits der Patienten: Abb 2: Dieser Bildschirm bildet den Eintstieg in das fallbasierte Programm "Kopfschmerz interaktiv" "Ein Pudding beweist sich beim Essen". Dieses Zitat nach Berthold Brecht dünkt mich von zentraler Wichtigkeit. Durch die Tätigkeit des Essens wird dieser darauf reduziert, ob er schmeckt oder nicht. Er wird zum "Ding an sich"15. In der Kunstgeschichte spricht man von der "Genialität der Skizze", die oft den vielversprechenden Vorstufen noch Anhaftet - auch wenn dann im eigentlich angestrebten Endprodukt auch rein gar nichts mehr davon zu spüren sein kann. In diesem Abschnitt geht es um konkrete Dinge - also um das, was aus den Träumen geworden ist, als sie an der Wirklichkeit und Machbarkeit auskondensierten. Die im folgenden dargestellten Problemlösungen können in zukünftigen Projekten vielleicht nochmals gute Dienste leisten. Denn Ideen sollen bekannt gemacht und frei kopiert werden können, dann werden sie überleben. Ich erlaube mir also, in diesem Abschnitt anhand konkreter Beispiele darzustellen, welche Überlegungen zur computergerechten Umsetzung wir uns in den letzten sieben Jahren gemacht haben - und welche Lösungen wir dabei gefunden haben. "Kopfschmerz interaktiv" wurde dafür mit dem European Academic Software Award 2000 (EASA2000) in Rotterdam ausgezeichnet. a 6 Die Anordnung der Patientenportraits im Oval erfolgt dabei in zufälliger Reihenfolge. Somit wird auch ein Student, der immer oben rechts hinklickt, mit der Zeit alle Fallbeispiele öffnen. 3.1.2 Mehr als Text: Filme als Informationsträger Abb 4: Der Bildschirmaufbau von "Kopfschmerz interaktiv" wenn der Spezialist (Marco Mumenthaler, rechts) den Hintergrund seiner Frage offenlegt. Beim Filmen des Anamnesegespräch wurde dem erfahrenden Arzt direkt über die Schulter gefilmt, als dieser die Patientenbefragung durchführte. Für den Studenten erfolgt dadurch der Eindruck, dass er selbst am Gespräch teilnimmta. Diese Unmittelbarkeit hat eine starke motivierende Wirkung. Abb 3: Der Blick über die Schulter des fragenden Arztes ermöglicht, dass die Patienten direkt in die Kamera antworten und der Betrachter auf diese Weise direkt in das Geschehen involviert wird. Die realistische filmische Wiedergabe der Patienten vermittelt zudem viele nichtverbale Information - wie zum Beispiel der Gesichtsausdruck von Menschen, die über ihre Kopfschmerzanfälle sprechen und darob erschrecken, was sie durchgemacht haben. 3.1.3 Vom linearen Film zum interaktiven Meta-Film Film ist ein lineares Medium - daher denken Personen, die damit zu tun haben, in der Regel linear. Die klassische Lehrfilmdarstellung eines Anamnesegespräches sieht folgendermassen aus: Zuerst werden Arzt und Patient vorgestellt, dann wird das Gespräch gezeigt und schliesslich folgt ein Kommentar des Arztes. Es kann auch jede einzelne Frage an den Patienten und dessen Antwort kommentiert werden, dass macht den Film für einen fortgeschrittenen Studenten jedoch so langweilig, dass dieser kaum bei der Sache bleiben wird. Der Computer erlaubt es nun, Kommentare jeweilen auf Abruf zu zeigen. Damit wird die lineare Struktur durchstossen, da die Kommentarebene des Spezialisten parallel zur Darstellung des Patientengesprächs immer verfügbar ist. Diese Technik wird "subjektive Kamera" genannt. Es gibt berühmte Filme, die über grosse Strecken diese Technik benutzten, um eine subjektive Unmittelbarkeit zu schaffen. Vgl. dazu "Dark Passage" (1947) mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. a Im konkreten Beispiel wurde dies formal so gelöst, dass während der Film die Anamnese zeigt darunter die momentane Fragestellung auf einer Taste (engl. "Button") eingeblendet wird. Ist dem Studenten nun nicht klar, was diese Fragestellung genau bedeutet, so kann diese Taste anklicken worauf der Film gestoppt wird und der erfahrene Arzt sein Spezialistenwissen preisgibt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Anfänger kann sich alle Kommentare anschauen wohingegen der Fortgeschrittene nur dann den Spezialisten fragt wenn er Unsicher wird. 3.1.4 Wichtigkeit und Umsetzung des Self-Assessment Das Ziel des Programmes ist es, dem Studierenden ein Vokabular an wichtigen Fragen in die Hand zu geben - und eine Strategie aufzuzeigen, wie mit diesen Fragen ein genaues Bild des Leidens der Patienten gezeichnet werden kann. Ein Bild, das so klar ist, dass dadurch fast alle bekannten Kopfschmerzformen deutlich unterschieden werden können. Abb 5: Im Quiz-Modus können Fragen eingegeben werden, worauf eine Liste möglicher Fragen eingeblendet wird, aus der durch Mausklick eine Frage ausgewählt wird, die dann direkt von der Patientin im Film beantwortet wird. In diesem Beispiel erzeugt die Volltexteingabe "seit wann" die Fragen "Kopfschmerzvorgeschichte und Verlauf" und "Zeitliches Muster des Auftretens". Es muss dem Studierenden unbedingt die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst zu prüfen ob er nun fähig sei, eine korrekte Anamnese zu erheben oder nicht. Mit Hilfe eines Quiz-Moduls, welches eine simulierte Anamnese erlaubt, wird diesem Anspruch Genüge getan. Das Quiz-Modul funktioniert so, dass der Student die Frage, die er dem Patienten stellen möchte, in ein Feld schreibt. Das Programm durchsucht dabei jedes Wort der Eingabe auf typische Elemente. Werden solche typische Elemente gefunden, so zeigt das Programm in einer Liste die dazugehörigen ausformulierten Fragen a an, welche der Student nun aktivieren kann, indem er darauf klickt. Als Reaktion wird genau die Sequenz des Anamnesegesprächs gezeigt, wo der Patient die besagte Frage beantwortet. Der Student versucht dabei, möglichst alle relevanten Fragen zu stellen. Wenn er jedoch nicht mehr weiterkommt, hilft ihm der erfahrene Arzt als "Coach" dabei, die fehlenden Fragen herauszufinden. Somit wird der Student nicht gleich ob seines anfänglichen Unvermögens frustriert - dies muss unbedingt durch ein geeignetes Hilfesystem verhindert werden, denn ein frustierter Student ist ein schlechter Lerner, der die Übung abbrechen wird.17 3.2 Umsetzung der körperlichen Untersuchung dargestellt anhand des Lernprogrammes "Neurologie interaktiv"18 Bei der körperlichen Untersuchung macht sich der Arzt ein Bild von der Erkrankung des Patienten indem er quantifizierbare Werte durch standardisierte Untersuchungen erhebt. Diese Werte werden in bestimmten zeitlichen Abständen wiederholt erhoben und geben dadurch Auskunft über den Verlauf der Erkrankung. Nebst dieser offensichtlichen Funktion existiert eine wohl ebenso wichtige zweite Ebene, die dadurch ermöglichte Herstellung eines Arzt-Patienten-Kontaktes. Durch ihn erst wird der Arzt zum wirklichen Arzt. Instrumente, die dieser dabei gebraucht sind bezeichnenderweise zu Insignien ärztlicher Tätigkeit geworden wie z.B. das Stethoskop b oder der Reflexhammer. Durch bildgebende Untersuchungen wie z.B. dem Röntgen, der Magnetresonazuntersuchung oder dem Ultraschall sind viele Untersuchungstechniken verdrängt worden. Es entspricht der immer stärker werdenden visuellen Gewichtung unserer Zeit, dass man dem am ehesten glaubt, was man sieht - und dazu sind die bildgebenden Untersuchungsmethoden idealerweise geeignet. Das Wissen um die körperliche Untersuchung geht daher immer mehr verloren. Viele Ärzte beklagen sich darüber, dass sie mehr und mehr zu Managern ihrer Patienten geworden sind und die "eigentlichen" Das Programm versucht also nicht erst, die Volltexteingabe bestmöglich zu interpretieren und weicht damit den Gefahren geschickt aus, die eine Textinterpretation beinhalten. b Momentan (2001) grassiert eine Inflation von TV-Serien mit Inhalten aus Spital- oder Notfall/Rettungswesen. Darin zeichnen sich die Fernsehärzte dadurch aus, dass sie das Stethoskop dauernd locker um den Hals geschwungen tragen - ob sie nun eines brauchen oder nicht. a 7 ärztlichen Tätigkeiten in den Hintergrund geraten sind. Eine gut durchgeführte körperliche Untersuchung könnte dabei für alle Beteiligten von grossem Nutzen sein. 3.2.1 Umsetzung der körperlichen Untersuchung Am Anfang dieses Aufsatzes beschrieb ich die Fasziniation, welche Raphaël Bonvin's 1994 entstandene "Laennec CD-ROM - Lernprogramm der Pneumologie"1 auf mich ausübte. Hier erkannte ich zum ersten mal, wie der Computer eine klinische Problemlösung vermitteln konnte, nämlich die der Auskultation. Dazu gebrauchte Bonvin die bildliche Darstellung von Patienten, die man intuitiv drehen konnte, um mit dem Mauszeiger, der über "sensiblen" Regionen zu einem Stethoskop wurde, die entsprechenden Lungengeräusche aufzurufen. Das bedeutete, dass der Student selbst Informationen zusammentragen und diese auswerten musste - und dass die verwendeten Informationen dabei von der gleichen Art waren wie beim wirklichen Patientenkontakt.c Die Voraussetzungen waren also vorhanden, um computerunterstützte, interaktive, fallbasierte Medien für die Ausbildung in klinischer Medizin zu schaffen. Zu dieser Zeit machte ich mich zusammen mit Marco Mumenthaler an die Arbeit, ein computerunterstütztes Lernmodul für die klinische Neurologie zu entwickeln. Das vordringlichste Problem, das sich dabei stellte, war das Bereitstellen von 11 verschiedenen Untersuchungsinstrumenten, die am ganzen Körper angewendet werden konnten. Auf Aktionen des "Untersuchers" sollte der simulierte Pateint adäquat reagieren.19 Bei hörbaren oder gesprochenen Reaktionen (Herzschlag, Lungengeräusche, Antworten etc.) stellte dies kein Problem dar - hier konnte einfach der passende Ton eingespielt werden - anders jedoch war bei sichtbaren Reaktionen (Gangbild, Augenbeweglichkeit, Finger-Nase-Versuch etc.) keine direkte Simulation möglich. Wir entschieden uns dafür, entsprechend Filme einzuspielen in denen der Patient auf die simulierte Untersuchung reagiert.20 Abb 6: In der simulierten neurologischen Untersuchung muss der ganze Mensch von Kopf bis Fuss für die verschiedenen Werkzeuge erreichbar sein. Die Reaktion des simulierten Patienten besteht teils aus Simulation, teils aus Illustration. Bonvin's "Laennec" wurde 1994 mit dem "European Academic Software Award" ausgezeichnet. c 8 Betrachten Sie das Gangbild Prüfen Sie den Achilles- und Patellarsenenreflex Prüfen Sie die Berührungssensibiltät an den Beinen Suchen Sie nach Druckdolenzen im Ischiadicus-Verlauf Prüfen Sie das "Bragard"-Zeichen Untersuchen Sie die Wirbelsäule auf Statik und Beweglichkeit Prüfen Sie den 'Lasegue' (zuerst am gesunden Bein) Prüfen Sie die Kraft der Grosszehen beim Auszuführen der Dorsalextension. Es wurde für uns offensichtlich, dass die filmische Darstellung der Reaktionen der Patienten auf die Interventionen des Untersuchers - obwohl aus der Not geborena einen Glücksfall darstellten. Dies unter anderem deswegen, weil darin nicht nur die direkte Reaktion des Patienten dargestellt wird, sondern auch die Arzt-PatientInteraktion mit zum tragen kommt - und das digitalisierte Video bereits von ausreichender Qualität war, dass auch die Feinheiten der Bewegung und des Ausdrucks vermittelt werden konnte, wodurch der simulierte Patient "sehr lebendig" wurde. 3.2.2 Hilfe bei der Konstruktion von Illness-Scripts Je höher der Freiheitsgrad des Lernens, desto weniger profitieren die schüchternen Studenten davon15. Mit einem geeigneten Hilfesystem kann dieses Manko ausgeglichen werden. Dabei musste eine Hilfestellung derart angeboten werden, dass die Neugier des Lernenden dabei nicht zerstört wird. Eine mögliche Lösung dieses Problems fanden wir, indem wir einen "simulierten Oberarzt" schufen, den man nach Belieben herbeirufen kann. Die Hilfe, die dieser Tutor leistet besteht dabei nicht darin, das Geschehen, die Krankeit oder das Vorgehen des Studenten zu kommentieren sondern in der Erteilung einfacher Ratschläge, welche Untersuchung nun unternommen werden könnte, um weiter zu kommen. Abb 7: Wenn man nicht mehr weiter weiss, kann man einen erfahrenen Tutor rufen, der weiter hilft. Dies, indem er zu wichtigen Unter-suchungen rät, die bisher noch nicht unternommen wurden, jedoch für die Diagnosestellung wichtig wären. Die dahinterliegende Modell entspricht dem des "Illness-scripts". Marco Mumen-thaler definierte hierzu für jeden der simulierten Patienten das deren Krankheit repräsentierende klinische Script. Daraus formulierten wir dann Aufforderungen, die der Tutor an den Studierenden richtet, wenn er um Hilfestellung angegangen wird. Die Reihenfolge der Liste mit Aspekten des "Illness-scripts", welche ja als Grundlage für die Hilfeleistung des Tutors dient, ist dabei jedesmal eine andere b. Zudem wird bei jeder Untersuchung, die der Student bereits gemacht hat, das entsprechende Item aus der Liste entfernt, so dass der Tutor nur zu Untersuchungen rät, die noch nicht gemacht wurden, jedoch von grosser Wichtigkeit sind. 3.2.3 Der Lösungsweg als Diskussionsgrundlage Die neuen Technologien sollten in verschiedenen Lernsettings eingesetzt werden können, unter anderem auch in tutorierten Gruppen. Dies könnte so aussehen, dass jeweilen mehrere Studierende in Gruppenarbeitsräumen vor oder nach dem Patientenkontakt die multimedialen Fälle diskutierend durcharbeiten. Wenn wir uns nochmal Barrows Betrachtung von 1969 in's Gedächtnis rufen „... some gathered data ritualistically and then tried to add it up afterwards, while others came up with a diagnosis based on some symptom or sign, never considering possible alternatives.“21, dann wird klar, dass das Vorgehen der Studierenden bei der Problemlösung die Grundlage bildet, auf welcher eine Diskussion geführt werden kann und die dann als Feedback in ihr Problemlösungsvermögen positiv einfliessen soll. Im Programm "Neurologie interaktiv" wird daher das Vorgehen der Studierenden für jeden Fallpatienten einzeln erfasst. Tabelle 4: Beispieltabelle, die erzeugt wurde, als ich den Fallpatienten mit der Diskushernie untersuchte strength of dorsal extension (big toe right) achilles tendon reflex (ankle jerk) (Achilles' tendon right) achilles tendon reflex (ankle jerk) (Achilles' tendon left) Lasegue's sign (straight-leg-raise) (lateral part of right lower leg) Lasegue's sign (straight-leg-raise) (lower leg left) gait (beside the patient) Tabelle 3: Aufforderungen des Tutors zum Beispiel des Patienten mit Diskushernie. "Aus der Not geboren" deshalb, weil wir zuerst einen künstlichen Patienten schaffen wollten, der entsprechend seiner Erkrankung und als folge definierter Algorithmen reagiert. Diese Umsetzung war uns aus technischen, finanziellen und personellen Mitteln nicht möglich. a Das ist darum wichtig, weil wir erreichen möchten, dass sich die Studenten nach einigen Durchgängen des Programmes an möglichst alle diese Items erinnern - und nicht nur an die paar ersten und letzten wie das der Fall wäre, wenn die Reihenfolge der Liste starr wäre. b Die aufgelisteten Daten beinhalten dabei die Untersuchung und der Ort, wo diese durchgeführt wurde. Damit wird das Vorgehen transparent - und dadurch diskutierund modulierbar. Nebst einer Auflistung der unternommenen Untersuchungen werden noch weitere Listen erzeugt, die von den Studierenden aufgerufen werden können. Diese weiteren Listen sind so konzipiert, dass sie den speziellen Anforderungen der verschiedenen Lernsettings möglichst optimal entsprechen. So gibt es zum Beispiel für das Setting des selbständig Lernenden eine Liste, wo die zu erhebenden Befunde für jede unternommene Untersuchung mit den dazugehörigen pathophysiologischen Erklärungen aufgelistet werden. Tabelle 5: Je nach Bedürfnis sind verschiedene Auflistungen verfügbar. Diese hier nennt nebst der Untersuchung und dem Ort auch die korrekterweise zu erhebenden Befunde und gibt zudem pathophysiologische Hinweise (Hier am Beispiel des 1. Items der Tabelle 4 demonstriert). Examination Findings Meaning strength of dorsal ex- decreased on The long extensor muscle of the big toe tension (big toe right) the right side is mainly innervated throught the L5root. Lasegue's sign (straight-leg-raise) (lower leg left) 60 Degree The elevation of the straightened leg pulls upon the roots of the sciatic nerve. These are mainly L5 and S1. Einen ganz anderen Weg bei der Darstellung des Vorgehens beschreitet die Gruppe "Instruct" mit dem Programm "CASUS", welches von Martin Fischer et al. ebenfalls in dieser Nummer der ZSfHD eingehend erläutert wird. Kurz Zusammengefasst wird dabei das eigene Vorgehen reflektiert und in einer interaktiven Graphik bildhaft umgesetzt. 4 Schlussfolgerungen Es wurde aufgezeigt, dass klinisches Wissen und Fertigkeiten am besten fallbasiert am Krankenbett erlernt werden können (illness-scripts). Hierbei ist ein coachender Tutor eine sehr wertvolle Hilfe. Im Sinne der Schonung von Patienten und einem möglichst sinnvollen Aufbau des Curriculums ist es vorteilhaft, computerunterstützte, fallbasierte Lernhilfen anzubieten (eventuell sogar selbst zu entwickeln, wenn noch nicht vorhanden). Den Lernprogrammen muss ein klarer Stellenwert im Curriculum zugewiesen werden und dieser muss von der Fakultät kommuniziert werden. Nur so werden die Lernprogramme "richtig" genutzt und die für die Erstellung notwendigen Investitionen verpuffen nicht ungenutzt. 9 Die Lernprogramme sollten - wann immer möglich - dort zur Verfügung gestellt werden, wo das Gelernte dann abrufbar bzw. anwendbar sein soll. In spezifischen Lernumgebungen sollten die verschiedenen Lernsettings berücksichtigt werden, so dass Studierende auch in Gruppen und diskutierend mit Computern lernen können. Methoden wurden bereits entwickelt, die es erlauben, klinische Inhalte mit Hilfe der neuen Technologien zu transportieren und den Transfer zu überprüfen. Dieser Band der ZSfHD zeigt etliche solcher Techniken auf. An dieser Stelle möchte ich mich schliesslich bei Prof. Rolf Schulmeister herzlich dafür bedanken, dass er - trotz Zeitmangels - das Manuskript durchgelesen und die nötigen Korrekturen angebracht hat. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erkenntnis bei der Lektüre der folgenden Artikel. Referenzen: 1 Bonvin R; „Laennec CD-ROM: Interaktives Lernprogramm in der Pneumologie“; Springer Verlag 1994; Order-number 32015 2 Barrows H.R., Twomblyn R.M.; „Problem-Based Learning“ – An Approach to Medical Education; Springer Series on Medical Education Vol.1 1980; Page xi (Preface) 3 Barrows H.R., Twomblyn R.M.; „Problem-Based Learning“ – An Approach to Medical Education; Springer Series on Medical Education Vol.1 1980; Page 58 4 Charlin B., Tardif J., Boshuizen H.P.A.; „Scripts and Medical Diagnostic Knowledge: Theory and Application for Clinical Reasoning Instruction and Research“; Acad. Med. 2000;75:182-190 5 Feltovich P.J., Barrows H.S.; „Issues of generality in medical problem solving. In: Schmidt HG, De Volder ML (eds). Tutorials in Problembased Learning: A new Direction in Teaching the Health Professions. Assen, The Netherlands: Van Gorcum, 1984 6 Bordage G, Lemieux M.; „Some cognitive characteristics of students with and without diagnostic rasoning difficulties“; Proceedings of the 21st Annual Conference on Research in Medical Education of the American Association of Medical Colleges, Washington DC, 1986:171-176 Bordage G, Lemieux M.; „Structuralism and medical problem solving“ Int. Semiotic Spectrum, 1987:3-4 7 Barrows H.R., Twomblyn R.M.; „Problem-Based Learning“ – An Approach to Medical Education; Springer Series on Medical Education Vol.1 1980 8 Godden D.R., Baddeley A.D.; "Context-dependent memory in two natural environments: On land and under water"; British Journal of Psychology, 66: 325-331 9 Reder L., Klatzky R.L.; "The Effect of Context on Training: Is Learning Situated?"; School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburg, Pennsylvania, 1994; PDF download at http://citeseer.nj.nec.com/reder94effect.html 10 Abgeändert von Schulmeister R. und Daetwyler C. nach Eberle F.; „Didaktik der Information“; Sauerländer Verlag 1996; ISBN 3794141571; gefunden unter http://beat.doebe.li/bibliothek/b00139.html 11 Schulmeister R.; „Grundlagen hypermedialer Lernsysteme“ 2. Auflage; Verlag Oldenburg; Seite 186 12 Schulmeister R.; „Grundlagen hypermedialer Lernsysteme“ 2. Auflage; Verlag Oldenburg; Seite 187 13 Schulmeister R.; „Grundlagen hypermedialer Lernsysteme“ 2. Auflage; Verlag Oldenburg; Seite 72 14 Henderson J.V.; "The Virtual Practicum: Correcting Descartes' Error With Computers?": ZSfHD 15 Brecht B.; "Über das Ding an sich"; Frankfurt/Main Bd. 20 der Gesamtausgabe 16Mumenthaler M., Daetwyler C.: "Kopfschmerz interaktiv"; AUM 2001; ISBN 3908619-14-9 17 Cooper C, Taylor R; "Personality and performance on a frustrating cognitive task"; Percept Mot Skills 1999 Jun;88(3 Pt 2):1384 18 Mumenthaler M., Daetwyler C.: "Neurologie interaktiv"; Thieme Verlagsgruppe 1998; ISBN 3-13-115691-0 (english Version: AUM 2000; ISBN 3-9086-19-13-0) 19 Daetwyler C.; "Neurology Interactive - an Interactive CD-ROM to Supplement Clinical Experience"; Proceedings "ED-Media & ED-Telecom 10th World Conference" ISBN 1-880094-30-4 S. 1609 - 1610 20 Daetwyler C.; "Die Videodokumentation von Patienten im Hinblick auf deren Verwendung in Lernmedien"; Proceedings "Computer Based Training in der Medizin"; München 1998; ISBN 3-8265-3673-8 21 Barrows H.R., Twomblyn R.M.; „Problem-Based Learning“ – An Approach to Medical Education; Springer Series on Medical Education Vol.1 1980; Page xi (Preface) 10