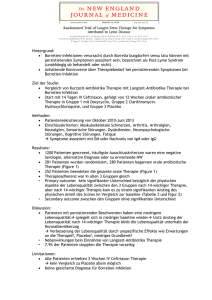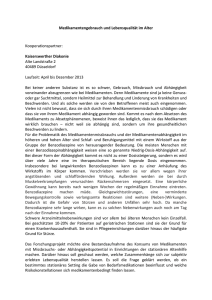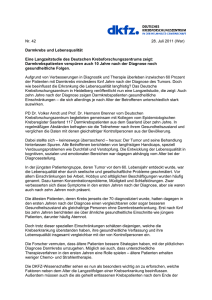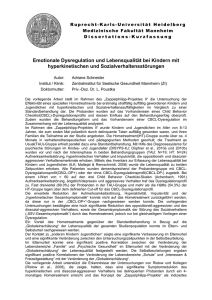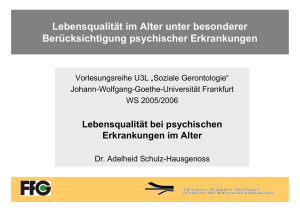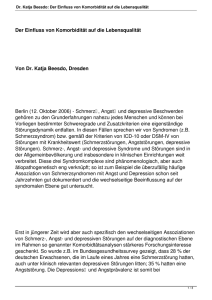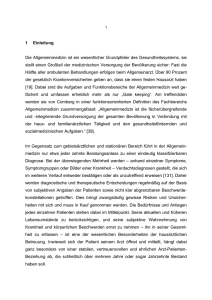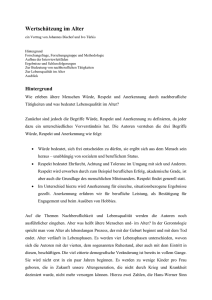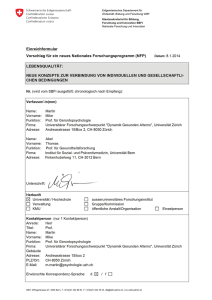lebensqualität und subjektiver gesundheit
Werbung
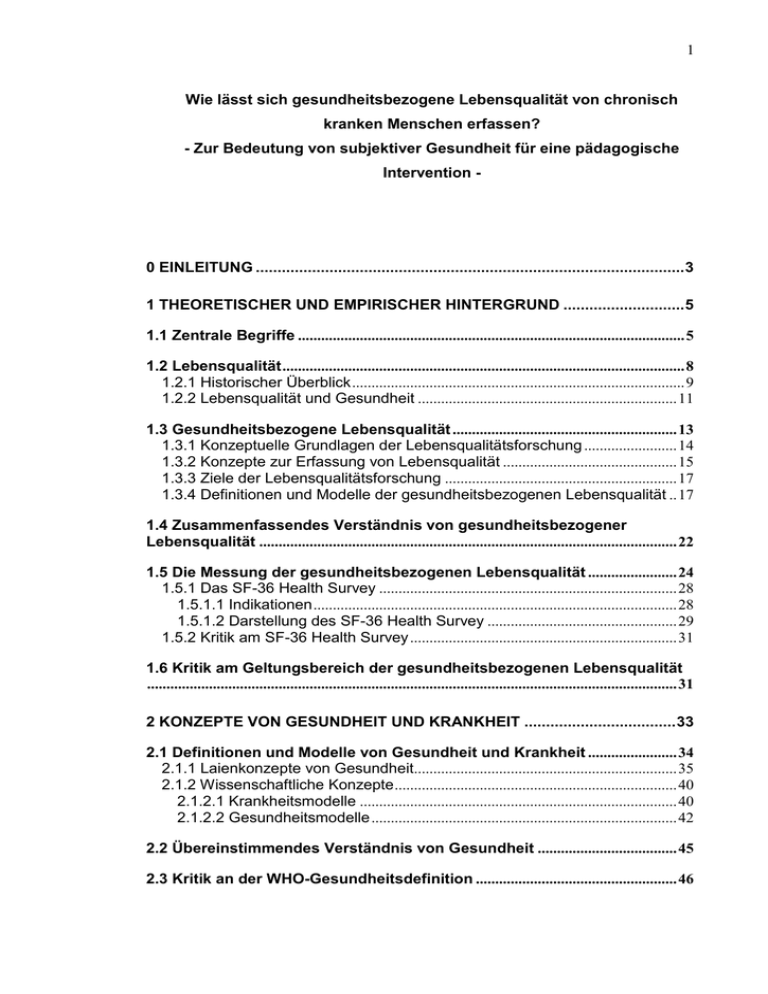
1 Wie lässt sich gesundheitsbezogene Lebensqualität von chronisch kranken Menschen erfassen? - Zur Bedeutung von subjektiver Gesundheit für eine pädagogische Intervention - 0 EINLEITUNG ................................................................................................... 3 1 THEORETISCHER UND EMPIRISCHER HINTERGRUND ............................ 5 1.1 Zentrale Begriffe .................................................................................................... 5 1.2 Lebensqualität ........................................................................................................ 8 1.2.1 Historischer Überblick ...................................................................................... 9 1.2.2 Lebensqualität und Gesundheit ................................................................... 11 1.3 Gesundheitsbezogene Lebensqualität .......................................................... 13 1.3.1 Konzeptuelle Grundlagen der Lebensqualitätsforschung ........................ 14 1.3.2 Konzepte zur Erfassung von Lebensqualität ............................................. 15 1.3.3 Ziele der Lebensqualitätsforschung ............................................................ 17 1.3.4 Definitionen und Modelle der gesundheitsbezogenen Lebensqualität .. 17 1.4 Zusammenfassendes Verständnis von gesundheitsbezogener Lebensqualität ............................................................................................................ 22 1.5 Die Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ....................... 24 1.5.1 Das SF-36 Health Survey ............................................................................. 28 1.5.1.1 Indikationen .............................................................................................. 28 1.5.1.2 Darstellung des SF-36 Health Survey ................................................. 29 1.5.2 Kritik am SF-36 Health Survey ..................................................................... 31 1.6 Kritik am Geltungsbereich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ......................................................................................................................................... 31 2 KONZEPTE VON GESUNDHEIT UND KRANKHEIT ................................... 33 2.1 Definitionen und Modelle von Gesundheit und Krankheit ....................... 34 2.1.1 Laienkonzepte von Gesundheit.................................................................... 35 2.1.2 Wissenschaftliche Konzepte ......................................................................... 40 2.1.2.1 Krankheitsmodelle .................................................................................. 40 2.1.2.2 Gesundheitsmodelle ............................................................................... 42 2.2 Übereinstimmendes Verständnis von Gesundheit .................................... 45 2.3 Kritik an der WHO-Gesundheitsdefinition .................................................... 46 2 3 CHRONISCHE KRANKHEIT UND DARAUS RRESULTIERENDE .............. 47 BELASTUNGEN ............................................................................................... 47 3.1 Chronische Krankheit und krankheitsübergreifende Belastungsfaktoren am Beispiel von Diabetes, Rheuma und HIV ................ 48 3.1.1 Diabetes mellitus ............................................................................................ 50 3.1.2 Rheumatische Erkrankungen ....................................................................... 50 3.1.3 HIV-Infektion.................................................................................................... 51 3.2 Gesundheitsbezogene Lebensqualität und psychosoziale Folgen ....... 52 4 SUBJEKTIVE GESUNDHEIT UND PÄDAGOGISCHE INTERVENTIONEN 54 4.1 Das Subjekt im gesundheitsbezogenen Alltag............................................ 55 4.2 Patientenberatung und Patientenschulung .................................................. 56 4.2.1 Ziele von Patientenberatung und Patientenschulung ............................... 59 4.2.2 Einflussfaktoren auf Patientenberatung und Patientenschulung ............ 62 5 UNTERSUCHUNGEN ZU GESUNDHEITSBEZOGENER ............................ 64 LEBENSQUALITÄT UND SUBJEKTIVER GESUNDHEIT .............................. 64 5.1 Methode und Durchführung ............................................................................. 65 5.1.1 Zielsetzung und Fragestellung ..................................................................... 66 5.1.2 Teilnehmer/innen ............................................................................................ 66 5.1.3 Auswertung...................................................................................................... 67 5.2 Interviews und kommunikative Validierung ................................................. 67 5.2.1 Fallbeispiel: Diabetes mellitus ...................................................................... 69 5.2.2 Fallbeispiel: Rheumatische Erkrankung ..................................................... 75 5.2.3 Fallbeispiel: HIV .............................................................................................. 83 5.3 Ergebnisse der Untersuchung ......................................................................... 89 5.3.1 Ergebnisse in Bezug auf subjektive Gesundheit ....................................... 90 5.3.2 Ergebnisse in Bezug auf die individuelle Bewertung ................................ 91 5.3.3 Ergebnisse in Bezug auf pädagogische Interventionsansätze ............... 92 6 SCHLUSSBETRACHTUNG .......................................................................... 94 7 LITERATURVERZEICHNIS........................................................................... 96 8 ANHANG ..................................................................................................... 105 3 0 EINLEITUNG Chronisch kranke Menschen erfahren in ihrem Leben vielfältige Einschränkungen, wobei zumindest phasenweise physische, psychische oder soziale Fertigkeiten gefordert sind. Die von chronisch Kranken empfundene Lebensqualität hängt von verschiedenen Bedingungen ab, wie zum Beispiel den Einflüssen der Umgebung, der sozialen Unterstützung und des körperlichen und seelischen Zustands des Patienten. Damit sind zur Bewertung von Gesundheit und Krankheit komplexe biopsychosoziale Dimensionen erforderlich. Die Lebensqualität für den chronisch Kranken wird zu einem immer wichtigeren Beurteilungskriterium für medizinische Maßnahmen und Arzneimittelprüfungen – z.B. Nebenwirkungen antiretroviraler Therapie bei HIV , so dass in der Medizin das patientenbezogene Krankheitserleben immer stärker berücksichtigt wird. Im Blickpunkt steht der Aspekt der Patientenzufriedenheit. Damit wird eine Zielveränderung in der medizinischen Versorgung eingeleitet und gleichzeitig den Bedarf an psychosozialer sowie pädagogischer Intervention begründet. Eine konstruktive Art des Fragens ist das Aufstellen einer Hypothese. Daher befindet sich ein Fragezeichen im Titel, als Versuch einer solchen Hypothesenbildung. Die vorliegende Diplomarbeit geht der Frage nach, ob Lebensqualitätsmessungen die subjektive Gesundheit von chronisch Kranken genügend abbilden. Deshalb ist der Ausgangspunkt dieses Beitrags die Befürchtung, dass wichtige individuelle Einschätzungen vernachlässigt werden. Mit dem Versuch, die sich andauernd verändernden gesundheitlichen Phänomene zu objektivieren und messbar zu machen, gehen subjektive Informationen verloren. Folgerichtig lautet die Hypothese, dass Personen mit einer chronischen Erkrankung in der Bewertung ihrer subjektiven Gesundheit von den Ergebnissen standardisierter Messinstrumente abweichen. Um den Zusammenhang und eine Abgrenzung der Problemstellung zu verdeutlichen, wird eine Erläuterung der zentralen Begriffe vorangestellt und das Konzept der gesundheitsbezogenen Lebensqualität auf dem aktuellen theoretischen Hintergrund verdeutlicht. Das Kapitel 1 ist so aufgebaut, dass die Überleitung von der Darstellung allgemeiner Lebensqualität zum Teilaspekt der gesundheitsbezogenen Lebensqualität in einem zusammenfassendem 4 Verständnis des Konzeptes mündet. Nach der Darstellung des hier verwendeten SF-36 Messinstruments endet das Kapitel mit der Kritik am Geltungsbereich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Da sich die meisten Definitionen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität auf die allgemein anerkannte Definition von Gesundheit der World Health Organisation (WHO) beziehen, erfolgt der gleiche Aufbau in Kapitel 2. Nach der Darstellung verschiedener Gesundheitsdefinitionen und Modelle mündet das übereinstimmende Verständnis von Gesundheit in der Kritik an der WHO Definition. In Kapitel 3 sind die gesundheitlichen Einschränkungen thematisiert. Neben krankheitsübergreifender Belastungsfaktoren werden am Beispiel dreier chronischer Krankheiten - Diabetes, Rheuma und HIV - krankheitsspezifische Beschränkungen exemplarisch verdeutlicht und auf psychosoziale Faktoren aufmerksam gemacht. Kapitel 4 behandelt Möglichkeiten, die gesundheitsbezogene Lebensqualität mittels subjektiv akzentuierter Patientenschulung und Patientenberatung zu verbessern. Diese Interventionsformen bieten chronisch Kranken die Möglichkeit eines Krankheitsmanagements gemäss individueller Bedürfnisse und Ziele. Zu den eigenen Untersuchungen zu gesundheitsbezogener Lebensqualität in Kapitel 5 ist neben der Darstellung der Methodik das SF-36-Testergebnis den Interviews vorangestellt, so dass abschließend eine kommunikative Validierung vorgenommen werden kann. Die Ergebnisse der Tests werden hinsichtlich gesundheitsbezogener Lebensqualität, subjektiver Bewertung und pädagogischer Interventionsansätze der Patientenschulung und Patientenberatung aufeinander bezogen. Im letzten Kapitel (Kap. 6) befinden sich schlussfolgernde Überlegungen zum Thema der vorliegenden Arbeit. 5 1 THEORETISCHER UND EMPIRISCHER HINTERGRUND In der Literatur wird häufig der Mangel an einer theoretischen Verankerung der Lebensqualitätsforschung diskutiert. Es werden verschiedene Modelle und Definitionen dargelegt, die jeweils auf unterschiedliche Dimensionen zurückgreifen (Dirhold & Thomas, 1996; Vallerand, Breckenridge & Hodgson, 2001; Bullinger, 1998; Ludwig, 1991; King, 2001). Gesundheitsbezogene Lebensqualität wird zusammenfassend als mehrdimensionales Konstrukt verstanden, das zur Bestimmung der Wirksamkeit von Behandlungsformen eingesetzt werden kann. 1.1 Zentrale Begriffe Eingangs sollen die für diese Arbeit zentralen Begriffe wie Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensqualität, gesundheitsbezogene Lebensqualität und subjektive Gesundheit erläutert werden. Gesundheit ist ein vielschichtiger, oft normativ verwendeter Begriff, dessen Definition grundsätzlich nicht objektiv erfolgen kann, sondern das Ergebnis sich wandelnder Gruppeninteressen und Diskurse darstellt (Blättner, 1994, S.18 ff). Die World Health Organisation (im Folgenden: WHO) hat 1946 den Gesundheitsbegriff als körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden definiert und nicht nur als Fehlen von Krankheit. Diese Definition der WHO bietet drei Vorzüge: Sie stellt Gesundheit als eigenständigen positiven Zustand dar, sie bezieht sich auf den ganzen Menschen in seinen körperlichen, geistigseelischen und sozialen Aspekten, und sie stellt das subjektive Befinden des Einzelnen in den Mittelpunkt. Problematisch muss allerdings das Leitbild des „umfassenden Wohlbefindens“ angesichts der anthropologischen Unausweichlichkeit von Altern, Trennung, Verlust und Tod erscheinen. Hinter dieser Vorstellung steht ein Fortschrittsglaube, der menschliches Leiden letztlich für besiegbar hält; eine Ideologie, die unter dem Stichwort „Fitnessgesellschaft“ kritisiert wird. Leiden und Lebenskrisen sind jedoch nicht nur grundsätzlich unvermeidbar, sie bringen nicht nur eine erhöhte Anfälligkeit 6 für körperliche und psychische Erkrankungen mit sich, sondern sie stellen auch unverzichtbare Anstöße für die persönliche Entwicklung und den Erhalt der Gesundheit dar. Ausführlicher wird dies in Kapitel 3 dargestellt. Der Begriff Wohlbefinden taucht an zentraler Stelle in der Gesundheitsdefinition der WHO auf. Er hat einen primär alltagssprachlichen Charakter und betont die subjektive Seite von Gesundheit (Mayring, 1991). Gerade diese Subjektivität jedoch macht deutlich, dass Gesundheit und Wohlbefinden als Leitziele für jeden Menschen etwas anderes bedeuten können. Diese Einsicht macht es der Wissenschaft schwer, beide Begriffe eindeutig zu definieren und zu operationalisieren. Galt es bislang in der Medizin und Psychologie vor allem, auf Anzeichen von Missbehagen, Beschwerden und Störungen zu achten, wird nun den ungestörten, positiven Anteilen Aufmerksamkeit gewidmet (Frank, 1991). Wohlbefinden bezeichnet demnach einen komplexen subjektiven Bewusstseinszustand, der grundsätzlich nicht unmittelbar der Beobachtung von außen zugänglich ist. Durch das Ausdrucksverhalten und Handeln eines Menschen kann zwar bisweilen indirekt auf das Ausmaß seines angenommenen Wohlbefindens geschlossen werden, letzte quantifizierbare Instanz sind aber sprachliche Äußerungen des jeweiligen Individuums. Fragt man Menschen nach ihrem Wohlbefinden, so stellt sich heraus, dass sich die Antworten auf eine Vielfalt von Aspekten beziehen können und von Person zu Person sehr unterschiedliche Begriffe benutzt werden. Bei Ludwig (1991) sind einige Beispielnennungen wie „Telefonat mit Sohn“, „guter Sex“ und „wenig Sorgen“ aufgeführt. Nach einer Übersicht von Becker (1991) wird zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden differenziert. Aktuelles Wohlbefinden setzt sich zusammen aus positiven Gefühlen, Stimmungen und körperlichen Empfindungen sowie dem Fehlen von Beschwerden. Habituelles Wohlbefinden bezieht sich auf die Selbstbeurteilung des für die Person andauernden typischen Wohlbefindens über einen längeren Zeitraum, der eine hohe Stabilität aufweist, so dass von einer relativ konstanten Eigenschaft ausgegangen werden kann. Weiterhin ist wichtig, dass physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden eng miteinander verbunden sind bzw. in Wechselwirkung stehen, zugleich aber als unterschiedliche Aspekte des Wohlbefindens aufzufassen sind. 7 Folgende vier Faktoren subjektiven Wohlbefindens lassen sich zusammenfassen: Wohlbefinden bedeutet Freiheit von subjektiven Beschwerden. Freude umfasst kurzfristige situationsspezifische positive Gefühle. Zufriedenheit wird als kognitiver Faktor interpretiert, der als Ergebnis der Einschätzung des eigenen Lebens, des Abwägens positiver und negativer Aspekte, des Vergleichs der eigenen Lebensziele und sozialen Erwartungen mit dem Erreichten aufgefasst wird. Glück wird als emotionale Komponente intensiven Erlebens von Wohlbefinden interpretiert, wobei das aktuelle Glücksempfinden vom langfristigen Lebensglück unterscheidbar ist (nach Mayring, 1991). In vager Form steht Lebensqualität als Konzept gegen eine Orientierung, die lediglich am quantitativen Wachstum und steigendem Lebensstandard ausgerichtet ist. Je nach Kontext werden mehr objektiv messbare Lebensbedingungen oder die subjektive Wahrnehmung dieser Bedingungen, d.h. das Wohlbefinden in einem bestimmten Lebenszusammenhang angesprochen (Glatzer & Zapf, 1984). Haase & Braden (2001) beurteilen den Begriff der Lebensqualität als einen niedrig entwickelten Begriff und kritisieren eine fehlende „unterscheidung zwischen Begrifflichkeiten, die zur Lebensqualität in Beziehung stehen, und Indikatoren, die die wesentlichen Merkmale von Lebensqualität eindeutig definieren“ (S. 96). Es gilt, Lebensqualität von anderen Begrifflichkeiten abzugrenzen, die mit ihr zusammenhängen, sich aber von ihr unterscheiden, darunter Wohlbefinden, Gesundheitszustand sowie Zufriedenheit mit dem Leben. Das Konzept der Lebensqualität hat inzwischen Eingang in den Medizinbereich gefunden, wobei sich der Terminus der gesundheitsbezogenen Lebensqualität eingebürgert hat (Bullinger, 1998). Im Rahmen der Evaluation von medizinischen Interventionen mit dem Ziel einer Qualitätsverbesserung wird Lebensqualität als eine wichtige Variable der Ergebnisevaluation genutzt. Die Lebensqualitätsforschung hat sich bei chronischen Krankheiten als eigenes Feld etabliert (vgl. dazu auch Petermann, 1996), wobei der Patientenzufriedenheit und gesundheitsbezogener Lebensqualität eine 8 bedeutsame Rolle zukommt. Bullinger (1994) liefert eine operationale Definition: „Unter gesundheitsbezogener Lebensqualität ist ein psychologisches Konstrukt zu verstehen, das die körperlichen, psychischen, mentalen, sozialen und funktionalen Aspekte des Befindens und der Funktionsfähigkeit der Patienten aus ihrer Sicht beschreibt“ (S.18, zit. n. Bullinger, 1991, S.143). Der Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität scheint aufgrund seiner Nähe zum als unklar kritisierten Begriff der Lebensqualität wenig zweckmäßig, so dass Bullinger (1996b) den Begriff der subjektiven Gesundheit als geeigneter erachtet. Auch die theoretische Fundierung wird als mangelhaft bewertet, so dass die Definition von gesundheitsbezogener Lebensqualität und empirische Arbeiten dazu, eher den Standpunkt der jeweiligen Forscher/innen ausdrückt (Vallrand, Brechenridge & Hodgson, 2001). Rose, Fliege, Hildebrandt, Bronner, Scholler, Danzer und Klapp (2000) führten eine krankheitsübergreifende Untersuchung an 3900 Patienten durch mit der Fragestellung, inwieweit der Begriff Lebensqualität als übergeordnetes Konstrukt für die herkömmlichen gesundheitsbezogenen Lebensqualitätsdimensionen geeignet ist. Das Ergebnis lässt den Begriff unpräzise erscheinen. „Die Annahme, dass die Dimensionen physisches und psychisches [sic] Wohlbefinden, Alltagsfunktionsfähigkeit und soziale [sic] Einbindung allgemeingültig unter dem Oberbegriff ´Lebensqualität´ zu subsumieren sind, [...] nicht gerechtfertigt“ (S. 219). Der Begriff „subjektives Gesundheitsgefühl“ erscheint den Autoren treffender. 1.2 Lebensqualität Der Begriff bezeichnet die Konstellation der objektiven Lebensbedingungen und des subjektiven Wohlbefindens von Individuen oder Gruppen in einer Gesellschaft. Lebensqualität bezieht sich vor allem auf ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte und deren individuelle Bewertung. Von der Wohlfahrtsökonomik zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt, bezeichnet Lebensqualität als sozialwissenschaftlicher Terminus einen mehrdimensionalen Wohlfahrtsbegriff, der vornehmlich auf den individuellen Bereich zielt (Glatzer & Zapf, 1984). 9 Seitdem der Begriff der Lebensqualität in den Sprachgebrauch von Wissenschaftlern und Politikern aufgenommen wurde, stieg die Anzahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema stetig an. Eine Literaturrecherche im Index Medicus erbrachte 1996 zum Stichwort „quality of life“ eine Trefferquote von 1400 Quellenangaben (Grant & Rivera, 2001). Gibt man heute, im Jahre 2002, das Stichwort „Lebensqualität“ als Suchbegriff in die Internetsuchmaschine „Fireball“ ein, erhält man 43.830 Quellenangaben, wobei der Begriff Lebensqualität in unterschiedlichem Kontext Verwendung findet (http://www.fireball.de). Lebensqualität und angrenzende Bezeichnungen wie Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück sind Begriffe, deren Bedeutung nicht beobachtbar, sondern mittels konstituierender Komponenten zu erschließen sind. Psychologen, Mediziner, Soziologen sowie Politologen bemühen sich schon lange um eine genauere Bestimmung der inhaltlich unscharfen Bezeichnung Lebensqualität. Dabei werden je nach Forschungsrichtung unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. In den Sozialwissenschaften wird Lebensqualität über die Lebenszufriedenheit bestimmter Populationen erfasst. Das Konstrukt „Zufriedenheit“ beinhaltet dabei eine kognitiv zu bewertende Komponente, z. B. sollen die Befragten ihre Zufriedenheit mit dem eigenen Einkommen einschätzen (Glatzer & Zapf, 1984). In der Medizin hingegen wird die „gesundheitsbezogene Lebensqualität“ untersucht. Hier spielt weniger - aber auch - eine Beurteilung gegebener Verhältnisse, sondern mehr die Reflexion des eigenen Erlebens in bezug auf eine Erkrankung oder Behandlung eine Rolle. Lindström (1992) beschreibt in einer Übersichtsarbeit den Zugang unterschiedlicher Forschungsrichtungen zum Begriff Lebensqualität. Historiker würden, so Lindström, nach dem guten Leben fragen, die Soziologen nach dem Glücklichsein, die Ökonomen interessiere die Bedingungen des Reichtums und die Mediziner konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf einen normalen Gesundheitszustand. 1.2.1 Historischer Überblick 10 Die Beschäftigung mit Aspekten menschlichen Daseins, die im weitesten Sinne auch der Lebensqualität zugeordnet werden können, hat eine lange Tradition. In der Antike wurde Lebensqualität weniger ausdrücklich als vielmehr über verschiedene Begriffsvarianten diskutiert, z.B. Glück, erfülltes und sinnvolles Leben, aber auch Wohlbefinden und angenehmen Leben. Lebenssinn, Lebensglück und Lebenserfüllung sind grundlegende Fragestellungen in der klassischen Ethik (Meier, 1995). Der Begriff der Lebensqualität als „quality of life“ wurde in den USA bereits 1920 von A. C. Pigou in Zusammenhang mit der Analyse von Arbeitsumgebungen erstmals explizit verwendet (Zapf, Breuer & Hampel, 1987). Auch in der Politik spielte der Begriff eine Rolle. In der USamerikanischen Verfassung ist mit dem `pursuit of happiness` (Spilker, 1996, zit. n. Bullinger, 1998, S.42) den Bürgern das unverzichtbares Recht verbrieft, ihr „Glück zu verfolgen“. Willi Brandt verwendete den Begriff der Lebensqualität in einer seiner Reden 1967 im Hinblick auf das wesentliche Ziel eines Sozialstaats, Solidarität gegenüber behinderten, gebrechlichen und betagten Menschen zu zeigen (Glatzer & Zapf, 1984). In der Wissenschaft war es vor allem die Sozial- und Wohlfahrtsforschung, die den Lebensqualitätsbegriff in den 70er Jahren näher untersuchte. Der deutsche Soziologe Glatzer (1992) versteht darunter eine gesellschaftliche Zielvorstellung, die die individuelle Wohlfahrt in den Mittelpunkt rückt. Lebensqualität konstituiert sich seinem Verständnis nach durch die wechselseitige Abhängigkeit von objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden (Glatzer & Zapf, 1984). Lebensbedingungen werden dieser Begriffsbestimmung zufolge mit beobachtbaren Sozialindikatoren wie Einkommen, Bildungsniveau, Wohn- und Arbeitsbedingungen, sozialen Kontakten, gesundheitlichem Zustand und politischem Engagement gleichgesetzt. Unter subjektivem Wohlbefinden verstehen Glatzer & Zapf (1984) die jeweils individuelle Einschätzung einer Person ihrer Lebensbedingungen, z. B. in Form von Zufriedenheitsangaben. Bei einer Kombination von Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden (jeweils unterteilt in gute und schlechte Bedingungen bzw. gutes und schlechtes Befinden) ergeben sich nach den Angaben der Autoren vier sogenannte „Wohlfahrtspositionen“ bzw. Typen der Lebensqualität: „Well - being“, „Dissonanz“, „Adaptation“ und „Deprivation“ (siehe Tab. 1). Die Identifikation 11 solcher Muster betrachten die Autoren als wichtige Forschungsaufgabe. Von besonderem Interesse ist, warum Personen mit guten Lebensbedingungen ein schlechtes subjektives Befinden angeben (Dissonanz) bzw. unter schlechten Lebensbedingungen durchaus über ein gutes subjektives Wohlbefinden berichten (Adaptation). In der Literatur sind diese Phänomene als Zufriedenheitsparadox und Unzufriedenheitsdilemma bezeichnet (vgl. dazu auch Dirhold & Thomas, 1996). Tabelle 1 gibt einen Überblick: Objektive Lebensbedingungen Subjektives Wohlbefinden gut schlecht gut well-being Dissonanz schlecht Adaptation Deprivation Tab.1 Wohlfahrtspositionen nach Glatzer und Zapf (1984) In der Medizin wurde dem Lebensqualitätsbegriff im Vergleich zu den Sozial- und Geisteswissenschaften deutlich später Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die Hinwendung zu nicht nur körperlichen, sondern auch psychischen und sozialen Dimensionen von Gesundheit und Krankheit und deren subjektiver Wahrnehmung hat sich der Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität etabliert (Bullinger & Ravens-Sieberer, 1996). Im Vordergrund steht die Einbeziehung der Patientenperspektive. 1.2.2 Lebensqualität und Gesundheit In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird nicht nur nach materiellen Bedingungen, sondern auch nach den subjektiven Einstellungen in Bezug auf allgemeine Lebensqualität gefragt. Themen wie Wohnung, Erwerbstätigkeit, Familienstand, Lebensstandard, Lebenszufriedenheit, Gesundheitsstatus und subjektive Gesundheit gehören dazu. Gesundheit ist eine Voraussetzung, das eigene Leben nach individuellen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Damit gilt „Gesundheit als Determinante des subjektiven Wohlbefindens“ (Lang 12 & Müller-Andrizky, 1984, S.145), wobei davon auszugehen ist, dass sich mit dem Gesundheitszustand das allgemeine Wohlbefinden und damit die wahrgenommene Lebensqualität verändert. Der in der Medizin verwandte Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ist schwer von der allgemeinen Lebensqualität abzugrenzen (Rose, Fliege, Hildebrand, Bronner, Scholler, Danzer & Klapp, 2000). Die WHO definiert Gesundheit als Zustand physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens, auf deren drei Kerndimensionen - körperlich, geistig, sozial - sich die meisten Definitionen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität beziehen. Daraus folgt, dass gesundheitsbezogene Lebensqualität nicht unbedingt mehr ist als eine breitere Konzeptualisierung von subjektiver Gesundheit. Bei der Auswertung der Literatur wird deutlich, dass eine definitorische Grauzone zwischen den Begriffen Gesundheitsstatus, subjektive Gesundheit, gesundheitliches Befinden und gesundheitsbezogene Lebensqualität existiert (Bullinger, 1996b;1998; Kohlmann, 1997; Bullinger & Kirchberger, 1998). Gelegentlich überschneiden sie sich oder sind austauschbar (Siegrist, Starke, Laubach & Brähler, 2000). Bullinger (1996b), verwendet die Begriffe subjektive Gesundheit und gesundheitsbezogene Lebensqualität synonym, wobei ihr der erstgenannte Begriff aus zwei Gründen geeigneter erscheint: Zum einen ist der Begriff ´subjektive Gesundheit` weniger belastet als der Begriff der Lebensqualität, und zum anderen kann mit diesem zwanglos an den Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angeknüpft werden, der weit über eine rein medizinische Betrachtung hinausgeht und soziale Aspekte mit einbezieht (Bullinger, 1996b, S. XVII). In der Literatur zur Medizin und zur Gesundheit findet man eher den Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, welcher versucht, sich von dem globalen Begriff der Lebensqualität zu unterscheiden und abzugrenzen. Gesundheitsbezogene Lebensqualität wird im allgemeinen als mehrdimensionaler Begriff definiert, der die Bereiche körperliches Befinden (Allgemeinbefinden), psychische Verfassung (kognitive und emotionale 13 Faktoren), soziale Einbindung (soziale Unterstützung und Integration), Lebenszufriedenheit und subjektive Gesundheit umfasst. Damit hebt gesundheitsbezogene Lebensqualität eher auf subjektive Komponenten der Gesundheit ab, etwa auf den emotionalen Zustand, die soziale Integration und die subjektive Wahrnehmung der Gesundheit. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern Lebensqualitätsmessungen tatsächlich das subjektive Befinden einer Person darstellen können. Die üblichen Definitionen von gesundheitsbezogener Lebensqualität spiegeln ebenso die Dimensionen von Gesundheit wider, wie sie die Weltgesundheitsorganisation 1946 definiert hat. 1.3 Gesundheitsbezogene Lebensqualität Der Lebensqualitätsbegriff in der Medizin ist eng mit der Gesundheitsdefinition der WHO verbunden, nach der Gesundheit als „Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen“ (WHO, 1946, zit. n. Sohn, 1997, S. 89) zu verstehen ist. Diese Definition wird von vielen Autoren als idealtypisch und statisch bezeichnet und deshalb kritisiert, weshalb auf die Kritik an der WHO-Definition unter Punkt 2.3 näher eingegangen wird. Die Begriffsbestimmung der WHO ist aber insofern wichtig, da sowohl die psychische als auch die soziale Komponente berücksichtigt wird. Mit der Erweiterung der Gesundheitsdefinition wurde die Notwendigkeit der Beachtung von psychischen und sozialen Faktoren wurde unterstrichen. Weitere Gründe für die Entstehung eines patientenzentrierten Ansatzes in der Medizin liegen einerseits in einer steigenden Anzahl älterer Menschen in der Bevölkerung und der damit verbundenen Verschiebung des Krankheitsspektrums von akuten zu chronischen Erkrankungen und andererseits in den immer stärker werdenden Zweifeln am Informationsgehalt der klassischen medizinischen Parameter Morbidität und Mortalität (Bullinger & Ravens-Sieberer, 1996). Als Bewertungskriterien, z.B. für die Effizienz einer Therapie, wurden lange Zeit nur die Verlängerung des Lebens bzw. die Veränderung der Symptomatik herangezogen, der Patient selbst wurde nicht nach seinem Erleben von Krankheit und Therapie befragt. Nach Bullinger (1996b), der deutschen Expertin für Lebensqualitätsforschung, wurde als Konsequenz der aufkeimenden 14 Lebensqualitätsforschung und des damit verbundenen Perspektivenwechsels, psychosoziale Aspekte von Krankheitsprozessen stärker betont. Das subjektive Erleben des Krankheitszustands gewann als Bewertungskriterium von Therapien zunehmend an Bedeutung. 1.3.1 Konzeptuelle Grundlagen der Lebensqualitätsforschung Die Entwicklung der Lebensqualitätsforschung in der Medizin kann nach Bullinger (1997) in drei wesentliche Phasen unterteilt werden (vgl. dazu auch Siegrist, 1990). In den 70er Jahren bildete die Diskussion über die Messbarkeit der Lebensqualität die erste Phase. Ähnlich der Auseinandersetzung in der Differentiellen Psychologie zur Erfassung von Persönlichkeitszügen wurde darüber debattiert, ob Lebensqualität über verschiedene Personen erfassbar oder nur intraindividuell, also für jede Person einzeln, zu beschreiben ist. Untersuchungen, bei denen verschiedene Probanden aufgefordert wurden, den Begriff „Lebensqualität“ zu definieren, zeigten eine hohe Übereinstimmung darin, was sie darunter verstehen (Ludwig, 1991). Weitere Untersuchungen legen nahe, dass es interkulturelle Übereinstimmungen in den Dimensionen der subjektiven Gesundheit gibt, wenn auch die Bedeutung der Dimensionen in den einzelnen Kulturen unterschiedlich groß ist (Bullinger, 1996a). In der zweiten Phase der Forschung zur subjektiven Gesundheit stand die Entwicklung von Messinstrumenten im Vordergrund, welche in der dritten Phase ab den 90er Jahren in verschiedenen Studien angewendet wurden. Zur Erfassung der subjektiven Gesundheit liegen inzwischen über 1000 Messinstrumente vor (Bullinger, 1998). Es existieren sowohl krankheitsübergreifende (generische) als auch krankheitsspezifische Messinstrumente. Generische Verfahren lassen sich weiter in Gesundheitsprofile und Nützlichkeitsmaße unterteilen, wobei letztere vor allem im Rahmen gesundheitsökonomischer Analysen Verwendung finden. Generische sowie krankheitsspezifische Messinstrumente gehen von einem multidimensionalen Konstrukt aus und erfassen dabei die subjektive Sicht des Patienten in Form von Selbstbeurteilung oder gewinnen Informationen durch Fremdeinschätzung. 15 Nach Bullinger (1998) musste sich die Lebensqualitätsforschung von Beginn an mit drei Hauptaspekten auseinandersetzen: Kann Lebensqualität definiert und operational erfasst werden? Wie ist die Qualität der zur Erfassung der Lebensqualität konstruierten Verfahren? Inwieweit haben die Ereignisse der Lebensqualitätsforschung Relevanz für individuelles, ärztliches und gesundheitspolitisches Handeln? Auch wenn die theoretische Rechtfertigung der Lebensqualitätsforschung als unzureichend kritisiert wird, sind die Arbeiten zu methodischen Erfassungen seit den 80-er Jahren weit vorangeschritten. 1.3.2 Konzepte zur Erfassung von Lebensqualität Um Lebensqualität wissenschaftlich erfassen zu können, besteht die erste Aufgabe darin, sie so zu operationalisieren, dass sie messbar und damit quantifizierbar wird. Grundsätzlich kann man nach Bullinger (1998) zur Zeit drei verschiedene konzeptionelle Ansätze der Operationalisierung unterscheiden. Tabelle 2 verdeutlichen diese: Konstruktebene Inhalt Vorwiegendes Einsatzgebiet Allgemeine oder Aussagen über die Medizinsoziologische globale allgemeine und -psychologische Lebensqualität Lebenssituation Grundlagenforschung Gesundheitsbezogene Aussagen über den Vergleich zwischen Lebensqualität allgemeinen verschiedenen Gesundheitszustand Erkrankungen Aussagen über die Gesundheitsökonomie, Bedeutung der Vergleich zwischen spezifischen Erkrankung verschiedenen für die allgemeine Erkrankungen oder Lebenssituation Therapien Utility Messungen 16 Tab.2 Verschiedene Ansätze zur Lebensqualitätsmessung (www.charite.de/psychosomatik/pages/pages/forschung/groups/leb_qual/index. html ) Allgemeine oder globale Lebensqualität: Der erste Ansatz geht davon aus, dass Lebensqualität ein Begriff ist, der individualzentriert, d. h. nur durch das individuelle Erleben zu definieren ist, etwa als Differenz zwischen angestrebten Zielen und erfahrener Realisierung und nur in seiner Ganzheit erfasst werden kann. Verfechter dieses Ansatzes setzen voraus, dass Lebensqualität nur intraindividuell beschreibbar ist, weil sie von Person zu Person in ihren Dimensionen variiert (Bullinger, 1998). Patienten sind aufgefordert, Angaben zur aktuellen Lebensqualität -so wie sie sie verstehen - im Vergleich zu ihrer schönsten und schlimmsten Zeit in ihrem Leben zu machen. Eine Vergleichbarkeit über einzelne Personen hinweg ist mit diesem Ansatz nur dann möglich, wenn man die Differenz zwischen individuell angestrebten Zielen und deren Realisierungen mit berücksichtigt. Gesundheitsbezogene Lebensqualität: Der zweite, interindividuelle Ansatz bezieht sich auf die Gesundheitsdefinition der WHO „und geht davon aus, dass Lebensqualität über eine endliche Zahl von für verschiedene Personen relevanten Dimensionen beschreibbar ist“ (Bullinger, 1998, S.44). Durch die allgemeinen, erkrankungsunspezifischen Fragen kann dieses Profil zwischen verschiedenen Erkrankungen oder Therapien anschaulich verglichen werden. Utility Messungen: Der dritte Ansatz besagt, dass Lebensqualität weder intraindividuell noch interindividuell erfassbar, „sondern implizit durch PatientInnenpräferenzen zu messen ist“ (Bullinger, 1998, S.44), wie etwa das Wiedererlangen einer vorher definierten Belastbarkeit. Hier wird vorausgesetzt, dass Lebensqualität ein implizites Konstrukt ist, das sich aus direktem Erfragen nicht ermitteln lässt. Vor allem unter gesundheitsökonomischen Fragestellungen wird Lebensqualität als Teil 17 der Entscheidungsfindung zwischen alternativen Therapien oder auch im Zusammenhang mit der Verteilung knapper werdender Ressourcen gesehen. Jeder dieser kurz vorgestellten konzeptuellen Ansätze hat zur Ausbildung einer bestimmten Methodologie geführt, die sich in der Entwicklung von Messinstrumenten niedergeschlagen hat. 1.3.3 Ziele der Lebensqualitätsforschung Ziele der Lebensqualitätsforschung in der Medizin sind zum einen die Beschreibung der Lebensqualität für bestimmte Populationen in der Bevölkerung, um daraus Informationen für gesundheitspolitische Planungen abzuleiten. Des weiteren wird die Anwendung des Begriffs der subjektiven Gesundheit als Parameter bei der Bewertung von Therapien, dessen Ergebnisse von Trägern medizinischer Leistungen - z.B. Krankenkassen bzw. Rentenversicherungen - genutzt werden. Die Lebensqualitätsforschung kann einen Beitrag zur Identifikation von Determinanten der Gesundheit und Evaluation liefern. Hier geht es um die Frage, inwieweit das Ergebnis komplexer Behandlungsbemühungen gesundheitspolitisch und ökonomisch vertretbar ist. Aktuell gewinnt die gesundheitsbezogene Lebensqualität in der Gesundheitsökonomie als Indikator für den Nutzen einer Maßnahme (z. B. Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahmen) in Relation zu den resultierenden Kosten an Bedeutung (Bullinger, 1997; 1998). Dazu werden die Patienten stärker in medizintherapeutische Entscheidungsprozesse eingebunden, was zu einer „Humanisierung“ in der Gesundheitsversorgung führen soll. 1.3.4 Definitionen und Modelle der gesundheitsbezogenen Lebensqualität Für die zunehmende Etablierung des Begriffs der gesundheitsbezogenen Lebensqualität in der Medizin sind mehrere Entwicklungen im 18 gesundheitswissenschaftlichen Bereich wegbereitend. Sie werden im Folgenden kurz zusammengefasst (Croog & Levine, 1989; Bullinger, 1998). Die WHO hat mit ihrer erweiterten Definition von Gesundheit, in welcher sie diese nicht lediglich als Abwesenheit von Krankheit, sondern vielmehr als das Vorhandensein von vollkommenem körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefinden umschreibt, einen ersten konzeptuellen Rahmen für das neue Forschungsfeld abgesteckt. Die Notwendigkeit einer Integration von psychischen und sozialen Faktoren bei der Diskussion von Gesundheit wurde dadurch herausgestellt. Die Zunahme an chronischen Erkrankungen und der gleichzeitige Rückgang an Infektionskrankheiten in den westlichen Ländern einerseits, sowie die beachtliche Entwicklung innerhalb der pharmakologischen Interventionen und der Medizintechnik andererseits zeigten, dass Sterblichkeits- oder Erkrankungsraten als alleiniges Maß für die Beurteilung einer Therapie unzureichend sind. Statt dessen haben diese größtenteils lebensverlängernden Maßnahmen gravierenden Einfluss auf das Alltagserleben und die Zufriedenheit der Patienten und ihrer Angehörigen. Kostendämmungen im Gesundheitswesen, gerade auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von teuren Technologien, lassen immer häufiger die Frage nach dem Nutzen einer Therapie entstehen. Die Lebensqualität sollte dabei als ein aussagekräftiger Faktor in die KostenNutzen-Gleichung aufgenommen werden. Schließlich lässt sich in den letzten Jahren in der Medizin ein zunehmendes Interesse an einer „Humanisierung“ der Gesundheitsversorgung feststellen. Das Erkennen des Zusammenspiels von Verhaltens- und biologischen Faktoren (z.B. Psychoneuroimmunologie und Verhaltensmedizin) sowie die Erkenntnisse aus der Coping- und Complianceforschung konnten zeigen, wie notwendig und für den Heilungsprozess förderlich es ist, die Patienten stärker in die Entscheidungsprozesse bezüglich ihrer Therapie einzuschließen. 19 Da es derzeit noch keine verbindliche Theorie zur Lebensqualität gibt, existieren in der medizinischen Literatur unterschiedlich akzentuierte Definitionen des Begriffs (Ludwig, 1991; Dirhold & Thomas, 1996; Bullinger, 1998). Ganz allgemein wird von gesundheitsbezogener Lebensqualität gesprochen, wenn der Einfluss einer Krankheit oder deren Behandlung auf die Lebensqualität erfasst werden soll. Petermann & Krischke (1996) sehen Lebensqualität als ein mehrdimensionales Konstrukt, das sowohl veränderte medizinische als auch psychische, soziale und ökonomische Aspekte des Lebens gleichzeitig berücksichtigt und zu einem differenzierten Beurteilungskriterium zusammenfasst. Lebensqualität ist demnach das Ergebnis von Beurteilungsprozessen, die im starken Maße von der Auswahl der einbezogenen Lebensbereiche und auch dem Bezugssystem der Beurteiler abhängt. Bullinger (1994) bezeichnet gesundheitsbezogene Lebensqualität ebenso als ein multidimensionales Konstrukt, das mindestens durch die vier Komponenten „psychisches Befinden“, „körperliche Verfassung“, „soziale Beziehungen“ und „funktionale Kompetenz“ der Befragten zu operationalisieren ist. Abbildung 1 verdeutlicht das Konstrukt: Gesundheitsbezogene Lebensqualität Körperliche Verfassung Soziale Beziehungen Psychisches Befinden Funktionale Kompetenz Abb. 1 Dimensionen der subjektiven Gesundheit nach Bullinger (1994) Subjektive Gesundheit ist kein über die Zeit stabiles Maß und wird durch die jeweilige Lebenssituationen einer Person beeinflusst. Wichtig ist der Selbstbericht der Befragten. 20 Küchler und Schreiber (1989) haben für die subjektive Gesundheit ein theoretisches Modell zur Anwendung erstellt, dessen Dimensionen sich im wesentlichen mit der oben genannten Definition von Bullinger (1994) decken. Beide Autoren stellen in ihrem Modell drei Komponenten der gesundheitsbezogenen Lebensqualität in einen Zusammenhang: die Erlebnis-, Bezugs- und Zeitdimension. Ihrer Meinung nach wird Lebensqualität durch eine „Erlebnisdimension“ bestimmt, der sie die größte Bedeutung beimessen. Die Komponenten des Modells sind zeitlich variabel und werden im Hinblick auf den jeweiligen kulturellen, familiären sowie gesellschaftlichen Kontext betrachtet. Weiterhin weisen die Autoren auf die Möglichkeit der Selbst- und Fremdeinschätzung der Lebensqualität und die individuelle Gewichtung der Merkmale hin. Im „Lebensqualitätswürfel“ haben die Autoren die genannten drei Dimensionen orthogonal zueinander in Beziehung gesetzt: damit kann jede hier von ihnen vorgeschlagene - Facette der Lebensqualität einem bestimmten Ort in diesem dreidimensionalen - Lebensqualitäts - Raum zugeordnet werden. Das Konzept erlaubt ein systematisches Vorgehen bei der phänomenlogischen Beschreibung prozeßhafter Abläufe. In der Erlebensdimension fassen die Autoren individuelle Aspekte der Lebensqualität zusammen. Sie differenzieren hier zwischen der somatischen, psychischen, interpersonellen, sozioökonomischen sowie einer spirituellen Dimension. Erleben des körperlichen Zustandes, im Laufe der Lebensgeschichte erworbene psychische Eigenschaften, Struktur und Qualität relevanter Beziehungen, sozialökonomischer Status sowie Religiösität und individuell angenommener Lebenssinn charakterisieren die Inhalte dieser Dimensionen. Die Beschreibung des Lebensrahmens umfasst die Bereiche Individuum, Familie, soziale Gruppe und Kultur. Insbesondere Lebensstil sowie politische und kulturelle Lebensbedingungen finden hier ihre Berücksichtigung (Küchler & Schreiber, 1989). Entsprechend der Bedeutung der ver- schiedenen Zeitabschnitte teilen die Autoren in ihrem Modell die zeitlichen Abschnitte in „Vergangenheit“, „Gegenwart“, „nahe Zukunft“ und „ferne Zukunft“. Dass die Zeitbereiche individuell unterschiedliche Realzeiträume meinen, entspricht dem individuumszentrierten Ansatz dieses Lebensqualitätskonzepts. In Abbildung 2 ist dieses Konzept dargestellt: 21 Abb. 2 Dimensionen der Lebensqualität nach Küchler und Schreiber (1989) Vallerand, Breckenridge & Hodgson (2001) führen weitere Modelle zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität an. Oleson (1990; zit. n. Vallerand, Breckenridge & Hodgson, 2001) entwickelte ein Modell für subjektiv wahrgenommene Lebensqualität. Lebensqualität wird hier als eine kognitive Erfahrung gesehen, die sich in Zufriedenheit eines Individuums in bedeutsamen Lebensbereichen äußert, und als eine affektive Erfahrung, die sich im Glücklichsein manifestiert. Die Autorin identifiziert die Lebensbereichskategorie von Gesundheit und Funktionsfähigkeit sowie die sozioökonomische und die seelisch-spirituelle Lebensbereichskategorie der Familie als Ursachen von Zufriedenheit und Glücklichsein. Schließlich erkennt sie die Entwicklung von Potenzial und Selbstaktualisierung als Folgen einer als positiv wahrgenommenen Lebensqualität. Das Lebensqualitätsmodell von Zhan (1992; zit. n. Vallerand, Breckenridge & Hodgson, 2001) beruht auf der graduellen Einschätzung von zufriedenstellenden Lebenserfahrungen eines Menschen. Sie beschreibt 22 Lebensqualität als mehrdimensionale Begrifflichkeit, „ die sich weder mittels eines subjektiven noch durch einen objektiven Ansatz vollständig messen lässt“ (Vallerand, Breckenridge & Hodgson, 2001, S. 86). Die Interaktion zwischen Person und ihrem Umfeld ergibt die wahrgenommene Bedeutung von Lebensqualität. Die Lebensqualitätsdimensionen sind: Lebenszufriedenheit, Selbstkonzept, Gesundheit, Funktionsfähigkeit sowie sozioökonomische Faktoren. Diesem Modell zufolge beeinflussen Umfeld, Kultur, soziale Situation, Gesundheit und Alter die Lebensqualität der Betreffenden. Ein Modell von Lebensqualität bei chronischer Krankheit stellen Cowan, Young-Graham und Cochrane (1992; zit. n. Vallerand, Breckenridge & Hodgson, 2001) vor. Sie legen die Variablen „Schweregrad der Erkrankung“, „Aggressivität der Behandlung“ und “sozioökonomische Ebene“ als Prämissen fest. Diese Prämissen wiederum haben Auswirkungen auf die Variablen „symptombezogenes Leiden“, „Funktionelle Veränderungen“ und „Kognitive Adaptation“. Die Autorinnen betrachten die Variablen „Funktionelle Veränderung“ und symptombezogenes Leiden nicht als Definitionsmerkmal von Lebensqualität, sondern als lebensqualitätsbeeinflussende Faktoren. Als Outcome-Variable gilt in diesem Modell die wahrgenommene Lebensqualität, nämlich das Ausmaß an Lebenszufriedenheit und selbst eingeschätztes Wohlbefinden einer Person. Für diese Modelle bedarf es noch klinischer Erprobungen, um ihre Anwendbarkeit und ihren Nutzen festzustellen (Vallerand, Breckenridge & Hodgson, 2001). 1.4 Zusammenfassendes Verständnis von gesundheitsbezogener Lebensqualität Obwohl in der Literatur verschiedene Definitionen und Modelle zum Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zu finden sind, hat sich aber ein Konsens über die minimalen Bestimmungsaspekte einer operationalen Definition herausgebildet (Bullinger, 1994; 1998). Dieser lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Unter gesundheitsbezogener Lebensqualität ist ein psychologisches Konstrukt zu verstehen, das die körperlichen, psychischen, 23 mentalen, sozialen und funktionalen Aspekte des Befindens und der Funktionsfähigkeit der Patienten aus ihrer Sicht beschreibt“ (Bullinger, 1991, S. 143, zit. n. Bullinger, 1994, S. 18). Diese operationale Definition geht von einer interindividuellen Universalität der Lebensqualität aus und betont, dass der Begriff Lebensqualität multidimensional zu beschreiben ist und eine Selbstauskunft der Patienten für bedeutsam hält. Weiterhin impliziert eine so definierte Lebensqualität eine Wandelbarkeit, die von verschiedenen Einflussfaktoren abhängt. Eine Beeinflussung der Lebensqualität eines Patienten ist von einer Erkrankung und deren Behandlung abhängig. Ebenso wichtig sind individuelle Einwirkungsfaktoren (Wahrnehmung und Verarbeitung einer Erkrankung) sowie solche aus dem Bereich der Lebensbedingungen (sozioökonomischer Status, Arbeitsfeld). Bullinger (1994) stellt in Abbildung 3 dar, inwieweit potentielle Einflussfaktoren und individuelle Einflussgrößen eine Veränderung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität herbeiführen können. Krankheit/ Behandlung Personale Charakteristika Lebensbedingung en Gesundheitsbezogene Lebensqualität Körperlich z.B. Symptome Mental z.B. Konzentrati on Emotional z.B. Stimmung Sozial z.B. Kontakt zu Freunden Verhaltens bezogen z.B. Hausarbeit 24 Abb.3 Einflussfaktoren auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität ( Bullinger 1994, S. 19) Da davon auszugehen ist, dass sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität im Laufe der Zeit verändert, muss auch gefragt werden, inwiefern der Begriff nur individuell, also als Einzelerfahrung von Personen zutrifft, oder inwieweit es eine allgemeine Gültigkeit wesentlicher Bereiche des Erlebens und Verhaltens gibt, die für alle Menschen gilt. Untersuchungen, in denen die Befragten selbst den Begriff Lebensqualität definieren und mit Inhalt ausfüllen konnten, haben gezeigt, dass in westlichen industrialisierten Ländern die definitorischen Kategorien von Lebensqualität einen hohen Grad von Allgemeingültigkeit besitzen (Ludwig, 1991). Auf der metaphysischen Ebene sind die Lebensqualitätsdimensionen interindividuell vergleichbar, auch wenn die Dimensionen für den einzelnen Menschen von unterschiedlicher Bedeutung sind und verschieden gewichtet werden (Bullinger, 1994; 1998). Von besonderem Interesse ist für Bullinger (1996a) die mögliche kulturelle Universalität des Lebensqualitätsbegriffs. „Unabhängig von nationalen Ursprüngen und aktuellen Lebensbedingungen könnte es für Menschen wichtig sein, sich psychisch wohl zu fühlen, körperlich fit, sozial integriert und funktional kompetent zu sein“ (S. 6). Wenn auch in der jeweiligen Kultur verschiedene Gewichtungen der Lebensqualitätsdimensionen vorgenommen werden, so bleibt das Konstrukt Lebensqualität erhalten. Daraus folgert Bullinger (1998), „dass Lebensqualität in antroposophischer Terminologie eine transkulturelle Universalie zu sein scheint“ (S. 46). 1.5 Die Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 25 Die Erhebung der subjektiven Einschätzung von Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensqualität ist mit grundsätzlichen Problemen belastet, weil den subjektiven Urteilen von Person zu Person und von Gruppe zu Gruppe unterschiedliche Beurteilungsmaßstäbe zugrunde liegen und weil sich nicht nur Gesundheit, sondern auch die Beurteilungskriterien in einem dynamischen Prozess verändern. Es muss davon ausgegangen werden, dass persönliche interne Vergleichsmaßstäbe im Verlauf der Zeit graduell an objektive Lebensbedingungen angepasst werden. Als gutes Beispiel dafür dient das häufig angeführte Zufriedenheitsparadox und Unzufriedenheitsdilemma (Glatzer & Zapf, 1984; Dirhold & Thomas, 1996; Petermann & Krischke, 1996), wobei chronisch körperlich kranke Menschen eher zu einer Überschätzung und Gesunde eher zu einer Unterschätzung ihrer Lebensqualität neigen können. Damit wären aber Lebensqualitätsdaten nicht zur Beurteilung des Gesundheitszustandes zu gebrauchen, sondern mehr dazu geeignet zu erfassen, inwieweit sich chronisch kranke Menschen bereits an ihre neue Situation gewöhnt haben und in welchen Lebensbereichen sozialpsychologische oder pädagogische Interventionsansätze anzeigt wären. Im Bereich der Erfassung gesundheitsbezogener Lebensqualität lässt sich eine Vielfalt an Messinstrumenten finden. Bullinger (1998) zählt insgesamt mehr als tausend Instrumente, wobei krankheitsübergreifende im Vergleich zu krankheitsspezifische Instrumenten überwiegen. Die meisten sind in englischer Sprache verfügbar, und nur wenige international übereinstimmende Tests die über verschiedene Sprachen hinweg einsetzbar sind. Im Folgenden werden einige generische - krankheitsübergreifende Fragebögen bzw. Skalen exemplarisch vorgestellt: Legewie und Trojan (2000) haben eine tabellarische Übersicht mit Instrumenten zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität veröffentlicht (Tabelle 3): 26 SF-36 WHOQOL Health Survey Fragebogen EuroQOL Quality of Fragebogen Well- being Skala Dimensi -körperliche onen der -phys. -Mobilität -Mobilität Funktion Gesundheit -Körperpflege -körperl. - -psych. Befinden allg. Aktivität Lebens Rollenerfüllung -Unabhängigkeit Tätigkeiten -soziale qualität körperlich und -soz. -Schmerz Aktivität emotional Beziehungen -Ängstlichkeit -Symptome -soz. Funktion -Umwelt und Nieder- und -Wohlbefinden -Spiritualität -Schmerz -(Gesamtscore) geschlagenheit 100 5 27 momentan momentan Letzte 6 Tage ca. 40 Minuten 2-3 Minuten ca. 20 Minuten Probleme -Vitalität -Gesundheitswahrnehmung Itemzah 36 l Zeitbez Letzte 4 ug Wochen Dauer 10 Minuten Tab.3 SF-36 Health Survey; WHOQOL Fragebogen; EuroQOL Fragebogen; Quality of Wellbeing Skale (Legewie & Trojan 2000, S. 26) Das SF-36 Health Survey ist ein 36 Items umfassender Fragebogen, der in den 70er Jahren in den USA zur Messung der Gesundheitseffekte einer Medical Outcome Studie entwickelt wurde und sich seitdem in zahlreichen Studien bewährt hat. Eine internationale Arbeitsgruppe (International Quality of Life Assessment Group) mit Mitgliedern aus inzwischen über 20 Ländern koordiniert die Übersetzung, psychometrische Prüfung und Normierung der Skalen. Bisher wurden Versionen in 10 Sprachen adaptiert, unter anderem in die deutsche Sprache (eingehender beschrieben unter 2.5.1). 27 Der WHOQOL-Lebensqualitätsfragebogen, eine Entwicklung der Lebensqualitäts-Arbeitsgruppe der WHO, stellt den Versuch dar, kulturübergreifende Dimensionen gemeinsam zu definieren und in einem kulturunabhängigen Messinstrument zu erfassen (Bullinger 1996a). Nachdem von Experten aus 15 Ländern (unter Einschluss mehrerer Länder der Dritten Welt) Einigkeit über wesentliche Domänen der Lebensqualität erreicht wurde, konnte jedes der Teilnehmerländer eigene Items zur Erfassung dieser Dimensionen formulieren. Eine Vorab Version mit 150 Items stellten die Grundlage dar und wurde an 300 Personen aus diesen Ländern getestet. Die Endform liegt als WHOQOL 100 (100 Items) und in einer Kurzfassung (WHOQOL BREV- 26 Items) vor und wurde inzwischen auch ins Deutsche übersetzt. Die Vollversion erlaubt die Ermittlung von 6 Domänen (siehe Abb. 6), in denen insgesamt 24 Facetten der Lebensqualität unterscheidbar sind. Mit der Kurzversion werden die vier Domänen physische sowie psychische Gesundheit, soziale Beziehungen und Umwelt erfasst. Der EuroQOL-Fragebogen wurde von einer europäischen Forschergruppe als einfaches Instrument für Evaluationsstudien entwickelt. Der Fragenkatalog besteht aus nur 5 Items mit jeweils 3 Antwortkategorien. Er wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und in einer großen Zahl von Evaluationsstudien eingesetzt (www.ivbl.unihannover.de). Die Quality-of-Well-Being-Skala entstand in den 70er Jahren in den USA. Das Instrument besteht aus einem variabel gestaltbarem halbstrukturiertem Interview, das sich auf Befinden und Symtome der letzten 6 Tage bezieht. Nach der Durchführung beurteilt der Untersucher die Lebensqualität nach vier Bereichen, wobei den Symptomen und Problemen eine besondere Bedeutung zukommt. Der von den oben aufgeführten krankheitsübergreifenden Messinstrumenten international meist diskutierte ist der SF-36 (Bullinger 1998), deshalb soll nachfolgend näher darauf eingegangen werden. Aufgrund des Bekanntheitsgrades (Bullinger 1996), wird der SF-36 in der eigenen Untersuchung (siehe Kap. 5) verwandt. 28 1.5.1 Das SF-36 Health Survey Die gesundheitsbezogene Lebensqualität ist ein Teilaspekt der Lebensqualität, zu dem es eine Reihe von Messinstrumenten gibt, die sinnvoll in der Rehabilitation eingesetzt werden können. Zu den bekanntesten gehört das SF-36 Health Survey (Bullinger, 1996b). Das SF-36 Health Survey gehört zu den krankheitsübergreifenden Verfahren, die subjektive Gesundheit verschiedener Populationen unabhängig von ihrem Gesundheitszustand aus Sicht der Betroffenen erfassen. Mit dem Verfahren können sowohl gesunde Personen im Alter von 14 Jahren bis zum höchsten Lebensalter als auch erkrankte Populationen unterschiedlicher Erkrankungsgruppen untersucht werden. Der SF-36 konzentriert sich auf die grundlegenden Dimensionen der subjektiven Gesundheit, also auf die psychischen, körperlichen und sozialen Aspekte des Wohlbefindens sowie die Funktionsfähigkeit aus Sicht der Patienten. Es geht bei diesem Instrument nicht so sehr um die Identifikation und Quantifizierung von Funktionen, sondern um die subjektive Beurteilung dieser Funktionen beziehungsweise die Befindlichkeit in verschiedenen Lebensbereichen. 1.5.1.1 Indikationen Die bisherigen Einsatzbereiche des SF-36 sind höchst vielfältig. Sie erstrecken sich über Populationen aus der somatischen Medizin bis hin zu psychischen Erkrankungen, weiter über Evaluation von Behandlungsverfahren bis zur individuellen Behandlungsindikation. Im klinischen Kontext kann es zur individuellen Charakterisierung der aktuellen Lebensqualität eines einzelnen Patienten, aber auch zur Planung maßgeschneiderter Therapien dienen. Ein weiterer Indikationsbereich sind gesundheitsökonomische Fragestellungen. Die primäre Einschränkung der Indikation besteht in bezug auf das Alter - ab 14 Jahren - der zu untersuchenden Populationen (Bullinger, 1996b). Die weitere Differenzierung berührt die Frage des Verwendungszwecks des Instruments. Der SF-36 wird primär zur Evaluation von Behandlungsmaßnahmen in 29 klinischen Studien eingesetzt. Er wird aber zunehmend zur individuellen Indikation von Behandlungen und deren Erfolgsbewertung verwendet (Bullinger, Ravens-Sieberer & Siegrist, 2001). Der SF-36 liegt nicht nur in Fragebogen-Form, sondern auch als Interview sowie als Telefoninterview vor. 1.5.1.2 Darstellung des SF-36 Health Survey Der SF-36 Health Survey Fragebogen besteht aus 36 Items, die 11 Themenbereichen zugeordnet sind. Die Patienten sind angehalten, für jedes der Items die Antwortalternative anzukreuzen, die ihrem Erleben am nächsten kommt. Es gibt Fragen, die mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten sind, bis hin zu sechsstufigen Antwortskalen. Der SF-36 erfasst acht Dimensionen der subjektiven Gesundheit und ein Item zur Veränderung des Gesundheitszustandes. Dabei wird erkennbar, dass die soziale Dimension im Verhältnis zur körperlichen Funktionsfähigkeit eher gering vertreten ist. Die folgende Tabelle 4 stellt das Instrument im Überblick dar: Körperliche Ausmaß, in dem der Gesundheitszustand Funktionsfähigkeit körperliche Aktivitäten wie Selbstversorgung, (10 Items) Gehen, Treppensteigen, Bücken, Heben und mittelschwere oder anstrengende Tätigkeiten 30 beeinträchtigt. Körperliche Ausmaß, in dem der Gesundheitszustand die Rollenfunktion Arbeit, z.B. weniger schaffen als gewöhnlich oder (4 Items) andere tägliche Aktivitäten beeinträchtigt, Einschränkungen in der Art der Aktivitäten oder Schwierigkeiten, bestimmte Aktivitäten auszuführen. Körperliche Schmerzen Ausmaß der Schmerzen und Einfluss der (2 Items) Schmerzen auf die normale Arbeit sowohl im als auch außerhalb des Hauses. Allgemeine Gesundheit Persönliche Beurteilung der Gesundheit (5 Items) einschließlich aktueller Gesundheitszustand, zukünftige Erwartungen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Erkrankungen und ihren Folgen. Vitalität Sich energiegeladen und voller Schwung fühlen (4 Items) versus müde und erschöpft. Soziale Funktionsfähigkeit Ausmaß, in dem körperliche Gesundheit oder (2 Items) emotionale Probleme normale soziale Aktivitäten beeinträchtigen. Emotionale Rollenfunktion Ausmaß, in dem emotionale Probleme die Arbeit (3 Items) oder andere tägliche Aktivitäten beeinträchtigen; u.a. weniger Zeit aufbringen, weniger schaffen und nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten. Psychisches Allgemeine psychische Gesundheit einschließlich Wohlbefinden Depression, Angst, emotionale und (5 Items) verhaltensbezogene Kontrolle, allgemeine positive Gestimmtheit. Veränderung der Beurteilung des aktuellen Gesundheitszustandes im Gesundheit Vergleich zum vergangenen Jahr. (1 Item) Tab.4 Dimensionen, Itemanzahl und Inhalt des SF-36 Health Survey (nach Bullinger, 1996b, XX). Der SF-36 ist konstruiert worden, um von Patienten, unabhängig vom aktuellen Gesundheitszustand und Alter, einen Selbstbericht der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zu erhalten. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer beträgt 10 Minuten. Bei Älteren muss mit einer längeren 31 Bearbeitungszeit gerechnet werden, so dass Bullinger (1996b) zur Erhöhung der Verständlichkeit und Klarheit einen größeren Schrifttyp vorschlägt. Grundlage für die Definition der subjektiven Gesundheit waren hier sowohl aus anderen Arbeiten vorliegende theoretische Ansätze als auch in Expertensitzungen zusammen mit Patienten identifizierte relevante Bereiche der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Es wurden Items ausgewählt, die die subjektive Gesundheit methodisch adäquat repräsentieren. (Bullinger, 1996b). 1.5.2 Kritik am SF-36 Health Survey Auch wenn der SF-36 „als psychometrisch zufriedenstellendes Verfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität gelten kann“ (Bullinger, 1996b, S. XXVIII), besteht das Problem, dass die mit nur zwei Items zu erfassende soziale Funktion möglicherweise unterrepräsentiert ist. Damit gewinnt die Dimension der körperlichen Funktionsfähigkeit eine höhere Gewichtung. Des weiteren berücksichtigt der Test die relative Wichtigkeit der krankheitsbezogenen Einschränkungen der Patienten nicht (Bullinger, 1996b). Dieser zuletzt genannte Aspekt betrifft besonders die zeitliche Veränderung subjektiver Gesundheit. Ein und dieselbe Person nimmt im zeitlichen Verlauf eine Neugewichtung ihrer Bewertungsmaßstäbe vor, so dass bei entsprechender Wiederholungsmessung das Messergebnis im genaugenommen nicht mehr vergleichbar ist (Bullinger, Ravens-Sieberer & Siegrist, 2001). 1.6 Kritik am Geltungsbereich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität Der Einzug der Patientenperspektive in verschiedene medizinische Disziplinen fördert eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die das Erleben des Patienten mit berücksichtigt. Dabei soll die Erfassung der subjektiv empfundenen Lebensqualität Aufschluss über jene psychosozialen und physischen Faktoren liefern, die für Krankheit und Therapie relevant sind. Will man aber Auskunft über die Lebensqualität eines Patienten erhalten, bedarf es Informationen über die individuelle Definition des Begriffs Lebensqualität, das 32 heißt über subjektive Konzepte zur Lebensqualität (Ludwig, 1991). Da es derzeit keine verbindliche Theorie zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität gibt (Ludwig, 1991), sondern nur unterschiedlich betonte Definitionen, die die Meinung der jeweiligen Forscher widerspiegeln, was Lebensqualität kennzeichnet. Ob sich diese Einschätzung mit der Definition des Patienten deckt, findet Ludwig (1991) zumindest fraglich. Der existierende Konsens, gesundheitsbezogene Lebensqualität als ein multidimensionales Konstrukt mit Bezug auf physische, psychische und soziale Komponenten sowie auf die Komponente der Funktionsfähigkeit im Alltagsleben zu sehen, löst das Problem nur unzureichend. Wie diese Bestandteile eines Ganzen zueinander in Beziehung stehen und wie sie zu gewichten sind, bleibt Ludwig (1991) zufolge weiterhin offen. In der Konsequenz bedeutet das, dass für unterschiedliche Patientenpopulationen in verschiedenen Situationen die jeweils wichtigsten Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ermittelt werden müssen, um das Ausmaß subjektiver Belastungen abschätzen und vergleichen zu können (Rose et al., 2000). Bewertungsaspekte wie das Ausmaß der Zufriedenheit, der Grad der Wichtigkeit, der den Komponenten beigemessen wird, der Veränderungswunsch und der Glaube daran, Veränderungen selbst herbeiführen zu können und die erlebten Beeinträchtigungen durch Krankheit und Therapie innerhalb der verschiedenen Lebensbereiche müssen Berücksichtigung finden. Ludwig (1991) stellt ihre Untersuchung zur „Lebensqualität auf der Basis subjektiver Theoriebildung“ vor, in der sie der Frage nachgeht, ob Lebensqualität von jeder Person anders definiert wird oder ob sich ein verallgemeinerbares Konzept finden lässt. Eine offene Befragung von 143 gesunden Menschen zur subjektiven und allgemeinen Lebensqualität sowie die Erstellung einer Rangordnung nach Wichtigkeit der gestellten Fragen ergibt ein Kategoriesystem von 14 verschiedenen Aspekten der Lebensqualität, die den Dimensionen Sozialleben, Psyche, Physis und Alltagsleben zugeordnet werden können. Die offenen Fragen, weiteren Personengruppen vorgelegt (331 Gesunden, 43 kardiovaskulären Patienten und 165 onkologischen Patienten), ergaben, dass Lebensqualität von den verschiedenen Gruppen vergleichbar definiert wurde. Diesen Befund wertet Ludwig (1991) als gültig für krankheitsübergreifende Konzeptualisierung zur Erfassung von 33 gesundheitsbezogener Lebensqualität und hält ein spezifisch für jede Krankheit neu zu entwickelndes Verfahren für unnötig: „Auch der Patient bleibt primär `chronisch Mensch` und behält die Kriterien zur Beurteilung seiner Lebensqualität bei“ (Ludwig, 1991, S. 32). Die Untersuchung hat gezeigt, dass zumindest in den westlichen industrialisierten Ländern die Befragten den Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität übereinstimmend definieren und mit den gleichen Inhalten füllen. Damit ist die Konzeptualisierung valide, die subjektiven Bewertungsprozesse aber sind nicht erfasst. Bullinger (1998) zufolge scheint Gesundheitsgezogene Lebensqualität eine interindividuelle Gültigkeit zu besitzen, so dass es für Menschen unabhängig von sozialdemographischen Unterschieden wichtig ist, sich körperlich fit und psychisch beständig zu fühlen, alltagsfunktionsfähig und sozial integriert zu sein. Kritisch ist daran zu bewerten, dass - auch wenn sich verschiedene Gruppen auf die gleichen Lebensbereiche beziehen - sich die individuellen Beurteilungen dieser Bereiche unterscheiden je nachdem, wie das Ausmaß der Zufriedenheit oder Wichtigkeit des jeweiligen Bereiches erlebt wird. Das Problem besteht damit in der Repräsentation individueller Lebensqualität durch standardisierte Instrumente (Bullinger, 1998). Aufgrund des dicht an dem Gesundheitsbegriff der WHO orientierten Ansatzes, soll im folgenden Kapitel näher auf Gesundheits- und Krankheitskonzepte eingegangen werden. 2 KONZEPTE VON GESUNDHEIT UND KRANKHEIT Auf den ersten Blick scheinen die Begriffe Gesundheit und Krankheit eindeutig erklärt. Gesundheit lässt sich mit Wohlbefinden und Abwesenheit von Beschwerden und Symptomen formulieren. Krankheit hingegen verbindet man mit Beschwerden, Schmerzen und Einschränkungen. Bei genauerer Betrachtung jedoch zeigt sich, dass die Begriffe sehr unterschiedlich definiert sein können. Für manche Menschen ist Gesundheit gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Glück, andere verstehen darunter das Freisein von 34 körperlichen Beschwerden oder die Fähigkeit des Menschen, mit Belastungen fertig zu werden. 2.1 Definitionen und Modelle von Gesundheit und Krankheit Eine ganz auf die körperliche Gesundheit gerichtete Aufmerksamkeit und die ganz auf Krankheit als Kriterium gerichtete Definition von Gesundheit kann bereits seit ca. fünfzig Jahren als veraltet gelten, auch wenn sie im Alltag weiterhin gebräuchlich scheint und immer wieder anzutreffen ist. Waller (1996) liefert für seine Aussage, dass es keine allgemeingültige, anerkannte wissenschaftliche Definition von Gesundheit gibt, mehrere Definitionsbeispiele und die Möglichkeiten, den Begriff „Gesundheit als Wertaussage, Abgrenzungskonzept und Funktionsaussage“ (S. 9) zu kategorisieren. Eine Begriffsbestimmung ist bei der Sichtung der Literatur immer erwähnt: die Gesundheitsdefinition der WHO. Dieser umfassende Gesundheitsbegriff betont im Gegensatz zum vorherrschenden medizinischen Ansatz die Verankerung von Wohlbefinden in allen Dimensionen des täglichen Lebens. Neben Anzeichen von Missbehagen, Beschwerden und Störungen gilt es den ungestörten, positiven Anteilen von Gesundheit Aufmerksamkeit zu widmen. Frank (1991) versteht körperliches sowie psychisches Wohlbefinden als ein subjektives Phänomen, wobei auch körperlich Kranke sich partiell wohlfühlen können. Sohn (1997) weist in diesem Zusammenhang auf „Diskrepanzen zwischen subjektivem und objektivem Gesundheitszustand“ (S. 92) hin. Hurrelmann (1994) definiert Gesundheit als einen „Zustand des objektiven und subjektiven Befindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich in den physischen, psychischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung in Einklang mit den Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befindet“ (S.16). Der Soziologe Parsons (1967) erklärt Gesundheit wie folgt: „Gesundheit kann definiert werden als Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist“ (zit. n. Franke & Broda, 1993, S. 22). 35 Innerhalb des heutigen medizinischen Systems sind die Definitionen von Gesundheit weiterhin in der Regel Negativbestimmungen. Beim Vorhandensein von Beschwerden wird die Person als krank eingestuft. Dieses Begriffsverständnis von Ärzten und Therapeuten stimmt oft nicht mit den Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sogenannter Laien überein. Eine rein biomedizinische Sicht vernachlässigt bedeutsame Dimensionen des Befindens. Gesundheit ist also kein eindeutig definierbares Konstrukt. Die unterschiedlichen Versuche, Gesundheit zu definieren und zu charakterisieren, haben nach Waller (1996) in verschiedene Konzepte und Modellvorstellungen von Gesundheit Eingang gefunden. Er unterteilt sie in Laienkonzepte und wissenschaftliche Konzepte. 2.1.1 Laienkonzepte von Gesundheit In einer Untersuchung zu statistischen Zusammenhängen selbst berichteter Gesundheitsindikatoren von Abel, Duetz und Niemann (2000), wird davon ausgegangen, dass „die selbst eingeschätzte Gesundheit ein Konglomerat des Wissens um und der Beurteilung von unterschiedlichen Teilbereichen des Gesundheitszustandes darstellt“ (S.323). Das Verständnis von Gesundheit verändert sich über die verschiedenen Lebensphasen und wird anhand des Gesundheitszustandes von Alters- und Geschlechtsgenossen verglichen. Die Beschäftigung mit subjektiven Vorstellungen über Krankheit und Gesundheit gibt Aufschluss darüber, welche Ursachen die betroffene Person ihrer Krankheit oder Gesundheit zuschreibt und ob sie selbst eine Mitverantwortung trägt. Daraus lässt sich ersehen, inwiefern Personen Maßnahmen zur Gesunderhaltung ergreifen können oder wollen. Subjektive Vorstellungen entscheiden mit darüber, ob der Betreffende der von Experten vorgeschlagenen Therapie oder Prävention gegenüber aufgeschlossen ist oder nicht - mit erheblicher Auswirkung auf die Therapiemitarbeit, der Compliance -. Die französische Medizinsoziologin Claudine Herzlich untersuchte 1973 die subjektiven Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit bei Angehörigen der Pariser Mittelschicht. Als 36 Ergebnis lassen sich die Laienvorstellungen drei Kategorien zuordnen (siehe Tabelle 5). Tabelle 5 vermittelt einen Überblick subjektiver Vorstellungen zu Gesundheit und Krankheit: Inhalt Beziehung zur Person Beziehung zu anderen Formen Beziehung zur Krankheit Gesundheit als Vakuum Sein Reservoir an Gesundheit Haben Gesundheit als Gleichgewicht Tun ein positiv bestimmter Inhalt fehlt Robustheit und Stärke Widerstandspotential gegenüber äußeren Einflüssen unpersönliche Tatsache alles oder nichts persönliches Merkmal messbar, stabil, veränderbar sekundär bewusst Grundlage von Gesundheit als Gleichgewicht körperliches Wohlbefinden, gute Stimmung, Aktivität, gute Beziehungen zu anderen persönliche Norm alles oder nichts unmittelbar bewusst wird durch Krankheit zerstört Widerstand gegen Krankheit basiert auf Reservoir an Gesundheit Störungen werden assimiliert Tab.5 Laienvorstellungen von Gesundheit – drei Dimensionen (Übersetzung von Faltermaier; 1998, S. 79; nach Herzlich, 1973, S. 63). Die Untersuchung von Herzlich hat ergeben, dass Gesundheit in erster Linie mit endogenen Faktoren wie Konstitution, Temperament und Erbanlagen in Verbindung gebracht wird, Krankheit dagegen mit exogenen Einflüssen wie städtische Umwelt, Unfälle, Bakterien usw. (Waller, 1996). Nach einem Überblick von Faltermaier (1998) sind Gesundheitskonzepte von Erwachsenen verschiedener Altersgruppen sehr differenziert, wobei sich in Untersuchungen zur subjektiven Vorstellung von Gesundheit in Großbritannien, Frankreich und Deutschland immer wieder vier Dimensionen finden lassen: 37 Gesundheit als `Abwesenheit von Krankheit` (geschätzte Verbreitung aufgrund verschiedener Erhebungen ca. 13 %): Hier wird Gesundheit nicht als eigene Qualität erlebt. Erst das Auftreten von Beschwerden oder Krankheit schafft ein Bewusstsein für den vorher für selbstverständlich angenommenen Gesundheitszustand. Gesundheit als `Energiereserve` (Verbreitung ca. 28 %): Die gesundheitliche Energie oder Widerstandskraft wird als angeborenes oder erworbenes Potential angesehen, das im Laufe das Lebens zuoder abnehmen kann. Gesundheit als `funktionale Leistungsfähigkeit` (Verbreitung ca. 30 %): Hier ist vor allem die Arbeitsfähigkeit gemeint, aber auch die Erfüllung alltäglicher Rollenverpflichtungen. Gesundheit als `Gleichgewicht` oder `Wohlbefinden` aufzufassen als innere Ruhe und Zufriedenheit (Verbreitung ca. 40 %): Körperliches und seelisches Wohlbefinden gehören ebenso wie Ausgeglichenheit und Lebensfreude zu dieser Form des Verständnisses von Gesundheit (S. 80). Diese Gesundheitskonzepte schließen einander nicht aus, d.h. eine Person kann gleichzeitig mehrere Gesundheitskonzepte für sich als zutreffend angeben. Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit und als funktionale Leistungsfähigkeit finden sich tendenziell häufiger in den unteren sozialen Schichten, Gesundheit als Gleichgewicht oder Wohlbefinden wird eher von Frauen und von Menschen mittleren Alters angegeben, während Männer aber auch alte Menschen bevorzugt Gesundheit als Leistungsfähigkeit angeben. Besonders sozialdemographische Unterschiede (Alter, Geschlecht, soziale Schicht und Berufszugehörigkeit) führen zu der Annahme, dass subjektive Gesundheitskonzepte in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensbedingungen und Lebenserfahrungen gebildet werden. Laienkonzepte von Gesundheit lassen also, bezogen auf das Alter, eine zeitlich-biographische Bedeutungsebene erkennen und implizieren damit eine dynamische Seite, die Faltermaier (1998) anhand einer Energiemethapher verdeutlicht. Gesundheit lässt sich je nach Zeit-Konzept als „Batterie“, „Akkumulator“ oder „Generator“ (S. 81) beschreiben. 38 Unter diesem Gesundheitsaspekt lässt sich die Frage nach Ähnlichkeiten zwischen chronischen Erkrankungen (Kap. 3) und dem Prozess des Alterns stellen, denn beide sind „behandlungsresistent“ (Fries, 1989, S.21) und erfordern ein Verhalten, das Baltes und Baltes (1989) in Bezug auf das erfolgreiche Altern mit dem Modell der selektiven Optimierung und Kompensation erklären. Unter subjektiven Vorstellungen zu Gesundheit werden die individuellen Auffassungen und Definitionen von Personen verstanden. Von subjektiven Theorien spricht man, wenn auch die individuellen Sichtweisen über Ursachen und Kontextbedingungen - Selbst- und Weltsicht - erfasst werden. Der Gegenstandsbereich subjektiver Theorien ist das menschliche zweckrationale Handeln in Bezug auf Gesundheit oder Krankheit, das auf die Basis jeweiliger Erfahrungen und Wissen zurückzuführen ist (Filipp & Aymanns, 1997; Flick, 1998; Frank, Belz-Merk, Bengel & Schrittmatter, 1998; Verres, 1989; Bengel & Belz-Merk, 1990). Die aus Handlungsalternativen getroffene Entscheidung führt zu Erwartungen über Handlungsergebnisse, so dass subjektive Theorien „das Insgesamt aller Wissens- und Vorstellungsinhalte abbilden, die mit der jeweils betrachteten Erkrankung assoziiert wird“ (Filipp, 1990, S. 248). Damit wird das Subjekt zum Experten für einen bestimmten Lebensbereich, wobei für die Verarbeitung körperlicher Erkrankungen laienhaftes Wissen, Einstellungen und Überzeugungen von großer Bedeutung sind (Hasenbring, 1990). Um über subjektive Vorstellungen - als Teil - hinaus die subjektiven Theorien von Gesundheit zu erfassen, findet Faltermaier (1994; 1998) mittels Interview von gesunden Frauen und Männern im mittleren Erwachsenenalter zehn verschiedene Typen von subjektiven Gesundheitstheorien. An ihnen lässt sich erkennen, in welchen Lebensbereichen welche Risiken für die eigene Gesundheit wahrgenommen werden, welche Erfahrungen damit verknüpft werden, um durch mögliches Handeln eine Kontrolle über diese Risiken zu erhalten. Eine zentrale Frage ist dabei, wie seitens des Individuums Einfluss auf die Gesundheit genommen werden kann. Welche Faktoren und Prozesse haben Einfluss auf die Wechselwirkungen zwischen körperlichen und psychischen Belastungen? Wo liegen Handlungsmöglichkeiten und Handlungsgrenzen? Wie lässt sich ein Ausgleich zwischen beruflicher Belastung und familiären Regenerationsressourcen schaffen? 39 Das Gesundheitshandeln beruht stark auf persönlichen Einstellungen und Erfahrungen, wobei die individuell entwickelten subjektiven Theorien eine Basis für sinnvolles Agieren ergeben, aber nichts darüber aussagen, ob tatsächlich danach gehandelt wird. Um das gesundheitsbezogene Handeln im Alltag erklären zu wollen, müssen subjektive Konzepte und Theorien um den Kontext eines biographischen Lebenskonzepts und sozial vorstrukturierte Handlungsanforderungen erweitert werden. Faltermaier (1998) stellt ein subjektives Gesundheitskonzept und Gesundheitshandeln schematisch dar. Zur Veranschaulichung siehe Abbildung 4: Lebenskonzept Subjektives Gesundheitskonzept Bedeutung von Arbeit/Beruf Subjektive Theorie von Gesundheit Positive Einflüsse Negative Einflüsse Einflussprozesse Risikowahrnehmung Kontrollüberzeugungen Gesundheitshandeln Umgang mit Risiken Bewältigung von Belastungen Risikoverhalten als Bewältigungsversuch Ausgleich von Risiken/Belastungen Abb.4 Subjektives Gesundheitskonzept und Gesundheitshandeln (S. 84). Zur Planung von gesundheitsfördernden Strategien erweist es sich für Faltermaier (1998) als sinnvoll, an den subjektiven Vorstellungen von 40 Gesundheit und an den im Laiensystem bereits existierenden Selbsthilfeaktivitäten anzusetzen (vlg. dazu auch Waller, 1996). Diese praktizierten Selbsthilfeaktivitäten als Gesundheitsvorstellungen von Individuen und die jeweilige Organisierung des Laiengesundheitssystems bilden Grundlage und Ausgangspunkt für eine pädagogische Intervention (Petermann, 1997; Schmid & Dlugosch, 1997; Faltermaier, 1998; Bengel & Belz-Merck, 1990). 2.1.2 Wissenschaftliche Konzepte Das System unserer Gesundheitsversorgung ist durch eine pathogenetische Betrachtungsweise gekennzeichnet und richtet die Behandlung nach möglichst schneller Beseitigung der Symptome und Beschwerden aus. Trotz großer Erfolge in Diagnostik und Therapie wurde die Vernachlässigung der Person in ihrer Ganzheitlichkeit beklagt. Die Kritik an dem medizinischen Versorgungssystem geht mit einer Diskussion um den Gesundheits- und Krankheitsbegriff einher, die wiederum zu neuen Ansätzen und Modellen führt (King & Hinds, 2001). Hierzu zählen Theorien und Entwürfe zur `seelischen` oder `psychischen Gesundheit` die sich auf Selbstverwirklichungskonzeptionen und Persönlichkeitstheorien beziehen (Paulus, 1994; Becker, 1995). Neben dem organischen Befund soll den psychosozialen Aspekten, die für die Krankheitsbewältigung und Heilung von Bedeutung sind, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden Eine ausführliche Beschreibung der Gesundheits- und Krankheitsmodelle ist bei Becker (1992; und Waller, 1996) zu finden. Um den Wandel zur Subjektorientierung in den Gesundheitswissenschaften zu verdeutlichen, werden im folgenden einige gängige Modelle vorgestellt. 2.1.2.1 Krankheitsmodelle Biomedizinisches Störungsmodell: Das bis heute in Arztpraxen und Krankenhäusern anzutreffende biomedizinische Störungsmodell fasst Krankheit als Folge gestörter somatischer Prozesse auf. Die reduzierte Sicht auf charakteristische Symptome, Ursache und Verlauf, lassen Krankheit und Gesundheit als 41 Gegensätze erscheinen. Entweder ist ein Mensch krank oder gesund. Die Reparatur des Körpers als Maschinenmodell obliegt dem behandelnden Arzt. Dieses Modell sieht sich zunehmend der Kritik ausgesetzt. Psychosoziale Modelle: Diese Modelle sind als bewusste Gegenposition zum biomedizinischen Modell konzipiert worden und beruhen auf unterschiedliche Theorien über Störungen. Ihre Gemeinsamkeit bei der Definition, Identifikation, Entstehung und Behandlung psychischer Störungen liegt in der Betonung psychischer einschließlich sozialer Bedingungen . Sie gehen von einer Kontinuität zwischen normalem und gestörtem Verhalten aus sowie der Bedeutung des psychosozialen Kontextes für Entstehung von Störungen und setzen eine Multikausalität von mitbestimmenden Ursachen voraus. Die primäre Ausrichtung auf psychische Störungen unter Ausklammerung biologischer Faktoren ist bei diesen Modellen kritisch zu bewerten. Diathese - Stress - Modelle: Gemeinsam ist diesen Modellen die psychosomatische Sicht auf Krankheit. Sie gehen von der Annahme aus, dass Krankheiten aus dem Zusammenspiel belastender Bedingungen (Stressoren) und individueller Krankheitsdisposition erfolgen. Krankheit wird als psychische Überforderung einer Person gewertet. Dieses Modell verbindet biomedizinische und psychosoziale Ansätze, wobei Einflüsse kritischer Lebensereignisse mitwirken. Von einer Kontinuität zwischen Krankheit und Gesundheit wird ausgegangen. Kritik finden diese Modelle unter anderem darin, dass nicht nur Überforderungen oder kritische Lebensereignisse zu psychischen Krankheiten führen können, sondern auch Unterforderungen oder Sinnkrisen. Biopsychosoziale Modelle: Biopsychosoziale Modelle fordern als umfassende Alternative zum biomedizinischen Ansatz die systematische Rücksichtnahme auf biologische, psychologische und soziale Faktoren von Krankheit. Die 42 Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit und zwischen Lebensproblemen und Krankheit sind fließend. Bei der Behandlung und ebenso der Prävention sind in vielen Fällen auch Lebensprobleme mit einzubeziehen. Kritisch ist zu diesen Modellen anzumerken, dass sie zwar Krankheit, jedoch keine Gesundheit erklären können. 2.1.2.2 Gesundheitsmodelle Pathogenetisches Modell: Hierbei handelt es sich um das gesundheitsbezogene Gegenstück zum biomedizinischem Störungsmodell. Gesundheit wird mit körperlicher Funktionstüchtigkeit gleichgesetzt. Krankheit ist der Gegenspieler von Gesundheit, und daher ist die Kritik an biomedizinischen Störungsmodellen übertragbar: das Modell klammert die seelische Gesundheit und psychosoziale Komponenten aus. Salutogenetisches Modell von Antonovsky: Eine deutliche Abkehr von Pathogenese – Krankheitsentstehung - stellt das salutogenetische Modell des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky dar. Er wich von der üblichen krankheitsverursachenden Fragestellung ab und interessierte sich für die Gründe, weshalb Menschen trotz einer Fülle von Gesundheitsrisiken gesund bleiben und nicht erkranken. Antonovsky vertritt die Anschauung eines „Kontinuums mit den Polen Gesundheit; körperliches Wohlbefinden und Krankheit; körperliches Missempfinden“ (Bengel, Schrittmatter & Willmann, 1998, S.32). Damit zieht er keine klare Grenze, sondern geht vielmehr von einem Kontinuum mit den beiden Endpunkten Gesundheit und Krankheit aus. Das Ergebnis eines interaktiven Prozesses zwischen belastenden Faktoren (Stressoren) und schützenden Faktoren (Widerstandsressourcen) im Kontext der Lebenserfahrung markiert den Platz einer Person auf diesem Kontinuum. Aus Antonowskys Sicht sind Stressoren etwas Alltägliches und nicht wie im pathogenetischen Modell ein krankmachender 43 Ausnahmezustand. Als zentrale Widerstandsressource entwirft Antonowsky das Konzept des „Kohärenzsinns“ (Dlugosch, 1994; Waller, 1996), was einer Grundhaltung gleichkommt, die Welt als sinnvoll zu erleben. Kohärenzsinn beinhaltet die Überzeugung der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit der persönlichen Lebenssituation (Bengel, Schrittmatter & Willmann, 1998). Zur Verdeutlichung des salutogenetischen Modells erfolgt mit Tabelle 6 eine Gegenüberstellung zum pathogenetischen Modell. Pathogenetisches Salutogenetisches Modell Modell Klassifikation des Dichotom: Kontinuierliche Gesundheitsstatus Gesund versus krank Klassifikation Untersuchungs- und Spezifische Krankheit Allgemeiner Behandlungsgegenstand Gesundheits-/Krankheitsstatus Ätiologie (Ursachen) Einbeziehung von Erhebung einer Risikofaktoren ganzheitlichen Lebensgeschichte und gesundheitsförderlicher Ressourcen Stressoren Ungewöhnliches und Etwas Alltägliches und pathogenes Element in seiner Konsequenz unbestimmbar Behandlung Medikamente Stärkung von Bewältigungsressourcen Tab.6 Vergleich zwischen pathogenetischem und salutogenetischem Modell (nach Noack 1997, S. 95). Integratives Anforderungs-Ressourcen-Modell von Becker: Becker stellt ein integratives Anforderungs-Ressourcen-Modell der 44 Gesundheit vor. Gesundheit oder Krankheit wird hier als der Versuch einer Person dargestellt, eine positive oder negative Bilanz zwischen „externen oder internen Anforderungen der letzten Zeit mit Hilfe externer und interner Ressourcen“(Becker, 1992, S. 99) zu ziehen. Der Kerngedanke des Modells besagt, dass der aktuelle Gesundheitszustand davon abhängt, inwieweit es einer Person mit Hilfe der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen innerhalb der letzten Zeit gelungen ist bzw. aktuell gelingt, bestimmte Anforderungen zu bewältigen. Fällt die Erfolgsbilanz der letzten Zeit positiv aus, ist eher von Wohlbefinden und Gesundheit auszugehen. Sollte die Bilanz negativ ausfallen, ist mit Missbefinden und Krankheit zu rechnen (Becker, 1992). Als zentrale Kategorie zur Bewältigung externer und interner Anforderungen sieht Becker (1995) die seelische Gesundheit. In seiner Theorie ist die seelische Gesundheit neben der Verhaltenskontrolle eine Persönlichkeitseigenschaft, die sich aus mehreren Faktoren (z.B. Sinnerfülltheit, Expansivität, Autonomie, Selbstwertgefühl) konstituiert. Sozialisationstheoretisches Gesundheitsmodell von Hurrelmann: Hurrelmann (1994) versteht Gesundheit als Teil der biographischen Entwicklung eines Individuums. Damit ist Gesundheit ein lebenslanger Prozess der Bewältigung von inneren und äußeren Anforderungen, Kontinuität des Selbsterlebens und Selbstentwicklung. Dieser Balancezustand zwischen physischen, psychischen und sozialen Anteilen muss zu jedem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt immer wieder hergestellt werden. Gesundheit ist kein passiv erlebter Zustand des Wohlbefindens, „sondern ein aktuelles Ergebnis der jeweils aktiv betriebenen Herstellung und Erhaltung der sozialen, psychischen und körperlichen Aktionsfähigkeit eines Menschen. Soziale, ökonomische, ökologische und kulturelle Lebensbedingungen bilden dabei einen Rahmen für die Entwicklungsmöglichkeiten von Gesundheit“ (S.17). Mandala-Modell der Gesundheit von Hancock: Waller (1996) stellt ein dynamisch interaktives Gesundheitsmodell von Hancock (1990 zit. n. Waller 1996) vor. Das kreisförmige Mandala- 45 Symbol soll die Einheit von Universum und Person repräsentieren. Ebenen der Humanbiologie, der Lebensweisen, des persönlichen Verhaltens, der psycho-sozio-ökonomischen Umwelt und der physischen Umwelt werden miteinander verknüpft, beeinflussen einander, können einander „verstärken oder aufheben“ (S.22 ff.). Die angeführten Modelle veranschaulichen das wissenschaftliche Bestreben, den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen und lassen den positiven Aspekt von Gesundheit erkennen. 2.2 Übereinstimmendes Verständnis von Gesundheit Je nach Berufsgruppe und akademischer Fachrichtung ist das jeweilige Gesundheitsverständnis von deren temporären Paradigmen bestimmt. Zusammenfassend lässt sich ein: prozessorientierter, lebensgeschichtlicher und subjektiver Gesundheitsbegriff beschreiben, der zwischen Krankheit und Gesundheit fließende Übergänge sieht, Ergebnis einer umfassenden und aktiven Auseinandersetzung der Person mit ihrer natürlichen und sozialen Mitwelt ist und hindernde und fördernde Bedingungen - insbesondere grundlegende Lebensbedingungen - vorfinden kann (Blättner, 1994, S.27). Übereinstimmend findet sich in der Literatur eine positive Definition von Gesundheit, so dass Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheit verstanden wird. Weiter wird von einer Multidimensionalität von Gesundheit ausgegangen, mit körperlichen, psychischen und sozialen Aspekten, auch wenn die Gewichtung je nach Berufsgruppe unterschiedlich ausfällt. „Gesundheit kann danach als ein komplexes reziprokes Zusammenspiel betrachtet werden, in dem neben situativen [...] Faktoren kognitive, aktionale und physiologische aufeinander einwirken“ (Paulus, 1994, S.22). Allerdings herrscht keine Einigkeit über die Anzahl der Dimensionen - wie die Modelle erkennen lassen -, auch wenn die WHO noch eine „ökologische“ und eine „spirituelle Dimension“ (WHO, 1988a, b, zit. n. Kickbusch, 1992, S. 24) hinzugefügt hat. 46 2.3 Kritik an der WHO-Gesundheitsdefinition Mit der WHO-Definition von Gesundheit ist der Versuch unternommen worden, Gesundheit aus dem Kernbereich medizinischer Tätigkeit herauszurücken. Die Aufmerksamkeit wird auf Bereiche gelenkt, die stärker zur gesellschaftlichen und persönlichen Verantwortung gehören. Gesundheit ist damit nicht nur eine Frage eines funktionierenden medizinischen Systems und seiner Fortentwicklungen, sondern umfasst ebenso außermedizinische Versorgungsbereiche. Kritische Stimmen sehen in dieser Definition einen überzogenen Anspruch, da die Handlungsfelder von psychischer, sozialer, geistiger, ökologischer und spiritueller Dimensionen konsequenterweise auf die gesamte Gesellschaft und Politik ausgeweitet werden müsste (Kickbusch, 1992). Der utopische Charakter wird auch durch die Betonung des individuellen Wohlbefindens kritisiert, besonders auf dem Hintergrund einer Vielzahl von Menschen z.B. in der Dritten Welt, die tagtäglich ums nackte Überleben kämpfen müssen. Damit wird Gesundheit als ferner Idealzustand entworfen der kaum zu erlangen ist -, der einen Endzustand - vollkommenes Wohlbefinden - impliziert und den Verlauf als Kontinuum zwischen Krankheit und Gesundheit aus dem Blick verliert. Die Konsequenz daraus hieße, dass die Mehrzahl der Menschen als krank und damit als therapiebedürftig anzusehen wären. Subjektives Wohlbefinden ist nur einer von mehreren Indikatoren für Gesundheit oder Krankheit, das nicht nur unzuverlässig, sondern auch medizinisch nicht behandelbar ist. Außerdem besteht durch den Einbezug von psychischem und sozialem Wohlbefinden - zusätzlich zum körperlichen - die Gefahr einer „Medikalisierung“ (Becker, 1992, S.96) psychischer und sozialer Lebensprobleme. Des weiteren geht durch den zu erreichenden statischen Zustands des Wohlbefindens die Dynamik eines interaktiven salutogenetischen Prozesses verloren. Weitere kritische Stimmen zur Gesundheitsdefinition hat Paulus (1994) herausgearbeitet. Näheres zur Kritik an dem Gesundheitsbegriff der WHO ist auch bei Blättner (1994) zu finden, die auf einen Übersetzungsfehler hinweist. „Milz (1994) korrigiert das Absolute der Definition insofern, als er den englischen Begriff `complete` nicht mit `vollständig`, sondern mit `umfassend` übersetzt, im Sinne 47 von `ganzheitlich` (Milz 1994, S. 20, zitiert nach Blättner, 1994, S. 20 ff.), womit die utopische Definition einen politischen Charakter bekommt. Bei aller Kritik jedoch sollte nicht übersehen werden, dass mit dieser Gesundheitsdefinition der WHO der subjektive Aspekt und damit die Patientenorientierung in die medizinische Forschung - in Form von Lebensqualitätsmessungen - und den medizinischen Alltag - in Form von Compliance durch die Hinwendung zu chronischen Erkrankungen - Einzug gefunden hat. Mit ihr wird der „mechanistisch-reduktionistische Gesundheitsbegriff [...] zumindest programmatisch überwunden“ (Paulus, 1994, S. 22). 3 CHRONISCHE KRANKHEIT UND DARAUS RRESULTIERENDE BELASTUNGEN Grundsätzlich handelt es sich bei chronischen Erkrankungen nicht um ein einmaliges Ereignis, sondern um ein weitgehend irreversibles Geschehen. Charakteristisch für eine chronische Erkrankung ist, dass durch die Krankheit bedingte Beschwerden meist nur gelindert, nicht aber behoben werden können. Der Verlauf ist oft nicht vorhersehbar, Phasen der Verschlimmerung können sich mit weitgehend beschwerdefreien Zeiten abwechseln. Bezeichnend für chronische Krankheiten ist nicht nur die Unheilbarkeit, sondern auch die zunehmende Verschlimmerung, die nicht zu verhindern ist (Sohn, 1997). Die zentralen Merkmale einer chronischen Krankheit sind „universell, progressiv, haben eine lange vorsymptomatische Phase“ und sind „relativ behandlungsresistent“ (Fries, 1989, S.21). Im folgenden Abschnitt werden die hier thematisierten Krankheitsbilder Diabetes mellitus, rheumatische Erkrankungen und HIV (Humanes Immunschwäche Virus, im Folgenden HIV) skizziert und Belastungen, die durch eine chronische Krankheit entstehen können, aufgezeigt. Die Auswahl der drei chronischen Erkrankungen ist willkürlich ausgewählt und entsprechen den persönlichen Interessen des Verfassers. 48 3.1 Chronische Krankheit und krankheitsübergreifende Belastungsfaktoren am Beispiel von Diabetes, Rheuma und HIV Trotz der Verschiedenartigkeit chronischer Erkrankungen lassen sich krankheitsübergreifende Belastungsfaktoren beschreiben. Beutel (1990) fasst sie in einer Übersichtsarbeit zusammen. Neben einer allgemein reduzierten körperlichen - und psychischen - Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit wird die körperliche Integrität des Betroffenen durch den Krankheitsprozess und die Behandlungsmaßnahmen (z.B. Nebenwirkungen von Medikamenten) bedroht. Seiner Ansicht nach spielen Lebensgefährdung und Todesangst, Einbuße von Gesundheit und Wohlbefinden, Selbstkonzept und der Zukunftspläne, emotionales Gleichgewicht, Bedrohung in der Erfüllung vertrauter Rollen und Aktivitäten des täglichen Lebens sowie die Bedrohung resultierend aus der Erfordernis, sich an neue physische oder soziale Umgebungen anzupassen, eine bedeutende Rolle im Leben chronisch kranker Menschen. Beutel (1990) unterscheidet im wesentlichen sieben Belastungsdimensionen, die trotz unterschiedlicher Krankheitsgruppen allen chronischen Erkrankungen gemein sind: Vorübergehende oder anhaltende Befindlichkeitsstörungen (z.B. Ängste, Depressionen, emotionale Labilität, und Reizbarkeit); veränderte Einstellung zur eigenen Person (z.B. vermindertes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl); Belastungen für Partnerschaft und Familie; deutliche Verminderung sexueller Aktivität und gehäufte Störungen sexueller Funktionen; unbefriedigende Compliance [Therapiemitarbeit] beim Einhalten medizinischer Maßnahmen und Empfehlungen; häufige Aufgabe von Berufstätigkeit mit Folgen wie Statusverlust, Einkommenseinbußen und veränderten sozialen Rollen; Verminderung von Sozialkontakten und Freizeitaktivitäten (S. 42). Die angeführten krankheitsübergreifenden Belastungsfaktoren spielen auch für die Erkrankten der nachfolgend aufgeführten Krankheitsbilder eine bedeutende Rolle. 49 Eine große Belastung für Personen, die an Diabetes mellitus erkrankt sind, bildet das häufige Auftreten von Spätfolgen. Bekannte Komplikationen sind hierbei Niereninsuffizienz, Impotenz, Schlaganfall, Herzinfarkt, Amputationen und Erblindung. Insgesamt ist die Lebenserwartung von an Diabetes mellitus Erkrankten reduziert. Zur Vermeidung der Spätfolgen ist eine genaue Kontrolle des Blutzuckerspiegels erforderlich. Der Betroffene sollte eine aktive Rolle in der eigenen Behandlung übernehmen (z. B. mehrmaliges Kontrollieren des Blutzuckerspiegels, sportliche Aktivität und ausgewogene Ernährung). Patienten mit rheumatischen Erkrankungen sind vor allem durch Schmerzen in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt, ängstlich in bezug auf das Fortschreiten der Erkrankung, und sie fühlen sich von der Außenwelt nicht verstanden. Nach Beutel (1990) kann aufgrund der rheumatischen Erkrankung leicht ein Teufelskreis aus Schmerz, Schonhaltung, weniger Aktivitäten und dem Wegfall von sozialer Bestätigung entstehen, aus dem der oder die Betroffene nur schwer entkommen kann. Die Leidtragenden können oftmals ihre alltäglichen Verrichtungen nicht ausüben. Als Folge der empfundenen Abhängigkeit von anderen Personen und der Schmerzen können depressive Verstimmungen auftreten. Durch die in den letzten Jahren deutlich verbesserte Therapierbarkeit von HIV schwindet die Krankheit immer weiter aus dem öffentlichen Bewusstsein in den persönlichen und hausäztlichen Bereich. Mit dem Verschwinden der akuten Lebensbedrohung und dem damit einhergehenden geringer werdenden gesellschaftspolitischem Interesse, bekommt die HIV-Infektion zunehmend den Status einer chronischen Krankheit. HIV-Infizierte haben sich zusätzlich zu der - durch die Therapie verschobenen, aber bestehenden - Lebensbedrohung mit einem erheblichen Ausmaß an Ausgrenzung und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Die Diagnose „Positiv“ führt zu einschneidenden Veränderungen in allen Lebensbereichen - vor allem der Zukunftsperspektive - und zieht meist depressive Reaktionen nach sich. Wichtig ist die lebenslange und hohe Therapiemitarbeit, denn unregelmäßige Einnahme des „MedikamentenCocktails“ führt unweigerlich zu Resistenzen und damit zu einer geringeren Lebenserwartung. Außerdem sind die Nebenwirkungen der antiretoviralen Therapie so massiv, dass es erhebliche Disziplin erfordert, die Medikamente trotzdem einzunehmen. 50 Die sexuelle Aktivität ist oft durch die medikamentöse Behandlung eingeschränkt und ein angstfreier, vertrauensvoller Austausch hinsichtlich Sexualität, Liebe, Freundschaft und Beziehungen zumindest erschwert (Dunde, 1991). Nachfolgend wird auf die einzelnen chronischen Erkrankungen Diabetes, Rheuma und HIV eingegangen werden. 3.1.1 Diabetes mellitus Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der sich relativer oder absoluter Insulinmangel in einer Störung der lebensnotwendigen Blutzuckerregulation zeigt. Es können im wesentlichen zwei Hauptformen unterschieden werden, der Typ-I-Diabetes mellitus („Insulin Dependent Diabetes Mellitus“, IDDM) und der Typ-II-Diabetes mellitus („Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus“, NIDDM). Der Typ-I-Diabetes mellitus manifestiert sich meist in der Kindheit und Jugend und ist gekennzeichnet durch fehlendes körpereigenes Insulin, während der Typ-II-Diabetes mellitus überwiegend nach dem 40. Lebensjahr auftritt (Hirsch, 1996). Bei dem Typ-II-Diabetes mellitus ist die Insulinwirkung durch eine erhöhte Insulinresistenz gestört. Der erhöhte Blutzuckerspiegel verursacht kaum subjektive Beschwerden, auch fehlen sichtbare Krankheitssymptome (Broda & Muthny, 1990). Diabetiker sind nicht nur durch akute Stoffwechselentgleisungen bedroht, sondern auch durch Spätkomplikationen nach langjährigem Krankheitsverlauf und Multimorbidität. Gefürchtetste Folgen sind die fortschreitende Schädigung der Blutgefäße (Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputationen), Niereninsuffizienz und Erblindung. Um das Risiko derartiger Krankheitsfolgen zu vermindern, ist eine lebenslange Überwachung und Einstellung des Blutzuckerspiegels notwendig. Diabetes macht eine ständige Abstimmung von Nahrungsaufnahme, körperlicher Betätigung und - gegebenenfalls - Insulinzufuhr erforderlich. 3.1.2 Rheumatische Erkrankungen 51 Unter dem Oberbegriff “rheumatische Erkrankung“ ist eine Vielzahl verschiedener Erkrankungen zusammengefasst, deren gemeinsames Merkmal Manifestationen am Stütz- und Bindegewebe des Bewegungsapparates (Gelenke, Sehnen, Muskeln, Wirbelsäule, Knochen) und häufige systemische Beteiligung des Bindegewebes innerer Organe (Herz, Gefäße, Lunge, Leber) sind. Nach häufig schleichendem Beginn verlaufen rheumatische Erkrankungen unvorhersagbar in entzündlichen Schüben, die zu zunehmender Einschränkung der Mobilität führen und von Schmerzen begleitet werden. Der Rheumafaktor ist bei ca. 5% der gesunden Personen in der Bevölkerung unter 50 Jahren nachzuweisen, mit zunehmendem Lebensalter steigt der Prozentsatz auf ca. 10-15%. Die Gruppe der rheumatischen Erkrankungen ist heterogen, dazu zählen u. a. die chronische Polyarthritis, Morbus Bechterew und Arthrose, die schubweise verlaufen und durch eine Abnutzung des Gelenkknorpels und der Binde- und Stützgewebe gekennzeichnet sind. Zu den Hauptsymptomen gehören Schmerz, Steifigkeit, Deformierung und Funktionsbehinderung der Erkrankten (Pschyrembel, 1990; Beutel, 1990). 3.1.3 HIV-Infektion Mit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) wird eine schwere Schwächung des körpereigenen Abwehrsystems benannt. Bei einem erworbenen Immundefekt ist die körpereigene Abwehrfähigkeit gegenüber Krankheitserregern stark vermindert. Das Krankheitsbild AIDS ist gekennzeichnet durch verschiedene Infektionen und Symptome, die sich infolge des Immundefektes entwickeln können. Die Immunschwäche wird durch das Retrovirus HIV verursacht, das die Zellen des Abwehrystems befällt, sich in ihnen vermehrt und schließlich die infizierten Zellen zerstört. Das typische Merkmal an einer HIV-Infektion ist, dass die körpereigenen Abwehrsysteme das Virus langfristig nicht bekämpfen können, obwohl schon kurz nach der Infektion Antikörper gebildet werden. Eine Ansteckung mit dem Virus ist nicht mit der Erkrankung an AIDS gleichzusetzen. Es muss unterschieden werden zwischen der Zeit der Infektion ohne Krankheitserscheinungen, den Vorstadien und schließlich dem Ausbruch der 52 Krankheit AIDS. HIV-infizierte Menschen sind nicht aidskrank, sie tragen lediglich den Erreger in sich, der zu AIDS-manifestierenden Krankheiten führen kann. Von der Umwelt werden HIV-infizierte Menschen jedoch oft als krank behandelt und aus Angst vor Ansteckung oder moralischen Gründen ausgegrenzt. Die Krankheit bricht in den meisten Fällen erst Jahre oder Jahrzehnte nach der Infektion aus, so dass durch die in den Industrieländern erhältliche medikamentöse Therapie und die damit steigende Lebenserwartung immer häufiger von einer chronischen Krankheit gesprochen wird. Obwohl die Therapiefortschritte für HIV-Infizierte Anlass zur Hoffnung sind, dürfen diese nicht als Möglichkeit einer Heilung von AIDS missverstanden wenden. Von der lebenslang notwendigen Therapie kann nach heutigem Kenntnisstand bestenfalls eine deutliche Lebensverlängerung, jedoch keine Heilung erwartet werden. Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen HIV ist kurzfristig nicht zu erwarten (Arastèh & Weiß, 1997). Die lebenslange gesundheitliche Beeinträchtigung durch eine chronische Erkrankung wirkt sich in erheblichen Maße auf psychosoziales Wohlbefinden aus und wird nachfolgend thematisiert. 3.2 Gesundheitsbezogene Lebensqualität und psychosoziale Folgen Die Darstellung der unterschiedlichen Belastungen aufgrund einer chronischen Erkrankung legen eine eingeschränkte subjektive Gesundheit von Menschen mit Diabetes mellitus, Rheuma-Betroffenen und HIV-Infizierten nahe. Diese Annahme wird von Ergebnissen epidemiologischer Studien unterstützt. In der Normierungsstichprobe des SF-36 Health Survey zeigte sich ein abweichendes Lebensqualitätsprofil sowohl für die Gruppe „Diabetes mellitus“ als auch für die Gruppe „Arthritis, Gelenkrheumatismus und Arthrose“ mit deutlichen Einbußen in der subjektiven Gesundheit (Bullinger & Kirchberger, 1998). In einer Untersuchung von Hanninen, Takala und KeinanenKiukaanniemi (1998) zeigten Diabetes mellitus-Patienten eine starke Beeinträchtigung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe. Insulinbehandlung, ein beeinträchtigtes 53 Sehvermögen, Übergewicht wirkten sich ebenso wie die Dauer der Erkrankung negativ auf die subjektive Gesundheit aus. Kohlmann, Herlyn, & Siegrist (1994) befragten 122 an den Bewegungsorganen erkrankte Personen. Auch diese Patientengruppe berichtete von einer eingeschränkten gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Starke Beeinträchtigungen waren vor allem in den Dimensionen Schmerz, Mobilität, Energieverlust und Schlaf festzustellen. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, welche psychosozialen Faktoren einen Einfluss auf die subjektive Gesundheit von chronisch kranken Menschen ausüben. Rose, Burkert, Scholler, Schirop, Danzer & Klapp (1998) untersuchten potentielle Determinanten der subjektiven Gesundheit bei 116 Diabetikern und stellten dabei fest, dass die Variablen „Krankheitsbewältigung“ (Coping) und Persönlichkeitsvariablen einen Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität ausübten. Die positive Wirkung von sozialer Unterstützung auf das Wohlbefinden wurde in zahlreichen Untersuchungen belegt (vgl. dazu auch Stokes, 1983; Schwarzer & Leppin, 1989; Lucchetti, 1998). Soziale Unterstützung kann sich dabei auf unterschiedlichen Ebenen äußern und zwar auf der Personenebene - Wie viele Kontaktpersonen sind vorhanden?, - der Gefühlsebene - Wird die Unterstützung auch als solche wahrgenommen? - oder auf der Handlungsebene - Wie wird Beruf und Freizeit gestaltet? -. Sozial gut eingebettet zu sein, ist eine hilfreiche Stütze bei der Bewältigung von chronischen Erkrankungen. In diesem Zusammenhang wird sozialer Unterstützung eine Pufferfunktion zugesprochen (Sohn, 1997). In einer österreichischen Studie zur Bedeutung sozialer Netzwerke und Unterstützung für die Gesundheit wurde auf die Daten von insgesamt 8108 Personen zurückgegriffen (Statistische Mitteilungen zur Gesundheit in Wien, 1998). Ein eher negatives Ergebnis der Untersuchung ist, dass chronisch und akut erkrankte Personen im Vergleich zu gesunden Personen über ein deutlich kleineres soziales Netzwerk verfügen. Dagegen zeigte sich ein positiver Zusammenhang zwischen einer höheren Anzahl von Bezugspersonen und geringeren gesundheitlichen Beschwerden. Die Darstellung von aktuellen Befunden zeigt, dass soziale Unterstützung die Belastung durch eine chronische Erkrankung mildern kann. 54 Sohn (1997) hält verschiedene Grundmuster im Umgang mit chronischer Krankheit fest: Verleugnung der Krankheit, medizinisch indizierte Verhaltensempfehlungen werden außer acht gelassen. Schicksalhafte und duldende Hinnahme der Nichtheilbarkeit der chronischen Erkrankung. Ängstliche Anspruchshaltung und Rollenverteilung mit Hilfsfunktionen durch Familienmitglieder. Aktive Auseinandersetzung mit der Diagnose und arztunabhängige Informationsbeschaffung (z.B. Selbsthilfegruppe). Pseudoaktivität. Durch Arztwechsel und immer neue Therapiekonzepte vermeidet der chronisch Kranke eine gesundheitsfördernde Lebensstiländerung. Die beste Voraussetzung um sich gesund zu fühlen, ist neben psychischen Abwehrkräften, körperlicher Fitness auch ein enggeknüpftes soziales Netz nötig (Sohn, 1997). Damit rückt das Gebiet der individuellen und sozialen Gesundheitsselbsthilfe als Ansatz für psychosoziale und pädagogische Interventionen in das Zentrum der Aufmerksamkeit professioneller Hilfe. 4 SUBJEKTIVE GESUNDHEIT UND PÄDAGOGISCHE INTERVENTIONEN Ob eine chronische Krankheit und medizinisch notwendige Behandlung von Patienten akzeptiert wird, hängt vom subjektiven Krankheitskonzept ab. Subjektive Theorien von Krankheit und Gesundheit beeinflussen maßgeblich die Einschätzung von Bewältigungsoptionen und damit die Motivation von Patienten, den Krankheitsprozess aktiv mitzugestalten. Somit befinden sich Patientenberatung und Patientenschulung mit ihrer pädagogischen Absicht im Spannungsfeld zwischen „Empowerment [als] Stärkung von Selbsthilfe- und Durchsetzungsfähigkeit“ (Stark, 1998 S.39) und medizinischem Management (Schmidt & Dlugosch, 1997). Um chronisch kranke „Patienten“ in ihrem Lebenskontext und ihrer Gesamtperson zu Experten ihrer eigenen Gesundheit zu bestärken, bedarf es in der medizinischen Praxis einer Orientierung an den 55 Zielen der Gesundheitsförderung wie dem „Empowerment“ (Paulus & Deter, 1998; Faltermaier, 1998). Dazu bedarf es das Interesse auf den informellen Sektor der Gesundheitsselbsthilfe im Alltag zu lenken. 4.1 Das Subjekt im gesundheitsbezogenen Alltag Anforderungen des Alltagslebens in Übereinstimmung mit den eigenen Bedürfnissen der entsprechenden Lebenssituation zu bringen, wirkt sich maßgeblich auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität aus. Jeder Mensch geht tagtäglich mit seinem Körper um, bemerkt Beeinträchtigungen, reagiert darauf und bemüht sich auf diese Weise, seine Gesundheit zu erhalten. Erst nach vergeblicher Auseinandersetzung mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und nach möglicherweise vergeblicher Hilfesuche im sozialen Netzwerk, wenden sich Betroffene an Experten des professionellen Gesundheitswesens. Bei der Entscheidung, einen Arzt aufzusuchen, spielen Faltermaier (1998; vgl. dazu auch Lang, Rieckmann & Schwarzer, 2000) zufolge psychische und soziale Faktoren eine entscheidende Rolle. „Die Wahrnehmung körperlicher Veränderungen, ihre Einschätzung als Krankheitssymptome und deren Bedrohlichkeit, Gespräche mit Bezugspersonen über diese Beschwerden und ihre Ratschläge, Überlegungen über die Ursache einer möglichen Krankheit und die Einstellungen über die Wirksamkeit medizinischer Hilfen“ (Faltermaier, 1998, S. 72), also der Bereich der individuellen und sozialen Gesundheitsselbsthilfe, bilden die Basis für gesundheitsfördernde Interventionen. Jedoch ist das Gesundheitsverhalten im Alltag in der Regel außerhalb der Reichweite des professionellen Systems. Das Laiengesundheitssystem, wobei der Begriff des Laien lediglich zur Abgrenzung vom Professionellen verstanden wird, findet in der Gesundheitsforschung zunehmend Interesse. Im Zentrum des Laiengesundheitssystems stehen das betroffene Individuum, das familiäre System sowie soziale Netzwerke, Selbsthilfegruppen und öffentliche Gesundheitsinstanzen. Die oben angeführten Handlungsebenen umschreiben zentrale Leistungen und Funktionen des Laiengesundheitssystems, die das Individuum zur Selbsthilfe nutzt bzw. nutzen kann, um eine Krankheit zu verhindern oder zu lindern. Der Umfang der 56 Gesundheitsselbsthilfe ist breit gefächert und zieht sich von Alltagserkrankungen bis hin zu chronischen Erkrankungen (Waller, 1996). Faltermaier (1998) verweist auf eine repräsentative Studie von Grunow et al. (1983; zit. n. Faltermaier, S.74), die zeigt, dass insgesamt 92 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland individuelle oder soziale Selbsthilfemaßnahmen bei gesundheitlichen Problemen ergreifen. Zur Gesundung griffen 77 Prozent der Befragten häufig oder gelegentlich zu Selbsthilfemaßnahmen. 63 Prozent holten gesundheitsbezogene Informationen von Familienmitgliedern ein, und 50 Prozent ließen sich von diesen auch praktisch unterstützen. Diese bereits praktizierten Selbsthilfeaktivitäten, die Gesundheitsvorstellungen von Individuen und die jeweilige Organisierung des Laiengesundheitssystems bilden neben subjektiven Vorstellungen, Grundlage und Ansatzspunkt für ein pädagogische Interventionen wie Patientenberatung und -schulung (Petermann, 1996; Schmidt & Dlugosch, 1997; Faltermaier, 1998). 4.2 Patientenberatung und Patientenschulung Als Begriffsbestimmung versteht Petermann (1997) die Bezeichnung der Patientenschulung als abgeschwächte Version der Patientenberatung. Beide „setzen an den Bedürfnissen, der krankheitsbedingten Problemlage und den Fertigkeiten von chronisch Kranken an“ (S.5). Bei der Patientenberatung steht die Begleitung, Aufklärung und Motivation des Patienten zu gesundheitsförderndem Verhalten im Vordergrund. Sie wird in Form von persönlichen Gesprächen - meist durch den Arzt - durchgeführt. Unter Patientenschulung werden Maßnahmen verstanden, die den Patienten befähigen sollen, mit seiner Erkrankung ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das vermittelte Wissen soll dem Patienten neues Bewältigungsverhalten (Coping) ermöglichen und zu mehr Eigenverantwortung führen. Begriffe wie pädagogische Interventionen oder Schulung, die auf einen erzieherischen Charakter hinweisen, haben oft einen Beigeschmack des Zwanges. Der Patient, und allein schon in diesem Wort macht sich die 57 Hierarchie zwischen Experten und Laien bemerkbar, erscheint im Rahmen einer Schulung möglicherweise unfrei und unmündig. Solange die Patientenschulung nicht primär auf das Erlernen notwendiger therapeutischer Maßnahmen (Diabetiker: Insulingabe; HIV-Infizierte: Tabletteneinnahme; Rheumatiker: Diät und Bewegung) abzielt, sollte soviel Selbstbestimmung wie möglich angestrebt und der generelle Begriff „Beratung“ (Schmidt & Dlugosch, 1997 S.24) zugrundegelegt werden. Das begrenzte Zeitbudget und die krankheitsbezogene Objektivierung gehen einher mit einer relativ geringen Berücksichtigung von individuellen Motiven und Bedürfnissen. Doch „das Medizinsystem tut sich mit einer differenzierten, individualisierten Beratung von Patienten eher schwer“ (S. 24; vgl. dazu auch Faltermaier, 1994). Eine Patientenberatung sollte keine einseitige Erteilung von Ratschlägen oder Vorschriften durch einen Experten an einen Patienten intendieren, sondern ein längerfristiger Prozess sein, der Motive, Kenntnisstand, Ziele und subjektive Gesundheitsvorstellungen des Hilfesuchenden mit einbeziehen und sich so weit wie möglich davon leiten lassen. Patientenberatungen finden in verschiedenen Settings statt, die sich beträchtlich in Struktur und Grundorientierung - kurativ oder eher präventiv voneinander unterscheiden können (Schmidt & Dlugosch, 1997). Neben Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Ambulanzen und Polikliniken sind hier auch Krankenhäuser sowie Rehabilitations- und Kurkliniken zu nennen. Im Krankenhaus werden Maßnahmen der Beratung und Schulung vornehmlich dann durchgeführt werden, wenn chronische Erkrankungen neu diagnostiziert werden. Aus zeitlichen sowie organisatorischen Gründen werden entsprechende Schulungs- und Beratungsangebote dann jedoch in Rehabilitationseinrichtungen oder im ambulanten Bereich weitergeführt und ergänzt. Die Erkenntnis, dass eine Vielzahl moderner Zivilisationskrankheiten chronisch-degenerativ sind, hat dazu geführt, vermehrt Gewicht auf Fragen der Prävention zu legen. Durch die sich ständig verbessernden medizinischen Behandlungsmöglichkeiten haben sich auch die Überlebenschancen vieler chronisch Kranker erhöht. Neben der medizinischen Behandlung und Therapie im engeren Sinne rücken zunehmend Prozesse des patientenbezogenen Krankheitserlebens und Fragen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität in den Fokus der Betrachtung (Petermann, 1996; Bullinger, 1998). 58 Im Rahmen der Patientenschulung sieht Petermann (1997) Aspekte der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention überlagert (vgl. dazu auch Schmidt & Dlugosch, 1997), wobei er sechs zentrale Komponenten von Patientenschulungsprogrammen ausmacht: Aufklärung: Es soll Behandlungswissen spezifisches vermittelt und Krankheitsein und angemessenes Krankheitsmodell erläutert werden. Aufbau einer angemessenen Einstellung zur Erkrankung und ihrer Bewältigung: vermehrte Krankheits- und Behandlungseinsicht, Erhöhung der Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit der Krankheit, Verbesserung der Therapiemotivation und -mitarbeit (Compliance). Sensibilisierung der Körperwahrnehmung: frühzeitiges Erkennen von Warnsignalen, Vorboten, Überlastungsanzeichen und der Verschlimmerung des Krankheitszustandes. Vermittlung von Selbstmanagement-Kompetenzen: Fertigkeiten bezüglich der Medikation (Entscheidungskompetenz bei der Applikation und Dosierung von Medikamenten, Verbesserung der Einnahmetechnik von Arzneimitteln und der Anwendung von Hilfsmitteln ...), spezielle Atemtechniken, Sitzhaltungen und Entspannungsübungen. Maßnahmen zur Anfallsprophylaxe und Sekundärprävention: Aufbau einer gesundheitsförderlichen Lebensweise (Nikotinabstinenz, mäßige sportliche Aktivität, gesunde Ernährung), Vermeidung von Stress und spezifischen Auslösern sowie Erfahrungen im Rahmen einer Notfallprophylaxe (Verhalten in Krisensituationen). Erwerb sozialer Kompetenzen und Mobilisierung Unterstützungsressuorcen: Kommunikationsfähigkeit Erkrankung Auswirkungen, und ihre sozialer über Artikulation die von behandlungsbezogenen Befürchtungen und Bedürfnissen gegenüber dem Arzt oder Apotheker, Einbeziehung der Angehörigen und Bezugspersonen. (Petermann, 1997, S.3-4). 59 Der Erfolg oder Misserfolg von pädagogischen Bemühungen hängt in entscheidendem Maße davon ab, inwiefern subjektive Vorstellungen ausreichend berücksichtigt werden. Deshalb müssen Ziele von Beratung und Schulung an subjektiven Ressourcen und Kompetenzen ausgerichtet sein. 4.2.1 Ziele von Patientenberatung und Patientenschulung Verfahren der Patientenschulung haben das Ziel, durch eine Verbesserung der Krankheits- und Behandlungseinsicht die Eigenverantwortung des Patienten zu fördern. Die Bemühungen gelten somit der „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Hurrelmann, 1994, S. 183) bzw. dem Selbst- und Krankheitsmanagement, damit der betroffene Patient die chronische Erkrankung und die damit verbundenen Belastungen erfolgreich bewältigen kann (Petermann, 1997; Bullinger, 1994). Eigentlich geht es bei der Patientenschulung immer auch um eine Verbesserung der Therapiemotivation (Schmidt & Dlugosch, 1997) und Therapiemitarbeit zur Lebensqualitätsverbesserung der Patienten und um Kostenreduzierung im Gesundheitswesen (Petermann, 1997). Abbildung 5 soll die Ziele verdeutlichen: Differenziertes Wissen: Krankheit und Bewältigungswissen Neues Bewältigungsverfahren: aktives und eigenverantwortliches Mitwirken bei der Krankheitsbewältigung (= Krankheitsmanagement) 60 Verbesserte Compliance Erhöhte Lebensqualität Reduzierte Kosten im Gesundheitswesen Abb.5 Globale Ziele der Patientenschulung (nach Petermann 1997, S. 6) Patientenschulung wird als ein Breitbandansatz verstanden, der neben einer spezifischen krankheitsbezogenen Schulung und Wissensvermittlung auch Gesundheitsberatung sowie Familien- und Angehörigeneinbeziehung enthält. Schmidt & Dlugosch (1997) plädieren dafür, dass bei der Beratung die Aufmerksamkeit nicht auf den Patienten - als Kategorie - oder auf deren Krankheiten als solche gelenkt werden sollte, sondern vielmehr auf Individuen und deren Gesundheit, auch wenn diese Individuen für gewisse Zeit Patienten sein können. Letztlich geht es darum, die Patientenschulung und -beratung zu einer umfassenden Gesundheitsberatung weiterzuentwickeln. Ein Problem chronisch Kranker sieht Petermann (1997) in deren mangelhaftem Krankheits- und Behandlungswissen, so dass medizinisch sinnvolle Maßnahmen nicht akzeptiert und umgesetzt werden (vgl. dazu auch Schmidt & Dlugosch, 1997). Für die fehlende Compliance sind maßgeblich fünf Aspekte verantwortlich: Eine komplizierte und missverständliche Beziehung zwischen Arzt und Patient. Eine im Umfang und Ausmaß komplexe Verordnung nebst unklarer Nebenwirkungen. Eine negative Auswirkung durch häufigen Arztwechsel oder Wechsel von Behandlungszentren. Unzureichende Behandlungseinsicht seitens des Patienten und Missverstehen von Verordnungen. Negative psychosoziale Folgen der Erkrankung wie Verlust von Bezugspersonen und Fähigkeiten.(S. 7). Die Behandlung chronisch Kranker verlangt nach einer umfassenden Schulung und Beratung, die die subjektiven Gesundheits- bzw. 61 Krankheitskonzepte des Patienten zum Inhalt hat, damit medizinisch notwendige Behandlungen akzeptiert werden. Die Vermittlung von Wissensinhalten, Sensibilisierung der Körperwahrnehmung und Selbstkontrolle im Rahmen des Krankheitsmanagements sind darauf ausgerichtet, das Krankheitskonzept zu verändern. Jeder Patient kann anhand von Behandlungserfolgen die positive Auswirkung auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität erkennen, so dass auf diese Weise eine Verbesserung der Compliance zu erreichen ist. Ein weiteres Ziel von Patientenschulungen ist, chronisch Kranken „konkrete Hilfen zur Bewältigung von Alltagsbelastungen anzubieten“ (Petermann, 1997, S.12). Chronisch Kranke müssen angemessene Gegenmaßnahmen kennenlernen und neue Fertigkeiten entwickeln, um den Alltag erfolgreich bewältigen zu können. Fünf Fertigkeiten sind Petermann (1997) zufolge zentral: Präventive Medikationsfertigkeiten (z.B. Medikamentenplan, regelmäßige Einnahme) Fertigkeiten zur Auslösevermeidung (z.B. bei Unter- oder Überzuckerung) Fertigkeiten in Notfällen (z.B. bei Schock, Schmerzen) Kommunikationsfertigkeiten (z.B. genaue Beschreibung von Beschwerden gegenüber dem Arzt, Angehörige oder Kollegen aufklären, Vorurteilen begegnen) Gesundheitsfördernde Fertigkeiten (z.B. Sport treiben, Urlaubsorte entsprechend den individuellen Bedürfnissen auswählen, evtl. Beruf wechseln) (S. 12). Die Ziele der Eigenverantwortungsförderung und Lebensqualitätsverbesserung von chronisch Kranken fordern unter dem Aspekt der Patientenperspektive die Berücksichtigung subjektiver Einflussfaktoren, die nachfolgend thematisiert werden. 62 4.2.2 Einflussfaktoren auf Patientenberatung und Patientenschulung Die Unterstützung zur Entwicklung von Persönlichkeit, sozialer Kompetenzen und lebenspraktischer Verantwortlichkeiten durch Information will den Menschen dazu befähigen, mehr Einfluss auf ihre Gesundheit und ihre Lebenswelt auszuüben. Es geht dabei um die Befähigung zu „lebenslangem Lernen“ (Waller, 1996, S. 185), um mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen umgehen zu können. „Ein zentrales Ziel der Patientenberatung ist es, neue Verhaltensweisen aufzubauen und [...] bestehende zu modifizieren oder zu beenden“ (Schmidt & Dlugosch, 1997, S. 32). Patientenberatung und -schulung sind daher von vielen Einflussfaktoren abhängig, die sich nicht nur im Interaktionsprozess zwischen Experten und Patienten bemerkbar machen. Die Kommunikation und die Arzt-PatientBeziehung sind allein durch das medizinische Setting mit meist viel zu kurzen Interaktionszeiten deutlich beeinträchtigt. Doch abgesehen von den Rahmenbedingungen, bilden Patientenressourcen wie z.B. Selbstvertrauen, Selbstaufmerksamkeit und internale Kontrollüberzeugungen (Schmidt & Dlugosch, 1997; Waller, 1996), sowie die Methoden der Interventionsmaßnahmen eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Gesundheitsberatung. Die subjektive Überzeugung, wichtige Ereignisse im Leben selbst beeinflussen zu können (internale Kontrollüberzeugung), Kohärenzsinn (Punkt 2.1.2.2) und soziale Integration (Punkt 3.2) bilden die Basis für eine individuelle Einschätzung gesundheitsbezogener Lebensqualität (Sohn, 1997). Neben sozialdemografischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht und sozialer Status sind kognitive, motivationale und affektive Komponenten grundlegend, die zwischen gelungener und misslungener Bedürfnisbefriedigung und der „wahrgenommenen Diskrepanz zwischen Ziel- und Wunschvorstellungen“ (Dirhold & Thomas, 1996, S.77) bewerten. Schmidt und Dlugosch (1997) gehen davon aus, dass sich Motivationen und gesundheitsbezogene Verhaltensweisen über die Lebensspanne deutlich verändern und damit das Ziel der Beratung beeinflusst. Als Beratungsstrategie ist davon auszugehen, dass der Patient ein mündiger Bürger ist, um in einer flexiblen Beratung eine aufgeklärte Übereinstimmung herstellen zu können. Eine mögliche Non-Compliance sollte erfasst und akzeptiert werden. Gemeinsam getroffene Entscheidungen müssen der 63 Persönlichkeitsstruktur, dem aktuellen Befinden und der Funktionstüchtigkeit des Patienten Rechnung tragen (Schmidt & Dlugosch, 1997). Dieser patientenorientierte Ansatz von Beratung und Schulung setzt an den Bedürfnissen und Zielen der Patienten an, was dazu führen soll, chronisch Kranken mehr Verantwortung beim Krankheitsmanagement zu übertragen. Zur Verdeutlichung zwischen traditionellem Vorgehen und patientenorientiertem Ansatz erfolgt eine Gegenüberstellung in Tabelle 7: Tabelle 7 Gegenüberstellung von experten- und patientenorientiertem Vorgehen: Expertenorientiertes Vorgehen Patientenorientiertes Vorgehen Medizinische Diagnostik Medizinische Diagnostik (mit ausführlicher Anamnese und Erfassung der Lebensqualität) Verbesserung des Verbesserung des Gesundheitszustandes aufgrund der Gesundheitszustandes aufgrund der medizinischen Befundlage medizinischen Befundlage, der Lebenssituation/Bedürfnisse des Patienten 64 Lebensqualitätsverbesserung als Lebensqualitätsverbesserung als ein Nebenkriterium zentrales Kriterium Aufklärung und Expertenhilfe Aufklärung, persönliche Beratung und Expertenhilfe Kontrolle der ärztlichen Verordnungen Besprechung der Patientenprotokolle Anforderung an den Patienten: Anforderung an den Patienten: Konsequente Umsetzung der Ressourcenbezogene Umsetzung der ärztlichen Vorgaben ärztlichen Vorgaben Compliance: Aktive Compliance: Umfassende Patientenmitwirkung ohne explizite Patientenkooperation mit expliziten Entscheidungsmöglichkeiten Entscheidungsmöglichkeiten Tab.7 Mögliche Unterscheidungsmerkmale zwischen einem experten- und patientenorientierten Vorgehen im Gesundheitswesen (Petermann, 1997, S.18). Anhand der Gegenüberstellung von Experten- und Patientenorientiertem Vorgehen ist zu erkennen, dass der vorherrschende Praxisalltag im medizinischem System dem subjektiven Krankheitserleben zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Mit der in der Medizin Aufgekommenen Patientenorientierung im Sinne gesundheitsbezogener Lebensqualitätsverbesserung findet neben einer Abkehr von somatischen Betrachtungsweisen ein zunehmendes Verständnis für soziale und seelische Faktoren von Krankheit statt. Inwiefern Lebensqualitätsmessungen die individuelle Darstellung der subjektiven Gesundheit und Ansätze für pädagogische Interventionsmöglichkeiten aufzeigen, wird im folgenden Kapitel anhand eigener Untersuchungen betrachtet. 5 UNTERSUCHUNGEN ZU GESUNDHEITSBEZOGENER LEBENSQUALITÄT UND SUBJEKTIVER GESUNDHEIT Zur Frage der Messbarkeit der gesundheitsbezogenen Lebensqualität über den Selbstbericht der PatientInnen soll anhand dreier Beispiele mit je einer chronischen Krankheit - Diabetes, Rheuma und HIV - nachgegangen werden. Die Begriffe gesundheitsbezogene Lebensqualität und subjektive Gesundheit werden wie bei Bullinger (1996b; 1998), hier in der eigenen Untersuchung auch synonym verwandt. 65 Fragebogeninstrumente zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität gehören in der klinischen Evaluationsforschung und Epidemiologie inzwischen zum unverzichtbaren methodischen Rüstzeug. Die bekanntesten Instrumente weisen hohe bis sehr hohe testtheoretische Gütekriterien auf (Reliabilität, Validität und als zusätzliches wichtiges Gütekriterium Sensibilität für Veränderungen), sind international erprobt und unter sorgfältigen Äquivalenzprüfungen in verschiedene Sprachen übersetzt. (Zum Stand der internationalen Lebensqualitätsforschung siehe Bullinger 1996a). Neben den unter Punkt 1.5 aufgeführten methodischen Alternativen, erscheint das SF-36 Health Survey durch unkomplizierte und deutliche Fragen der am besten geeignete Test um die nun folgende eigene Untersuchung durchzuführen. 5.1 Methode und Durchführung Das SF-36-Health Survey ist ein krankheitsübergreifendes Messverfahren, das die gesundheitsbezogene Lebensqualität unterschiedlicher Personen unabhängig von ihrem Gesundheitszustand durch Selbstbericht misst. Die Begründung der Methodenauswahl ergibt sich aus dem Umstand, dass der SF36 im deutschsprachigen Raum der am meisten verwendete ist (Rose et al., 2000) und wegen der Einfachheit und Klarheit der Konzeption des Fragebogens. Die Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurde mit der einfachen Papier-Bleistift-Fragebogenform durch den SF-36 durchgeführt. Nach vorheriger Information über den Verwendungszweck und Instruktionen zu den Ausfüllmodalitäten gab es für die Teilnehmer/innen keine Beschränkung der Bearbeitungsdauer. Nach der Auswertung des Fragebogens fand ein erneuter Termin statt, zur Vorstellung der Testergebnisse und bei dem ein strukturiertes Interview erfolgte, in dem die elf einzelnen Fragen des Tests erneut angesprochen wurden. Zusätzlich zu den elf des Fragen wurde eine zwölfte Frage gestellt: Ob die Befragten ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität genauso einschätzen wie das Testresultat und ob ihnen zur Bestimmung ihrer subjektiven Gesundheit noch Fragestellungen fehlen. Die InterviewAufzeichnung wurde durch Notizen festgehalten, wobei die Transkription der 66 durch die Befragung erhaltenen Daten mit einem Höchstmaß an inhaltlich erzielbarer Genauigkeit erfolgte. Die inhaltliche Zustimmung der Teilnehmer nach der Transkription entstand durch kommunikative Validierung (Kvale, 1991; Ludwig-Mayerhofer, 1999). 5.1.1 Zielsetzung und Fragestellung Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag zur Darstellung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von chronisch kranken Menschen am Beispiel von Diabetes, Rheuma und HIV leisten. Diese Untersuchung ist nicht repräsentativ und erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und stellt auch die grundsätzliche Validität des Tests nicht in Frage. Sie soll exemplarisch zeigen, ob die Ergebnisse einer generischen Lebensqualitätsmessung sich mit der subjektiv empfundenen Gesundheit der Befragten deckt oder davon differiert. Dieser heuristischen Absicht - im Sinne eines Suchens und Findens (Kleining, 1995) liegt die Idee zugrunde, informative Unterschiede zu finden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, Ideen für die Optimierung der subjektiven Gesundheit chronisch Kranker zu sammeln. Im Rahmen dieser Untersuchung wird folgender Fragestellung nachgegangen: Bilden generische Lebensqualitätsmessungen die subjektive Gesundheit genügend ab? Hypothese: Personen mit einer chronischen Erkrankung (Diabetes, Rheuma, HIV) weichen in der Bewertung ihrer subjektiven Gesundheit von den Ergebnissen standardisierter Messinstrumente ab. 5.1.2 Teilnehmer/innen Folgende Kriterien müssen für die Teilnahme erfüllt sein: Art der chronischen Erkrankung (Diabetes, Rheuma, HIV) Alter über 14 Jahre deutsche Sprachkenntnisse 67 Insgesamt waren an der Untersuchung drei Teilnehmer/innen mit je einer chronischen Krankheit Diabetes, Rheuma und HIV einbezogen. Die Auswahl der Personen ergaben sich durch die beruflichen, familiären und freundschaftlichen Kontakte des Verfassers. 5.1.3 Auswertung Die Auswertung errechnet sich über Addition der angekreuzten Itembeantwortungen pro Skala zuzüglich deren Gewichtung. Die Formeln für die Zusammenfassung der Items und die Umwandlung in Skalenwerte sind im Handbuch für die deutschsprachige Fragebogenversion veröffentlicht (Bullinger & Kirchberger, 1998). Für die vorliegende Untersuchung erfolgte die Auswertung mittels eines im Internet zugänglichen Computerauswertungsprogramms von Swoboda & Weichmeier (1997) unter (www.med.uni-muenchen.de/mfv/sf36 .html), in englischer Sprache (Ware,1997) unter (www.qualitymetric.com/innohome/insf36.shtml) und beinhaltet neben der Tabelle der erreichten Punktzahl von einzelnen Items eine grafische Darstellung über die jeweiligen gesundheitsbezogenen Lebensqualitätsdimensionen sowie eine zusammenfassende Graphik der körperlichen und psychischen Summenskalen. 5.2 Interviews und kommunikative Validierung Zusätzlich zu dem schriftlich auszufüllenden SF-36 Fragebogen wurde mit den einzelnen Teilnehmern/innen ein strukturiertes Interview geführt, das die gleichen Fragen des Tests beinhaltet. Hier liegt die Überlegung zugrunde, dass die Wiederholung der Fragen bei mündlicher und schriftlicher Form zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Durch die Befragung ist es den Teilnehmern möglich, von der vorgefertigten Antwort abzuweichen, so dass durch die mündliche Antwort Zusatzinformationen im Hinblick auf die Bewertung und pädagogische Interventionsmöglichkeiten zu erwarten sind. 68 Die zusätzliche und letzte Frage erkundigt sich nach der subjektiven Einschätzung in Bezug auf die Richtigkeit des Testergebnisses und nach der subjektiven Vollständigkeit lebensqualitätsbezogener Dimensionen. Damit erfolgt eine kommunikative Validierung, in der die Teilnehmer/innen die Ergebnisse zur Diskussion gestellt werden (Ludwig-Mayerhofer, 1999). Bei den nachfolgenden Fallbeispielen werden die Dimensionen in den Tabellen- und Diagrammangaben wie folgt abgekürzt: KÖFU > körperliche Funktionsfähigkeit, KÖRO > körperliche Rollenfunktion, SCHM > körperliche Schmerzen, AGES > allgemeine Gesundheit, VITA > Vitalität, SOFU > soziale Funktionsfähigkeit, EMRO > emotionale Rollenfunktion, PSYC > psychisches Wohlbefinden, PSW > psychischer Summenwert KSW > körperlicher Summenwert Die Tabellen weisen mit der erreichten Punktzahl die normierten Werte der einzelnen Dimensionen aus. Die dazugehörigen Konfidenzintervalle bezeichnen einen Wertebereich innerhalb derer sich die Wahrscheinlichkeit der errechneten Daten bewegt. Sie gibt damit die Präzision der Schätzung an (LudwigMayerhofer, 1999). Beispiel: Bei einer errechneten Punktzahl von 57.03 für körperliche Funktionsfähigkeit, liegt die Wahrscheinlichkeit der Sicherheit für diesen Wert bei plus/minus 5.02. Der Wert wird als vertikaler Strich im oberen Bereich der Dimensionenwerte grafisch dargestellt. In den Diagrammangaben werden Mittelwert und Standardabweichung wie folgt abgekürzt: MW > Mittelwert: kennzeichnet die Summe der Einzelwerte (Ludwig-Mayhofer, 1999). SA > Standardabweichung: dient dazu verschiedene normierte 69 Messwerte vergleichbar zu machen und zeigt an, ob ein errechneter Mittelwert typisch ist. Standardisierte Werte haben einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1 (Ludwig-Mayhofer, 1999). 5.2.1 Fallbeispiel: Diabetes mellitus Zur Person: Herr A. ist Mitte 40, im Polizeidienst voll berufstätig, sehr sportlich und gesundheitsbewusst. Vor 7 Monaten ist im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung Diabetes mellitus diagnostiziert worden. Seither bemüht sich Herr A. intensiv, seine Krankheit und die Auswirkungen auf den Körper zu verstehen, und „in den Griff zu bekommen“ (Hr. A., persönl. Mitteilung, 16.09.01). Neben seiner Familie wissen nur wenige ausgesuchte Freunde, Bekannte und Kollegen von seiner Krankheit, da er berufliche Nachteile befürchtet. Die Auswertung des SF-36 zeigt Tabelle 8: KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC PSW KSW Punktzahl 57.03 56.85 62.12 35.3 52.09 45.94 55.88 41.56 56.39 44.44 Konfidenz- 5.02 7.74 4.48 7.74 8.24 6.92 5.3 7.74 4.48 intervall Tab.8 Dimensionenwerte, Konfidenzintervalle; psychische und körperliche Summenwerte für Diabetes mellitus. 5.3 70 Dimensionenwerte Diabetes 80 +3SA 70 +2SA 60 +1SA 50 MW 40 -1SA 30 -2SA 20 -3SA 10 0 KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC Diagramm 1 Grafische Darstellung der Dimensionenwerte für Diabetes Mellitus. Summenwerte Diabetes 80 +3SA 70 +2SA 60 +1SA 50 MW 40 -1SA 30 -2SA 20 -1SA 10 0 PSW KSW Diagramm 2 Grafische Darstellung der psychischen und körperlichen Summenwerte für Diabetes mellitus. 71 Interview mit Herrn A. am 16.09.01 Zu 1. Wie würden Sie ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? Ausgezeichnet, sehr gut, gut, weniger gut, schlecht. Schlicht und ergreifend „weniger gut“. Ganz subjektiv kann ich nicht einfach sagen, dass ich gesund bin oder mich gesund fühle, ich habe nun mal Diabetes! Aber durch den Diabetes lebe ich jetzt für meinen Körper gesünder. Zu 2. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie würden Sie ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben? Viel besser als vor einem Jahr, besser als vor einem Jahr, gleich wie vor einem Jahr, schlechter als vor einem Jahr, viel schlechter als vor einem Jahr. Im Vergleich zum vergangenen Jahr geht es mir sehr viel schlechter, weil ich vor einem Jahr noch nichts von meinem Diabetes wusste oder hatte. Zu 3. Sind Sie durch ihren jetzigen Gesundheitszustand bei folgenden Tätigkeiten eingeschränkt? a. Anstrengende Tätigkeiten, b. Mittelschwere Tätigkeiten, c. Einkauftaschen heben oder tragen, d. mehrere Stockwerke steigen, e. ein Stockwerk steigen, f. sich beugen, knien, bücken, g. mehr als einen Kilometer zu Fuß gehen, h. mehrere Straßenkreuzungen gehen, i. eine Straßenkreuzung gehen, j. sich baden oder anziehen. Nein, ich bin in keiner der aufgeführten Tätigkeiten in irgend einer Weise eingeschränkt, selbst die „anstrengenden Tätigkeiten“, unter a) aufgeführt, machen mir keine Schwierigkeiten. Ich halte mich mit 7-Kilometer-Läufen körperlich fit, so dass mir „schnell laufen, schwere Gegenstände heben und anstrengender Sport“ nichts ausmachen. Aber: Wettkämpfe kann ich nicht mehr bestreiten, weil ich nicht abschätzen kann, wie es mit meinem Zucker bei langer, fremdgesteuerter Anstrengung aussieht. Zu 4. Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen 72 Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. Zuhause? A. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein, b. ich habe weniger geschafft als ich wollte, c. ich konnte nur bestimmte Dinge tun, d. ich hatte Schwierigkeiten bei der Arbeit oder bei der Durchführung anderer Tätigkeiten. Objektiv gesehen habe ich keine Schwierigkeiten oder Belastungen im Beruf und alltäglichen Tätigkeiten, aber ich muss viel bewusster planen und handeln. Ich kann nicht mehr so spontan sein in meinem Alltag. Mein Bewusstsein hat sich gewandelt. Als Beispiel fällt mir ein, dass ich neulich, bevor ich in den Keller ging, um an etwas zu arbeiten, 2 ZwischenBroteinheiten für die kommende Arbeit gegessen hatte. Plötzlich steht meine Frau in der Haustür, sie ist früher als geplant nach Hause gekommen. Sie schlug vor, erst mal einen Kaffee zu trinken, aber ich konnte nicht, ich hatte ja gerade erst 2 Broteinheiten zu mir genommen! Um meine Werte nicht durcheinander zu bringen, haben wir also zu diesem Zeitpunkt keinen Kaffee gemeinsam getrunken, sondern wie normalerweise erst später. Und da liegt das Problem: die Spontaneität ist hin, ich bilde feste Rituale von Essen und Injektionen, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Zu 5. Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten (z.B., weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)? A. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein, b. ich habe weniger geschafft als ich wollte, c. ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten. Nein, nicht in den letzten 4 Wochen, aber ich denke dauernd an meine Krankheit, der Diabetes-Film läuft dauernd im Hintergrund mit. Ängstlich und niedergeschlagen war ich vor 7 Monaten, als ich die Diagnose bekam. Zu 6. Wie sehr haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre normalen Kontakte zu Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn oder zum Bekanntenkreis beeinträchtigt? Überhaupt nicht, etwas, mäßig, ziemlich, sehr. 73 Überhaupt nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass das Verhältnis zu einigen ein anderes geworden ist, ich meine eine gewisse Distanziertheit zu spüren, vermutlich weil sie damit nicht umgehen können. Jedenfalls wird teilweise nicht über mein Diabetes gesprochen. Zu 7. Wie stark waren Ihre Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen? Ich hatte keine Schmerzen, sehr leicht, leicht, mäßig, stark, sehr stark. Schmerzen hatte ich keine. Zu 8. Inwieweit haben Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen beider Ausübung ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert? Überhaupt nicht, etwas, mäßig, ziemlich, sehr. Da ich keine Schmerzen hatte: überhaupt nicht. Zu 9. In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen ... a. voller Schwung, b. sehr nervös, c. so niedergeschlagen, dass sie nichts aufheitern konnte, d. ruhig und gelassen, e. voller Erfolg, f. entmutigt und traurig, g. erschöpft, h. glücklich, i. müde? „Voller Schwung“ kann ich nicht mehr sein, mein Diabetes lässt sich nicht abschütteln. Nervös bin ich nie und niedergeschlagen manchmal, wenn meine Blutzucker-Werte nicht meinem Gefühl, Vorstellungen und Erwartungen entsprechen. Meist bin ich aber gelassen durch die Routine und wenn die Werte „gut“ sind und ich mich nicht verschätzt habe. Entmutigt bin ich zum Beispiel, wenn ein Wert oder mehrere nicht meiner Erwartung entspricht und ich mir überhaupt nicht erklären kann, wie er zustande kommen konnte. Wenn ich soundso viel esse, muss ich soundso viel spritzen und bekomme erfahrungsgemäß soundso einen Wert. Wenn das nicht “hinhaut“, obwohl ich alles richtig gemacht habe, bin ich ratlos und entmutigt. Ich verstehe es einfach nicht! Erschöpft bin ich manchmal, aber das hat nichts mit dem Diabetes zu tun, genauso wie die Müdigkeit. Und 74 Glücklichsein ist für mich ein Hochgefühl, und in Bezug auf den Diabetes gibt es das für mich nicht. Zu 10. Wie häufig haben ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in den vergangenen 4 Wochen ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt? Immer, meistens, manchmal, selten, nie. Wenn wir eine Einladung zum Essen bekommen von jemandem, der nicht weiß dass ich Diabetes habe, dann werde ich unsicher und verliere das Interesse. Ich weiß dann nicht, wie viel ich wovon essen kann, weil ich nicht weiß, was drin ist oder wie es zubereitet ist. Ich müsste dann später auf die Toilette und messen... . Das macht mir Stress und keine Freude. Also versuche ich, Situationen, die ich nicht einschätzen, kann zu vermeiden. Zu 11. Inwieweit trifft jede der folgenden Aussagen auf Sie zu? A. Ich scheine etwas leichter als andere krank zu werden, b. ich bin genauso gesund wie alle anderen die ich kenne, c. ich erwarte, dass sich meine Gesundheit verschlechtert, d. ich erfreue mich ausgezeichneter Gesundheit. Ich habe nicht den Eindruck, leichter als andere krank zu werden und bin deshalb auch genauso gesund wie alle anderen. Allerdings erwarte ich, dass sich meine Gesundheit verschlechtert, denn selbst wenn ich den „Anfängen wehre“, indem ich sehr genau auf meine Werte achte, so weiß ich doch um die Wahrscheinlichkeit der Verschlechterung und die Spätfolgen, die der Diabetes nach sich ziehen kann. Punkt d) „ich erfreue mich ausgezeichneter Gesundheit“ trifft auf mich überhaupt nicht zu: ich habe Diabetes, das kann nicht gesund sein! Der vorliegende Bogen ist ein Instrument zur Messung der krankheitsübergreifenden gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Gibt es Fragen, die Ihnen fehlen, und würden Sie Ihre Lebensqualität genauso beurteilen, wie es das Ergebnis des Tests es tut? 75 Erstmal bin ich enttäuscht über die geringe Anzahl von Fragen, ich hätte das fünffache an Fragen erwartet. Aber mir fällt jetzt auch nichts ein, was mir fehlen würde, was alles noch hätte gefragt werden sollen. Was mir fehlt, ist eine differenziertere Fragestellung, so dass man genauer antworten könnte. Außerdem schränkt mich die zeitliche Begrenzung auf 4 Wochen in der Beantwortung der Fragen ein. Aber das ist in meinem Wunsch nach einer größeren Differenzierung enthalten. Das Ergebnis des Tests überrascht mich nicht, ich weiß ja, dass ich körperlich fit bin, weil ich ja auch gesundheitsbewusst lebe. Psychisches Wohlbefinden, soziale Funktion und allgemeine Gesundheitswahrnehmung sind die Bereiche, die bei mir unter dem Durchschnitt liegen. Und das zeigt ja nur, dass mir die Krankheit mental zu schaffen macht wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie nicht“ im Griff“ habe. Meine allgemeine Gesundheitswahrnehmung hat deshalb den niedrigsten Wert, weil ich ja weiß, dass ich nicht gesund bin, auch wenn es mir allgemein gut geht. Die soziale Komponente der Lebensqualität ist mir persönlich nicht so wichtig, ich habe genug mit mir selbst zu tun. Ich ärgere mich über einige Leute in der Selbsthilfegruppe, die auf meine Fragen so tun, dass das alles nicht so wichtig ist, weil sie es selber schon hinter sich haben. Was mir fehlt, ist, dass wir gar nicht über Lebensqualität gesprochen haben. Fragen wie: wie beurteilen Sie ihre Lebensqualität, oder wie hat die Krankheit Ihre Lebensqualität beeinflusst? Meine Lebensqualität ist gesunken, weil mir bewusst ist, dass ich Diabetes habe. 5.2.2 Fallbeispiel: Rheumatische Erkrankung Zur Person: Frau B. ist 70 Jahre alt, lebte bis Mai 2001 allein zu Hause und wurde von ihrer Tochter sowie durch eine ambulante Versorgung 3x täglich betreut. Nach einer erfolgreichen Operation im Halswirbel-Bereich verbringt sie im Rahmen einer Krankenhausliegezeitverkürzung ihre Rekonvaleszenz in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. Frau B. leidet seit mehr als 10 Jahren an einer rheumathoiden Polyarthritis und in der Folge an einer Knochendegeneration 76 beider Hände und Finger sowie einer Degeneration beider Knie. Hinzu kommen eine hochgradige Osteoporose und zunehmende ischiämische Schmerzen. Die Interviewteilnehmerin sitzt im Rollstuhl, kann nur mit speziell geformtem Besteck und anderen Hilfsmitteln kleingeschnittene Nahrung aufnehmen, vermag nicht aus eigener Kraft zu stehen, so dass Kleidungswechsel, Grundpflege, Toilettengänge nur mit zwei Pflegepersonen möglich sind, um bei der bestehenden Osteoporose Knochenbrüche und dem Rheuma Bewegungschmerzen zu vermeiden. Die Beweglichkeit von Frau A. ist soweit eingeschränkt, dass sie für das Aufsetzen auf die Bettkante, das Drehen im Bett, den Transfer in bzw. aus dem Rollstuhl, das Aufsuchen der Toilette oder der Körperpflege Hilfe benötigt. Frau B. ist in Bezug auf Zeit, Ort und Person voll orientiert, die Kommunikation ist ungestört, sie ist kontaktfreudig und ihre Hobbys sind Lesen und Fernsehen. Die Auswertung des SF-36 zeigt Tabelle 9: KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC PSW KSW Punktzahl 14.94 17.67 24.93 35.3 36.48 24.13 9.23 27.48 24.76 25.95 Konfidenz- 5.02 7.74 7.74 4.48 7.74 8.24 6.92 5.3 4.48 intervall Tab.9 Dimensionenwerte, Konfidenzintervalle; psychische und körperliche Summenwerte für rheumatische Erkrankung. Dimensionenwerte Rheuma 80 +3SA 70 +2SA 60 +1SA 50 MW 40 -1SA 30 -2SA 20 -1SA 10 0 KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC 5.3 77 Diagramm 3 Grafische Darstellung der Dimensionenwerte für rheumatische Erkrankung Summenwerte Rheuma 80 +3SA 70 +2SA 60 +1SA 50 MW 40 -1SA 30 -2SA 20 -3SA 10 0 PSW KSW Diagramm 4 Grafische Darstellung der psychischen und körperlichen Summenwerte für rheumatische Erkrankung. Interview mit Frau B. am 17.12.01 Zu 1. Wie würden Sie ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? Ausgezeichnet, sehr gut, gut, weniger gut, schlecht. Wissen Sie, ich habe hier die Antwort „weniger gut“ angekreuzt, weil ich ja trotz KG [Krankengymnastik] immer noch nicht Stehen kann. Seit der HWSOP [Halswirbeloperation] ist alles schlimmer geworden, da habe ich wochenlang nur im Bett gelegen, konnte nicht einmal aufstehen, wissen Sie. Hier geht es mir schon viel besser, ich sitze draußen bei den Anderen, im Speisesaal, bei gutem Wetter fährt mich meine Tochter spazieren bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir beim Umsetzen vom Bett in den Rollstuhl eine Rippe brach. Sie wissen ja, ich habe Osteoporose. Da ging es mir dann wieder schlechter, ich habe ja immer Schmerzen, mal mehr, mal weniger, aber da konnte ich nur auf einer Seite liegen, bis mir die ganze Seite wehtat, es war zum Verrücktwerden. Aber jetzt geht es mir wieder besser, deshalb 78 habe ich „weniger gut“ angekreuzt und nicht „schlecht“. Ich finde, es geht mir sogar ganz gut, wenn nicht immer diese Schmerzen wären. Zu 2. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie würden sie ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben? Viel besser als vor einem Jahr, besser als vor einem Jahr, gleich wie vor einem Jahr, schlechter als vor einem Jahr, viel schlechter als vor einem Jahr. Da geht es mir eindeutig schlechter als vor einem Jahr. Bevor ich ins Krankenhaus kam und nun hier in stationärer Pflege bin, wohnte ich Zuhause. Meine Wohnung ist nach meinen Bedürfnissen umgebaut worden, Sie wissen schon, Rampen für den Rollstuhl, Handläufe in Schlafzimmer, Bad und Küche, das Essen bekam ich geliefert, und dreimal am Tag kam mein “Zivi“ um mir beim Ausziehen, Einkaufen usw. zu helfen. Meine Tochter kam auch vorbei, um nach mir zu sehen. Aber da konnte ich noch stehen, wissen Sie? Seit dem ewigen „Herumgeliege“ im Krankenhaus habe ich keine Kraft mehr in den Beinen. Zu 3. Sind Sie durch ihren jetzigen Gesundheitszustand bei folgenden Tätigkeiten eingeschränkt? a. Anstrengende Tätigkeiten, b. mittelschwere Tätigkeiten, c. Einkaufstaschen heben oder tragen, d. mehrere Stockwerke steigen, e. ein Stockwerk steigen, f. sich beugen, knien, bücken, g. mehr als einen Kilometer zu Fuß gehen, h. mehrere Straßenkreuzungen weit zu Fuß gehen, i. eine Straßenkreuzung weit zu Fuß gehen, j. sich baden oder anziehen. Alle Tätigkeiten, die da erwähnt sind, kann ich nicht ausführen. Aber ich habe meinen Alltag ganz gut organisiert. Seit mein Mann tot ist, helfen mir meine Tochter und ihr Mann. Der „Zivi“ kommt ja auch drei mal täglich, und damit habe ich alle Hilfe, die ich brauche. Zu 4. Hatten Sie in den vergangenen vier Wochen aufgrund ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. Zuhause? A. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein, b. ich habe weniger geschafft als ich wollte, c. ich 79 konnte nur bestimmte Dinge tun, d. ich hatte Schwierigkeiten bei der Arbeit oder bei der Durchführung anderer Tätigkeiten. Wissen Sie, in meinem Alter muss ich nicht mehr arbeiten. Im Alltag sieht das anders aus: meine körperliche Gesundheit schwankt täglich. Ich merke es immer erst in dem Moment, in dem ich etwas tun will, aber merke, dass ich es nicht so schaffe, wie ich es mir vorgenommen hatte oder gestern noch geschafft hatte. An manchen Tagen kann ich eben mehr, weil ich weniger Schmerzen habe. Und sei es einfach nur, dass ich nachts gut geschlafen habe, dann kann ich am nächsten Tag viel besser mithelfen. Zu 5. Hatten sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)? a. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein, b. ich habe weniger geschafft als ich wollte, c. ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten. Auch hier ist es das gleiche, auch meine Niedergeschlagenheit oder Freude schwankt täglich. Natürlich war ich in den letzten 4 Wochen niedergeschlagen. Ich kann immer noch nicht stehen, und das nun seit 3 Monaten. Trotz Krankengymnastik sacken mir meine Beine weg, und meine Knie schmerzen. Manchmal habe ich große Angst, dass ich nie mehr nach Hause komme. Mein Schwiegersohn hat schon gefragt, ob ich etwas dagegen hätte, wenn er sich schon mal ein paar Heime anschaut. Das hat mich schrecklich demoralisiert. Aber ich habe mir gedacht, lass ihn mal gucken, ins Heim gehe ich sowieso nicht. Wenn ich doch bald wieder stehen könnte, dann wäre ich auch diesen schrecklichen Dauerkatheter los. Aber der Arzt sagt, er wäre nur zu meinem Besten, denn je häufiger ich vom Rollstuhl auf die Toilette gesetzt würde, umso schmerzhafter wäre es für mich, außerdem würde damit das Risiko von Knochenbrüchen geringer. Aber wissen Sie, nur um das Ding loszuwerden, würde ich dieses Risiko eingehen. Na ja, es wird schon wieder werden. Zu 6. Wie sehr haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in 80 den vergangenen 4 Wochen Ihre normalen Kontakte zu Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn oder zum Bekanntenkreis beeinträchtigt? Überhaupt nicht, etwas, mäßig, ziemlich, sehr. Also, meine Tochter kommt mich regelmäßig besuchen, aber das hat sie Zuhause auch getan. Meine Freundin ist auch schon hierher gekommen und hat mich besucht, außerdem telefonieren wir miteinander, so wie vorher auch. Allerdings bin ich die letzten Monate nicht einmal bei ihr gewesen. Wissen Sie, sie hat einen wunderschönen Garten. Aber dadurch, dass ich nicht mehr stehen kann, kann ich mich auch in kein Auto mehr setzen, ich bräuchte so einen Behindertentransport, wo man mich samt Rollstuhl auf die Ladefläche schiebt, das will ich nicht. Meine Nachbarn Zuhause sehe ich gar nicht mehr. Die habe ich meist nur getroffen, wenn ich mit meinem „Zivi“ spazieren gefahren bin. Dafür habe ich hier mit einer Dame Bekanntschaft geschlossen, wir sitzen im Essraum zusammen an einem Tisch, und auch im Garten sitzen wir meistens zusammen und unterhalten uns. Ihre Familie ist furchtbar nett, und meine Tochter mag sie auch. Zu 7. Wie stark waren Ihre Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen? Ich hatte keine Schmerzen, sehr leicht, leicht, mäßig, stark, sehr stark. Die Schmerzen werden immer schlimmer, habe ich den Eindruck. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, ich weiß gar nicht, wie ich liegen soll, mein Ischias bringt mich noch um. Ich muss dann klingeln und die Nachtwache bitten, mich auf der anderen Seite oder auf dem Rücken zu lagern. Oft mehrmals in der Nacht. Manchmal aber überhaupt nicht. In den letzten 4 Wochen ist es aber schlimmer geworden, ich muss mal mit dem Arzt sprechen, was man da machen kann. Zu 8. Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert? Überhaupt nicht, etwas, mäßig, ziemlich, sehr. 81 Weder im Beruf noch Zuhause. Aber manchmal sind die Schmerzen so stark, dass ich mich im Rollstuhl vornüber beugen muss, um meinen Rücken zu entlasten, oder ich muss die Schwestern bitten, mich zwischendurch aufs Bett zu legen, weil ich vor Schmerz einfach nicht mehr sitzen kann. Sitzen Sie mal stundenlang im Rollstuhl! Zu 9. In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen Wochen ... a. voller Schwung, b. sehr nervös, c. so niedergeschlagen, dass nichts Sie aufheitern konnte, d. ruhig und gelassen, e. voller Erfolg, f. entmutigt und traurig, g. erschöpft, h. glücklich, i. müde? Am besten gehe ich die Fragen einzeln durch: „voller Schwung“ bin ich in letzter Zeit gewesen, wenn die Übungen mit der Krankengymnastin einen Fortschritt gemacht haben, das heißt, wenn die Schmerzen mir Bewegungen erlauben, die ich sonst ohne Schmerzen nicht machen konnte, die Knie durchdrücken zum Beispiel oder Fahrradfahren auf diesem Heimtrainer. Dann fühle ich, dass es bergauf geht, dann fühle ich mich gut. Allerdings ist das Gefühl sehr tagesabhängig, je nach Schmerzen oder Rheuma-Schub. Nervös bin ich häufig, weil ich mir Gedanken mache, wie es weitergehen soll. Dann bin ich auch sehr niedergeschlagen. Dann mache ich mir Sorgen, dass ich vielleicht ins Heim muss und das wenige, das ich bisher alleine entscheiden konnte, auch noch verloren geht. Andererseits denke ich, es kommt, wie es kommen muss, da werde ich auch mit fertig, bin ich bisher ja auch! So ist es auch mit dem Erfolg: schaffe ich mehr als erwartet, bin ich ganz zuversichtlich, schaffe ich weniger, dann bin ich traurig. Müde und erschöpft bin ich nach langem Sitzen im Rollstuhl, nach der Krankengymnastik oder wenn ich Schmerzen habe, die ich nicht aushalten kann. Glücklich bin ich, wenn meine Tochter zu Besuch kommt oder eine Freundin und wir draußen spazieren fahren. Aber auch wenn ich mit der Dame hier aus dem Haus und deren Familie in größerer Runde beisammensitze, dann ist die Stimmung meist fröhlich und ausgelassen. Zu 10. Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme 82 in den vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt? Immer, meistens, manchmal, selten, nie. Na ja, Besuche konnte ich seit meinem Krankenhausaufenthalt und eigentlich auch vorher nicht mehr machen. Wie gesagt, seit ich nicht mehr stehen kann, kann ich in kein Auto mehr einsteigen. Die letzten Jahre war es sowieso so, dass meine Verwandten und Freunde mich besuchen kamen. So ist es hier auch, nur dass sie eben hierher kommen. Zu 11. Inwieweit trifft jede der folgenden Aussagen auf Sie zu? a. Ich scheine etwas leichter als andere krank zu werden, b. ich bin genauso gesund wie alle anderen, die ich kenne, c. ich erwarte, dass sich meine Gesundheit verschlechtert, d. ich erfreue mich ausgezeichneter Gesundheit. Dass ich leichter als andere krank werde, ist Unsinn. Einigen Bekannten geht es gesundheitlich besser, anderen schlechter, andere sind schon tot, und ich habe eben Rheuma. Und dass ich genauso gesund bin wie alle anderen, die ich kenne, kann ich auch nicht behaupten, die haben eben andere Krankheiten. Also mein Mann hatte Lungenkrebs, der Mann einer Freundin einen Schlaganfall , also tauschen möchte ich mit dem nicht, ich bin wenigstens geistig völlig gesund. Allerdings erwarte ich, dass sich mein Gesundheitszustand verschlechtert. Der Verlauf der letzten Jahre zeigt es deutlich; ich saß ja nicht immer im Rollstuhl, und die Schmerzen sind auch schlimmer geworden. Ich will darüber aber gar nicht nachdenken, ich will erst mal wieder stehen können und wieder nach Hause kommen. Wird schon werden. Der vorliegende Bogen ist ein Instrument zur Erfassung der krankheitsübergreifenden gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Gibt es Fragen, die Ihnen fehlen, und würden Sie ihre Lebensqualität genauso einschätzen, wie es das Ergebnis des Tests es tut? Ehrlich gesagt, bin ich über das Ergebnis ziemlich erschrocken. Ich weiß ja, dass ich für so ziemlich alles fremde Hilfe brauche, aber es ist schon bitter, 83 wenn man mit eigenen Augen schwarz auf weiß sieht, dass man nichts mehr kann. Ich liege insgesamt ja im unteren Drittel, einiges ist unter der Nachweisgrenze. Dabei finde ich gar nicht, dass meine Lebensqualität so schlecht ist. Sicher geht es mir schlecht, das weiß ich ja auch, aber sooo schlecht? 5.2.3 Fallbeispiel: HIV Zur Person: Herr C. ist 38 Jahre alt, voll berufstätig im Öffentlichen Dienst und hat im Rahmen einer neuen homosexuellen Partnerschaft vor 4 ½ Jahren einen HIVTest machen lassen, mit positivem Ergebnis. Sein Partner ist HIV-negativ. Die Auswertung des SF-36 zeigt Tabelle 10: KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC PSW KSW Punktzahl 54.93 56.85 62.12 50.55 52.09 56.85 55.88 55.64 56.12 54.46 Konfidenz- 5.02 4.48 7.74 8.24 7.74 6.92 5.3 7.74 4.48 5.3 intervall Tab.10 Dimensionenwerte, Konfidenzintervalle; psychische und körperliche Summenwerte für HIV. 84 Dimensionenwerte HIV 80 +3SA 70 +2SA 60 +1SA 50 MW 40 -1SA 30 -2SA 20 -3SA 10 0 KÖFU KÖRO SCHM AGES VITA SOFU EMRO PSYC Diagramm 5 Grafische Darstellung der Dimensionenwerte für HIV. Summenwerte HIV 80 +3SA 70 +2SA 60 +1SA 50 MW 40 -1SA 30 -2SA 20 -1SA 10 0 PSW KSW Diagramm 6 Grafische Darstellung der psychischen und körperlichen Summenwerte für HIV. Interview mit Herrn C. am17.10.01 85 Zu 1. Wie würden Sie ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? Ausgezeichnet, sehr gut, gut, weniger gut, schlecht. Trotz HIV „sehr gut“, ich fühle mich körperlich nicht beeinträchtigt. Ich treibe keinen Sport, nehme meine Medikamente, verspüre keine Nebenwirkungen und fühle mich deshalb sehr gut. Zu 2. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie würden Sie ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben? Viel besser als vor einem Jahr, besser als vor einem Jahr, gleich wie vor einem Jahr, schlechter als vor einem Jahr, viel schlechter als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nichts verändert. Zwischenzeitlich, vor zwei Monaten, war meine Viruslast erhöht, aber durch eine Neukombination meiner Medikamente ist alles wieder ok. Zu 3. Sind sie durch ihren jetzigen Gesundheitszustand bei folgenden Tätigkeiten eingeschränkt? a. Anstrengende Tätigkeiten, b. mittelschwere Tätigkeiten, c. Einkaufstaschen heben oder tragen, d. mehrere Stockwerke steigen, e. ein Stockwerk steigen, f. sich beugen, knien, bücken, g. mehr als einen Kilometer zu Fuß gehen, h. mehrere Straßenkreuzungen weit zu Fuß gehen, i. eine Straßenkreuzung weit zu Fuß gehen, j. sich baden oder anziehen. Bei sämtlichen Tätigkeiten, von „mittelschweren Tätigkeiten“ abwärts, bin ich überhaupt nicht eingeschränkt, ich bin ja kein Opa. Bei „anstrengenden Tätigkeiten“ ist es etwas anderes, da bin ich etwas eingeschränkt, weil ich das aber noch nie konnte. Anstrengende Tätigkeiten habe ich mein Leben lang versucht zu vermeiden. Zu 4. Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause? A. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein, b. ich habe weniger geschafft als ich wollte, c. ich konnte nur bestimmte Dinge tun, d. ich hatte Schwierigkeiten bei der Arbeit oder bei der Durchführung anderer Tätigkeiten. 86 Wie gesagt, ich fühle mich sehr gut. Also: nein. Zu 5. Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten (z.B. weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)? a. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein, b. ich habe weniger geschafft als ich wollte, c. ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten. Nein, aber immer alle 6 Wochen, vor und nach der großen Blutuntersuchung. Die Unsicherheit macht mich nervös. Vor zwei Monaten hatte ich eine erhöhte Viruslast, was mir große Sorge bereitet hat. Niedergeschlagen war ich wegen des fehlenden Vertrauens in meinen Körper. Blendend ging es mir dann bei ausgewechselter Kombinations-Therapie. Ich bin wohl ein psychosomatischer Typ, es geht mir schlagartig wieder gut, wenn ich mental weiß, dass die Virenanzahl sinkt. Offensichtlich arbeitet mein Verdrängungsmechanismus gut, aber der geht nicht so weit, dass ich die Tabletten zwei mal täglich vergesse. HIV ist immer präsent, aber nicht vordergründig im Alltag, es schränkt mich nicht ein. Zu 6. Wie sehr haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelische Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre normalen Kontakte zu Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn oder zum Bekanntenkreis beeinträchtigt? Überhaupt nicht, etwas, mäßig, ziemlich, sehr. Überhaupt nicht. Zu 7. Wie stark waren Ihre Schmerzen in den vergangenen 4 Wochen? Ich hatte keine Schmerzen, sehr leicht, leicht, mäßig, stark, sehr stark. Ich habe keine Schmerzen, auch keine Nebenwirkungen durch die Medikamente. Zu 8. Inwieweit haben Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen beider 87 Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert? Überhaupt nicht, etwas, mäßig, ziemlich, sehr. Wie gesagt, gar nicht. Zu 9. In diesen Fragen geht es darum, wie sie sich fühlen und wie es ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen ... a. voller Schwung, b. sehr nervös, c. so niedergeschlagen, dass nichts Sie aufheitern konnte, d. ruhig und gelassen, e. voller Erfolg, f. entmutigt und traurig, g. erschöpft, h. glücklich, i. müde? „Voller Schwung“ bin ich meistens, weil es keinen Grund gibt, keinen Schwung zu haben. Ich halte mich eben in Schwung. Nur vor und nach der Blutuntersuchung bin ich nervös, deshalb also „selten“. Und so „niedergeschlagen dass nichts mich aufheitern könnte“ bin ich nie. Ich bin eben ein Optimist, deshalb bin ich auch meistens gelassen. „Voller Erfolg“ bin ich manchmal, wenn ich etwas geschafft habe, was ich mir vorgenommen hatte, aber das hat nichts mit HIV zu tun. Als Erfolg werte ich zum Beispiel, meine Beziehung zu meistern. „Entmutigt und traurig“ bin ich nie, wie gesagt, ich bin Optimist. Ich bin auch selten „erschöpft“, immer nur dann, wenn es mir psychisch nicht gut geht. Was ist „Glück“? Wenn ich frisch verliebt bin? Da halte ich es mit Hildegard Knef: das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Ich bin ganz allgemein glücklich, weil ich zufrieden bin und es auch sein kann. „Müde“ bin ich manchmal, ich bin halt keine 20 mehr. Zu 10. Wie häufig haben ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt? Immer, meistens, manchmal, selten, nie. Nie. Wenn es mir schlecht gehen würde, würde ich den Kontakt eher suchen. Mein Bekannten- und Freundeskreis ist der gleiche wie vor 4 Jahren, da wissen alle, dass ich HIV-pos. bin. Neuen Bekannten oder 88 Arbeitskollegen erzähle ich nichts von der Infektion, da befürchte ich Repressalien. Zu 11. Inwieweit trifft jede der folgenden Aussagen auf Sie zu? a. Ich scheine etwas leichter als andere krank zu werden, b. ich bin genauso gesund wie alle anderen, die ich kenne, c. ich erwarte, dass sich meine Gesundheit verschlechtert, d. ich erfreue mich ausgezeichneter Gesundheit. Ob ich „leichter als andere krank werde“, weiß ich nicht, kann ich auch gar nicht beurteilen, aber ich fühle mich genauso gesund wie alle anderen, die ich kenne. Es geht mir gut. Gäbe es nicht den medizinischen Fortschritt, würde ich erwarten, dass sich meine Gesundheit verschlechtert. Ich hoffe, dass es mir weiterhin so gut geht, wie es mir jetzt geht, und hoffe auf den Fortschritt. Ich „erfreue mich ausgezeichneter Gesundheit“ in bezug auf die Infektion. Bis auf die üblichen Wehwehchen, die alle haben. Der vorliegende Bogen ist ein Instrument zur Messung der krankheitsübergreifenden gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Gibt es Fragen, die Ihnen fehlen und würden Sie Ihre Lebensqualität genauso beurteilen wie es das Ergebnis des Tests es tut? Viele Fragen beschränken mich auf 4 Wochen, aber chronisch Kranke leiden doch wohl länger als 4 Wochen an ihrer Krankheit. Vor allem schwankt der körperliche und besonders der mentale Zustand jedes Einzelnen. Selbst ein Jahr ist schon zu kurz, weil man ja die psychischen und körperlichen „Tiefs“ in Erinnerung behält und mit sich rumschleppt, auch wenn es mir heute gut geht. Aber die Fragen als auch das Ergebnis decken sich so ziemlich mit meiner eigenen Definition von Lebensqualität. Allerdings fehlt mir so etwas wie die Frage nach der sozialen Akzeptanz der Krankheit. HIV impliziert doch eine „Selbst-Schuld“, deshalb ist es auch schwerer zu verarbeiten. Erst mal die persönliche Seite, ob man es hätte verhindern können und dann die Anderen, weil man durch diese Selbstschuld weitgehend sozial isoliert wird. 89 Man bekommt diese soziale Anteilnahme nicht, dieses Mitfühlen, wie bei Leuten, die Krebs oder andere schreckliche Krankheiten haben. Die haben nämlich nicht selbst „Schuld“. Eine weitere Frage, die mir fehlt, bezieht sich auf das Verreisen. Da fühle ich mich ziemlich eingeschränkt. Nicht nur, dass ich überlegen muss, ob mich bestimmte Länder mit einer HIV-Infektion einreisen lassen ohne vorherigen Test, sondern ich muss auch genau bedenken, wie es mit der medizinischen Versorgung in bezug auf HIV aussieht. Gibt es da überhaupt Kliniken oder Ärzte, die sich mit HIV auskennen? Sind die unter Umständen nicht auf dem neuesten Stand? Usw. usw. ... Meine Medikamente muss ich in ausreichender Menge natürlich mitnehmen und hoffen, dass wir nicht beklaut werden. Gibt es in diesem Land meine Medikamente zu kaufen? Es ist schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Über Partnerschaft gibt es auch keine Frage, denn ohne Partner ist es viel schwieriger, mit HIV umzugehen. Ich habe das große Glück, einen Partner zu haben, das erleichtert unheimlich viel im Leben. Ich bin nicht allein, auch wenn ich die eine oder andere Niedergeschlagenheit mit mir selbst abmachen muss. Ich bin froh, nicht allein zu sein und auf Partnersuche sein zu müssen. Mit HIV ist das schwierig, ich höre von meinem Arzt von Leuten, die mutterseelenallein sind. Bei der Partnersuche kommt immer die Frage nach Verhütung auf, aber in meiner Beziehung schränkt mich das nicht ein, das ist zur Normalität geworden. Es gibt noch etwas, das mich einschränkt, und das sind meine ärztlichen Besuche alle 6 Wochen. Das erfordert eine ziemliche Organisation mit dem Job, besonders weil niemand wissen soll, wieso ich da dauernd hin muss. 5.3 Ergebnisse der Untersuchung Für Herr A. ist sein derzeitiger Gesundheitszustand „sehr viel schlechter“ (persönl. Mitteilung, 16.09.01), weil er vor einem Jahr „noch nichts von“ seinem „Diabetes wusste“ (16.09.01). Auch wenn er körperlich funktionsfähig, seine körperlichen Rollen erfüllen kann und schmerzfrei ist, wertet er seine allgemeine Gesundheit im Vergleich zu den anderen Dimensionen am 90 niedrigsten. Vitalität und emotionale Rollenfunktion liegen auch über der Norm, während soziale Funktionsfähigkeit und psychisches Wohlbefinden vergleichsweise eingeschränkt wahrgenommen werden. Er fühlt sich manchmal niedergeschlagen, „ratlos und entmutigt“ (16.09.01), weil sich die Gedanken um den Diabetes „nicht abschütteln“ (16.09.01) lassen. „Und Glücklichsein ist für mich ein Hochgefühl, und in Bezug auf den Diabetes gibt es das für mich nicht“ (16.09.01). Bei Frau B. liegt die Punktzahl für körperliche Funktionsfähigkeit, körperlicher Rollenfunktion und emotionale Rollenfunktion unterhalb der Werte der dritten Standardabweichung. Die Dimensionen Schmerz, soziale Funktionsfähigkeit und psychisches Wohlbefinden sind im unteren Drittel angesiedelt, während die Bereiche der persönlich beurteilten allgemeinen Gesundheit und Vitalität im Verhältnis am höchsten ausgeprägt sind. Herr C. beurteilt seine gesundheitsbezogene Lebensqualität ausnahmslos überdurchschnittlich gut. Die Dimension mit der geringsten Punktzahl ist die Einschätzung der allgemeinen Gesundheit, die zwar auch über der Norm liegt, aber darauf hindeutet, dass „HIV immer präsent“ (Hr. C., persönl. Mitteilung, 17.10.01) ist und sich negativ auf die subjektive Gesundheit auswirkt. 5.3.1 Ergebnisse in Bezug auf subjektive Gesundheit Hinsichtlich der Dimensionen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität scheinen alle drei Teilnehmer/innen keine weiteren definitorischen Anteile subjektiver Gesundheit zu vermissen. Auch wenn Herr A. enttäuscht über die geringe Anzahl der Fragen ist, die seiner Meinung nach differenzierter hätten sein dürfen, um ein genaueres Bild seiner subjektiven Gesundheit abzubilden, geht er scheinbar von einem globaleren Verständnis von gesundheitsbezogener Lebensqualität aus. Seinerseits zusätzlich erwartete Fragen betreffen eher die allgemeine Lebensqualität. „Die gewisse Distanziertheit“ (Hr. A., persönl. Mitteilung, 16.09.01) die Herr A. hinsichtlich der Kontakte zu Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn und zum Bekanntenkreis spürt, beeinträchtigt ihn überhaupt nicht. Allerdings ist seine soziale Funktion manchmal beeinträchtigt, und zwar dann, wenn er Kontakte zu anderen Menschen hat, die nichts von 91 seinem Diabetes wissen. Situationen, die er nicht einschätzen kann, verursachen ihm „Stress und keine Freude“ (16.09.01). Frau B. beurteilt ihren allgemeinen Gesundheitszustand auf einer Skala von 5 Möglichkeiten zwischen ausgezeichnet und schlecht mit „weniger gut“. Objektiv gesehen, kann Frau B. aufgrund des Rheumas nicht einmal mehr stehen und sitzt im Rollstuhl. Ihr Vergleichskriterium ist ein vorangegangener Krankenhausaufenthalt, in dem sie „wochenlang nur im Bett gelegen“ (Fr. B., persönl. Mitteilung, 17.12.01) hat. Ihr geht es „sogar ganz gut, wenn nicht immer diese Schmerzen wären“ (17.12.01). Auch wenn Frau B. weiß, dass ihre ausgewiesene gesundheitsbezogene Lebensqualität gering ist, ist ihre subjektive Einschätzung im Interview insgesamt positiver. Herr C. kritisiert die zeitliche Begrenzung auf 4 Wochen, weil damit die lebenslang anhaltende chronische Krankheit nicht repräsentiert wird. Des weiteren bringt die soziale Akzeptanz von HIV zur Sprache. Die Furcht vor „Repressalien“ (Hr. C., persönl. Mitteilung, 17.10.01) veranlasst ihn dazu seine Infektion zu verschweigen, obwohl es seinem psychischen und sozialen Wohlbefinden zuträglicher wäre, keine gesellschaftliche Diskriminierungen befürchten zu müssen. 5.3.2 Ergebnisse in Bezug auf die individuelle Bewertung Die Befragten bewerten die einzelnen Fragen und auch das Ergebnis der Lebensqualitätsmessung individuell unterschiedlich. Herr A. findet sich im Ergebnis wieder, weiß, dass er körperlich fit ist, leidet aber an der Unberechenbarkeit seiner Erkrankung. Sein psychisches Wohlbefinden ist damit massiv beeinflusst, mehr als es das Testergebnis ausweist. Ohne sich krank zu fühlen, beeinträchtigt sein Wissen um die Krankheit die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Soziale Kontakte, die ihn manchmal beeinträchtigen, wenn diese über seinen Diabetes nicht informiert sind, bewertet er persönlich als „nicht so wichtig“ (16.09.01). Daraus ist zu schließen, dass die subjektive Einschätzung der sozialen Kontakte positiver ausfällt als es das Testergebnis ausweist. Frau B. weiß, dass ihre Lebensqualität stark beeinträchtigt ist, bewertet sie aber insgesamt höher als das Testergebnis. Sie findet nicht, dass ihre 92 gesundheitsbezogene Lebensqualität „so schlecht ist“ (Fr. B., persönl. Mitteilung, 17.12.01). Daraus folgt, dass Frau B. ihre durch den Test objektivierte Einschätzung ihrer subjektiven Gesundheit in der kommunikativen Validierung anders bewertet. Als Erklärung dafür können innerpsychische Anpassungs- und Regulationsprozesse bezüglich des Anspruchniveaus und Relevanz von Bedürfnissen dienen, die die wahrgenommene Lebensqualität entscheidend mit beeinflussen (Dirhold & Thomas, 1996). Auch wenn Herr C. sozial sehr gut eingebunden ist, beeinträchtigt die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz der HIV-Infektion sein psychisches und soziales Wohlbefinden. Durch den Umstand einer möglichen sexuellen Übertragung impliziert die HIV-Infektion eine Selbstschuld, weshalb die Krankheit „auch schwerer zu verarbeiten“ (Hr. C., persönl. Mitteilung, 17. 10. 01) ist. Herr A. liegt mit seinen Werten im körperlichen Bereich über der Norm, genauso wie Herr C.. Der Unterschied liegt im Beurteilungsmaßstab: Herr A. hält sich mit 7-Kilometer-Langläufen fit, während Herr C. sein Leben lang anstrengende Tätigkeiten „versucht“ hat „zu vermeiden“ (Hr. C., persönl. Mitteilung, 20.11.01), was die Vergleichbarkeit der Tests erschwert. Wenn die individuelle Gewichtung der einzelnen Fragen und Ergebnisse der gesundheitsbezogenen Lebensqualitätsmessung ungleich ausfällt, so wie es die Befragung der drei Teilnehmer erkennen lässt, ist ein interpersoneller Vergleich nur zu Lasten der Genauigkeit möglich. 5.3.3 Ergebnisse in Bezug auf pädagogische Interventionsansätze Herr A.: Hier zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass mit einer offeneren gesundheitsbezogenen Informationsversorgung im Bekanntenkreis z.B. im Hinblick auf „eine Einladung zum Essen“ (Hr. A., persönl. Mitteilung, 16.09.01) eine bessere sozialen Einbindung und damit eine höhere soziale Zufriedenheit zu erzielen wäre. Unter Umständen sind auch Bemühungen um einen neuen Bekanntenkreis hilfreich, so dass von vornherein ein selbstverständlicher Umgang mit dem Diabetes möglich ist. Ein weiterer Ansatz zur Intervention bietet das subjektive Gesundheits- bzw. Krankheitskonzept. Das Gefühl, den Diabetes „nicht im Griff“ (16.09.01) zu haben und die daraus 93 entstehende Entmutigung lassen auf eine Vorstellung schließen, Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit zu betrachten. Hier wäre in einer Beratung unter dem Gesichtspunkt internaler Kontrollüberzeugungen hilfreich und auf eine Schulung zur angemessenen Körperwahrnehmung (Petermann 1997) hinzuweisen, die von pathologisch-mechanistischer Gesundheitsvorstellung auf eine ganzheitliche Betrachtung im Sinne körperlichen, sozialen und psychischen Wohlbefindens zielt. Frau. B.: Die Weigerung von Frau B., in ein Pflegeheim überzusiedeln, könnte als eine psychische Verdrängung unangenehmer Ereignisse interpretiert werden oder in positiver Deutung als `erfolgreichem Altern` (Lehr 1989) im Sinne des Modells der selektiven Optimierung mit Kompensation (Baltes & Baltes 1989). Denn ähnlich wie eine chronische Krankheit ist „das Altern universell, progressiv, hat eine lange vorsymptomatische Phase und ist relativ behandlungsresistent“ (Fries 1989 S. 21), so dass Frau B. eine doppelte Bewältigungsleistung erbringen muss. Als beratende Intervention böten sich hier das Aufzeigen von Alternativen und die Stärkung ihrer vorhandenen positiven Potenziale an, um die aktive Mitgestaltung einer Zukunftsplanung zu ermöglichen. Denn dass der Schwiegersohn schon mal nach Heimen Ausschau hält, hat Frau B. „schrecklich demoralisiert“ (Fr. B., pers. Mitteilung, 17.12.01). Herr C.: Herr C. scheint die HIV für sich akzeptiert zu haben. Er lebt in einer glücklichen Partnerschaft und ist in seinem Freundeskreis gut eingebettet, so dass er bei Problemen „den Kontakt eher suchen“ (Hr. C., persönl. Mitteilung, 17.10.01) würde als sich zurückzuziehen. Für eine Beratung könnte auf einer psychosozialen Ebene die Schuld-Frage thematisiert werden (Lucchetti, 1998). In Bezug auf gesellschaftliche Diskriminierung ist eine Gestaltung der sozialen Umwelt im Sinne einer Erweiterung des Bekanntenkreises möglich, in dem ein offener Umgang mit dem Thema HIV vollständig akzeptiert ist. Die Testergebnisse weisen in bezug auf die drei Teilnehmer/innen einen hohen Gültigkeitsgrad für ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität auf. Die individuelle Beurteilung des Gesamtergebnisses und die eingeschätzte relative Wichtigkeit der einzelnen Dimensionen fallen jedoch unterschiedlich aus. Herr A. fühlt sich subjektiv nicht so gesund wie das Testergebnis es ausweist, stellt das Ergebnis aber auch nicht in Frage. Frau B. schätzt ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität insgesamt höher ein, und Herr C. findet seine subjektive Gesundheit angemessen ermittelt. Aber erst die hier mündlich 94 durchgeführte Befragung fördert die Möglichkeit zu pädagogischen Interventionen zutage. Damit ist die Bedeutung von subjektiver Gesundheit unter Berücksichtigung der individuellen Bewertung für eine pädagogische Intervention nicht von der Hand zu weisen. 6 Schlussbetrachtung In dieser Diplomarbeit konnte anhand der vorliegenden Literatur zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität aufgezeigt werden, dass der existierende Konsens, gesundheitsbezogene Lebensqualität als ein multidimensionales Konstrukt, basierend auf physischer, psychischer und sozialer Komponenten sowie der Komponente der Funktionsfähigkeit im Alltagsleben, Gültigkeit hat. Der konzeptionelle Bezug zur WHO- Gesundheitsdefinition wurde von Ludwig (1991) in einer offenen Befragung empirisch belegt, wenn auch die definitorische Übereinstimmung auf „einer mittleren bis hohen Abstraktionsebene“ (ebd. S.33) liegt. Die Abstraktion oder operationale Erfassung von gesundheitsbezogener Lebensqualität geht aber immer auch zu Lasten subjektiver und damit individueller Einschätzung von Gesundheit. Die Hypothesenbildung - Personen mit einer chronischen Erkrankung (Diabetes, Rheuma, HIV) weichen in der Bewertung ihrer subjektiven Gesundheit von den Ergebnissen standardisierter Messinstrumente ab - lenkt die Bearbeitung des Themas auf die Frage der genügenden bzw. ungenügenden Abbildung subjektiver Gesundheit, wobei das Ergebnis der Literaturexpertise (Kapitel 1 bis 4) unterschiedlich ausfällt. Es wird deutlich, dass die Einbeziehung des Begriffs Lebensqualität in medizinische Evaluationen und Therapieziele für den Anspruch eines geänderten Krankheitsund Gesundheitsverständnisses steht. Die in dem Terminus enthaltenen Dimensionen bedeuten nichts anderes als das Anerkennen der Ganzheitlichkeit eines Menschen in seinem Kranksein. Wenn die Dimensionen Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden neben der körperlichen Symptomatik abgefragt werden, heißt das, dass ein biopsycho-soziales Krankheitsverstehen zugrundeliegt. 95 Der in der Medizin verwandte Begriff Lebensqualität bezieht sich auf Gesundheit, allerdings gibt es keine einheitliche - sondern nur eine allgemein anerkannte - Definition von gesundheitsbezogener Lebensqualität, so dass mit dem gleichen Wort durchaus Verschiedenes gemeint sein kann. Damit ist der vielfältige Gebrauch des Begriffs eher verwirrend. Die synonyme Verwendung weiterer Termini wie „Gesundheitsstatus“, „subjektive Gesundheit“, „subjektives Gesundheitsgefühl“, „gesundheitliches Befinden“ und weitere, tragen entschieden dazu bei. Der Einsatz von über 1000 Messinstrumenten (Bullinger 1998) macht einen Zahlenvergleich zwischen unterschiedlichen klinischen Studien unübersichtlich und erst dann möglich, wenn das zugrundegelegte Konzept und die Messmethode bekannt ist. Die Vielfalt macht den Einsatz eines Messinstruments unklar und fragwürdig, so dass den damit nicht Vertrauten die gesundheitsbezogene Lebensqualität eher wie ein Schlagwort vorkommt und nicht als patientenorientiertes Therapieziel. Das für die vorliegende Arbeit angewandte SF-36 Health Survey wurde primär zur Evaluation von Behandlungsverfahren in Kohortenstudien und randomisierten klinischen Studien konzipiert, wird aber zunehmend im Bereich der Indikation von Behandlungen bzw. der Evaluation von rehabilitativen Behandlungsmaßnahmen verwandt (Bullinger 1996b). Beim Einsatz zur Planung maßgeschneiderter Therapien und bei der individuellen Patientenversorgung im klinischen Zusammenhang sind konzeptionelle Schwachpunkte zu beachten: die generelle Unterrepräsentation der sozialen Funktion und die daraus folgende Überbewertung der physischen Funktionen. Weiter ist keine Bewertung der einzelnen Dimensionen möglich, so dass die relative Wichtigkeit einer Lebensqualitätsbeschränkung nicht erfasst wird. Damit wird die in der Überschrift gestellte Frage berührt, wie sich gesundheitsbezogene Lebensqualität von chronisch kranken Menschen erfassen lässt. Der SF-36 kann „als ein psychometrisch zufriedenstellendes Verfahren zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität gelten“ (Bullinger, 1996b, S. XXVI), was sich auch in den Ergebnissen der drei Fallbeispiele widerspiegelt. Auch wenn die Teilnehmer/innen im empirischen Teil dieser Arbeit (Kapitel 5) ein übereinstimmendes Verständnis von gesundheitsbezogener Lebensqualität aufweisen, so unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer subjektiven Wertmaßstäbe. Deutlich wird das an der nicht so 96 wichtig erachteten sozialen Funktion von Hr. A. und der geringeren Bewertung körperlicher Funktionen von Hr. C. Eine Ausnahme bildet Fr. B., die das ausgewiesene Lebensqualitätsergebnis insgesamt positiver beurteilt. Die Fragestellung, ob krankheitsübergreifende Lebensqualitätsmessung hier exemplarisch am SF-36 - subjektive Gesundheit genügend abbildet, ist schlussfolgernd zu bejahen. Aber auch die Hypothese hinsichtlich der Abweichung in der Bewertung subjektiver Gesundheit und den Ergebnissen standardisierter Messinstrumente konnte bestätigt werden. Ein Messinstrument kann nur so subjektiv sein, wie es der Abstraktionsgrad der Konzeption es zulässt. Wenn man gesundheitsbezogene Lebensqualität auf den Aspekt der Selbstauskunft reduziert ohne individuelle Bewertungskriterien zu erfassen, gehen wertvolle Informationen über subjektive Gesundheit für eine pädagogische Intervention im Sinne von Patientenberatung und Patientenschulung verloren. Das bedeutet: soll sich subjektive Gesundheit für eine pädagogische Intervention fruchtbar erweisen, muss entweder eine Gewichtung von Lebensqualitätsindikatoren von standardisierten Messungen erfolgen, oder eine Befragung hinzukommen, die die individuelle relative Wichtigkeit der Dimensionen berücksichtigt. 7 LITERATURVERZEICHNIS Abel, T., Duetz, M. & Niemann, S. (2000). Statistische Zusammenhänge selbstberichteter Gesundheitsindikatoren: eine explorative Analyse von Befragungsdaten bei 55.65 jährigen. In M. Bullinger, J. Siegrist & U. Ravens-Sieberer (Hrsg.), Lebensqualitätsforschung aus medizinpsychologischer und –soziologischer Perspektive: Jahrbuch der Medizinische Psychologie 18 (S. 320-336). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Abele, A. & Becker, P. (Hrsg.). (1991). Wohlbefinden: Theorie, Empirie, Diagnostik. Weinheim; München: Juventa Verlag. Arastèh, K. & Weiß, R. (1997). Buch gegen die Panik. Leben mit der HIV- 97 Infektion. Berlin: Verlag rosa Winkel. Baltes M. M., Kohli M., & Sames K. (Hrsg.). (1989). Erfolgreiches Altern. Bedingungen und Variationen. Bern; Stuttgart; Toronto: Huber. Baltes, P. B. & Baltes, M. M. (1989). Erfolgreiches Altern: Mehr Jahre und mehr Leben. In M. M. Baltes, M. Kohli & K. Sames (Hrsg.), Erfolgreiches Altern. Bedingungen und Variationen (S. 5-9). Bern; Stuttgart; Toronto: Huber. Becker, P. (1991). Theoretische Grundlagen. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), Wohlbefinden: Theorie, Empirie, Diagnostik (S. 13-49). Weinheim; München: Juventa Verlag. Becker, P. (1992). Die Bedeutung integrativer Modelle von Gesundheit und Krankheit Für die Prävention und Gesundheitsförderung. In P. Paulus (Hrsg.), Prävention und Gesundheitsförderung: Perspektiven für die psychosoziale Praxis (S. 91-108). Köln: GwG-Verlag. Becker, P. (1995). Seelische Gesundheit und Verhaltenskontrolle: Eine integrative Persönlichkeitstheorie und ihre klinische Anwendung. Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe: Bengel, J. & Belz-Merk, M. (1990). Subjektive Gesundheitskonzepte. In R. Schwarzer (Hrsg.), Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch (S.105-115). Göttingen; Toronto; Zürich: Hogrefe. Bengel, J., Schrittmatter, R. & Willmann, H. (1998). Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese – Diskussionstand und Stellenwert. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Beutel, M. (1990). Psychosoziale Aspekte chronischer Krankheit. In M Broda, & F. A. Muthny. Umgang mit chronisch Kranken: Ein Lehr- und Handbuch der psychosozialen Fortbildung. Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag. Blättner, B. (1994). Gesundheitsförderung und Gesundheitsbildung –aktueller Stand der Diskussion- Literaturrecherche zur Vorbereitung des Kongresses „anders leben lernen“ Beiträge der Erwachsenenbildung zur Gesundheitsförderung vom 13.-16. November 1994. VHS, Hamburg: Kalibor. Broda, M. & Muthny, F. A. (1990). Umgang mit chronisch Kranken: Ein Lehr- und Handbuch der psychosozialen Fortbildung. Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag. 98 Bullinger, M. (1994). Lebensqualität: Grundlagen und Anwendungen. In F. Petermann & K.-C. Bergmann (Hrsg.), Lebensqualität und Asthma. (S. 1728). München [u.a.]: Quintessenz. Bullinger, M. & Ravens-Sieberer, U. (1996). Stand der Forschung zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Kindern. In F. Petermann (Hrsg.), Lebensqualität und chronische Krankheit (S.29-71). Munchen: Dustri-Verlag. Bullinger, M. (1996a). Trends in der internationalen Lebensqualitätsforschung. In F. Petermann (Hrsg.), Lebensqualität und chronische Krankheit (S. 5-28). München: Dustri-Verlag. Bullinger, M. (1996b). Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit Dem SF-36 Health Survey. Die Rehabilitation 3, 35. Jahrgang, XVII-XXIX. Bullinger, M. (1997). Lebensqualitätsforschung: Bedeutung – Anforderung – Akzeptanz. Stuttgart; New York: Schattauer. Bullinger, M. (1998). Gesundheitsbezogene Lebensqualität und subjektive Gesundheit. In W. Dür & J. M. Pelikan (Hrsg.), Qualität in der Gesundheitsförderung: Ansätze und Beispiele zur Qualitätsentwicklung und Evaluation (S. 41-74). Wien: Facultas-Universitätsverlag. Bullinger, M. & Kirchberger, I. (1998). Der SF-36: Fragebogen zum Gesundheitszu-stand (SF 36): Handbuch für die deutschsprachige Fragebogenversion. Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Bullinger, M., Ravens-Sieberer, U. & Siegrist, J. (2000). Gesundheitsbezogene Lebensqualität in der Medizin – eine Einführung. In M. Bullinger, U. RavensSieberer, & J. Siegrist, (Hrsg.), Lebensqualitätsforschung aus medizinpsychologischer und –soziologischer Perspektive: Jahrbuch der Medizinischen Psychologie, 18 (S. 11-21). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Croog, S. H. & Levine, S. (1989). Quality of life and health care interventions. In H. E. Freeman & S. Levine (eds.), Handbook of medical sociology, 4th edition (pp 508-528). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Dann, H. D. (1991). Subjektive Theorien zum Wohlbefinden. In A. Abele & P. 99 Becker (Hrsg.), Wohlbefinden: Theorie, Empirie, Diagnostik (S. 97-117). Weinheim; München: Juventa. Die deutsche Version des EuroQuol-Fragebogens. Ein Messinstrument zum Einsatz in Kosten-Nutzwert-Analysen [Internet]. Institut für Versicherungsbetriebslehre. Forschungsfelder. Verfügbar unter: www.ivbl.uni-hannover.de [10.01.02]. Dirhold, S. & Thomas, W. (1996). Ein theoretischer Orientierungsrahmen zur Erforschung der Lebensqualität onkologischer Patienten. In F. Petermann (Hrsg.), Lebensqualität und chronische Krankheit (S. 72-96). München: Dustri-Verlag. Dlugosch, G. E. (1994). Modelle in der Gesundheitspsychologie. In P. Schwenkmezger & L.R. Schmidt (Hrsg.), Lehrbuch der Gesundheitspsychologie (S. 101-117). Stuttgart: Enke Verlag. Dunde, S. R. (Hrsg.). (1991). Beratungsführer zu AIDS für Angehörige psychosozialer und medizinischer Berufe. Stuttgart: Hippokrates Verlag. Erkrankungen, rheumatische. (1990). In Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch (256. neu bearbeitete Auflage). Berlin; New York: W. de Gruyter Verlag. Faltermaier, T. (1994). Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union. Faltermaier, T. (1998). Subjektive Konzepte und Theorien von Gesundheit. Begründung, Stand und Praxisrelevanz eines gesundheitswissenschaftlichen Forschungsfeldes. In U. Flick (Hrsg.), Wann fühlen wir uns gesund? Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit (S. 70-86). Weinheim; München: Juventa. Filipp, S. H. (1990). Subjektive Theorien als Forschungsgegenstand. In R. Schwarzer (Hrsg.), Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch (S. 247-262). Göttingen; Toronto; Zürich: Hogrefe. Filipp,S. H. & Aymanns, P. (1997). Subjektive Krankheitstheorien. In R. Schwarzer (Hrsg.), Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch (2., überarb. Und erw. Aufl.). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Flick, U. (Hrsg.). (1998). Wann fühlen wir uns gesund? Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Weinheim; München: Juventa. Frank, R. (1991). Körperliches Wohlbefinden. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), 100 Wohlbefinden: Theorie, Empirie, Diagnostik (S. 71-95). Weinheim; München: Juventa. Frank, U., Belz-Merk, M.,Bengel, J., & Schrittmatter, R. (1998). Subjektive Konzepte und Theorien von Gesundheit. Begründung, Stand und Praxisrelevanz eines gesundheitswissenschaftlichen Forschungsfeldes. In U. Flick (Hrsg.), Subjektive Gesundheitsvorstellungen gesunder Erwachsener (S.57-69). Weinheim; München: Juventa. Franke, A. & Broda, M. (Hrsg.). (1993). Psychosomatische Gesundheit. Versuch einer Abkehr vom Pathogenese–Konzept. Tübingen: DGVT-Verlag. Fries, J.F. (1989). Erfolgreiches Altern: Medizinische und demographische Perspektiven. In M. M. Baltes, M. Kohli & K. Sames (Hrsg.), Erfolgreiches Altern. Bedingungen und Variationen. (S. 19-26). Bern; Stuttgart; Toronto: Huber. Gesundheit: ein umfassendes Konzept: Statistische Mitteilungen zur Gesundheit in Wien (1998/2), [Internet]. Bedeutung sozialer Netzwerke und sozialer Unterstützung für die Gesundheit. Verfügbar unter: www.magwien.gv.at/who/gb/98/gesund.pdf [16.12.01]. Glatzer, W. (1992). Lebensqualität aus sozioökonomischer Sicht. Veröffentlichung der Joachim Jungius - Gesellschaft, 69, (S. 47-59). Glatzer, W. & Zapf, W. (Hrsg.). (1984). Lebensqualität in der Bundesrepublik: Objektive Lebensbedingungen und sobjektives Wohlbefinden. Frankfurt; New York: Campus Verlag. Grant, M. M., & Rivera, L. M. (2001). Entwicklung von Lebensqualität in der Onkologie und onkologischen Pflege. In C. R. King & P. S. Hinds (Hrsg.), Lebensqualität: Pflege- und Patientenperspektiven – Theorie, Forschung, Praxis (S. 29-53). Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Huber. Haase, J. E. & Braden, C. J. (2001). Richtlinien zur Klärung lebensqualitätsbezogener Begrifflichkeiten. In C. R. King & P. S. Hinds Lebensqualität: Pflege- und Patientenperspektiven – Theorie Forschung Praxis (S.95-119). Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Huber. Hanninen, J., Takala, J., & Keinanen-Kiukaannemi, S. (1998). Quality of life in NIDDM patients assessed with the SF-20 questionnaire. Diabetes Research and Clinical Practice, 42 (1), 17-27. Hasenbring, M. (1990). Zum Stellenwert subjektiver Theorien im 101 Copingkonzept. In F. A. Munthy (Hrsg.), Krankheitsverarbeitung. Hintergrundtheorien, klinische Erfassung und empirische Ergebnisse (S. 7887). Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo; Hong Kong: Springer-Verlag. Hirsch, A. (1996). Diabetes und Lebensqualität. In F. Petermann (Hrsg.), Lebensqualität und chronische Krankheit (S. 185-222). München: DustriVerlag. Hurrelmann, K (1994). Sozialisation und Gesundheit: Somatische, psychische und soziale Risikofaktoren im Lebenslauf (3. Aufl.). Weinheim; München: Juventa-Verlag. Internet-Suchmaschine Fireball, [Internet]. Suchbegriff: Lebensqualität. Verfügbar unter: www.fireball.de [12.02.02]. Kickbusch, I. (1992). Plädoyer für ein neues Denken: Muster - Chaos - Kontext. Neue Handlungsansätze in der Gesundheitsförderung. In P.Paulus (Hrsg.), Prävention und Gesundheitsförderung: Perspektiven für die psychosoziale Praxis (S. 23-33). Köln: GwG-Verlag. King, C. R. (2001). Lebensqualität und umstrittene Themen – Eine Übersicht. In C. R. King & P. S. Hinds (Hrsg.), Lebensqualität: Pflege- und Patientenperspektiven – Theorie, Forschung, Praxis (S. 55-69). Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Huber. King, C. R. & Hinds, P. S. (Hrsg.). (2001). Lebensqualität: Pflege- und Patienten perspektiven – Theorie, Forschung, Praxis. Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Huber. Kleining, G. (1995). Lehrbuch Entdeckende Sozialforschung Band I: Von der Hermeneutik zur qualitativen Heuristik. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union. Kohlmann, T., Herlyn, K. & Siegrist, J. (1994). Lebensqualität bei Erkrankungen der Bewegungsorgane. Psychomed, 6, 6-11. Kohlmann, T. (1997). Die Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit dem Nottingham Health Profile. In M. Bullinger (Hrsg.), Lebensqualitätsforschung. Bedeutung – Anforderung – Akzeptanz (S. 7-17). Stuttgart; New York: Schattauer. Küchler, T. & Schreiber, H. W. (1989). Lebensqualität in der Allgemeinchirurgie: Konzepte und praktische Möglichkeiten. Hamburger Ärzteblatt, 43, 246-250. 102 Kvale, S. (1991). Validierung: Von der Beobachtung zu Kommunikation und Handeln. In U. Flick, E. v. Kardoff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel & S. Wolf (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. (S. 427-431). München: Psychologie Verlags Union. Lang, F. R., Rieckmann, N. & Schwarzer, R. (2000). Lebensqualität über die Lebensspanne: Die Rolle von Depressivität und Alter in der Alltagsgestaltung. In M. Bullinger, J. Siegrist & U. Ravens-Sieberer (Hrsg), Lebensqualitätsforschung aus medizinpsychologischer und -soziologischer Perspektive: Jahrbuch der Medizinischen Psychologie 18 (S. 337-367). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Lang, S. & Müller-Andritzky, M. (1984). Gesundheit und soziale Integration. In W. Glatzer & W. Zapf (Hrsg.), Lebensqualität in der Bundesrepublik ObjektiveLebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden (S.141-156). Frankfurt; New York: Campus Verlag. Legewie, H. & Trojan, A. (2000). Skript Gesundheitspsychologie – Gesundheitssoziologie. Theorie und Forschung zur Gesundheitsförderung [Internet]. Verfügbar unter: www.tuberlin.de/fak8/ifg/psychologie/legewie/Skript-Ges-foerd.pdf [12.09.01]. Auszug aus H. Legewie & A. Trojan. Nachhaltige Gesundheit und Entwicklung – Leitbilder, Politik und Praxis der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt- und Lebensbedingungen. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften. Lehr, U. (1989). Erfolgreiches Altern – Einführung. In M. M. Baltes, M. Kohli & K. Sames (Hrsg.), Erfolgreiches Altern. Bedingungen und Variationen (S. 23). Bern; Stuttgart; Toronto: Huber. Lindström, B. (1992). Quality of life: A model for evaluating health for all. Conceptual considerations and policy implications. Sozial- und Präventivmedizin,37, S.301-306. Lucchetti, S. (1998). Zwischen Herausforderung und Bedrohung. Subjektive Krankheitstheorien bei HIV-Infektion und AIDS. In U. Flick (Hrsg.), Wann fühlen wir uns gesund? Subjektive Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit (S. 268-284). Weinheim; München: Juventa. 103 Ludwig, M. (1991). Lebensqualität auf der Basis subjektiver Theoriebildung. In M. Bullinger, M. Ludwig & N. Steinbüchel von (Hrsg.), Lebensqualität bei kardiovaskulären Erkrankungen (S. 24-34). Göttingen: Hogrefe. Ludwig-Mayerhofer (1999). ILMES – Internet-Lexikon der Methoden der empirischen Sotialforschung [Internet]. Verfügbar unter: www.lrzmuenchen.de/~wlm/ilmes.htm [18.10.01]. Mayring, P. (1991). Konzeptualisierung und Diagnostik von Wohlbefinden. In A. Abele, & P. Becker (Hrsg.), Wohlbefinden: Theorie, Empirie, Diagnostik (S. 51-70). Weinheim; München: Juventa Verlag. Medizinische Klinik mir Schwerpunkt Psychosomatik und Psychotherapie, [Internet]. Konzepte zur Erfassung der Lebensqualität. Verfügbar unter: www.charite.de/psychosomatik/pages/forschung/groups/lrb_qual/index.html [13.09.01]. Meier, D. (1995). Lebensqualität im Alter: Eine Studie zur Erfassung der individuellen Lebensqualität von gesunden Älteren, von Patienten im Anfangsstadium einer Demenz und ihren Angehörigen. Bern; Berlin; Frankfurt/M; New York; Paris; Wien: Lang. Noack, R. H. (1997). Salutogenese: Ein neues Paradigma in der Medizin? In H. H. Bartsch & J. Bengel (Hrsg.), Salutogenese in der Onkologie (S. 88-105). Basel: Karger. Paulus, P. (Hrsg). (1992). Prävention und Gesundheitsförderung: Perspektiven für die psychosoziale Praxis. Köln: GwG-Verlag. Paulus, P. (1994). Selbstverwirklichung und psychische Gesundheit: Konzeptionelle Analysen und ein Neuentwurf. Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Paulus, P. & Deter, D. (Hrsg.). (1998). Gesundheitsförderung: Zwischen Selbstverwirklichung und Empowerment. Köln: GwG-Verlag. Petermann, F. (Hrsg.). (1996). Lebensqualität und chronische Krankheit. München: Dustri-Verlag. Petermann, F. (Hrsg.). (1997). Patientenschulung und Patientenberatung: Ein Lehrbuch. (2. vollst. Überarb. Und erw. Aufl.). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Petermann, F. & Krischke, N. (1996). Krebs- und Tumorerkrankungen: 104 Ergebnisse der Lebensqualitätsforschung. In F. Petermann (Hrsg.), Lebensqualität und chronische Krankheit (S. 97-135). München: DustriVerlag. Rose, M., Burkert, U., Scholler, G., Schirop, T., Danzer, G. & Klapp, B. F. (1998). Determinants of the quality of life of patients with diabetes under intensified insulin therapie. Diabetes Care, 21 (11), 1876-85. Rose, M., Fliege, H., Hildebrandt, M., Bronner, E., Scholler, G., Danzer, G., & Klapp, B. F. (2000). „Gesundheitsbezogene Lebensqualität“, ein Teil der „allgemeinen“ Lebensqualität? In M. Bullinger, J. Siegrist & U. RavensSieberer (Hrsg.), Lebensqualitätsforschung aus medizinpsychologischer und –soziologischer Perspektive. Jahrbuch der medizinischen Psychologie, 18 (S. 206-221). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Schmidt, L. R. & Dlugosch, G. E. (1997). Psychologische Grundlagen der Patienten-Schulung und Patientenberatung. In F. Petermann (Hrsg.). Patientenschulung und Patientenberatung: Ein Lehrbuch (S. 23-51) (2. vollst. Überarb. Und erw. Aufl.). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Schwarzer, R. & Leppin, A. (1989). Sozialer Rückhalt und Gesundheit. Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Seelbach, H., Kugler, J., & Neumann, W. (Hrsg.). (1997). Von der Krankheit zur Gesundheit (S. 89-101). Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Verlag H. Huber. Siegrist, J. (1990). Grundannahmen und gegenwärtige Entwicklungsperspektiven einer gesundheitsbezogenen Lebensqualitätsforschung. In P. Schölmerich & G. Thews (Hrsg.), „Lebensqualität“ als Bewertungskriterium in der Medizin: Symposium der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (S. 59-65). Stuttgart; New York: G. Fischer Verlag. Siegrist, J., Starke, D., Laubach, W. & Brähler, E. (2000). Soziale Lage und gesundheitsbezogene Lebensqualität: Befragungsergebnisse einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung. In M. Bullinger, J. Siegrist & U. Ravens-Sieberer (Hrsg.), Lebensqualitätsforschung aus medizinpsychologischer und –soziologischer Perspektive. Jahrbuch der medizinischen Psychologie, 18 (S. 307-336). Göttingen; Bern; Toronto; Seattle: Hogrefe. Sohn, W. (1997). Wie gesund sind chronisch Kranke? Optionen einer salutogenetischen Sicht in der allgemeinärztlichen Langzeitbetreuung. In H. Seelbach, J. Kugler & W. Neumann (Hrsg.), Von der Krankheit zur 105 Gesundheit (S. 89-101). Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Verlag Hans Huber. Stark, W. (1998). Empowerment – fördernde Bedingungen schaffen statt Defizite Beheben. In P. Paulus & D. Deter (Hrsg.), Gesundheitsförderung: Zwischen Selbstverwirklichung und Empowerment (S. 39-43). Köln: GwGVerlag. Stokes, J. P. (1983). Predicting satisfaction with social support from social network Structure. American Journal of Community Psychology, 11, 141152. Swoboda, W. & Weichmeier, F. (1997). Fragebogen des Monats des Bayerischen Forschungsverbunds Public Health – MOS Short Form-36 (SF36) [Internet]. Public Health in Deutschland, Service des Bayerischen Forschungsverbundes Public Health. Verfügbar unter: www.med.unimuenchen.de/mfv/sf36.html [17.12.01]. Vallerand, A. H., Breckenridge, D. M. & Hodgson, N. A. (2001). Theorien und Begriffsmodelle als Leitlinien lebensqualitätsbezogener Forschung. In C. R. King & P. S. Hinds (Hrsg.), Lebensqualität: Pflege- und Patientenperspektiven – Theorie, Forschung, Praxis (S. 71-93). Bern; Göttingen; Toronto; Seattle: Huber. Verres, R. (1989). Zur Kontextabhängigkeit subjektiver Krankheitstheorien. In C. Bischoff & H. Zenz (Hrsg.), Patientenkonzepte von Körper und Krankheit (S. 18-24). Bern; Stuttgart; Toronto: Huber. Waller, H. (1996). Gesundheitswissenschaft: eine Einführung in Grundlagen und Praxis (2. überarb. Aufl.). Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer. Ware, J. E. (1997). Try the SF-36 Version 2 Online Demo [Internet]. Quality Metric Incorporated. Verfügbar unter: www.qualitymetric.com/innohome/insf36.shtml [11.02.02]. Zapf, W., Breuer, S., Hampel, J., u.a. (1987). Individualisierung und Sicherheit: Unter-suchungen zur Lebensqualität in der Bundesrepublik Deutschland. Perspektiven und Orientierungen - Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes, 4. München: C. H. Beck. 8 ANHANG