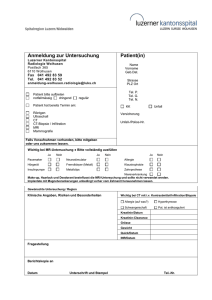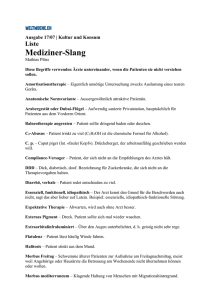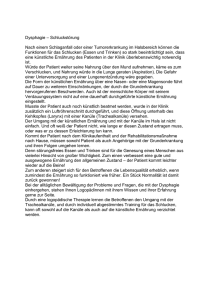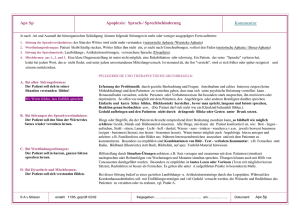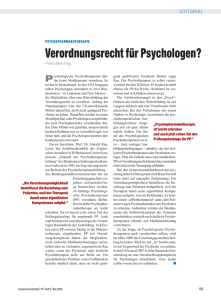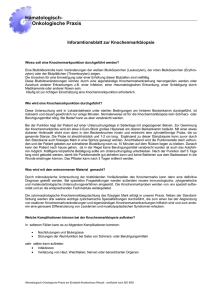Suchttherapie verlangt Spezialisten Report Psychologie im
Werbung

Suchttherapie verlangt Spezialisten Report Psychologie im Gespräch mit der Leitenden Dipl.-Psychologin der Oberbergklinik Extertal, Christina Hempel Report Psychologie: Die Suchtproblematik war, als Sie vor 30 Jahren in der DDR Psychologie studierten, viel weniger als heute ein Schwerpunkt psychotherapeutischer Arbeit. Was faszinierte Sie an diesem Thema? Ch. Hempel: Zunächst wenig. Ich habe mich erst nach einigen Jahren Berufserfahrung diesem Gebiet zugewandt. Als sich die ehemalige DDR einer angemessenen und qualifizierten Behandlung von Suchtkranken stellte und nicht mehr davon ausging, dass es sich bei dieser Erkrankung um ein Überbleibsel der bürgerlichen Gesellschaft handele – das war ungefähr Anfang der 80er Jahre – wurden sehr schnell auf hohem Niveau Forschungsprojekte und Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Das Berliner Griesinger-Krankenhaus fungierte damals als Leiteinrichtung. Es wurde angeordnet, alle Alkoholkranken in speziellen Beratungsstellen auf Kreisebene zu betreuen. Alkoholkranke waren auch im Osten die "ungeliebten Patienten" in den Krankenhäusern und Arztpraxen, deren Behandlungsmöglichkeiten häufig als wenig bis gar nicht erfolgversprechend eingeschätzt wurden. In dieser Zeit habe ich meine Weiterbeildung zur Betreuung Suchtkranker begonnen und in den großen Schwerpunktkliniken in Berlin, Ueckermünde und Schwerin hospitiert. Ich ahnte anfangs nicht, welch interessantes und befriedigendes Arbeitsfeld sich mir erschließen würde und wie vielen sympathischen und sensiblen Menschen ich begegnen würde. Viele Psychologinnen und Psychologen verfolgen skeptisch die zunehmende Spezialisierung auf Teilgebiete der Psychologie und Psychotherapie. Wie wichtig ist der Spezialist in der Suchttherapie? Suchtbehandlung erfordert eine spezielle Kompetenz, die in einer besonderen Aus- oder Weiterbildung erworben werden sollte. Während des Studiums konnte ich kein spezielles Suchtverständnis erwerben. Entsprechende Vorlesungen gehörten nicht zum Angebot. Das Studium - für Ärzte übrigens genauso wie für Psychologen - ist meines Erachtens auch heute noch nicht danach ausgerichtet, Spezialkenntnisse in der Behandlung von Suchtpatienten zu vermitteln. Die Suchterkrankung ist zudem eine so komplexe Erkrankung, dass man tatsächlich ohne ein spezielles Wissen nicht auskommt. Es geht dabei nicht nur um psychodynamische Hypothesen oder psychotherapeutische Interventionen, sondern um ganz präzise Kenntnisse von den Wirkungen der Drogen, den Absetzphänomenen und Entzugserscheinungen sowie um fundiertes Wissen über die Symptome dieses nicht eben einfachen Krankheitsbildes, um erfolgreich suchtkranke Patienten behandeln zu können. Aus dem, was der Patient uns erzählt, den Ausprägungsgrad der Erkrankung einzuschätzen, ist keine einfache diagnostische Aufgabe. Während etwa depressive Patienten relativ konkrete Beschwerden klagen, z.B. Schlafstörungen oder den Verlust von Lebensfreude, beschreibt uns der suchtkranke Patient ja vor allem seine Rituale mit Substanzen. Für den Therapeuten bleibt dabei ein größerer Spielraum bei der Bewertung dieser Rituale, den er nur durch Fachkompetenz und Erfahrung verantwortlich gestalten kann. Der Begriff "Privatklinik" löst unterschiedliche Assoziationen aus, u.a. die einer elitären Patientenauswahl. Stört Sie das als Therapeutin? Ich wünsche jedem Patienten die bestmögliche, auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmte Therapie. Zu unseren Patienten zählen viele Lehrer, Ärzte, Unternehmer – Privatversicherte und Selbstzahler. Für mich sind sie in erster Linie Patienten, Menschen in Krisensituationen, die unsere Hilfe suchen. Welche Rolle spielen Sie als psychologische Psychotherapeutin im Klinikkonzept? Die Oberbergkliniken sind Akutkliniken. Patienten kommen zu uns, werden - soweit nicht geschehen - entgiftet. In dieser Entgiftungsphase steht zunächst die körperliche Betreuung im Vordergrund. Es hängt vor allem von der körperlichen Verfassung und der Gesprächsfähigkeit des Patienten ab, wann die gezielte psychologische Betreuung einsetzt, die jedoch, so früh wie möglich - auch schon während der Entgiftung – beginnt. Die Beziehungsgestaltung zum Patienten erfolgt in dem Moment, da er die Klinik betritt. Von da an sind unsere Pflege- und Serviceteams, die Ärzte und Psychologen für den Patienten da und leisten Haltearbeit, wie wir es nennen, die den Patienten in seinem Entschluss bestärkt, etwas zur Lösung seiner Probleme zu unternehmen. Diese Motivation des Patienten ist am Anfang oft erzwungen durch beunruhigende Symptome, unter denen er zu leiden beginnt, oder auch durch Angehörige oder den Arbeitgeber. Die Entzugszeit ist eine sehr schwierige Zeit für den Patienten. Ihn quälen Ängste als Resultat dessen, was er mit den Substanzen erlebt hat. Gleichzeitig ist die Bindung an den Suchtstoff aber noch so stark, dass der Patient sich gar nicht vorstellen kann, ohne diesen zu leben. In dieser ambivalenten Phase ist ein Angebot zur stützenden Begleitung besonders wichtig. Ist diese frühe Einbindung von Psychologen typisch in der Suchttherapie? Der Trend, zumindest in spezialisierten Kliniken, geht dahin. Aber auch in Allgemeinkrankenhäusern, auf internistischen Stationen, sollten die Motivationsgespräche zunehmend größeren Raum einnehmen. Wir bemühen uns, besonders in der Aufnahmephase, in der der Patient mit starken Scham- und Schuldgefühlen zu kämpfen hat, eine Brücke zum Patienten zu bauen und ihm ein tragfähiges Angebot zu machen. In dieser Zeit sind Sensibilität und Einfühlungsvermögen sowie spezifische Suchtkompetenz auf Seiten des Therapeuten eine wichtige Voraussetzung für eine qualifizierte Entzugsbegleitung. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Sobald der Zustand des Patienten es erlaubt, und das ist bei Alkoholkranken nach drei bis vier Tagen häufig der Fall, bekommen unsere Einzelgespräche eine zunehmend strukturierte Qualität. Der Patient wird angehalten, über das, was er während der Aufnahme- bzw. Entgiftungsphase erlebt hat, zu reflektieren, und es wird ihm bei der Einordnung und Beurteilung des Erlebten geholfen. Wir nennen das Arbeiten am Aufbau einer Krankheitseinsicht bzw. eines Krankheitsmodells. Dieses ist die Basis für die spätere Abstinenzvornahme und die Abstinenzkompetenz. Wir binden den Patienten, sobald es seine körperliche und seelische Verfassung erlaubt, in Gruppen ein, damit er über die Schuld- und Schamgefühle dieser Anfangsphase sprechen kann und sich in der Gemeinschaft der Betroffenen Verständnis und Stütze holen kann. In der berufspolitischen Arbeit gewinnt man bisweilen den Eindruck, es bestünden zwischen Ärzten und psychologischen Psychotherapeuten nur schwer überbrückbare Interessengegensätze... Im Klinikalltag spüre ich das nicht. Bei uns arbeiten psychologische und ärztliche Psychotherapeuten in einem Programm. Wir sind eingearbeitet und die Zusammenarbeit funktioniert überwiegend sehr gut. Wir haben ein interessantes Behandlungsprogramm mit verschiedenen Einzel- und Gruppentherapien. Selbstverständlich sind, gerade für ein so großes Team wie das unsere, therapeutische Disziplin und Konzepttreue von besonderer Bedeutung. Es bleibt aber nach meinem Verständnis auch ausreichend Raum für individuelle Umsetzungsund Gestaltungsmöglichkeiten. Sind Patienten, die gewohnt sind, sich den meisten Problemen intellektuell zu nähern, schwierigere Patienten und sind sie schwerer therapierbar? Die kopftrainierten Patienten haben sicher größere Schwierigkeiten, einen direkten Zugang zu ihren Gefühlen zu finden. Andererseits verstehen sie, wenn es gelungen ist, sie zu motivieren, oft rascher, welchen Handlungsbedarf ein Symptom signalisiert. Ihre Lust am Nachdenken kann man nutzen. Diese Patienten arbeiten oft engagiert an der Korrektur ihrer Wahrnehmungen, ihrer kognitiven und emotionalen Bewertungen und sind kreativ beim Durchspielen neuer Verhaltensentwürfe. Kompliziertere Widerstandsphänomene werden aus meiner Sicht durch diese Vorzüge aufgewogen. Qualitätssicherung in der Psychotherapie ist ein wichtiges Thema. In der Suchtbehandlung hat es aus meiner Sicht eine besondere Bedeutung. Wie stellen Sie sich dem? Unser hoher Personalstand, bei dem im Mittel ein Arzt oder ein Psychologe zwei Patienten betreut, sichert z. B. die Strukturqualität unserer Arbeit. Die Ergebnisqualität prüfen wir anhand von Katamnesen. Die frühzeitige soziale Rückbindung unserer Patienten ist uns, auch aus qualitätssichernden Aspekten, sehr wichtig. Schon während des stationären Aufenthaltes wird der Patient durch Belastungserprobungen auf die Zeit nach dem Klinikaufenthalt vorbereitet. Ein Schwerpunkt dabei ist die ambulante Nachsorge über unsere Korrespondenztherapeuten, ein anderer ist der Besuch von Selbsthilfegruppen. Die Zusammenarbeit mit Korrespondenztherapeuten und das Modell der Oberberggruppen hat bereits der Klinikgründer, Prof. Dr. Gottschaldt, initiiert und entwickelt. Wir laden Selbsthilfegruppen zu Informationsveranstaltungen in unser Haus ein, binden die Angehörigen unserer Patienten in Form von Gesprächen in unsere Arbeit ein. In speziellen Fortbildungsveranstaltungen unserer Klinik nutzen viele in der Region tätige psychologische Psychotherapeuten und Ärzte die fast kostenlose Möglichkeit, Wissen zu erwerben. Ich verspreche mir davon eine Qualitätssteigerung auch in der Nachsorge, aber auch bei der Früherkennung suchtkranker Patienten. Aus meiner Sicht wird die Bedeutung der psychologischen Psychotherapeuten in Zukunft noch zunehmen, nicht nur als Vermittler, sondern perspektivisch auch als Überweiser. Die Weichen sind durch das Psychotherapeutengesetz und die Kammerbildungen im Ansatz richtig gestellt. Der Therapieplan eines Patienten kann bei Ihnen täglich sechs oder sieben Stunden unterschiedlicher Therapieformen beinhalten. Sind abhängig Erkrankte in der Lage, dieses Pensum zu bewältigen? Zu uns kommen die Patienten vielfach im intoxikierten Zustand. Entgiftungs- und Motivationsbehandlung sind in unser stationäres Konzept integriert. Das bedeutet, dass wir mit den psychischen Folgen des Stoffgebrauchs, den neuropsychologischen Defiziten des Patienten, konfrontiert sind. Das schränkt die Arbeitsfähigkeit der Patienten am Anfang ein. Wir stellen uns zur Zeit die Frage, ob unsere klar strukturierten und auch größtenteils manualisierten Therapieinhalte nicht öfters wiederholt werden müßten, um so die eingeschränkten Leistungsmöglichkeiten zu kompensieren. Die Konsequenz daraus wäre eine etwas verlängerte Verweildauer von im Mittel etwa 8 Wochen. Therapiedichte als Markenzeichen ginge dabei nicht verloren, könnte aber in der Anfangsphase, in der einige Patienten noch nicht so belastbar und aufnahmefähig sind, etwas zurückgenommen werden. In den Medien hat das Konzept vom "kontrollierten Trinken" ein starkes Echo gefunden. Halten Sie es für realistisch? In den Köpfen auch der von uns behandelten Patienten lebt noch sehr lange der Wunsch, das Trinken kontrollieren zu können. Das halte ich für legitim und nachvollziehbar. Natürlich würde es ein Betroffener vorziehen, nicht abhängig erkrankt zu sein. Wenn wir ein Auseinandergehen der Behandlungsziele feststellen müssen – der Patient will kontrolliert trinken, wir meinen, dass er abstinent leben sollte - geht unser Therapiebündnis zu Ende. Ich vermag nicht zu sagen, ob der z. B. von Prof. Körkel beschriebene Weg funktionieren kann. Ich denke aber, dass der Wunsch nach Kontrolle des Trinkens auch Gegenstand des Gespräche zwischen abstinenzorientierten Therapeuten und Patienten sein darf. Für mich persönlich ist nur eine Abstinenzvornahme eine angemessene Reaktion auf eine Abhängigkeitserkrankung. Ich empfehle das dem Patienten aus meiner Erfahrung heraus, kann aber nicht verhindern, dass er für sich eine andere Zielstellung für möglich und vor allem wünschenswert hält. Für mich geht es bei der ganzen Debatte nicht darum, die Abstinenz als Therapieziel aufzuheben. Menschen, nicht nur Patienten, die in ihre Sucht verstrickt sind, suchen für sich immer nach Kompromissen. Dieser Realität muss ich mich stellen. Wegen der vitalen Bedrohung, die eine sich chronifizierende Abhängigkeitserkrankung für den Patienten darstellt, lehne ich es aber ab, den Patienten bei diesen Versuchen zu begleiten, um so die Realisierbarkeit seines Vorhabens zu überprüfen. Wenn wir über neue Ansätze in der Suchttherapie sprechen, dann möchte ich vielmehr auf die sich entwickelnde Behandlungsvielfalt verweisen: qualifizierte Entgiftungs- und Motivationsbehandlung, Entwöhnungsbehandlung, Rückfallbehandlung, Kriseninterventionen zur Rückfallprophylaxe, Nachsorgebehandlungen. Ich denke, dass man sich künftig noch mehr am individuellen Krankheitsverlauf des Patienten orientieren wird. Für chronifiziert erkrankte Patienten ist sicher eine qualifizierte Entgiftungsbehandlung, ein sich anschließendes Entwöhnungsprogramm mit ambulanter Nachbehandlung und Selbsthilfegruppenbesuch das beste Angebot. Vorstellbar sind aber auch je nach Ausprägungsgrad und Phase der Erkrankung Modelle mit kürzerer stationärer Verweildauer und einem sich anschließenden intensiven ambulanten Behandlungsangebot. Erstrebenswert aus meiner Sicht sind nahtlos miteinander vernetzte Behandlungsbausteine innerhalb eines Behandlungsangebotes für Suchtkranke, die der Patient, wenn er das will, ohne rückfallriskante Wartezeiten in Anspruch nehmen kann. Das Gespräch führte Christa Schaffmann. Dipl.-Psychologin Christina Hempel, Psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin BDP, Oberbergklinik Extertal, Brede 29, 32699 Extertal-Laßbruch Aus: Report Psychologie 3/02 März 2002 Diesen Text finden Sie auch im Internet unter der Adresse www.BDP-Verband.org/bdp/idp/2002-1/01.shtml