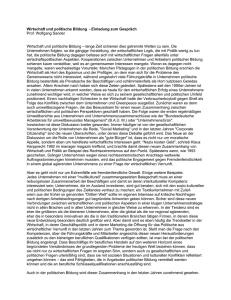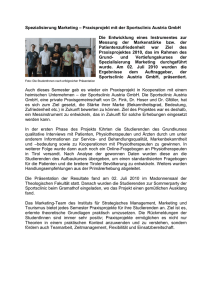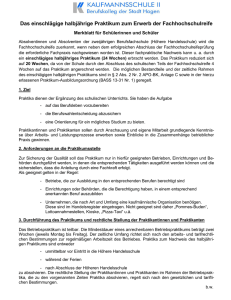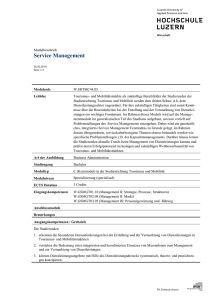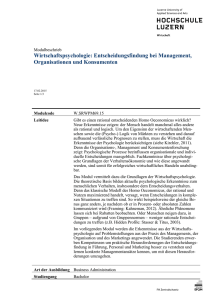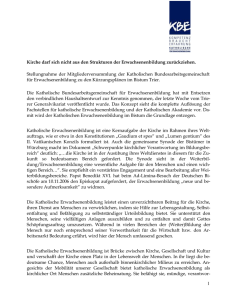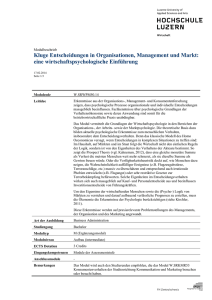Beschreibung der Expertengespräche von Tina Wittmeier
Werbung

1 Beschreibung der Expertengespräche von Tina Wittmeier ExpertInneninterviews – Tina Wittmeier Um mehr über das Selbstverständnis der PädagogInnen sowie über den Wissenstransfer innerhalb der Einrichtungen zu erfahren, wurden mit den Einrichtungen, die innerhalb der Projektlaufzeit Praktika durchführten, ExpertInneninterviews durchgeführt, Insgesamt sind drei Interviews mit vier Personen dokumentiert. 1. Zusammenfassung der Antworten S. 1 2. Interview mit Steffi Rohling, Geschäftsführung VHS-Verband Rheinland-Pfalz S. 6 3. Interview mit Katja Rickert, HPF Abt. Allgemeinbildung, Arbeit & Leben S. 13 4. Interview mit Michael Grunewald & Rudi Imhof S. 19 1. Zusammenfassung der Antworten auf die Fragenkomplexe Berufsbeschreibung und Werdegang Alle Interviewten beschreiben ihre Arbeit als die eines Erwachsenenbildners. Die Berufe der interviewten Personen sind dennoch recht unterschiedlich. So gab es Interviews mit Jugendbildungsreferenten, einer Abteilungsleiterin, einer Verbandsdirektorin und einer Bildungsreferentin. Auch werden in der pädagogischen Arbeit verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Dennoch gibt es immer ein verbindendes Element: es geht um die Ermöglichung von Bildungsprozessen. Weitere Arbeitsschwerpunkte lagen in der Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation von Bildungsveranstaltungen, die sich vornehmlich an Erwachsene richten. Dabei gibt es keine klare Grenze, ab welchem Alter Personen teilnehmen können: auch Jugendliche gehören bei allen Einrichtungen zur Zielgruppe. Je nach Stelle unterscheidet sich die Gewichtung der einzelnen Aufgaben. So lag der Fokus 2 bei einer Stelle mehr im inhaltlichen, finanziellen, rechtlichen Bereich und in der Beratung von Partnereinrichtungen. Ebenso unterschiedlich wie die Beschreibungen der einzelnen Arbeitsfelder sind auch die Werdegänge der interviewten Personen. Dabei reicht die Bandbreite von der Ausbildung nach dem Hauptschulabschluss mit späterem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und anschließendem Studium bis zu recht geradlinigen Berufswegen. Auffallend ist jedoch, dass keine der interviewten Personen lediglich eine Qualifikation aufweist. Vielmehr haben alle mehrere Ausbildungsschwerpunkte, mehrere Zusatzqualifikationen oder Studienabschlüsse. Von diesen meist recht unterschiedlichen beruflichen Herkünften profitieren die meisten auch heute noch in ihrer pädagogischen Arbeit. Die Besetzung ihrer heutigen Stelle sehen die Interviewten als eine Mischung aus Planung und Zufall. So haben sich manche schon recht früh für den Beruf des Erwachsenenpädagogen entschieden, sind aber eher per Zufall zu ihrer Spezialisierung gekommen. Oder sie waren in völlig anderen Bereichen tätig, bevor sie sich dann ihren heutigen Berufsweg eingeschlagen haben. Voraussetzungen für die Arbeit in der jeweiligen Institution Je nach Institution variiert die Gewichtung des Fachwissens, das neue Mitarbeitende mitbringen müssen. Dabei reicht die Bandbreite von „Fachwissen ist von Vorteil“ bis hin zu „Fachwissen bzw. fachliche Verbundenheit ist ein absolutes Muss“. Bei allen Beteiligten wurde dies ergänzt durch fachübergreifende Kompetenzen, wie die Bereitschaft, sich auch auf Themen einzulassen, die nicht dem eigenen Schwerpunkt entsprechen. Neben diesen wurden auch spezielle pädagogische Kompetenzen gefordert. Hier nannten alle Beteiligten als Voraussetzung, dass man sich auf die Teilnehmenden und unterschiedliche Zielgruppen einlassen und auf diese eingehen können muss. Einzelnennungen erhielten Reflexionskompetenz, Sensibilität für Gruppenarbeit, Methoden- und Moderationskompetenz. Darüber hinaus wurden auch Voraussetzungen genannt, die nicht spezifisch für die Pädagogik sind. Dazu gehören betriebswirtschaftliche und interkulturelle 3 Kompetenzen, Interesse, Verlässlichkeit, Umgang mit dem PC; Teamfähigkeit oder Mobilität. Einen Spezialfall stellt die Forderung nach einem christlichen oder zumindest humanistischen Menschenbild dar. Dies ist der „Firmenphilosophie“ geschuldet und variiert daher von Einrichtung zu Einrichtung. Welche Kompetenzen wurden bereits im Studium erlernt, und welche mussten zusätzlich angeeignet werden? Diese Frage scheint schwierig zu beantworten zu sein. Meist konnte nicht genau differenziert werden, woher man welche Kompetenzen besitzt. Im Studium der Pädagogik wurden vor allem Grundkompetenzen erlernt, auf die dann im Berufsleben aufgebaut werden konnte. Dabei unterscheiden sich die Studienorte deutlich voneinander. Je nach Schwerpunkt und Angebot der Hochschule wurden Grundlagen in Konfliktmanagement, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Organisationskompetenzen, Moderationstechniken, Zeitmanagement, Projektmanagement oder Beratungskompetenzen theoretisch erlernt. Die praktische Anwendung fand dann meist erst im späteren Berufsleben statt, wo diese Kompetenzen dann erweitert und vertieft werden konnten. Desweiteren hatten manche Interviewpartner durch die Hochschule die Möglichkeit, während des Studiums Zusatzqualifikationen zu erwerben, die ihnen dann sowohl im Studium als auch in der späteren beruflichen Tätigkeit geholfen haben. Ausnahmen bilden im pädagogischen Bereich diejenigen, die ein bestimmtes Fach studiert haben, und nun in diesem Feld arbeiten. Diese haben vornehmlich Fachwissen aus ihrem Studium mitgenommen und sich die pädagogischen Kompetenzen über Zusatzqualifikationen und Weiterbildungen erworben. Professionalität Alle Interviewten empfinden sich in ihrer Arbeit als professionell, jedoch mit sehr unterschiedlichen Argumenten. Dies hängt weitestgehend von der jeweiligen Arbeitsaufgabe ab. 4 So wurde Professionalität unter anderem als Fähigkeit, systemisch zu denken und eine pädagogische Haltung zu haben, beschrieben. Eine weitere Definition war, dass die Arbeit ernst genommen wird, man bereit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und in ein größeres Netzwerk eingebunden ist. Oder auch: seine Arbeit zu können und die dafür notwendigen Fähigkeiten zu besitzen. Desweiteren wurde Professionalität beschrieben als Fähigkeit, an alles mit einem ganzheitlichen Blick heranzugehen. Weitere genannte Elemente von Professionalität waren gelungene Organisation des Arbeitsalltags, Zuverlässigkeit, Auftreten, Methodenvielfalt, auf Rahmenbedingungen angemessen reagieren können und Themen zielgruppengerecht aufzuarbeiten. Weitergabe der eigenen Kompetenzen In allen Einrichtungen wird sowohl mit neuen Mitarbeitenden als auch mit PraktikantInnen großen Wert auf Gespräche gelegt, die Möglichkeit zur Information und Reflexion geben. Diese finden zum Teil regelmäßig, aber auch nach Bedarf statt. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Praktika gibt es immer zwei Komponenten: zum einen wird geschaut, welche Aufgaben in der Einrichtung anstehen, zum anderen aber auch, welche Kompetenzen und Interessen die/der PraktikantIn mitbringt. Darauf aufbauend werden dann die konkreten Aufgaben ausgearbeitet. Hierbei achten alle Einrichtungen darauf, dass zumindest ein Teil der Aufgaben, z.B. im Rahmen eines eigenen kleinen Projektes, möglichst selbstständig erledigt wird. Dabei werden die PraktikantInnen jedoch nicht allein gelassen; die PraxisanleiterInnen stehen für Fragen zur Verfügung und geben Tipps, nützliche Informationen (bspw. über Abläufe) oder Erklärungen. Voraussetzung für die selbstständige Arbeit ist u.a. die transparente Gestaltung von Abläufen und Zuständigkeiten. Dies soll den PraktikantInnen ermöglichen, eigene Erfahrungen zu sammeln, aber auch beispielhaft bestimmte Abläufe oder Inhalte kennen zu lernen, damit diese dann später auf andere Bereiche übertragen werden können. Dieses Konzept wird zum Teil auch bei neuen Mitarbeitenden eingesetzt, um deren Erfahrungsschatz zu erweitern. Wichtig war ebenfalls in allen Einrichtungen, dass die/der PraktikantIn Einblicke in die alltägliche Arbeit der betreuenden Person sowie einen „Gesamtblick“ der Institution bekommt. Zu diesem Zweck begleiten die PraktikantInnen die 5 PraktikumsanleiterInnen zu verschiedenen Terminen, Sitzungen oder MitarbeiterInnenrunden. Letzteres auch deshalb, damit beide Parteien – PraktikantIn und Mitarbeitende – sich gegenseitig kennen lernen und eine Einbindung in das Team vorgenommen wird. Auch bei neuen Mitarbeitenden gibt es diese „Begleitelemente“, bei denen die „neuen“ bspw. die Möglichkeit haben, neue Methoden zu erlernen. Zum Teil wird den PraktikantInnen auch die Möglichkeit geboten, ihre an der Universität theoretisch erlernten Inhalte sowie Interessen und Hobbies in die Gestaltung der Praktika einzubringen, indem sie bspw. eine eigene Veranstaltung konzipieren und durchführen oder versuchen, diese Themen zielgruppengerecht aufzuarbeiten. Unterstützung durch die Institution Zunächst einmal lässt sich sagen, dass in allen Einrichtungen, aus denen Personen befragt wurden, die Weitergabe von Wissen und Kompetenzen unterstützt wird. Zumeist geschieht das in eher passiver Weise, indem die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, sich für neue Mitarbeitende oder PraktikantInnen Zeit zu nehmen. Darüber hinaus unterstützen häufig die KollegInnen die betreuende Person in ihren Vorhaben oder stellen sich als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. Die PraktikantInnen haben zum Teil auch die Möglichkeit, andere Mitarbeitende in ihrem beruflichen Alltag oder in ihren Veranstaltungen zu begleiten, so dass sie einen besseren Einblick in die gesamte Arbeit der Institution oder andere Arbeitsbereiche bekommen. Wichtig ist in diesen Einrichtungen, dass das gesamte Team hinter der Entscheidung für eine/n Praktikant/in steht. Auch bei neuen Mitarbeitenden wird es als wichtig angesehen, dass diese die Möglichkeit haben, sich mit der/dem „alten“ Mitarbeitenden auszutauschen, bevor diese geht. Dafür gibt es in einer Einrichtung eine Überlappungszeit, in der systematische Gespräche mit beiden Mitarbeitenden sowie der Leitung stattfinden, um die Einarbeitung optimal zu gestalten. Darüber hinaus wird großen Wert auf möglichst schnelle und gute Integration – fachlich und persönlich – der/der neuen Mitarbeitenden gelegt. 6 Beitrag der neuen KollegInnen/PraktikantInnen zum Wissenstransfer Eine wichtige Voraussetzung für den Wissenstransfer sehen alle Beteiligten in der Neugierde und Offenheit von Seiten der neuen KollegInnen bzw. PraktikantInnen. Darüber hinaus erwarten sie, dass diese sich aktiv einbringen und ihre Gedanken und Erfahrungen mitteilen. Dazu gehört auch der Außenblick, den diese nur relativ kurz nach ihrem Einstieg in die Einrichtung besitzen. Um diesen einbringen zu können, ist außerdem noch Kritikfähigkeit und ein gewisses Selbstbewusstsein vonnöten. Zudem wurde die Passung von neuer/m KollegIn bzw. PraktikantIn und der interviewten Person genannt. Gewünscht werden von fast allen Interviewten Informationen über Lehrinhalte und Schwerpunkte der Universität. Auch über theoretische Inhalte und neue Methoden informiert zu werden, wurde hier genannt. Weitere Wünsche an PraktikantInnen waren zum einen Impulse für die Netzwerkarbeit und die Herstellung von Kontakten, praktische Erfahrungen und die Rückmeldung über Wünsche, Ziele und Motivation hinsichtlich des Studiums. Zudem wurde erwähnt, dass es schön wäre, wenn die Studierenden von Seiten der Universität auf das System vorbereitet würden, damit diese sich etwas darunter vorstellen können, wenn sie in das Praktikum kommen. Was würden Sie den Studierenden mitgeben, damit diese sich auf die Ausübung des erwachsenenpädagogischen Berufs optimal vorbereiten können? Alle Interviewten raten den Studierenden dazu, so viele Praxiserfahrungen wie möglich zu sammeln. Dabei ist es unerheblich, ob diese im Rahmen von Praktika, Nebenjobs oder Ehrenamt gesammelt werden. Wichtig ist dies auch für Bewerbungen, da spätere Arbeitgeber (darunter auch die Einrichtungen der InterviewpartnerInnen) großen Wert auf praktische Erfahrungen und Engagement – auch schon während des Studiums – legen. Zudem sollen die Studierenden sich über die eigenen Interessen und Schwerpunkte klar werden. Nur so können diese schauen, wo sie sich und ihre Fähigkeiten einbringen und erweitern können. Wenn diese klar sind, wird den Studierenden geraten, sich dahingehend zu spezialisieren und somit einen Zusatznutzen für 7 spätere Arbeitgeber (z.B. hinsichtlich Methodenkompetenz oder Fachwissen) generieren, aber auch über eine Engführung hinaus zu kommen, indem man sich nicht nur auf ein Gebiet beschränkt. Die PraxisvertreterInnen raten außerdem den Studierenden, großen Wert auf Vernetzung zu legen, da diese den späteren Berufseinstieg deutlich erleichtern kann. Diesbezüglich wurden persönliche Kontakte aufbauen und pflegen, aber auch die Mitgliedschaft in einem Verband erwähnt. Genannt wurden auch Auslandserfahrungen, in denen die Studierenden ihre Sprachund kulturelle Kompetenz erweitern und den späteren Arbeitgebern aufzeigen können, dass sie flexibel sind und sich auf Neues einstellen können. Zudem wurde genannt, dass die Studierenden darauf achten sollten, wie viele und vor allem welche Daten sie im Internet veröffentlichen, da spätere Arbeitgeber diese evtl. überprüfen. Außerdem wird den Studierenden geraten, selbstbewusst mit dem eigenen Wissen und Können umzugehen, da Pädagogen sehr gut ausgebildet sind. 2. Expertinneninterview – Steffi Rohling Evaluation der Einrichtungen im Rahmen des Projektes „Theorie-PraxisTransfer“ – VVHS Steffi Rohling Teil A: Fragen nach dem Selbstverständnis, der eigenen Professionalität und dem Werdegang 1. Wie würden Sie Ihren derzeitigen Beruf beschreiben? Was hat er mit Erwachsenenbildung zu tun? Ich bin Verbandsdirektorin des Verbandes der Volkshochschulen von RheinlandPfalz. Meinen Beruf würde ich folgendermaßen beschreiben: Ich bewege mich auf drei Ebenen. Zum einen habe ich eine inhaltliche Aufgabe, zum anderen habe ich finanzielle Aufgaben und zum dritten habe ich Aufgaben, die Rechtsfragen betreffen. Meine Arbeit ist die eines Erwachsenenbildners, sie hat ausschließlich mit Erwachsenenbildung zu tun. Ich arbeite inhaltlich in den Bereichen der Erwachsenenbildung, beschäftige mich mit den Rahmenbedingungen der Erwachsenenbildung, muss auf alle Fragen, die mir die Mitgliedseinrichtungen unseres Verbandes stellen, die ja in der Erwachsenenbildung arbeiten, antworten können, ich muss konzeptionell und systematisch arbeiten. 2. Wie sind Sie zu Ihrem derzeitigen Beruf gekommen? Erzählen Sie von Ihrem Werdegang. 8 Ich bin von Haus aus Erziehungswissenschaftlerin und habe Erwachsenenbildung im Schwerpunkt studiert. Von daher gab es schon von Anfang an eine Ausrichtung in dieses Feld. Ich habe mich schon in meinen Praktika sehr stark im Bereich der öffentlichen Weiterbildung aufgehalten. Mein erstes Praktikum absolvierte ich bspw. in einer Kreisvolkshochschule. Ich habe auch lange beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) gearbeitet: das war mein erster Einstieg, um auch einen Überblick zu bekommen, in einer Institution, die nicht nur lokal bzw. kommunal arbeitet, sondern bundesweit agiert. Dort habe ich einen Einblick bekommen in Strukturen, Anbieter, Politik etc. bundesweit. Ich habe dann aber auch einen Exkurs in die Wirtschaft gemacht, habe ein halbes Jahr bei Daimler Chrysler im Rahmen eines Praktikums gearbeitet, um den Unterschied kennen zu lernen. Danach habe ich mich relativ bewusst für den öffentlich geförderten Weiterbildungsbereich entschieden. Ich habe dann im Bereich der Schulabschlusskurse bei einem freien Träger einen Hauptschulabschlusskurs sozialpädagogisch geleitet und begleitet und bin nach meinem Studium im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium im Bereich der allgemeinen Weiterbildung tätig geworden, habe dies dann fünf Jahre lang gemacht. Das war für mich auch ein „Kalteinstieg“, ich wusste nicht, was da so richtig auf mich zukommt. Aber das Ministerium hat mir einen sehr guten Einblick dahinein geben, wie Weiterbildung, Finanzierung, politische Systeme funktionieren und was Weiterbildung mit Politik zu tun hat. Ich glaube, dass eine solche Institution einem eine sehr gute Möglichkeit bietet, in einem bestimmten Feld Generalist zu werden. Darüber hinaus hatte ich dort auch die Möglichkeit, viele verschiedene Institutionen kennen zu lernen. Danach habe ich intern in ein anderes Referat gewechselt, was dann gar nichts mehr mit der Weiterbildungsstruktur der allgemeinen Träger zu tun hatte, nämlich in den Bereich der frühkindlichen Förderung. Ich habe dort zwei Jahre lang ein Fortbildungssystem für Erzieherinnen mitaufgebaut. Dort habe ich allerdings gemerkt, dass mein Herz für die Erwachsenenbildung schlägt und ich gerne wieder zurück in die allgemeine Weiterbildung möchte. Manchmal geschehen solche Zufälle im Leben, es lässt sich nicht alles systematisch planen. So war diese Stelle im Verband ausgeschrieben, um die ich mich dann beworben habe. Ein Berufsweg ist somit eine Mischung aus der eigenen Entwicklung, den eigenen Zielen und Vorstellungen einerseits und vielen Zufällen andererseits. Ich hätte theoretisch auch ganz woanders landen können. Nebenbei habe ich noch zwei Zusatzausbildungen gemacht. Das kann ich sehr empfehlen, da es mir sehr viel gebracht hat in meiner beruflichen Entwicklung. Ich habe eine gruppendynamische Zusatzausbildung und eine Zusatzausbildung in der systemischen Beratung absolviert. Bei solchen Themen lernt man viel für sich, auch und vor allem Schlüsselkompetenzen, die man später sehr gut gebrauchen kann, wenn man bspw. eine Leitungsfunktion hat. Ein weiterer wichtiger Part meiner Berufsbiografie ist, dass ich eineinhalb Jahre im Ausland war, ein Jahr vor und ein halbes Jahr nach meinem Studium. Auch das hat mir geholfen, einen Weitblick zu bekommen und meine Sprachkompetenzen zu erweitern. Das war noch mal ein wichtiger Schritt, sich einfach etwas zu trauen, sich mit anderen Ländern und Kulturen auseinanderzusetzen. Ich finde, meine Berufsbiografie ist für eine Absolventin bzw. einen Absolventen der Erwachsenenbildung ganz normal. Wir sind alle Generalisten, zugleich aber auch Spezialisten. Wir kennen uns sehr gut im Weiterbildungsbereich aus, der aber so 9 vielfältig ist, so dass wir wiederum in bestimmten Bereichen Spezialisten sind. Für Außenstehende bin ich vielleicht der Weiterbildungsspezialist, aber in der Weiterbildung bin ich eher die Generalistin. Durch meine Einblicke in die verschiedenen Bereiche kann ich mich nun gut in diese hineinversetzen, bspw. durch meine Arbeit bei den Schulabschlusskursen weiß ich nun sehr konkret, was die Arbeit bedeutet, und kann dies dann auch in den Bereich einbringen, in dem wir auch hier in unserem Haus arbeiten. Daher finde ich es wichtig, eigene praktische Erfahrungen zu sammeln, da einem diese Bereiche dann stärker ans Herz wachsen und man sich besser hineinversetzen kann. Natürlich geht das nicht in allen Bereichen, aber dafür arbeitet man dann ja auch in einer Institution mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und Themenschwerpunkten. 3. Welche speziellen Voraussetzungen muss man mitbringen, um in Ihrer Institution arbeiten zu können? Grundsätzlich gilt für die Erwachsenenbildung, dass man zwei wesentliche Kompetenzen braucht: man braucht einen Inhalt, ein Fachwissen, aber auch das systemische, politisch-strategische Denken. Wenn wir jemanden neu einstellen, dann bringt die-/derjenige meist eine dieser Kompetenzen mit. Dann muss man schauen, in wie weit die Person Kompetenzen im anderen Bereich hat oder sie sich aneignen kann. Eine weitere Kernkompetenz ist die Reflexionskompetenz. Gerade in unserem Beruf ist sie wichtig, da man es immer mit verschiedenen Systemen zu tun hat. Man muss sich nicht nur in das Gegenüber hineinversetzen können, sondern dadurch, dass wir selbst Multiplikatoren sind und es mit Multiplikatoren zu tun haben, muss man immer die gesamte Kette mitdenken: was macht die Einrichtung damit, die sich wiederum mit den Teilnehmenden beschäftigt. Die Kernkompetenzen liegen also in den beiden Bereichen: fachlich und überfachlich. 4. Welche Kompetenzen haben Sie aus Ihrer Ausbildung bereits mitgebracht und welche mussten Sie sich zusätzlich aneignen? Wodurch haben Sie diese erlernt? In der Ausbildung wird für viele Dinge ein Grundstein gelegt. Dadurch dass man sich selbst den roten Faden suchen muss, muss man lernen, Dinge, aber auch sich selbst zu organisieren. Die Seminare waren so ausgelegt, dass sie einen hohen reflexiven Anteil hatten, dass sie einen dahingehend unterstützt haben, eine pädagogische Haltung zu entwickeln. Im Studium wurde auch sehr stark gefördert und gefordert, sich in andere hineinversetzen zu können, Dinge zu hinterfragen, sich mit Zielgruppen auseinanderzusetzen, oder auch Konzepte zu entwickeln. Diese Kompetenzen halte ich auch für absolut notwendig, um später in unserem Beruf erfolgreich arbeiten zu können. Im Studium hat man zwar noch nicht viele praktische Erfahrungen, aber man setzt sich mit Themen wie Konfliktmanagement, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit auseinander. Im Beruf ist das dann auch ein lebenslanges Training, man hat die Möglichkeit, sich auch wieder mit diesen Kernkompetenzen zu professionalisieren. Die Kompetenzen, die im fachlichen Bereich liegen, habe ich in der Arbeit erworben, wie rechtliche und finanzielle Fragestellungen, Verstehen des politischen Systems, Fragen wie „wie funktioniert ein Haushalt“ oder auch „wie funktioniert eigentlich Landesfinanzierung“. Hierbei ist es vor allem wichtig, das System zu verstehen. 5. Würden Sie sich als "professionell" hinsichtlich Ihres derzeitig ausgeübten Berufes beschreiben? Warum / Warum nicht? Auf jeden Fall würde ich mich als professionell beschreiben. Wenn ich nicht professionell in meinem Feld arbeiten würde, könnte ich meinen Job nicht machen. 10 Ich bin professionell, weil ich die bereits beschriebenen, für meine Arbeit notwendigen Dinge kann. Wichtig ist dabei vor allem, systemisch Denken zu können und eine pädagogische Haltung zu haben. Teil B: Fragen nach der Institution und dem Wissenstransfer innerhalb dieser 6. Wie können Sie selbst die Ihnen wichtigen Kompetenzen an jüngere KollegInnen weitergeben? Aktuell habe ich beispielsweise einen Mitarbeiter, der noch relativ neu ist, der von dem Fach ist, für das er eingestellt wurde. Hier ist mein Bestreben, ihn sukzessive zu sensibilisieren, in welchem System er sich befindet. Die fachlichen Kompetenzen sind vorhanden, die Netzwerke, in welchen wir arbeiten, die Kooperationspartner, die wir haben, das politische System, in dem wir uns befinden, muss er kennen lernen. Mir ist es wichtig, diesen eingangs erwähnten Dreiklang zwischen inhaltlichen, finanziellen und rechtlichen Fragestellungen auch an die Mitarbeitenden oder auch PraktikantInnen weiterzugeben. Vielleicht ist es auch hier das Ganzheitliche, das man immer auch den Blick auf die verschiedenen Bereiche haben muss. Das versuche ich weiterzugeben. Im Rahmen des Praktikums werden hierzu Gespräche geführt: so gibt es Nachbereitungsgespräche, in denen bspw. Veranstaltungen analysiert werden. Ergänzend dazu gibt es Erklärungen, wenn etwas unklar geblieben ist. Eigentlich wird alles beispielhaft erarbeitet: als „Trockenübung“ wird ein Haushalt detailliert angeschaut oder ein Gesetz und das dann reflektiert und ausgewertet. Mit neuen Mitarbeitenden ist das Ganze etwas „krasser“: diese werden sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ich glaube auch, dass das eine Frage der Routine oder des Trainings ist. Wenn man die Sachen einmal exemplarisch bearbeitet und das Prinzip verstanden hat, kann man diese Erkenntnisse und Erfahrungen auf andere Bereiche anwenden oder ähnliche Gegebenheiten übertragen. So wird man dann auch zum Profi auf seinem Gebiet. 7. Werden Sie dabei von Ihrer Institution unterstützt? Ich bin selbst für die Rahmenbedingungen verantwortlich, die wir hier haben. Aber eine der Rahmenbedingungen ist auch, dass ich weiß, dass so etwas von unserem Vorstand grundsätzlich unterstützt wird. Was wir gemacht haben, ist, dass wir das Thema im Kreis der Pädagogischen Mitarbeiter/innen besprochen haben. Dabei haben wir abgesprochen, dass jede/r mit unserer Praktikantin ein Setting ausmacht, sie zu Terminen mitnimmt, damit sie auch die Möglichkeit hat, in verschiedene Bereiche hineinzuschauen. So hat sie einen konkreten Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche. Es ist dadurch systematisiert, dass wir gemeinsam im Gespräch sind, wie wir sie einbinden. Von unserer Seite gibt es ein Angebot, was die Praktikantin/der Praktikant alles wahrnehmen kann, von Seiten der Praktikantin/des Praktikanten muss dann aber auch die Entscheidung kommen, was sie/er mitnehmen möchte und was nicht. Wenn feststeht, dass wir wieder eine Praktikantin/einen Praktikanten haben, teile ich dies allen mit, aber auch wie ich mir den Umgang vorstelle, dass jede/r auf sie/ihn zugeht, etwas mit ihr/ihm ausmacht, und gleichzeitig wird mitgeteilt, dass dies dann auch Thema unserer nächsten Besprechung ist. Wir haben zwei Besprechungsformen: zum einen die Besprechung mit allen Pädagogischen Mitarbeiter/innen, zum anderen die Gesamtmitarbeiterbesprechung. Das Praktikum 11 wird dann in beiden Runden besprochen, zum Teil auch in Anwesenheit der Praktikantin/des Praktikanten. Bei Bedarf wird das Praktikum erneut auf die Themenliste der Runden gesetzt. Die Mitarbeitenden klären größere Aufgaben für die Praktikantin/den Praktikanten zunächst mit mir ab, bevor sie auf die Praktikantin/den Praktikanten zugehen. In diesem Sinne ist das Praktikum bei uns institutionalisiert und auch transparent gestaltet. Bei der Einführung von neuen Mitarbeitenden versuchen wir, immer eine Überlappungszeit zwischen der „alten“ und der neuen Person zu haben. Bisher ist uns das immer gelungen. In dieser Zeit werden auch mit mir systematische Gespräche geführt, um die Einarbeitung der neuen Person optimal zu gestalten. In den Gesprächs- und Mitarbeiterrunden ist dann auch Raum für die/den Neue/n. Ich selbst unterstütze die Mitarbeitenden dabei. Mir ist das sehr wichtig, da wir hier elf Personen sind, die miteinander arbeiten, da kommt es auf jede/n einzelne/n an. Ich habe ein hohes Interesse daran, dass eine neue Person schnell und gut integriert wird, und das nicht nur fachlich sondern auch persönlich, da logischerweise Personen, die sich wohler fühlen, auch besser arbeiten. Gerade zu Anfang führe ich daher auch mit der neuen Person Gespräche darüber, wie es ihr/ihm geht, wie sie/er angekommen ist, wie es dieser Person bei uns geht. 8. Was sollen die neuen KollegInnen von ihrer Seite aus zum Wissenstransfer beitragen? Anfänglich hat man noch den Blick von außen auf die Einrichtung. Es dauert nicht lange, bis dieser verloren geht. Gerade daher ist die Anfangszeit sehr interessant, da dort Fragen gestellt werden, wie z.B. warum man das so macht und nicht anders. Wenn man als Leitung klug ist, nimmt man diese Fragen sehr ernst. Meist steht hinter diesen Fragen eine Berechtigung. Bei unserem neuen Mitarbeiter konnten wir bspw. eine Frage im Rahmen unseres Fortbildungsangebotes nicht plausibel beantworten, so dass wir als Folge dann etwas verändert haben. Für die Institution bietet dieses Hinterfragen auch immer eine Chance, wenn man es versteht, sie als solche zu nutzen. Man muss damit selbstbewusst umgehen können. Somit erwarte ich mir von neuen KollegInnen Neugier, Offenheit, aber auch Kritikfähigkeit und dass sie ihren Blick von außen einbringen. Bei der Auswahl einer Praktikantin/eines Praktikanten ist es wichtig, dass der Mensch zu der Institution passt und dass man „einen Draht zueinander“ hat. Das ist zunächst ein sehr menschlicher Zugang. Ein Praktikum ist immer ein Lernfeld, weshalb aus meiner Sicht keine zu hohen Erwartungen gestellt werden sollten Schön wäre es, wenn die Person bereits praktische Erfahrungen sammeln konnte. Ich schaue mir den Lebenslauf auch dahingehend an, ob die Person engagiert ist, also ob sie Nebenjobs hat oder bereits ein Praktikum absolviert hat. Dann ist noch wichtig, wie die Person im Erstgespräch auftritt, zeigt sie Interesse oder Neugier? Hier wird vor allem auf Schlüsselqualifikationen geschaut, wie Offenheit, Kommunikationsfähigkeit oder auch Verbindlichkeit. Ich muss auch sagen, dass ich nicht jede/n nehmen würde. Wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht geht, oder die Person sich nicht engagiert, würde ich auch sagen, dass das nicht funktioniert. Für ein Praktikum kommen für uns in der Regel Studierende im Hauptstudium in Frage. Damit ist dann eine Haupt-Voraussetzung erfüllt, nämlich dass die/der Studierende bereits etwas mit Erwachsenenbildung zu tun hatte, etwas darüber gehört und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das an der Universität 12 erworbene Wissen kann dann bspw. im Rahmen eines kleinen Projektes eingebracht werden, von dem beide Seiten profitieren, und auf das die Studierenden dann vielleicht in ihrer Diplomarbeit zurückgreifen können. Von Seiten der Universität ist es natürlich schön, wenn diese auf ein solches System vorbereitet, damit die Studierenden sich etwas darunter vorstellen können. Das ist natürlich kein Ausschlusskriterium. Von unserer Seite ist mir eher wichtig, dass wir von uns aus etwas mitgeben können. Teil C: Ausblick, Anregungen, Vorschläge 9. Was würden Sie den Studierenden von heute mitgeben, damit diese sich auf die Ausübung des erwachsenenpädagogischen Berufs optimal vorbereiten können? Ich finde es wichtig, dass die Studierenden mehr machen als nur ihr Pflichtpraktikum. Das Diplom ist sozusagen die Eintrittskarte, wenn wir jemanden einstellen, aber wir klopfen einen Lebenslauf auch dahingehend ab, was für Institutionen darauf stehen. Deshalb ist es immer gut, wenn zwei, drei Praktika gemacht wurden, oder nebenher gearbeitet wurde. Dabei ist es auch egal, ob die Sachen etwas miteinander zu tun haben. Man macht sich selbst ein Bild davon, ob jemand interessiert, engagiert war oder sich für etwas eingesetzt hat. Zudem kann ich sehr empfehlen, ins Ausland zu gehen. Man zeigt damit auch, dass man flexibel ist, dass man sich auf etwas Neues einstellen kann, offen für so etwas ist, dass man sich sprachliche Kompetenzen angeeignet hat. Außerdem bin ich Mitglied im BV-Päd., dem Berufsverband der Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler e. V., und kann das den Studierenden nur empfehlen. Der Jahresbeitrag beträgt für Studierende 35 €. Ich kann nur empfehlen, hier Mitglied zu werden, da es eine wirklich gute Form der Vernetzung ist. Der BV-Päd. macht Jahrestagungen, bietet Beratung an, eine Praktikums-Börse und vieles mehr. Vernetzung ist auch ein wichtiges Thema, also auch Kontakt zu halten zu den Praktikumsstellen. Irgendwann ist man mit dem Studium fertig und sucht einen Job. Wir wissen alle, dass Kaltbewerbungen schwierig sind. Daher ist es umso wichtiger zu wissen, wen man fragen kann. Außerdem würde ich den Studierenden raten, sehr selbstbewusst mit dem, was sie gelernt haben, in die Berufswelt zu gehen. Wir als Pädagogen sind sehr gut ausgebildet. 10. Haben Sie weitere Anregungen oder Vorschläge hinsichtlich des Wissenstransfers? Mir haben die Lernräume viel Spaß gemacht und sie haben mir auch viel gebracht, auch für uns als Institution, einfach auch vor dem Hintergrund, sich noch einmal der Rolle bewusst zu werden, dass es auch unsere Aufgabe ist, an die nächste Generation Wissen weiter zu geben. Durch das Projekt ist das dann ziemlich plastisch geworden. In den Lernräumen wurde deutlich, dass die Diskussionen immer sehr intensiv und sehr interessant waren. Daher würde ich mich dafür aussprechen, dies beizubehalten. Vorsichtig wäre ich bei Fragen, die in die ganze Runde gestellt werden, da man damit dann evtl. auch hierarchische Verhältnisse berührt. Dann wird es schwierig, offen zu reden. 13 Insgesamt fand ich es immer klasse, auch für das Thema einmal einen Raum zu haben, zu reflektieren. Ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die die Universität mittel- und langfristig managen muss. Ich finde es grandios, dass die ELAG das zusammen mit der Universität angestoßen hat, dass die ELAG sich hierbei so engagiert hat. Dafür sind wir Landesorganisationen der ELAG auch zu Dank verpflichtet, da es auch eine Arbeit ist, von der alle profitieren. Aber mittel- und langfristig ist es eine Aufgabe der Universität, das Netzwerk zu halten und systematisch in diese Richtung weiter zu arbeiten. Ich habe so etwas in meinem Studium in Marburg erlebt, wo die VertreterInnen der Institutionen immer wieder an die Universität kamen und sich und die Einrichtungen vorgestellt haben. Somit waren die Einrichtungen unter den Studierenden bekannt. Die VertreterInnen hatten regelmäßigen Kontakt zur Universität und wurden in gewissen Zyklen angeschrieben und eingeladen, sich im Rahmen der Institutionenanalyse vorzustellen. So wurde das von Seiten der Universität sehr systematisch gepflegt. Zudem gab es eine Person, die nicht nur für den Kontakt zuständig war, sondern auch im Hauptstudium Besuche in den Einrichtungen organisierte. Diese Frau war auch für die Beratung zum Praktikum zuständig, wenn jemand Fragen oder Probleme hatte. Zudem vernetzte sie die Studierenden untereinander, damit diese sich über Praxiserfahrungen austauschen konnten. So etwas wäre natürlich für alle Universitäten wünschenswert. 3. Expertinneninterview – Katja Rickert Evaluation der Einrichtungen im Rahmen des Projektes „Theorie-PraxisTransfer“ – Arbeit & Leben Katja Rickert Teil A: Fragen nach dem Selbstverständnis, der eigenen Professionalität und dem Werdegang 1. Wie würden Sie Ihren derzeitigen Beruf beschreiben? Was hat er mit Erwachsenenbildung zu tun? Ich bin Abteilungsleiterin der Abteilung Bildung und damit zuständig für alle Bildungsangebote, die Arbeit & Leben offen ausschreibt und in Kooperation durchführt. Diese Angebote stehen allen thematisch Interessierten zur Verfügung und werden teilweise in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie Gewerkschaften, Schulen, Verbänden oder Interessensgruppen durchgeführt. Wir sind für die außerschulische politische Bildung zuständig, und damit auch für die Organisation, Planung, Durchführung und inhaltliche Entwicklung von Seminaren, die in diesem außerschulischen politischen Bereich national und international stattfinden. Das beginnt bei der Akquise von Fördergeldern auf Bundes- oder Landesebene für die jeweiligen inhaltlichen Seminare, geht über die Konzeptentwicklung bis hin zu den Abrechnungsmodalitäten oder die Betreuung von ReferentInnen, wenn man selbst nicht das Seminar durchführt. Unsere Zielgruppe besteht aus den Personen, die sich persönlich politisch, oder fachlich weiterbilden möchten. Dabei nutzen wir als Arbeit & Leben die Möglichkeit der Bildungsfreistellung. Unsere Angebote stehen nicht nur Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter offen: je nach Veranstaltung sprechen wir auch spezielle Zielgruppen wie Jugendliche oder Personen im Ruhestand an. 14 Die Abteilung Bildung, in der ich arbeite, ist relativ klein. Sie besteht aus einer Seminarverwaltung, einer pädagogischen Mitarbeiterin, und kontinuierlich PraktikantInnen. Daher ist man als Abteilungsleiterin bei vielen Dingen auch im Detail involviert, auch wenn man sonst mit ganz vielen anderen Gesamtorganisationsentwicklungsmaßnahmen vertraut und in diese eingebunden ist. Die detaillierte Einbindung in alle Phasen, von der Planung bis zur Durchführung, ist meiner Ansicht nach auch wichtig, da man selbst nach Möglichkeit auch weiterhin Seminare durchführen sollte, um nah bei der Zielgruppe zu sein und die direkten Auswirkungen der eigenen Planung sehen zu können. Wobei ich auch sagen muss, dass für den Teil der Durchführung als Hauptamtliche leider recht wenig Raum vorhanden ist, da man doch recht häufig in administrative Aufgaben verwickelt ist. In Prozentzahlen ausgedrückt machen daher die organisatorischen Aufgaben etwa 70% meiner Arbeit aus, also die Planung und Organisation einer Veranstaltung sowie die Kommunikation mit den ReferentInnen bezüglich des Aufbaus, des Inhalts oder auch den Methoden und der Philosophie von Arbeit & Leben, die in den Seminaren vertreten werden soll. Ein Schwerpunkt von Arbeit & Leben sind die offenen Seminare. Wir bieten aber auch viele Seminare in Kooperation an. Dazu müssen diese Kooperationen erst einmal aufgebaut und im Anschluss gepflegt werden. Hierfür sind natürlich auch viele Gespräche nötig, die dann auch zu meinen Aufgaben zählen. In meiner Rolle und Funktion als Abteilungsleiterin bin ich außerdem in die Gesamtentwicklung von Arbeit & Leben auf Organisationsund Personalentwicklungsebene involviert. 2. Wie sind Sie zu Ihrem derzeitigen Beruf gekommen? Erzählen Sie von Ihrem Werdegang. Nach meinem Fachabitur war ich ein Jahr in den USA als Au-Pair. Danach habe ich zunächst zwei Semester Bauingenieurwesen an der Fachhochschule studiert. Mir wurde dann aber klar, dass ich etwas mit Menschen machen möchte. Ich habe dann Diplom-Sozialpädagogik studiert und habe in dieser Zeit ein weiteres Auslandspraktikum in den USA absolviert. Während meines Studiums war mir bereits bewusst, dass ich später mit Menschen arbeiten möchte, die ein gewisses Interesse und Motivation haben, in ihrem Leben etwas zu verändern und dieses zu gestalten. Mir wurde deutlich, dass ich nicht nur in einer Beratungsstelle arbeiten möchte, die Menschen aufgrund eines bestimmten Drucks von anderen Institutionen, wie vielleicht dem Jugendamt, aufsuchen, sondern ich will mit Menschen arbeiten, die eine gewisse Eigenmotivation mitbringen. Somit stand ich vor der Wahl: entweder konzentriere ich mich auf Coaching, auf Trainings, auf Seminare oder ich gehe in die Personal- und Organisationsentwicklung, da in diesen Bereichen, wenn es um berufliche oder persönliche Weiterbildung geht, ein höheres Engagement vorhanden ist. Dementsprechend habe ich dann mein Studium aufgebaut und Schwerpunkte gezielt in der Erwachsenenbildung gesetzt. Ich habe mir überlegt, was ich später für diesen Bereich der Weiterbildung benötige, welches Handwerkszeug ich mir zulegen muss, um in diesem Bereich arbeiten zu können. Ich habe dann während meines Studiums eine Trainerausbildung über knapp drei Jahre absolviert, um mir Know-how in den Bereichen Methoden und Moderation zu erlangen, und um zu lernen, wie ich Menschen dabei unterstützen kann, sich persönlich weiterzuentwickeln. Zudem hatten wir die Möglichkeit, eine Ausbildung als MediatorIn zu machen, die ich dann wahrgenommen habe. Ein weiterer persönlicher Schwerpunkt von mir ist die Natur, da ich finde, dass diese den perfekten Spielraum für Entwicklung bietet. Daher habe ich beschlossen, in den Outdoor-Bereich zu gehen und damit meine beiden 15 Schwerpunkte zu verknüpfen. Dieser bedeutet Arbeiten mit möglichst handlungsorientierten Methoden, die nah an der Gruppe sind. Die Natur bietet gerade in der Arbeit mit Gruppen oder Teams die Möglichkeit, die Menschen recht schnell an ihre Grenzen zu bringen. Dadurch ist man sehr schnell weg von der Außendarstellung hin zu den Emotionen, welche Weiterentwicklung bedeuten. Vor meiner Arbeit bei Arbeit & Leben war ich in der Prävention für Jugendliche beschäftigt. Ich habe beim Jugendamt gearbeitet und hatte dort mit Jugendlichen zu tun, die entweder in ihrer Gemeinde Jugendvertreter waren oder als Jugendleiter gearbeitet haben, und die sich im Bereich des Ehrenamts weiterbilden wollten, um dann in dem entsprechenden Gebiet arbeiten zu können bzw. gezielte Präventionsangebote für Schulen im Bereich Sport, Ernährung, Essverhalten oder Mediation anbieten zu können. Diese Tätigkeiten zwischen selbst Seminare anzubieten und durchzuführen sowie neue inhaltliche Konzepte zu entwickeln, hat mein Repertoire deutlich erweitert. Parallel dazu habe ich über 10 Jahre in der Au-Pair Beratung und Betreuung für die USA gearbeitet. Hier habe ich hauptsächlich junge Frauen in ihrem Entscheidungsprozess und in der Erstellung der Bewerbungsunterlagen unterstützt. Weiterhin hatte ich schon einige Lehraufträge an der Hochschule Fulda im Bereich „Gruppendynamik, Indoor- und Outdoor Kompetenz für Sozialpädagogen/innen“. Dass ich dann zu Arbeit & Leben gekommen bin, war mehr oder weniger Zufall. Ich habe die Stellenanzeige gelesen und mich hat schon allein die Bezeichnung „Arbeit & Leben“ angesprochen. Für mich ist arbeiten leben, ich muss mich mit meiner Arbeit identifizieren können, sie muss mich motivieren können, sie muss mir Spaß machen und natürlich auch zur Existenzsicherung beitragen. Aber den Schwerpunkt würde ich auf die Herausforderung legen, und dass man für sich diesen persönlichen Gewinn hat. Hier hat Arbeit & Leben viel zu bieten, auch hinsichtlich der Mischung, mit der man hier konfrontiert wird. Ich bin nicht als Abteilungsleiterin eingestiegen. Das hat sich dann nach einem halben Jahr ergeben. Die Strukturen, die vorher da waren, waren meiner Auffassung nach nicht so klar und deutlich. Wir haben alle auf einer Teamebene gearbeitet, ohne die Bestimmung einer Person, die dann Entscheidungen treffen kann. Das heißt, die Person, die entscheiden konnte, war die Geschäftsführerin von Arbeit & Leben, was es dann natürlich schwer gemacht hat, wenn in einer Teamsitzung etwas zu entscheiden war. Damals befand sich Arbeit & Leben in einer Phase der strukturellen Veränderung, in deren Verlauf dann zwei Abteilungsleitungsstellen geschaffen wurden, da die Problematik auch in anderen Bereichen deutlich geworden war. Ursprünglich eingestiegen bin ich als Jugendbildungsreferentin, war aber auch für den Bereich Erwachsenenbildung zuständig. Durch den internen Veränderungsprozess bin ich dann zur Abteilungsleiterin geworden. 3. Welche speziellen Voraussetzungen muss man mitbringen, um in Ihrer Institution arbeiten zu können? Wichtig ist die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Da wir im Bereich der Weiterbildung arbeiten, werden natürlich auch Bewerbungen nach diesem Kriterium durchforstet. Dabei ist es dann egal, ob die Weiterbildungen innerhalb der Organisation gemacht werden, oder ob man sich persönlich weiterbildet. Wichtig ist vor allem das Interesse an der permanenten eigenen Weiterbildung. Außerdem finde ich wichtig, eine Sensibilität für die Gruppendynamik zu haben und das Wissen, wie Gruppen funktionieren. Das kann man nur dadurch lernen, in dem 16 man viel mit Gruppen arbeitet. Diesen Erfahrungsschatz kann man dann in die Planung einbringen, bspw. wie man ein Seminar methodisch-didaktisch oder auch inhaltlich aufbaut. Dafür benötigt man zusätzlich auch Methoden- und Moderationskompetenz. Diese lernen die Studierenden selten im Studium, weshalb es wichtig ist, sich diese auf einem anderen Weg anzueignen. Zudem sind betriebswirtschaftliche Kompetenzen immer von Vorteil. Wir werden nicht nur mit inhaltlicher Entwicklung konfrontiert, sondern wir müssen auch Kalkulationen erstellen, Mittel akquirieren und diese sinnvoll einsetzen. Um im Bereich Bildung arbeiten zu können, muss die Person, die die Bildungsreisen plant und organisiert natürlich auch ein gewisses Interesse an anderen Ländern und Kulturen sowie Reisefreudigkeit mitbringen. Man kann nichts organisieren, an dem man dann selbst kein Interesse hat. Da wir viel mit Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, ist interkulturelle Kompetenz natürlich auch von Vorteil, sei es die Sprachkompetenz oder dass man weiß, dass die Person einige Zeit im Ausland verbracht hat. Dies braucht man verstärkt im Neustadtprojekt oder auch in den arbeitsmarktpolitischen Projekten. Als Selbstverständlichkeit erachte ich den Umgang mit allen gängigen Computerprogrammen, wie z.B. Powerpoint oder Excel. Ich finde, das muss man als HochschulabsolventIn können. Wichtig ist vor allem die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Neuem. Nicht nur bezüglich organisatorischer Abläufe, sondern auch auf inhaltlicher Ebene. Gerade wenn man sich im Bereich der Erwachsenen-/Weiterbildung bewegt, muss man sich immer wieder darüber im Klaren sein, dass man Menschen begeistern und motivieren will, und dazu bereit sein, sich dafür immer weiterzubilden. Das Interesse und die Offenheit für Neues muss jeder selbst mitbringen und diese sind vor allem dann wichtig, wenn man mit bestimmten Zielgruppen zu tun hat, z.B. im außerschulischen Bereich, wo dann vielleicht in der Schule schlecht Erfahrungen gemacht wurden, weil es nur Frontalunterricht gab, und man sich dann selbst sagen kann, dass man es anders machen möchte. 4. Welche Kompetenzen haben Sie aus Ihrer Ausbildung bereits mitgebracht und welche mussten Sie sich zusätzlich aneignen? Wodurch haben Sie diese erlernt? Ich finde es sehr schwierig, hier zu differenzieren. Wir haben im Studium viele Beratungskompetenzen erwerben können, da hier ein Schwerpunkt gelegt wurde. Meine Mediatorenausbildung während des Studiums hat mir z.B. für die Arbeit im Jugendamt sehr geholfen. Zudem hatten wir im Studium die Möglichkeit, den Übungsleiterschein im Sportbereich zu machen. Das fand ich auch sehr hilfreich, da ich hier viel über Methodik und Didaktik lernen konnte. Es hängt aber auch immer viel vom Zufall ab, was man im Studium lernt, da dies keine Pflichtfächer waren und man es mitnehmen konnte oder auch nicht. Im weiteren hatte ich die Möglichkeiten unterschiedliche Methoden der sozialen Arbeit kennen zu lernen. Einige wende ich heute noch immer in Seminaren an, wie zum Beispiel das kreative Schreiben oder verschiedene künstlerische Aspekte. Aus meiner Trainerausbildung konnte ich vieles hinsichtlich Teamdynamik mitnehmen, vor allem eben sehr situationsbezogen, prozessorientiert und flexibel während einer Veranstaltung auf die Teilnehmenden eingehen zu können. Ich finde, dass ist auch eine Grundhaltung, die man erwirbt. Wie man mit Teilnehmenden umgeht und wie man auf ihre Bedürfnisse eingeht und reagiert hängt auch viel von 17 den eigenen Normen und Werten ab. Über diese Grundhaltung muss man sich auch klar werden, wie man an die Arbeit mit Menschen herangeht, da davon natürlich die eigene Arbeitsweise abhängt. Andere Bereiche des Studiums, wie z.B. Geschichte der Erwachsenenbildung, haben nun nicht so eine enorme Auswirkung auf meinen beruflichen Alltag. Ich finde diese aber auch wichtig, da sie das Fundament der Arbeit bilden. 5. Würden Sie sich als "professionell" hinsichtlich Ihres derzeitig ausgeübten Berufes beschreiben? Warum / Warum nicht? Ja, ich würde mich definitiv als professionell beschreiben. Ich gehe immer mit einem ganzheitlichen Blick an alles heran. Es stellt sich natürlich die Frage, was unter professionell verstanden wird. Wenn es darum geht, wie man seinen Arbeitsalltag organisiert, würde ich mich als professionell beschreiben, sei es bei der Strukturierung von Arbeitsabläufen, der Weiterentwicklung von Konzepten oder der inhaltlichen Weiterbildung. Für mich ist eine weitere Komponente der Professionalität auch Zuverlässigkeit, bspw. Antragsfristen und Termine einzuhalten. Dann gehört dazu, gegenüber Kooperationspartnern professionell aufzutreten. Alles Dinge, die nicht nur PädagogInnen betreffen, sondern alle Berufsgruppen, wenn es darum geht, wie jemand seinen beruflichen Alltag bewältigt. Professionell finde ich auch die Bereitschaft, sich ständig selbst weiterzuentwickeln, auch immer wieder zu schauen, was es an neuen Themenfeldern gibt, die einen interessieren, und wie man diese in den Berufsalltag vernetzen und integrieren kann. Das Hochschulstudium ist die Eintrittskarte für eine bestimmte tarifliche Eingruppierung. Bei allem anderen ist man selbst permanent gefordert, um weder persönlich noch beruflich stehen zu bleiben. Teil B: Fragen nach der Institution und dem Wissenstransfer innerhalb dieser 6. Wie können Sie selbst die Ihnen wichtigen Kompetenzen an jüngere KollegInnen weitergeben? Generell bin ich ein Fan des situativen Führens. Dabei muss man immer schauen, mit wem hat man es als Person zu tun, und parallel dazu, welche Aufgabe diese Person erledigen soll. Und je nachdem kann ich dann sehen, wie die Unterstützung von meiner Seite aussehen muss. Das Konzept des situativen Führens bietet zudem die Chance, PraktikantInnen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, nämlich zu schauen, wo die Personen jetzt stehen, was sie aktuell können, welche neuen Impulse im Praktikum bekommen wurden, und was diese Person dann daraus macht, wie sie ihr weiteres Studium gestaltet und ihre Schwerpunkte setzt. Daher kann ich auch nicht generell sagen, dass wir mit unseren PraktikantInnen immer dasselbe machen, sondern es kommt immer auf mein Gegenüber an, was die Person mitbringt und was sie noch an gezielter Förderung und Unterstützung braucht und ihr dann ein entsprechendes Feedback zu geben. Daher setzen wir uns am Anfang zusammen und schauen, was die Person mitbringt, welche Ziele sie hat und wie sie diese bei Arbeit & Leben umsetzen kann. Bei jeder Aufgabe gibt es dann eine Rückmeldung, wie die Person diese empfunden hat, so dass es zu einem permanenten Prozess des Feedbacks kommt. 18 Ich lege jeder/m, die/der bei uns ein Praktikum macht, aber noch nicht so viel mit Gruppen zu tun hatte, nahe, sich darüber klar zu werden, was die eigenen inhaltlichen Vorlieben sind, wo die eigenen Stärken und Schwächen sowie Interessen liegen, mit welchen Menschen man sich zutraut zu arbeiten, und sich dann evtl. eine Arbeit auf Honorarbasis zu suchen, wo man das dann weiter ausbauen kann. Ich finde es unheimlich wichtig, dass, wenn ich später im Bereich Erwachsenenbildung arbeiten möchte, ich auch Erfahrungen mit Menschen in Gruppenprozessen habe, um eine Sensibilität dafür zu bekommen. 7. Werden Sie dabei von Ihrer Institution unterstützt? Während des Praktikums haben die PraktikantInnen die Möglichkeit, überall mit dabei zu sein. Wenn während des Praktikums interessante Seminare laufen, haben die PraktikantInnen die Möglichkeit, an diesen zu partizipieren, entweder als Teilnehmende/r, als stille/r BeobachterIn oder als Co-TrainerIn, um Erfahrungen zu sammeln. Die jeweilige Rolle ist dann natürlich an die Voraussetzungen und Interessen gekoppelt, die eine Person mitbringt. Die Geschäftsführerin von Arbeit & Leben ist für Praktika immer offen und unterstützt einem dann auch in den Vorhaben, die man umsetzen möchte. Arbeit & Leben sieht PraktikantInnen als Bereicherung. Zwar investieren wir in ein Praktikum immer auch Zeit, aber wir bekommen auch sehr viel zurück. Zum Teil ergeben sich auch neue Kooperationspartner oder neue Netzwerke durch die nebenberuflichen Tätigkeiten der PraktikantInnen. Ein Praktikum kann für die jeweiligen Personen dann auch eine Einstiegsmöglichkeit bei Arbeit & Leben sein. Daher finde ich es auch immer wichtig, zu den PraktikantInnen auch weiterhin Kontakt zu halten. 8. Was sollen die neuen KollegInnen von ihrer Seite aus zum Wissenstransfer beitragen? Ich wünsche mir, dass die PraktikantInnen Impulse für die Netzwerkarbeit mitbringen. Wenn die Person z.B. Kontakte zum Allgemeinen Studierendenausschuss hat oder sich anderweitig engagiert, kann man überlegen, für diese Zielgruppe ein spezifisches Weiterbildungsangebot zu erstellen. Das hilft uns natürlich hinsichtlich der Bedarfsermittlung und Akquise von Teilnehmenden. Wichtig finde ich, dass die PraktikantInnen sich aktiv einbringen. Wenn Sie bereits Erfahrungen gesammelt haben, können Sie diese auch mit in unseren beruflichen Alltag einfließen lassen. Dazu gehört natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, diese Erfahrungen dann auch mitzuteilen. Mich interessiert auch, was die Studierenden derzeit an der Universität machen, was derzeit gelehrt wird. Auch, welchen Stellenwert die Themen haben, mit denen wir in unserer Arbeit konfrontiert werden, wie Diversity Management, Gender Mainstreaming oder die Sinus-Milieus. Hier ist mir der Dialog wichtig, in dem man dann über solche Sachen sprechen kann. Ich denke, die Atmosphäre, die hier vorherrscht, gibt einem auch viel Raum für solche Gespräche und dafür, sich einzubringen. Teil C: Ausblick, Anregungen, Vorschläge 9. Was würden Sie den Studierenden von heute mitgeben, damit diese sich auf die Ausübung des 19 erwachsenenpädagogischen Berufs optimal vorbereiten können? Es wäre für jede/n sinnvoll zu schauen, wo die eigenen Schwerpunkte oder auch Interessen liegen, und wie man dann vielleicht einen Weg findet, diese zu verknüpfen und umzusetzen. Dazu kann man dann schauen, welche Organisationen diese Umsetzung ermöglichen könnten. Zudem schauen wir auch immer bei Bewerbungen, was die-/derjenige schon während des Studiums gemacht hat. Daher wäre es sinnvoll, sich auch andere Kompetenzen nebenher anzueignen, evtl. durch einen Nebenjob oder Praktika. Wichtig sind Praxiserfahrungen auch, um Netzwerke zu knüpfen auf die man dann auch später zurückgreifen kann. Daher würde ich raten, mehr Praktika zu machen, als gefordert werden. 10. Haben Sie weitere Anregungen oder Vorschläge hinsichtlich des Wissenstransfers? In der Dokumentation zum letzten [Anm.d.R.: dem zweiten] Lernraum wurden Methoden veröffentlicht, die ich sehr spannend fand. Leider bleibt in meinem beruflichen Alltag wenig Zeit, so etwas umzusetzen. Es würde mich aber sehr interessieren, in wie weit das vielleicht bei anderen geschehen ist. 4. Experteninterview – Michael Grunewald & Rudi Imhof Evaluation der Einrichtungen im Rahmen des Projektes „Theorie-PraxisTransfer“ – ZGV Michael Grunewald (G) & Rudi Imhof (I) Teil A: Fragen nach dem Selbstverständnis, der eigenen Professionalität und dem Werdegang 1. Wie würden Sie Ihren derzeitigen Beruf beschreiben? Was hat er mit Erwachsenenbildung zu tun? G: Als Jugendbildungsreferenten besteht unsere Aufgabe darin, Jugendliche, junge Erwachsene oder Erwachsene dahingehend weiterzubilden, dass sie sich in dieser Gesellschaft auf der politischen Ebene besser bewegen können. Das kann sowohl methodisch als auch inhaltlich sein. I: Jugendbildungsreferent heißt in unserem Fall, dass wir uns vornehmlich an junge Erwachsene bis im Alter von ca. 20 Jahren wenden. Wir haben aber als weitere Zielgruppe auch Multiplikatoren. In diesem Fall richtet sich das Angebot dann erst einmal an Erwachsene. Zu dieser politischen Aufgabe würde ich noch hinzufügen, dass es für uns ganz wichtig ist, die Jugendlichen „da abzuholen, wo sie stehen“, ihre Biografie mit aufzunehmen und auch mit ihnen gemeinsam zu schauen, wie sie an gesellschaftlichen, betrieblichen Prozessen partizipieren können. G: Die Arbeit mit den Multiplikatoren ist dann auch die Schnittmenge zur Erwachsenenbildung. Mit Jugendlichen muss anders gearbeitet werden als mit Erwachsenen. 20 I: Hinzu kommt, dass sich die Arbeit mit Multiplikatoren an eine interessierte Fachöffentlichkeit wendet, also auch an Menschen, die schon eine gewisse Ahnung vom Thema haben. In unserer Jugendarbeit haben wir aber natürlich einen großen Schwerpunkt auf den Jugendlichen, die nicht in diesem Bildungsprozess all zu weit oben angesiedelt sind, also auch auf Jugendlichen mit Lernschwächen. Ich denke, es gibt auch zwischen der Erwachsenenbildung und der außerschulischen Jugendbildung keine klare Grenze, wie bspw. bis 26 darf man mitmachen, ab 27 aber nicht mehr. Das gibt es höchstens bei einigen Förderrichtlinien. 2. Wie sind Sie zu Ihrem derzeitigen Beruf gekommen? Erzählen Sie von Ihrem Werdegang. I: Ich habe nach neun Jahren Hauptschule auf einer kaufmännischen Berufsvorschule meine mittlere Reife gemacht. Danach war für mich die Lust an der Schule erst einmal erschöpft. Ich habe dann eine Ausbildung als Industriekaufmann absolviert. Auch hier war mir recht schnell klar, dass ich in diesem Beruf nicht alt werden wollte. Dann habe ich die Fachoberschule Wirtschaft gemacht, mit dem Ziel, Betriebswirtschaft zu studieren, und habe dann direkt zwischen der schriftlichen und der mündlichen Prüfung an einem internationalen Jugendbegegnungsseminar in der damaligen Tschechoslowakei teilgenommen. Dort habe ich mich mit dem Leiter sehr gut verstanden und habe ihn dann gefragt, was er eigentlich beruflich macht. Nach einigem hin und her wurde klar, dass er Jugendbildungsreferent der Industriejugend der evangelischen Kirche ist. Ich sah das dann als vernünftige Alternative zur Betriebswirtschaft und habe dann Sozialpädagogik in Darmstadt studiert. Davor war ich bereits ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig, habe nach meinem Abschluss fünf Jahre lang im Dekanat Wiesbaden als Dekanatsjugendwart, wie das damals hieß, gearbeitet. Heute würde man dazu auch Referent sagen. In dieser Zeit bestand meine Arbeit schon je zur Hälfte aus Jugend- und Bildungsarbeit. Nach fünf Jahren merkte ich, dass es eine ewige Spirale ist: Konfirmanden abholen, mit ihnen drei Jahre arbeiten, und wenn man ihnen dann eigene Aufgaben überlassen könnte, waren sie weg und die nächsten Konfirmanden kamen. Dann habe ich noch mal Geschichte, Politik und Pädagogik in Frankfurt studiert und den Abschluss als Diplom-Pädagoge im Fachbereich außerschulische Jugendbildung und Erwachsenenbildung gemacht. Direkt nach dem Studium habe ich dann im Vorläufer des jetzigen Zentrums als Jugendbildungsreferent angefangen. G: Ich habe auch einen ähnlichen Werdegang. Nach der Realschule hatte ich keinerlei Interesse an einem weiteren Schulbesuch. Meine Schulmüdigkeit hat mich dann dazu gebracht, dass ich eine Ausbildung als Betriebsschlosser bei einer großen Autofirma gemacht habe. Ich habe nach meiner Ausbildung dann dort noch zehn Jahre gearbeitet, aber gleichzeitig angefangen, Seminare der außerschulischen politischen Jugendbildung zu machen, erst für die IG Metall, dann für die Volkshochschulen in Frankfurt und Berlin, für verschiedene Einzelgewerkschaften und den DGB und später für die evangelische Kirche. Das hat dazu geführt, dass ich mit meinem Schlosserjob nicht alt werden würde. Ich habe dann eine „Hochschule“ der Gewerkschaften, der Akademie der Arbeit in Frankfurt, besucht, wusste aber auch danach, dass ich kein Gewerkschaftssekretär werden wollte, und habe mich dann entschieden, noch einmal ein gesellschaftswissenschaftliches Studium dranzuhängen. Aufgrund des noch fehlenden Abiturs konnte ich das dann noch nicht, sondern musste zunächst 21 mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachholen. Danach habe ich in Frankfurt an der Universität Soziologie studiert, was ich dann mit einem Diplom abgeschlossen habe. Schon während meines Studiums bin ich in die Arbeit mit Jugendlichen eingestiegen, in einem offenen Treff — das was man in der klassischen Sozialpädagogik macht — und habe gleichzeitig noch Seminare der außerschulischen Jugendbildung und Erwachsenenbildung gemacht. Als dann hier eine Stelle frei wurde, habe ich mir gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte und habe dann hier angefangen. I: Ich denke, wenn man es aus unserer Warte betrachtet, sind unsere Lebensläufe eher typisch. Der zweite Bildungsweg war ein relativ typischer Bildungsgang. Heute wäre es eher atypisch. G: Ich glaube auch, dass der zweite Bildungsweg eher ein typischer Fall bei den Menschen 50+ ist. Bei meinen jüngeren KollegInnen ist mir niemand bekannt, der einen solchen Weg eingeschlagen hat. Die meisten haben das dann auf dem so genannten Königsweg erreicht, also auf dem ersten Bildungsweg. Ich glaube, das Zeitalter der Jugendarbeit aus der Arbeiterbewegung heraus ist vorbei, da es nicht mehr diese Jugendbewegung gibt, zumindest nicht in der Breite und als gesellschaftspolitisches Thema. I: Das ist ein Grund. Ein weiterer Grund ist, dass heute viel mehr Menschen eines Jahrganges direkt Abitur machen und studieren. 3. Welche speziellen Voraussetzungen muss man mitbringen, um in Ihrer Institution arbeiten zu können? G: Durchhaltevermögen würde ich sagen. Die evangelische Kirche als Institution, die auch finanzielle Krisen zu meistern hat, ist auch geprägt von Finanzdebatten. Und diese bedeuten für uns, dass wir uns möglicherweise jedes Jahr wieder neu fragen müssen, ob es uns nächstes Jahr noch gibt, ob es unsere Förderkriterien, nach denen unsere Arbeit bewertet und gefördert wird, noch existieren. Wir sind beide in einem Bereich tätig, der auch aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes mitfinanziert wird. Da weiß man auch nie genau, ob diese weiterhin bestehen. Ansonsten muss man gut mit Menschen umgehen können. Das ist meiner Meinung nach eine zentrale Voraussetzung in der Arbeit mit Menschen, also auch der Bildungsarbeit. Man muss immer schauen, dass man diejenigen, die ja in der Regel freiwillig an diesem Bildungsprozess teilnehmen, so beteiligt, dass sie auch diesen Schritt mitgehen können. I:. Eine weitere Voraussetzung ist, kein Experte in dem Sinne zu sein, dass man nur eine Richtung hat. Man muss die Bereitschaft haben, auch fachübergreifend arbeiten zu können. Hier im Zentrum ist das besonders ausgeprägt und das macht mir auch Spaß. In der dezentralen Arbeitsstruktur früher war das nicht so einfach. Die Kooperation mit KollegInnen, die gemeinsame Verantwortung, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit; das sind Dinge, die man hier braucht. Dazu sollte man sich wenigstens einigermaßen in der Struktur der evangelischen Kirche und ihrer Sitten und Bräuche auskennen und loyal sein. G: Ganz wichtig ist natürlich auch noch, dass das eigene Menschenbild auf der Basis des christlichen oder zumindest humanistischen Menschenbildes beruht, sonst könnten wir hier gar nicht arbeiten. I: Zudem stehen wir hier in einem besonderen Spannungsbogen. Auf der einen Seite sind wir keine Beauftragten der Kirche, wir treten nicht repräsentativ im Auftrag der Kirche auf. Im Gegenteil: Von unseren Klienten werden wir gefragt, warum Kirche eigentlich so etwas macht. Wenn ich bspw. mit einer 22 Hauptschulklasse unterwegs bin, von der ca. 80% Muslime sind, kommt schon auch die Frage, warum die evangelische Kirche etwas macht, wo sie dann teilnehmen können und was das mit Kirche zu tun hat. Dann sehe ich es schon als unsere Aufgabe, ihnen ein humanistisch-christliches Weltbild vorzustellen und auch die soziale gesellschaftliche Verantwortung der Kirche nach außen deutlich zu machen, auch wenn es dann keine Mitglieder der Kirche sind. 4. Welche Kompetenzen haben Sie aus Ihrer Ausbildung bereits mitgebracht und welche mussten Sie sich zusätzlich aneignen? Wodurch haben Sie diese erlernt? G: Ich würde sagen, dass ich in der Ausbildung bestimmte grundlegende Kompetenzen erlernt habe, wie Moderationstechniken oder wie man einen Vortrag hält. Was ich in der Ausbildung nicht gelernt habe, ist wie man das dann nachher praktisch macht, also Zeitmanagement, Projektmanagement oder wie man Kooperationen herstellt. Es war wichtig, zu lernen, dass man Kooperationen herstellen muss, aber wie man das macht, war nicht Teil der Ausbildung. Gelernt habe ich diese Dinge dann durch praktische Erfahrungen. Wir sind auch beide in einen bundesweiten Kreis von (Jugend-) Bildungsreferenten eingebunden, in dem wir uns jedes Jahr zur Reflexion unserer Arbeit treffen. So hat man auch immer wieder die Möglichkeit einer „Tätigkeitssupervision“, wo wir uns mit KollegInnen austauschen und dabei lernen können. Wir haben keinen Beruf, in dem man nach dem Studium alles hat, was man dafür benötigt, sondern wie man praktisch handelt oder wie das in der Praxis aussieht, lernt man in der Regel erst nach dem Studium. I: Ich sehe das ähnlich, würde das aber für mich noch weiter führen. Ich kann das nicht genau differenzieren, was nun genau in der Ausbildung gelernt wurde und was später. Das fing an mit der Berufsausbildung und meiner dortigen Tätigkeit als politische Jugendvertretung im Betrieb. Dort wurden ganz bestimmte Fertigkeiten gefordert und vermittelt, die mir dann in der „nächsten Phase“ der Ausbildung an der Fachhochschule zugute kamen. Dort würde ich die Stärken eher im Kennenlernen von Methoden, von didaktischen Überlegungen und Einüben von Kommunikationsprozessen sehen. Das ist etwas, was ich später an der Universität vermisst habe. An der Universität ging es eher darum, möglichst schnell bzw. gut ein Referat vorzutragen oder eine Hausarbeit zu schreiben. Es lässt sich nicht genau differenzieren, was nun genau wo gelernt wurde. Ich denke vielmehr, es ist ein Prozess, der seit vierzig Jahren läuft. G: Ich denke, dass ist etwas besonderes an der Erwachsenenbildung. Es ist ein Beruf, in dem man mit Menschen zu tun hat. Die Kommunikation mit Menschen in Bildungsprozessen ist etwas, was man theoretisch nicht lernen kann. Man kann ganz viele Anhaltspunkte bekommen, wie Methodik oder Gesprächsführung, aber wie man in den realen Kontakt mit realen Menschen, die zu so einer Veranstaltung kommen, tritt, kann man im Studium nicht lernen. Man kann viele theoretische Grundlagen schaffen, aber die praktischen Erfahrungen lassen sich im Studium nicht vermitteln. In anderen Studiengängen kann man mehr theoretisch arbeiten. Da ist dann der Anteil des in der Ausbildung erworbenen Wissens höher als in der Erwachsenenbildung. I: Dazu kommt, dass wir natürlich grob vorgegebene Ziele in unserer Arbeit haben, aber es kann natürlich auch vorkommen, dass eine gut geplante, einwöchige Veranstaltung nach eineinhalb Tagen total kippt oder dass plötzlich etwas anderes im Fokus steht. Dann muss man sich plötzlich innerhalb einer Bildungsveranstaltung umorientieren. Wir haben ja keinen Lehrplan, den wir 23 erfüllen müssen. Wir haben auch keine Abstufungen oder Benotungen, die wir vornehmen müssen. Die Arbeit mit Leuten mit einem Thema in der vorhandenen gegebenen Zeit, das ist, was unseren Beruf ausmacht. 5. Würden Sie sich als "professionell" hinsichtlich Ihres derzeitig ausgeübten Berufes beschreiben? Warum / Warum nicht? I: Ich würde mich eher als Generalist mit einigen Schwerpunkten bezeichnen, in denen ich vielleicht einen guten Kenntnisstand habe, mir Kenntnisse erworben und erarbeitet habe und in denen ich auch in der Lage bin, diese weiterzugeben. Aber in jedem Segment meiner Arbeit gibt es Leute, die das besser können oder die das anders machen würden. Aber diese machen dann vielleicht sonst nicht mehr viel anderes. Da ist natürlich die Frage, was eigentlich professionell ist. Als professionell würde ich uns schon sehen, da wir die Aufgabe, die wir haben, auch wirklich ernst nehmen, an kontinuierlichen Weiterbildungsprozessen teilnehmen und eingebunden sind in ein größeres Netzwerk. G: Ich würde mich immer als Profi bezeichnen. Professionell heißt bei uns nicht, dass man viel Fachwissen über ein Thema hat. Unsere Arbeit besteht darin, Bildungsprozesse zu initiieren, zu steuern, die Teilnehmenden miteinzubeziehen, zu schauen, dass diese dabei bleiben und aus dem Prozess gestärkt hervorgehen. Das ist unsere Profession, das können wir. Das heißt nicht, dass das immer gelingt, aber professionell heißt eben, auch damit dann umgehen zu können. Wenn jemand auf uns zukommt, und gerne eine Veranstaltung zu einem bestimmten Thema machen möchte, müssen wir schauen, in welcher Umgebung machen wir das, was für ein Ziel soll es haben, wie macht man das und dann auch die Methodik entwickeln. Von daher sind wir Profis, was die Methodenvielfalt angeht. Wir können Bildungsprozesse initiieren, steuern und unterstützen, darin sind wir professionell. Teil B: Fragen nach der Institution und dem Wissenstransfer innerhalb dieser 6. Wie können Sie selbst die Ihnen wichtigen Kompetenzen an jüngere KollegInnen weitergeben? G: Wichtig ist es, verschiedene Abläufe zu visualisieren und transparent zu gestalten, damit die PraktikantInnen diese verstehen können. Bei der Veranstaltungsplanung ist z.B. wichtig, dass man dem Veranstaltungshaus sechs Wochen vorher Bescheid gibt, wie viele Teilnehmende kommen, da man ab diesem Zeitpunkt zahlen muss. Das wissen viele Studierende nicht. Diese Informationen muss man dann zur Verfügung stellen. Viel von diesem Wissen gewinnt man auch erst durch Erfahrung. Wir versuchen, den PraktikantInnen eigene Erfahrungen zu ermöglichen. Man lernt z.B. viel auch daraus, dass Veranstaltungen eben nicht funktionieren. I: Ich sehe das ähnlich. Zu Beginn habe ich aber auch viele Informationen und Tipps durch Gespräche mit erfahrenen KollegInnen bekommen. Deshalb sind diese natürlich auch wichtig. G: Wir beteiligen die PraktikantInnen auch an unserer alltäglichen Arbeit und geben ihnen Einblicke und Möglichkeiten zur Reflexion. Zum anderen beteiligen wir sie durch eigene Projekte, in denen sie möglichst selbstständig eigene 24 Erfahrungen sammeln können. Es ist dann auch nicht schlimm, wenn dabei etwas schief geht. I: Wir bieten den PraktikantInnen auch die Möglichkeit, die Arbeitsweisen und -felder der anderen KollegInnen kennen zu lernen, da diese natürlich höchst unterschiedlich sind. Das ist auch einer der Vorteile hier im Haus, das wir mehrere KollegInnen vor Ort haben und die Bandbreite relativ groß ist. Im Bezug auf jüngere KollegInnen findet eine vielleicht gewünschte Fluktuation hier momentan nicht statt. Daher bezieht sich der Austausch im Haus vor allem auf PraktikantInnen. Den Austausch mit jüngeren KollegInnen haben wir dann innerhalb der regionalen oder bundesweiten Netzwerke. Das geschieht dann über Gespräche, oder dass man gemeinsam eine Veranstaltung plant und organisiert. 7. Werden Sie dabei von Ihrer Institution unterstützt? G: Im Moment haben wir durch die Personalplanung selten die Möglichkeit, auf neue Mitarbeitende zu treffen. Das sind dann doch eher die PraktikantInnen, mit denen wir es zu tun bekommen. Aber immer mal wieder bekommen wir auch neue KollegInnen. Das hängt aber nicht von uns ab, da wir für die Personalplanung nicht zuständig sind. I: Die neuen KollegInnen sind dann aber Fachleute für ihr Thema, wo wir dann auch etwa ein halbes Jahr brauchen, bis man feststellen kann, was man zusammen machen kann und was nicht. Und nach einem halben Jahr zu sagen, die Person ist eigentlich ganz nett, der kann ich jetzt etwas beibringen, das ist dann schon ein bisschen spät. Das ist dann schon eher ein gegenseitiges Abklopfen. Aber Berufsanfänger hatten wir hier schon länger nicht mehr. Im Bezug auf den Austausch ist das in der heutigen Struktur deutlich einfacher geworden. Früher waren die Leute eher Einzelkämpfer, die weit verteilt saßen und sich nicht unbedingt einig waren. Unter einem Dach ist dann doch deutlich einfacher, miteinander zu kooperieren und voneinander zu lernen. Im gesamten Raum der Kirche ist das schon schwieriger. Da herrscht manchmal viel zu viel Konkurrenzdenken zwischen den Gemeinden, das dann den Austausch oder Kooperationen eher verhindert. 8. Was sollen die neuen KollegInnen von ihrer Seite aus zum Wissenstransfer beitragen? G: Diejenigen, die an einem Transferprozess teilnehmen, müssen natürlich auch offen dafür sein. Daher gehört Offenheit, auch gegenüber neuen Informationen, als wichtiger Bestandteil dazu. Dann gehört zum professionellen Alltag, dass man sich auch um Sachen kümmert, die einem nicht so sehr liegen. I: Ich würde mir Informationen darüber wünschen, was derzeit an der Universität passiert, welche Inhalte gelehrt werden, auf was Wert gelegt wird, inwieweit auch die Erwartungen der Studierenden eine Rolle spielen. Auch eine Rückmeldung darüber, warum sie studieren, was sie studieren, was sie sich davon versprechen, welche Motivation sie haben. G: Mich interessieren ebenfalls die Lehrinhalte an der Universität, bspw. was wird über die verschiedenen Lernarten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gelehrt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass diese dann eventuell nicht Bestandteile des individuellen Studiums sind, da die Studierenden sich das aussuchen können. Daher ist das auch keine Erwartung von meiner Seite, sondern es wäre schön, wenn darüber Auskunft gegeben werden könnte. 25 Teil C: Ausblick, Anregungen, Vorschläge 9. Was würden Sie den Studierenden von heute mitgeben, damit diese sich auf die Ausübung des erwachsenenpädagogischen Berufs optimal vorbereiten können? I: Ich würde ihnen empfehlen — und diese Möglichkeit hat man an der Universität — über eine Engführung hinauszukommen, sich nicht zu sehr auf ein Gebiet zu spezialisieren. Ich plädiere nicht wieder für den Generalismus, aber die Bandbreite sollte etwas größer sein. G: Da ich nicht genau weiß, was sie derzeit machen, sind Empfehlungen etwas schwierig. Das Studium heute ist viel strukturierter und verschulter, als es noch zu meiner Zeit war, dadurch ist diese Bandbreite auch ein Stück weit verringert. I: Ich würde den Studierenden von heute noch empfehlen, dass sie, sobald die Möglichkeit dazu besteht, sich in Praxisfeldern umsehen. Das muss dann nicht in der Form eines Praktikums über acht oder zehn Wochen sein, sondern das kann auch erst einmal eine Mitarbeit in einem Projekt sein, ehrenamtlich oder zunächst mit einem etwas geringeren Honorar. Das bringt zum einen zusätzliche Kenntnisse und ist zum anderen bei Bewerbungsschreiben immer hilfreich. Meine Empfehlung ist daher, möglichst viele Praxiserfahrungen zu sammeln. G: Und nicht so viele Daten im StudiVZ veröffentlichen. Diese werden nämlich auch von späteren eventuellen Arbeitgebern überprüft. 10.Haben Sie weitere Anregungen oder Vorschläge hinsichtlich des Wissenstransfers? G: Ich würde mir mehr Informationen darüber wünschen, was gelehrt wird, also auch, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Die Themen unterliegen natürlich einem Wandel der Zeit, so dass es interessant wäre, was aktuell ein Thema ist. I: Bei den einzelnen PraktikantInnen gibt es natürlich immer eine individuelle Selektierung. Daher würde ich mir auch eine etwas breitere Übersicht wünschen über das, was an der Universität passiert, was die Studierenden machen, wie die Anforderungen sind, in welche Richtung das geht. G: Heutzutage haben Universitäten ja auch ein Profil, vielleicht hat ja das Institut auch ein solches, das dann vorgestellt werden kann. I: Meine bisherigen Erfahrungen mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz waren nicht so gut. Wir wollen weiterhin Praktikumsplätze anbieten, aber das schien niemanden zu interessieren. Wir würden uns wünschen, auch weiterhin PraktikantInnen zu haben. Wir haben einige Projekte, auch hier im Haus, in denen PraktikantInnen mitarbeiten könnten. Von daher wünschen wir uns auch etwas mehr Engagement von Seiten der Universität.