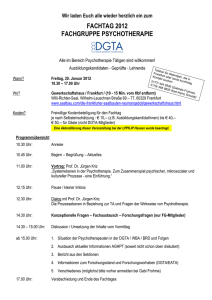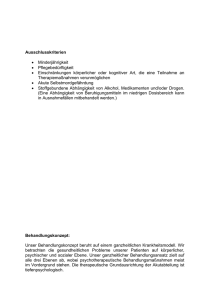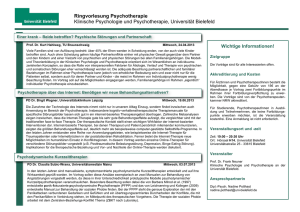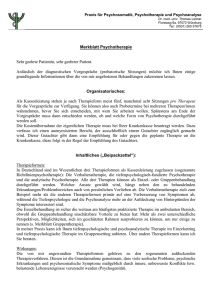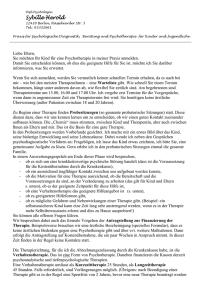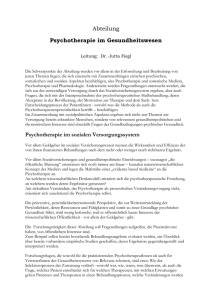(2004): Wissenschaftliche Grundlagen: Denkmodelle
Werbung

Erscheint in: Senf / Broda: Praxis der Psychotherapie, 3. Aufl. 2005 (Thieme Verlag), S. 18-24 Nicht zitieren und verbreiten: Vorabdruck nur im Rahmen des Ergänzungs-St. Wissenschaftliche Grundlagen: Denkmodelle J. Kriz Zum Theorie-Praxis-Verhältnis Die Praxis der Psychotherapie und ihre wissenschaftlichen Grundlagen stehen in einem Spannungsverhältnis, wie es für zahlreiche akademisch fundierte Handlungsfelder typisch ist: Beide Seiten, „Praktiker“ und „Theoretiker“, werfen einander oft vor, von den spezifischen Aufgaben, Fragestellungen, Vorgehensweisen, Lösungsvorschlägen und der Arbeitsroutine der jeweils anderen zu wenig zu verstehen – geschweige denn, deren Beiträge recht zu würdigen. In den Debatten um die vielbeklagte „Theorie-Praxis-Kluft“ fordern die einen, dass die Theorie mehr Praxisnähe zeigen und mehr Lösungen für die konkreten (professionellen) Alltagsprobleme bereitstellen müsse. Die anderen halten dagegen, dass zu viel „vor sich hingewurstelt“ werde, d.h. dass die mühsam erbrachten Ergebnisse und Leitprinzipien der Wissenschaft zu wenig zur Kenntnis genommen würden. Stattdessen stünden wissenschaftlich letztlich nicht begründbare Handlungen im Vordergrund. Solche Debatten, die auch in anderen Disziplinen wie Pädagogik, Soziologie, Ökonomie, ja selbst in Teilbereichen der Technik, ähnlich geführt werden, missverstehen oft das Theorie-Praxis-Verhältnis dahingehend, dass sich Praxis wesentlich als Anwendung von Theorie ableiten ließe. Das aber wird von Wissenschaftstheoretikern eher bestritten. So hat Westmeyer (1978, 1980) bereits für die klassische Verhaltenstherapie gezeigt, dass sie (bzw. Teile davon) nicht als „angewandte Lerntheorien“ verstanden werden kann. Stattdessen plädiert er, wie auch Perrez (1982a,b) dafür, Theorie im Rahmen von Psychotherapie bestenfalls als Bereitstellung von „technologische Regeln“ zu verstehen, nämlich als Aufforderungen, in bestimmten Situationen bestimmte Maßnahmen zu ergreifen um bestimmte Ziele zu erreichen. Das Theorie-Praxis-Verhältnis wird daher treffender mit der Beziehung zwischen Landkarte und Landschaft verglichen: Landkarten (als Metapher für die Wissenschafts- und Theorie-Ebene) können zwar zeigen, wo ein See liegt, wie tief er ist und welche Beschaffenheit die Umgebung hat. Aber wie man ihn in der Landschaft (als Metapher für die Praxis-Ebene) im ggf. unwegsamen Gelände aufsucht, oder gar, wie man dann im See schwimmt, kann nur praktisch erfahren und gelernt werden. Nur für bestimmte Anliegen ist eine Landkarte hilfreich – insbesondere zur Orientierung und für Anregungen zu neuen Wegen sowie für die Reflexion von Erfahrung. Im Extremfall kann sie aber sogar hinderlich sein: wer immer mit der Landkarte vor Augen durchs Gelände läuft, dürfte bald an einem Baum oder in einer Schlucht enden – so wie ein Kliniker, der sich allzu sehr an ein theoretisch fundiertes Behandlungsmodell im Zusammenhang mit einer Störungsdiagnose nach Lehrbuch klammert, Gefahr laufen könnte, bedeutsame andere Lebensumstände und Symptome zu übersehen. Gleichwohl macht diese Metapher durchaus auch die Relevanz von "Landkarten" deutlich (Kriz 1996): Aspekt der Anwendung. Zunächst einmal können sie vor Ort hilfreich sein, indem sie zur besseren Übersicht und Orientierung oder als Entscheidungshilfen herangezogen werden. Aspekt der Theorien-Debatte. Aber auch durch Vergleich unterschiedlicher Erfahrungen auf Teil-Reiserouten lässt sich anhand von Landkarten die Einsicht in die Gesamtlandschaft erhöhen und somit ggf. wiederum zu einer Verbesserung der Landkarten beitragen. Aspekt der Ausbildung. Letztlich können Landkarten sogar fernab von der Landschaft (nennen wir es: im Elfenbeinturm) den Praktikern nützen - sie können nämlich jenen, die sich vorbereiten, diese Landschaft zu bereisen, gezielt und übersichtlich bestimmte Erfahrungen vermitteln und auf mögliche Erfahrungen vorbereiten. Kanfer (1997), der Wissenschaft ebenfalls „hauptsächlich als eine Ressource zur Entwicklung von Strategien, Techniken und Methodologien zur Zielerreichung und Überprüfung von Ergebnisqualität“ verstanden wissen will, trifft „wichtige Unterschiede“ hinsichtlich folgender Aspekte: Datenquelle. Im Gegensatz zum Wissenschaftler kann der Praktiker nicht vorher auswählen, welche Ereignisse er untersuchen will, noch welche Datenquelle ihm die relevanteste Information gibt. Zudem reagiert er nicht nur auf externale Information (z.B. Verhalten des Patienten) sondern auch auf selbst generierte Information (z.B. Reaktionen des Patienten auf das Verhalten des Therapeuten). Zweck und Fragestellung. Das Ziel des Interesses wird vom Therapeuten nicht durch wissenschaftliche Hypothesen über Faktoren-Zusammenhänge, sondern vom Individuum und dem Kontext seiner Beschwerden bestimmt und kann sich zudem im Laufe der Behandlung ändern. Ergebniskriterien. Diese sind im Rahmen von Wissenschaft meist klar im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung definiert; in der Praxis kann eine hoch effektive Technik gepaart mit einer zutreffenden Problemdefinition letztendlich aber nicht erfolgreich sein wenn z.B. das soziale Umfeld auf Veränderungen stark negativ reagiert. Ergebniskriterien sind daher oft für unterschiedliche Teilkomponenten der Behandlung unterschiedlich zu setzten. Sprache. Entgegen der klaren Begriffsdefinitionen im Rahmen der Wissenschaft verwenden Klienten ihre eigene (Alltags-)Sprache, was Therapeuten zu Interpretationsfehlern und infolge dessen zu inadäquaten Interventionen verleiten kann. Soziale Verantwortung. Diese ist beim Wissenschaftler anders ausgerichtet– nämlich auf genaue Beschreibung und Reflexion der Forschungsschritte – als beim Praktiker, der einerseits dem Patienten, aber auch dessen sozialem Umfeld gegenüber verantwortlich ist, was zu Wertkonflikten der unterschiedlichen Entscheidungsperspektiven führen kann. Statisches versus dynamisches Naturmodell. Während wissenschaftliche Modelle relativ statisch ausgerichtet sind, orientiert sich der Psychotherapieprozess an einer zeitlichen Dimension, der rekursiv und iterativ ist und sich nicht ohne weiteres auf ein linearstatisches Modell beziehen lässt. Zwar lassen sich manche Verläufe bei biologischen Prozessen brauchbar vorhersagen – z.B. bei bakteriellen Infektionskrankheiten. Bei psychischen Störungen oder chronischen Krankheiten beeinflussen jedoch viele Aspekte wie individueller Lebensstil, Verhaltensmuster, TherapeutKlient-Beziehung (oder die Compliance beim Arzt) das Geschehen in komplexer Weise. Dieser letzte von Kanfer (1997) genannte Aspekt gilt heute zwar immer noch für große Teile psychotherapeutischer Mainstream-Forschung, allerdings betonen gerade humanistische und systemische wissenschaftliche Konzepte die thematisierten nicht-linearen Dynamiken (s.u.). Neben diesen grundsätzlichen Unterschieden zwischen theoretischem und praktischem Handeln im Bereich der Psychotherapie seien drei weitere Aspekte benannt, die hier in spezifischer Weise das Theorie-Praxis-Verhältnis erschweren. Unklare Grundlagendisziplinen In vielen Bereichen wird allein schon durch unterschiedliche Begriffe zwischen wissenschaftlicher Grundlage und praktischem Handeln differenziert – beispielsweise „Medizin“ und „Arzt“, „Pädagogik“ und „Erzieher“ oder „Lehrer“, „Jura“ und „Anwalt“ oder „Richter“ . Eine solche Relation gibt es für die Psychotherapie nicht. Zwar wird über eine mögliche „Psychotherapiewissenschaft“ debattiert, doch konnte sich dies bisher weder begrifflich noch konzeptionell oder gar institutionell durchsetzen. Aus umgekehrter Blickrichtung ist damit die Anbindung praktischer Psychotherapie an eine Grundlagenwissenschaft unklar. So wurde Psychotherapie lange als ärztliche Tätigkeit reklamiert (und ist z.B. in den USA im Gesundheitsbereich weitgehend diesem Berufsstand vorbehalten), was auch eine theoretische Anbindung an die Medizin, spezifisch: die Psychiatrie, implizierte. Auf der anderen Seite finden sich ebenso vehemente Plädoyers dafür, Psychologie als Basiswissenschaft für Psychotherapie zu verstehen (z.B. Baumann 1999). Doch sind zumindest diese beiden Studiengänge – bei Kinder- und Jugendpsychotherapie zudem Pädagogik und in anderen Ländern, wie Österreich, ohnedies noch weitere Ausbildungen – als Basis für eine aufbauende psychotherapeutische Tätigkeit faktisch vorhanden. Diese begründen jeweils heterogene Ausrichtungen und unterschiedliche Gewichtungen von Basiswissenschaften (Medizin, Psychologie, Pädagogik etc.). Theorien über Theorien Zu einem bedeutsamen Teil hat praktische Psychotherapie direkt oder indirekt mit Vorstellungen der Menschen über Krankheit, Entwicklung, Verhaltensursachen, Veränderung etc. zu tun – also mit „Alltagstheorien“ über denselben Gegenstandsbereich, über den auch Therapie als Wissenschaft Aussagen trifft. (Die Landschaft i.o.S. enthält also bereits Landkarten der Landschaft). Mehr noch: diese Alltagstheorien sind durchsetzt von hinreichend korrekten bis absurden Teilen und Abbildern der wissenschaftlichen Psychotherapie und ihrer Theorien. Dies führt zu erheblichen Interferenzen, die wiederum theoretisch wie praktisch mit berücksichtigt werden müssen. Innenwelt-Aussenwelt Quer zur obigen Frage der Grundlagendisziplinen treffen in der Psychotherapie zwei grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven zusammen: Außensicht. Man kann einerseits den Menschen hinsichtlich seiner biochemischen, neuronalen, verhaltensmäßigen Aspekte und deren Korrelate zu Reizkonfigurationen, seine Antworten auf Fragebögen und seine verbalen Aussagen, seine Berichte über Ängste, Ziele, Wertvorstellungen, vermutete logische Zusammenhänge, etc. untersuchen. Obwohl hier bereits unterschiedliche Teilperspektiven aufgezählt wurden - ein streng behavioraler Ansatz würde zumindest die letzten beiden nicht berücksichtigen – bleibt es doch die Sicht „von außen“. Innenwelt. Im Unterschied dazu weiß jeder Mensch, dass sein gesehenes „Rot“, seine „Angst“, seine „Werte“ für ihn etwas grundsätzlich Anderes ist, als das, was sich in physiologischen Messungen, Antworten in Fragebögen oder auch in verbalen Berichten widerspiegelt. Seine erlebte Innenwelt bleibt letztlich privat, auch wenn er den (vermutlich überwiegenden) Teil jener Strukturen, mit denen er auf sich selbst und „die Welt“ Bezug nimmt, in bedeutsamen sozialen Beziehungen erworben und entfaltet hat. Auf der Basis eigener erlebter Innenwelten, ererbter und gelernter Kommunikationsmittel (Affekte und Sprache) sowie gemeinsamer Kultur gelingt es, empathisch (einfühlend) und hermeneutisch (verstehend) etwas über die Innerwelt des Gegenüber zu erschließen. Aber es kann, bestenfalls, sinnvolle, bedeutsame, erlebensintensive und handlungsrelevante Interaktionen gegenseitig letztlich individuell-persönlicher Innenwelten geben. Uns interessieren hier weniger die erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Grundsatzdebatten zu dieser Problematik, welche Regale in Bibliotheken füllen und immer noch weiteres Material liefern. Es geht vielmehr darum, dass nicht nur Begriffe wie „Selbst“, „Hermeneutik“, „Biographie“ diese innen-außen-Differenz reflektieren, sondern auch mit „Coping“ oder „Stress“ zunehmend deutlich wird, dass beispielsweise außenweltliche beschriebene Belastungsfaktoren empirisch und theoretisch nicht hinreichend sind, sondern notwendig die innenweltliche, subjekt-bedeutsame Perspektive mit einbezogen werden muss (und das trotz aller angedeuteten extrem unliebsamen Schwierigkeiten der Erfassung). Eine Theorie bzw. Wissenschaft, welche Psychotherapie erfassen will, müsste daher zumindest eine doppelseitige sein – eine, die beide sehr unterschiedlichen Perspektiven berücksichtigt. Es sei betont, dass diese Differenz auch keineswegs in der unten diskutierten Unterscheidung „Natur versus Kultur“ voll abgebildet werden kann. Auf der Basis des skizzierten Theorie-Praxis-Verhältnisses sollen nun Denkmodelle in Bezug auf wissenschaftlichen Grundlagen der Psychotherapie anhand dreier Taxonomien diskutiert werden. Die Entscheidung, gleich drei „Einteilungen“ zu diskutieren, soll der Gefahr des ontologischen Missverständnisses vorbeugen, solche Taxonomien „gäbe“ es im objektiven Sinne, oder eine sei „wahrer“ als eine andere. Vielmehr handelt es sich um Kategorisierungen zur Orientierung und Differenzierung bedeutsamer Aspekte. Was allerdings als „bedeutsam“ gilt, hängt von den Fragen, Anliegen und Interessen, und damit der Kultur der Kategorisierer ab. Die Dichotomie: Natur versus Kultur „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.“ Dieser 1894 formulierte und oft zitierte Satz von Wilhelm Dilthey weist auf einen bedeutsamen Perspektiven-Unterschied im alltäglichen wie wissenschaftlichen Umgang mit Phänomenen hin. Dies lässt sich anhand eines Beispiels weiter erhellen (Slunecko & Mayer 1999): Ein Forscher erblickt in einem ihm unbekannten Tal eine Ansammlung von verwitterten, eingekerbten Steinen und untersucht diese zunächst mit geologischen und anderen naturwissenschaftlichen Fragestellungen und Methoden, bis er plötzlich entdeckt, dass es sich um eine Formation aus Grabsteinen handelt und die Kerbungen offenbar Zeichen darstellen. Damit geraten nun die Intentionen der menschlichen Handlungen in den Fokus: Nicht die Ursachen sondern die Gründe für die Kerbungen und die Steinformation sind nun wichtig. Was sollen diese bedeuten und für wen soll(t)en sie etwas bedeuten? Um dies zu erforschen muss versucht werden, Wissen über die Lebensumstände, die Geschichte, die Glaubenssysteme – kurz: die Kultur – dieser zu gewinnen (bzw. vorhandenes Wissen unter dieser Perspektive zusammenzustellen). Es dürfte kaum zu bestreiten sein, dass diese Kultur-Perspektive für die Psychotherapie sehr bedeutsam ist. Die Aussage eines Patienten ist selten als Naturvorgang zu fassen, den es objektiv nomothetisch (gesetzmäßig) zu erklären gilt, sondern als Kulturvorgang, der subjektiv und kommunikativ idiographisch (Eigentümliches, Einmaliges beschreibend) verstanden werden muss. Zusätzlich treffen auch hier die o.a. Innen- und Außenperspektive aufeinander, da sich der Mensch wesentlich selbst verstehen muss, als jemand, dessen persönliche (Auto-)Biographie hinreichend konsistent einer „Vergangenheit“ bedarf und sich auf eine „Zukunft“ hin entwerfen kann. Welche Eigenschaften, Defizite und Symptome hat jemand (und „ich selbst“), welche Leistungen und Verhaltensweisen werden (wie stark, wie oft, wann etc.) gezeigt? – Diese Perspektive unterscheidet sich von Fragen wie: „Als wen sehe ich mich, wer bin ich geworden, was will ich im Leben erreichen?“ und dem Erleben, verstanden zu werden, von Geborgenheit oder von Sinnlosigkeit. Bekanntlich ist der Mensch sowohl in der frühen Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins als auch später zumindest in hinreichendem Maße auf das empathische Verstehen signifikanter Anderer angewiesen und die Realität baut sich bedeutsam aus den kulturellen Strukturen auf, wie schon die Sprache zeigt. Gleichzeitig aber sind Verstehens-, Bewusstseins-, Handlungsund Sprachprozesse nicht nur allgemein in Naturvorgänge eingebettet, sondern auch spezifisch von diesen abhängig: Wird das Gehirn funktionsunfähig, so hört jedes psychische Geschehen auf; dies gilt in spezifischer Weise auch für ganz bestimmte, oft hoch spezialisierte neuronale und psychische Zusammenhänge bei Ausfällen und Leistungen (auch wenn die interindividuelle Plastizität und die interindividuelle Varianz der Befunde und Befindlichkeiten im Laufe der Forschung zunehmend höher eingeschätzt wird). Ferner verändern Entwicklungsvorgänge oder die Zufuhr bestimmter Substanzen das subjektive Erleben und beobachtbares Handeln; das Gefühlsleben ist an die Funktion bestimmter Drüsen gebunden, etc. Alle diese somatischen Vorgänge lassen sich im Rahmen der Naturwissenschaft untersuchen und deren Perspektive lässt sich auf die Zusammenhänge zwischen somatischen und psychischen Vorgängen (durch Introspektion oder deren Äußerungen bei anderen) ausdehnen. Ferner lassen bestimmte Aspekte von Wirksamkeit – etwa Reduktion von spezifischen Symptomen, Erweiterung spezifischer Kompetenzen etc. – mit quantitativ-nomothetischer Methodik gut untersuchen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass das, was unter „spezifisch“ jeweils zu verstehen ist, wiederum von Sinn-, Wert- und Zielentscheidungen relativ zur jeweiligen Kultur und ihren (allgemeinen wie wissenschaftsspezifischen) Diskursen abhängt. „Natur versus Kultur“ ist somit ein prägnantes Kürzel für zwei unterschiedliche, besonders im Bereich der Psychotherapie eher komplementäre Perspektiven und Vorgehensweisen, die sich nicht durch die jeweils andere ersetzen lassen. Es wäre daher unangemessen, in der Diskussion, der Forschung oder auch bei den (Denk)Modellen nur eine der beiden zu berücksichtigen. Pluralität der Weltzugänge. Die Perspektive der Kultur ist für die Psychotherapie als Wissenschaft wie als Praxis aber noch in einer anderen Hinsicht bedeutsam: Psychotherapie ist wie jede andere Wissenschaft und professionelle Tätigkeit in die Pluralität der „Weltzugänge“ eingebunden – womit das breite Spektrum von unterschiedlichen Antworten auf die Frage: „wie wollen wir leben?“ gemeint sein soll. Die daraus resultierende Heterogenität an Lebensgeschichten, Vorlieben, Zielen und Werten wird in freiheitlich demokratischen Gesellschaften nicht als Bedrohung oder unerwünschte Abweichungen vom Durchschnitt begriffen, sofern sie mit den Grundkonsensen der Gesellschaft nicht in Widerspruch stehen, sondern als positive Leistung einer Kultur und damit als etwas Erhaltenswertes oder gar Förderungswürdiges. Mehr als andere interventionistische Tätigkeiten (z.B. technische Veränderungen, biologische Eingriffe, ja selbst Vorgehensweisen im Bereich der somatischen Medizin) aber wirkt Psychotherapie in die Struktur von Sinndeutungen hinein. Es geht darum, wie Menschen sich relativ zu einer Sozialgemeinschaft (und ihren Untergruppierungen) biographisch und narrativ in „Vergangenheit“ einordnen und auf „Zukunft“ hin entwerfen. Selbst die Entscheidung, einen als isoliert empfundenen „Tic“, wie z.B. das Augenbrauenhochziehen, „wegkonditionieren“ zu lassen, kommt nicht ohne zumindest implizite Stellungnahme zu Lerngeschichten und zu Bedeutungskontexten aus. Auf der anderen Seite ist Psychotherapie mehr als andere Wissenschaften, die ebenfalls in besonderem Maße Sinn- und Narrative Strukturen zum Gegenstand haben, wie z.B. Soziologie, Theologie oder Literaturwissenschaft, auf interventionistische Veränderung dieser „Lebenswelt“ ausgerichtet. Sowohl die psychotherapeutische Tätigkeit selbst als auch die systematische Reflexion über die Grundstrukturen und Wirkungsweisen dieser Tätigkeit – also die wissenschaftliche (Er)-Forschung der Psychotherapie – spiegeln daher in besonderem Maße diese Pluralität der „Weltzugänge“. Denn selbst unter wünschenswerter maximaler Einbeziehung der Erkenntnisse aus anderen Wissenschaften bezieht sich die Psychotherapie-Wissenschaft im Kern immer auf die oben skizzierte sinnhafte und interventionistische Beziehung zwischen Therapeut und Patient (bzw. Paar oder Familie). Die Fragen danach, wie wir leben wollen, was wir für wesentlich erachten, aus welchem Bild vom Menschen wir die Maximen unseres Handelns ableiten etc. betreffen daher nicht nur das therapeutische Handeln selbst sondern auch dessen Erforschung. Mechanistisch - organismisch – potentiell selbstreflexiv Ausgehend von früheren Arbeiten Eckensbergers (1979) haben Eckensberger & Keller (1998) als Taxonomie der Modellvorstellungen in der Entwicklungspsychologie drei Perspektiven vorgeschlagen. Diese lassen sich in Bezug zur Psychotherapie fruchtbar verwenden, da grundlegende Prinzipien von Entwicklungs- und von Psychotherapie-Prozessen ähnlich diskutiert werden (wobei wir hier „Entwicklung“ allgemeiner durch „Veränderung“ ersetzen). Mechanistische Perspektive. Sie orientiert sich an der Maschinenmethapher: Veränderung liegt außerhalb des Subjekts, steht unter Stimuluskontrolle, ist kausal erklärbar, weitgehend über ReizReiz- oder Reiz-Reaktions-Kontingenzen bestimmt und wird in quantitativ fassbaren, kontinuierlich ändernden Grössen beschrieben. Sie ist bidriektional (Ab- und Zunahme von Leistungen) und normativ neutral, d.h. aus dem Modell heraus lässt sich kein optimaler Endzustand ableiten. Stabilität scheint gegeben, Veränderung muss erklärt werden. Eckensberger & Keller argumentieren, dass nicht nur die Lerntheorien typischerweise diese Perspektive einnehmen. Vielmehr wird sie gegenwärtig durch die Verknüpfung der kognitiven Psychologie (wo diese mit der Computermetapher arbeitet) mit der modernen Hirnforschung belebt. Organismische Perspektive. Sie orientiert sich an der (sozio)biologischen Metapher einer phylogenetischen Entwicklung mit Adaption, Selektion und Mutation von Organismen. Veränderung liegt eher innerhalb des Subjekts, das in aktiver Interaktion mit der Umwelt über Assimilation (sich die Welt anpassen) und Akkomodation (sich der Welt anpassen) seine Strukturen (z.B. Schemata) ausbildet und modifiziert. Teile und Teilprozesse sind ganzheitlich miteinander vernetzt, woraus eine diskontinuierliche qualitative Transformation der Struktur folgen kann (entsprechende Entwicklungstheorien sind daher Stufentheorien). Veränderung findet zwar unter Anpassungsgesichtspunkten statt und lässt sich im Hinblick auf diese bewerten, ist aber nicht auf ein Entwicklungsziel ausgerichtet und daher normativ neutral. Es sei bemerkt, dass manche Wissenschaftstheoretiker genau diese dynamisch-systemischen Aspekte zum Anlass nehmen, statt der Natur-Kultur-Dichotomie eine Unterscheidung in nomologische und autopoietische Realtität vorzunehmen. Letztere ist nicht konstant und unveränderlich gegeben, sondern (in Interaktion mit einer Umwelt) sich selbst steuernd und entwickelnd, und damit eines offenen Entwicklungshorizontes fähig (Schülein & Reitze 2002, Slunecko 2002). Potentiell selbstreflexive Perspektive. Sie stellt ins Zentrum, dass der Mensch nicht nur denken, sondern über sich nachdenken und somit intendiert und zukunftsorientiert handeln kann (auch wenn er von dieser Potenz nicht immer Gebrauch macht). Er deutet und (re-)konstruiert, im Kontext der Gemeinschaft mit anderen Subjekten, nicht nur Situationen und bildet kognitive Schemata sondern manifestiert durch sein Handeln Bedeutung in der Umwelt (vgl. das o.a. Grab-Stein-Beispiel, Werkzeuge und andere Dinge unserer weitgehend „hergestellten“ Kultur-Welt). Kultur bietet dabei sowohl Handlungsgrenzen wie auch –möglichkeiten; zwischen letzteren kann das Subjekt auswählen, hat (zumindest begrenzte) Entscheidungsfreiheiten und ist daher verantwortlich (zu machen). Diese hier nur in aller Kürze skizzierten drei Perspektiven von Eckensberger & Keller sind für die Psychotherapie deshalb von besonderer Bedeutung, weil damit nicht nur typische Welt- und Menschenbilder im wissenschaftlichen Zugang treffend gekennzeichnet sind, sondern nach rund 400 Jahren abendländischer Wissenschaft diese Weltbilder auch in den Vorstellungen der Patienten darüber zu finden sind, welche Entwicklung sie in die Psychotherapie führte und welche Quellen und Bedingungen der Veränderung sie erwarten. Auf den ersten Blick mag man versucht sein, die drei Perspektiven unterschiedlichen Phänomenbereichen als „Selbstverständlichkeiten“ zuzuordnen: die mechanistische eher physikalisch-chemischen Prozessen, die organismische den biologisch-somatischen Vorgängen und die selbstreflexive dem Humanbereich. Dies mag zwar tendenziell korrekt sein, doch wurden die Weltbilder im 20 Jahrhundert, zuletzt besonders durch die System- und Selbstorganisationstheorien, erheblich „aufgemischt“. So sind für die Forschung zunehmend physikalische und chemische Prozesse interessant, welche eben nicht mechanistisch „funktionieren“ sondern genau jene Eigenschaften aufweisen, die charakteristisch für die organismische Perspektive benannt wurden: Qualitative Entwicklungssprünge, Adaptation an gegebene Umweltbedingungen, nicht-Determinierbarkeit, Förderung von Selbstregulation und Selbstorganisation usw. (Kriz 1992, 1997), Auf der anderen Seite findet man sowohl in Forschung und Praxis im Bereich des Lebens (etwa in Teilen der Medizin) und sogar im Bereich des Psychischen teilweise eine Berufung auf jene klassisch-mechanistische Perspektive (Kriz 1998, 1999, 2000). Die Jahrhunderte erfolgreichen Beispiele aus dem Bereich maschineller Technik dienen in unserer Gesellschaft – und damit auch Wissenschaftlern wie Praktikern in der Psychotherapie sowie den Patienten selbst – als Metaphern für Wirkungsweisen und Veränderungsmöglichkeiten biologischer, psychischer und sozialer Prozesse. Selbst Wissenschaftler, die sich beispielsweise dezidiert einer humanistischen und phänomenologischen Position zurechnen, sind dabei nicht gefeit davor, ungewollt mechanistische Modellvorstellungen zu transportieren (Kriz 2003). Eine explizite Auseinandersetzung mit grundlegenden Vorstellungen von Entwicklung, Veränderung und Stabilität ist daher gerade für die Psychotherapie unerlässlich, um nicht zu Metaphern zu greifen, die zur eigenen Theorie und dem Menschenbild „quer“ stehen und daher eine jeweils angemessene Forschung behindern. Vier psychotherapeutische „Grundrichtungen“ Angesichts dieser, hier nur ausschnitt- und skizzenhaft darstellbaren Heterogenität an Perspektiven auf das klinisch-therapeutische Geschehen, ist es nicht verwunderlich, dass sich eine größere Anzahl an therapeutischen Ansätzen oder „Schulen“ entwickelt hat, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte legen. Bisweilen ist diese Schulenbildung auf rein historische oder geographische Entwicklungstendenzen, auf sektiererische Abschottungsbedürfnisse etc. zurückgeführt worden, was zudem für die wünschenswerte Entwicklung einer einheitlichen „wissenschaftlichen“ Therapie hinderlich sei. Bei aller berechtigter Mahnung vor mangelnder Öffnung gegenüber jeweils anderen Ansätzen und Richtungen übersieht eine solche Kritik, dass sich die Vielfalt heutiger Wissenschaftsdisziplinen durch unterschiedliche Interessenschwerpunkte – also „schulenartige“ Konzentration – ausdifferenziert hat und sogar in Wissenschaften wie Physik oder Mathematik heute durchaus unterschiedliche Schulen existieren, ohne dass damit der Vorwurf mangelnder Wissenschaftlichkeit im Raume stünde. Sie übersieht aber insbesondere, dass die Vielfalt therapeutischer Zugänge eine Widerspiegelung der Vielfalt an Werten, Lebensformen, Vorlieben und Ziele in einer pluralistischen Gesellschaft darstellen – quasi als unterschiedlichen Antworten auf die Frage „wie wollen wir leben?“ Nun ist es die wesentliche Aufgabe von Wissenschaft, eine faktische Vielfalt theoretisch einheitlich zu erfassen. Es geht darum, in einem hyperkomplexen Raum aus Symptomen, biographischen und lerngeschichtlichen Ereignissen und deren Deutungen, Bindungserfahrungen, sozialen und kognitiven Prozess-Stabilisierungen, Weltanschauungen, therapeutischen Fähigkeitensaspekten, Vorlieben und Wertentscheidungen, wissenschaftlichen Modellen und Begründungen, Daten und deren Interpretationen usw. niedrigdimensionale Übersicht und Ordnung zu schaffen. Dies kann z.B. durch allgemeine und übergreifende Aspekte der Beschreibung geschehen – z.B. Grawes (1995) Aspekte „Allemeiner Psychotherapie“ oder Weinbergers (1995) „Common Factors“ – oder durch Versuche einer theoretisch integrativen Rekonstruktion (z.B. Kriz 1985, 1991, Grawe 1998). Das Bemühen um eine einheitliche Theorie für die Rekonstruktion therapeutischen Handelns steht allerdings nicht in Widerspruch zur schulenmäßigen Diversifikation dieses Handelns selbst. Denn hier gehen auch die jeweiligen Vorlieben, Fokusse, Lebensvorstellungen der Therapeuten ein, die ebenfalls in die Pluralität der Gesellschaft eingewoben sind. Und bekanntlich gibt es trotz großer Forschungsbemühungen auf dem gegenwärtigen Stand höchstens in Ausnahmen akzeptierte Zuordnungen zwischen diagnostischen „Störungs“-Kategorien und den unterschiedlichen Therapierichtungen. Vielmehr zeigt sich (vgl. exemplarisch Eckert & Biermann-Ratjen 1990), dass die konzeptuelle Identität des Therapeuten innerhalb einer bestimmten Schule nützlich ist und unterschiedliche Schulen differentielle Effekte in der Therapie hervorbringen – die nicht einfach eindimensional auf „höhere oder geringere Effektivität“ reduziert werden können. Bei aller Heterogenität und Ausdifferenzierung im Einzelfall werden oft vier „Richtungen“ der Psychotherapie unterschieden, welchen das Spektrum der Ansätze zugeordnet werden kann. Dabei geht es hier nicht um eindeutige oder überschneidungsfreie Zuordnungen, sondern um die Zentrierung auf bestimmte Aspekte, Themen und Konzepte. a) b) c) d) Analytische und tiefenpsychologische Ansätze Verhaltenstherapeutische Ansätze (einschließlich der kognitiven VT) Humanistische Ansätze Systemische Ansätze (einschließlich der Familientherapie) Diese Cluster haben jeweils nicht nur unterschiedliche Kernkonzepte und damit unterschiedliche Fokussierungen auf den therapeutischen Prozess und was „Veränderung“ überhaupt bedeuten soll. Sondern sie sind auch unterschiedlichen Paradigmen verpflichtet, was klinisch-therapeutische „Realität“ ausmacht – und damit, was als „Fakten“ zu verstehen ist. Aus rein theoretischer Sicht wäre es zwar wünschenswert, dass ein Patient Veränderungen in folgenden „Realitäts“-Aspekten durchläuft, (entsprechend den Kernkonzepten der vier Cluster): a) b) c) die biographische Eingebundenheit seiner spezifischen Konflikt(abwehr)dynamik in deren symptomgebenden (kompromissbildenden) Auswirkungen versteht, ebenso gelerntes Verhalten und/oder der zugrundeliegenden kognitiven Prozessstrukturen ändert und neue Kontingenzen aufbaut, ferner die als Angst gespürte und in Vermeidungsverhalten manifestierte Inkongruenz zwischen seinem organismischen Erleben und seinem „Selbst“ zumindest in den symptomgenerierenden Auswirkungen durch Reintegration des nicht-Zugänglichen ins „Selbst“ vermindert, und letztlich auch d) seine destruktiven narrativen Konstruktionen über seine Beziehungen zu sich, zu anderen und zur Welt und deren gegenseitige Stabilisierung in den Interaktionen bedeutsamer Anderer (z.B. Partner oder Familie) verflüssigt und zu neuen Sinn- und Interaktions-Mustern („Attraktoren“) in den jeweiligen Systemdynamiken findet. Kein Therapeut kann jedoch alle diese Aspekte handlungsrelevant im Kopf haben – obwohl hier nur einige Aspekte der Kernkonzepte exemplarisch zur Sprache kamen (so fehlen z.B. spezifischere Konzepte wie „Individuation“, „Lebenspläne“, „falsches Reasoning“, „Kontaktzyklus“ , „Problemsysteme“ usw.). Aber selbst wenn ein Therapeut alle diese thematisierten Aspekte im Auge haben könnte, würde sich – auf dem gegenwärtigen Forschungsstand – wenig Praktisches daraus ergeben: Er müsste sich letztlich in einer konkreten Situation und im Hinblick auf die Beschwerden des Patienten entscheiden, ob er z.B. eher regressive Prozesse und Übertragungsdynamiken fördern, einen sokratischen Dialog oder eine systematische Desensibilisierung beginnen, durch empathische Begegnung oder Focusing unbewusstes organismisches Erleben ins Selbst integrieren oder über zirkuläres Fragen, paradoxe Intervention oder lösungsorientiertes Interview bestimmte narrativinteraktive Muster verändern will (um wieder nur wenige Aspekte zu nennen). Ebenso wird trotz der oben genannten theoretischen Integrationsbemühungen auch der Wissenschaftler oft im Rahmen jeweils eines dieser Denkmodelle seine spezifischen Fragen formulieren und spezifische Methoden der Untersuchung und Überprüfung entwickeln. Wissenschaft beinhaltet das reflektierte, zielgerichtete Herausarbeiten zugrundeliegender Strukturen in einem bestimmten Gegenstandsbereich – einschließlich der Rekonstruktion der Wirkungen, die diese Strukturen entfalten. Im Falle von Psychotherapie ist der Gegenstandsbereich die PatientTherapeuten-Beziehung, die ihre Wirkung vor allem in der Veränderung der leidvollen Prozesse des Patienten zu entfalten hat. Das „Herausarbeiten“ geschieht im Rahmen einer und in Rückwirkung auf eine Theorie. Je nach wissenschaftstheoretischer Position kann es sich aber z.B. um eine nomologische bzw. denotative Theorie handeln, die u.a. falsifizierbare Prognosen ermöglicht. Oder aber es geht um eine interpretative bzw. konnotative Theorie, die vor allem das rekonstruktive Verstehen im Gesamt-Sinnzusammenhängen zum Ziel hat (vgl Schülein & Reitze 2002). Darüber hinaus sind die Fragen nach den wissenschaftlichen Grundlagen der jeweils in den Ansätzen zu findenden Konzepte, Grundannahmen und Hypothesen nicht identisch mit den Fragen nach einer wissenschaftlichen Überprüfbarkeit der Effektivität des Ansatzes. Letztere richtet sich zwar oft an klassisch-naturwissenschaftlichen Modellen aus. Doch müssen zumindest folgende drei Aspekte der Relativierung berücksichtigt werden: Psychotherapie wird grundsätzlich nicht technisch kontrolliert konstant hergestellt, sondern ist situationsspezifisch nicht appliziert, sondern entsteht erst in der Begegnung Patient-Therapeut ist damit grundsätzlich sozial-sinnhaft. Forschung, die dies nicht berücksichtigt, ist stark von Artefakten gefährdet. Wissenschaft ist wie Psychotherapie ein hoch ausdifferenziertes soziales Gebilde, das mit seinen unterschiedlichen Ausrichtungen und Grundpositionen unweigerlich in die Heterogenität der Weltbilder einer Kultur eingeflochten ist. Da es eine zentrale Aufgabe von Wissenschaft ist, nicht für irgendeine Position unreflektiert Partei zu ergreifen, sondern stattdessen einen rationalen Diskurs zu über die und zwischen den Positionen zu ermöglichen, werden anhand unterschiedlicher Taxonomien Kernkonzepte in der Debatte über psychotherapeutische Grundmodelle vorgestellt. Dabei geht es vor dem Hintergrund des Theorie-Praxis-Verhältnisses zunächst um die Dichotomie „Kultur – Natur“, die dann um die Konzept-Trias „mechanistisch – organismisch – potentiell selbstreflexiv“ ergänzt wird. Die eröffnet letztlich einen differenzierten Blick auf die Bedeutung der Unterschiede in den vier großen therapeutischen Hauptströmungen – die gleichzeitig auch das Spektrum unterschiedlicher Lebenszugänge in unserer Kultur widerspiegeln. Literatur: Baumann, U. (1999): Wissenschaftliche Psychotherapie auf der Basis der wissenschaftlichen Psychologie. In: Petzold, H. & Märtens, M. (Hrsg.): Wege zu effektiven Psychotherapien. Opladen: Leske & Budrich, 45-61 Eckensberger, L.H. (1979): A metamethodological evaluation of psychological theories from a cross-cultural perspective. In: Eckensberger, L.H. et al. (Hrsg): Cross-cultural contributions to psychology. Lisse: Swets & Zeitlinger, 255-275 Eckensberger, L. H. & Keller, H. (1998): Menschenbilder und Entwicklungskonzepte. In: Keller, H. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. Bern: Hans Huber Eckert, J.; Biermann-Ratjen, E.-M.(1990): Ein heimlicher Wirkfaktor: Die "Theorie" des Therapeuten. In: Tschuschke, V.; Czogalik, D. (Hrsg.): Psychotherapie - Welche Effekte verändern? S. 272-287. Berlin: Springer Grawe, K. (1995): Grundriss einer allgemeinen Psychotherapie. Psychotherapeut, 40, 130-145 Grawe, K.(1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe. Kanfer, F. (1997): Wissenschaftliche Grundlagen der Psychotherapie: Lerntheoretische Sicht. In: Senf, W. & Broda, M. (Hrsg.): Praxis der Psychotherapie. Stuttgart: Thieme, 19-23 Kriz, J. (1985): Grundkonzepte der Psychotherapie. München: Urban&Schwarzenberg (5. Aufl. 2001: Weinheim: Beltz/PVU). Kriz, J. (1991): Mental Health: Its Conception in Systems Theory. An Outline of the Person-Centered System Approach. In: Pelaez, M.J. (Ed.): Comparative Sociology of Familiy, Health & Education, XX, (Malaga, Espania), 6061 - 6083 Kriz, J. (1992): Chaos und Struktur. Systemtheorie Bd 1. München, Berlin: Quintessenz Kriz, J. (1996): Grundfragen der Forschungs- und Wissenschaftsmethodik. In: Hutterer-Krisch, R. et.al.: Psychotherapie als Wissenschaft - Fragen der Ethik, Bd. 5 der "Serie Psychotherapie" (Hrsg.: G. Sonneck), Wien: Facultas, 15-160 Kriz, J. (1997): Systemtheorie. Eine Einführung für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas Kriz, J. (1998): Die Effektivität des Menschlichen . Argumente aus einer systemischen Perspektive. Gestalt Theory, 20, 131-142 Kriz, J. (1999): Fragen und Probleme der Wirksamkeitsbeurteilung von Psychotherapie. In: Petzold, H. & Märtens, M. (Hrsg.): Wege zu effektiven Psychotherapien. Opladen: Leske & Budrich, 273 – 281 Kriz, J. (2000): Perspektiven zur „Wissenschaftlichkeit von Psychotherapie. In: Hermer, M. (Hrsg.): Psychotherapeutische Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunderts. Tübingen: DGVT-Verlag, 43 – 66 Kriz, J. (2003): Mechanistischer Humanismus statt humanistischer Systemtheorie ? PERSON, X, yyy-yyy Perrez, M. (1982a): Was nützt Psychotherapie ? Psychol. Rundschau, 33, 121-126 Perrez, M. (1982b): Die Wissenschaft soll für die psychotherapeutische Praxis nicht länger tabu bleiben. Psychol. Rundschau, 33, 136-141 Schülein, J.A. & Reitze, S. (2002): Wissenschaftstheorie für Einsteiger. Wien: WUV/UTB Slunecko, T. (2002): Von der Konstruktion zur dynamischen Konstitution. Wien: WUV Slunecko, T. & Mayer, H. (1999): Das Hindernis und die Schwelle. In: Slunecko, T. et al. (Hrsg.): Psychologie des Bewusstseins – Bewusstsein der Psychologie. Wien: WUV, 219-232 Weinberger, J. (1995): Common factors aren´t so common: the common factors dilemma. Clinical Psychology, 2, 45-69 Westmeyer, H. (1978): Wissenschaftstheoretische Grundlagen der klinischen Psychologie. In: Baumann, U. et al. (Hrsg.): Klinische Psychologie – Trends in Forschung und Praxis. Bern: Huber, 108-132 Westmeyer, H. (1980): Zur Paradigmadiskussion in der Psychologie. In: Michaelis, W. (Hg.), Kongreßber.d.Dt.Ges.f.Psychol S. 115-126.