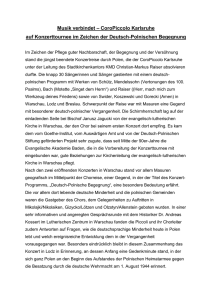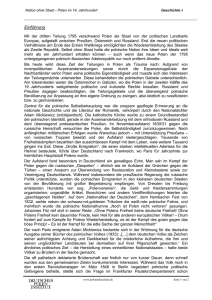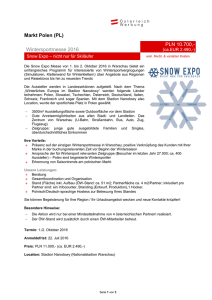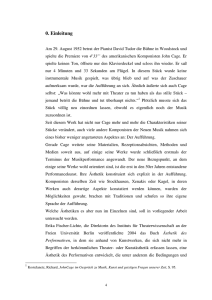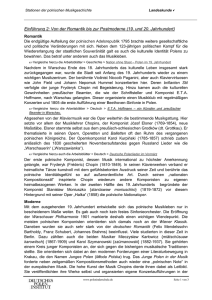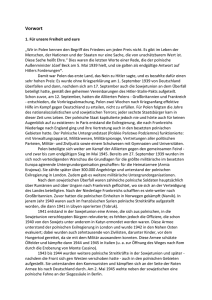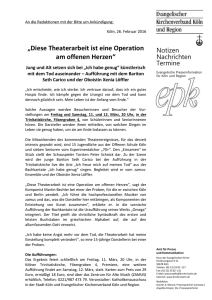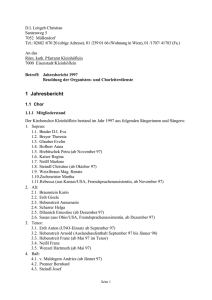Was soll ich sagen - ich bedaure es, dass ich nicht mit Fotoapparat
Werbung
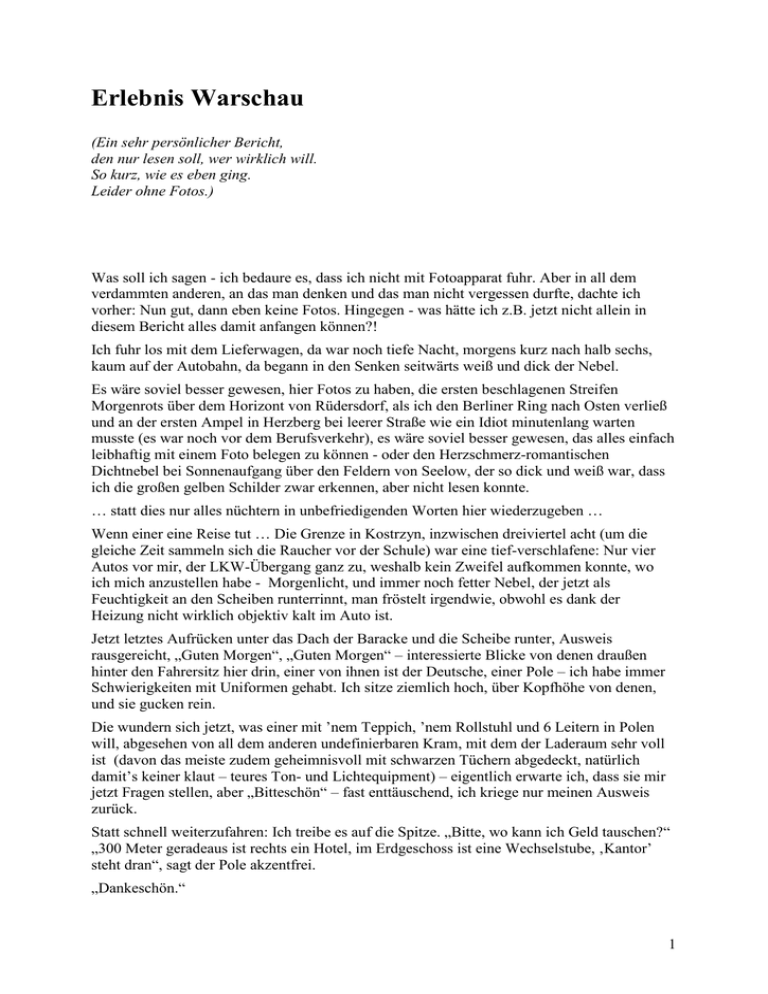
Erlebnis Warschau (Ein sehr persönlicher Bericht, den nur lesen soll, wer wirklich will. So kurz, wie es eben ging. Leider ohne Fotos.) Was soll ich sagen - ich bedaure es, dass ich nicht mit Fotoapparat fuhr. Aber in all dem verdammten anderen, an das man denken und das man nicht vergessen durfte, dachte ich vorher: Nun gut, dann eben keine Fotos. Hingegen - was hätte ich z.B. jetzt nicht allein in diesem Bericht alles damit anfangen können?! Ich fuhr los mit dem Lieferwagen, da war noch tiefe Nacht, morgens kurz nach halb sechs, kaum auf der Autobahn, da begann in den Senken seitwärts weiß und dick der Nebel. Es wäre soviel besser gewesen, hier Fotos zu haben, die ersten beschlagenen Streifen Morgenrots über dem Horizont von Rüdersdorf, als ich den Berliner Ring nach Osten verließ und an der ersten Ampel in Herzberg bei leerer Straße wie ein Idiot minutenlang warten musste (es war noch vor dem Berufsverkehr), es wäre soviel besser gewesen, das alles einfach leibhaftig mit einem Foto belegen zu können - oder den Herzschmerz-romantischen Dichtnebel bei Sonnenaufgang über den Feldern von Seelow, der so dick und weiß war, dass ich die großen gelben Schilder zwar erkennen, aber nicht lesen konnte. … statt dies nur alles nüchtern in unbefriedigenden Worten hier wiederzugeben … Wenn einer eine Reise tut … Die Grenze in Kostrzyn, inzwischen dreiviertel acht (um die gleiche Zeit sammeln sich die Raucher vor der Schule) war eine tief-verschlafene: Nur vier Autos vor mir, der LKW-Übergang ganz zu, weshalb kein Zweifel aufkommen konnte, wo ich mich anzustellen habe - Morgenlicht, und immer noch fetter Nebel, der jetzt als Feuchtigkeit an den Scheiben runterrinnt, man fröstelt irgendwie, obwohl es dank der Heizung nicht wirklich objektiv kalt im Auto ist. Jetzt letztes Aufrücken unter das Dach der Baracke und die Scheibe runter, Ausweis rausgereicht, „Guten Morgen“, „Guten Morgen“ – interessierte Blicke von denen draußen hinter den Fahrersitz hier drin, einer von ihnen ist der Deutsche, einer Pole – ich habe immer Schwierigkeiten mit Uniformen gehabt. Ich sitze ziemlich hoch, über Kopfhöhe von denen, und sie gucken rein. Die wundern sich jetzt, was einer mit ’nem Teppich, ’nem Rollstuhl und 6 Leitern in Polen will, abgesehen von all dem anderen undefinierbaren Kram, mit dem der Laderaum sehr voll ist (davon das meiste zudem geheimnisvoll mit schwarzen Tüchern abgedeckt, natürlich damit’s keiner klaut – teures Ton- und Lichtequipment) – eigentlich erwarte ich, dass sie mir jetzt Fragen stellen, aber „Bitteschön“ – fast enttäuschend, ich kriege nur meinen Ausweis zurück. Statt schnell weiterzufahren: Ich treibe es auf die Spitze. „Bitte, wo kann ich Geld tauschen?“ „300 Meter geradeaus ist rechts ein Hotel, im Erdgeschoss ist eine Wechselstube, ‚Kantor’ steht dran“, sagt der Pole akzentfrei. „Dankeschön.“ 1 Ich fahre. Es ist dieser undurchschaubare Slalom von Gummihütchen und Barrieren, die ich von jeder Grenze kenne. 300 Meter weiter steht (gelb, Neubau) dieses verschlafene Hotel im Morgenlicht, zugepflastert mit – man kann viele Einwortsätze daran lesen - diesen übergroßen Billigschildern (ich bin ja nicht blind), darunter KANTOR. Ich erinnere mich plötzlich, dass ich hier, bei anderem Wetter, anderer Tageszeit, anderem Licht, schon mal gewesen bin, stelle das Auto eine Minute gut verschlossen auf dem leeren, überweiten Kiesparkplatz ab und gehe durch die automatisch aufrutschende Doppel-Glastür hinein in die Kühle einer überflüssigen Klimaanlage. Der Typ hinter seiner Glasscheibe, der mir mein Geld wechselt, ist so freundlich wie die Nachtschicht im Knast, nur nicht so redselig. Na bitte, dann nicht. Fünf Mimnuten später bin ich auf dem Weg nach Osten, ins Morgenlicht hinein, eine Allee im Nebel, auf der bereits melancholisch die Herbstblätter treiben. Keinerlei anderer Verkehr auf der schwarzen, glatten Straße unterwegs, weder in dieser noch in jener Richtung, was ein wunderbares Fahren macht. Das letzte, was man von Kostrzyn sieht, ist eine BP-Tankstelle an einem leeren Kreisverkehr, der Asphalt der Straße offenbar noch keine drei Tage alt. Keine Markierungen. Dann ist man völlig allein mit sich, mit den Alleen, die sich herbstlich entblättern, der eigenen Geschwindigkeit, dem Morgenlicht und dem Nebel. Kaum Ortschaften. Gelegentlich ein Haus seitab, heruntergelassene Rolladen, ein Gemüsegärtchen, wo Bäume im Nebel Schattenstreifen ziehen, gelegentlich ein entgegenkommender Lastwagen. Einsamkeit, wie ich sie bestenfalls von den Nachkriegs-Landstraßen meiner Kindheit kenne. Ein Schießhochstand im Nebel direkt an der Straße. Zwischen zwei Dörfern ist eine junge Frau unterwegs, mit einer mattglänzenden Milchkanne auf dem Kopf. Sowas sieht man sonst nur in sehr alten Filmen. Das Morgenprogramm von Antenne Brandenburg (das einzige, was auf diesem Radio läuft) ist eine Strafe für Verdammte, Gott sei Dank wird der Empfang zusehends schwächer, und ein polnischer Sender kommt mehr und mehr durch, mit Text, den ich nicht verstehe, aber viel Musik, die ich mag. Bei Gorzów-Wielkopolskie reißt urplötzlich der Nebel auf. Ich fahre gerade eine breite Außenbezirks-Straße ohne Häuser seitlich hinunter. Binnen einer Minute ist die Sonne da, und man kann weit das Tal und die Stadt auf der anderen Seite überblicken – wunderhübsch. Den Rest der Fahrt bei Sonne. Die Straßen sind jetzt voller, Lastwagen, alte Busse, PKW, Trecker, Pferdefuhrwerke unterwegs, aber es hält sich sehr in Grenzen, gemessen an dem, was man von uns kennt. Es ist irgendwie eine Reise in die Vergangenheit. Es ist so wie 1972, da war ich das erste Mal in Polen. Da war die Strecke über Posen und Warschau zur russischen Grenze hin genau solch eine verlassene, sonnige, gerade, leere, wunderbare Landstraße wie diese hier. Neulich bin ich sie wieder ein Stück gefahren, es ist inzwischen ein trostloser und lebensgefährlicher Verkehrsweg durch ein ekelhaftes Industriegebiet einzig von gesichtslosen Hotels, Gewerbeansiedlung, Neon und Puffs, wo ein Lastwagen an der Stoßstange des anderen klebt, während auf der beidseitig gemeinsamen Mittelspur weiße und silberne Porsches und Audis aus Düsseldorf und München mit Tempo 240 um ihr Vorrecht aufs Überholen kämpfen. Dagegen dies hier: die weißen viereckigen ausgestochenen Teiche in den Dörfern, in denen sich der Himmel spiegelt. Ein Herrenhaus seitwärts, das auch im Italien der 50er Jahre stehen könnte. Eine Herde Gänse, gehütet von einem acht- oder neunjährigen Mädchen , oder eine Kuh, gebunden an einen Pflock, und eine alte Frau, die am Grashang sitzt dabei. Die Alleen sind schattig, die Landschaft rechts und links hügelt sich davon in der warmen Sonne. Das Alleinsein mit sich selbst, der wenige Verkehr, der unwirklich bleibt. Bydgoszcz ist eine alte Stadt, mit Kopfsteinpflaster und verwahrlosten Parks. Von den Häusern blättert der Putz, aber die Sonne scheint darauf. Verblasste Ladeninschriften. Eine Reise zurück in die Kindheit. Straßenbahnschienen. Dann ein Bahnübergang. 2 Ich kann recht schnell fahren und lehne bequem über dem Lenkrad. Die Tatsache, dass die Straßen über Kilometer und Kilometer schnurgerade dahingehen, macht selbst bei meinem nicht gerade spurtfreudigen Renault das gelegentliche Überholen zu einer Sache mit kalkulierbarem Risiko. Wenn allerdings diese Spurrinnen nicht wären, wäre es hübscher, in denen man beim Ausscheren ins Schlingern gerät - vom Schwerverkehr und der Sommerhitze gepflügt, und es ist manchmal so, als ob man zwischen Gartenmauern fährt. Bodenwellen quer zum Weg, die ich, wenn ich sie kommen sehe, zwar vorsichtig nehme, aber trotzdem dann fliegt hinten das ganze Zeug, Scheinwerfer, Leitern, Tonpulte in einer gemeinsamen Aktion hoch und landet krachend wieder unten. Jeder dieser Schläge tut mir persönlich weh. Irgendwann rechts hier in dieser Gegend, denke ich, überholen mich die Schüler rechterhand. Sie sind morgens nach mir mit dem Zug vom Bahnhof Zoo gestartet, aber schneller als ich, und sie werden schon gegen Mittag in Warschau sein. Fast eine dreiviertel Stunde fahre ich hinter einem Militärkonvoi her, der mit 40 dahinschleicht, eine endlose Kette von identischen Lastwagen mit Plane auf der Straße vor mir. Als letztes fährt eine Art Jeep, bei dem jedesmal, wenn man überholen will, eine anonyme rote Fahne unter der Plane hervorgereckt wird, während die Karre einen Schlenker nach links ausführt, gefährlich rein in den Gegenverkehr. Na gut, hab kapiert – und ich bleibe trotz 40 dahinter. Soll ich statt dessen jetzt essen gehen? Na, lieber das Auto nicht unbeobachtet lassen. Die Sonne steht jetzt hoch, es ist heller Mittag, und ich bin überrascht, dass ich schon über 6 Stunden fahre. Irgendwann biegen die Soldaten nach links in den Wald ab, um das Vaterland zu schützen. Zwei Uhr Mittags: Ab Toruń beginnen die endlosen Birkenwälder. Gelegentlich führt ein Schotterweg schnurgerade dort hinein. An den meisten dieser Einmündungen, rechts wie links, stehen Mädchen und blicken den ankommenden Autofahrern entgegen, so als ob sie eine Verabredung mit Vater, Bruder oder einem Bekannten hätten, so als ob sie hier Blaubeeren gepflückt hätten und ins nächste Dorf, ins nächste Städtchen zurück mitgenommen werden wollen. Aber sie haben keine Blaubeeren, keinerlei Gepäck dabei. Es sind in der Regel sehr junge Mädchen, könnten meine Schülerinnen sein, und sie sind so angezogen, wie meine Mutter es „anständig“ genannt hätte. Sie zeigen nicht den Bauchnabel wie unsere Mädchen an der Bülow. Gelegentlich sieht man einen der Lastwagen aus der Ukraine oder Lettland, die gehalten haben, die Beifahrertür offen, und offensichtlich sind da von unten nach oben Verkaufsverhandlungen im Gang. Die Diskrepanz zwischen hellem Sonnenschein, grünem Birkenwald, der anständigen Kleidung und dem, was vorgeht, ist in jeder Hinsicht schwer zu ertragen. Irgendwo in der Einsamkeit gibt es links ein Motel, ein Restaurant, ganz aus Holz, am Wald, sehr gemütlich, und ich rolle vorbei und denke, hier werde ich auf der Rückfahrt etwas essen. Eine Stunde später kündigt sich Warschau an, denn die Straße wird zur Autobahn, und der Verkehr nimmt zu. Ich habe zweimal, in Torn und einmal danach, die Wiswa, die Weichsel überquert, imposante Brücken. Das Land ist jetzt flach, uninteressant, besiedelter, die Häuser sind höchstens zweistöckig und haben flache Dächer wie in Norditalien oder Griechenland. Die Sonne scheint, es ist auch griechisches Licht. Lieblose Bauten in weiten Äckern. Ich polke die Stadtpläne von Warschau hervor und falte sie auf der Ablage unter dem Steuerrad auf, studiere sie beim Fahren. Der Verkehr nimmt zu, es gibt quer über das weite Land hohe Alleen von weiten Hochspannungsmasten, unter denen ich durchrolle. Der Radioempfang wird besser, es gibt mittlerweile mehrere Sender zur Wahl. Ich fahre in den sonnigen Nachmittag hinein nach Südosten. Der Tacho zeigt fast 700 km von der Haustür in Berlin. Mir kam es, ehrlich gesagt, kürzer vor. Ich mustere den Stadtplan. Da ich sozusagen am Fluss entlang von Nordwesten hereinkomme, muss die Anzahl der Stadtbezirke, die gleich auf Schildern zu lesen sein wird, denke ich, 3 gering sein. Bielany, Zoliborz – wo bin ich? Es gibt hier die hohen, rot-weiß geringelten Schornsteine von Kraftwerken, auch viel Wald, links den Fluss, rechts unten unter der Autobahn die Häuser – ist dies schon Warschau? Ich kenne, denke ich, Warschau von meinen bisherigen Besuchen recht gut, aber ich bin noch nie von Nordwesten gekommen. Rechts sagt mir eine Abfahrt, dass es zu irgendwas Olympischem geht. Wo, zum Teufel, ist in Warschau ein Olympisches Dorf? Tja, Pech gehabt, oberschlau gewesen. Zehn Minuten später fahre ich an der alten Festung am Weichselufer vorbei, ich erkenne sie rechts oben vor der Sonne. Also habe ich die Abfahrt verpasst. Also biege ich ab, in den regulären Stadtverkehr hinein, und fahre parallel dazu, wie ich gekommen bin, nach Norden zurück, ständig irgendwelche qualmenden, schleichenden Lastwagen vor mir. Die Straßenschilder sagen mir nichts. Aber ich erkenne, dass ich die Straße wiedererkenne, mit dem charakteristischen Straßenbahn-Schotterbett rechterhand – hier haben damals die Kollegen gewohnt. Uliza Adama Mickiewicza. Aha. Gleich wird dieser Platz kommen, denke ich, den ich im Geiste vor mir sehe. Der hieß irgendwie … irgendwas mit einem unbekannteren amerikanischen Präsidenten. Voilà, der Platz kommt: Plac Wilsonia. Zehn Minuten später bin ich an der Schule. Es ist halb vier, knapp zehn Stunden habe ich gebraucht, insgesamt, natürlich, länger als der Zug. Die Sonne scheint auf den Parkplatz. Das rotziegelige Gebäude, die modernen Freitreppen davor. Die Hochhäuser im Hintergrund, der baumige Park zum Fluss hin, all das kenne ich. Ich geh hinein, etwas knieweich von der Fahrt. Eva Maniszewska, die Direktorin (was für eine bezaubernde Frau!) serviert mir in ihrem Büro Tee. Dann ist alles gut. Ich sehe sie, meine Schüler/innen - alle da, alles in Ordnung, weil die polnische Gruppe gerade probt. Hallo, Ihr Süßen. Ich locke sie hinaus in die warme Sonne, sie haben nichts zu tun. Ich denke mir, warum sollen sie nicht draußen die verdammte Sonne genießen, sie haben immerhin letzte Woche in Berlin zwei bravouröse Aufführungen hingelegt, was will man mehr – sie brauchen im Augenblick nicht unbedingt zu proben. Lass erst mal die Polen machen. Ein Problem sehe ich immerhin. Die Polen proben in dem Raum, in dem gespielt werden soll – dies ist eine Art Foyer oder Atrium – ich kenne den Raum, ich kenne die Schule, der Raum ist im Grunde optimal. Er wäre, sagen wir, wirklich optimal, wenn man ihn verdunkeln könnte, denn so dringt das Sonnenlicht gleißend bis auf die Spielfläche, und ich habe zwar im Grunde nichts gegen Sonnenlicht, aber ich weiß, dass Sonnenlicht und Theateratmosphäre absolut zweierlei Ding sind. Wir müssen, denke ich, diesen verdammten Raum verdunkelt kriegen, oder wie?! Das ist absolut klar, sagen sie mir, das machen sie immer so, sie stellen rechtzeitig Pappen vor die Fenster, kein Problem. Rechtzeitig? denke ich, leicht nervös. Heute ist Donnerstag, übermorgen wollen wir spielen. Wann ist in Polen „rechtzeitig“? Denn immerhin müssen wir ja, sollte der Raum erst einmal verdunkelt sein, so etwas wie eine Einleuchtung der Bühne mir den Scheinwerfern, die ich mitgebracht habe, vornehmen. Also wann? Der zuständige „Techniker“, wird mir bedeutet, nun gut, wollte zwar um 14 Uhr da sein, aber um 16 Uhr war er noch nicht da, und um 18 Uhr ruft er an, dass er es heute nicht mehr schafft, er käme aber am nächsten Morgen (Freitag) um 10. - Und ehe man hier allzu vorschnell zu allzu harschen Urteilen findet, sollte man sich einfach klar machen, dass, ganz anders als bei uns, jeder Lehrer in Polen, jeder! (und unser „Techniker“ gehörte zu jenen), um sich finanziell überhaupt über Wasser halten zu können, neben der Schule her eben den einen oder anderen Job zusätzlich machen muss. So banal, so einfach, so verständlich! Und deshalb kam er auch am nächsten Morgen um 10 nicht (inzwischen Freitag, der Tag vor der Aufführung). Er ließ stattdessen vermelden, er käme um zwei. 4 Aber auch um zwei kam er nicht. Um zwei dagegen, als für uns die Probe angesetzt war, war das Foyer/Atrium überraschenderweise besetzt, und es probte - sehr lautstark, personalreich und überaus intensiv - eine uns unbekannte Tanzgruppe ethnisches Volksgut für den Oktober (wir dagegen wollten morgen spielen …). Auf unsere schüchterne Frage an die zuständige und sehr resolute Lehrerin, wie lange denn das ethnische Gebahren auf unserer Probenbühne noch anhalten würde, sagte sie, bis drei – um drei wollte sie aber davon nichts mehr wissen. Drei hätte sie nie im Leben gesagt. Und um vier probte sie immer noch. Wir dagegen hatten unsere Probe bis 6 angesetzt gehabt, hätten also zu diesem Zeitpunkt noch gerade knappe zwei Stunden zur (letzten) Probe für unser Theaterstück übrig. Da trat bei dem einen oder anderen ein gewisser Schweiß auf die Stirn. Pech war, dass Frau Direktorin Maniszewska an diesem Tage für uns nicht handhabbar war – sie war voll im Stress, denn zu allem Überfluss (bzw. durchaus im beabsichtigten Kontext unseres Theaterstückes) waren ja am übernächsten Tag, dem Sonntag, Sejm-Wahlen in Polen - und dieses gewaltige Ereignis, zumal die betreffende Schule als Wahllokal ausersehen war, warf seine deutlich sichtbaren Schatten voraus. Und so war eben nicht nur die Direktorin vorübergehend nicht greifbar, sondern wurde die Schule selbst auch zu einem überraschenden, plötzlichen und undurchschaubaren Labyrinth – plötzlich waren Gänge mit Tischkavalkaden und mit drohenden polnischen Warnschildern verbarrikadiert, wir durften nicht mehr durch den Haupteingang, und plötzlich waren auch ganz normale Toiletten unserem arglosen Zugriff entzogen. Dies war im Ernst ein Wahllokal – und sie fürchteten als Partizipanten des Irak-Konfliktes Terrorakte. Dementsprechend war die Sicherheit. Der Techniker, der notwendige Techniker, um unsere von Berlin teuer per Minibus mitgebrachten Scheinwerfer zu installieren, er kam also am ersten Tag nicht um 14, 16 oder 18 Uhr, wie versprochen, und auch am 2. Tag nicht, wie versprochen, um 10 und auch nicht um 2, aber er kam doch um viertel nach vier. Mittlerweile liefen die letzten 24 Stunden vor unserer Aufführung. Er musste uns zumindest die Kabel geben, an die wir unsere Scheinwerfer anschließen konnten. Sie hatten den Strom, wir hatten die Lampen, wir brauchten von ihm die Kabel. Die hatten wir in Berlin selbst nur geliehen gehabt und inzwischen zurückgegeben. Das Gespräch, das ich auf Englisch mit ihm führte, als er kam (handshake), war überaus kurz. (Ich:) “Could you show us the cables for the stage lights, please?” Er: “No, we haven’t any.” Ich: „I see. – How will you then please install the stage lights we brought here?“ Er: (einfache Antwort): „Not at all, I can’t do this“ Ich ehrlich gesagt, ziemlich fassungslos): “And why not?” Er : “I never have done it before.” Nun immerhin … Lächeln seinerseits – und das war für ihn das Ende der Affaire. Wir würden (der Raum war inzwischen vom Hausmeister perfekt sonnenverdunkelt) mithin nachtschwarz auf dunkler Bühne im absolut Unsichtbaren spielen. Die befasste bedauernswerte polnische Kollegin (dear Agnieszka!) zog zu diesem Zeitpunkt die ungefähr 492. Probe durch, George W. Bush teufelte wirkungsvoll im Dunkeln etwas über den heiligen Krieg – leider sah man den Präsidenten nicht – und auch nicht die Friedenstaube oder die Tussen oder die Cheerleader sah man nicht, weil sich die eifrigen polnischen Schüler mit dem übersetzten Text leider im völlig Dunkeln abmühten. Um 18 Uhr, zu dem Zeitpunkt, als das Ende der Probe angesetzt war, wurde mir klar, dass die Dunkelheit sich nicht lichten würde, würde ich nicht versuchen sie zu lichten. Ich wartete mühsam beherrscht das Ende der Probe ab und fing dann an, etwas panisch herumzubrüllen und ganz normale Verlängerungsschnüre anzufordern, vom nächsten Fernseher z.B. oder meinetwegen vom Toaster aus der Caféteria – war mir doch egal. Die Schüler zogen auf Schnurraub aus und brachten genug Verlängerung, um eine Lampe direkt an die nächste Steckdose zu bringen. Nicht an unser Steuerpult, i-bewahre, das konnten wir uns abschminken, aber an die nächste Steckdose. Wir würden unsere Lampen nicht zentral 5 steuern, kunstvoll aufblenden, stimmungsstark abblenden können, wir konnten sie bestenfalls an die nächste Steckdose hauen wie einen Staubsauger oder den vorerwähnten Toaster. Das heißt … das immerhin hätten wir fast geschafft ... Leider zeigte die erste wie auch alle weiteren Verlängerungsschnüre, dass wir die Rechnung ohne die polnische Elektronorm gemacht hatten. Die Polen sind zwar jetzt in der EU, aber elektrisch sind sie eben noch in Polen. Man kennt das: In Amerika haben sie, um uns zu ärgern, dünne Schlitze statt runder Löcher, in der Schweiz zu dicke Pole für unsereinen und obendrein gemeinerweise den falschen Abstand, aber was unsere östlichen Freunde da so bieten, das ist wirklich Spitze. In Polen haben die Stecker nämlich so eine Art Zyklopenauge auf der Stirn – ja, die Erdung besteht aus einem wahrlich abenteuerlichen dritten Metallstäbchen, das dreist jede Annäherung verhindert, einen deutschen Stecker auch nur entfernt in eine polnische Steckdose oder einen Verlängerungsschnurstecker einzuführen – dieser dritte absolut störende Dorn wirkt derart verblüffend, dass man sich unwillkürlich nach der versteckten Kamera umschaut. Leider war mir nicht nach Lachen zumute. Wir trieben Dreifachsteckdosen auf, fingen an, Stecker aufzuschrauben und Plastik auseinanderzubrechen, denn natürlich war das meiste von diesem Zeug japanisch-koreanisch genietet statt geschraubt. Die Finger zitterten und rutschten vom Schweiß, in weniger als 20 Stunden würden wir gespielt haben müssen. Bis 18 Uhr heute war die Probe angesetzt gewesen, aber bis halb zehn tobte an diesem Abend der Nahkampf mit der Technik; Kabeltrommeln tauchten plötzlich auf, unser Einsatz war heldenhaft, unsere Waffen waren Zangen und Schraubenzieher, wir bauten Adapter. Am Schluss konnten wir sechs Scheinwerfer von den 10 mitgebrachten (gegenüber 21 in der deutschen Aufführung) auf die oben beschriebene Art dezentral anschließen (also raus aus den Steckdosen, rein in die Steckdosen) – falls wir es schaffen würden, bis zum nächsten Morgen noch weitere 10 oder 12 Verlängerungsschnüre zu organisieren. Was das betrifft, der heldenhafte Einsatz ging bei Agnieszka, der polnischen Theaterlehrerin, meiner bezaubernden Wirtin, und Pjotr, ihrem reizenden Mann (Jurist, deshalb immer im Anzug), zu Hause bis in die privatesten Ecken des Schlafzimmers weiter: Rumms, rupf, wurden brutal die Computernetzkabel unter dem Schreibtisch hervorgezerrt und auseinandergerissen – im Dienste der Sache, aber mir blutete das Herz, es war einfach nicht mit anzusehen. Meine beiden Wirte, Hosts, Unterhalter, Einlader zu Kerzenlicht-Abendessen in einem chicken Lokal in Praga, gastfreundlich bis zur Selbstaufgabe, zum Umarmen nett! Wir trösteten uns gegenseitig, bevor wir schlafen gingen in jener kleinen Wohnung in diesem Supermarzahn im Südosten Warschaus. Das Auto (der Nissan) draußen auf dem taghell erleuchteten und bewachten Parkplatz auf der weiten, öden Flache zwischen den Wohnblocks. Der Erdgeschoss-Balkon vergittert, zwei Wohnungstüren zum Hausflur mit 5 Schlössern. Eine andere Welt, die mir dennoch liebgeworden ist in den wenigen Tagen. Morgen war der Tag. Morgen würden wir spielen. Es würde schon klappen. Ich lag auf der Couch im Wohnzimmer und konnte ziemlich wenig schlafen. Denn am nächsten Tag brachen wir mein heiliges Gesetz. Mein heiliges Gesetz ist: keine Probenarbeit mehr am Tag der Aufführung selbst. Am Aufführungstag nur noch Lächeln, Entspannung, Ausruhen, großes Atemholen für den eigentlichen Akt, egal wie es steht. – Aber an diesem Tag …?! Dieser Tag war letzter-elektrischer-Anschluss-Tag, großer Problem-aus-der-Welt-schaff-Tag, Proben-Tag, Übersetzungstag (Danke, Konrad!) … Denn gerade rechtzeitig war offenbar geworden, dass wir einen Teil unseres Stückes gar nicht so spielen können würden, wie das Stück das von der Konzeption her eigentlich vorsah. Es ging um die aktuellen Bezüge auf die aktuelle deutsche Wahl, die über unsere Leinwand flimmern würden. Es war natürlich intendiert gewesen, dass diese aktuellen Bezüge auf die deutsche Wahl in Polen durch solche 6 auf die aktuelle polnische Wahl ersetzt würden, nun stellte sich heraus, dass es ein polnisches Gesetz gab, das genau Derartiges so kurz vor der aktuellen Wahl verbot. Sowas konnte man „dumm gelaufen“ nennen. Daraus folgende Tatsache war jedoch, dass auch in der polnischen Aufführung das deutsche Programm laufen würde, das den polnischen Zuschauern natürlich nichts sagen würde, dass deshalb wir, Konrad und ich, 5 Stunden vor der Aufführung, während draußen Agniewszkas Probe tobte - vier, drei, zwei Stunden vor der Aufführung immer noch - assistiert von Eva Maniszewska und Kollegin Schulz-Brüssel in den Computer hackten, was ich diktierte und was Konrad übersetzte, den Text, den er synchron zur Aufführung via Funkkmikro einsprechen würde (würden wir noch Zeit haben, das wenigstens einmal zu proben?!) Außerdem gab es polnische Politiker, die in den Filmeinspielungen deutsch sprachen – auch diese mussten simultan-übersetzt werden … Außerdem, ein weiteres Problem … aber vielleicht sollte ich der Einfachheit halber und im Interesse des Umfangs dieses Textes aufhören, weitere Probleme zu schildern, und statt dessen auf die schönen Teile des Aufenthaltes übergehen. Bereits mittags (wie all die Tage traumhaft schönes, warmes Sommerwetter, helle Sonne!) lief ein Zug in Warschau ein, der transportierte meine Lebenspartnerin und den Kunstkollegen, dessen Projekt-Bilder eine weitere Bereicherung des heutigen Abends darstellen würden – und ich war, während die Proben an der Schule liefen, mit dem Lieferwagen durch Warschau gefahren zum Bahnhof beim Kulturpalast. Die beiden waren zu unchristlichster Nacht- bzw. Morgenzeit in Berlin losgefahren, jetzt waren sie hier. Eine Hand am Steuer, eine Hand am Ohr (am Handy) „Wo seid Ihr?“, während ich durch das Mittags-Verkehrschaos lenke. „Wir trinken einen Kaffee hier in der Halle, Südseite.“ „Bin gleich da, Ihr könnt zahlen.“ 1972 bin ich hier zum ersten Mal gefahren, mit einem alten, weißen VW-Käfer. Da war dies eine quasi autofreie, breite Paradefläche, wo sie breitrollend ihre Panzer und Raketen vorführen konnten. Inzwischen haben sie den Bahnhof hierher verlegt, und der Kulturpalast drängt sich zwischen Mc-Donalds-Filiale, Ampeln, Bahnhof und einer Million Autos, die scheinbar alle keinen Parkplatz finden. Mittagsgeschiebe und Verkehr. Ich finde einen Parkplatz, indem ich mich in die Drei-Minuten-Ladezone mogle. Polnische Polizei läuft auf den Stufen des Bahnhofs Zweierstreife und hat die Parksünder auf dem Kieker. Ich rase, das Handy noch am Ohr, in die Halle, finde meine Leute in dem Café auf der Südseite. Die trinken Kaffe, denken gar nicht dran zu bezahlen. Ich muss wieder raus, äuge ängstlich nach den Polizisten, während die Gäste aus Berlin in aller Ruhe Latte macchiato schlürfen. Nachher fahren wir durch Warschau nach Norden, und ich komme mir vor wie ein Einheimischer, während sie nur Gäste in dieser Stadt sind. Der Nachmittag, wie gesagt, siehe oben, gehörte Konrad und der Übersetzungsarbeit am Computer. Kommen wir zum Ende. Kommen wir zur Vorführung am frühen Abend, um fünf. Es war … super-gut, optimal, über alles Erwarten großartig. Es war, neidlos sei dies anerkannt, partiell besser als die Aufführungen in Berlin. Woran lag das? Nun, z.B. war das, was in Berlin wie vom lieben Gott kam (das Licht fadete oder entstand wie magisch immer genau da, wo man es brauchte, geradezu geheimnisvoll, wie von selbst – man machte sich, mit anderen Worten, einfach keine Gedanken darüber) – es war dies in Berlin einfach wunderschön gewesen. Hier dagegen war das Licht optimal – aber es war eben Schwerstarbeit und Handarbeit, und man sah es. Die deutschen Schüler (die insofern viel mehr in die polnische Aufführung eingebunden waren als die polnischen Schüler jemals in die Berliner Aufführung) rissen – dezentral, wie gesagt – auf mehreren Seiten der Bühne die Stecker aus den Dosen oder schlugen sie hinein, wir hatten außerdem in Ermangelung anderer Möglichkeiten und der Not gehorchend einen zusätzlichen Scheinwerfer an eine (weitere) Leiter montiert, dadurch hatten nicht nur unsere konstitutiven Leitern eine weitere Funktion 7 mehr, sondern wir besaßen zudem einen sozusagen inhaltsadäquaten „Suchscheinwerfer“, der durch Drehen der Leiter per Hand gesteuert wurde und sowohl besser den letzten dunklen Winkel der Bühne ausleuchten als auch für phantastische neue Effekte sorgen konnte, wie wir sie in Berlin nicht gehabt hatten. Das war es: Durch all das verlor die polnische Aufführung bei weitem nicht, sondern sie gewann sozusagen eine Ebene dazu. War die Berliner Aufführung „nur“ eine elegante Kreuzfahrt gewesen, so konnte man hier zusätzlich gewissermaßen „ins Maschinendeck blicken“, und das war einfach phantastisch. Und zwischendurch rasten die deutschen Schüler von den Lampen weg auf die Bühne und bellten im professionellen Stakkato ihren Kant-Chor. Aber insgesamt war es schon verrückt – ich kann doch als Theaterlehrer nicht den Schluss daraus ziehen, dass man bis unmittelbar vor der Aufführung, um deren Erfolg zu gewährleisten, am besten alles so weit wie möglich ins Chaos treiben lässt …?! Oder wie? Der deutsche Kameramann zauberte von den polnischen Bikinimädchen Bilder auf die große Leinwand, dergleichen hatten wir in Berlin einfach nicht gesehen - und (ohne den deutschen Schauspielern etwa zu nahe treten zu wollen, das wäre schlicht unfair) - aber die polnische Friedenstaube war einfach pure poetische Musik und ihre Ermordung deshalb unbeschreiblich schrecklicher als in Berlin und im Grunde die Grenze des gerade noch Erträglichen – ein unglaublicher Effekt! Der ganze Abend insgesamt war umwerfend, sehr zufriedenstellend, die Elternreaktion der polnischen Schüler, kurz gesagt, schlicht überwältigt und geradezu atemlos dankbar, und sie marschierten hinterher reihenweise auf und drückten Agnieszka und mir die Hand, äußerten (auf Englisch) Bewunderung und Beobachtung von Details - so etwas hatten sie bisher hier einfach noch nicht gesehen. „I didn’t recognize my son – he’s so calm all the other time …“ Hatten sie wohl auch nicht. Und ich auch nicht. Eine Winzigkeit habe ich deshalb noch Lust nachzutragen. Ich verstand z.B. nicht, warum die Bikinimädchen das „Ausziehen“ nicht probten, das sie während unseres Stückes absolvieren müssen. D.h., sie sind erst Bikinimädchen, dann werden sie erschossen, als Leichen abtransportiert, später kommen sie wieder als unsere Cheerleader, dann ziehen sie sich wieder bis auf die Bikinis aus (das ist unser so genannter erotischer Tanz mit den Soldaten), dann sind sie wieder unsere Bikinimädchen wie zu Anfang, dann kommt eine Szene, wo es aussieht, als ob sie gleich wieder erschossen würden (ein kurzer, schrecklicher Moment!) – eigentlich hat sich hier strukturell, formal nur ein Kreis geschlossen – solche Dinge sind in der Literatur eminent wichtig! Sie sind dann im 3. Teil unseres Stücks also wieder Bikinimädchen wie am Anfang, – und somit so und nicht schlimmer, als sie an 1000 Stränden der Welt zu erblicken wären und wie sie sich den ganzen Sommer über wohl selbst am Strand zeigen werden. Aber unsere Bikinimädchen probten – Katholizismus und Polen hin oder her - aus irgendeinem unerfindlichen Grunde dieses Ausziehen nicht, und da erhob sich für mich einfach die professionelle Frage: Warum, verdammt noch einmal, taten sie das nicht?! Sie saßen da auf unserem schwarzen Teppich, statt Bikinimädchen zu sein, in ihrer normalen Schülerinnenkleidung. Nun gut, dachte ich aufgebracht, was geht es mich an, von mir aus sollen sie Wintermäntel tragen und Pelzmützen aufsetzen, es ist schließlich die polnische und nicht „meine“ Aufführung. Aber ich fand es schon irgendwie „unprofessionell“. In dem, was man „Generalprobe“ nennen darf, zwei Stunden vor der Aufführung, wurde ich Zeuge, dass sie sich jetzt tatsächlich erstmals in Bikinis zeigten (wenn auch nicht in den einheitlichen, schwarzen, „coolen“ Bikinis wie bei uns), dass sie später dann wieder die Cheerleader verkörperten, dass sie sich (in der Generalprobe!!!) aber dann wieder nicht ausbzw. umzogen zu den Bikinimädchen, sie sie vorher bereits gewesen waren, und ich rang im Geiste mit der verzweifelten Frage, warum nicht?! - und ich fand das einfach unglaublich: 8 Wie kann man geradewegs aus Jux und Dollerei und überdies völlig überflüssigerweise irgendeine Kleinigkeit vor einer Aufführung gar nicht, ich meine, nicht ein einziges Mal, proben?! Die Antwort ergab sich in der Aufführung. Das nie Geprobte geschah, sie zogen während des erotischen Tanzes erstmals die T-Shirts über den Kopf und wurden wieder zu Bikinimädchen. Allerdings erwiesen sich die T-Shirts jetzt beim ersten Versuch live vor über 100 Zuschauern als minimal zu eng, und so zogen sie eben nicht nur die T-Shirts, sondern noch alles mögliche andere gleich mit hoch … Weil sie (Gott sei Dank!) trotzdem in der Rolle blieben, dachten alle Zuschauer, das sei haargenau so gewollt gewesen. Wie sagte ich oben? – So etwas hatten sie hier noch nie gesehen. Die Wirkung war gewaltig. Am nächsten Tag, mittags - Wahlsonntag, und die Leute kamen in die Schule - beluden die Schüler das Auto. Abschiedsstimmung, Umarmung und Winke-Winke vor der großen Freitreppe, dann verließen wir, jetzt zu zweit, im hellen Sonnenlicht nordwestlich über die großen Ausfallstraßen Warschau. Ich fuhr so zurück, wie ich gekommen war, über Płońsk, Lipno, Toruń. Am Nachmittag aßen wir im Garten des gemütlichen, hölzernen Motels im Wald in der Einsamkeit, das ich mir auf der Hinfahrt ausgeguckt hatte, ein leckeres Mittagessen. Später Tanken, zum allerersten Mal, der Tank war ratzfatz-leer. Noch später, in Bydgoszcz, verfuhr ich mich, denn mir war zurück zu nicht klar gewesen, dass ich hier den Schildern nach Gdańsk hätte nachfahren müssen, das schien mir zu weit nördlich, und so gerieten wir nach Süden zu vom Weg, und plötzlich waren wir am Flugplatz. Dann hatten wir die richtige Richtung wieder (Gdańsk), aber wir fuhren jetzt bereits in die sinkende Sonne hinein. Bei Piła wurde es dunkel, in Wałcz war es pechschwarze Nacht. Bergauf, bergab, ein Friedhof, eine Kirche, Kopfsteinpflaster, dunkle Fenster, keine Autos, wenige einsame Lampen auf überhohen Betonmasten, DDR-Atmosphäre, tiefe 60er Jahre. Dann: immer wieder Gruppen von betrunkenen Männern auf dem Heimweg. Und wenn wir das im Radio richtig verstehen konnten, zeigten die ersten Hochrechnungen einen heftigen Rechtsruck. Also da auch der Wechsel. Hatte unser Stück also nichts genutzt. Dunkle Landstraßen ohne Markierungen und mit tiefen Spurrillen. Jetzt war das Überholen der riesigen Lastwagen risikoreich und nicht so lustig wie auf der Hinfahrt. Bei Bodenwellen schepperten unsere Leitern hinter uns in der Dunkelheit. War mir die Hinfahrt kurz vorgekommen, dehnte sich das angestrengte Nach-vorne-Starren in die Nacht jetzt endlos. Es wurde neun, es wurde zehn, allmählich kam der Hunger wieder, aber ich wollte jetzt nicht noch einmal anhalten zum Essen. Abgesehen davon, wo? Rechts und links kein Licht in der Nacht, nur Schwärze, an der Landstraße (Alleebäume) kaum Hinweisschilder. Waren wir überhaupt noch auf dem Weg zur Grenze? Ich rechnete aus, dass wir es noch über 100 Kilometer bis dort hatten. Endlos. Irgendwo links, dachte ich, hatten uns längst die Schüler, die lange nach uns losgefahren waren, überholt, würden in Kürze am Bahnhof von den glücklichen Eltern in die Arme geschlossen. Wir dagegen waren jetzt schon länger unterwegs, als der gesamte Hinweg gedauert hatte. Natürlich (schuldbewusst) hatten wir auch bei diesem Mittagessen enorm getrödelt. Gorzów-Wielkopolskie … Gott sei Dank, das zeigte mir wenigstens, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Schade, dass ich meiner Begleiterin bei dieser ägyptischen Finsternis nicht zeigen konnte, wie schön es hier eigentlich aussah, das weite Tal und die Häuser auf der anderen Seite, im Morgenlicht, wenn der Nebel aufriss. Jetzt: abgrundtiefe Nacht. Und dann schließlich doch: Kostrzyn, gegen halb zwölf, eine Oase grellen Lichts in der Finsternis. Nachtclubs. Die letzten polnischen Tankstellen. Zu diesem Preis tankten wir natürlich noch einmal voll. Ich hätte auch gern was gegessen, aber sie hatten nur Kekse, von denen ich Abstand nahm. Frösteln in der Nacht, leichter Nebel in der Luft. Dann die paar Meter hinüber zu den Grenzabfertigungen, riesige Felder von hohen Neonlampen, genug Platz 9 für 10.000 Lastwagen die Stunde. Aber sonntagnacht-schläfrig momentan nur ein einziger Durchgang offen. Fenster runter, „dankeschön, bitteschön, gute Weiterfahrt“ – unaufregend. Das dicke Ende kam nach, einige Minuten später, aber das wussten wir noch nicht. Fühlte man sich zuvor bei der Durchfahrt durch die dunklen Ortschaften in Polen vielleicht noch wie in der DDR vor 40 Jahren, so denkt man, sobald man die alte, finstere Oderbrücke quert und runter durch die verlassenen, verfallenden Russensiedlungen auf der westlichen Seite rollt, wo es kein Licht gibt außer dem der eigenen Scheinwerfer, man sei Mai 1945 angelangt. Verwahrloste Grünanlagen, abbröckelnder Putz, leere, schwarze Fensterhöhlen, so weit das Auge bzw. der Scheinwerfer blickt, der das alles für eine unwirkliche Sekunde aus dem Dunkel reißt … gruselig hoch fünf … und hier war es dann, plötzlich da vorne, blitzende Lichter quer über die Straße und eine Nagelkette … Uniformen, dann fing ich ein Wort auf einem breiten Rücken auf: ZOLL. Plötzlich ist man mitten im Agentenfilm. PKWs wurden durchgewinkt, aber die ganzen bösen LKWs aus Rumänien, aus Bulgarien, der Ukraine, Weißrussland, Litauen, Estland, Lettland, denen wurde zur Seite rausgezeigt – alles, was halbwegs nach LKW aussah, also auch wir. Dreiviertel zwölf Uhr nachts. Steigende Hungergefühle. Taschenlampen ins Gesicht. Mahlzeit. „Na, was haben wir denn da? Was haben Sie denn mitgebracht? Na, nun steigen Sie mal aus. Machen Sie mal die Ladefläche auf. Haben Sie Zigaretten dabei?“ „Nein, wir rauchen nicht.“ „Aber, aber, Sie werden doch Freunde haben, die rauchen, denen haben Sie sicher was mitgebracht“ (leichter Hohn). „Nein, solche Freunde haben wir nicht.“ (Wir bleiben absolut hart.) Er betrachtet sich unbefriedigt den zusammengerollten Teppich, den wir mitführen, und ich sehe, wie er sich fragt: Was mag da alles drin sein?! „Und das? Was ist das denn? Ist das etwa ein Rollstuhl?“ „Ja“, sage ich, „ein Rollstuhl, zusammenklappbar. Ist für Dr. Seltsam.“ Allmählich wird immer unklarer, wer hier wen veralbert. Ich halte ihm ein Plakat von unserer Warschauer Aufführung hin. Ein lasziv bestrumpftes Frauenbein tritt darauf einem Uniformierten in den Hintern. Leider kann unser Beamter kein Polnisch. Er blickt mich an. Schließlich lassen sie uns weiter, und eh hier weitere Unklarheiten auftauchen … ich finde es ja richtig, dass nicht alles einfach unkontrolliert hereingelassen wird. Dann die Höhen von Seelow. Dann Rüdersdorf und der Berliner Ring. Autobahn. Nachts um halb eins schließlich das vertraute Kreuz Oranienburg, die roten Blinklichter des Fernmeldeturms Frohnau links in der Nacht. Wenig später zu Hause. Am nächsten Morgen (Montag) hätte ich eigentlich zur 3. Stunde. Aber ich muss zur ersten, arme Opfer suchen, die mir den Wagen ausräumen, alles von Teppich bis Rollstuhl wieder in die Aula hochschleppen. Meine Theaterschüler können das nicht sein, die haben heute Gnade und dürfen angesichts des harten Wochenendes und der späten Rückkunft gestern abend etwas später kommen. Ich finde einen Kurs, der ohne Lehrer ist. Die Armen. Der Lehrer nicht da, und sie dachten, sie dürften nun etwas die Glieder recken und verspäteten Morgenschlaf nachholen. Ist nicht. Sie sind lieb und helfen. Um 9 fahre ich das Auto zurück, tanke voll, gebe es ab, erledige den Papierkram, lese mein eigenes Auto auf, das bei der Vermietfirma vom Tau beschlagen seit Donnerstag im Morgenlicht steht. Um 5 vor 10 bin ich pünktlich zurück zum Unterricht. Die dritte Stunde ist meine erste. Der Alltag hat mich wieder. Schade. 10