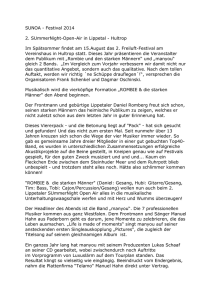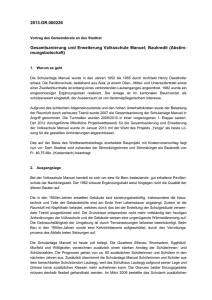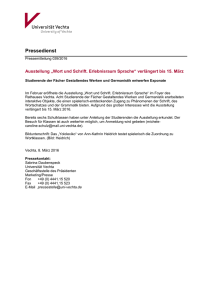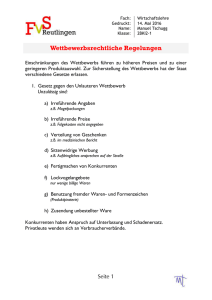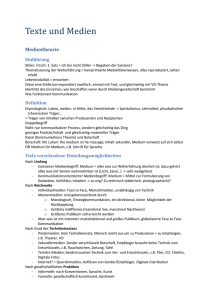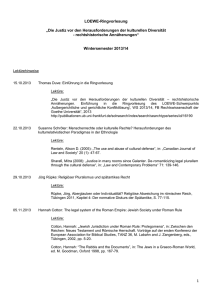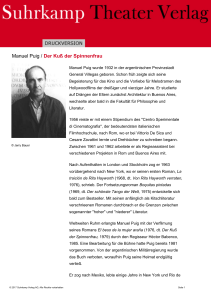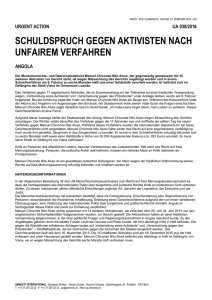11. Switalla, B.: Diagnostische Lektüre. In:Lernchancen 1/1999
Werbung

Bernd Switalla, Bielefeld Ein Umgang mit (Schüler-)Texten: Diagnostische Lektüre 1. Das Problem Wie können Lehrerinnen und Lehrer die Texte Lernender lesen? Welche Fähigkeit zur Diagnostischen Lektüre sollten Studierende der Lehrämter erwerben können? Und wie sollten Kinder über ihre Textproduktionen sprechen können? Auf der einen Seite propagiert die Grundschuldidaktik neue Formen und Zwecke des Schreibens von Texten in der Schule; auf der anderen Seite ist das textdiagnostische Know How von vorgestern. Wie kann die praktische Kompetenz der Lernenden gefördert werden, wenn die analytische Kompetenz der Lehrenden unterentwickelt ist? Wie sollen die Kinder über ihre Texte zu handlungsorientiert nachzudenken lernen, wenn die Lehrer ihnen kein handlungsorientierendes begriffliches Vokabular vermitteln können? 2. Ein exemplarischer Fall Im Seminar Sprachdiagnostik diskutieren wir einen Schreibversuch von Manuel gegen Ende des ersten Schuljahres. Die Geschichte von Swimmy hat den Kindern so sehr gefallen, daß sie sie selbst aufschreiben wollen. Die Studierenden haben den Original-Text vor sich, und ich fordere dazu auf, ihn laut vorzulesen. Ein Teilnehmer liest ihn so: Swimmys Abenteuer in der Unterwasserwelt Er trifft die Krake und spielt mit der Krake. Er geht tiefer ins Meer. Swimmy hat einen neuen Freund. Es ist der Wal. Mit dem-den Wal schwimmt er ums Meer. Das war die Geschichte von dem kleinen schwarzen Fisch Swimmy. Hat noch zwei Freunde. Es waren zwei Brüder. Er liest ihn, so könnte man vielleicht sagen, normalisierend; er literalisiert Manuels Text. Meine Anregung, den Text doch so zu lesen, wie er auf dem Papier steht, hat eine Reihe von weiteren Versuchen zur Folge, begleitet von Lachen, Erstaunen, Unsicherheit, Nachdenken: Was, bitte, ist die angemessene Lesart des Textes auf dem Papier (im Original)? Wie kann man die Schriftzeichenfolge auf dem Papier angemessen interpretieren? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars phrasieren den Text beim lauten Lesen nach Sinnschritten und denken sich Satzzeichen hinzu. Sie orientieren sich an ihren eigenen Wortbild(ungs)-Verständnissen und überlesen die unüblichen Schreibungen der Wörter. Sie übersehen die vom Schriftbild her angezeigten Laut-Buchstaben-Verständnisse und lesen die Schriftzeichen wie Notationszeichen für einen mündlichen Vortrag. Und während sie das tun, entwickelt sich ein intensives Gespräch - mit interessanten Beiträgen: “Doch, doch - die Lautbuchstabenbeziehung hat der noch nicht begriffen: trifft schreibt Manuel mit einfachem i und spielt auch - und wie der überhaupt spielt schreibt.” - “Ja, da schreibt er eben so wie er´s hört, da hat er wirklich gut hingehört.” - “Aber - er hört auch wieder nicht genau genug hin: bei trifft hört man doch die zwei f und das kurze i; und bei tiefer das lange i; das kann er also noch nicht.” “Auch wenn er noch keine Satzzeichen schreibt - er schreibt in Sätzen, und die Geschichte ist trotzdem auch gut erzählt.” - “Das stimmt, es ist eine Reihe von Sätzen, die Manuel hier zu Papier gebracht hat. Aber - eine Geschichte, das doch wohl kaum.” “Daß man Satzzeichen schreibt, um einen lesbareren Text hinzukriegen, das muß er noch lernen. Aber daß er eine Geschichte aufgeschrieben hat, da würde ich auch nicht sagen wollen.” - “Manuel schreibt keine Geschichte auf; er gibt einfach nur wieder, was ihm wichtig ist, welche Ereignisse er für wichtig hält bei der Swimmy-Geschichte.” - “Und das macht er schon ganz gut: die Geschichte - wenn es denn eine ist - hat eine Überschrift und sie hat einen Schluß.” “Einen interessanten Schluß, wie ich finde, So ähnlich wie bei nem mündlichen Vortrag: So, das war jetzt die Geschichte, die ich euch hab erzählen wollen.” - “Ja, aber interessant ist ja auch, daß er dabei noch einen Akzent setzt.” - “Man erfährt jetzt auch noch, wie Swimmy aussieht; daß es sich bei ihm um einen kleinen schwarzen Fisch handelt.” - “Ich finde, damit er geht er, wie soll ich das sagen, etwas auf Distanz: Das war die Geschichte von der Person, von der ich euch was hab erzählen wollen, oder so.” “Aber dieser Nachsatz, dieser Nachtrag da, Hat noch zwei Freunde, es waren zwei Brüder”, der müßte mehr in die Geschichte rein, der wirkt so angehängt, so nachgeschoben, nachgetragen.” - “Finde ich nicht: Manuel erzählt eine Geschichte von Swimmy, und nachdem er die so wiedergegeben hat, sagt er einfach, was man auch noch von Swimmy wissen sollte.” “Bloß, seine Orthographie: die Klein- und Großschreibung beherrscht er noch fast gar nicht. Verben schreibt er mitten im Satz groß, Nomen schreibt er oft klein. Präpositionen wieder groß”... - “Schon, aber erstaulich ist doch, wie sehr er die Rechtschreibung schon beherrscht. Nehmen Sie nur mal als Beispiel die Wendung Den kleinen schwarzen Fisch. Da schreibt er die beiden Adjektive klein und schwarz als Attribute klein und das Nomen Fisch groß. Das spricht doch schon dafür, daß er was verstanden hat.” - “Aber wenn er das so macht, dann kann er schon was. Weiß er dann nicht auch schon was über Wortarten, über die Wortarten Adjektiv und Nomen?” “Wenn die Aufgabe war, eine Swimmy-Geschichte zu erzählen, dann hat Manuel die Aufgabe nicht gelöst: er reiht einfach Ereignisse und Tatsachen hintereinander, und das noch nicht einmal logisch geordnet. Er trifft eine Krake, und mit der geht er tiefer ins Meer. Dann, ganz unvermittelt: Swimmy hat einen neuen Freund, es ist der Wal usw. Wo ist da die zusammehnhängende Geschichte?.” - “Kann man aber auch anders lesen, diesen zweiten von dir zitierten Satz: Jetzt auf einmal oder Ein wenig später hat Swimmy dann einen Freund gewonnen. Es ist der Wal.” - ... Wie wird der Text hier gelesen, und welcher Wissenshintergrund spielt dabei eine Rolle? Wie könnte er noch gelesen werden, wenn man den Bezugsrahmen des Vorwissens wechseln würde? 3. Ein Plädoyer für diagnostische Lektüre Es ist offensichtlich, daß die Studierenden den Fall Manuel im Licht ihres schreib-, text- und schrifttheoretischen Wissens interpretieren: Wer einen Text zu Papier bringt, der hat (je nach Textsorte) eine gewisse Darstellungsaufgabe zu lösen. Er muß eine Reihe von lesbaren Sätzen niederschreiben, in der beliebige Leserinnen und Leser eine logisch kohärente Gedankenfolge wiedererkennen können sollten. Er muß den graphischen und orthographischen Konventionen folgen können, die die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes im ganzen fördern. Er muß mit den grammatischen Sachverhalten vertraut sein, die für die Kenntnis und Befolgung mancher dieser Konventionen von Bedeutung sind: bei der Abgrenzung von Wörtern, der Unterscheidung der Rollen der Wörter im Satzglied und im Satz, bei der Abgrenzung und Unterscheidung von Sätzen. Er muß Textmuster und Textsorten kennen. Zum Beispiel muß er Alltagsgeschichten von literarischen Geschichten, narrative von deskripten Texten und darstellende Sätze von kommentierenden unterscheiden können. Und seine Leserinnen? Sie müssen nicht nur implizit über schreib-, text- und schrifttheoretisches Wissen verfügen; sie müßten es auch explizit zur Sprache bringen und anwenden können. Eine diagnostische Lektüre der Texte von Lernern ist ohne ein entsprechendes begriffliches Vokabular wohl kaum denkbar. Genau daran fehlt es aber nicht selten: Wichtige Unterschiede zwischen der Rede und der Schrift werden sensualistisch gedeutet; das Verständnis der LautBuchstaben Beziehung hält man für das Schlüsselproblem des Schriftwerbs. Das textanalytische und texttheoretische Wissen ist oft laienhaft. (“Jeder Text hat eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluß.”) Das Produkt des Schreibens wird nicht prozeß- (also auch: aufgaben-)analytisch wahrgenommen. (“Ein Text läßt sich unabhängig von Bedingungen und Folgen des Schreibhandelns beschreiben, beurteilen und bewerten.”) Diagnostisch orientierte Lektüren sind darüber hinaus interpretationstheoretisch zu reflektieren. Wer Texte anderer verständig zu lesen versucht, der hat ja einen Brückenschlag hinzubekommen: den zwischen der Sprache des Textes und seiner eigenen Sprache, zwischen der im Medium der Sprache dargestellten Erfahrungs- und Wissenswelt des Textes und seiner eigenen Wissens- und Erfahrungswelt. Die Lektüre, auch die diagnostische, ist (zunächst einmal) immer ein Wiedererkennen der eigenen Darstellungswelt mit den Mitteln der eigenen Darstellungssprache vor dem Hintergrund. Wir lesen die Texte anderer Personen (und letztlich auch die eigenen) immer erst mit bestimmten Intentionen, orientiert durch bestimmte Interessen und mit Bezug auf die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen. Diesen Bezugsrahmen bestimmmen bei der Lektüre der Texte von Lernenden selbstverständlich auch unsere unterrichtlichen und didaktischen Intentionen, Interessen, Kenntnisse und Erfahrungen. (Zum Beispiel auch unsere Vorstellungen davon, welche schriftsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Unterricht voraussetzen kann und fördern sollte.) Der Prozeß der diagnostischen Lektüre ist also ohne Zweifel eine sehr komplexe Tätigkeit: Ohne fachliches Wissen geht dabei nichts; aber fachliches Wissen allein reicht nicht. Wir haben das Lesen darüber hinaus als eine komplexe interpretative Handlung zu sehen - und zu reflektieren. Zur Disposition steht in jedem einzelnen Fall diagnostischer Lektüre nicht nur der Text auf dem Papier, sondern auch der beim Lesen entstehende Text im Kopf. Die Diagnose setzt ja voraus, daß wir den Text zu verstehen versuchen, bevor wir ihn analytisch beschreiben, diagnostisch beurteilen und pädagogisch bewerten. Das heißt, kurz gesagt, die diagnostische Lektüre gelingt in dem Maße, in dem wir unsere eigene Praxis des Lesens der Texte von Lernenden reflexiv strukturieren. 4. ... und die Praxis diagnostischer Lektüre? Wie könnte man dabei vorgehen? Die Erfahrung spricht dafür, mit den Auffälligkeiten, den Ungereimtheiten, den Brüchen, den Schwächen des Textes konstruktiv umzugehen: Auch zum Fehlermachen gehört ein Können - ein implizites Wissen, das zu explizieren, zu reflektieren und zu restrukturieren die Aufgabe der Lernenden ist, zu der wir als Lehrende moderierend beitragen können. Ich möchte das Konzept der Rekonstruktion des impliziten Problemwissens von Manuel kurz exemplarisch skizieren. Manuels explizites, ausdrücklich artikuliertes Problemverständnisses lasse ich dabei außer acht; wiewohl es selbstverständlich zweckmäßig ist, sich auch ein Bild davon zu machen, wie Lernende ihre Prozesse und Produkte des Schreibens selbst begreifen. Ich konzentriere mich dabei auf (ortho)graphische Auffälligkeiten. Manuel schreibt UnterWaserWelt und nicht Unterwasserwelt. Welches Verständnis zum Beispiel der Wortbildung könnte er mit dieser Schreibung zum Ausdruck bringen? Swimmys Abenteuer spielen sich für ihn nicht unter einer Waserwelt ab, sondern in einer Welt unter Waser, in einer Unter Waserwelt eben. (Sonst würde seine Überschrift ja gelautet haben: Swimmys Abenteuer unter der WaserWelt.) Man könnte vermuten: Manuel ist am Ende des ersten Schuljahres auf dem Weg, eine komplexe nominale Wortbildung zu beherrschen - und die Logik ihrer Bildung zu begreifen: Da gibt es eine Welt, das ist eine Welt unter Wasser; keine Welt im Wasser, sondern eine unter der Oberfläche des Wassers, eine Unter-Wasser-Welt eben. Und er beginnt vielleicht Analogien herzustellen und zu begreifen: Eine Unter-Wasser-Welt , das ist eine Welt-unter-Wasser. Und ein Unter-See-Boot, das ist ein Boot, tief unter dem Meer - oder? Eine Unter-Wasser-Welt, das ist eine tief im Wasser, tief unter der Wasser-Ober-Fläche... Aber: Ein Unter-Zieh-T Shirt, was isn das dann? Erstaunlicherweise schreibt Manuel WaserWelt und nicht Waserwelt (oder Wasserwelt). Auch dem läßt sich ein konstruktives diagnostisches Verständnis abgewinnen: Manuel markiert mit seiner Schreibung gewissermaßen die Wortbildung(sregel), so wie er sie versteht: die WaserWelt, eine Welt im Waser; die DschungelWelt, eine Welt im Dschungel - die SaurierWelt, eine Welt mit Sauriern? Ähnlich ließe sich auch seine Schreibung Das War Die 6Schischte Von Den kleinen Schwarzen Fisch diagnostisch lesen, jedenfalls die nonimale Konstruktion Von Den kleinen Schwarzen Fisch: Da ist ein Schwarzer Fisch, und der ist ein kleiner... Manuel verwendet die Schriftzeichen zur Markierung logisch-semantischer Differenzen... Aber ist es nicht eher so, daß er in mehrfacher Hinsicht einfach noch nicht schriftfähig ist, zum Beispiel die LautBuchstaben-Beziehung nicht beherrscht? Spielen wir nicht bloß mit gutgemeinten Gedankenexperimenten, die an der literalen (In)Kompetenz vorbeizusehen verleiten? Sicher spielen wir mit unseren Vorstellungen von möglichen Verständnissen. Aber wir entwickeln dabei mögliche Lesarten. Wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, uns nurmehr fehleranalytisch auf Abweichungen vom (ortho)graphischen Schriftbild und Schriftverständnis zu fixieren - und die Heuristik des Schreibprozesses im Medium der Schrift zu verfehlen. Denn das ist der entscheidende Punkt: Manuel entwickelt sein Schriftverständnis im Medium der Schrift. Selbstverständlich bleibt dann immer noch Raum auch für die Rekonstruktion seines Laut-Buchstaben-Verständnisses: trift einerseits, tifer andererseits, get versus hat - damit ließen sich paradigamtische Reihen bilden, mit denen über Analogien gezeigt werden könnte, was einen kurzen Vokal oder eine Konsonantenverdoppelung in aller Regel ausmacht, einen Neuen freunt im Unterschied zu einem alten Freund, einen großenJunge gegenüber einem kleinen Jungen usw. Aber auch hier kommt man mit simplen Vorstellungen nicht weiter: Schriftzeichen bilden Lautzeichen eben nicht einfach nur ab. In freunt hört man eben kein d , und in trifft auch keine zwei f. Die diagnostische Lektüre von Schülertexten blendet dergleichen nicht aus, sie arbeitet nur mit der Unterstellung, daß wer anders schreibt als literarisierte Erwachsene, sich auch etwas dabei gedacht haben mag oder denkt. Sie folgt dem heuristischen Prinzip, das Schriftbild wörtlich zu lesen. Sie unterstellt, daß Schreiben ein komplexer kognitiver Prozeß ist. Das gilt selbstverständlich auch für die Makrostruktur des Textes von Manuel. Was wir hier beobachten können, ist ein Versuch, narratives Wissen anzuwenden - und zugleich weiterzuentwickeln. Dabei spielt das visuelle Medium Schrift eine besondere Rolle: Manuel kann die Schritte, das Sujet, und den Rahmen seiner Erzählung reflexiv organisieren; er kann seine Erzählweise operational modifizieren. Aber wie erzählt er? Erzählt er überhaupt? Man kann seinen Text auch lesen als typische Nacherzählung: Eine (vorgelesene?) Geschichte ist in ihren wesentlichen Ereignisen wiederzugeben; dabei ist der mit dem Titel angezeigte Plot deutlich zu markieren. Schließlich ist der Ausgang der Geschichte (wertend) zu kommentieren. In dieser diagnostischen Perspektive ist Manuels Text dann nur teilweise gelungen. Denn der (vielleicht von der Lehrerin vorgegebenen) Motivierung der Geschichte folgt eine schlichte Aneinanderreihung zweier markanter Ereignisse, und schon wird die Darstellung der Ereignisse mit einer (impliziten) Evaluation ihres narrativen Gehalts abgeschlossen - und um eine Hintergrundinformation über die weitere Figurenkonstellation, das geschichten-interne Personen-Ensemble ergänzt. Aber werden wir damit Manuels Text gerecht? Ist das die einzige angemessene Lesart? Wohl kaum: Manuel erzählt von zwei Abenteuern: Swimmy trifft die Krake und spielt mit der Krake. Und: Swimmy hat einen neuen Freund. Es ist der Wal. Mit dem Wal schwimmt er ums Meer.Die Darstellung des ersten Abenteuers ist von lakonischer Implizitheit, die des zweiten Abenteuers ist explizit strukturiert. Sie referiert die Konstellation einer anderen Begegnung, präsentiert den weiteren Protagonisten der Geschichte und fingiert das gemeinsame Handeln beider Protagonisten. Eine ungewöhnliche narrative Organisation, verglichen mit unseren eigenen Konzepten literalisierten Erzählens. Aber wenn wir uns zu vergegenwärtigen versuchen, welchem gedanklichen Plan diese Erzählung folgen könnte, dann ist sie vielleicht keineswegs desorganisiert; sie folgt möglicherweise einem anderen narrativen Prinzip der Sequentialisierung: ... - Schnitt - Szene 1: Swimmmy hat nun einen anderen, einen neuen Freund gewonnen. – Kommentar aus dem Off oder Wahrnehmung des beobachenden Erzählers: Es ist der Wal (genau der, von dem in der Buchgeschichte ja auch die Rede war) - Szene 2 oder Szenenfolge 2 - n: Mit diesem Wal unternimmt er eine lange Reise und schwimmt mit ihm um das ganze Meer. Zu viel hinein interpretiert? Ich denke, kaum. Wenn wir die Praktiken kindlichen Erzählens immer nur als defiziente Exemplifizierungen einer voll entwickelten Erzählfähigkeit verstehen, dann machen wir es uns hinsichtlich der kognitiven Prozesse beim Erzählen zu einfach. Jedenfalls heuristisch. Erst wenn wir aus dem vorliegenden Text seine andere narrative Organisation gleichsam gedankenexperimentell zu erschließen versuchen, werden wir der Erzählweise des Kindes gerecht. Literale Erzählungen, schriftsprachliche Erzähltexte von Kindern können gerade von den auffälligen Brüchen, den textuellen Inkohärenzen her konstruktiv gelesen und gedeutet werden. Eine fehlende pronominale Referenz - es ist der Wal. Mit dem Wal... - muß dann kein Indikator für unentwickelte Erzählfähigkeit sein; sie kann dann auch verstanden werden als ein wenn auch nicht planvoll ausgeführtes, gleichwohl aber intentional verwirklichtes Darstellungsverfahren sein. Aber heißt das nicht, die Kunst des Lesens zwischen den Zeilen bei der Analyse und Kritik der Texte von Kindern in einer Weise zu perfektionieren, die bei der Befolgung des Prinzips des Wohlmeinenden Verstehens der Äußerungen und Texte anderer hoffnungslos überzieht? Das kann durchaus sein. Es ist aber in jedem Fall überzeugender, von mehreren Lesarten auszugehen, als sich nur an eine einzige zu halten - an die, die den eigenen Gewohnheiten des Formulierens und Interpretierens am ehesten entspricht. Ob es nun um das Verständnis des graphischen, des orthographischen, des grammatischen oder des textuellen Könnens und Wissens der Lernenden geht - in jedem Fall sollten wir die mediale Gestalt ihrer Texte ernst nehmen und uns um eine wörtliche Lektüre bemühen, die uns zu mehreren Lesarten führen, also zu einer Erweiterung unserer Interpretationsspielräume führen kann. Spekulativ ist daran auch kognitionstheoretisch gesehen nichts: Wir halten uns, wenn wir wissen wollen, was die Kinder beim Schreiben im Kopf haben, nach Lichtenberg an die Spuren ihres Zeichenhandelns. 5. Schreiben als Denken; Schrift als Medium des Denkens Die kognitionstheoretische Perspektive der diagnostischen Lektüre will ich noch etwas genauer darstellen. In der gegenwärtigen Sprachdidaktik und Sprachwissenschaft ist noch immer die Neigung vorherrschend, eher die kommunikative, weniger aber die kognitive Funktion des Schreibens zu beachten. Man betont die Bedeutung der Schrift für die Verständigung - und vernachlässigt die Bedeutung der Schrift für das Denken. Zweifellos ist aber das Schreiben für Manuel auch ein Denkprozeß und die Schrift ein Denkwerkzeug. Indem Manuel seine Gedanken zu Papier bringt, verlegt er sie gewissermaßen nach außen, er externalisiert sie. So kann er sich zu seinen Gedanken verhalten, kann über sein Denken nachdenken, während er schreibt und während er das Geschriebene wieder liest. Auf dem Papier sind seine Gedanken in einer anderen (das Gedächtnis, die Erinnerung entlastenden und erweiternden Weise) präsent. Manuel kann sich Gedanken über seine Gedanken machen, gestützt auf ein zweites Medium des Denkens, die Schrift eben. Und das bedeutet einen qualitativen Sprung für den Inhalt wie für die Struktur seiner Gedanken. Sie haben eine Gestalt angenommen, haben eine Form gefunden, die er nicht mehr nur im Kopf hat, sondern die er vor Augen hat. Er kann sie formulieren, reflektieren und reformulieren; es entsteht dabei ein neuartiges, ein schriftgebundenes Denken. (Unsere Idee der rationalen Interpretation als einer Darstellung jenes Gefüges von Aussagen, Annahmen und Wertungen, das wir aus dem Text herauslesen - oder sollte man sagen: das wir in ihn hineinlesen, ist ohne die Schrift als Medium der Kognition gar nicht zu denken.) Wo sind da seine Gedanken, im Kopf oder auf dem Papier? Wo verläuft die Grenze zwischen dem Kopf und der Welt? In gewisser Weise passiert das Denken dazwischen. Die künstliche Umwelt der Zeichendinge verändert die Natur unseres Bewußtseins. Auch die des Bewußtseins von den Zeichendingen selbst! Manuels Text läßt das erkennen. Denn er kann auch als ein Versuch des Kindes gelesen werden, sich beim Schreiben des Denkwerkzeugs Schrift zu vergewissern und es sich mehr und mehr anzueignen. Manuel entwickelt, indem er schreibt, ein tieferes Verständnis des Unterschieds zwischen der Sprache und der Schrift. Und das betrifft keineswegs nur die sog. Laut-Buchstaben-Beziehungen. Er ist vielmehr dabei, die Grammatik der Sprache im Medium der Schrift zu entdecken. So lernt er, Wörter zu unterscheiden und Wortbildungen zu erkennen; er lernt, wie Wortarten voneinander unterschieden werden. Er erwirbt einen Begriff davon, welche die Rolle die Wörter im Satz spielen und was einen Satz ausmacht. Er lernt das alles, indem er schreibt. Er eignet sich das grammatische Wissen an, über das man verfügen muß, um Aussagen nicht nur machen, sondern auch darstellen zu können. Manuel ist auf dem Weg, einen interpretierbaren Text herzustellen. Manuel experimentiert mit seinem Denken, und er experimentiert mit dem Medium seines Denkens. Er ist dabei, höherstufige kognitive Kompetenzen zu entwickeln. Er entdeckt die medienspezischen Formen des Denkens und die Form des Mediums des Denkens. Wenige Monate später wird Manuel wissen, welche Gestalt sein Denken in der Schrift haben sollte, damit es von anderen nachvollzogen - und von ihm selbst weitergedacht werden kann. Er wird erkennen, wie die Form des Denkens im Medium der Schrift den Gehalt seiner Gedanken bestimmt. Wie wird er das wissen? Es wird für viele Jahre noch kein reflexives, sondern ein experimentelles Wissen sein. Manuel wird wissen, wie er es anstellt, einen lesbaren Text zu schreiben; wenn er Glück hat, wird er später auch wissen, wie er weiß, was er schon weiß. Sein implizites Wissen wird wachsen, lange bevor er es explizit zur Sprache bringen kann wahrscheinlich im Medium der Schrift. ______ B. Swi. / 9. Juli 1999