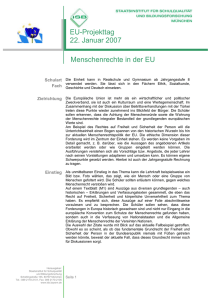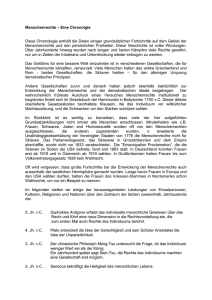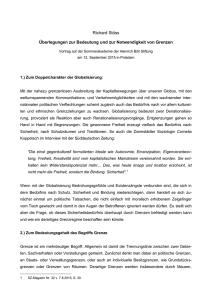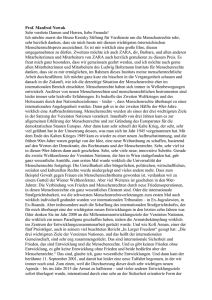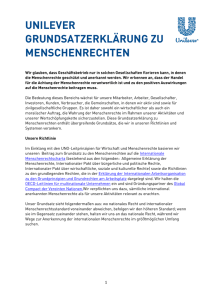Die kulturelle Identität Europas und die Frage der Menschenrechte
Werbung
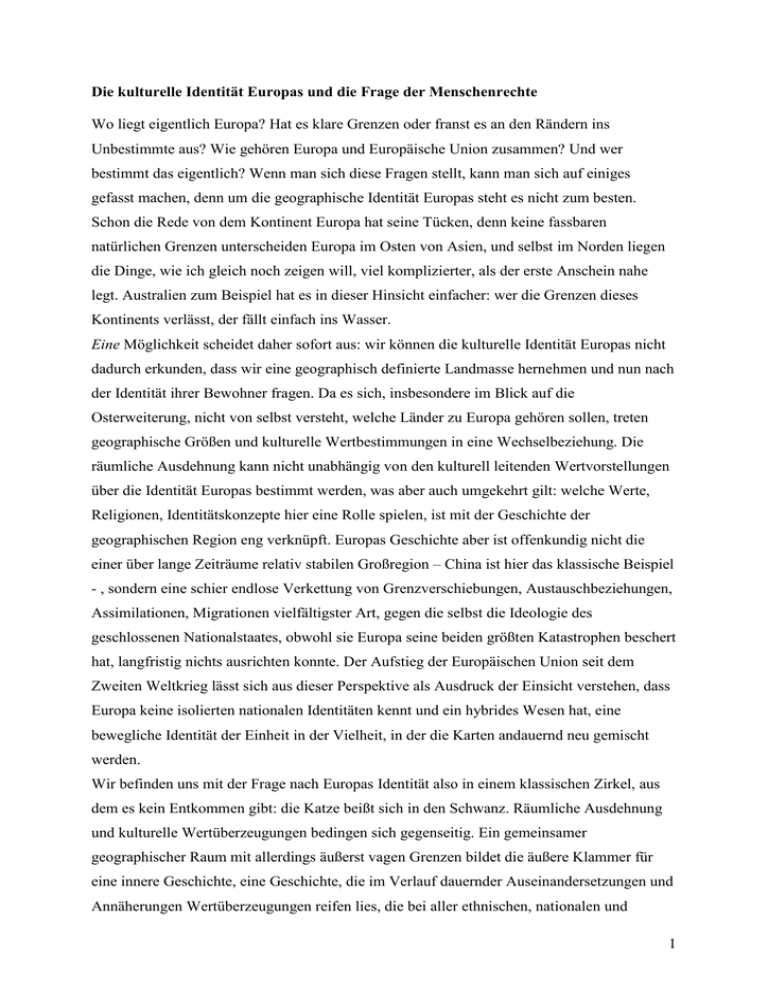
Die kulturelle Identität Europas und die Frage der Menschenrechte Wo liegt eigentlich Europa? Hat es klare Grenzen oder franst es an den Rändern ins Unbestimmte aus? Wie gehören Europa und Europäische Union zusammen? Und wer bestimmt das eigentlich? Wenn man sich diese Fragen stellt, kann man sich auf einiges gefasst machen, denn um die geographische Identität Europas steht es nicht zum besten. Schon die Rede von dem Kontinent Europa hat seine Tücken, denn keine fassbaren natürlichen Grenzen unterscheiden Europa im Osten von Asien, und selbst im Norden liegen die Dinge, wie ich gleich noch zeigen will, viel komplizierter, als der erste Anschein nahe legt. Australien zum Beispiel hat es in dieser Hinsicht einfacher: wer die Grenzen dieses Kontinents verlässt, der fällt einfach ins Wasser. Eine Möglichkeit scheidet daher sofort aus: wir können die kulturelle Identität Europas nicht dadurch erkunden, dass wir eine geographisch definierte Landmasse hernehmen und nun nach der Identität ihrer Bewohner fragen. Da es sich, insbesondere im Blick auf die Osterweiterung, nicht von selbst versteht, welche Länder zu Europa gehören sollen, treten geographische Größen und kulturelle Wertbestimmungen in eine Wechselbeziehung. Die räumliche Ausdehnung kann nicht unabhängig von den kulturell leitenden Wertvorstellungen über die Identität Europas bestimmt werden, was aber auch umgekehrt gilt: welche Werte, Religionen, Identitätskonzepte hier eine Rolle spielen, ist mit der Geschichte der geographischen Region eng verknüpft. Europas Geschichte aber ist offenkundig nicht die einer über lange Zeiträume relativ stabilen Großregion – China ist hier das klassische Beispiel - , sondern eine schier endlose Verkettung von Grenzverschiebungen, Austauschbeziehungen, Assimilationen, Migrationen vielfältigster Art, gegen die selbst die Ideologie des geschlossenen Nationalstaates, obwohl sie Europa seine beiden größten Katastrophen beschert hat, langfristig nichts ausrichten konnte. Der Aufstieg der Europäischen Union seit dem Zweiten Weltkrieg lässt sich aus dieser Perspektive als Ausdruck der Einsicht verstehen, dass Europa keine isolierten nationalen Identitäten kennt und ein hybrides Wesen hat, eine bewegliche Identität der Einheit in der Vielheit, in der die Karten andauernd neu gemischt werden. Wir befinden uns mit der Frage nach Europas Identität also in einem klassischen Zirkel, aus dem es kein Entkommen gibt: die Katze beißt sich in den Schwanz. Räumliche Ausdehnung und kulturelle Wertüberzeugungen bedingen sich gegenseitig. Ein gemeinsamer geographischer Raum mit allerdings äußerst vagen Grenzen bildet die äußere Klammer für eine innere Geschichte, eine Geschichte, die im Verlauf dauernder Auseinandersetzungen und Annäherungen Wertüberzeugungen reifen lies, die bei aller ethnischen, nationalen und 1 religiösen Pluralität doch auch auf identitätsstiftende Gemeinsamkeiten befragt werden können. Wo Europa liegt – was zu Europa gehört – und was Europa bedeutet: diese beiden Fragen gehören also zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Diesen Punkt möchte ich anschaulich machen, indem ich mich auf zwei Gegenbeispiele beziehe, die zeitlich und geographisch weit auseinander liegen: das mittelalterliche Grönland und das zeitgenössische Neuseeland. Die Insel hoch im Norden soll die Fallstricke einer falsch verstandenen Auffassung von kultureller Identität illustrieren, die sich gegen geographische Gesichtspunkte abschottet, das Land an den Antipoden hingegen soll eine Schwierigkeit verdeutlichen, in die der Zusammenhang von Identität und Menschenrechten führen kann. Den Hinweis auf Grönland verdanke ich dem faszinierenden Buch von Jared Diamond, Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Diamond schildert dort das traurige Schicksal der Wikinger in Grönland. Diese brachten, als sie um das Jahr 1000 von Norwegen aus mit der Besiedelung des 2500 km entfernten Grönlands begannen, ihre erst kürzlich erworbene kulturelle Identität als europäische Christen mit. So machten sie Grönland zu einem Teil Europas. Als ich zu Beginn auf die Schwierigkeit einer natürlichen Grenzziehung sogar im Norden Europas hinwies, hatte ich diese Seltsamkeit im Auge. Etwa 500 Jahre hielten sich die Wikinger in Grönland und installierten eine komplette europäische Infrastruktur einschließlich des Baus von Kathedralen und der aus Norwegen importierten Viehhaltungskultur. Unter anderem an einer Verschlechterung des Klimas gingen sie dann aber im 15. Jahrhundert zugrunde, während die Inuit-Kultur auf Grönland, mit derselben Verschlechterung konfrontiert, überlebte. Diamond zeigt nun in seinem Besteller höchst anschaulich, dass der Hauptgrund für den Untergang der Wikinger-Kolonie auf Grönland in deren rigider kultureller Identität als Europäer bestand, die sie dazu brachte, ihre angestammte Lebensform in ein dafür gar nicht geeignetes Umfeld zu übertragen. So forcierten sie beispielsweise eine ökologisch ruinöse Viehwirtschaft, grenzten sich aber gleichzeitig so entschieden von den als minderwertig betrachteten Inuit ab, dass es ihnen unmöglich wurde, unter fast arktischen Bedingungen überlebenssichernde Techniken wie die Jagd auf Wale zu übernehmen. Der Untergang der Wikinger auf Grönland ist also ein Lehrstück in kultureller Hybris und statischer Identitätsauffassung, die zusammen interkulturelles Lernen unmöglich machen. Mein nächstes Beispiel knüpft sich an den Staat Neuseeland. Er ist in der jüngeren Debatte zum Thema Europa immer wieder herangezogen worden, um eine Schwierigkeit deutlich zu machen, die mich noch beschäftigen wird. Denken wir nur an die Präambel zu dem in Frankreich und den Niederlanden gescheiterten Entwurf einer europäischen 2 Verfassung. Dort heißt es in Artikel I.2: „ Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“ Hehre Werte also, und prominent unter ihnen platziert, Menschenwürde und Menschenrechte, wie es sich gehört. Das Problem besteht darin, dass jeder Bezug auf Europa als eine geographische Größe fehlt. An seiner Stelle finden sich universell gültige und in der Tat zentrale Wertvorstellungen eines humanistischen Menschenbildes, sozusagen Bausteine einer kulturellen Identität der Gesamtmenschheit. Und nun kommt Neuseeland ins Spiel, eine gefestigte Demokratie, die sich in ihrem Selbstverständnis emphatisch den eben genannten Werten unterstellt. Was wäre nun, wenn Neuseeland unter Berufung auf Artikel I, 2 des Verfassungsentwurfs einen Mitgliedsantrag in der Europäischen Union stellen und genauso wie die Türkei auf Beitrittsverhandlungen insistieren würde? Wäre es nicht diskriminierend und damit ein expliziter Verstoß gegen die – vielleicht – künftige EU-Verfassung, Neuseeland dieses Ansinnen mit dem läppischen Argument abzuschlagen, das Land liege nun einmal am anderen Ende der Welt? Mit diesen beiden Beispielen ausgerüstet, lässt sich nun das zentrale Problem besser verstehen: kulturelle Wertvorstellungen und Identitäten sind, so zeigt uns das Beispiel von Normannisch-Grönland, keine starren Größen, sie können nur im Austausch und durch Veränderungsbereitschaft überleben. Wo dieser Austausch aber stattfindet – und Europa ist, im Guten wie im Schlechten, seit dem Ende der Antike eine einzige große Arena solcher Begegnungen gewesen – geraten regionale Identitäten in Fluß und kann eine Dynamik der „Wertgeneralisierung“ (Hans Joas) entstehen, an deren Ende universelle Werte stehen, die in Auckland genauso zustimmungsfähig sind wie in Brüssel. Der Diskurs der Menschenrechte hat ja, wie jüngst wieder Heiner Bielefeld gezeigt hat, schon seit einigen Jahrzehnten keinen ernsthaften globalen Gegenspieler mehr. Menschenrechte können dann aber eben als solche keine regionale Identität mehr begründen, wie das Beispiel Neuseeland zeigt. Damit haben wir den Zirkelschluß zwischen dem kulturell-werthaften und dem geographischen Aspekt von Identität zu einem Dilemma verschärft: werden Werte als regional und partikular verstanden, dann können sie auch entsprechende Identitäten stiften. In Europa ist für diesen Mechanismus vielleicht die Schweiz mit ihrer ausgeprägt kantonalen Struktur das beste Beispiel. Je enger der Zusammenhang von Wertbindung und geographischer Identität aber gefasst wird, umso 3 mehr gerät er in Widerspruch zu den universellen Werten der Menschheit. Alpine Abgeschiedenheit und Liebe zum Brauchtum lassen sich zusammendenken , aber Menschenrechte, die nur in Europa gelten würden, wären eine schreiende Absurdität. Um diesem Dilemma zu entkommen, brauchen wir erstens einen genaueren Begriff von Identität, zweitens eine Idee von der historisch-kulturgeographischen Eigenart Europas und drittens und vor allem eine durchdachte Konzeption der Art und Weise, in der lokale Erfahrungen und universelle Wertbindungen miteinander verknüpft sind. 1. Die Identität der Identität Mein sicherlich zunächst überraschender Kronzeuge in dieser Frage ist Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie. Er hat für das naturwissenschaftliche Denken etwas in Gang gebracht, das auch in kulturellen Zusammenhängen von entscheidender Bedeutung ist: die Überwindung des Essentialismus. Damit meine ich die Vorstellung, das jedes Ding einen Wesenskern hat, eine unveränderliche Substanz, an der ihre Identität hängt. Dieses weit verbreitete und tief in unser alltägliches Denken eingedrungene Bild könnte man auch das Avocado-Modell der Identität nennen (weiche Schale, harter Kern). Es ist so suggestiv wie falsch. Denn in der Wirklichkeit der Evolution gibt es keine ewigen Wesenheiten, sondern nur ständige Interaktionen zwischen relativ stabilen Einheiten, die sich in der Zeit verändern. Essentialisierungen dynamischer Prozesse haben seit Darwin in den Naturwissenschaften jeden Kredit verloren und sind angesichts der interaktiven Struktur des Sozialen in den Humanwissenschaften womöglich noch fataler als dort. Dennoch kommen sie in Feuilleton und öffentlichen Debatten häufig vor und wirken dann meist als destruktive Argumentationsstopper. Das beste Beispiel aus der Gegenwart sind Äußerungen über das unveränderliche Wesen „des“ Islam. „Der“ Islam, so heißt es dann, sei im Kern – hier haben wir wieder das Avocado-Modell – unfähig, die Trennung von Kirche und Staat zu denken, die Geltung des Koran zu relativieren etc. An die Stelle solcher pauschalen Identitätsbehauptungen, in denen ein realer, aber begrenzter Ausschnitt des Spektrums (z.B. der Islamismus) für die Sache selbst erklärt wird, sollten besser differenzierte Analysen über die faktisch vorfindliche Mannigfaltigkeit islamischer Positionen und ihre Entwicklungsdynamik treten. Ein anderes gutes Beispiel für die gefährliche Wirkung essentialistischer Identitätsmodelle ist Samuel Huntingtons Buch über den „Clash of Civilisations“. Es arbeitet mit flächigen Beschreibungen, in denen jeweils dynamische Prozesse, die von den Selbstbeschreibungen der Beteiligten abhängig sind, auf unveränderliche Wesenheiten zurückgeführt werden, die 4 dann wie Dinge aufeinanderprallen. Gefährlich sind solche Vorstellungen vor allem deshalb, weil ja Identitäten nicht einfach in der Welt herumliegen wie Gegenstände. Sie werden durch die Deutungen von Handelnden mit erzeugt und stabilisiert und wandeln sich mit ihnen. Eine Beschreibung wie diejenige Huntingtons zu akzeptieren hat daher den Charakter einer selbst erfüllenden Prophezeiung. Es hilft dabei mit, einen Zusammenstoß zu provozieren, der unter einer weniger essentialistischen Beschreibung vielleicht hätte vermieden werden können. Ein essentialistisches Modell von Identität verbietet sich also von selbst. Es wird dem Austauschcharakter, der Beweglichkeit, Pluralität und zeitlichen Dynamik von individuellen und sozialen Identitäten nicht gerecht. Huntington erweist sich in diesem Betracht als ein würdiger Nachfahre der Wikinger. Identität wird, wie auch die Sozialpsychologie seit Georg Herbert Mead immer wieder gezeigt hat, durch Interaktion und Kommunikation nach innen und außen nicht gefährdet, sondern überhaupt erst erzeugt. Dennoch ist nicht zu leugnen, dass ein wichtiger Bestandteil von Identitäten darin besteht, das eigene vom anderen zu unterscheiden. Man kann gar nicht „Ich“ oder „Wir“ sagen, ohne dabei implizit zu sagen: Du nicht, Ihr auch nicht etc. Wie lässt sich diese unvermeidliche Abgrenzungsfunktion der Identität von einer Ausgrenzung unterscheiden? Hier muß man zunächst hervorheben, dass Identität nicht nach einem Entweder-Oder-Schema funktioniert. Jeder Mensch unterhält zu jeder Zeit eine Menge von verschiedenen wertbesetzten Beziehungen zu höchst unterschiedlichen Gruppen, Aktivitäten und geographischen Regionen, die sich problemlos miteinander vertragen, oft auch ineinander verschachtelt sind. So kann ich mich problemlos gleichzeitig als Darmstädter, Südhesse, Deutscher, Europäer und Weltbürger fühlen. Und je stärker sich das zukünftige Europa von dem nationalstaatlichen Modell des 19. und 20. Jahrhunderts entfernt, desto weniger treten regionale, nationale, europäische und globale Identitätsaspekte in einen Gegensatz. Auch das buntscheckige Gewebe von Gebräuchen und Vorlieben, durch das sich Landsmannschaften identitätspflegend von anderen abgrenzen, hat an sich keine ausgrenzende Bedeutung. Man muß bloß die Kirche im Dorf lassen und zwischen Folklore und wichtigerem unterscheiden. Freilich ist das gemütliche „mir san mir“ nicht selten schon auf dem Sprung, in ausgrenzende Xenophobie umzuschlagen. Verhindert werden kann das – leicht in der Theorie, schwer in der Praxis –dadurch, dass regionale Identitäten in einen universalistischen Rahmen hineingestellt und damit gewissermaßen unschädlich gemacht werden. Das funktioniert aber nur, wenn die Werte, die ich als ausschlaggebend für meine Identität vertrete, tatsächlich für alle gelten können und sollen. Nehmen wir das Beispiel der Menschenrechte. Wer sich dadurch von anderen sozialen Gruppen und Individuen unterscheidet, dass er im Unterschied zu diesen auf der zentralen 5 Rolle der Menschenrechte besteht, der grenzt sich zwar ab, aber niemanden aus. Abgrenzung meint dann das Bestehen auf dem Gehalt von identitätsstiftenden Werten. Diese Werte sind aber in ihrem Umfang universell, d.h. für alle Menschen gültig. Was sich hier abstrakt anhört, hat der Verfassungsrechtler Arnim von Bogdandy sehr konkret zu Ende gedacht, nämlich im Blick auf das Verhältnis Europas zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Wertekanon der EU spielen die Idee des Völkerrechts und der Gedanke ausgleichender sozialer Gerechtigkeit gegenwärtig offensichtlich eine andere, größere Rolle als in den kulturellen Wertüberzeugungen der USA, was sich auch durch den Wahlsieg Obamas nicht geändert haben dürfte. Dies könnte man nun antiamerikanisch zu einer ausgrenzenden Identität stilisieren: Wir Europäer, so lautete dann die diabolische Einflüsterung, sind Euch Amerikanern moralisch überlegen, weil wir die universelleren Werte vertreten. Abgesehen von der dann fälligen historischen Erinnerung, dass die Idee eines Völkerbundes von dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson aus der Erfahrung des ersten Weltkriegs ins Spiel der internationalen Politik gebracht wurde, lässt sich aber nun leicht zeigen, dass ein solches selbstgerechtes Verständnis universeller Werte selbstuntergrabend ist. Wertüberzeugungen, die Gültigkeit für alle Menschen beanspruchen, zielen auf den Einschluss aller und sind deshalb unvereinbar mit Strategien, in denen sie zur geopolitisch-moralischen Besserstellung einzelner Weltregionen instrumentalisiert werden. So zu argumentieren, verschärft allerdings noch das Dilemma, auf das wir bereits gestoßen waren: wie können kulturelle Werte, die unter den Bedingungen von Pluralismus und Austausch einer Dynamik der Verallgemeinerung unterliegen, regionale Identitäten begründen? Darauf werde ich in meinem letzten Punkt zu sprechen kommen. 2. Die Geburt Europas aus der Ehe von Kultur und Geographie Europa ist ein soziales Konstrukt und gleichwohl nicht willkürlich, sondern erwachsen aus historischen Erfahrungszusammenhängen, die geographische Nähe teils zur Voraussetzung hatten, wie sie diese umgekehrt– durch Verkehrswege etc. – teils erst ermöglich haben. Deshalb gehört Grönland zu Europa, Neuseeland aber nicht, unbeschadet dessen, dass seine normativen Grundlagen in denselben universalistischen Werten gefunden werden können, die die Verfassungspräambel für Europa beschreibt. Ich möchte das für Europa typische Ineinandergreifen geographischer Vorgaben und kultureller Interpretationen nun anhand einer Schrift von Remi Brague über Europas „Exzentrische Identität“ knapp nachzeichnen. Dieses Buch war so etwas wie der Eröffnungszug in der jüngeren Debatte über das Identitätsthema. 6 Den kulturgeographischen Gedanken, den ich hier entwickelt habe, spitzt Brague nochmals zu, indem er betont, dass die Identität Europa weder kulturell noch geographisch in irgendeiner Weise jemals gesichert gewesen sei, sondern im Verlauf seiner Geschichte in dauernder Auseinandersetzung mit dem kulturell und geographisch Fremden ständig neu errungen werden musste. Der Witz von Europas Identität liegt nach Brague darin, dass sein Eigenes ausschließlich der mühevollen Aneignung des Anderen entsprungen ist. Das von ihm benannte klassische Gegenbeispiel ist wiederum China, wo über viele Jahrhunderte ein in sich geschlossenes Staatswesen, verkoppelt mit einer konfuzianistischen Weltanschauung, eine substanzielle und höchst stabile Identität hervorgebracht habe. Sinologen werden hier mit Recht entschieden widersprechen, aber Bragues Gegenbeispiel dient nur der rhetorischen Zuspitzung und ist insoweit entbehrlich. Europa sei jedenfalls ein besitzloser Habenichts, bestenfalls der Erbe heterogener Traditionen, ein Schwamm, der gierig die kulturschöpferischen Taten früherer und fremder Zivilisationen aufsaugt. Und in der Tat ist zumindest das Christentum, der unstrittig prägendste Faktor der europäischen Geschichte, ja nicht auf europäischem Boden entstanden. Anders liegen die Dinge zwar, wenn man von dem enormen Einfluss ägyptischer und asiatischer Quellen einmal absieht, mit der zweiten zentralen Größe, der griechischen Philosophie. Aber sie ist eben europäisches Erbe erst mittels ihrer Aneignung durch die Römer geworden. Brague spricht deswegen von der „Romanität“ als dem Prinzip Europas und meint damit eine aneignende, offene, interpretierende und weiterentwickelnde Einstellung dem Fremden gegenüber. Exzentrisch ist Europas Identität dann deshalb, weil sie keine Hausgeburt ist, sondern, wenn ich im Bild bleiben darf, eine Auslandsadoption. An dieser Stelle kann ich nun Bragues Argumentation mit dem zusammenbringen, was ich im Anschluß an Darwin zur Überwindung des Essentialismus gesagt habe. Substanzielle und essentielle Identitäten werden sich schließlich, wenn diese Überlegungen zutreffend sind, über kurz oder lang als Sackgassen erweisen, während exzentrische Identitäten zu immer neuen Wegkreuzungen führen. Das Exzentrische, sozusagen Zweitklassige Europas verglichen mit in sich ruhenden alten Zivilisationen - , seine fehlende Essenz erweist sich damit als Stärke. Das kulturelle Profil Europas ist eben nicht dem ruhigen und selbstgewissen Blick nach innen erwachsen, es hat sich erst durch weiträumige Interaktionen, also im selben Zug mit der Gliederung und Begrenzung seines geographischen Raums ausgebildet. Brague unterscheidet dabei zwei Hauptachsen von zwei späteren Unterteilungen. Die erste Hauptachse entsteht mit der Blüte der griechischen Kultur und trennt als Schnitt auf der NordSüd-Achse das Mittelmeerbecken als Okzident vom Rest der Welt als dem Orient. Quer dazu 7 kommt es mit der Ausbreitung des Islam zu einem zweiten Schnitt auf der Achse Ost-West, der die christlich geprägte nördliche Hälfte des Mittelmeerraums von seinem islamischen Süden trennt. Auch die beiden späteren kulturgeographischen Achsen sind mit geistigen Umwälzungen eng verbunden. Der dritte Schnitt unterscheidet innerhalb Europas lateinische und byzantinische Christen und hat die Geschichte der Balkanländer, durch die er verläuft, zutiefst geprägt. Der vierte und letzte Schritt schließlich setzt eine Zäsur im europäischen Kernland, indem er den protestantischen Norden vom katholischen Süden trennt. Diese geographischen Trennungslinien sind natürlich zugleich Verbindungslinien, Zonen der Auseinandersetzung und mithin die Konfinien einer für Europa typischen Einheitserfahrung. Diese entstand, wie jüngst der Historiker Michael Borgolte in einem faszinierenden Buch vorgeführt hat, gerade aus der Vielfalt. Gerade im Mittelalter, so zeigt Borgolte, ist der innere Bezug der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam bis hin zu tödlichen Konflikten so intensiv, dass daraus neben Hass und Unverständnis doch auch die Erfahrung eines neuen Typs von Identität entspringen konnte, nämlich einer Identität, die sich weder auf territoriale Selbstverständlichkeiten, noch auf eine fraglose Leitkultur, sondern gerade auf die „ertragene Differenz“ in der dauernden Auseinandersetzung stützen konnte. Der geographische Aspekt wird hier also mit den kulturellen Selbstverständnissen in der Weise verbunden, dass räumliche Nähe zum Medium einer gemeinsamen historischen Erfahrung werden kann. Ich glaube, in diese Richtung sollte man weitergehen. Hier ist aber eine wichtige Unterscheidung angebracht: eine „gemeinsame Erfahrung“ liegt nämlich nicht bereits dann schon vor, wenn Völker oder andere soziale Gruppen in einen historischen Kontakt treten. Oft zielt dieser Kontakt ja auch auf Leib und Leben der anderen, und dreißig Jahre hat es im 17. Jahrhundert gedauert, bis das Gemetzel der Konfessionskriege durch den Westfälischen Frieden beendet werden konnte. Es gibt keinen Automatismus, der von durchlebten Gewalterfahrungen zur Bereitschaft für Frieden und Toleranz führt. Das beste und schrecklichste Beispiel hierfür ist natürlich der Beginn eines zweiten Weltkriegs 21 Jahre nach dem Ende des ersten. Erst nachdem der Aggressor, das deutsche Reich, militärisch bezwungen war, konnten vorausschauende Europäer eine gemeinsame historische Erfahrung formulieren, um Vergleichbares zukünftig zu verhindern. Das geeinte Europa war deshalb schon in seinen Anfängen als Robert Schumans Montanunion mehr als ein Wirtschaftsverband, der normative Hintergrund immer präsent, die wirtschaftliche Einheit nie Selbstzweck. Für das Argument, das ich hier entwickeln möchte, ist daher der Unterschied zwischen zwei Arten von Erfahrung zentral: einer „Erfahrung, die alle machen“ und einer 8 „gemeinsamen Erfahrung“. Die Frage nach der Rolle der Menschenrechte für die kulturelle Identität Europas wird nur vor diesem Hintergrund überhaupt verständlich. Alle Völker Europas, die Schweiz einmal beiseitegelassen, haben zweifelsohne im vergangenen Jahrhundert Schreckliches durchgemacht. Aber die Gewaltgeschichte Europas kennt Täter, Opfer und Unbeteiligte, manchmal in klar verteilten und moralisch scharf geschnittenen Grenzen, wie im Falle von Nazideutschland und den europäischen Juden, manchmal in komplexen, unentwirrbaren Gemengelagen. Es wäre aber nicht nur zynisch, sondern geradezu moralisch verabscheuungswürdig, wollte man deshalb etwa sagen, Nazis und Juden hätten im dritten Reich eine gemeinsame Erfahrung gemacht. Damit aus einem historischen Prozess, an dem alle beteiligt sind, eine geteilte, gemeinsame Erfahrung werden kann, müssen die beteiligten Parteien oder ihre Nachfahren eine gemeinsame Sprache finden, in der eine Lehre aus der leidvollen Vergangenheit gezogen wird. Auch der positive Aspekt des europäischen Erbes, die Vielfalt der Kulturen und die Kultur eines differenzoffenen Umgangs mit ihr, gründet in der Idee von Europa als einem möglichen Raum geteilter Erfahrungen. Dies ist die Argumentationslinie, mit der ich einen inneren Zusammenhang zwischen der kulturellen Identität Europas und der Frage der Menschenrechte herstellen werde. Zuvor will ich aber das historische Profil der europäischen Identität zusammenfassend nochmals skizzieren und dabei die Rolle der Religionen ins Zentrum rücken. Dabei ist mir bewusst, dass die wirkliche Geschichte ethnische, wirtschaftliche, machtpolitische und religiöse Aspekte immer untrennbar verknüpft zeigt. Zwei Punkte sind es, die sich hier vor allem als wichtig erweisen: erstens die Erfahrung von Vielheit und Fremdheit im Unterschied zu einem fraglosen Ruhen im Eigenen, zweitens die Erfahrung von Gewalt von den Kreuzzügen und Judenpogromen über die Konfessionskriege, den Kolonialismus bis hin zu den Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts. Beides gehört natürlich eng zusammen. Es ist eine faszinierende These Michael Borgoltes, dass sowohl die Intensivierung der Gewalt als auch die Chancen zu einer pluralismusfreundlichen, toleranten Identität in einem engen Zusammenhang mit der eigentümlichen Religionsgeschichte Europas steht, und zwar wiederum sowohl innerhalb des Christentums als auch in der Auseinandersetzung mit Judentum und Islam. Die Geschichte der Europäisierung des Christentums ist in gewissem Sinn die Geschichte der Entstehung Europas. Sie ist gekennzeichnet durch den Übergang von der polytheistischen Pluralität der vorchristlichen Antike zur Konkurrenz dreier universalistischer Monotheismen, die sich alle auf die Tradition Abrahams begründen. Dieser Universalismus, also die Vorstellung, die eine Wahrheit über den einen Gott für alle Menschen zu vertreten, ist zweifelsohne ein unerschöpflicher Quell von Militanz und 9 Aggression, der Jagd auf Ketzer und Ungläubige gewesen und bis heute geblieben. Er war aber eben auch ein Quell für die Entwicklung von Toleranzvorstellungen und praktischen Formen der Duldung, auch des Dialogs. Wenn es nur eine Wahrheit gibt, sie aber jeder von sich aus entdecken muss, dann kommen die Dinge in Bewegung. Diese beiden Dimensionen der abendländischen Religionsgeschichte, die gewaltsame und die tolerante, gehören untrennbar zusammen. Die Vorstellung einer Identität durch die Erfahrung von Differenz hindurch konnte sich im schiedlich-friedlichen Milieu polytheistischer Pluralität nicht entwickeln, genauso wenig aber unter der Alleinherrschaft einer einzigen monotheistischen Religion. Ein exklusiv christliches Abendland, wie es sich die Romantik gelegentlich herbeigewünscht hat, hat es nie gegeben. Die kulturgeographischen Grenzen Europa sind in jedem Sinne fließend, sie dokumentieren nicht die Essenz einer Identität, sondern den aktuellen Stand einer Auseinandersetzung um die Frage, wie Einheit aus Vielheit entstehen kann. Ich halte deshalb auch die Rede von einem Kerneuropa, um das sich in konzentrischen Kreis Neuzugänge und Beitrittswillige gruppieren, für wenig hilfreich. Sie leidet an dem Essentialismus des Avocado-Modells. Wenn zutrifft, was ich hier über den dynamischen, von Auseinandersetzung und Vielfalt lebenden Charakter der Identität Europas gesagt habe, dann muss sich der Kern jedes Mal mit verändern, wenn eine neue Schale hinzukommt. Die Wertvorstellungen, die Europas kulturelle Identität begründen, sind in den Erfahrungen von tiefem Pluralismus und zerstörerischer Gewalt erwachsen. „Tief“ ist der Pluralismus, weil er eine dauernde Konkurrenz um verbindliche Sinngebungen einschließt. „Zerstörerisch“ ist die Gewalt, weil sie diese Tiefe nicht aushalten kann. - Dass die gewaltige Zentrifugalkraft dieser Erfahrungen den Kontinent nicht auseinandergesprengt hat, ist nicht selbstverständlich und war es vor allem nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht. Aber die Geschichte der Europäischen Union, soweit sie über gemeinsame Märkte und Bürokratien hinausgeht, zeigt auch, dass aus solchen Erfahrungen aller doch gemeinsame Werte werden können. Diese Werte – Menschenrechte, Frieden, Gerechtigkeit usw. - sind universell und es muss nun zum Schluss gefragt werden, ob und wie sich aus einem gemeinsamen Wertuniversalismus der Europäer eine lokale Identität ergeben kann, durch die sich unsere Weltregion von anderen abgrenzt, ohne sie auszugrenzen. 3. Universelle Menschenrechte und die regionale Identität Europas 10 Seit der Gründung der Vereinigten Nationen und der Menschenrechtserklärung von 1948 hat dieser Begriff eine ganz erstaunliche Karriere durchgemacht. Die Idee, dass Menschen ohne weitere Qualifikationen, einfach weil sie Menschen sind, über angeborene und unveräußerliche Rechte verfügen, die in ihrer unverlierbaren Würde begründet sind, ist zu einer Art „Zivilreligion der Moderne“ geworden, zu einem Wert der Werte, einem Heiligen Schrein des Globalismus, auf den sich zumindest in der Theorie alle einigen können. An Versuchen, Menschenrechte und -Würde nicht bloß zu fordern, sondern auch zu begründen, fehlt es nicht. Dabei kann man entweder von der Würde des Einzelnen ausgehen, wie in der schöpfungstheologischen Begründung oder in Kants kategorischem Imperativ, oder man kann den sozialen Charakter der Würde betonen und landet dann bei vertrags- oder kommunikationstheoretischen Ansätzen wie etwa dem von Jürgen Habermas. Allen Varianten ist gemeinsam, dass sie sozusagen auf der Augenhöhe der Menschheit argumentieren und von allen persönlichen, kulturellen und geographischen Besonderheiten absehen. Und darin liegt ja auch gerade der Witz des Wertkomplexes „Menschenwürde und Menschenrechte“. Er ist von Hause aus universalistisch und in jüngster Zeit haben sich sogar, etwa in der Tierethik die Stimmen vermehrt, die über die Gattung Mensch hinaus fordern, auch anderen Wesen, vor allem den höheren Tieren, Rechte und eine abgestufte Würde zuzugestehen. Wie weit diese Dynamik noch führen wird, lässt sich gar nicht absehen. Aber eines steht fest: wenn man den normativen Gehalt des Menschenrechtsgedankens zu bestimmen versucht, dann fehlt ihm jede europäische Note. Menschenrechte als Prärogativ einer Gruppe sind einfach absurd. Aus diesem unbestreitbaren Sachverhalte haben einige Autoren geschlossen, dass ein universalistischer Identitätsbegriff ebenfalls ein Paradox darstellt. Besonders weit hat sich in diese Hinsicht der Politikwissenschaftler Thomas Meyer aus dem Fenster gelehnt. In einem Buch mit dem Titel Die Identität Europas ironisiert er die Geschichte der einschlägigen Bemühungen um entsprechende programmatische Texte, von der 1995 auf Anregung Vaclav Havels verabschiedeten Charta der europäischen Identität bis hin zu den aktuellen Verfassungsentwürfen, die seit Lissabon nicht mehr so genannt werden dürfen. Die Ironie Meyers bezieht sich natürlich nicht auf die Geltung der dort hervorgehobenen Werte, sondern auf den Versuch, sie zur Grundlage einer spezifisch europäischen Identität zu machen. Meyer zieht aus seiner Analyse die weitreichende Schlussfolgerung, dass Europa gar keine kulturelle Identität braucht, weil die einzigen Werte, die dafür in Frage kämen, universelle Werte sind, diese aber nicht Europa alleine, sondern der ganzen Welt gehören. Damit schießt er meiner Meinung nach über das Ziel hinaus und ich möchte nun begründen, warum: Die Position Meyers ist typisch für jene Stimmen in der Diskussion, die, geleitet von einer 11 geschichtsphilosophischen Theorie der Säkularisierung, universelle Werte in vernünftigen Argumentationen begründet sehen, die auf die Überwindung historischer Traditionen, religiöser Weltanschauungen und kultureller Identitäten zielen. Die Aufklärung wird in diesem Denken als ein Prozess verstanden, der darauf abzielt, gewachsene, biographisch und geschichtlich vermittelte und in affektiven Gemeinschaften verkörperte Wertbindungen – das Partikulare - durch vernünftigen Universalismus zu ersetzen. Ich halte das für falsch und für ebenso einseitig wie den reaktionären Versuch, den Universalismus der Menschenrechte durch den Hinweis auf gewachsene lokale Auffassungen zu unterlaufen (wie etwa die angebliche asiatisch-kollektive Deutung der Menschenrechte). Für die kulturelle Identität Europas hängt deshalb vieles davon ab, zwei Dinge gleichzeitig festzuhalten: den Universalismus der für Europa maßgeblichen Werte und die Tatsache, dass ein lebendiges Verhältnis zu solchen Werten nur dadurch entstehen kann, dass man sich auf historische, emotional erregende Erfahrungen bezieht. Ohne die Schubkraft der Gefühle und der gemeinsamen Geschichte bleibt die Verpflichtung auf die Menschenrechte blass und droht zum Ornament, zum rhetorischen Füllsel für Sonntagsreden zu verkommen. Europa ist der Kontinent, in dem von Anfang an die verschiedensten Religion und Lebensformen nicht nur mit einander in Kontakt kamen, sondern auch um die Deutung der Welt konkurrierten und dabei von der wechselseitigen Auslöschung bis zu Verständnis und Toleranz alle Spielarten des Umgangs mit Differenz durchprobiert haben. Es waren in meinen Augen diese historischen Erfahrungen, die dann in der Aufklärungszeit zu philosophischen Begründungen für die Menschenrechte geführt haben. Der rote Faden zu den emotional bedrängenden, häufig extrem leidvollen und höchst unterschiedlichen Geschichten der zahlreichen ethnischen und religiösen Gruppen ist dabei nicht zerschnitten worden. Das lokale, historisch gewachsene Selbstverständnis der Menschen bleibt also auch dann bestimmend, wenn man zu der Einsicht vorgedrungen ist, dass alle wichtigen Werte universeller Natur sind und der ganzen Menschheit gehören. Kwame Anthony Appiah, der in Ghana aufgewachsene Princetoner Philosoph, hat dies als den Kern seines Kosmopolitanismus bezeichnet: „Cosmoplitanism, is, in a slogan, universality plus difference“. Dieser Wechselbezug des Menschheitlichen und des Lokalen lässt sich in zwei Richtungen ausbuchstabieren: erstens besteht zwischen den historischen Erfahrungen und kulturellen Prägungen der Menschen und dem Durchbruch der Aufklärung zu universellen Begründungen kein ausschließender Gegensatz; vielmehr bringen philosophisch-diskursive Argumente Intuitionen auf den Punkt, die im Erleben der Menschen entstanden und schon vorher in Erzählungen, Liedern und Ritualen lebendig gehalten wurden. Die Philosophie ist 12 immer nur, wie Hegel schon sagte, ihre Zeit in Gedanken gefasst. Es ist ein absurdes Zerrbild zu glauben, die moderne Auffassung der Menschenrechte sei durch einen Vernunftgebrauch erreicht worden, der frei und unabhängig über einem Sumpf aus lebensweltlicher Dumpfheit und religiösen Vorurteilen geschwebt habe. Zweitens aber ist es genauso falsch, aus dem Universalismus der Werte zu schließen, der Weg, auf dem man zu ihnen gelangt ist, spiele nun keine Rolle mehr. Damit etwas von einer abstrakten Norm zu einem die Person ergreifenden Wert wird, muss dieser Wert in einer engen Beziehung zu der Herkunftsgeschichte der Person stehen. Das gleiche gilt für soziale Gruppen. Die Menschenrechte gelten und sollen gelten in Europa wie in Neuseeland und anderswo. Aber hierzulande hat ihre Geltung eine spezifische lokale Motivation. Zu ihr gehört natürlich auch, dass es vielfach europäische Denker waren, die den Menschenrechtsdiskurs in Gang brachten. Genauso wichtig sind aber die konkreten historischen Erfahrungen der Europäer. Sie reichen historisch seit dem Mittelalter vom Dialog und der Einübung von Toleranz bis zu gegenseitigem Hass und kriegerischer Aggression. Im 20. Jahrhundert hat sich dieser negative Aspekt der Identität Europas als Arena des Austrags von tiefer Verschiedenheit katastrophal zugespitzt. Wie essentiell die Geltung der Menschenrechte in die kulturelle Identität Europas hineinreicht, haben die Europäer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert überwiegend dadurch lernen müssen, dass diese mit Füßen getreten wurde. Soweit aber aus dieser Erfahrung aller im Zuge der Einigungsprozesses dann auch eine gemeinsame Erfahrung wird, entsteht dabei dann auch ein spezifisch europäisches Verständnis der Menschenrechte, das ihre universelle Geltung eher noch unterstreicht. Viele Wege führen nach Rom, viele Exoduserzählungen ins gelobte Land des menschenrechtlichen Universalismus. Europa kann seine kulturelle Identität finden, indem es sich aus seiner regionalen Geschichte und auf seine besondere Weise als Verkörperung globaler Werte entdeckt. 13