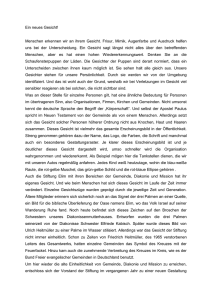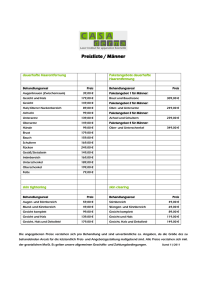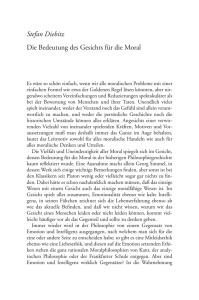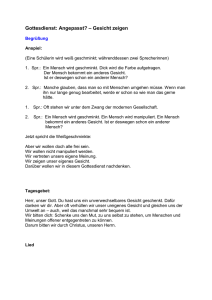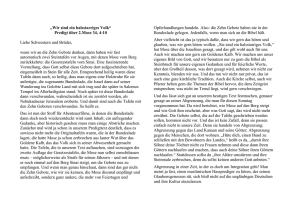Melanie Wolfers / Andreas Knapp (Salzburg, 24
Werbung
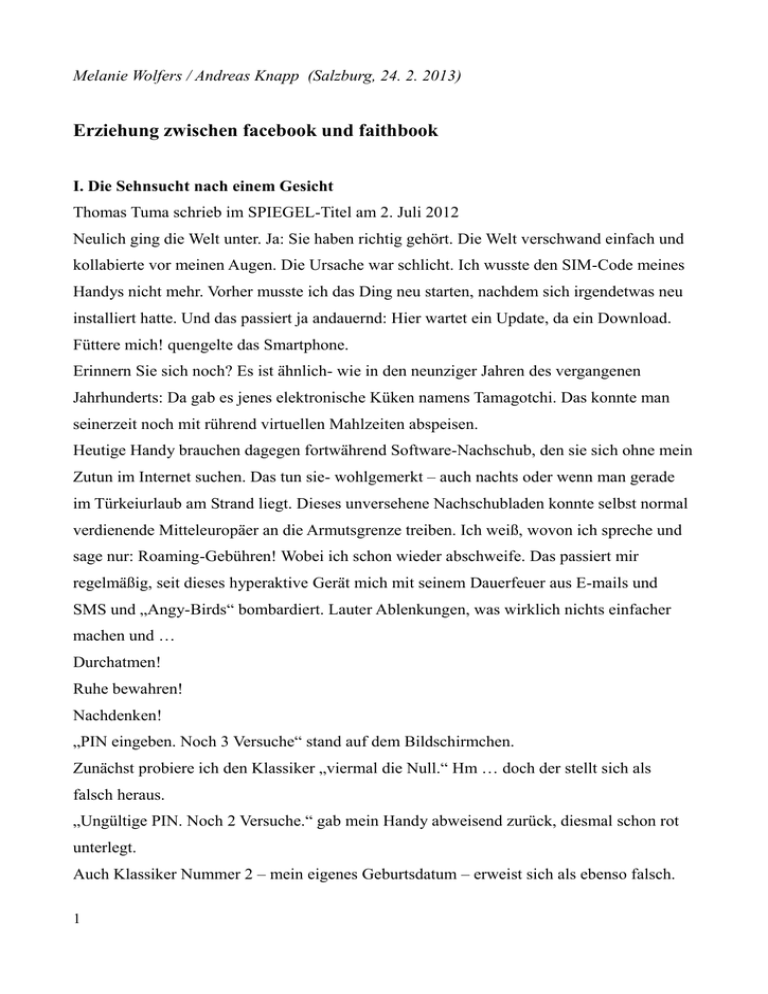
Melanie Wolfers / Andreas Knapp (Salzburg, 24. 2. 2013) Erziehung zwischen facebook und faithbook I. Die Sehnsucht nach einem Gesicht Thomas Tuma schrieb im SPIEGEL-Titel am 2. Juli 2012 Neulich ging die Welt unter. Ja: Sie haben richtig gehört. Die Welt verschwand einfach und kollabierte vor meinen Augen. Die Ursache war schlicht. Ich wusste den SIM-Code meines Handys nicht mehr. Vorher musste ich das Ding neu starten, nachdem sich irgendetwas neu installiert hatte. Und das passiert ja andauernd: Hier wartet ein Update, da ein Download. Füttere mich! quengelte das Smartphone. Erinnern Sie sich noch? Es ist ähnlich- wie in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts: Da gab es jenes elektronische Küken namens Tamagotchi. Das konnte man seinerzeit noch mit rührend virtuellen Mahlzeiten abspeisen. Heutige Handy brauchen dagegen fortwährend Software-Nachschub, den sie sich ohne mein Zutun im Internet suchen. Das tun sie- wohlgemerkt – auch nachts oder wenn man gerade im Türkeiurlaub am Strand liegt. Dieses unversehene Nachschubladen konnte selbst normal verdienende Mitteleuropäer an die Armutsgrenze treiben. Ich weiß, wovon ich spreche und sage nur: Roaming-Gebühren! Wobei ich schon wieder abschweife. Das passiert mir regelmäßig, seit dieses hyperaktive Gerät mich mit seinem Dauerfeuer aus E-mails und SMS und „Angy-Birds“ bombardiert. Lauter Ablenkungen, was wirklich nichts einfacher machen und … Durchatmen! Ruhe bewahren! Nachdenken! „PIN eingeben. Noch 3 Versuche“ stand auf dem Bildschirmchen. Zunächst probiere ich den Klassiker „viermal die Null.“ Hm … doch der stellt sich als falsch heraus. „Ungültige PIN. Noch 2 Versuche.“ gab mein Handy abweisend zurück, diesmal schon rot unterlegt. Auch Klassiker Nummer 2 – mein eigenes Geburtsdatum – erweist sich als ebenso falsch. 1 „Ungültige PIN! Noch 1 Versuch!“ so die unerbittliche Anzeige auf dem kleinen Bildschirmchen. Zugegeben: mein dritter Versuch mit „2147“ war eher eine Verlegenheitslösung. Dabei hätte ich schwören können, dass mein Ziffern-Code ganz nahe dran war an 4711 – also an Omas Eau de Cologne – Danach war alles zu spät. Mein Handy verbarrikadierte sich und mit ihm die Welt. Keine Post mehr, keine Anrufe, kein Terminkalender und überhaupt: Kein Überblick mehr. Nur noch ich – ohne Anschluss an mein eigenes Leben. So glitt ich hinein in eine düstere sternenlose Nacht... Isolation pur. Seither ist mir unausweichlich klar: Ohne mein Smartphone bin ich vom Rest der Welt abgenabelt – wie Robinson Crusoe, der Insulaner ohne seinen Freitag. Man wacht in einer Realität auf, die überraschend fremd wirkt. Nicht einmal 7 Jahre ist es her, dass das Smartphone auf den Markt kam: Damals kampierten Scharen echter Fans vor den Apple-Filialen und konnten den Verkaufsstart kaum erwarten. Stellen Sie sich einmal vor: Johannes Gutenbergs Buchdruckerkunst brauchte 200 Jahre, um sich global durchzusetzen. Dieses kleine Ding hingegen hat den Planeten in nur 5 Jahren erobert mit seiner Kombination aus Internetzugang und mobilem Telefon. In Deutschland sollen inzwischen 113 Millionen Mobiltelefone in Gebrauch sein. Insofern konnte der Vorstandschef eines großen Softwareherstellers witzeln: Wussten Sie eigentlich, dass auf der Welt mehr Menschen ein Handy besitzen als eine Zahlbürste? Eine Revolution ungeahnten Ausmaßes, die unsere Kommunikationsstrukturen völlig verändert. Denken wir an „Facebook“: Facebook ist eine Website, die soziale Netzwerke im Internet ermöglicht. Im Jahr 2004 erstmals zugänglich erreicht die Plattform heute rund 900 Millionen Nutzer, der Großteil von ihnen zwischen 18 und 40 Jahren. Diese Entwicklung legt nahe, über den Namen des Netzwerkes ein wenig nachzudenken. Denn „Facebook“ ist ein interessanter Name für ein soziales Netzwerk: „das Buch der Gesichter“. Vielleicht drückt sich in dem Namen aus: „Zeig dein Gesicht. Zeig, wer du bist und teile mit anderen, was Dir wichtig ist.“ Möglicherweise drückt sich darin auch der 2 Wunsch aus: „Ich will mein Gesicht zeigen, will in Kommunikation und Beziehung treten.“ Der Name „Facebook“ kann aber auch die Aufforderung und Bitte enthalten: „Sieh mein Gesicht! Sieh mich an! Nimm mich wahr und schenk mir Anerkennung!“ Der französische Philosoph Emmanuel Lévinas hat viel über das menschliche Antlitz nachgedacht und beobachtet: Im Blick eines anderen kommt einem die Aufforderung entgegen: „Sieh mich! Achte mich!“ Im Antlitz des Anderen liegt der unbedingte Appell: „Lass mich in meiner Angewiesenheit auf andere nicht allein! Sei mir Bruder! Sei mir Schwester!“ Wer derart vom Blick eines anderen berührt wird, spürt: „Hier bin ich gemeint. Ich bin zu einer Antwort herausgefordert, die nur ich allein geben kann." Ein solcher Blick kann das Beste im eigenen 'Ich' wachrufen, das zu echter Wertschätzung und selbstvergessener Zuwendung fähig ist. Zugleich fällt es schwer, einander face to face zu begegnen, denn eine wechselseitige Beziehung bedeutet auch, dass ich mich verletzlich mache. In einer echten Beziehung gestattet man der anderen Person, dass sie meinen Horizont und meine Pläne bereichert oder weitet, aber ebenso auch stört, verändert oder infrage stellt. Wir Menschen haben ein Urbedürfnis nach Kommunikation und zugleich tun wir uns schwer damit, unser Gesicht wirklich zu zeigen und in offene, authentische Beziehungen einzutreten. Hier lauert auch eine Gefahr der medialen Kommunikation. Für viele ist das Handy zu einem Körperteil geworden. Man will immer erreichbar, online sein. On sein oder nicht on sein, ist das überhaupt noch eine Frage? Man will vernetzt sein. Das schnurlose Telefon als eine drahtlose Nabelschnur. In Italien, wo die Spaghetti exakt „al dente“ sein müssen, rufen die heimkehrenden Schüler im Bus 8 min vor Ankunft an: „Mama, butta la pasta! Jetzt kannst du die Spaghetti ins Wasser werfen!“ Jede Kleinigkeit muss mitgeteilt werden: „Es fängt gerade an zu regnen.“ „Lisa hat heute Salami auf ihrem Jausenbrot.“ „Unser Klassenlehrer hat heute eine grüne Kravatte an.“ Und schauen Sie mal, wie viele Menschen mit einem Knopf im Ohr, vor sich hin brabbelnd und auf den Boden starrend, durch die Stadt laufen. Doch welche Qualität hat diese Art von Kommunikation? Der Hirnforscher Manfred Spitzer beschreibt in seinem Buch „Digitale Demenz!“ karikierend eine kommunikative Situation: 3 Man hat ein Rendevouz im Restaurant und sitzt sich gegenüber. Doch man schaut sich nicht mehr gegenseitig in die Augen, sondern jeder starrt auf sein Smart-phone, vielleicht um seinen Freunden zu twittern, wie toll das Rendevouz gerade ist. (Spitzer, Digitale Demenz, 109). Viele ziehen es vor, keine richtigen Telefongespräche oder gar Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu führen. Dafür mailt und simst man, „das ist unpersönlich, leicht zeitversetzt und erreicht sein Ziel dennoch mit der Präzision einer Fernlenkwaffe. Die Sprache und damit auch die Tiefe des Austausches geht dabei allmählich flöten. Und kann jemand, der nicht mehr klar, sauber und bisweilen ausführlich schreibt, noch klar, sauber und ausführlich denken? SMS zum Beispiel zerlegen Dialoge in kleinste Bestandteile, die oft kein Ganzes mehr ergeben. Ich denke auf 160-Zeichen-Level.“ (DER SPIEGEL 27/2012, 65) Welche substantielle Kommunikation ist da noch möglich? Wie kann man so etwas Komplexes wie das eigene Innenleben dann noch annähernd angemessen mitteilen? Und welchen Einfluss hat die Quantifizierung von Kommunikation auf deren Qualität? Früher überreichte man seiner ersten großen Liebe mit zitternden Händen noch einen Zettel, auf dem stand: Willst du mit mir gehen? Heute kann man einfach ein Dutzend mails an Mädels im Umfeld verschicken in der Hoffnung, dass eine davon schon antworten wird. (vgl. DER SPIEGEL 27/2012, 67). Dazu eine Zahl: Ein Teenager in den USA erhält im Durchschnitt 3417 Textnachrichten monatlich, das sind 7-8 Mitteilungen pro Stunde, wenn man den Tag mit 16 Stunden ansetzt. Die US-Soziologin und Technologieexpertin Sherry Turkle gibt zu bedenken: Wenn heute jemand ein Gefühl oder eine Idee hat, dann verschickt er eine Nachricht an alle seine Freunde. Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, er rufe seine Frau 15 mal täglich an, dann wäre das ein untrügliches Zeichen für eine Zwangshandlung gewesen. Heute ist das etwas ganz normales. Rund eine Milliarde Menschen meinen, ihre spontanen Gefühle und Meinungen in Schlagworten „posten“ zu müssen. Der Berliner Philosoph Byung-Chul Han stellte vor ein paar Wochen die Sinnfrage von moderner Verständigung. Er schreibt: „Die digitale Kommunikation ist nicht dafür geeignet, Sinn zu produzieren. Nur ein Dialog mit einem Du kann Sinn stiften. Ein Gebet wäre ein Dialog. Auf Facebook oder Twitter ist kein Dialog möglich, dazu gehört mehr als 'Gefällt mir'. Aber die Kirchen leeren und Facebook 4 füllt sich. Es ist eine neue Kirche entstanden, die aber keinen Sinn stiftet. Auf Facebook können wir dem Tod nicht entkommen. Und weil wir das spüren, kommunizieren wir immer mehr und immer schneller.“ Diese Angst schlägt sich beispielsweise darin nieder, dass wir die Fähigkeit verlieren, allein mit uns selbst zu sein. Schauen Sie doch nur mal, was in einer Schlange an der Supermarktkasse passiert.Viele Leute sehen aus, als würden sie gleich eine Panikattacke bekommen, wenn sie mal fünf Minuten dastehen sollen. Alle holen sofort ihr Handy raus und tippen darauf rum. …Im Pausenhof der Schule, an der Bushaltestelle, im Rail-Jet: Es bimmelt und piepst in allen Tonlagen. Eine weitere fatale Entwicklung ist der Eindruck: Du brauchst keinen Freund. Frag dein Handy. Durch das Sprachprogramm wird es möglich, sich sogar mit seinem i-phone zu unterhalten und über bestimmte Themen zu diskutieren. Doch ein smart-phone ist eine Maschine, die kein Mitgefühl haben kann. Und wenn das Medium immer mehr zum Zielpunkt wird, dann redet man eben nicht mehr mit Hilfe des Handys mit Freunden, sondern man redet mit dem Handy selber. Oder man redet seinem Computer gut zu, weil er nicht ganz so will, wie wir es wollen...Der ständige Umgang mit Rechnern oder Smart-phones verstärkt eine Tendenz, die sich mit der Beginn der Neuzeit angebahnt hat: Dass der Mensch sich nämlich selber als Maschine versteht. Die Auffassung vom Lebewesen als Maschine ist ein Grundmuster unseres modernen Menschenbildes. Seit dem Beginn der Neuzeit hat der Mensch seine technologischen Fähigkeiten in ungeahntem Ausmaß erweitert. Von den anfänglich noch primitiven Maschinen haben wir es im Computerzeitalter zu wahren Wunderwerken an Schnelligkeit, Speicherkapazitäten, künstlicher Intelligenz und mikroskopischer Finesse gebracht. Inzwischen hat sich die Physik vom mechanistischen Weltbild verabschiedet, aber die Weise, wie wir Menschen uns selber verstehen, ist vielfach noch von diesem mechanistischen Denken geprägt. Achten wir nur einmal auf unsere Sprache. A: „Guten Morgen! Na, bist du wieder fit? Ist dein Aku wieder aufgeladen?“ M: „Du, meine Batterien waren gestern abend so leer, dass sich in meinem Kopf kein Rädchen mehr drehte.“ A: „Gehn wir gleich ins Café. Ich hatte dir gestern versprochen, dich einzuladen, damit du 5 mal ordentlich auftanken kannst.“ M: „Das hatte ich gar nicht abgespeichert. Ich dachte, wir müssen jetzt gleich zu dieser Lehrertagung.“ A: „Na, hoffentlich hast du wenigstens auf dem Schirm, dass du die Begrüßung übernimmst?“ M: „Bei dir ist ja 'ne Schraube locker. Das wolltest doch du übernehmen!“ A: „Jetzt ticke nicht gleich aus! Du machst das so, wie abgesprochen.“ M: „Bei dir ist ja ne Birne durchgebrannt. Ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Wenn ich daran denke, dass ich gleich vor ein paar hundert Leuten reden soll, da bleibt mir die Pumpe stehen.“ A: „Dreh nicht gleich durch. Vor ein paar Tagen hast du mir erzählt, dass der Arzt dich durchgecheckt hat und du gut durch den Gesundheits-TÜV gekommen bist.“ M: „Aber spontan eine Rede halten, das kannst du vielleicht. Aber ich bin anders programmiert.“ A: „Du stehst ja völlig unter Strom!“ M: „Jaaa. Ich bin geladen!“ A: „Na, bevor bei dir die Sicherungen durchbrennen, gehen wir erst mal ins Café, da kannst du noch ein bisschen abschalten.“ M: „Abschalten? Du redest mit mir, als sei ich eine Maschine...“ A: „Wie? Ich rede mit dir, als seist du eine Maschine? Du tickst ja nicht richtig!“ Jüngst machte der Biologe und Gehirnforscher Gerald Hüther darauf aufmerksam, wie sehr unsere Denkmuster von der Faszination geprägt sind, die von der großartigen Leistung von Maschinen und Computern ausgeht. Es entstehen Denkmuster in unseren Köpfen, die dazu verleiten, uns selbst als Maschinen oder computerartige Schaltapparate zu verstehen. (Hüther, Männer. Das schwache Geschlecht und sein Gehirn, Göttingen, 2009, 9). Wie aber wollen wir uns selber verstehen? Als Maschinen oder als lebendige Wesen, die eigene Zwecke verfolgen können? Rede ich in Begriffen, in denen ich mich als freies Wesen verstehe oder als manipulierbare Maschine? Sage ich: „Das habe ich nicht abgespeichert“ – oder „Das habe ich vergessen“? Sage ich: „Ich bin nicht motiviert.“ - oder „Ich will nicht.“ 6 Als vor einigen Jahren der österreichische Rechnungshof beanstandete, dass in den Ministerien zu viel Kaffee getrunken werde, da antwortete die Regierung im Parlament, die moderne Managementforschung habe erwiesen, dass der Entzug solcher Vergünstigungen zur Demotivation der Beamten führe. Die Argumentation, die hier benutzt wird, bedient sich der Sprache der Manipulation. Ein anderes Beispiel: Sage ich: Meine Hormone spielen verrückt – oder sage ich: Ich liebe dich. Das ist doch ein kleiner Unterschied. Natürlich steht es jedem frei, sich als eine manipulierte Maschine zu verstehen. Ich frage mich dann allerdings, ob ich mit jemandem, der zu mir sagt: Meine Hormone treiben mich zu dir hin, ob ich mit einem solchen Menschen befreundet sein möchte. Maschinen, Computer, Smartphones: Das Machwerk von Menschenhand wird zum Spiegel und Gleichnis unseres Selbstverständnisses. Je mehr wir die mechanischen und elektronischen Fähigkeiten erweitern, umso mehr kommen wir auf die Idee, uns selber anhand mechanischer und elektronischer Mechanismen zu verstehen. Und dies bedeutet: Wir deuten uns von unseren Funktionen her. Das ist der Mechaniker, die Bürokraft, der Administrator. Wir werden dadurch anonymer. Ohne Namen und Gesicht. Und wir werden austauschbar: Jemand anderes kann die Funktionen ausüben, die ich innehatte. Auf mich als Person kommt es ja nicht an. Computer und Internet stellen mächtige Vehikel für Anonymität dar. „Nirgendwo gibt es mehr Avatare, Aliase, Deckadressen, falsche Identitäten und andere vorgetäuschte Knoten als im sozialen Netz.“ (110) Studien zeigen, dass diejenigen, die direkte menschliche Kontakte pflegen, sozial wesentlich besser integriert sind als Menschen, die ihre Beziehungen über facebook oder ähnliche soziale Netzwerke pflegen. Weiterhin wurde deutlich, dass die virtuellen Kontakte mehrheitlich negative Gefühle vermitteln. Wer viele Kontakte in facebook pflegt, ist in der sozialen Realität weniger engagiert. Die für Sozialverhalten verantwortlichen Hirnareale entwickeln sich weniger, wenn man primär digitale Kontakte sucht. (Spitzer, 127) Hören wir noch einmal den Hirnforscher Manfred Spitzer: „Ein Lächeln, gute Gespräche, eine gemeinsame Mahlzeit, eine kleine Aktivität 7 zusammen – das ist der Stoff, der uns ein erfülltes Leben beschert. Ein Abendessen mit drei Freunden macht viel glücklicher und bewirkt viel mehr als dreihundert virtuelle Kontakte in Facebook.“ (Spitzer, 325) Wenn dem so ist: Warum sind so viele fasziniert von den digitalen sozialen Netzwerken? Worin besteht ihre große Verlockung? Ich denke: Es ist der Wunsch nach einem sozialen Ort. Also: Jemand zu sein. Gekannt, anerkannt und geschätzt zu sein. In altertümlicher Sprache gesagt: Ich will ein Gesicht haben. Oder vielleicht ist es ja gar nicht so altertümlich. Denn wenn die größte soziale Plattform des Internets sich „Facebook“ nennt, dann macht es genau auf dieses Urbedürfnis des Menschen aufmerksam: Ich will irgendwo verzeichnet sein, wo ich ein Gesicht habe und anderen mein Gesicht zeigen kann. Denn wonach wir uns wirklich sehnen, ist eben nicht nur das Medium. Wir brauchen das Gegenüber, das lebendige Gesicht. Schauen wir in einem zweiten Schritt in die Bibel: Vielleicht lässt sich der rote Faden der Bibel mit dem Namen „Facebook“ charakterisieren. C.S. Lewis’ Roman „Du selbst bist die Antwort“ trägt den Originaltitel: „Till we have faces. A Myth Retold – Bis wir alle ein Gesicht haben. Die Neuerzählung eines Mythos.“ Darin beschreibt Lewis anhand eines griechischen Mythos, dass Gott sehnsüchtig darauf wartet, dass wir ihm endlich ein Gesicht zeigen. In der Bibel erweist Gott sich als einer, der Beziehung will. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel wird im Bild des Paradieses die ursprüngliche, das heißt die ideale Beziehung zwischen Gott und Mensch beschrieben. Gott und Mensch leben in gegenseitiger Vertrautheit. Diese Vertrauensbeziehung zeigt sich darin, dass Gott abends im Paradies spazieren geht. Es gibt eine selbstverständliche, familiäre Nähe zwischen Gott und den Menschen. Man kennt sich sozusagen von „Angesicht zu Angesicht“. Doch dann schleicht sich Misstrauen ein. Der Mensch traut Gott nicht mehr ganz über den Weg. Ein solches negatives Denken ist das heimliche Schlangengift, das letztlich jede Beziehung zerstört: „Meint Gott es wirklich gut mit mir?“ „Meint es die oder der andere wirklich ehrlich mit mir?“ Die suggestive Frage der Schlange im Paradies zielt genau auf dieses Misstrauen: „Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?“ (Gen 3,1) Nein, das hat er nicht! Der biblische Gott hat dem Menschen vielmehr alle 8 Früchte erlaubt – mit einer Einschränkung, die der Begrenztheit des Menschen entspricht. Wenn Eltern ihrem Kind verbieten müssen, Omas Tabletten zu lutschen, kann das bei dem Kind so ankommen, als ob die Eltern ihm etwas nicht gönnen. Ähnlich kann der Mensch die ihm gesetzten Grenzen dahingehend interpretieren, dass Gott ihm Liebe vorenthält. Adams und Evas nagender Zweifel, ob Gott sie wirklich liebt oder ihnen missgünstig etwas vorenthält, zerstört das Grundvertrauen. Von nun an trauen sich die Menschen auch gegenseitig nicht mehr. Adam versteckt sich vor Eva und umgekehrt. Der Mensch hat die Unbekümmertheit paradiesischer Nacktheit verloren und es beginnt das Versteckspiel mit Feigenblättern, Masken und Schminke, um die nackte Wahrheit zu verstecken. Er bekleidet sich wieder mit Tierfellen und kann doch nicht mehr zur Unschuld des Tieres zurück. Er hat Angst, sich eine Blöße zu geben und dem anderen in die Augen zu schauen. Der Mensch hat sein Gesicht verloren und kann sich nicht mehr sehen lassen. Er schämt sich für sein Tun und bedeckt seine Scham. Der Mensch will sich nach seinem Gesichtsverlust vor lauter Katzenjammer am liebsten in ein Mauseloch verkriechen. Gott aber sucht ihn: „Adam, Mensch, wo bist du?“ So lautet die erste Frage, die Gott in der Bibel an den Menschen richtet. Adam und Eva haben Angst, sich blicken zu lassen. Sie schämen sich vor sich selbst, voreinander und vor Gott. Gott aber lässt sie nicht links liegen, sondern sucht sie. Er bittet, fordert auf und wirbt - damals wie heute: „Kehr mir nicht deinen Rücken zu, sondern wende dich mir zu.“ Wir laden Sie nun zu einer kleinen Körperübung ein: Wir stehen alle auf. Abgesehen von den Personen in der 1. Reihe schauen nun alle auf den Rücken eines anderen. Vielleicht kenne ich diese Person vor mir. Vielleicht auch nicht. Wie ist das, wenn man jemanden von hinten sieht? Zeigt diese Person mir die kalte Schulter? Wenn ich das Gesicht nicht sehe, kann ich auch nicht darin lesen. Vielleicht hat der oder die vor mir die Augen geschlossen und träumt. Oder lächelt. Oder macht einen grimmigen Gesichtsausdruck. Ich habe keine Ahnung, was der oder die da vor mir jetzt denkt und fühlt. Und für die, die vorne stehen – jetzt mal alle die Augen schließen: Wie ist das, wenn jemand hinter einem steht. Wenn es jemand ist, der mich sympathisch findet, dann ist es ein gutes Gefühl: Da steht jemand hinter mir. Der oder die hält zu mir und hält mir den Rücken frei. 9 Wie aber, wenn es eine Person wäre, die mir nicht wohl gesonnen ist. Die mich belächelt, die mir in den Rücken fallen kann? Die mich spöttisch anschaut und ich sehe das nicht? Wir wenden uns jetzt um: Reihe 1 zu 2; Reihe 3 zu 4 usw. Jetzt sehen wir, wen wir vor uns haben. … Wir schließen die Augen, um zu überlegen: Wir war das jetzt? Habe ich gelächelt? Die Augenbrauen gehoben? Was habe ich im Gesicht des Gegenüber wahrgenommen. Wir öffnen wieder die Augen und hören ein Gedicht: annäherung an die Wirklichkeit nicht durchblicken sondern anblicken nicht im griff haben vielmehr ergriffen sein nicht bloß verstehen auch zu dir stehen nicht durchschauen einfach nur anschauen so werden wir wirklich wir (aus: Andreas Knapp, Gedichte auf Leben und Tod) 10 Wie ein roter Faden zieht sich - von Adam und Eva angefangen angefangen – durch die Bibel, dass Gott nach dem Gesicht des Menschen sucht. Man könnte diese Suchte als die Geschichte einer Gesichts-Werdung lesen und es ist lohnenswert, die ganze Bibel unter der Perspektive zu betrachten, wie der Mensch nach und nach ein Gesicht bekommt. Dabei ist wichtig, dass Gott sich nicht gewaltsam aufdrängt. Daher soll sich umgekehrt auch der Mensch auf die Suche nach dem Antlitz Gottes machen. Immer wieder findet sich die Einladung Gottes: „Sucht mein Angesicht!“ Nur wenn beide - Gott und Mensch - Interesse aneinander haben, nur wenn beide sich sehen wollen, kann es wirklich zu einem face to face kommen. Auf Augenhöhe. Eine solche Beziehung zwischen Gott und Mensch nennt die Bibel einen „Bund“. Im Bild des Ehebundes (z.B. Hos 2,18-25) kommt diese Dimension besonders klar zum Ausdruck. Israel steht mit seinem Gott auf Du und Du. Im Vergleich der verschiedenen Religionen zeigt sich, dass die Gotteserfahrung Israels einmalig ist. Abraham, Isaak und Mose erleben Gott als ein befreiendes Gegenüber, das sich ihnen zuwendet und sie anspricht. Israel hat seinen Gott also weder als gesichtslose Fruchtbarkeit noch als anonymes, d.h. namenloses kosmisches Gesetz erlebt. Gott ist kein anderes Wort für einen unpersönlichen Sachzwang, sondern er zeigt sich mit Namen. Er ist eine Macht, die dem Menschen in Freiheit und Wohlwollen zugewandt ist. So erahnen die Israeliten Gott als ein Du, das zur Freundschaft einlädt. Bund bedeute eine freie Vereinbarung zwischen zwei Partnern. Es geht um einen Freundschaftsbund zwischen Gott und seinem Volk. Gott wirbt um die innere Zustimmung zu diesem Bund. Es geht also nicht mehr um einen äußeren Betrieb, um Kult oder Gefolgschaft. Sondern Gott wirbt um das Innere des Menschen, um sein Herz. Es gehört zu den Sternstunden der Menschheit, dass die Propheten der Bibel einen Gott verkünden, der nicht mehr primär auf äußere Riten und Religiosität, sondern auf das Innere des Menschen schaut. Religion wird immer mehr zu einer Herzensangelegenheit. Das lateinische Wort für „glauben“ heißt ‚credere’. Es leitet sich ab von ‚cor dare’, das Herz schenken. Eine innere Glaubenshaltung aber kann von außen weder nachgeprüft noch erzwungen werden. Weil Gott eine innerliche Beziehung will, wird alle äußerlich erzwungene Gefolgschaft sinnlos. Hier findet eine großartige Revolution des Gottesbildes 11 statt. Es bahnt sich eine geistesgeschichtliche Revolution an, die auch das Menschenbild völlig verändert. Der Mensch beginnt, sich selber immer mehr als verantwortliches Individuum zu verstehen. Über lange Jahrhunderttausende erlebte sich der Mensch nicht als individuell und daher auch nicht als „persönlich“ verantwortlich. Er ist eingebettet in den Kosmos und seine ewigen Gesetzlichkeiten - in den Rhythmus von Morgen und Abend, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Die ursprünglichen menschlichen Gesellschaften funktionieren und denken in den Kategorien von Sippe oder Stamm. Im Bewusstsein gibt es nur das GruppenWir. Ein sprechendes Zeugnis dafür sind urtümliche Sprachen, in denen Ich und Du nicht unterschieden wird. In der Ketschua-Sprache etwa ist das Basispronomen das „wir“. Die Pronomina „Ich“ oder „Du“ sind Ableitungen aus dem „Wir“. Ich habe ein paar Jahre in einem Indio-Dorf in Bolivien gelebt. Dort wurde etwa vor den Parlamentswahlen gemeinsam beraten und dann hat die gesamte Dorfgemeinschaft sich für eine Partei entschieden und diese dann auch geschlossen gewählt. Das Wir-Bewusstsein, die Sippe ist dominant. Das Individuum ist nur eine untergeordnete Größe. Das Individuum taucht in der Geschichte der Menschheit erst relativ spät auf. Zum einen wird die persönliche Verantwortung in den Hochformen der Ethik in Griechenland, Persien, Indien und China ca. 500 v. Chr. formuliert. Zum anderen predigen zeitgleich die Propheten der hebräischen Bibel einen Gott, der auf das Herz schaut, d.h. auf die persönliche Intention des Einzelnen. Es ist immer weniger das Volk, sondern die einzelne Person, die erfährt: „Ich stehe vor meinem Gott.“ Am Du Gottes wird der Mensch immer mehr zum Ich. Der Mensch löst sich heraus aus einem kosmischen Bewusstsein und aus dem Wir des Clans. Das alte Stammes-Sprichwort „Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf“ wird kritisiert und außer Kraft gesetzt. (Ez 18, 2-3) Die „Sippenhaft“ wird abgelöst durch die individuelle Verantwortung: „Ein Sohn soll nicht die Schuld seines Vaters tragen und ein Vater nicht die Schuld seines Sohnes.“ (so bei Ez 18, 20) Jetzt zählt einzig und allein die Entschiedenheit des persönlichen Gewissens. Vor Gott erfährt sich der Mensch als zur Antwort berufen und zur Entscheidung befähigt. Schon in der Paradieses-Erzählung hält Gott Adam sein Tun vor Augen (= kon-frontieren), 12 Frons heißt ja: Stirn. Gott bietet dem Menschen die Stirn, schaut ihm ins Gesicht, will eine Antwort und ruft den Menschen so zur Ver-Antwortung. Der ethische Anspruch wird als An-Spruch Gottes erfahren. Gott ist das Gegenüber, das dem Menschen ins Gewissen redet und in die Freiheit der Verantwortung ruft. Unser moderner Begriff der Verantwortung hat hier seinen Ursprung. Ver-antworten stammt aus der Vorstellung, dass der Mensch Gott im Gericht antworten muss. Der zuerst in Ägypten formulierte religiöse Gerichtsgedanke führt dazu, dass sich im Lauf der Geschichte das Konzept der menschlichen Verantwortung entwickelt. Der Mensch versteht sich nicht mehr als ohnmächtiges Moment am großen Weltgeschehen. Er ist persönlich gefragt und hat für seine Überzeugungen und Taten einzustehen. Das jüdisch-christliche Gottesbild sieht im Menschen das Wesen, das auf das Wort Gottes eine Antwort geben kann. Wir können die Liebe Gottes annehmen und sie bejahen. Wir können Liebe aber auch ablehnen. In dieser Fähigkeit zur Liebe liegt für uns das zentrale Kennzeichen unseres jüdischchristlichen Menschenbildes. Wir sind geschaffen aus Liebe – und wir sind befähigt, eine Antwort der Liebe zu geben. Der Dialog, An-spruch und Ant-wort, machen uns zu Menschen. Johann Wolfgang von Goethe hat ein Märchen geschrieben, in dem folgender Dialog stattfindet: „Was ist herrlicher als Gold?“ fragte der König. „Das Licht“, antwortete die Schlange. „Was ist erquicklicher als das Licht?“ fragte jener. „Das Gespräch“, antwortete diese. Im Anfang ist das Ohr. Das erste Sinnesorgan, das sich beim menschlichen Embryo ausbildet, ist das Gehör. Lange bevor wir das Licht der Welt erblicken, nehmen wir hörend Kontakt auf: mit dem Herzschlag der Mutter, mit ihrer Stimme, mit den Geräuschen der Welt. Von Anfang an leben wir von dem, was uns zugesagt wird: Dass wir willkommen sind, erwartet, geliebt. Wenn Menschen gute Worte versagt werden, wird ihre Entfaltung gehemmt. Sie fühlen sich als Ver-sager und sind verletzt. 13 Wir Menschen sind auf den Dialog angewiesen. Der Embryo, der die Stimme der Mutter hört, beginnt sich zu regen. Die Bibel erzählt, dass sich Johannes der Täufer schon im Bauch seiner Mutter freudig bewegt hat, als diese den Gruß Marias hörte. Das Wort ruft nach Antwort: Wer etwas gehört und in sich aufgenommen hat, kann den Wunsch verspüren, dies zu erwidern. Er will sich äußern und sehnt sich nach einem Menschen, der ihn versteht, nach einem Gesprächspartner. Man könnte auch sagen: Im Anfang war das Wort. Wir Menschen werden dadurch zu Menschen, dass wir im Haus der Sprache wohnen. Wir können kommunizieren und brauchen den Dialog. Wenn Kinder nicht angesprochen werden, dann verkümmern sie. Ihnen ist die Geschichte von Friedrich II. bekannt, der wissen wollte, ob Menschen eine Ursprache angeboren ist. Bei seinem bekannten Experiment wollte Friedrich II. also feststellen, welche Sprache Kinder entwickeln, wenn sie ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen. Über den genauen Hergang des Experiments ist wenig bekannt. Nach dem Zeugnis des Salimbene von Parma hat Friedrich zum Zwecke dieser Suche mehrere Säuglinge von der Außenwelt isoliert und ihren Ammen befohlen, die Kinder zwar zu säugen und sauberzuhalten, aber weder mit ihnen zu sprechen noch sie zu liebkosen, oder ihnen sonstige Zuwendung zuteil werden zu lassen. Auf diese Weise habe er – so Salimbene – herausfinden wollen, in welcher Sprache Kinder ihre ersten Worte von sich geben. Das Ergebnis war allerdings niederschmetternd: Alle Kinder starben, wohl aufgrund fehlender sensorischer Stimulation. Friedrich II. schrieb dann: „Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen, und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen.“ Das zentrale menschliche Bedürfnis nach Kommunikation und Kommunion hat auch eine transzendente Dimension. Denn es bleibt bei aller digitalen Vernetzung immer noch das Bedürfnis nach einem Netz, das uns auffängt, wenn alle Stricke reißen. Es bleibt die Sehnsucht danach, wirklich in der Tiefe meines Herzens gekannt und verstanden zu werden, und zwar auch dann noch, wenn menschliche Worte versagen. Der christliche Glaube interpretiert den Hunger nach echter Kommunikation als Hinweis darauf, dass Gott diese Sehnsucht nach Verstehen und Verstandenwerden, nach Wort und Antwort stillen kann. Wir Menschen leben vom Wort und religiös gesprochen: Wir leben vom Segenswort. 14 Segnen, bene dicere heißt ja: etwas gut sagen, gut nennen. Sagen, dass es gut ist. Wir leben davon, dass wir angenommen sind. Dass jemand sagt: Es ist gut, dass du da bist. Das ist auch das Schöpfungswort: Gott ruft Welt und Mensch ins Dasein und er sieht, dass es gut ist. Und er sagt, dass es gut ist durch seinen Segen. Das christliche Menschenbild besagt: Du bist Ebenbild Gottes, Tochter oder Sohn Gottes, von ihm gekannt und geliebt. Dein Name ist in Gottes Hand geschrieben. Du bist nicht vergessen. Und du hast einen unendlichen Wert, unabhängig von deiner Leistung. Wenn in deinem Leben manches schief geht, wenn du nicht nützlich bist im Sinne von berechenbarer Wirtschaftlichkeit: Du hast einen unendlichen Mehrwert. Für Gott bist du ein VIP, eine very important person. Unsere Namen stehen im Faithbook Gottes. Gott spricht mich an: „Zeig’ dich mir. Und zeige dich deinem Mitmenschen als Schwester, als Bruder. Erweise dich als Mitmensch.“ Was bedeutet dies für unseren konkreten Umgang miteinander, für unsere Gesprächskultur, für die Schulkultur? Eine christlich geprägte Schule wird sich besonders um die Qualität der Kommunikation mühen. Die Einladung, „Gottes Facebook zu sein“ könnte vor dem Hintergrund der einleitenden Überlegungen bedeuten: Ich zeige mein Gesicht. Ich zeige, wer ich bin und teile mit anderen, was mir wichtig ist. Ich gebe mich zu erkennen als ein Mensch, der im Glauben eine Quelle von Freude, Frieden und Freiheit erfährt, der aber auch Zweifel, Angst und Trauer kennt. Es könnte desweiteren bedeuten: Ich habe ein echtes Interesse, anderen face to face zu begegnen und mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Gottes Facebook sein würde schließlich bedeuten, auf die tiefe Sehnsucht meines Gegenübers nach Anerkennung und Wertschätzung zu antworten. Liebe ist nie etwas abstraktes, sondern immer mit konkreten Namen und Gesichtern verbunden. „Deus vult condiligentes“ - Gott will Mitliebende, formuliert Duns Scotus. Jede und jeder kann der göttlichen Zusage ein Gesicht verleihen: „Du kannst dich sehen lassen. Du bist jemand. Und du kannst der Welt etwas einmaliges und kostbares geben.“ Ein Gedicht von Hilde Domin: 15 Es gibt dich Dein Ort ist wo Augen dich ansehn. Wo sich die Augen treffen entstehst du. (...) Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehn und sagen, dass es dich gibt. (Andreas:) Ich habe ehrenamtlich einige Jahre als Schulseelsorger in Leipzig gearbeitet. Konkret bemühte ich mich, jede Woche ein paar Stunden einfach da zu sein, in meinem Sprechzimmer, um Zeit zu haben. Und wenn Schüler merken, dass da jemand ist, der Zeit hat, der versucht, nicht zu urteilen, sondern einfach Raum gibt, dann kommen sie ins Reden. Von Dingen, über die sie sonst vielleicht nie reden würden. Es kamen Jugendliche, die mir ihre Arme zeigten, voller Narben vom Ritzen, von Selbstverletzung. Dahinter steht oft ein Mangel an Liebe und Aufmerksamkeit. Man schickt 100 SMS pro Tag los. Aber diese elektronisch vermittelte Kurz-Kommunikation bleibt zwangsläufig an der Oberfläche. Ihr Medium ist ein flacher Bildschirm. Sie ist trotz bunter Touchscreens technisch kühl. Eine Schülerin erzählte mir, dass sie eigentlich nur mir ihrer Ratte reden kann, weil die Mutter nie richtig Zeit hat. Der österreichische Dichter Karl Kraus bringt es auf den Punkt: „Hab' ich dein Ohr nur, find' ich schon mein Wort.“ Und wir kennen alle diese Erfahrung: Die Aufmerksamkeit meines Gegenüber wird zum Geburtshelfer meiner Sprache. Wer erfährt, dass jemand ihm 16 oder ihr gut zuhört, dem kommen die Worte leichter über die Lippen. Ja, manchmal merken wir in einem Gespräch sogar, dass der andere mit mir zusammen nach Worten sucht und ringt. Dann sind wir gemeinsam unterwegs zur Sprache und das richtige Wort stellt sich zwischen uns ein. Unser Menschenbild lässt uns daher die Frage nach den Räumen und der Qualität unserer Kommunikation stellen. Wie steht es um unsere Kommunikation in der Schule? Zwischen Leitung und Kollegium, innerhalb des Kollegiums; wie gestaltet sich der Lehrer-ElternDialog? Und vor allem: Wie reden wir mit den Schülerinnen und Schülern in Fragen, die über den Lernstoff und den Funktionale des Schulbetriebs hinausgehen? Das ist eine große Herausforderung an unsere Schulen: Dass wir Zeiten und Räume finden, in denen wir über uns selbst ins Gespräch kommen können. Dazu braucht es Freiräume, in denen keine Leistung abgefragt werden und in denen man unzensiert reden kann. Sie alle kennen solche Momente, in denen Schülerinnen und Schüler auf einen zugehen und etwas Persönliches mitteilen wollen. Vielleicht beginnen sie damit, dass sie ein schlechtes Abschneiden einer Klassenarbeit damit rechtfertigen, dass sie daheim Probleme haben. Das könnte ein Signal sein, ein Klopfzeichen an unserer Tür, um in ein persönliches Gespräch zu kommen. Und ist diese Fähigkeit zum Dialog nicht eine der höchsten Qualitäten des Menschseins? Ein tolles Kompliment wäre doch: mit dem kann man reden! Mit der kann man reden! Im Zentrum des christlichen Glaubens steht ein Gott, mit dem man reden kann. Gott ist Wort. Und dieses Wort ist Fleisch geworden und hat mitten unter uns gewohnt. Gott macht sich in Jesus Christus kommunikabel. Das Medium, durch das sich Gott mitteilt, hat ein menschliches Gesicht: Jesus von Nazaret. Vielleicht ist auch das ein Hinweis, was in unserer medialen Kultur fehlt. Wir haben viele Medien der Kommunikation. Telefon, Handy, Skype, SMS, Facebook. So schnell und leicht bedienbar diese Medien sind, aber sie sind eben medial, mittelbar – und das heißt nicht unmittelbar. Nicht direkt. Immer steht noch etwas dazwischen. Immer ist noch etwas zwischen dir und mir. Ein virtueller Kontakt bleibt defizitär. Eine tiefere Kommunikation ist erst dort möglich, wo man nicht auf einen Bildschirm starrt, sondern in lebendige Augen schaut. Wir kommunizieren nicht nur über Worte, sondern auch über unseren Körper und dessen Ausstrahlung. 17 Gott wählte als Kommunikationsmittel zu uns Menschen kein abstraktes Medium, sondern er ist Fleisch geworden. In Jesus von Nazaret geht Gott leibhaftig auf Menschen zu, unmittelbar, direkt. Und es entspricht unserem Glauben, dass wir in unseren menschlichen Begegnungen Christus selber begegnen. Im Zwischenmenschlichen berühren wir auch das göttliche Geheimnis. Und das ist ja auch die große Chance in einer Schule: Dass wir nicht vor einem Computer sitzen, sondern dass wir Gesichter vor uns haben. Wir selber sind das beste Medium. Was jemand mit persönlicher Überzeugung vermittelt, ehrlich und authentisch, das hinterlässt einen tieferen Eindruck als ein noch so gut geschriebener Artikel in Wikipedia. In Begegnungen von face to face wird mehr vermittelt als bloße Information. Ich setze mich selber aus mit dem was ich sage. Ich gebe mich ein Stück auch preis, mache mich kritisierbar, verletzbar. Aber zugleich liegt darin die Chance, dass durch eine solche Begegnung eine größere Tiefe ins Spiel kommt. Für eine Freundschaft, für Liebe genügt es nicht, sich nur virtuell zu begegnen. Wir suchen die andere Person, hautnah, berührbar, ganzheitlich. Unsere Hoffnung auf Vollendung in Gott wird genau in diesen Bildern zum Ausdruck gebracht: Wir werden Gott schauen von Angesicht zu Angesicht, face to face. In der Kaffeepause haben wir nun die Gelegenheit zu Begegnungen von Angesicht zu Angesicht. Der Kaffee hier wird nicht in manipulativer Absicht angeboten. Denn wir sind keine Maschinen, die betankt oder aufgeladen werden müssten, sondern freie Menschen, die sich über eine Einladung freuen können! Ich gebe Ihnen noch ein Gedicht mit in die Kaffeepause: Frühstücksgedanken wie eine Mauer die Zeitung hinter der du dich verbirgst hauchdünn das Papier und doch ganz undurchdringlich 18 ich aber würde gern in einen Augen lesen was in deiner Welt geschieht von Krieg und Frieden in deiner Seele den Wetterbericht von deinen Hochs und Tiefs und schließlich würde ich so gern das Rätsel lösen das sich in deinen Stirnfalten versteckt (aus: Andreas Knapp, Gedichte auf Leben und Tod) 19 II. Das Gesicht Gottes 1. Archaische Gottesbilder Wir wollen uns in einem nächsten Schritt der Frage nach den Gottesbildern zuwenden. Zunächst kleines Album mit Gottesbildern. Ein Art „Facebook“ des lieben Gottes. Die Darstellungen stammen von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Erwachsenen, die spontan auf ein winziges Dia mit Glasrähmen, das mit schwarzer Plakafarbe eingefärbt war, mit Hilfe einer Nadel ihr Gottesbild einritzten. Obwohl diese Miniaturen technisch gar nicht so einfach sind, haben es einige zu richtigen Kunstwerken gebracht. Ein Blick in die Religionsgeschichte zeigt, dass es tausende von Gottesbildern gibt. In diesen spiegeln sich grundlegende menschliche Erfahrungen: Die Sorge um die Nahrung. Das Wunder der Fruchtbarkeit. Die Angst vor den Naturgewalten. Die sozialen Verhältnisse. Ein paar Beispiele. 1.Venus von Willendorf (und zwar das Willendorf in der Wachau) Zu den ältesten Zeugnissen der Kultur zählen Frauendarstellungen. Die Frau erscheint archetypisch, als Symbol der Geborgenheit, der Fruchtbarkeit, als Große Mutter. Sie wird dargestellt mit fülligem Leib und ausgeprägten Brüsten. Die große Mutter umsorgt den Menschen im Leben – und beim Tod des Menschen öffnet sich der Schoß der Erde und nimmt den Toten auf. Weil die große Mutter das Leben nicht nur gibt, sondern auch wieder nimmt, wird sie als wankelmütig und grausam dargestellt. Im Mythos verlässt sie ihren Mann, der in die Unterwelt hinabsinkt. Dann geht die Mutter ebenfalls in die Unterwelt, um ihn wieder zu suchen. In dieser Zeit herrscht Dürre oder Winter. Der Zyklus der Natur wird also im Mythos gedeutet. Vielerorts wurden Sexualpraktiken und Menschenopfer eingeführt, die zur Wiederbelebung der Natur dienen sollen. 2. Der Regengott Baal – der Geliebte der Großen Mutter Baal ist ein jugendlicher Sturm- und Gewittergott. In der Rechten schwingt er die Donnerkeule, in der Linken hält er den Lebensbaum, der die Form eines Blitzes hat. Auf dem Kopf erscheinen zwei Hörner als Zeichen der Kraft. Baal ist das männliche Symbol der Fruchtbarkeit. Im babylonischen Mythos stirbt der Regengott im Herbst und wird dann von der großen Mutter aus der Unterwelt wieder zurückgeholt. Zu Beginn des Frühlings wurden 20 Kinder geopfert, um den Gott zu beleben und aus der Totenstarre zu befreien. 3. Apis, der Stier, als Zeichen göttlicher Fruchtbarkeit Das Göttliche ist für die Ägypter vor allem in der Macht, in der Kraft erfahrbar, dargestellt im Stier. Dieser symbolisiert die Fruchtbarkeit, die Geschlechtslust und die Zeugungskraft als göttliche Lebenskraft. 4. Kronos und Rheia, Eltern von Göttern und Menschen Nach dem olympischen Schöpfungsmythos tauchte Gaia, die Erdmutter aus dem ursprünglichen Chaos auf und gebar aus eigener Kraft, ohne Partner, ihren männlichen Gemahl Uranos. Dieser befruchtete dann durch Regen die Erdmutter und so entstanden die Pflanzen und die Titanen. Der jüngste von ihnen, Kronos, entthront seinen Vater und vermählt sich mit Rheia. Die Kinder aber verschlingt er sofort wieder. Bei der Geburt des Zeus wird Kronos getäuscht, den Rheia hält ihm, statt des Kindes, einen Stein hin, der in Windeln gewickelt ist. Als Zeus erwachsen ist, entthront er seinen Vater. Hier werden die ursprünglichen chaotischen Mächte dann in einer Art von Götterfamilie geordnet. Bei den griechisch-römischen Göttermythen finden wir das Menschliche und Allzu-Menschliche an den Himmel gespiegelt: Es gibt die Eifersucht, die erotische Hingerissenheit, den Neid, aber auch Güte und Treue. Und schließlich finden sich die familiären und politischen Strukturen der Menschheitsfamilie in der Götterfamilie wieder. Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um zu zeigen: In den Gottesbildern spiegeln sich grundlegende menschliche Bedürfnisse, Emotionen und Erfahrungen. Besonders auffällig ist die Ambivalenz der Götter. Sie sind launisch, weil sie ja die launischen Naturgewalten abbilden. Sie sind gewalttätig, so wie eben auch unter Menschen Mord und Totschlag herrschen. Das Gute und das Böse, das Menschen erleben, findet sich in dualistisch geprägten Religionen wieder, als Prinzip des Lichtes und der Finsternis. Viele Jahrtausende hat man die Götter als Despoten gefürchtet. Als exakte Spiegelbild einer ambivalent erfahrenen Natur werden die Götter in den Mythen auch geschildert: Sie sind unberechenbar und tyrannisch. Die Götterbilder der Menschheit tragen archetypische Züge. Und auch im Gottesbild der Bibel finden sich diese Archetypen. Auch der biblische Gott hat bisweilen ambivalente 21 Züge. Doch der Schlüssel für das biblische Gottesbild liegt nicht in der Erfahrung eines ewigen Gesetzes, etwa im Zyklus der Natur, noch in einer launischen Geschichte, die den Menschen zum ohnmächtigen Spielball der Götter macht. 2. Der Gott des Exodus So stellen wir uns die Frage: Welches Gesicht zeigt uns der Gott der Bibel? Die zentrale Erfahrung des Volkes Israel, an die immer wieder erinnert wird, ist der Auszug aus Ägypten, der Exodus. Die Befreiung aus Ketten und Gefängnis wird zur Schlüssel-Erfahrung für das Volk Israel. Israel deutet die Freiheit als Geschenk Gottes. Diese Einsicht markiert einen entscheidenden Durchbruch im Gottesbild. Und so wurde es erzählt: Eine Gruppe von Hebräern war im Ägypten vom Pharao zur Fronarbeit gezwungen worden. Die Ägypter machten den Israeliten „das Leben schwer durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle möglichen Arbeiten auf den Feldern. “ (Ex 1,14) Ein Mitglied des Stammes namens Mose wird freilich am Hof des Pharaos erzogen. Eines unschönen Tages muss Mose wegen eines Verbrechens fliehen. In der Wüste macht er eine wichtige Erfahrung mit dem Gott seines Volksstammes. Vor der seltsamen Naturerscheinung eines brennenden Dornbusches zieht es Mose die Schuhe aus. Es geht ihm auf, dass der Gott, den seine Vorfahren verehrt hatten, treu ist: Gottes Liebe brennt, aber verbrennt nicht. Der Name dieses Gottes ist „Jahwe“ und wird gedeutet als: „Ich bin der ‚Ich-bin-da’.“ (Ex 3,14) Gott zeigt Mose nicht sein Gesicht, aber seine Haltung: „Ich bin treu. Dein Schicksal ist mir nicht gleichgültig. Ich gehe mir dir.“ Im Vertrauen auf diesen Gott gelingt unter der Führung des Mose schließlich ein Massenausbruch aus dem „Sklavenhaus Ägypten“. Während der Flucht kommt den Hebräern ein Naturereignis unverhofft zu Hilfe: Ein starker Ostwind erzeugt am Schilfmeer einen Ebbe-Flut-Effekt. (vgl. Ex 14,21) Dem Flüchtlingsstrom gelingt im richtigen Augenblick der Durchzug durch das Rote Meer. Die zurückkehrende Flut verhindert die Verfolgung durch die Ägypter. Mose schreibt das unerwartete Gelingen der Flucht weder dem eigenen Geschick noch einem blinden Zufall, sondern der Hand Jahwes zu. Der geglückte Auszug wird als göttliche Tat verstanden und gefeiert. 22 Diese Befreiung aus Ketten und Kerker wird zur Schlüsselerfahrung für das biblische Gottesbild. Zu Gott zu gehören ist anders als dem Pharao zu gehören. Gott braucht den Menschen nicht, um sich groß zu machen oder sich am Leben zu erhalten. Jahwe zeigt sich vielmehr als freilassende Liebe. Er ist jene Macht, die Halt gibt, ohne festzuhalten. Die Sicherheit schenkt, ohne zu versklaven. Es ist wie ein Erkennungsmerkmal: Wo Freiheit wächst, da wirkt Gott. Umgekehrt wird alles, was unfrei macht, als Götze entlarvt. Jahwe fordert dazu heraus, die Götzen zu verlassen, aus trügerischen Sicherheiten auszusteigen und ihm zu vertrauen. Denn nur so kann Israel ins gelobte Land von Freiheit und Gottverbundenheit finden. Im religiösen Weltbild der Hebräer wird die Freiheit als Geschenk Gottes gedeutet. Gott will einen freien Menschen. Immer mehr wird dieser Gott als ein jemand erfahren, der jeden einzelnen mit Namen anspricht und ihn damit in die Freiheit der Ver-Antwortung ruft. Gott will den Menschen freien, indem er ihn wie ein Liebender vor die Alternative stellt: Willst du mich – oder willst du mich nicht? Diese Erfahrung eines Gegenüber, das Freiheit und Liebe schenkt, lässt die Hebräer Gott als ein Du erahnen. Welches Gesicht zeigt Gott dem Menschen? In der ansprechenden Erfahrung der Befreiung wird Gott als jemand erlebt, der anspricht, anruft und zu einem Bund der Freundschaft einlädt. Gott ist keine gesichtslose Fruchtbarkeit, kein kosmisches Gesetz, sondern ein zugewandtes Antlitz. Dieses Du ist ansprechbar und dem Menschen gegenüber zugleich anspruchsvoll. Die befreiende Erfahrung der Fluchtwelle durch das Rote Meer ist eine Initialzündung für einen langen Weg wachsender, innerer Freiheit. Wer längere Zeit in einer Abhängigkeit gelebt hat, braucht zunächst einmal Abstinenz. Er muss die alten Strukturen und Mechanismen hinter sich lassen, das soziale Umfeld verändern. Er ist auch herausgefordert, einen anderen Lebensstil zu lernen, der ihm neue Freiheit und Verantwortung ermöglicht. Das Volk Israel muss durch eine vierzigjährige Wüste ziehen, die als Ent-ziehungs-Kur von vielfältigen Abhängigkeiten zu verstehen ist. Die Wüste ist eine Schule der Freiheit, weil sie keine sofortige Befriedigung der Bedürfnisse bereithält. In der Wüste steht nicht an jeder Ecke eine Pommes-Bude oder ein Getränkemarkt. Israel soll lernen, sich nicht mehr gehen zu lassen, sondern selber zu gehen. Der lange Marsch durch die Wüste ist unabdingbar, um sich von falschen Abhängigkeiten zu befreien und zu lernen, aus dem Glauben an den Gott 23 der Liebe zu leben. Dieser Weg in die größere Freiheit bleibt immer gefährdet und droht im Sand zu verlaufen. So kommt es zur Versuchung der Regression. Als die Israeliten in der Wüste hungrig werden, wollen sie nach Ägypten zurück, um sich an den Fleischtöpfen des Pharao den Wanst vollschlagen zu können: Wenn auch unfrei – Hauptsache satt! Erst kommt das Fressen, dann die Moral. (B. Brecht) Freiheit aber bedeutet, um moralischer Werte willen auch mit knurrendem Magen, wenigstens ein paar Schritte, weitergehen zu können. Wird in einer Gesellschaft kein Konsum-Verzicht mehr eingeübt, so wird das Quäntchen Freiheit des Menschen zum Opfer der Übermacht von Werbung und Manipulation. Es gibt auch die Flucht nach vorn, in Traumwelt und Phantasie. Und so wird es erzählt: Als das Volk auf seinen Anführer Mose, der von Gott die Gesetzestafeln empfängt, warten muss, wird es ihm langweilig. Während Mose auf die Tafel schreibt, machen seine Schüler in seinem Rücken Unfug: Sie basteln sich einen Götzen, der Fruchtbarkeit symbolisiert: Das „Goldene Kalb“ ist nämlich eine Miniaturausgabe des ägyptischen Stiergottes , der Potenz und Macht darstellt. Doch die Anbetung der Fruchtbarkeit mitten in der Wüste ist nichts als eine Fata Morgana. Die Israeliten müssen lernen, sich der eintönigen Realität der Wüste zu stellen. Immerhin: Sie finden etwas Essbares, eine Art von Brot („Manna“) und sehen darin ein Geschenk des Himmels. Bald freilich hängt das Wüstenbrot Marke "Manna" vielen zum Hals heraus und die nächste Krise bahnt sich an. Der Durst brennt. Und es ist wie ein Wunder, als sie mitten in der Wüste unverhofft auf eine Quelle stoßen. Die Schule der Wüste zielt auf den Exodus aus sich selbst heraus. Das Lernziel „Vertrauen“ bedeutet, nicht aus der Sicherheit dessen zu leben, was man in der Hand und im Griff hat. Israel lernt, dass Gott die leeren Hände füllen kann, wenn man sie ihm offen hinhält. Gott schenkt in der Wüste das Brot vom Himmel und das Wasser, das aus dem Felsen entspringt. Glaube und Vertrauen sind die „Ressourcen“, die nachhaltigen Quellen also, die das Herz wirklich füllen können. Es gibt eine Lebendigkeit, die nur dann im Menschen aufsprudeln kann, wenn er nicht mehr hart ist wie ein Stein, sondern sich berühren lässt und weich wird; wenn er nicht alles selber im Griff hat, sondern sich von anderen oder von oben beschenken lässt. Eine weitere Lektion der Wüste: Die Israeliten müssen lernen, dass man das von Gott geschenkte Brot nicht horten kann. Es gab einige Hebräer, die vom Manna mehr 24 einsammelten als notwendig war. Aber dieses Brot wurde wurmig und stank. (Ex 16,20). Der Wunsch, alles zu bunkern und genügend Reserven zu haben, ist ein Zeichen fehlenden Vertrauens. Liebe lässt sich nicht einwecken oder aufsparen. Es gibt keine Freundschaft aus Konserven. Liebe schenkt sich immer nur von Augenblick zu Augenblick. Sie lebt vom Vertrauen, dass der andere mir treu bleiben und mich auch morgen wieder beschenken wird. Im großen Erziehungsprojekt der Wüstenschule zeigt sich Gott als Lehrer, als Ausbilder, als Erzieher, der sein Volk führt. Er lädt den Menschen in seine Schule ein, um Vertrauen und Glauben zu lernen. Im Buch Deuteronomium spricht Gott zu seinem Volk: Aus diesen Erfahrungen ... „sollst du die Erkenntnis gewinnen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Vater seinen Sohn erzieht.“ (Dtn 8,5) Hier wird uns Gott als Pädagoge vorgestellt: Ziel der Erziehung ist die Freiheit, d.h. eine erwachsene Person, die autonom und selbstverantwortlich ist. Gott will keine Sklaven, sondern im Gegenteil: Erziehen ist educere, herausführen aus der Unmündigkeit und Sklaverei Ägyptens, konkret: die Herausführung aus politischer, wirtschaftlicher, aber auch sozialer und psychischer Abhängigkeit. Exodus und Educatio hängen sprachlich und inhaltlich zusammen: Es geht um eine progressive Überwindung von Abhängigkeit und darum, Land zu gewinnen, Freiheit und Weite. Gott will den Menschen als ein erwachsenes Wesen, das in Freiheit und Verantwortlichkeit auf die Herausforderungen des Lebens antworten kann. So wird der Mensch zum Abbild Gottes und zu einem Wesen, das mit seinem Schöpfer eine Beziehung von Freundschaft und Liebe eingehen kann. Bei diesem langen Weg geht es um die Wiederfindung des Urvertrauens zu Gott. Und Vertrauen meint: Ich kann mich dem anderen zeigen. Ich darf vor ihm sein, so wie ich bin. Ich muss dem anderen nichts vormachen, mich nicht größer oder kleiner machen als ich bin. Es ist Gottes Initiative, der uns dabei entgegenkommt. Er zeigt sich. Das nennen wir „Offenbarung“. Das griechische Wort für „Offenbarung“ (apo-kalypsis) bedeutet wörtlich: „die Hüllen fallen lassen“. Die Geschichte der Offenbarung zielt darauf hin, dass Gott dem Menschen immer wieder zeigen will, wer er eigentlich ist. Wie er zu uns steht. Mit welchen Augen er uns anschaut. Wie er uns zugewandt ist. 25 3. Die Pädagogik Jesu Schauen wir nun in einem weiteren Schritt in das Neue Testament. Von Jesus wird gesagt, dass er das sichtbare Ebenbild Gottes ist. In seinem Gesicht, in seinem Handeln, in seinen Worten wird sichtbar, wer Gott ist. In einem Gedicht über Jesus habe ich das so formuliert: Wer bist du? Schon immer erwartet wie eine große Liebe und doch ganz anders angesichts deiner leuchtet das göttliche antlitz menschlich sichtbar mein wahres ansehen empfange ich allein durch deinen blick du schaust mich an also bin ich (aus: Andreas Knapp: Brennender als Feuer, S. 8) Menschen haben erfahren, dass Gott ihnen in Jesus sein Gesicht gezeigt hat. Menschen, die aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, werden wieder integriert. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören. In vielen Wundern geht es um Heilung der Behinderungen, die die Kommunikation beeinträchtigen. Hören können, reden können, einander wieder ins Gesicht sehen können. Damit beginnt das Reich Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist Kommunikativ. Und darum teil er sich anderen mit. 26 Deutlich wird dies etwa, wenn Jesus lehrt. Im Neuen Testament finden wir Jesus immer wieder in dieser Rolle als Lehrer und Erzieher. Das Volk nannte Jesus „Lehrer“ (Rabbi) und „Meister“, denn das war seine Rolle und sein Auftrag, wie er selber bestätigt. Jesus hat Jünger, discipuli, zu deutsch: Lehrlinge oder Schüler und er hält Unterricht. Nicht in einer Schule, sondern in der Synagoge, auf dem Berg, auf der grünen Wiese. Er hat kein Lehrpult, aber er steigt in ein Boot, das ihm als schwimmende Kanzel dient. Was fällt nun an der Pädagogik Jesu auf? Jesus lehrt mit Autorität. Im Evangelium (Mk 1, 21f.) lesen wir: Das Volk war tief beeindruckt, ja sogar betroffen von der Lehre Jesu, denn er lehrte sie wie einer, der (göttliche) Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was heißt Autorität? Echte Autorität meint nicht, sich über andere zu erheben und sie zu dominieren, indem man sagt: Du weißt ja nichts. Ich werd's dir jetzt sagen! Das Wort „Autorität“ hat seinen Ursprung im lateinischen „augere“ - vermehren. Im ursprünglichen Sinn des Wortes hat jemand dann Autorität, wenn er die Entwicklung und das Wachstum des anderen vermehrt, so wie das in der etwas altertümlichen Wendung zum Ausdruck kommt: „Einen Menschen groß ziehen“. Wer die Freiheit des andern dagegen einschränkt, wer ihn klein macht und erniedrigt, der hat keine wahre Autorität. Von den Schriftgelehrten wird gesagt, dass sie keine Autorität hatten. Warum? Weil sie den Leuten viele Lasten auferlegen, die sie selber nicht zu tragen bereit sind. Sie drücken die anderen und machen sie klein, um selber groß rauszukommen. Eine solche Person ist unglaubwürdig und hat deswegen auch keine Autorität. Die wesentlich Voraussetzung für Erziehung ist die Glaubwürdigkeit desjenigen, der erzieht. Es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch wie man es sagt. Ein weiterer Faktor: Jesus ist glaubwürdig, weil er selber das tut, was er sagt. Weiterhin hat Jesus eine gewisse Selbstdistanz. Er lässt sich nicht auf eine bestimmte Rolle fixieren – und schafft dadurch in seiner Umgebung einen gewissen Freiraum. Jesus setzt sich selber nicht absolut, sondern ist Lehrer und Lernender zugleich. Er lässt sich auch kritisieren und korrigieren. Weil Jesus selber glauben lernte, kann er auch glauben lehren. So wird er als lernender Lehrer zum Vorbild, das man nachahmen kann. Er und seine Jünger bilden eine große Lerngemeinschaft auf dem Weg zum Reich Gottes. Im Gegensatz zu den Pharisäern möchte Jesus die Freiheit seiner Schüler vermehren, damit sie als erwachsene, 27 reife und verantwortliche Personen leben können. Er möchte keine abhängigen und infantilen Bewunderer haben. Er erlaubt ihnen daher auch nicht, dass man ihn „Vater“ nennt. Er weist den Paternalismus zurück. Er will, dass seine Schüler aus der gleichen Würde und Freiheit leben, die er selber hat und sagt: „Wenn der Schüler alles gelernt hat, wird er wie sein Meister sein.“ (Lk 6,40) Jesus begegnet Menschen. Es kommt zu einer intensiven Begegnung - doch dann geht Jesus weiter. Ein wichtiger Augenblick in der Erziehung ist das Wieder-Loslassen. In seinen Abschiedsreden macht Jesus deutlich: Er wird die Jünger allein lassen, um sie frei zu lassen. Es ist normal, dass man sich an Ältere anhängt. Jesus aber verschwindet im richtigen Augenblick, um der Freiheit willen. Als guter Pädagoge weiß Jesus, dass die Geduld die Mutter der Erziehung ist. Allerdings berichtet uns das Evangelium, dass auch Jesus bisweilen an seine Grenzen kam. Manchmal ist er es müde, mit so ungelehrigen Schülern zu tun zu haben, die einfach nicht kapieren, was er ihnen beibringen will. Dann ruft er aus: Oh du ungläubige und unbelehrbare Generation! Wie lange muss ich euch noch ertragen! (Mt 17,17) Jesus stöhnt, aber er verliert dann die Geduld doch nicht und lehrt wieder weiter. In all seinem Lehren und Handeln respektiert Jesus immer die Freiheit des Menschen. Er lädt ein („Wenn du willst...“: Mk 10, 17-22), aber er wendet weder Gewalt noch subtile Manipulation an. Es ist ihm wichtig, dass seine Schüler ihm freiwillig folgen. Er stellt sie vor die Alternative, zu bleiben oder zu gehen – und zwar ohne Drohung. Er stülpt nichts über, sondern er will anbieten, vorschlagen und herausfordern. Dadurch wird die Freiheit seiner Schüler pro-voziert, d.h. hervor-gerufen und gefördert. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu seinen Schülern: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.“ (Joh 15,15) Das Ziel der Erziehung ist also: die Beziehung, die naturgemäß von Abhängigkeit geprägt ist, progressiv zu überwinden. Ein Kind ist noch ganz abhängig von Eltern und Lehrern. Ziel der Erziehung ist der erwachsene Mensch, der ebenbürtig ist in seiner Freiheit und Persönlichkeit. Jesus gebraucht dafür das Bild der Freundschaft, denn unter Freunden gibt es keinen Paternalismus und keine Unterordnung. Freundschaft ist Beziehung unter 28 Gleichen. Im Reich Gottes, so die prophetische Vision im Alten Testament, wird dann keiner mehr den anderen belehren (Jer 31,34), weil alle Schüler Gottes sind (Joh 6,45). Gott ist der Geber aller Gaben – und alle Menschen sind Lernende, Empfangende, so dass sich keiner über den anderen erheben kann. Lehrer und Lehrerinnen sind ihren Schülern immer nur in bestimmter Hinsicht einen Schritt voraus und ihr Ziel ist, dass sie bald eingeholt werden. Aus diesem Grund lehrt Jesus seine Jünger, selber zu lehren. Er will, dass auch sie gute Lehrer werden. Er beansprucht für sich weder das Heilungs- noch das Lehrmonopol. Er behält seine Gaben und Erfahrungen nicht für sich zurück, sondern teilt sie mit seinen Schülern. Es kommt ihm auf die Reifung seiner Schüler an: Sie sollen selber LehrErfahrungen machen. Und so schickt er seine Jünger öfter mal alleine los, damit sie ein Praktikum machen. Hinterher führt er Personalgespräche und wertet mit seinen Jüngern das Praktikum aus. Interessant ist, dass bei dieser Evaluation nicht der Erfolg im Zentrum steht. Die Jünger haben zwar Erfolge vorzuweisen. Aber Jesus relativiert diese und sagt: Der entscheidende Wert ist, dass ihr Kinder Gottes seid. Eure Namen sind im Himmel verzeichnet. Im Facebook Gottes. Ihr habt vor Gott ein Gesicht. Gott ist es, der euch Ansehen schenkt. Damit befreit er seine Schüler vom Leistungsdruck und sagt: Euer entscheidender Wert ist euch von Gott schon geschenkt. Dieser innere Wert soll der Grund eurer Freude sein – und nicht der äußere Erfolg. Und wenn der mal ausbleiben sollte, so habt ihr immer noch einen inneren Halt und eine innere Freude. (vgl. Lk 10,20) In der Begegnung mit Jesus entdecken die Jünger und Jüngerinnen das Gesicht Gottes. Johannes lässt dann Jesus sagen: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige, der Gott ist und der an der Brust Gottes ruht, er hat Kunde gebracht. 4. Kein Bild! In Jesus Christus hat Gott uns sein Gesicht gezeigt. Das ist die urchristliche Überzeugung. Zugleich bleibt die Grundüberzeugung bestehen, dass Gott für uns verborgen ist und wir uns kein Bild machen dürfen. Im Hintergrund des Bilderverbotes im Alten Testament steht die damals verbreitete Meinung, in einem Bild sei die Gottheit sichtbar und leibhaftig gegenwärtig; das Bild sei mit der Gottheit identisch und verlange deshalb göttliche Verehrung. Das Bilderverbot ist 29 also zunächst ein Kultverbot. Das Verbot eines Kultbildes unterscheidet Israel von allen Völkern und Religionen seiner Umwelt im alten Orient. Gemalte oder geschnitzte Bilder legen Gott auf einen bestimmten Umriss fest, sie fixieren ihn, machen ihn gegenständlich. Daran nimmt der Glaube Israels Anstoß. Das Bilderverbot richtet sich gegen die Vergegenständlichung und Fixierung der Vorstellungen vom lebendigen Gott. Das Verbot von Bildern soll die immer neu möglichen Erfahrungen mit Gott offen halten. Denn Israel hat Gott als „Jahwe“ erfahren. In der Geschichte von Mose am brennenden Dornbusch gibt Gott diesen seinen Namen bekannt. „Ich bin, der ich bin“. „Jahwe“ kann auch übersetzt werden mit:„Ich bin der ‚Ich-bin-für-dich-da’“. Wofür steht dieser Name? – Er sagt aus: Jahwe ist der, der immer bei seinem Volk sein wird; der es nicht verlässt, sondern treu zu ihm hält. Der Name steht aber auch dafür, dass Gott sich nicht mit einem „etwas“ identifizieren lässt, das man dann in der Hand hätte. Der Gottesname ist ein Versprechen und keine (Beschwörungs-)Formel, mit der man Gott auf den Begriff oder manipulierend in Griff bekommen könnte. Der brennende Dornbusch drückt dies bildhaft aus: Gott zeigt sich Mose in einer ungewöhnlichen und faszinierenden Erscheinung, von der dieser sich angezogen fühlt. Zugleich aber darf Mose nicht nähertreten, sondern muss zum Zeichen der Ehrfurcht die Schuhe ausziehen. (vgl. Ex 3,1-6) Der Gott, den Israel im Exodus aus Ägypten und im Zug durch die Wüste erfahren hat, ist kein sesshafter Herrscher, dem man in seinem palastartigen Tempel Tribute zu entrichten hat. Vielmehr ist Jahwe ein Gott der Wüste. Wie ein Sturm: hörbar und doch unfassbar; wie das Firmament: bergend und doch unendlich weit; wie eine Wolke: sich zeigend und verhüllend zugleich. Er ist greifbar nahe und er ist unbegreiflich zugleich. Alles Reden von Gott bleibt immer vorläufig. Seine Wirklichkeit ist stets anders und größer als alle Bilder. Der Gott, von dem die Bibel spricht, ist und bleibt widerständig und hat eine bilderstürmerische Tendenz. Unsere Bilder von Gott sagen Richtiges und Wichtiges. Aber der lebendige Gott ist und bleibt von allen Begriffen und Bildern grundverschieden. Gott fällt immer aus dem Rahmen und bleibt größer als alle Bilder. Die christliche Theologie hat in ihrer Geschichte immer wieder daran erinnert, dass man von Gott nicht in einem naiven Sinn reden kann. Gott ist irgendwie anders, größer, geheimnisvoller. Entsprechend gilt, dass wir von Gott eher sagen können, was er nicht ist, als was er ist. Wer Gott auf einen Begriff bringen will, vergreift sich und greift ins Leere. 30 Die wahrhaft Glaubenden definieren Gott nicht. „Definieren“ heißt ja wörtlich: „begrenzen“. Es ist eher ein Akt des Unglaubens, wenn man versucht, Gott auf eine Formel zu bringen. Und einen solch definierten Gott kann man nicht ernst nehmen, weil er gar nicht göttlich ist. Viele Menschen lehnen Gott ab, weil sie ein zu enges Bild von Gott haben. Ihre Ablehnung Gottes ist dann allerdings auch nur die Verwerfung einer falschen Formel. Schon Leo Tolstoj gab zu bedenken: Wenn ein Wilder an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, so heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass Gott nicht aus Holz ist … Die Theologie und vor allem die mystische Tradition betonen: Allein das verstummende Staunen kommt Gott nahe. Aurelius Augustinus bringt es auf den Punkt: „Wenn du ihn verstanden hast, dann ist es nicht Gott.“ Weil man also Gott nicht festlegen kann,muss der Mensch den zahlreichen Versuchungen wehren, sich von Gott ein festes Bild zu machen. Wir können von Gott nicht so selbstverständlich reden, als ob wir ihn begriffen hätten. Feste Bilder können auch Menschen festlegen und begrenzen. Viele Menschen jagen Bildern nach, die man ihnen vorgaukelt, atemlos, bis zur Erschöpfung. Wie ich auszusehen habe... Was ist leisten soll... Wozu ich es im Leben bringen soll... Solche Bilder können Götzenbilder sein. Es gibt dämonische Gottesbilder, die krank machen: Gott als Quälgeist, als kleinlicher Buchhalter, als willkürlicher Tyrann oder als unbarmherziger Richtergott. Diese Gottesbilder sind oft unbewusst. Meist liegen hier negative Grunderfahrungen von Leben und Liebe in der Kindheit vor, die von negativ erlebten Persönlichkeitsanteilen der Eltern unbewusst auf Gott übertragen werden. Oft wird Gott verworfen, weil man sich von den eigenen Eltern emanzipieren will. Oder man macht Gott verantwortlich für manch Negatives (Ängste, Minderwertigkeitsgefühle). Dagegen kann das Meditieren positiver Gottesbilder (Bibel) therapeutisch wirken. Das Gottesbild kann als lebensförderndes oder lebensbehinderndes Grundmuster des Fühlens, Denkens und Handelns wirken. Auf jeden Fall gilt: Gott ist immer größer als alle Bilder. Wir kommen mit Gott an kein Ende. Gott ist nicht festlegbar. Er kann nicht festgehalten oder abgebildet oder gar gebannt werden. Dadurch wird immer wieder ein Freiraum geschaffen für neue Entwicklungen, neue Gedanken. Und wenn der Mensch Ebenbild Gottes ist, so bedeutet dies schließlich, dass wir auch mit 31 dem Menschen nicht fertig werden. Dass das Menschenbild nach oben offen bleiben muss. Weil der Mensch einen göttlichen Aspekt hat, kommen wir auch mit unserem Suchen und Fragen nach dem, was der Mensch ist, an kein Ende. Weil wir uns von Gott kein Bild machen dürfen, dürfen auch den Menschen nicht in ein Bild einsperren. Wie Gott ist auch der Mensch ein Geheimnis, d.h. es gibt eine Dimension des Unbegreiflichen und Unverfügbaren. Der Glaube an Gott provoziert diesen Freiraum und wird zugleich zur kritischen Instanz aller Festlegungen. Die Bibel sagt: Wir sind als Bild Gottes geschaffen. Das bedeutet: Wir schaffen und machen uns nicht selber ein Bild. Denn das ist die große Versuchung: Wir würden gerne wissen, wer wir selbst sind und wir hören nicht auf, uns zu vergleichen. Und wir sind ständig in Gefahr, uns Bilder von denen zu machen, die uns anvertraut sind. Aber der wahre Pädagoge führt jeden zu dem einzigartigen Geheimnis, das er oder sie selbst ist. Religion ist: dieses Geheimnis in mir selbst und in jedem Menschen respektieren. Wenn wir einen Menschen auf ein bestimmtes Bild festlegen, dann machen wir uns einen Götzen. Man kann Menschen vergöttern und anhimmeln, man kann sie auch verteufeln. Unsere Bilder von anderen werden für diese zum Gefängnis. Wenn wir aber unsere Bilder immer wieder in Frage stellen lassen und weiten, dann kann der andere Mensch sich immer mehr zeigen wie er ist – und sich auch verändern. Es ist wie ein Bild, das man aus dem Rahmen nimmt. Das Bild bleibt nicht im engen Rahmen eingespannt, sondern es kann sich entwickeln, größer werden, neue Dimensionen bekommen. Diese Haltung nennt Jesus: Glauben. Glaubst du, dass Gott noch andere Möglichkeiten hat? Glaubst du, dass in jedem Menschen mehr steckt, als wir äußerlich sehen können? Dass jeder Mensch im faithbook Gottes eingeschrieben ist? Jeder Mensch hat ein Geheimnis, das wir nicht greifen und begreifen können. In jedem Menschen steckt etwas Göttliches. Die Erfahrung Jesu war: Dort, wo Menschen an die ungeahnten Möglichkeiten Gottes glaubten, dort konnten Menschen gesund werden. Wo man umgekehrt aber Gott nichts zutraute, dort blieben Menschen krank, engstirnig, borniert. Wir machen uns Bilder von anderen. Das ist normal. Jesus aber lädt uns ein, zu glauben: Das, was wir sehen, ist noch nicht alles. In jedem Leben stecken noch ungeahnte Möglichkeiten: „Du, ich traue dir etwas zu. Versuche mal etwas Neues. Vielleicht schaffst 32 du etwas, was man von dir gar nicht gedacht hätte.“ Konnten nicht manche schwierigen Schüler einen guten Weg gehen, weil sie gespürt haben, dass eine Lehrerin, ein Lehrer an sie geglaubt hat? - Wenn wir aneinander glauben, dann geben wir einander eine Chance zum Wachstum. Wenn wir nicht zu klein voneinander denken, dann kann Ungeahntes zum Vorschein kommen. Ja, wenn wir Gott und den anderen etwas zutrauen, dann können Wunder geschehen. Wir haben mit einer vergessenen PIN begonnen. Schließen möchte ich mit einem Gedicht: passwort jeder mensch ein verwunschener turm von sich selber hinter schloss und riegel gebracht bewegungsmelder lösen alarm aus komm mir nicht zu nah unübersehbar das warnschild vorsicht bissiger mensch keine brechstange kein raffinierter dietrich nur ein schlüsselwort sesam öffne dich zärtlich gesprochen DU vielleicht entriegele ich die sperrkette der angst und aus dem spaltbreit ein leises willkommen (aus: Andreas Knapp, Gedichte auf Leben und Tod) 33