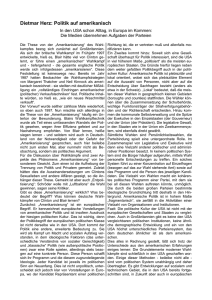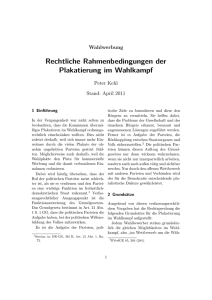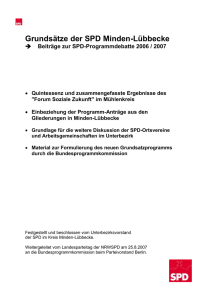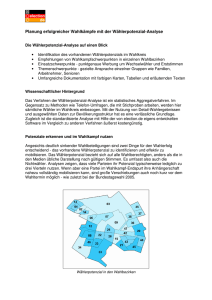als Word-Datei
Werbung

Selbstdarstellung der politischen Parteien in den Medien vor der Bundestagswahl 2002 –Wie „amerikanisiert“ ist der deutsche Wahlkampf? Magisterarbeit im Fach Politikwissenschaft an der Universität Potsdam vorgelegt von Jens Wegner eingereicht bei Prof. Dr. Jürgen Dittberner Potsdam, den 08. Juli 2003 0 Inhalt 1. Einleitung...............................................................................................................3 1.1 Thema und Eingrenzung...................................................................................3 1.2 Literatur und Forschungsstand.........................................................................5 2 Rahmenbedingungen für einen Wahlkampf in den Medien..............................8 2.1 Verhältnis von Politik und Medien in der BRD..................................................8 2.1.1 Aufgaben der Medien im demokratischen System.................................8 2.1.2 Rechtliche Grundlagen der Medien in der BRD....................................11 2.1.3 Mediatisierung der Gesellschaft?..........................................................13 2.1.4 Anpassung der Politik an die Regeln der Medien.................................15 2.1.5 Bedeutung der Medien für den modernen Wahlkampf.........................17 2.2 Systemunterschiede zwischen den USA und der BRD..................................18 2.2.1 Politische Unterschiede........................................................................18 2.2.2 Mediale Unterschiede...........................................................................26 3 „Amerikanisierung“ – was ist das?...................................................................30 3.1 Merkmale der „Amerikanisierung“....................................................................30 3.1.1 Professionalisierung..............................................................................31 3.1.2 Spindoctoring........................................................................................32 3.1.3 Personalisierung...................................................................................34 3.1.4 Themen- und Ereignismanagement......................................................36 3.1.5 Meinungsforschung...............................................................................38 3.1.6 Angriffswahlkampf.................................................................................40 3.2 „Amerikanisierung“ oder „Modernisierung“?...................................................42 1 4 Wahlkampf 2002..................................................................................................44 4.1 Die politische Ausgangslage zu Beginn des Wahlkampfes............................44 4.2 Kampa, Kompetenzteam und Co. – Die Organisation des Wahlkampfes......48 4.3 Selbstdarstellung der Parteien in den Medien................................................53 4.3.1 Klassische Parteienwerbung.................................................................53 4.3.2 Medienstrategien..................................................................................59 4.3.3 Internetpräsentation..............................................................................67 4.3.4 Die Fernsehduelle.................................................................................73 4.4 Alles anders? Ein Vergleich mit früheren Wahlkämpfen..................................77 5 Fazit......................................................................................................................81 Literatur.....................................................................................................................85 Abkürzungsverzeichnis...........................................................................................94 Anhang......................................................................................................................96 2 1. Einleitung 1.1 Thema und Eingrenzung Im Bundestagswahlkampf 2002 erweckte ein Novum das öffentlichen Interesse. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik standen sich ein amtierender Bundeskanzler und der Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei in einem Duell gegenüber. Dieses fand zwar nicht zu Highnoon im Wilden Westen statt, sondern zur besten Sendezeit in einem Fernsehstudio. Als Waffen dienten auch keine Pistolen, sondern Sachargumente. Gleichwohl stammt aber auch diese Art, Mann gegen Mann gegeneinander anzutreten, aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mit den beiden Fernsehduellen zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber wurde ein Sendeformat in den deutschen Wahlkampf übernommen, wie es in den USA schon seit langem üblich ist. Doch auch anderen Methoden, derer sich die politischen Parteien und ihre Kandidaten zur Selbstdarstellung im Wahlkampf bedienen, wird nachgesagt, sie würden den amerikanischen Wahlkampf kopieren. In der Folge werde der deutsche Wahlkampf zunehmend „amerikanisiert“. Radunski schreibt bereits 1996: „Die Amerikanisierung der Politik ist längst auch deutsche Wirklichkeit“1. Die Stichworte, die in diesem Zusammenhang genannt werden, lauten Personalisierung, Angriffswahlkampf oder Spindoctoring. Doch wie „amerikanisiert“ sind Bundestagswahlkämpfe heutzutage tatsächlich? Sind die Wahlkampfmethoden, die im Jahr 2002 zu beobachten waren, nicht eher das Ergebnis eines längeren Prozesses, währenddessen sie sich den Gegebenheiten einer sich stetig ändernden Mediengesellschaft angepasst haben? Ist die Verwendung des Begriffs „Amerikanisierung“ angesichts der erheblichen politischen und medialen Systemunterschiede zwischen den USA und der Bundesrepublik überhaupt zulässig? Die vorliegende Arbeit soll versuchen, durch eine Fallstudie über die Selbstdarstellung der Parteien in den Medien vor der Bundestagswahl 2002 Antworten auf diese Fragen zu geben. Im Titel dieser Arbeit sind bereits die Thesen enthalten: - Selbstdarstellung der politischen Parteien vor der Bundestagswahl 2002: Dieser Teil des Titels impliziert, dass die Medien für die Selbstdarstellung der Parteien 1 Radunski: Politisches Kommunikationsmanagement (1996), S. 39. 3 eine bedeutende Rolle spielen. In Wahlkampfzeiten erbringen diese verstärkt kommunikative Leistungen, um Aufmerksamkeit der Medien und damit der Wähler, deren Stimmen es zu gewinnen gilt, zu erhalten. Es wird daher zu untersuchen sein, welcher Methoden sich die politischen Parteien im Bundestagswahlkampf 2002 im einzelnen bedient haben. - Wie „amerikanisiert“ ist der deutsche Wahlkampf?: Dieser Frage liegt die Annahme zu Grunde, dass in deutschen Wahlkämpfen zumindest teilweise Methoden zur Anwendung kommen, die amerikanischen Mustern entlehnt sind. Ausgehend von der Selbstdarstellung der Parteien in den Medien wird daher untersucht werden, in welchem Ausmaß dies für den Bundestagswahlkampf 2002 zutrifft. Es ist notwendig, in einer theoretischen Hinführung zunächst die Rahmenbedingungen zu skizzieren, unter denen ein Wahlkampf in den Medien stattfinden kann. Dazu ist zum einen ein Überblick über das Verhältnis von Politik und Medien in der Bundesrepublik zweckmäßig. Dabei werden die Funktionen und rechtlichen Grundlagen vorgestellt, unter denen die Medien agieren, sowie der ständige Wandel, dem das Verhältnis von Medien und Politik unterliegt, betrachtet. Zum anderen sollen die medialen und politischen Systemunterschiede zwischen der Bundesrepublik und den USA dargestellt werden. Ausgehend von der Annahme, dass sich im deutschen Wahlkampf amerikanische Methoden wiederfinden lassen, ist es sinnvoll, die verschiedenen Rahmenbedingungen in beiden Ländern kurz zu umreißen. Dieser Abschnitt dient dazu, Begriffe zu klären und Hintergründe zu erläutern, die zum besseren Verständnis der anschließenden Untersuchung notwendig sind. Er soll jedoch weder im Hinblick auf die Medientheorie noch auf die Systemunterschiede zwischen der Bundesrepublik und den USA umfassende Erkenntnisse liefern, sondern beschränkt sich auf die schlaglichtartige Darstellung der für das Verständnis der vorliegenden Arbeit wesentlichen Aspekte. In dem sich daran anschießenden Abschnitt soll der Begriff „Amerikanisierung“ genauer durchleuchtet werden. Zu diesem Zweck werden zunächst die wesentlichen Merkmale dargestellt, die mit diesem Terminus in Verbindung gebracht werden. Dabei wird auch darauf eingegangen, wie ausgeprägt sich diese im Wahlkampf der USA darstellen. Anschließend soll die Frage erörtert werden, ob der Begriff problemlos in der wissenschaftlichen Diskussion verwendet werden kann, oder ob 4 sich nicht der Terminus „Modernisierung“ besser eignet, um die Veränderungen in der deutsche Wahlkampfführung zu umschreiben. Schließlich wird der Wahlkampf der Parteien vor der Bundestagswahl 2002 untersucht. Nach einer vorangehenden Darstellung der politischen Ausgangslage der jeweiligen Partei sowie den verschiedenen Organisationsformen der Wahlkampfteams, steht die Selbstdarstellung der Parteien in den Medien im Mittelpunkt der Untersuchung. Gleichzeitig soll dabei gezeigt werden, in welcher Form die zuvor angesprochenen Merkmale einer „Amerikanisierung“ im Bundestagswahlkampf 2002 wiederzufinden sind. Abschließend widmet sich ein kurzer Überblick der Frage, ob es sich bei den angeführten Merkmalen tatsächlich um neue Erscheinungen des Wahlkampfes 2002 handelt oder ob sie nicht auch schon im Vorfeld früherer Bundestagswahlen zu beobachten waren. Ziel der Arbeit ist es, die Wesensmerkmale des Bundestagswahlkampfes 2002 im Hinblick auf den Begriff „Amerikanisierung“ zu charakterisieren und dem Leser einen hinreichenden Eindruck über die Anwendbarkeit dieses Begriffs in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion zu vermitteln. 1.2 Literatur und Forschungsstand Über Medientheorie, politische Kommunikation und das Verhältnis von Politik und Medien findet in der wissenschaftlichen Literatur eine breite Diskussion statt. Dementsprechend ist die Anzahl der diesbezüglichen Publikationen fast unüberschaubar. Dabei fällt auf, dass die Zahl der Veröffentlichungen von Fachliteratur in diesem Forschungsfeld gerade im Nachklang von Wahlen deutlich zunimmt. Dies verwundert nicht, da Wahlkämpfe eine verstärkte kommunikative Leistung der Parteien bedingen, die sich entsprechend in den Medien widerspiegelt. Wahlkämpfe bieten der Wissenschaft daher reichlich Material für Studien und Analysen. So ist auch zu erwarten, dass sich in nächster Zeit wieder eine Vielzahl von Arbeiten der Untersuchung der Bundestagswahl 2002 widmen werden. Bisher allerdings sind erst wenige Veröffentlichungen vorzufinden. Eine erste Auswertung des Wahlkampfes liefert allerdings Richard Hilmer2. Das Thema „Amerikanisierung“ wurde vor allem nach der Bundestagswahl 1998 in zunehmenden Maße zum 2 Vgl. Hilmer: Bundestagswahl 2002 (2003). 5 Gegenstand der Debatte, auch wenn der Begriff schon früher gelegentlich in der Diskussion auftauchte3. Die größte Zahl der Aufsätze – bisher hat sich noch keine Monographie dem Thema gewidmet – behandelt jedoch indes lediglich Einzelaspekte der „Amerikanisierung“. So widmen sich etwa Pfetsch und Schmitt-Beck4 in erster Linie den Kommunikationsstrategien der Parteien im Wahlkampf, während Klein und Ohr genau wie Wirth und Voigt5 auf die Personalisierung der Politikdarstellung eingehen. Falter und Römmele behandeln dagegen vorwiegend die Professionalisierung von deutschen Wahlkämpfen6. Breite Aufmerksamkeit in der Fachliteratur erhielt schließlich auch ein Artikel Falters, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde und das Thema Spindoctoring zum Gegenstand hatte 7. Einen guten Gesamtüberblick über die Thematik liefert ein Aufsatz von Holtz-Bacha aus dem Jahr 19998. Neben diesen wissenschaftlich-analytischen Untersuchungen wurde in jüngster Zeit auch zunehmend Literatur von Journalisten, Politikberatern und Werbefachleuten veröffentlicht, die in der Vergangenheit aktiv an der Planung und Durchführung von Wahlkämpfen mitgewirkt hatten. Hervorzuheben sind insbesondere die Bände von Machnig9 und Althaus10. Daneben findet auch eine Monographie von Althaus zum Thema Politikberatung11 breite Beachtung in der wissenschaftlichen Diskussion. Die Autoren setzen sich vorwiegend mit der praktischen Seite des Kampagnenmanagements auseinander und tragen damit dem zunehmenden Interesse der Öffentlichkeit an der Wahlkampforganisation Rechnung. Dieses zeigt sich insbesondere in einer Vielzahl von Veröffentlichungen in den Medien, die im Vorfeld der Bundestagswahl 2002 erschienen sind und sich mit dieser Frage auseinander setzen12. 3 So z.B: Radunski: Politisches Kommunikationsmanagement (1996). Vgl. Pfetsch/Schmitt-Beck: Amerikanisierung von Wahlkämpfen? (1994); Pfetsch: „Amerikanisierung“ der politischen Kommunikation? (2001). 5 Vgl. Klein/Ohr: Gerhard oder Helmut? (2000); Wirth/Voigt: Der Aufschwung ist meiner! (1999). 6 Falter/Römmele: Professionalisierung bundesdeutscher Wahlkämpfe (2002). 7 Vgl. Falter, J: Alle Macht dem Spindoctor (1998), in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.04.1998. 8 Vgl. Holtz-Bacha: Bundestagswahlkampf 1998 (1999). 9 Vgl. Machnig: Politik – Medien – Wähler (2002). 10 Vgl. Althaus: Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying (2002). 11 Vgl. Althaus: Wahlkampf als Beruf (1998). 12 Vgl. u.a. Goffart: Nur der Sieg zählt, in: Handelsblatt vom 12.07.2002; Albers: Modern, medientauglich, ratlos, in: Welt am Sonntag vom 21.07.2002; Leersch: Die Kanzlermacher, in: Die Welt vom 13.08.2002. 4 6 Für die nachfolgende Darstellung wurde die vorhandene Literatur im Hinblick auf die Fragestellung eingehend untersucht und einer Sekundäranalyse unterzogen. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, ob die entsprechenden Untersuchungsergebnisse auf die Bundestagswahl 2002 anwendbar sind. Der zweite Teil der Arbeit stützt sich auf Medienberichte sowie auf Material, das dem Verfasser von den Parteien zur Verfügung gestellt wurde, so etwa Wahlkampfhandbücher und Kampagnenberichte. Zwei Experteninterviews mit dem stellvertretenden Leiter der Abteilung strategische Planung und Wahlkämpfe der CDU, Oliver Röseler 13, und dem Wahlkampfmanager der Grünen im Wahlkampf 2002, Rudi Hoogvliet, brachten weitere wertvolle Erkenntnisse. 13 Röseler war im Bundestagswahlkampf 2002 gleichzeitig Mitglied des Stoiber-Teams. 7 2. Rahmenbedingungen für einen Wahlkampf in den Medien 2.1 Verhältnis von Politik und Medien in der BRD 2.1.1 Aufgaben der Medien im demokratischen System Die Bundesrepublik Entsprechend Artikel Deutschland 20 ist Grundgesetz eine parlamentarische bestimmen die Bürger Demokratie. in Wahlen Repräsentanten, die für befristete Zeit die politischen Entscheidungen für die Bevölkerung treffen. Um sich bei Wahlen sachgerecht und kompetent für einen Repräsentanten entscheiden zu können, müssen die Bürger in der Lage sein, sich umfassend über dessen Absichten und Ziele zu informieren. Dies kann nur in den seltensten Fällen durch direkten Kontakt zwischen Bürger und den zur Wahl stehenden Kandidaten geschehen. Auf lokaler Ebene mögen die Akteure dazu zwar durchaus noch in der Lage sein. Auf Landes-, Bundes- oder gar europäischer Ebene jedoch ist der direkte Kontakt kaum realisierbar. Die Größe unserer Gesellschaft und eine Vielzahl an politischen Handlungsalternativen machen eine unmittelbare Kommunikation meistens unmöglich. Das Transportmittel für die politische Kommunikation bilden daher die Massenmedien14. Sie sind geeignet, die größtmögliche Zahl von Bürgern zu erreichen und sie zu minimalen Kosten über die politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen zu informieren. So ermöglichen sie es dem Einzelnen, den politischen Prozess laufend zu verfolgen und sich ein rationales Urteil zu bilden, auf Grund dessen er eine Wahlentscheidung fällen kann. 14 Massenmedien sind die technischen Verbreitungsmittel für Massenkommunikation. Dabei handelt es sich um jene „Sonderform zwischenmenschlicher Kommunikation, bei der [...] ein ‚Kommunikator‘ seine Aussagen öffentlich [...], indirekt und einseitig [...] an ein anonymes, heterogenes und raumzeitlich verstreutes ‚Publikum‘ richtet. Kommunikatoren sind [...] Beobachter der Wirklichkeit, die Ihre Beobachtungen und Reflexionen [...] wiedergeben“. Siehe: Andersen/Woyke: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland (2000), S. 366. Die Begriffe „Massenmedien“ und „Medien“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 8 Unter den verschiedenen Funktionen15, die die Massenmedien in der Gesellschaft erfüllen, lassen sich in der wissenschaftlichen Literatur die drei Hauptaufgaben Information, Meinungsbildung sowie Kritik und Kontrolle hervorheben16. Da es dem Einzelnen kaum möglich ist, sich ohne die Vermittlungsrolle der Medien ein umfassendes Bild von seinem gesellschaftlichen Umfeld zu machen, „gilt die Informationsfunktion häufig als die vornehmste Aufgabe der Massenmedien“17. Mit ihrer Hilfe soll den Bürgern ermöglicht werden, die Zusammenhänge, Entscheidungen und Handlungen in Politik, Wirtschaft und allen anderen Bereichen der Gesellschaft zu verfolgen und sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Je größer der Informationsgrad des Einzelnen ist, desto eher ist er in der Lage, eine rationale Wahlentscheidung zu treffen oder sich sogar aktiv am politischen Prozess zu beteiligen18. Um einen hohen Informationsgrad der Bevölkerung zu erreichen, müssen die Massenmedien möglichst allgemein verständlich, umfassend und objektiv berichten. Zu beachten ist jedoch, dass die Medien nicht in der Lage sind, permanent über sämtliche politischen Aspekte, Entscheidungen und Hintergründe zu berichten. Die täglichen Abläufe der modernen Politik sind viel zu komplex, um sie in ihrer Gesamtheit laufend in den üblichen Medienformaten darstellen zu können. Die Medien sind daher gezwungen, eine Auswahl an Ereignissen zu treffen, über die sie die Öffentlichkeit informieren wollen. Sie allein entscheiden, ob ein Ereignis berichtenswert ist oder ob es in der Berichterstattung keine Beachtung findet. Information wird daher immer auch von Nicht-Information begleitet19. Auch die Entscheidung, ob über ein bestimmtes Thema ausführlich oder nur am Rande berichtet wird, liegt allein in der Verantwortung der Medien. Dadurch haben die Massenmedien großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Politik durch die Bevölkerung und besitzen eine erhebliche Machtposition im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Auf der Informationsfunktion der Medien basiert die Meinungsbildungfunktion. Durch diese werden die Bürger in die Lage versetzt, die ihnen vermittelten Informationen Der Begriff „Funktion“ ist hier im Sinne von „Leistung“ zu verstehen, die die Massenmedien in der Gesellschaft erbringen. Vgl. Schulz: Politische Kommunikation (1997), S. 27ff. 16 Vgl. Kamps: Politik in Fernsehnachrichten (1999), S. 58ff; Meyn: Massenmedien in Deutschland (1999), S. 32; Schulz: Politische Kommunikation (1997), S. 46ff. 17 Kamps: Politik in Fernsehnachrichten (1999), S. 60. 18 Vgl. ebd. 19 Vgl. ebd., S. 61. 15 9 über den politischen Prozess nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch kritisch zu bewerten. Da in einer pluralistischen Gesellschaft Parteien und andere Interessengruppen permanent darum bemüht sind, ihre eigenen Interessen zu vertreten, werden sie gegenüber der Öffentlichkeit kaum Argumente anbringen, die ihren jeweiligen Positionen entgegenstehen20. Würden die Medien also die Argumentation dieser Gruppen ungefiltert und unkommentiert wiedergeben, könnte sich der Bürger nur schwer und unter großem Aufwand ein ausgewogenes Bild vom politischen Geschehen machen. Mit Hintergrundinformationen, Kommentaren und alternativen Argumenten versuchen die Medien daher, den Bürgern eine ausgewogene Urteilsbildung zu erleichtern. „Es besteht dann die Hoffnung, daß im Kampf der Meinungen das Vernünftige die Chance hat, sich durchzusetzen“21. Um diese Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehmen zu können, müssen und sollten die Medien weitestgehend ausgewogen und objektiv informieren. Reine Berichterstattung und Kommentar müssen strikt und für die Rezipienten der Medien klar erkennbar voneinander getrennt sein. Diesem Ideal wird in der Realität nicht immer entsprochen. Zwar gibt es selten einen deutlich sichtbaren Verstoß gegen die Trennung von Nachricht und Meinung. Doch schon die Auswahl der Ereignisse und die Intensität, mit der über sie berichtet wird, spiegelt oft bereits eine vorgefertigte Meinung wider. Hinzu kommt, dass die Akteure in den Medien, also Redakteure und Journalisten, eine persönliche Meinung zu den Themen, über die sie berichten, haben. Ob angesichts dessen eine klare Trennung zwischen individuellen Ansichten und neutraler Berichterstattung immer gewährleistet ist, darf bezweifelt werden. Die Selektion der Themen sowie die persönliche Meinung der Journalisten haben daher einen bedeutenden Einfluss auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit. Um trotzdem einen möglichst hohen Grad an Objektivität zu erreichen, ist ein breit gefächertes Medienangebot erforderlich. Die dritte klassische Aufgabe der Massenmedien ist die Kritik- und Kontrollfunktion. In demokratischen Gesellschaften sind es die Medien, die neben der Opposition die Regierung kritisieren und deren Amtsführung kontrollieren. Ihnen obliegt daher die Aufgabe, Missstände aufzudecken und die Öffentlichkeit davon zu unterrichten. Ohne sie „liefe die Demokratie Gefahr, der Korruption oder der bürokratischen Willkür 20 21 Vgl. ebd., S. 63. Meyn: Massenmedien in Deutschland (1999), S. 33. 10 zu erliegen“22. Diese wichtige Rolle im Regierungssystem hat den Medien gelegentlich die Bezeichnung vierte Gewalt23 eingebracht. Der Begriff soll die Medien in ihrer Bedeutung für die Demokratie auf eine Stufe mit der Exekutive, Legislative und Judikative stellen. Er ist jedoch mit Vorsicht zu verwenden. Die Kontrollfunktion der Medien ist weder demokratisch legitimiert, noch wird sie selbst überwacht; für die Durchführung der Kontrolle gibt es keine fest vorgeschriebenen Verfahren oder Abläufe und Neutralität ist - wie oben erwähnt wurde - nicht immer gewährleistet. Nichtsdestotrotz weist der Begriff in die richtige Richtung und es „herrscht doch weitgehend Einigkeit darüber, dass Kritik und Kontrolle durch Massenmedien eine wichtige Errungenschaft demokratischer Gesellschaften ist“24. Durch die wichtige Stellung im politischen Prozess erwächst den Medien jedoch auch eine große Verantwortung. Ob Journalisten dieser immer gerecht werden, ist zweifelhaft. So ist für eine effiziente Kontrolle oft enger Kontakt zu Mitgliedern der Regierung oder anderer Entscheidungsträger erforderlich. Inwieweit sich Journalisten davon beeinflussen lassen und ob sie alle Informationen, die sie erhalten, auch veröffentlichen, ist fraglich. Aus den bisherigen Ausführungen ist bereits deutlich geworden, dass sich die drei Funktionen zum Teil überschneiden und deren Ausübung durch die Medien nicht immer unproblematisch ist. Gleichwohl zeigen sie die große Bedeutung auf, die die Massenmedien in einem demokratischen Regierungssystem innehaben und verdeutlichen, dass sie einen unverzichtbaren Bestandteil in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland bilden. 2.1.2 Rechtliche Grundlagen der Medien in der BRD Um ihre Funktionen in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung wahrnehmen zu können, benötigen die Medien eine rechtliche Grundlage. In der Bundesrepublik Deutschland stellt diese zunächst das Grundgesetz dar. Artikel 5 GG gewährleistet das Recht auf freie Meinungsäußerung, Informations- und Pressefreiheit. Gleichzeitig untersagt es jegliche Zensur der Berichterstattung. Einschränkungen sind den Medien lediglich „in den Vorschriften der allgemeinen 22 Ebd. S. 35. Vgl. u.a. Altmeppen/Löffelholz: Zwischen Verlautbarungsorgan und „vierter Gewalt“ (1998), S. 121; Bergsdorf: Die 4. Gewalt (1980). 23 11 Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre“ (Art. 5 Abs. 2 GG) gesetzt. Damit ermöglicht das Grundgesetz den Medien, die oben genannten Funktionen ohne Beeinträchtigung oder Kontrolle durch den Staat ausüben zu können. Welch hoher Stellenwert der freien Meinungsäußerung, der Informations- und Pressefreiheit zugerechnet wird, ist aus verschiedenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ersichtlich. So heißt es in einem Urteil des Ersten Senats aus dem Jahre 1958: „Für eine freiheitlichdemokratische Staatsordnung ist es [das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung jw] schlechthin konstituierend, weil es erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen ermöglicht, der ihr Lebenselement ist. Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt“.25 Neben dem Grundgesetz bilden die Landesverfassungen und die Landespressegesetze weitere rechtliche Grundlagen für die Arbeit der Medien. Die Formulierungen der Landesverfassungen ähneln in Bezug auf Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit in der Regel dem Text des Grundgesetzes26 und gehen zum Teil auch über dessen Regelungsinhalt hinaus. So enthält etwa die Verfassung von Brandenburg das Gebot, „ein Höchstmaß an Meinungsvielfalt zu gewährleisten“ und verbietet, journalistische Tätigkeit durch „Zeugnispflicht, Beschlagnahme und Durchsuchung“ zu behindern27. Weitergehende Regelungen beinhalten die Landespressegesetze. So räumen sie etwa den Medien ein Informationsrecht ein, das zum Teil über die im Grundgesetz verankerte Informationsfreiheit hinausgeht. Dazu gehören etwa die Auskunftspflicht der Behörden oder das Zeugnisverweigerungsrecht28. Die Bestimmungen der Landesverfassungen und der Landespressegesetze gelten auch für das Verhältnis zwischen Medien und Bundesorganen, die ihren Sitz in dem jeweiligen Land haben, da der Bund auf seine Rahmengesetzgebungskompetenz, die ihm nach dem Grundgesetz zusteht, verzichtet hat (Vgl. Art. 75 Abs. 1. Ziff. 2 GG). Da der Staat den Medien bei der Ausführung ihrer Aufgaben einen weitgehenden rechtlichen Handlungsspielraum einräumt, sie aber gleichzeitig einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben, erwächst ihnen eine bedeutende gesellschaftliche 24 Kamps: Politik in Fernsehnachrichten (1999), S. 63. BVerfGE 7, S. 198ff. 26 Vgl. etwa Art. 8 Abs. 1-3 der Verfassung von Berlin 27 Vgl. Art. 19 Abs. 4-5 der Verfassung von Brandenburg 28 Vgl. z.B. § 5 Pressegesetz des Landes Brandenburg; §§ 4 u. 18 Berliner Pressegesetz. 25 12 Verantwortung. Um dieser gerecht zu werden, existieren neben den genannten staatlichen Grundlagen auch „Ansätze zu einem Standesrecht der Massenmedien“ 29. Sie sollen in erster Linie eine berufliche Selbstkontrolle gewährleisten. Hierzu zählen die Publizistischen Grundsätze und die Richtlinien für die redaktionelle Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserates. Darin heißt es etwa: „Die Achtung vor der Wahrheit [...] und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse“30. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Akzeptanz dieser Grundsätze lediglich auf einer freiwilligen Verpflichtung beruht. 2.1.3 Mediatisierung der Gesellschaft? Die Massenmedien haben aufgrund ihrer großen Reichweite und der Unabhängigkeit, die ihnen durch das Grundgesetz gewährt wird, eine herausragende Stellung im gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsprozess. Diese ermöglicht es ihnen, ihre politischen Funktionen in der Gesellschaft sinnvoll und umfassend wahrzunehmen. Die Wirkung, die sie dabei auf ihr Publikum und auf die gesellschaftlichen Akteure, über die sie berichten, im allgemeinen haben, wandelt sich ständig. Insbesondere haben sich die Beziehungen zwischen Medien und Politik im Laufe der Zeit verändert: Wurden die Medien traditionell lediglich als ein Vermittlungsinstrument zwischen Bevölkerung und staatlichen oder anderen Organisationen angesehen, stellen sie heute Akteure dar, die direkt oder indirekt auf die Handlungen ihrer Umwelt Einfluss nehmen. So spricht Oberreuter inzwischen von einem Prozess der Mediatisierung31 der Gesellschaft. Damit umschreibt er eine Entwicklung, in deren Verlauf sich Politiker und Vertreter anderer gesellschaftlicher Organisationen zunehmend den Regeln und der Funktionsweise des Mediensystems unterwerfen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Da visualisierte und personalisierte politische Handlungen von den Medien bevorzugt würden, passe sich die Politik dieser Gegebenheit an. Politische Handlungen und Argumente seien unwichtiger als die Frage, ob ein politischer Akteur beim Publikum gut oder schlecht ankomme. Infolgedessen beginne nicht nur die politische Seriosität, sondern auch ein „präziser Politikbegriff“ überhaupt, sich aufzulösen32. 29 Kepplinger: Massenkommunikation (1982), S. 55. Deutscher Presserat: Publizistische Grundsätze in der Fassung von 1996, einzusehen unter: www.presserat.de/site/pressekod/kodex/index.shtml 31 Vgl. Oberreuter: Mediatisierte Politik und politischer Wertwandel (1989), S. 36. 32 Vgl. ebd., S. 37f. 30 13 Als Ergebnis dieser Mediengesellschaft33 Entwicklung gesprochen. wird Darunter in der Literatur oft versteht Ulrich Saxer von einer „moderne Gesellschaften [...], in denen Medienkommunikation [...] eine allgegenwärtige und alle Spähren des gesellschaftlichen Seins durchwirkende Prägekraft entfaltet“34. Merkmale für eine solche Mediengesellschaft sieht Jarren darin, dass sich die Medien immer weiter ausbreiten und immer engmaschiger die gesamte Gesellschaft durchdringen, die Informationsvermittlung sich enorm beschleunigt und sich neue Medientypen herausbilden und dass die Medien selbst als Akteure eine hohe Aufmerksamkeit beanspruchen und sich letztlich zu Institutionen entwickeln35. Ein wichtiger Grund für die Mediatisierung ist die große Reichweite der Massenmedien allgemein und insbesondere des Fernsehens. Laut Medienbericht der Bundesregierung lag die Gesamtreichweite tagesaktueller Medien im Jahr 1995 bei 97 Prozent. Das Fernsehen erreichte dabei täglich 83 Prozent der Bevölkerung36. Hinzu kommt eine rasante Entwicklung der Internet- und Onlinemedien in den letzten Jahren. So stieg die Zahl der Internetnutzer zwischen 1997 und 2001 von rund vier auf knapp 39 Prozent der Bevölkerung37. Dieser hohe Verbreitungsgrad der Medien hat zur Folge, dass gesellschaftliche und politische Ereignisse für einen Großteil der Bevölkerung erst durch die Medien wahrnehmbar werden. „Was nicht in der Hauptsendezeit läuft, gelangt häufig nicht ins Bewußtsein der Bürger“38. Als weiterer Grund kann die Ökonomisierung des Mediensystems angesehen werden. Im Gegensatz zu den Printmedien waren Rundfunk und Fernsehen bis in die 1980er Jahre staatlich reguliert. Erst als neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch privatwirtschaftliche zugelassen wurden, erhielt das Marktprinzip auch in diesem Bereich Einzug. Mit der fortschreitenden Europäischen Integration wurden Unternehmensverflechtungen im Medienbereich auch über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus möglich und verstärkten diese Entwicklung. Durch die technische Entwicklung entstanden darüber hinaus immer mehr Sendeplätze, so dass weitere private Sendeanstalten ihr Programm anbieten konnten. Die Folge dieser Ökonomisierung ist eine stärkere Orientierung der Medien 33 Vgl. Jarren: Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit im Wandel (1998); Saxer: Mediengesellschaft (1998). 34 Saxer: Mediengesellschaft (1998), S. 53. 35 Vgl. Jarren: Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit im Wandel (1998), S. 74. 36 Vgl. Bericht der Bundesregierung über die Lage der Medien in der Bundesrepublik Deutschland 1998. 37 Vgl. Eimeren/Gerhard/Frees: ARD/ZDF Online-Studie (2001), S. 383. 38 Meyn: Massenmedien in Deutschland (1999),S. 337. 14 an Werbemarkt- und Publikumsinteressen zu Lasten von Vermittlungsinteressen gesellschaftlicher Organisationen und politischer Akteure39. Es lassen sich noch andere Gründe für die Mediatisierung und die Entwicklung hin zu einer Mediengesellschaft nennen: So sieht etwa Kepplinger in der Verbesserung der Allgemeinbildung eine Voraussetzung für ein gesteigertes Interesse am aktuellen Geschehen und in Folge dessen eine verstärkte Mediennutzung40. Alle angeführten Gründe haben dabei die Konsequenz, dass der Einfluss der Massenmedien auf die Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen ist und diese Entwicklung noch immer anhält. Die Folge ist, dass das Publikum die Realität in zunehmenden Maß durch die Medien erfährt. Insbesondere dem Fernsehen schreibt Jarren eine „überragende soziokulturelle Position“ zu und bezeichnet es daher, wie auch Sarcinelli, als „Leitmedium“41. Meyer spricht sogar von der „Visualisierung der sozialen Kommunikationsgewohnheiten“. Die Bilder im Fernsehen wirkten wie „unvermittelte Elemente der objektiven Welt selbst“42. Dem Publikum ist dabei häufig nicht bewusst, dass die gesendeten Bilder genau wie die Berichterstattung der Printmedien einer Selektion durch die Redakteure unterworfen sind und nicht ein bloßes Abbild der Wirklichkeit darstellen. „Mit dem Wachstum massenmedialer Kommunikation kennt die Bevölkerung in der öffentlichen Sphäre eine eigene, manchmal nur eine einzige Realität, die massenmediale Realität“43. 2.1.4 Anpassung der Politik an die Regeln der Medien Die Mediatisierung der Gesellschaft beeinflusst vor allem das Verhältnis zwischen Politik und Medien. War der politische Journalismus ursprünglich Bestandteil der politischen Interessenvermittlung, entwickelte er sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem autonomen Gegenpol zur Politik44: Medien und Politik bildeten zwei klar voneinander getrennte Systeme, die jedoch gleichzeitig voneinander abhängig waren. So waren die Medien auf Informationen aus der Politik angewiesen, um über sie berichten und auf diese Weise ihrer Informationsfunktion nachkommen zu können. Die Politik wiederum benötigte die Medien, um der Öffentlichkeit ihre jeweiligen Handlungen und Entscheidungen bekannt zu machen und sich so 39 Vgl. Jarren: Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit im Wandel (1998), S. 79f. Vgl. Kepplinger: Die Demontage der Politik in der Informationsgesellschaft (1998), S. 37. 41 Jarren: Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit im Wandel (1998), S. 84; Sarcinelli: Parteien und Politikvermittlung (1998), S. 284. 42 Vgl. Meyer: Die Transformation des Politischen (1994), S. 134. 43 Kamps: Politik in Fernsehnachrichten (1999), S. 26 44 Vgl. Altmeppen/Löffelholz: Zwischen Verlautbarungsorgan und „vierter Gewalt“ (1998), S. 97. 40 15 politische Legitimation zu verschaffen45. Doch auch diese Vorstellung von einem Dualismus zwischen Medien und Politik entspricht längst nicht mehr der Realität und wurde vom Prozess der Mediatisierung überholt. Je mehr die Medien an Verbreitung gewannen, desto abhängiger wurde der Erfolg von Politikern von deren Berichterstattung. Zu beobachten sind daher zunehmend „Machtverlagerungen zugunsten der Massenmedien und zu Ungunsten des Systems politischer Herrschaft“46. Jarren sieht zudem in der abnehmenden „gesamtgesellschaftlichen Bindungsstärke und Integrationsfähigkeit“ anderer gesellschaftlicher und politischer Akteure einen Grund für die stärker werdenden Einflussmöglichkeiten der Massenmedien47. Durch die Ausweitung ihres Einflusses wirken die Massenmedien daher immer stärker an der Gestaltung der öffentlichen Meinung und damit auch an der politischen Willensbildung der Bevölkerung mit. Beide Aufgaben sind in der Bundesrepublik Deutschland jedoch traditionell vor allem den politischen Parteien zugedacht (Vgl. Art. 21 Abs. 1 GG, § 1 Abs. 1,2 Parteiengesetz). Hinzu kommt, dass Klingemann und Wattenberg bereits 1990 in der Bevölkerung eine „Abschwächung der psychologischen Bindung an die etablierten politischen Parteien“48 festgestellt haben. Dies hat zur Folge, dass die Parteien bei der Wahrnehmung ihrer politischen Willensbildungsfunktion zunehmend auf die Berichterstattung der Medien angewiesen sind. So kommt auch Brettschneider zu dem Schluss, dass Massenmedien für die Politikvermittlung heute von größerer Bedeutung sind als direkte Gespräche zwischen Vertretern der Parteien und den Bürgern49. Die Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass die politischen Akteure ihre kommunikative Infrastruktur den medialen Gegebenheiten anpassen müssen, wenn sie Ihre spezifischen Interessen an die Öffentlichkeit bringen wollen. Die Vermittlung von Inhalten nach außen wird verstärkt in die Hände von PR-Agenturen gelegt, Informationen werden den Medien veröffentlichungsbereit zugespielt und die gesamte Außenkommunikation wird professionalisiert50. Gerade mit Blick auf die wichtige Rolle, die das Fernsehen für die Vermittlung von Ereignissen inzwischen hat, achten 45 Politiker dabei verstärkt Vgl. ebd., S. 101. Schulz: Politische Kommunikation (1997), S. 25. 47 Vgl. Jarren: Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit im Wandel (1998), S. 85. 48 Klingemann/Wattenberg: Zerfall und Entwicklung von Parteiensystemen (1990), S. 330. 49 Vgl. Brettschneider: Kanzlerkandidaten im Fernsehen (2002), S. 264. 50 Vgl. Jarren: „Mediengesellschaft“ (2001), S. 16. 46 16 auf die Medienwirksamkeit ihrer Auftritte und Handlungen. Darüber hinaus lassen sich komplizierte politische Sachverhalte im Fernsehen vereinfacht darstellen, um ein größeres Publikum zu erreichen: „Die Personifizierung eines Problems ist ein üblicher Weg, um Aufmerksamkeit zu erzeugen“51. Die Folgen sind die Inszenierung symbolischer Politik, Durchführung von sogenannten Pseudoereignissen und eine verstärkte Konzentration auf die politischen Akteure statt auf Themen und Inhalte. Meyer spricht von der „Inszenierung des Scheins“. Herstellung von Politik werde im Hinblick auf die Wirkungsmacht der Nachrichtenfaktoren kalkuliert. Das politische Produkt erschöpfe sich in seiner reinen Darstellung, die die Vorstellung der Bürger in Dienst nehme. Er konstatiert: „Schaupolitik ist zu einer eignen [...] dominierenden Form politischer Kommunikation geworden“52. Eine ähnliche Sichtweise auf die Entwicklung haben Dörner und Vogt, wenn sie davon sprechen, dass der sichtbare Teil der Politik zu einer „professionell inszenierten Dauerwerbesendung gerate“ 53. Zwar gibt es auch Stimmen, die diese Perspektive nicht teilen. So weist der Wahlkampfmanager der SPD im Bundestagswahlkampf 2002, Matthias Machnig, darauf hin, dass Politik nur wenig Kontrolle über das habe, was andere von ihr wahrnehmen und betont, dass Personen und Inhalte unauflöslich miteinander verbunden seien54. An der Tatsache, dass sich Politik heute verstärkt an den Regeln der Massenmedien orientiert, besteht indes allerdings kein Zweifel. 2.1.5 Bedeutung der Medien für den modernen Wahlkampf Unter Wahlkampf wird im permanenten Wettbewerb der Parteien diejenige zeitliche Phase verstanden, in der vor allem die Parteien und die von ihnen aufgestellten Kandidaten verstärkt inhaltliche, organisatorische und kommunikative Anstrengungen unternehmen, um Wähler zu mobilisieren und deren Stimmen für sich zu gewinnen. Wenn die Massenmedien bereits im politischen Alltagsgeschehen eine herausragenden Stellenwert besitzen, werden sie für die Parteien daher vor allem in Wahlkampfzeiten zu einem unverzichtbaren Transportmittel und Multiplikator für ihre politischen Botschaften. Die Funktionen des Wahlkampfes lassen sich in Information, Identifikation und Mobilisierung unterscheiden55. Der Bürger muss über Wahlprogramme und die 51 Hoffmann-Riem: Politiker in den Fesseln der Mediengesellschaft (2000),S. 117. Meyer: Die Transformation des Politischen (1994), S. 137. 53 Dörner/Vogt: Der Wahlkampf als Ritual (2002), S. 15. 54 Vgl. Machnig: Politische Kommunikation in der Mediengesellschdaft (2002), S. 146. 55 Vgl. Woyke: Stichwort: Wahlen (1998), S. 106f. 52 17 politischen Ziele der Parteien informiert werden. Gleichzeitig bietet der Wahlkampf mit seiner intensiven Außendarstellung von Politikinhalten Anhängern und Mitgliedern verstärkt Gelegenheit, sich mit einer bestimmten Partei zu identifizieren und sich gegenüber anderen abzugrenzen. Schließlich sollen Parteianhänger und andere Wähler mobilisiert werden, um die jeweilige Partei aktiv zu unterstützen, oder ihr am Wahltag die Stimme zu geben. Für die Erfüllung dieser drei Funktionen sind die Parteien auf die Leistungen der Massenmedien angewiesen. Zudem weisen Dörner und Vogt darauf hin, dass nur wenige Bürger die Wahlprogramme der Parteien lesen oder anhand der vorangegangenen Legislaturperiode die Leistungen und Misserfolge der Parteien genau analysieren und bei der Wahlentscheidung gegeneinander abwägen. „Stattdessen wirken hier oft Stimmungen, Medienkampagnen, Personen und ihre professionell inszenierte Ausstrahlung“56. Die Vermittlungsleistung der Massenmedien erhält vor diesem Hintergrund nochmals eine größere Bedeutung. Dabei kommen für die Parteien im Wahlkampf grundsätzlich zwei Formen der Mediennutzung in Frage. Unter dem Begriff Paid Media können sämtliche Formen bezahlter Wahlwerbung gezählt werden. Dazu gehören etwa Wahlwerbespots, Plakate oder Anzeigen in den Printmedien. Eine wesentlich höhere Bedeutung kommt jedoch der Berichterstattung im redaktionellen Bereich der Medien, der Free Media, zu. Diese Form bietet den Parteien die Gelegenheit zur kostenlosen Selbstdarstellung und damit zur Wahlkampfwerbung in den Medien57. Wie die Parteien im einzelnen versuchen, die Formen der Paid und Free Media zu nutzen, wird weiter unten (siehe 4.3) gezeigt. 2.2 Systemunterschiede zwischen den USA und der BRD 2.2.1 Politische Unterschiede Das jeweilige politische System eines Landes stellt die notwendigen Rahmenbedingungen für den Wahlkampf. Will man den Bundestagswahlkampf auf seine „Amerikanisierung“ hin untersuchen, ist daher ein Vergleich zwischen den politischen Systemen der BRD und der USA unerlässlich. Für eine ausführliche systematische Darstellung dieser Unterschiede reicht jedoch der Rahmen dieser Arbeit bei weitem nicht aus. Daher werden im Folgenden lediglich diejenigen 56 Dörner/Vogt: Der Wahlkampf als Ritual (2002), S. 21. 18 Merkmale des jeweiligen politischen Systems erörtert, die für den Wahlkampf und damit für den Begriff der „Amerikanisierung“ relevant sind. Dazu zählen im wesentlichen drei Aspekte: a) die unterschiedlichen Regierungssysteme, b) die Wahlsysteme sowie c) die Rolle der politischen Parteien. Es soll gezeigt werden, welche Voraussetzungen für den Wahlkampf sich aus den Systemunterschieden ergeben. a) Die Regierungssysteme Wie in den meisten Rahmenbedingungen europäischen in der Staaten entsprechen Bundesrepublik dem die politischen parlamentarischen Regierungssystem. Dies bedeutet konkret, dass auf Bundesebene der Bundestag das einzige Staatsorgan ist, das unmittelbar vom Volk gewählt wird. Die übrigen Organe verfügen demzufolge lediglich über eine abgeleitete Legitimation. So obliegt etwa die Wahl des Bundeskanzlers den Abgeordneten des Bundestages. Jener schlägt die Regierungsmitglieder vor, die vom Bundespräsidenten ernannt werden (Vgl. Art. 64 Abs. 1 GG). Anders als in den USA kann sich also ein Kandidat für das Amt des Regierungschefs nicht direkt der Bevölkerung zur Wahl stellen, sondern zunächst höchstens als Bewerber um ein Mandat als Bundestagsabgeordneter. Diese Regelung ließe vermuten, dass es zunächst keinen Bewerber gibt, der eine zentrale Rolle im Wahlkampf spielt. In der Realität bestimmen jedoch zumindest diejenigen Parteien, die die größten Chancen auf den Wahlsieg haben, frühzeitig einen Kanzlerkandidaten, mit der Absicht, ihn zum Regierungschef zu wählen, falls ihre Fraktion die Mehrheit im Bundestag stellen sollte. Die Aufstellung eines Kanzlerkandidaten ist allerdings weder im Grundgesetz noch im Parteiengesetz vorgesehen, sondern erfolgt allein auf die Eigeninitiative der Parteien hin. Die Folge für den Wahlkampf ist, dass der Kanzlerkandidat meistens im Mittelpunkt der Wahlwerbung seiner Partei steht, obwohl er nicht direkt gewählt werden kann. Demgegenüber existiert in den USA ein Präsidialsystem58. Dies bedeutet, dass neben den beiden Kammern des Kongresses, die auf zwei (Repräsentantenhaus) 57 Vgl. Fengler/Jun: Kopie der Kampa im neuen Kontext (2003), S. 174. Shell lehnt der Begriff „Präsidialsystem“ ab, da er die Wechselbeziehung zwischen Exekutive und Legislative verschleiere. Vgl. Shell: Das politische System – Kongreß und Präsident (1998), S. 207. Da an dieser Stelle keine Begriffsanalyse durchgeführt werden kann und der Begriff geeignet ist, die 58 19 beziehungsweise vier Jahre (Senat) direkt von der Bevölkerung gewählt werden, auch der Präsident als Staatsoberhaupt und Chef der Exekutive vom Volk bestimmt wird. Formal handelt es sich dabei lediglich um eine indirekte Wahl, da von den Bürgern in den einzelnen Bundesstaaten zunächst Wahlmänner bestimmt werden, die wiederum ihre Stimme für einen Präsidentschaftskandidaten abgeben. Diese Regelung ist durch die Annahme der amerikanischen Verfassungsväter begründet, dass aufgrund des erforderlichen Urteilsvermögens bei der Wahl des Staatsoberhauptes „die direkte Wahl von Männern vorgenommen wird, die besonders befähigt sind zur Beurteilung der für den Rang des Amtes nötigen Eigenschaften“59. Heute gehören die Wahlmänner allerdings in der Regel einer der beiden großen Parteien an und sind damit faktisch verpflichtet, für den von ihrer Partei nominierten Kandidaten zu stimmen. Die Präsidentenwahl kommt damit einer direkten Wahl sehr nahe. So sieht auch Wasser eine Entwicklung hin zu einer „faktischen Volkswahl“60. Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland ergibt sich also die zentrale Rolle, die der Kandidat für das Amt des Regierungschefs im Wahlkampf spielt, in den USA zwangsläufig aus dem politischen System. b) Die Wahlsysteme Um die Wählerstimmen in Parlmentsmandate umzurechnen, sind zwei Verfahren denkbar: das Verhältniswahlsystem und das Mehrheitswahlsystem. Beide führen zu unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen im Parlament. Während in ersterem auch kleine Parteien ihrem Stimmenanteil entsprechend Mandate erhalten, begünstigt letzteres große Parteien und führt in der Regel zu klaren Mehrheiten im Parlament. Beide Wahlsysteme haben Vor- und Nachteile. So spiegelt das Verhältniswahlsystem den politischen Willen der Wählerschaft korrekter in der Zusammensetzung des Parlaments wider. Gleichzeitig kann es aber auch leicht zu einer Zersplitterung der Parteienlandschaft kommen, Regierungsbildungen sind falls daher keine Sperrklausel meistens vorgesehen Koalitionen ist. notwendig. Für Das Mehrheitswahlsystem dagegen bringt stabile Mehrheiten hervor. Normalerweise sind in einem solchen System nur zwei Parteien im Parlament vertreten. Der Nachteil liegt bei diesem Verfahren darin, dass kleine Parteien und Gruppen kaum eine Chance haben, ihre politischen Vorstellungen in die parlamentarische Debatte einzubringen. Abgrenzung zum parlamentarischen System zu veranschaulichen, wird er in dieser Arbeit dennoch verwendet. 59 Hamilton: Die Federalist Papers. Artikel 68 zitiert in: Adams: Die Federalist-Artikel (1994), S. 411. 20 Die Konsequenzen, die sich aus den unterschiedlichen Wahlsystemen ergeben, haben auch Folgen für den jeweiligen Wahlkampf. Das konkrete Wahlverfahren wird in der Bundesrepublik Deutschland nicht durch das Grundgesetz sondern durch das Bundeswahlgesetz bestimmt (Vgl. Art. 38 Abs. 1, 3 GG). Es entspricht im Prinzip der Verhältniswahl. Zwar haben die Wähler mit der Erststimme die Möglichkeit, die Hälfte der Abgeordneten im Parlament direkt zu bestimmen. Diese Stimme entscheidet aber lediglich über die personelle Zusammensetzung des Bundestages, nicht über die Mehrheitsverhältnisse an sich. Diese werden allein auf Grundlage des Anteils der Zweitstimmen, die eine Partei auf sich vereinigen kann, ermittelt. Abgeordneten, die nicht direkt gewählt werden, ziehen über die von den Parteien erstellten Landeslisten ins Parlament ein. Das Bundeswahlgesetz spricht daher von „einer mit der Personalwahl verbundenen Verhältniswahl“ (§ 1 Abs. 1 Bundeswahlgesetz). Nur wenn in einem Bundesland mehr Kandidaten einer Partei durch die Erststimme gewählt werden als ihr nach dem Anteil der Zweitstimmen zusteht, hat auch die Erststimme einen kleinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments. Diese Abgeordneten können dann auf der Basis von Überhangmandaten zusätzlich in den Bundestag einziehen. Um der bereits erwähnten Gefahr einer Zersplitterung der Parteienlandschaft vorzubeugen, ist eine Sperrklausel von fünf Prozent vorgesehen. Dies bedeutet, dass nur diejenigen Parteien Sitze im Bundestag erhalten, die mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen auf sich vereinigen können. Lange Zeit führte diese Regelung dazu, dass nur drei Parteien im Parlament vertreten waren. Erst 1983 wurde mit den Grünen erstmals seit 1957 wieder eine vierte Partei in den Bundestag gewählt. Nach der Wiedervereinigung kam 1990 die PDS dazu, die gegenwärtig jedoch nur mit zwei Abgeordneten, die durch die Erststimme direkt gewählt wurden, vertreten ist. Aufgrund mehrerer im Bundestag vertretener Parteien ist es unwahrscheinlich, dass eine Partei die absolute Mehrheit der Sitze erlangt. Zur Wahl des Bundeskanzlers und damit auch zur Bildung einer Regierung sind daher regelmäßig Koalitionen von mindestens zwei Parteien notwendig. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hat bisher auch noch keine Partei alleine die Regierung gestellt. 60 Wasser: Institutionen im politischen System (1997), S. 8. 21 Die Tatsache, dass eine Koalitionsbildung mit hoher Wahrscheinlichkeit notwendig ist, hat Konsequenzen für die Wahlkampfführung. Parteien mit ähnlichen politischen Vorstellungen und Ideen sehen ineinander oft schon früh einen potenziellen Koalitionspartner. So Angriffswahlkampf in verbietet sich etwa ein allzu hart ausgetragener Richtung eines möglichen Regierungspartners. Auf der anderen Seite stehen auch Parteien mit ähnlichen Werten in Konkurrenz um die Zweitstimme der Wähler, so dass die Parteien eher versucht sein werden, sich zu profilieren und voneinander abzugrenzen anstatt einen gemeinsamen Lagerwahlkampf zu führen. Trotz seines geringfügigen Einflusses auf die Anzahl der Mandate hat auch das Element der Personalwahl, das im bundesdeutschen Wahlsystem vorgesehen ist, Folgen für den Wahlkampf. So müssen die Bewerber, die als Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis antreten, nicht nur für das Programm ihrer Partei werben, sondern auch versuchen, sich selbst als Person gegenüber den Bewerbern aus den konkurrierenden Parteien zu profilieren. Auch in den USA gibt die Verfassung lediglich Rahmenbedingungen für die Wahl von Kongress und Präsident vor. Die genauen Bestimmungen werden von den Bundesstaaten festgelegt (Vgl. Art. 1 Abschnitt 4 u. Art. 2 Abschnitt 1 der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika). Generell entsprechen die Wahlen jedoch dem Prinzip der Mehrheitswahl. Die Bevölkerung jedes Bundesstaates wählt mindestens drei Abgeordnete in den Kongress. Alle sechs Jahre wählen die Bürger jedes Staates zwei Senatoren in den Senat sowie alle zwei Jahre, abhängig von der Einwohnerzahl, mindestens einen Abgeordneten in das Repräsentantenhaus. Die Bewerber stellen sich dabei direkt den Wählern. Kandidatenlisten der Parteien existieren nicht. Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann, ist gewählt. Die Wahlkämpfe vor den Wahlen zum amerikanischen Kongress müssen daher von vornherein mehr auf die zur Wahl stehenden Bewerber konzentriert sein, als dies beim Verhältniswahlsystem der Fall ist. Darüber hinaus müssen Parteien und Kandidaten nicht auf potenzielle Koalitionspartner Rücksicht nehmen. Dies liegt zum einen daran, dass das Mehrheitswahlsystem die Herausbildung eines Zweiparteiensystems begünstigt. So sind in den USA lediglich Anhänger der Demokraten und Republikaner im Kongress vertreten. Es gibt zwar noch andere Parteien. Diese spielen jedoch auf Bundesebene keine Rolle. Zum 22 anderen werden die Mitglieder der Regierung durch den Präsidenten ernannt, so dass es dabei nicht auf die Stimmenmehrheit im Kongress ankommt. Auch die Wahl des Präsidenten erfolgt entsprechend der Mehrheitswahl. Dies resultiert natürlich zum einen aus der Tatsache, dass eben nur ein Amt zu vergeben ist. Zum anderen kann jedoch ein Bundesstaat die Stimmen seiner Wahlmänner nur geschlossen abgeben. Dies bedeutet, dass sämtliche Wahlmännerstimmen eines Staates für denjenigen Kandidaten abgegeben werden, der dort die Mehrheit erzielt. Die Stimmen, die auf den Gegenkandidaten entfallen, werden nicht berücksichtigt. Dieses Verfahren kann im Extremfall dazu führen, dass ein Kandidat aufgrund der Mehrheit der Wahlmännerstimmen zum Präsidenten gewählt wird, obwohl er nicht die Mehrheit der abgegebenen Wählerstimmen erhalten hat. Da jeder Bundesstaat so viele Wahlmänner hat, wie er Abgeordnete in den Kongress entsendet, sind die Präsidentschaftskandidaten vor allem daran interessiert, die bevölkerungsstärksten Bundesstaaten für sich zu gewinnen. Für die Wahlkampfführung bedeutet dies, dass in diesen Staaten „die Kandidaten in den letzten Wochen vor der Wahl ihre Ressourcen massieren“61, um ihre Chancen zu verbessern. c) Die politischen Parteien Politische Parteien spielen in modernen Demokratien eine bedeutende Rolle bei der Wahl legitimierter Regierungen. Ihre Funktionen lassen sich im wesentlichen in fünf Punkten umreißen62: - Zielfindungsfunktion - Artikulation und Aggregation gesellschaftlicher Interessen - Regierungsbildung - Mobilisierung der Bürger - Rekrutierung von Eliten Der Stellenwert der einzelnen Aufgaben kann dabei in unterschiedlichen Staaten variieren. Relevant für die Wahlkampfführung sind jedoch generell vor allem die beiden zuletzt genannten Funktionen. In der Bundesrepublik Deutschland haben die politischen Parteien eine außerordentliche Bedeutung im politischen Prozess. So betont das Grundgesetz 61 Wasser: Politische Parteien und Wahlen (1998), S. 328. 23 ausdrücklich die Gründungs- und Betätigungsfreiheit der politischen Parteien (Vgl. Art. 21 Abs. 1 GG). Damit nehmen sie den Rang einer „verfassungsrechtlichen Institution“63 ein. Das Grundgesetz regelt jedoch nur die Rahmenbedingungen. Die konkreten Aufgaben, die von den Parteien wahrgenommen werden sollen, sind im Wahlgesetz und im Parteiengesetz näher bestimmt. Vor allem letzteres beinhaltet einen breiten Aufgabenkatalog. Für den Wahlkampf sind dabei vor allem zwei Funktionen wichtig: die Mobilisierungs- und die Rekrutierungsfunktion. Die Mobilisierungsfunktion ergibt sich aus der Bestimmung, dass die politischen Parteien „die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern“ (§ 1 Abs. 2 Parteiengesetz) sollen. Die Mobilisierung der Bürger zur Teilnahme am politischen Prozess ist zwar nicht nur im Wahlkampf eine wichtige Aufgabe der Parteien. Sie gewinnt allerdings in dieser Zeit einen besonders hohen Stellenwert, geht es doch um die Legitimation der politischen Macht und damit um das Herzstück eines demokratischen Regierungssystems. Die Parteien selbst sind an der Mobilisierung der Bürger interessiert, da sie einen hohen Stimmenanteil und in Folge dessen möglichst viele Mandate und damit eine einflussreiche Stellung im Parlament anstreben. Wie erfolgreich die Parteien bei der Wahrnehmung ihrer Mobilisierungsfunktion sind, hängt wesentlich von den Methoden ab, die sie zu diesem Zweck anwenden. Diese sind indes nicht vorgeschrieben. Parteien könnten daher im Wahlkampf leicht der Versuchung erliegen, mit Hilfe populärer Wahlversprechen und grober Vereinfachung der politischen Argumentation, die Zustimmung der Bevölkerung zu gewinnen. Wenn die Anwendung solcher Mittel überhand nimmt, besteht die Gefahr einer „allgemeinen Entpolitisierung“64. Durch die Heranbildung von Bürgern, die in der Lage sind, „öffentliche Verantwortung“ (§ 1 Abs. 2 Parteiengesetz) zu übernehmen und deren Aufstellung zu Wahlen, nehmen die Parteien die Aufgabe der Rekrutierung von Eliten wahr. Bei der Kandidatenaufstellung verfügen die Parteien damit im Prinzip über eine Monopolstellung. Ein unabhängiger Bewerber, der nicht die Unterstützung einer Partei besitzt, hat kaum Aussicht darauf gewählt zu werden. Der Entscheidungsspielraum der Wähler über die personelle Zusammensetzung des Bundestages wird damit stark eingeschränkt. Durch Aufstellung von Kandidaten und deren Platzierung auf den Landeslisten können die Parteien bereits eine 62 Vgl. Woyke: Stichwort Wahlen. S. 90.; Wasser: Politische Parteien und Wahlen, (1998), S. 315. Andersen/Woyke: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland (2000), S. 444f. 63 24 Vorentscheidung darüber treffen, wer mit Sicherheit in den Bundestag gewählt wird. Darüber hinaus wird in vielen Wahlkreisen traditionell eine bestimmte Partei gewählt, so dass dort auch durch die Vergabe der Erststimme selten der Kandidat einer anderen Partei die Mehrheit gewinnt. Die Konsequenz ist, dass „in dem Moment, in dem die Parteien ihre Kandidaten gekürt haben, [...] die personelle Zusammensetzung des Bundestages weitgehend vorprogrammiert“65 ist. Selbst bei einer abnehmenden psychologischen Bindung der Bevölkerung an eine bestimmte Partei, wie sie Klingemann und Wattenberg feststellen66, spielen die politischen Parteien in der Bundesrepublik also aufgrund der Rekrutierungsfunktion eine wesentliche Rolle im politischen Prozess. Damit liegt auch die Wahlkampfführung in erster Linie bei den Parteien anstatt bei den einzelnen Kandidaten selbst. Wer durch eine gute Position auf einer Landesliste abgesichert ist, muss im Wahlkampf weniger stark für sich werben, als wenn seine Wahlchancen allein von seiner persönlichen Wahlkampfführung abhinge. In der amerikanischen Verfassung ist die Funktion politischer Parteien zwar nicht vorgesehen. Ihre gesellschaftlichen Aufgaben werden auch nicht durch unterrangige Gesetze bestimmt. Sie sind aber dennoch von großer Bedeutung im politischen Kommunikationsprozess der USA. Anders als in Deutschland spielten jedoch ideologische oder soziologische Prinzipien bei der Bildung der US-Parteien kaum eine Rolle. In einer stark heterogenen Gesellschaft, wie sie in den USA schon immer existierte, entstanden Parteien vielmehr als zweckmäßige Zusammenschlüsse einzelner Interessengruppen mit dem Ziel, Mehrheiten für die Übernahme öffentlicher Ämter zu gewinnen67. Dies ist auch bis heute ihre wichtigste Aufgabe geblieben. So sieht Wasser die US-Parteien als „Instrumente der Herrschaftsorganisation, der Rekrutierung politischen Führungspersonals, der Organisation von Wahlen und des Zusammenfügens disparater Interessen“68. Damit würden sie vorrangig Wahl- und Kandidatenrekrutierungsfunktionen übernehmen, während die Zielfindungsfunktion vernachlässigt wird. Pfetsch sieht die politischen Parteien in den USA sogar „auf technische Funktionen von Wahlkampfmaschinen reduziert“69. 64 Backes/Jesse: Parteien, Wahlrecht und Wahlen (1996), S. 37. Woyke: Stichwort Wahlen (1998), S. 94. 66 Vgl. Klingemann/Wattenberg: Zerfall und Entwicklung von Parteiensystemen (1990). 67 Wasser: Politische Parteien und Wahlen (1998), S. 306f. 68 Ebd., S. 316. 69 Pfetsch: „Amerikanisierung“ der politischen Kommunikation? (2001), S. 29. 65 25 Die Rekrutierung folgt in den USA jedoch einem anderen Prinzip als in Deutschland: Demokraten und Republikaner haben bei der Kandidatenaufstellung keine Monopolstellung wie die Parteien in der Bundesrepublik. Das Mitspracherecht der Bürger ist daher entsprechend größer. Dies liegt vor allem daran, dass in den meisten Bundesstaaten in Vorwahlen, den sogenannten Primaries, über die Aufstellung der Kandidaten abgestimmt wird70. Dies gilt sowohl für Parlaments- als auch für Präsidentschaftskandidaten. In vielen Bundesstaaten müssen sich die Bürger lediglich entscheiden, ob sie an der Primary der Demokraten oder der Republikaner teilnehmen wollen, um einen Kandidaten zu küren. Einige Bundesstaaten halten auch Closed Primaries ab. Dabei müssen die Bürger formal erklären, dass sie in der anschließenden Kongress- oder Präsidentschaftswahl tatsächlich für den Kandidaten der jeweiligen Partei stimmen werden. Bei Präsidentschaftswahlen stehen die in den Vorwahlen ermittelten Kandidaten dann erneut bei einem nationalen Parteikonvent zur Wahl. Welche Delegierten auf diesem Konvent abstimmen dürfen, wird ebenfalls in vielen Fällen dem Wählervotum in den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Obwohl die einzelnen Verfahren der Kandidatennominierung stark variieren können, ist der Unterschied zur einheitlichen Praxis in der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich. Die Bedeutung, die den nominierten Kandidaten aufgrund des Mehrheitswahlrechts zukommt, hat auch Konsequenzen für die Wahlkampfführung der Parteien. So obliegt ihnen in erster Linie die Organisation und Durchführung der unterschiedlichen Primaries und Konvente sowie die Aufbringung der dafür erforderlichen finanziellen Mittel. Für die Mobilisierung der Wähler sind jedoch in erster Linie die Kandidaten selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die Vorwahlen, in denen sich die Bewerber noch nicht der Unterstützung der gesamten Partei sicher sein können. Auch bei den anschließenden Kongress- und Präsidentschaftswahlen können die Kandidaten zwar auch auf die Unterstützung der Parteien zurückgreifen. Für ihre Wahlkampfführung sind sie jedoch selbst verantwortlich. 70 Die Regelungen über die Kandidatenaufstellungen sind den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Die politische Praxis bei der Durchführung von Vorwahlen variiert daher oft sehr stark. In wenigen Staaten werden die Kandidaten auch noch durch ein Caucus- oder Conventionverfahren bestimmt, bei dem die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen bleibt. Die einzelnen Regelungen umfassend darzustellen, ist deswegen in dieser Arbeit nicht möglich. Es soll jedoch deutlich werden, dass sich die Kandidatennominierung in den USA von der Praxis in der Bundesrepublik Deutschland wesentlich unterscheidet. 26 Bereits dieser knappe Überblick über die politischen Gegebenheiten verdeutlicht, dass die Voraussetzungen für Wahlkämpfe in der Bundesrepublik Deutschland und den USA sehr unterschiedlich sind. Es ist daher fraglich, inwieweit der Begriff „Amerikanisierung“ für die Beschreibung der Entwicklung von Wahlkämpfen in Deutschland anwendbar ist. Auf diese Frage wird weiter unten (siehe 3.2) näher einzugehen sein. Zunächst sollen jedoch die Unterschiede im medialen System der beiden Länder dargestellt werden. 2.2.2 Mediale Unterschiede In modernen Demokratien sind die Massenmedien unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Wahlkampfführung. Die rechtlichen Grundlagen, auf denen Existenz und Arbeit der Medien in der Bundesrepublik Deutschland basieren, wurden bereits dargestellt. Auch in den USA ist das Recht auf freie Meinungsäußerung und damit auch auf ein unabhängiges Mediensystem in der Verfassung verankert: „Der Kongreß darf kein Gesetz erlassen, das [...] die Rede- oder Pressefreiheit [...] einschränkt“ (1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika). Dennoch gibt es zum Teil deutliche Unterschiede in den Mediensystemen der beiden Staaten, die die jeweiligen Wahlkämpfe beeinflussen können. Dies gilt insbesondere im Bereich von Rundfunk und Fernsehen. Darüber hinaus lassen sich auch Unterschiede in der Kommunikationskultur feststellen. Während in der Bundesrepublik die Printmedien vorwiegend privatwirtschaftlich organisiert sind, existiert im Rundfunkbereich ein Duales System aus privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sind unabhängig von staatlicher Kontrolle und finanzieren sich überwiegend durch Gebühren. Ein Rundfunkrat, der sich aus Mitgliedern gesellschaftlich relevanter Gruppen zusammensetzt, soll eine Selbstkontrolle hinsichtlich Ausgewogenheit, Unparteilichkeit und Objektivität der Sender gewährleisten71. Die seit Mitte der 1980er Jahre zugelassenen privaten Fernseh- und Hörfunksender finanzieren sich im Gegensatz dazu ausschließlich durch Werbung und unterliegen nicht der Kontrolle eines Rundfunkrates. Das Nebeneinander von privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hat Auswirkungen auf die Wahlkampfplanung und -führung der Parteien. Dies resultiert 71 Vgl. Papier/Möller: Presse- und Rundfunkrecht (1999), S. 458. 27 insbesondere aus dem generellen Anspruch auf kostenlose Wahlwerbespots, den politische Parteien gegenüber den öffentlich-rechtlichen Sendern geltend machen können. Entsprechende Regelungen enthalten die Staatsverträge des ZDF und der meisten ARD-Rundfunkanstalten72. Diejenigen Sender, aus deren Staatsverträgen keine Anspruchsgundlage der Parteien auf Gewährung von Sendezeit abzuleiten ist73, stellen diese in der Regel freiwillig zur Verfügung. Dabei ist jedoch entspechend dem Parteiengesetz die Chancengleichheit der Parteien zu wahren (Vgl. § 5 Abs. 1 Parteiengesetz). In der Praxis wird die Gesamtwerbezeit dabei unter Berücksichtigung der Bedeutung der Parteien und unter Wahrung bestimmter Mindestkontingente verteilt. Aufgrund der großen Reichweite der öffentlich-rechlichen Rundfunkanstalten bedeutet diese Regelung, dass auch Parteien mit einem geringen Wahlkampfbudget die Möglichkeit haben, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Doch auch die privaten Rundfunkanstalten müssen den Parteien zu Wahlkampfzeiten angemessene Sendezeiten zur Verfügung stellen. Entsprechende Bestimmungen für bundesweit zu empfangende Sender enthält der vierte Rundfunkstaatsvertrag74. Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind den privaten Sendern jedoch bei der Vergabe von Sendezeit die Selbstkosten zu erstatten. Die Chancengleichheit der Parteien bleibt dennoch weitgehend gewährleistet. Obwohl Wahlwerbespots für Parteien in der Bundesrepublik kostenlos sind beziehungsweise lediglich gegen Erstattung der Selbstkosten ausgestrahlt werden können, sind sie zum Bereich Paid Media zu zählen, da sie keiner redaktionellen Bearbeitung durch die ausstrahlenden Sender unterliegen, in alleiniger Verantwortung der Parteien produziert werden und eindeutig als Wahlwerbung erkennbar sind. In diesem Bereich haben die Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland daher erhebliche Auswirkungen auf den Wahlkampf. Gebe es keine entsprechenden Vorschriften, wäre damit zu rechnen, dass die Parteien mit den größten Budgets deutlich mehr Sendezeit hätten als finanzschwächere Parteien. 72 Vgl. etwa. § 11 Abs. 1 des ZDF-Staatsvertrage; § 14 Abs. 2 des Staatsvertrages über den Mitteldeutschen Rundfunk. 73 So beinhaltet etwa der ARD-Staatsvertrag keine entsprechende Regelung. Auch der Staatsvertrag des Sender Freies Berlin sah keine kostenlosen Wahlwerbespots vor. Der Staatsvertrag der Rundfunkanstalt Berlin Brandenburg, der aus dem Zusammenschluss von SFB und ORB am 1. Mai 2003 entstanden ist, räumt dem neuen Sender entsprechend § 8 Abs. 2 lediglich die Möglichkeit ein, Sendezeit zur Verfügung zu stellen. 28 Aufgrund der großen Breitenwirkung von Radio und Fernsehen hätten sie damit eindeutig Vorteile im Wahlkampf. In den USA dagegen gibt es keine öffentlich-rechtlichen medialen Strukturen. So gut wie alle Medien sind in privatem Eigentum. Rundfunksender finanzieren sich ausschließlich über Werbeeinnahmen. Eine staatliche Kontrolle findet nicht statt. Zwar gibt es im Rundfunkbereich mit der Federal Communications Commission eine Regulierungskommission, die Sendelizenzen vergibt. Diese werden in der Regel routinemäßig ausgestellt oder verlängert. In der Praxis beschränkt sich die Funktion der Kommission jedoch auf die Wahrnehmung einer Vermittlerrolle bei Konflikten innerhalb der Medienindustrie75. Was die Vergabe von Sendezeit an Parteien oder Kandidaten für öffentliche Ämter betrifft, gibt es keine Regulierungen. Genau wie jede Produktwerbung können politische Werbespots in beliebiger Menge gegen Bezahlung im Programm der Sender platziert werden. Dies führt dazu, dass vermögende Parteien und Kandidaten grundsätzlich die Möglichkeit haben, mehr Sendezeit zu bekommen als finanziell schwächere76. Zwar ließe sich argumentieren, dass aufgrund des Mehrheitswahlsystems die zwei großen Parteien ohnehin begünstigt werden. Auf der anderen Seite wurde bereits dargelegt, dass es vorrangig in der Verantwortung der einzelnen Bewerber liegt, ihren Wahlkampf zu organisieren. Insbesondere bei den Vorwahlen haben somit finanzschwächere Bewerber das Nachsehen, wenn sie sich weniger Sendezeit kaufen können. Die unterschiedliche Regelung in den USA und der Bundesrepublik haben darüber hinaus Auswirkungen auf die Länge der Werbespots. So haben HoltzBacha und Kaid in einer Studie festgestellt, dass in Ländern, in denen Wahlwerbung frei erworben werden kann, die Spots wesentlich kürzer sind als in Ländern, die eine Regulierung vorsehen. Danach ist eine Wahlsendung in den USA in der Regel 30 oder 60 Sekunden lang. In Deutschland dauern die Spots durchschnittlich 2,5 Minuten77. Ein wesentlicher Grund für diesen Unterschied ist in den unterschiedlich hohen Kosten für Wahlwerbung in den jeweiligen Ländern zu sehen. Die Länge von Werbespots kann jedoch Auswirkungen auf die Strategie der Wahlkampfführung 74 Vgl. § 42 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, i.d.F. des vierten Rundfunkstaatsvertrages, gültig ab 1. April 2000. 75 Vgl. Kleinsteuber: Medien und öffentliche Meinung (1998), USA. S. 380f. 76 Vgl. Holtz-Bach/Kaid: A Comparative Perspective on Political Advertising (1995), S. 15. 77 Vgl. ebd. S., 16. 29 haben, denn es ist fraglich in welchem Umfang sich politische Inhalte innerhalb einer halben Minute transportieren lassen. Die unterschiedlichen Strukturen im Medienbereich haben auch Auswirkungen auf die Kommunikationskultur der beiden Länder. So stellt Pfetsch einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Kommerzialisierung der Medienstrukturen und dem Stil der politischen Kommunikation fest78. Demnach sind die Medien bei zunehmenden wirtschaftlichen Wettbewerb verstärkt darum bemüht, die Kosten der Informationsbeschaffung zu minimieren. Dies macht sie jedoch empfänglicher für die von der politischen Öffentlichkeitsarbeit mediengerecht vorbereiteten Botschaften. Je geneigter die Medien sind, vorproduziertes Material in ihrer Berichterstattung zu verwenden, desto wichtiger ist für die Parteien die Planung mediengerechter Inszenierungen im Wahlkampf. Sowohl im politischen als auch im medialen System sind also deutliche Unterschiede zwischen den USA und der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich. Gerade vor diesem Hintergrund soll im Folgenden der Begriff der „Amerikanisierung“ auf seine Anwendbarkeit auf den deutschen Wahlkampf hin untersucht werden. 3. „Amerikanisierung“ – was ist das? 3.1 Merkmale der „Amerikanisierung“ Der Begriff „Amerikanisierung“ taucht seit den 1990er Jahren regelmäßig im Vorfeld von Bundestagswahlen in der öffentlichen Diskussion auf. So bezeichnete etwa Radunski 1996 den Begriff als „stereotype Kommentierung deutscher Wahlkämpfe“79. Welche Elemente des Wahlkampfes machen nun aber eine „Amerikanisierung“ aus? An dieser Stelle soll erläutert werden, auf welche Merkmale des modernen Wahlkampfes sich dieser Terminus genau bezieht. In der Literatur lassen sich zahlreiche Aspekte finden, an denen der Begriff festgemacht wird. Zum einen wird der Terminus auf die Planungs- und Organisationsebene des Wahlkampfes bezogen. So betrachtet etwa Donges die Professionalisierung der 78 79 Vgl. Pfetsch: „Amerikanisierung“ der politischen Kommunikation? (2001), S. 30. Radunski: Die Amerikanisierung der Wahlkämpfe (1996), S. 33. 30 Wahlkampfführung als ein Hauptmerkmal80 der „Amerikanisierung“. Falter und Römmele dagegen heben in diesem Zusammenhang vor allem das sogenannte Spindoctoring, also den Einsatz von unabhängigen Politikberatern, als Merkmal hervor81. Zum anderen spielt der Begriff auch auf die Durchführungsebene des Wahlkampfes an. Winfried Schulz sieht etwa in der zunehmenden Bedeutung des Marketing-Ansatzes oder der Inszenierung des Wahlkampfes als KandidatenWettstreit wichtige Merkmale der „Amerikanisierung“82, während Plasser sogar „die Tendenz zur sportlichen Dramatisierung“ des Wahlkampfs hinzuzählt83. Letztendlich lassen sich jedoch aus der Literatur sechs Hauptmerkmale der „Amerikanisierung“ herauskristallisieren, die sich jedoch nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen lassen und sich zum Teil überschneiden: - Professionalisierung des Wahlkampfes - Spindoctoring - Personalisierung - Vermehrtes Ereignis- und Themenmanagement durch die Wahlkampfteams - Zunehmende Inanspruchnahme von Meinungsforschung - Ein verstärkter Angriffswahlkampf. Vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen Systemunterschiede wird im Folgenden dargestellt, was unter den einzelnen Merkmalen zu verstehen ist und wie ausgeprägt diese im amerikanischen Wahlkampf tatsächlich sind. Darüber hinaus soll gezeigt werden, inwieweit die politischen und medialen Bedingungen in der Bundesrepublik eine Übernahme dieser Merkmale ermöglichen. In welchem Ausmaß sich die einzelnen Merkmale im Bundestagswahlkampf 2002 tatsächlich wiederfinden, wird im vierten Teil dieser Arbeit ausführlich überprüft. 3.1.1 Professionalisierung Unter Professionalisierung des Wahlkampfes wird eine Zentralisierung der Wahlkampagne verstanden. Dadurch sollen Wahlkampfmaßnahmen besser koordiniert und ein einheitlicher Auftritt von Partei und Kandidaten gegenüber den Medien gewährleistet werden. Um diese Ziele zu erreichen, bedienen sich die Parteien zunehmend professioneller Hilfe. Die Leitung der Kampagnen übernehmen nicht mehr nur Parteifunktionäre, sondern unabhängige Medienprofis, die oft nicht 80 Vgl. Donges: Amerikanisierung, Professionalisierung, Modernisierung? (2000), S. 29. Vgl. Falter/Römmele: Professionalisierung bundesdeutsche Wahlkämpfe (2002), S. 52f. 82 Vgl. Schulz: Politische Kommunikation (1997), S. 186f. 81 31 einmal der Partei angehören. So gehört für Schulz zur Professionalisierung des Wahlkampfes, dass „die Aufgaben engagierter Parteisoldaten von Experten für die Diagnose und Steuerung der öffentlichen Meinung, wie Meinungsforscher, Medienberater, Werbe- und Public-Relations-Agenturen übernommen werden“84. Die Kampagnenorganisation wird damit zunehmend aus den Parteien hin zu Medienspezialisten verlagert, die außerhalb des politischen Systems stehen85. Das wohl prominenteste Beispiel für die Professionalisierung des Wahlkampfes in der Bundesrepublik stellt bisher die erstmals 1998 eingerichtete Wahlkampfzentrale der SPD, Kampa, dar. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem Medienberatung, Pressearbeit, Werbung, Gegnerbeobachtung, Unterstützung der Kandidaten bei Veranstaltungen und die Auswertung der Ergebnisse von Meinungsforschungsinstituten86. Daneben bestand eine bedeutende Leistung in der Koordination der traditionellen Parteigremien für die Wahlkampfführung. Doch auch die Parteien, bei denen die Organisation des Wahlkampfes vorrangig noch in den Parteigremien angesiedelt ist, greifen verstärkt auf die Hilfe unabhängiger Werbeagenturen zurück87. Pfetsch und Schmitt-Beck stellen allerdings fest: „Der Trend zur Professionalisierung und Zentralisierung der Wahlkampforganisation ist aufgrund der unterschiedlichen ideologischen Festlegungen nicht in allen Parteien gleich weit fortgeschritten“88. Die Gründe für eine zunehmende Professionalisierung können zum einen im Bedeutungszuwachs der Medien gesehen werden. So erkennt etwa Holtz-Bacha in dem Bemühen der Politik, die Medienberichterstattung gezielt zu beeinflussen, eine Folge der Zulassung privater Rundfunkanstalten und der damit einhergehenden Zunahme der Sender89. Zum anderen sei auch in den Veränderungen in der Wählerschaft wie die abnehmende Parteienidentifikation und dem damit einhergehenden Bedeutungsverlust der politischen Parteien ein Grund für die Professionalisierungstendenzen zu sehen90. Die im Vergleich zur Bundesrepublik relativ unbedeutende Rolle der Parteien ist auch in den USA die Voraussetzung für stark professionalisierte Wahlkämpfe. Da es vor 83 Plasser: Globalisierung der Wahlkämpfe (2003), S. 107. Schulz: Wahlkampf unter Vielkanalbedingungen (1998), S. 378. 85 Vgl. Holtz-Bacha: Bundestagswahlkampf 1998 (1999), S. 10. 86 Vgl. Becker: New Labour auf dritten Wegen (2002), S. 270. 87 Vgl. Müller, Marion: Parteienwerbung im Bundestagswahlkampf (2002), S. 629ff. 88 Pfetsch/Schmitt-Beck: Amerikanisierung von Wahlkämpfen? (1994), S. 237. 89 Vgl. Holtz-Bacha: Massenmedien und Wahlen (2002), S. 25f. 90 Ebd. 84 32 allem in der Verantwortung der einzelnen Kandidaten liegt, für sich zu werben, sind sie es auch, die sich ein eigenes Wahlkampfteam zusammenstellen müssen. Dabei greifen sie auf kleine private Unternehmen zurück, die sich meistens auf die Durchführung von Wahlkampagnen spezialisiert haben. Da sich eine Kampagne in den USA also jeweils nur auf eine einzelne Person und nicht auf eine Partei konzentrieren muss, sind die Bedingungen für einen professionalisierten Wahlkampf dort eher gegeben als in Deutschland. 3.1.2 Spindoctoring Das Spindoctoring geht meist mit der Professionalisierung der Wahlkampforganisation einher. Der Begriff Spin Doctor ist nur schwer ins Deutsche zu übertragen. Der Vorschlag Holzers, ihn mit „Hexenmeister“91 zu übersetzen, erscheint unzutreffend, hat doch die Aufgabe eines Spin Doctors weniger mit Hexerei als mit professioneller Medienarbeit zu tun. Auch Falters und Römmeles Vorschlag, in der Person des Spin Doctors „eine Art Medizinmann der Wahlkampfführung“ 92 zu sehen, greift zu kurz. Vielmehr handelt es sich um einen professionellen Wahlkampfmanager, der den gesamten Wahlkampf überblicken, koordinieren und ihn letztendlich in die richtige Richtung lenken soll. Will man also die Aufgabe eines Spin Doctors anschaulich umschreiben, kann man davon sprechen, dass er dem Wahlkampf den richtigen „Dreh“ gibt. Dies entspricht auch am ehesten der Übersetzung des englischen Verbs to spin. Althaus lehnt sogar nicht nur eine Übersetzung, sondern den Begriff Spin Doctor an sich ab, da dieser den Markt für eine sehr spezifische Dienstleistung verniedliche. Stattdessen zieht er die Bezeichnung Political Consultant vor 93. Doch welche Bezeichnung man auch vorzieht, fest steht, dass in den USA die Wahlkampfführung auf allen politischen Ebenen ohne professionelle Berater nicht mehr denkbar ist. Die Beratung der Politiker im Wahlkampf hat sich dort mittlerweile zu einem eigenständigen Berufszweig etabliert, und „die Professionalisierung der Political Consultants schreitet fort“94. So existiert mit der American Association of Political Consultants bereits seit 1969 ein eigener Berufsverband für politische Berater mit über 1100 Mitgliedern. Deren Mitglieder bekennen sich nicht nur zu einem Ehrenkodex für Political Consultants, sondern nehmen auch regelmäßig an 91 Holzer: Von Hexenmeistern und Media-Handwerkern (1996), S. 119. Falter/Römmele: Professionalisierung bundesdeutsche Wahlkämpfe (2002), S. 52. 93 Vgl. Althaus: Professionalismus im Werden (2002), S. 79 92 33 der Verleihung der sogenannten Pollies teil, einem vom Verband ausgelobten Preis für Leistungen im Bereich der professionellen Politikberatung. Die knapp hundert Kategorien reichen von der Beurteilung gesamter Kampagnen über Teilaspekte wie Fernsehspots oder Radiowerbung für die Kandidaten bis hin zu „Best Use of Negative Advertising on a Website”95. Daneben existieren eine Reihe von akademischen Einrichtungen, die sich auf die Ausbildung professioneller Wahlkampfberater spezialisiert haben. Als erste und renommierteste unter ihnen gilt die 1986 gegründete Graduate School of Political management der George Washington University. Diese tägt ihrem Selbstverständnis nach der Tatsache Rechnung, dass „both electoral politics and governing have become increasingly specialized and professionalized“96. Beide Beispiele verdeutlichen, welch hohen Stellenwert die professionelle Politikberatung in den USA mittlerweile erreicht hat. Althaus konstatiert: „Das für das europäische Denken fremde Konzept, politische Expertise in einem freien Beruf zu organisieren statt in einem bürokratischen Parteiapparat, ist inzwischen fixer Bestandteil der politischen Kommunikation in den USA“97. Die Wahlkampfführung in der Bundesrepublik Deutschland ist allerdings noch weit davon entfernt. Auf das Management der Wahlkampforganisation hierzulande wird in Punkt 4.2 noch näher eingegangen. An dieser Stelle sei nur vermerkt, dass der Wahlkampfmanager der CDU/CSU im Jahr 2002, Michael Spreng, dem Bild eines Spin Doctors beziehungsweise Political Consultants am nächsten kommt. Als Medienexperte wurde auch er von außerhalb des politischen Alltagsgeschehens engagiert, um den Wahlkampf erfolgreich zu organisieren. Nichtsdestotrotz ist er nicht grundsätzlich auf die Politikberatung im Sinne eines Political Consultants spezialisiert. Auch kann seine Rolle im Wahlkampf der Bundesrepublik zumindest noch als Ausnahme gesehen werden. Mit dem Ausmaß des Political Consulting in den USA ist die Praxis in der Bundesrepublik bisher kaum zu vergleichen. 3.1.3 Personalisierung Der Begriff Personalisierung umschreibt eine wachsende Bedeutung der Darstellung von persönlichen und unpolitischen Eigenschaften eines Kandidaten in den Medien auf Kosten von Sachthemen und Inhalten von Parteiprogrammen. Komplexe politische Sachverhalte sollen auf diese Weise vereinfacht dargestellt werden. Ein 94 Ebd., S. 97. Vgl. www.theaapc.org 96 Vgl. www.gwu.edu/~gspm/about/index.htm 95 34 wichtiger Grund hierfür ist die Tatsache, dass dem Publikum die „Orientierung an Personen allemal leichter fällt als die Auseinandersetzung mit Sachfragen“98. Darüber hinaus ist jedoch zu bedenken, dass Massenmedien auf Bilder und damit auch auf die Darstellung von Personen angewiesen sind. Sollen etwa ein neues Gesetz, ein Parteiprogramm oder geplante Reformen dem Publikum im Fernsehen vermittelt werden, bedarf es eines Politikers, der die jeweiligen Inhalte erläutert und rechtfertigt. Die Personalisierung trägt damit auch den Bedürfnissen des Mediensystems Rechnung und kann insofern hauptsächlich als eine Folge des Bedeutungszuwachses des Fernsehens angesehen werden99. Im Wahlkampf zeigt sich allerdings noch ein anderer Aspekt der Personalisierung: „Wenn also hier eine zunehmende Personalisierung diagnostiziert wird, meint das dann wohl auch weniger die an Personen orientierte Vermittlung und Wahrnehmung von Politik, sondern in erster Linie die hervorgehobene Position weniger Politiker in den Kampagnen ihrer Parteien“100. Holtz-Bacha spricht damit die zunehmende Konzentrierung auf die Spitzenkandidaten der Parteien, vor allem von SPD und CDU, an, als deren Höhepunkt die beiden Fernsehduelle zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber im Bundestagswahlkampf 2002 gesehen werden kann. Dabei nehmen die Ausstrahlung und das Auftreten der Kandidaten in den Medien zunehmend einen größeren Stellenwert ein. Bruns kommt zu dem Schluss: „Die Persönlichkeit des Politikers entscheidet über Glaubwürdigkeit, Hoffnung und Vertrauen, das die Bürger in die von ihm und seiner Partei vertretene Politik setzen können“101. Die Personalisierung muss sich dabei aber nicht ausschließlich auf das Fernsehen beschränken. Das Wahlplakat der CDU von 1994, auf dem lediglich Helmut Kohl inmitten einer Menschenmenge zu sehen war und selbst das Parteilogo fehlte, dient dafür als Beispiel. Problematisch ist diese Entwicklung insofern, als dass sie suggeriert, der Bundeskanzler könne direkt vom Volk gewählt werden. Wie aber oben bereits gezeigt wurde, entspricht das Verfahren in der Bundesrepublik grundsätzlich dem parlamentarischen System, wobei der Regierungschef von der sich ergebenden Mehrheit im Parlament bestimmt wird. Grundsätzlich wäre daher mit einer geringeren Konzentration auf die Persönlichkeit der Kandidaten im deutschen Wahlkampf zu rechnen. 97 Althaus: Professionalismus im Werden (2002), S. 97. Holtz-Bacha: Das Private in der Politik (2001), S. 24. 99 Vgl. Stern/Graner: It’s the candidate, Stupid? (2002), S. 148. 100 Holtz-Bacha: Bundestagswahlkampf 1998 (1999), S. 13. 101 Bruns: Der Politiker ist die Message, in: Der Tagesspiegel vom 03.02.2001. 98 35 In den USA hingegen lässt bereits das Mehrheitswahlsystem und die Verfahren zur Bestimmung der Kandidaten in den einzelnen Bundesstaaten eine starke Personalisierung erwarten. Egal ob es sich nun um Vorwahlen, Repräsentantenhausoder Präsidentschaftswahlen handelt; stets treten zwei Kandidaten gegeneinander an. Wer von beiden die Mehrheit der Stimmen erhält, ist gewählt. Dass die Kandidaten angesichts dieses Verfahrens neben politischer Kompetenz verstärkt auf die Vermittlung von Persönlichkeit und Sympathie achten, darf daher nicht verwundern. So ist auch die Veranstaltung von Fernsehduellen zwischen den Bewerbern um das Amt des Präsidenten in den USA fast schon zu einer Tradition geworden. Bereits 1960 traten John F. Kennedy und Richard Nixon auf diese Weise gegeneinander an. Dass Kennedy das Rededuell gewann, schreibt Hoffmann nicht nur dessen Sachverstand zu: „Kennedy besaß neben einem öffentlichkeitswirksamen Privatleben die ideale Kombination aus Wissen, Schlagfertigkeit, Humor und Verständnis – Charisma“102. Zwar folgte daraufhin eine 16-jährige Pause, seit 1976 bilden die Duelle jedoch bei jeder Präsidentschaftswahl einen Höhepunkt des Wahlkampfes. Aber auch in der Bundesrepublik wird der Personalisierung ein zunehmender Einfluss auf die Wahlentscheidung zugesprochen. Klein und Ohr etwa gehen in einer empirischen Untersuchung der Frage nach, ob persönliche, unpolitische Eigenschaften von Helmut Kohl und Gerhard Schröder die Wahlentscheidung der Wähler bei der Bundestagswahl 1998 beeinflusst haben. Sie kommen zu dem Ergebnis: „Auch wenn man sehr strenge Kriterien anlegt, üben unpolitische Kandidatenorientierungen einen nachweisbaren Einfluss auf die Wahlentscheidung aus, der über die Effekte der Parteiidentifikation, der Kompetenzzuschreibung an die Parteien sowie der rollenrelevanten Kandidateneigenschaften hinausgeht“103. Besonders die persönliche Vertrauenswürdigkeit, aber auch das Privatleben und die physische Attraktivität der Kandidaten hätten signifikant zum Wahlergebnis beigetragen. Dass sich diese Entwicklung verstärkt, zeigt Ohr in einer anderen Untersuchung, in der er die Kandidatenorientierung in den Wahlkämpfen vor den Bundestagswahlen von 1961 bis 1998 analysiert. Danach ist ein stärkerer Trend zur Personalisierung in den letzten Jahrzehnten festzustellen. So seien insbesondere in den Wahlen 1994 und 102 103 Hoffmann: Das große Zittern (2002), S. 429. Klein/Ohr: Gerhard oder Helmut? (2002), S. 218. 36 1998 die Kandidatenbewertungen bereits wichtiger als die Parteibindungen für die Erklärung der Wahlentscheidung geworden104. 3.1.4 Themen- und Ereignismanagement Das Augenmerk eines Wahlkampfteams muss vor allem darauf gerichtet sein, die Botschaften, die die Partei oder der Kandidat vermitteln soll, in die Medienberichterstattung, insbesondere die des Fernsehens, und damit in die öffentliche Aufmerksamkeit zu bringen. Ein Mittel dazu ist die Produktion von Wahlwerbespots für das Fernsehen. Zum einen ist dies aber vor allem in einem rein kommerziellen Rundfunksystem wie in den USA sehr teuer. Zum anderen ist die Absicht, die hinter den Spots steht, offensichtlich und dementsprechend die „Abwehrhaltung der Zuschauer ausgeprägter“105. In der Bundesrepublik ist darüber hinaus der bezahlte Fernsehwahlkampf gesetzlich eingeschränkt. Daher wird versucht, durch gezieltes Themen- und Ereignismanagement die Botschaft der Kandidaten im redaktionellen Teil der Berichterstattung unterzubringen. So stellt auch Holtz-Bacha fest, dass das persuasive Kommunikationsziel der politischen Akteure in den Free Media weniger offensichtlich ist und sie daher hoffen, von deren Glaubwürdigkeit zu profitieren106. Die Absicht der Kandidaten ist dabei, ihre Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung zu steigern und die Aufmerksamkeit des Publikums auf die von ihnen bevorzugten Themen zu lenken. Indem die Politik also vor allem im Wahlkampf versucht, Einfluss auf die Themenauswahl der Medien zu nehmen, muss sie sich bei der Auswahl und Inszenierung der Themen und Ereignisse der Medienlogik anpassen. Diese müssen dementsprechend „so beschaffen sein, daß sie die Widerstände des Mediensystems überwinden, d.h. eine Anpassungsleistung an Medienformate, Nachrichtenfaktoren und Logistik der Medienorganisationen erbringen, um zu Nachrichten zu werden“107. Durch entsprechende Präsentationsformen, abgestimmtes Timing und eine gute Logistik können Wahlkampfmanager Journalisten die Arbeit erleichtern und damit die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis in den Medien platzieren zu können, erheblich steigern. Das Ausmaß des Einflusses, den die Politik damit auf die Themenauswahl der Medien hat, ist beachtlich. Dies zeigt auch eine Untersuchung von Genz, 104 Vgl. Ohr: Wird das Wählerverhalten zunehmend personalisierter? (2000), S. 297. Falter: Alle Macht dem Spin Doctor, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.04.1998. 106 Vgl. Holtz-Bacha: Bundeswahlkampf 1998 (1999), S. 17. 105 37 Schönbach und Semetko. Darin wurden die Hauptnachrichtensendungen der vier größten deutschen Fernsehsender jeweils sieben Wochen vor den Bundestagswahlen der Jahre 1990, 1994 und 1998 analysiert. Dabei kam heraus, dass die meisten gesendeten Beiträge auf den Anstoß eines politischen Akteurs zurückgingen. Lediglich 18 Prozent der Beiträge waren erkennbar von Journalisten bestimmt108. Welche Methoden ein effizientes Themen- und Ereignismanagement in der Praxis ausmachen, zeigt Brunner anhand der Präsidentschaftswahlen 2000 in den USA 109. So bestand die Strategie des Wahlkampfteams um George W. Bush darin, lange vorbereitete Politikinitiativen im zweiwöchigen Rhythmus auf nationaler Ebene zu präsentieren. Durch permanentes Wiederholen der entsprechenden Botschaften und die strikte Vermeidung, andere Themen anzusprechen, wurde den Medien wenig Spielraum geboten, andere Aspekte zu thematisieren. Andere Methoden bestehen in der selektierten Ausgabe von exklusiven Informationen an ausgewählte Journalisten oder in der Bekanntgabe von wichtigen Entscheidungen oder Ereignissen kurz vor Redaktionsschluss der jeweiligen Medien, um die Recherchemöglichkeiten einzuschränken. Neben der gezielten Steuerung realer Themen und Initiativen wird darüber hinaus politischen Ereignissen oft auch lediglich aufgrund des Bewusstseins, dass über sie berichtet wird, ein mediengerechter Charakter verliehen, oder sie finden überhaupt erst aus diesem Grunde statt. Kepplinger spricht in diesem Zusammenhang von mediatisierten und inszenierten Ereignissen110. Als Beispiel für mediatisierte Ereignisse wird oft der SPD-Bundesparteitag 1998 in Leipzig genannt, bei dem Gerhard Schröder zum Kanzlerkandidaten gewählt wurde. Der gesamte Ablauf des Parteitages war für die Berichterstattung in den Medien inszeniert. So kommentierte das heute-jounal im April 1998: „Ein mediengerecht inszenierter Wahlkampfauftritt, typisch für Amerika oder Großbritannien, an den wir uns hier erst noch gewöhnen müssen“111. Als Beispiele für inszenierte Ereignisse, auch oft als Pseudoereignisse bezeichnet, lassen sich Pressekonferenzen von Regierung, Opposition oder Parteien sowie 107 Pfetsch/Schmitt-Beck: Amerikanisierung von Wahlkämpfen? (1994), S. 238. Vgl. Genz/Schönbach/Semetko: „Amerikanisierung“? (2001), S. 408f. 109 Vgl. Brunner: Wahlkampf in den USA (2002), S. 65ff. 110 Vgl. Kepplinger: Die Demontage der Politik (1998), S. 170. 111 Niemetz im ZDF-heute-journal vom 17.04.1998, hier zitiert nach: Holtz-Bacha: Bundestagswahlkampf 1998 (1998), S. 9. 108 38 Stellungnahmen einzelner Politiker anführen, die nur stattfinden, um Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Besonders häufig sind solche Inszenierungen von Ereignissen im Wahlkampf zu beobachten. So beschreibt Meyer das Vorgehen wie folgt: „Die Politiker wissen, daß sie das Geschehen und vornehmlich das Nichtgeschehen so inszenieren müssen, wie es die Medien brauchen, um es nach ihren Nachrichtenwertgesetzen zur Nachricht und damit zum Ereignis in der Welt promovieren zu können“112. Einige Autoren sehen durch diese Anpassung der Politik an die Regeln der Massenmedien eine Tendenz zur Dethematisierung. So schreibt Leif in diesem Zusammenhang, dass „(inszenierte) Bilder, gut gestylte Stimmungen und überlegt eingesetzte Emotionen [...] immer mehr die Argumente oder den redlichen intellektuellen Austausch“113 verdrängen. Eine Konsequenz dieses Prozesses ist eine Zunahme symbolischer Politik, die bereits weiter oben (siehe 2.1.4) angesprochen wurde. 3.1.5 Meinungsforschung Der Einsatz von Meinungsforschung im Wahlkampf ist in der Bundesrepublik Deutschland keine neue Erscheinung. Bereits in den 1950er Jahren nutzte das Kanzleramt Umfragedaten des Allensbacher Instituts114. Regelmäßig wird seitdem die Stimmung in der Bevölkerung erfasst. Gefragt wird etwa nach der allgemeinen politischen Stimmungslage, die Einstellung zu bestimmten politischen Problemen, Charakter- und Kompetenzimages von konkurrierenden Kandidaten oder die grundsätzliche politische Neigung und die Wahlabsicht der Wähler. Diese sehr umfangreichen Umfragen werden auch als benchmark polls bezeichnet115. Ist jedoch im Zusammenhang mit dem Begriff der „Amerikanisierung“ von einem verstärkten Einsatz der Umfrageforschung während des Wahlkampfes die Rede, ist der Einsatz von kurzfristigeren und konkreteren demoskopischen Methoden zum Zweck einer effizienten Kampagnensteuerung gemeint. Anstatt lediglich relativ langfristige politische Stimmungen in der Wahlbevölkerung zu erfassen, ist es in den USA üblich, die Meinungsforschung kontinuierlich als Erfolgsmesser von bestimmten Argumentationen, Werbemitteln und Wahlkampfstrategien zu verwenden. Dazu dienen vor allem Ad Hoc-Umfragen und 112 Meyer: Die Transformation des Politischen (1994), S. 142. Leif: Macht ohne Verantwortung (2001), S. 9. 114 Vgl. Gallus: Demoskopie in Zeiten des Wahlkampfs (2002), S. 32. 113 39 kürzere Trendumfragen, die sogenannten brushfire polls und tracking polls116, die um so öfter eingesetzt werden, je näher der Wahltermin rückt. Stellt sich dabei heraus, dass die verwendeten Methoden nicht die gewünschte Wirkung in der Bevölkerung zeigen oder sogar unerwünschte Folgen haben, kann die Wahlkampftaktik kurzfristig umgestellt und der jeweiligen Situation angepasst werden. So schreibt auch Mauss, dass es bei der politischen Meinungsumfrage nicht darum gehe vorherzusagen, wer die Wahlen gewinne. „Es geht vielmehr darum, herauszufinden wie ein Kandidat das bestmögliche Ergebnis erzielen kann oder welches die beste Kommunikationsstrategie für ein bestimmtes Vorhaben ist“117. Bei der Meinungsforschung müssen allerdings ebenfalls die systembedingten Unterschiede zwischen den USA und der Bundesrepublik berücksichtigt werden. Wie schon bei der Personalisierung bedingt das personenbezogene amerikanische System eine andere Wahlkampfführung. Hier sind zwei Hauptgründe zu nennen: Erstens liegen die programmatischen Schwerpunkte in den USA weniger bei den Parteien, die ohnehin nur eine sehr beschränkte Rolle in den Wahlkämpfen einnehmen, als bei den Kandidaten und deren persönlicher Wahlkampforganisation. Gelegentlich können die Themen der Kandidaten sogar von denen ihrer Partei abweichen. Im Gegensatz zu parlamentarischen Systemen, in denen die Themenschwerpunkte eher in den Parteien konzentriert sind, ist daher in den USA vor allem der einzelne Kandidat selbst dafür verantwortlich, den Erfolg seiner Strategien zu überprüfen. Zweitens sind die unterschiedlichen Medienstrukturen zu beachten. Viele Fernsehsender in den USA sind regional begrenzt. Dies hat zur Folge, dass Wahlwerbespots, die in den USA das wichtigste Wahlkampfinstrument darstellen, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zugeschnitten werden. Anders als in Deutschland, wo dieselben Spots flächendeckend zu empfangen sind, würde eine landesweite Umfrage nach deren Wirkung also keinen Sinn machen. Beide Aspekte spiegeln sich auch in der Struktur der Umfrageinstitute wider: In der Bundesrepublik bedienen sich die politischen Parteien großer quasi- wissenschaftlicher Institute für Markt- und Sozialforschung, die sich trotz der Nähe ihrer Geschäftsführer zu bestimmten Politikern als unabhängig betrachten. In den 115 Vgl. Brunner: Wahlkampf in den USA (2002), S. 26. Ebd. 117 Mauss: Filtern, fragen und beraten (2002), S. 81. 116 40 USA wird die Meinungsforschung dagegen vorwiegend von kleineren Beratungsfirmen angeboten, die an ihre jeweiligen Auftraggeber gebunden sind118. Gallus sieht allerdings auch in Deutschland einen wachsenden Bedarf der Politiker an Meinungsumfragen. Verantwortlich dafür seien das Aufbrechen fester Sozialmilieus, eine nachlassende Parteiidentifkation und eine zunehmende Zahl von Wechselwählern. Je stärker diese Tendenzen würden, „umso größer ist das Verlangen nach Umfragen, nach in regelmäßigen Intervallen erhobenen Daten darüber, was der repräsentative Querschnitt der Bevölkerung denkt, wünscht, missbilligt“119. 3.1.6 Angriffswahlkampf Als weiteres Merkmal der Amerikanisierung wird häufig ein verstärkter Angriffswahlkampf – auch Negative Campaigning genannt – gesehen. Damit ist die Verbreitung von negativen Nachrichten über den politischen Gegner gemeint. Dass diese Taktik im Wahlkampf angewendet wird, verwundert zunächst nicht, denn, so schreibt Radunski: „Es wird nicht nur für etwas, sondern auch gegen eine Partei oder gegen einen Politiker gestimmt“120. Das Kritisieren von politischen Entscheidungen und Programmen des Gegners kann daher als natürlicher Wahlkampfbestandteil in einer pluralistischen Gesellschaft gesehen werden und ist auch in bundesdeutschen Wahlkämpfen keine Neuheit. Es stellt sich allerdings die Frage, wann die Grenze eines fairen Angriffswahlkampfs überschritten wird, ob tatsächlich immer nur die politischen Inhalte des Gegners angegriffen werden und insbesondere, ob der Persönlichkeitsschutz der einzelnen Kandidaten gewährleistet bleibt. So sind insbesondere die Wahlkämpfe in den USA dafür berüchtigt, ihre Angriffe auch gegen die Privatsphäre der politischen Gegner zu richten. Die Instrumentalisierung von Bill Clintons Affäre mit Monika Lewinsky durch die Republikaner gilt als das bekannteste Beispiel dafür. Es darf dabei jedoch nicht übersehen werden, dass die Darstellung des Privaten im amerikanischen Wahlkampf ohnehin eine größere Rolle spielt als in Deutschland. Die öffentliche Zurschaustellung eines intakten Familienlebens wird gerne genutzt, um die eigenen Wahlchancen zu erhöhen. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass die Kandidaten ihren Gegnern eine größere Angriffsfläche bieten und sie dazu herausfordern, den 118 Vgl. ebd., S. 82. Gallus: Demoskopie in Zeiten des Wahlkampfs (2002), S. 30. 120 Radunski: Politisches Kommunikationsmanagement (1996), S. 43. 119 41 Wahrheitsgehalt ihrer Darstellung zu überprüfen. Nichtsdestotrotz sind einem zu überzogenen Negative Campaining auch in den USA Grenzen gesetzt. Im Präsidentschaftswahlkampf 2000 wurde von Bushs Wahlkampfteam eine Werbespot produziert, in dem der Slogan „The Gore prescription plan: bureaucrats decide“ eingeblendet wurde. Dabei löste sich der Schriftzug langsam auf, wobei am Schluss für kurze Zeit lediglich der Wortbestandteil „rats“ lesbar blieb121. Daraufhin setzte in den USA eine breite öffentliche Diskussion über die Zulässigkeit solcher Methoden ein. Als umgekehrt kurz vor der Wahl berichtet wurde, dass George W. Bush als 30jähriger wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein verlor, ließ sein Herausforderer Al Gore unverzüglich mitteilen, dass er nicht für das Bekanntwerden dieser Angelegenheit verantwortlich sei122. Diese Reaktion zeigt, dass auch in den USA das Aufdecken von privaten Details nicht generell auf Akzeptanz stößt. In der Bundesrepublik hingegen beschränkt sich Angriffswahlkampf fast ausschließlich auf politische Themen. Ein prominentes Beispiel hierfür stellt die RoteSocken-Kampagne der CDU im Bundeswahlkampf 1994 dar, die gegen die PDS gerichtet war. Zwar gibt es auch immer wieder Wahlsprüche, die sich gegen einzelne Politiker richten. So etwa Slogans wie „Kohl muß weg“ oder „Danke, Helmut – es reicht“ im Jahr 1998. Diese richten sich jedoch in der Regel gegen die politische Position des Gegners und nicht gegen seine persönlichen Eigenschaften. HoltzBacha schreibt darüber hinaus: „Insbesondere läßt sich keine kontinuierliche Entwicklung hin zu steigendem Negativismus verzeichnen“123. So seien in dieser Hinsicht Wahlkämpfe wie 1980, als Helmut Schmidt gegen Franz Josef Strauß antrat, eher aufgefallen als die Kampagnen der neunziger Jahre. Allerdings kann in der Bundesrepublik zumindest ein Trend festgestellt werden, dass Angriffswahlkampf als Wahlkampfmittel von vornherein häufiger eingeplant wird als dies zuvor der Fall war. So hatte 1998 die SPD in ihrer Wahlkampfzentrale Kampa einen eigenen Arbeitsbereich eingerichtet, der ausschließlich für die Gegnerbeobachtung zuständig war. Dies allein sagt zwar noch nichts über die Qualität oder das Vorhandensein von Elementen des Angriffswahlkampfs aus, bildet aber eine unverzichtbare Basis dafür. So schreibt Vito Cecere, der für diese Abteilung zuständig war: „Sie [die Gegnerbeobachtung - jw] spürt frühzeitig 121 Vgl. Althaus: Professionalismus im Werden (2002), S. 90. Vgl. Cecere: Man nennt es Oppo (2002), S. 65. 123 Holtz-Bacha: Bundestagswahlkampf 1998 (1999), S. 14. 122 42 Entwicklungen und Vorhaben, aber auch Konflikte und Widersprüche auf der anderen Seite auf und befähigt somit das eigene Team zur schnellen Reaktion“124. 3.2 „Amerikanisierung“ oder „Modernisierung“? Die Darstellung der Elemente, die im deutschen Wahlkampf mit einer „Amerikanisierung“ in Verbindung gebracht werden, zeigt, dass viele der in den USA angewandten Wahlkampfmethoden vom dortigen politischen und medialen System begünstigt werden. Selbst wenn sich also im deutschen Wahlkampf entsprechende Elemente der amerikanischen Wahlkampfführung wiederfinden, ist es angesichts dieser Systemunterschiede zweifelhaft, ob immer von einer gezielten Übernahme der angeführten Praktiken gesprochen werden kann. Dies führt zwangsläufig zu der Frage, ob die Verwendung des Terminus „Amerikanisierung“, der eine Orientierung an amerikanischen Mustern impliziert, für den wissenschaftlichen Gebrauch angemessen ist. Auch in der Literatur gibt es Kontroversen um die Zulässigkeit des Begriffs. Während Radunski schreibt: „Die Amerikanisierung der Politik ist längst auch deutsche Wirklichkeit“125, lehnen Sarcinelli und Geisler den Begriff gänzlich ab: „Die Vielzahl seiner disparaten Bezugsebenen macht deshalb den Amerikanisierungsbegriff zwar zu einem Element der rhetorischen Politikfolklore. Als wissenschaftliches Instrument ist er kaum tauglich, werden doch die politisch-institutionellen wie auch politischkulturellen Differenzen systematisch ausblendet [sic!]“126. Dagegen ist für Plasser der Gebrauch des Begriffs zwar zulässig. Er sieht jedoch zwei unterschiedliche Zugänge zum Konzept der Amerikanisierung. So sehe der Diffusionsansatz die „Amerikanisierung“ als Folge einer transnationalen Diffusion und Implementierung von US-Konzepten und Strategien der Wahlkampfführung. Im Unterschied dazu würden Vertreter des Modernisierungsansatzes in der „Amerikanisierung“ eine Folge der Modernisierung des Mediensystems und der Beziehung zwischen Wählern und Parteien sehen. In diesem Zugang stehe der Begriff als Synonym für eine allgemeine Modernisierung und Professionalisierung127. Aufgrund der angeführten Systemunterschiede scheint bei der Verwendung des Begriffs „Amerikanisierung“ der zweite Zugang plausibler zu sein. So ist eine 124 Cecere: Man nennt es Oppo (2002), S. 67. Radunski: Politisches Kommunikationsmanagement (1996), S. 39. 126 Sarcinelli/Geisler: Die Demokratie auf dem Opferaltar kampagnenpolitischer Aufrüstung? (2002), S. 156. 127 Vgl. Plasser: Globalisierung der Wahlkämpfe (2003), S. 37. 125 43 Modernisierung des Mediensystems insbesondere in den vergangenen zwei Jahrzehnten – wie bereits erwähnt – unübersehbar. Darüber hinaus beschleunigen neue Technologien und Medien wie das Internet den Informationsfluss zunehmend, Nachrichten sind zu jeder Tages- und Nachtzeit und von jedem beliebigen Ort aus abrufbar. Dass die Politik – zumal in Wahlkampfzeiten – versucht, sich dieser Entwicklung anzupassen, kann nicht verwundern. Darüber hinaus sind Veränderungen in der Wählerschaft festzustellen. Die Parteiidentifikation nimmt ab128, die Zahl der Wechsel- und Nichtwähler entsprechend zu. Für die Parteien im Wahlkampf bedeutet dies, dass es zusehends größerer Anstrengungen bedarf, um die Wählerschaft zu mobilisieren. Dass die Wahlkampfplanung und -durchführung angesichts dessen zunehmend in die Hände von Experten gelegt wird und die angewandten Methoden den Gegebenheiten permanent angepasst werden, liegt daher auf der Hand. Gleichzeitig ist aber auch offensichtlich, dass sich deutsche Wahlkampfmanager an amerikanischen Methoden orientieren und diese zum Teil auch übernehmen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang vor allem an das Format der Fernsehduelle. Aber auch andere Aspekte der amerikanischen Wahlkampfführung dienten den deutschen Kampagnen als Vorbild. So bestätigt Röseler, dass sich die Kampagnenmanager der Union intensiv mit dem Wahlkampfmethoden der Republikaner im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2000 auseinandergesetzt haben. Ein konkretes Resultat dieser Studien war die Übernahme des Internetinstruments Rapid Response (siehe 4.3.3). Aber auch in Bereichen der Organisation und Medienarbeit habe man sich Anregungen geholt. Gründe für diese Orientierung an den Wahlkampfmethoden der USA sieht Röseler unter anderem in der großen Zahl von privaten Unternehmen, die um die Organisation und Durchführung der politischen Kampagnen konkurrieren: „Wettbewerb schafft Innovation – gerade auch im Bereich der Wahlkampfführung“129. Auch dem Wahlkampf der Grünen gaben die in den USA praktizierten Wahlkampfmethoden wichtige Impulse. Der dortige Wahlkampf hat laut Rudi Hoogvliet in Hinblick auf Professionalität „fünf bis zehn Jahre Vorsprung auf die Praxis in der Bundesrepublik“130. So habe sich bereits 1999 eine zehnköpfige Gruppe um den späteren Wahlkampfmanager der Grünen diesbezüglich Anregungen bei 128 Klingemann/Wattenberg: Zerfall und Entwicklung von Parteiensystemen (1990), S. 330. Interview mit Röseler vom 24.06.2003. 130 Interview mit Hoogvliet vom 04.07.2003. 129 44 Politikberatern der Demokraten geholt. Vor allem im Bereich der Zielgruppenbestimmung mithilfe strukturierter Umfragen hätten die Grünen wichtige Erkenntnisse gewinnen können, die zum Teil auch im Wahlkampf 2002 angewendet wurden. Vor diesem Hintergrund kann die Verwendung des Begriffs „Amerikanisierung“ zunächst nicht gänzlich abgelehnt werden. In welchem Ausmaß sich nun aber Elemente amerikanischer Wahlkampfführung im Bundestagswahlkampf 2002 wiederfanden, soll im Folgenden anhand der Selbstdarstellung der politischen Parteien dargestellt und analysiert werden. 45 4. Wahlkampf 2002 4.1 Die politische Ausgangslage zu Beginn des Wahlkampfes Um die unterschiedlichen Strategien und Methoden der einzelnen Parteien in ein Gesamtbild einordnen zu können, ist es notwendig, die politische Ausgangslage, in der sie sich zu Beginn des Wahlkampfes befanden, kurz zu skizzieren. Damit stellt sich jedoch zunächst die Frage, auf welchen Zeitpunkt der Wahlkampfstart genau terminiert werden kann. Marion Müller, deren Studie zur Parteienwerbung auf Interviews mit den jeweiligen Wahlkampfleitern basiert, sieht den Wahlkampfauftakt der einzelnen Parteien uneinheitlich. So sei die FDP bereits Anfang 1999 in den Wahlkampf gestartet. Die anderen Parteien hätten mit ihren Kampagnen im Laufe des Jahres 2001 begonnen131. Einerseits kann man durchaus den Wahlkampfbeginn so früh bestimmen, zumal etwa die CDU bereits im Mai 2001 die Werbeagentur McCann-Erickson mit der Durchführung ihrer Kampagne beauftragte. Andererseits ist zu bedenken, dass die Terroranschläge auf das World Trade Center in den USA am elften September eine gravierende Zäsur darstellten, die zumindest für einige Wochen jegliche bereits vorhanden Wahlkampfaktivitäten in den Hintergrund drängte. Erst gegen Ende des Jahres 2001 gerieten wirtschaftspolitische Fragen und damit auch eines der Hauptthemen im darauf folgenden Wahlkampf - wieder zunehmend in die öffentliche Aufmerksamkeit. Wenn man allerdings ein Datum für den konkreten Wahlkampfbeginn festlegen will, kann der 11. Januar 2002 als solches angesehen werden. An diesem Tag erklärte die Vorsitzende der CDU, Angela Merkel, dass sie auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet habe. Damit stand gleichzeitig fest, dass der bayerische Ministerpräsident, Edmund Stoiber, als Spitzenkandidat der Union antreten würde. Da also ab nun die Spitzenkandidaten der beiden größten Parteien, SPD und CDU/CSU, feststanden, konnten sich die einzelnen Wahlkampfteams ab diesem Tag in Position bringen und ihre konkreten Strategien festlegen. Aus diesem Grund orientiert sich diese Arbeit an diesem Datum, wenn im Folgenden der Wahlkampf 2002 untersucht wird. Für die SPD stellte sich die politische Ausgangslage im Januar 2002 schwierig dar. In einer repräsentativen Umfrage zeigten sich lediglich 31 Prozent der Befragten zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Insbesondere die Leistungen im 131 Vgl. Müller, Marion: Parteienwerbung im Bundestagswahlkampf (2002), S. 629f. 46 wirtschaftspolitischen Bereich – hier vor allem die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurden überwiegend negativ beurteilt. Andererseits erfreute sich jedoch der Bundeskanzler selbst einer großen Beliebtheit. So erklärten im Januar 2002 72 Prozent, dass sie es gerne sähen, wenn er auch künftig „eine wichtige Rolle“ in der Politik spielen würde132. Für die SPD war daher eine personalisierte, auf die Person Gerhard Schröder ausgerichtete Wahlkampfführung naheliegend. Ein Bilanzwahlkampf, in dem die bisherigen Leistungen der SPD während ihrer Regierungszeit hätten betont werden können, bot sich dagegen vor allem aufgrund der steigenden Arbeitslosenzahlen nicht an133. Für die Union war die Situation zu Beginn des Wahlkampfes einfacher. Als größte Oppositionspartei war es für sie leichter, sich auf Inhalte zu konzentrieren, indem sie die Arbeit der Regierung kritisierte und politische Alternativen anbot. Da Stoiber zudem nicht über die gleiche positive Medienwirkung wie Schröder verfügte, sollte dem erwarteten personalisierten Wahlkampf der SPD ein Kompetenzwahlkampf der beiden Unionsparteien gegenübergestellt werden. So gab Stoiber, kurz nachdem er als Spitzenkandidat feststand, in einem Interview die Richtung des Wahlkampfes vor: „Ich will, dass es ein Wahlkampf der Kompetenz wird, des Ringens um die bessere Lösung. Es darf nicht nur ein Medienwahlkampf und vor allem kein Diffamierungswahlkampf werden“134. Für die Wahlkampfplanung der Union musste darüber hinaus noch ein weiterer Aspekt beachtet werden. Da der gemeinsame Spitzenkandidat für die Bundestagswahl erstmals seit 1980 wieder aus den Reihen der CSU stammte, musste verstärkt darauf geachtet werden, die Kampagne der beiden Unionsparteien einheitlich zu gestalten. Für die Grünen als zweite Regierungspartei stellte sich die Ausgangslage uneinheitlich dar. Zwar lag sie im Januar 2002 in den Umfragen lediglich bei fünf Prozent135. Dies kann in erster Linie auf die Diskussion um die Zustimmung zur Entsendung von Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan zurückgeführt werden. Auf 132 Die Angaben beruhen auf einer Umfrage, die das Institut NFO-Infratest jeden Monat im Auftrag des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und verschiedenen Tageszeitungen durchführt. Sie basiert auf telefonischen Interviews mit rund 1000 Befragten. Hier zitiert in: Der Spiegel, Nr. 4/2002, S. 42f., vgl. auch: www.infratest-dimap.de/sonntagsfrage/default.htmmap.de/wahlen/btw02/default.htm. 133 Vgl. Hilmer: Bundestagswahl 2002 (2003), S. 193. 134 Vgl. Edmund Stoiber im Spiegel-Interview: "Kampf um beste Lösungen", in: Der Spiegel. Nr. 3/2002, S. 30. 135 Siehe Fn. 132. 47 dem Parteitag der Grünen in Rostock im November 2001 stimmten rund 75 Prozent der Delegierten für den Einsatz, was vor allem an der Basis der Grünen als Verstoß gegen die pazifistische Tradition der Partei gewertet wurde. Nichtsdestotrotz konnten sich die Grünen vorangegangenen auf einen Bilanzwahlkampf Legislaturperiode wichtige einlassen, Anliegen da ihrer sie in der Anhängerschaft umgesetzt hatten: Atomausstieg, eine verbesserte Verbraucherpolitik und die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften136. Darüber hinaus verfügten sie mit Außenminister Joschka Fischer über den Politiker mit den höchsten Sympathiewerten in Deutschland137, so dass sich auch personalisierte Elemente in der Wahlkampfführung anboten. Ähnlich wie die Unionsparteien konnte die FDP aus der Oppositionsrolle heraus ihre Strategie auf die Kritik an den Inhalten der Arbeit der Bundesregierung in der vorangegangenen Legislaturperiode ausrichten. Gleichzeitig befand sich die FDP im Januar 2002 bereits seit längerem in einer Phase der Neuausrichtung. Bereits auf ihrem Bundesparteitag in Düsseldorf im Mai 2001 hatte sie beschlossen, sich von einer Klientelpartei zur einer „Partei für das ganze Volk“ zu wandeln. Ihr strategisches Ziel sah die FDP dabei in der Erreichung eines Wähleranteils von 18 Prozent bei der Bundestagswahl. Wie sie dies erreichen wollte, legte sie ebenfalls bereits zu diesem Zeitpunkt fest: „durch eine eindeutige, inhaltliche Kompetenz“ sowie „durch eine Wahlkampagne, die mobilisiert und motiviert, indem sie unkonventionell ist und auch überholte Tabus bricht“138. Damit war schon frühzeitig die Strategie für die Wahlkampfführung der FDP vorgegeben. Dieses unkonventionelle Vorgehen sollte sich allerdings im Laufe des Wahlkampfes angesichts des Hochwassers im Osten Deutschlands und des Skandals um ein israelfeindliches Flugblatt des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen als zunehmend problematisch erweisen. Für die PDS erschien die Ausgangsposition im Januar 2002 zunächst aussichtsreich. Die Umfragewerte, die zu diesem Zeitpunkt bei rund sieben Prozent lagen, waren relativ vielversprechend139. Die positiven Werte für die pazifistisch eingestellte Partei waren auch eine Folge der Zustimmung der Grünen zur Truppenentsendung nach 136 Vgl. Hilmer: Bundestagswahl 2002 (2003),S. 196f. Siehe Fn. 132. 138 Beschluss des 52. Ord. Bundesparteitags in Düsseldorf. 4. – 6. Mai 2001, einzusehen unter: www.fdp-bundesverband.de/pdf/b_025.pdf 139 Siehe Fn. 132. 137 48 Afghanistan im November 2001. Daher schien auch für einen inhaltlichen Wahlkampf eine Betonung der pazifistischen Gesinnung erfolgversprechend zu sein. Beim Personal der Partei verfügte lediglich Gregor Gysi über eine genügend positive Medienwirkung für eine personalisierten Kampagne. Da dieser jedoch seit dem vorhergehenden Herbst das Wirtschaftsressort in Berlin leitete, war er nur schwer in vollem Umfang für den Wahlkampf einsetzbar. Mit seinem Rückritt von diesem Amt Ende Juli 2002 in der Folge der Bonusmeilen-Affäre fiel er sogar gänzlich als Galionsfigur der PDS im Wahlkampf aus. 4.2 Kampa, Kompetenzteam und Co. – die Organisation des Wahlkampfes Als ein Merkmal der „Amerikanisierung“ wurde oben bereits die Professionalisierung der Wahlkämpfe genannt. Diese kommt besonders in der Organisation der Wahlkampfführung zur Geltung. An dieser Stelle soll daher näher auf die Organisationsformen der Wahlkampfteams der einzelnen Parteien eingegangen werden. Bereits 1998 hatte die SPD in der Wahlkampforganisation mit ihrem Kampa-Modell erfolgreich neue Maßstäbe gesetzt. Oliver Röseler spricht sogar von einem „Quantensprung in der Wahlkampfführung selbst“140. Die Wirkung, die die moderne und professionell gestaltete Kampagne der SPD auf ihr Wahlergebnis hatte, fand in der wissenschaftlichen Literatur breite Beachtung141. Dementsprechend verwundert es nicht, dass sich die SPD auch im Bundestagswahlkampf 2002 weitgehend an ihr Konzept von 1998 hielt. So wurde die Kampa 02 erneut außerhalb der Parteizentrale angesiedelt. Verantwortlich für die Planung, Organisation und Ausführung des Wahlkampfes waren in erster Linie Generalsekretär Franz Müntefering und der Bundesgeschäftsführer Matthias Machnig. Die rund 120 Mitarbeiter verteilten sich auf zehn verschiedene Teams, von denen jedes für einen bestimmten Arbeitsbereich zuständig war. Neben Bereichen wie Presse und Finanzen gehörten dazu auch Teams, die für den Wahlkampf-Ost, Gegnerbeobachtung und Online-Wahlkampf zuständig waren. Als unabhängige Partner wurden wie schon 1998 die Werbeagentur KNSK/BBDO und das Meinungsforschungsinstitut Polis beauftragt. 140 Röseler: Union wie noch nie (2003), S. 201. Vgl. u.a. Jun: Der Wahlkampf der SPD im Bundestagswahlkampf 1998 (2001); Schmitt-Beck: Ein Sieg der „Kampa“? (2001); Timm: Die SPD-Strategie im Bundestagswahlkampf 1998 (1999). 141 49 Eine wesentliche Aufgabe der Wahlkampfzentrale bestand darin, Kommunikation und Handlungen zwischen den einzelnen Akteuren der Partei zu koordinieren. Parteizentrale, Bundestagsfraktion, Kanzleramt und die von der SPD geführten Regierungen in den Bundesländern mussten permanent auf dem gleichen Informationsstand gehalten und Wahlkampfaktionen unter ihnen abgestimmt werden. Dies sollte durch regelmäßig stattfindende Sitzungen gewährleistet werden. So fanden zwei- bis dreimal pro Woche Treffen zwischen Schröder, Münterfering und dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Peter Struck, statt. Ebenso oft trafen sich auch Machnig, der Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier und Vertreter der parlamentarischen Geschäftsführung zu Sitzungen. Die Ministerpräsidenten der SPD wurden bei Präsidiums- oder Bundesratssitzungen und durch einmal wöchentlich stattfindende Schaltkonferenzen in das Geschehen eingebunden142. Durch diese Abstimmungen sollte ein einheitlicher Medienauftritt der SPD während des Wahlkampfes gewährleistet werden. Die Unionsparteien standen durch die Entscheidung für Stoiber als Spitzenkandidaten vor der Herausforderung, den Wahlkampf von CDU und CSU eng zu koordinieren. So war zu Beginn des Wahlkampfes bezweifelt worden, ob die beiden Schwesterparteien im Wahlkampf effizient zusammenarbeiten können143. Zwar lag die organisatorische Verantwortung für den Wahlkampf in Bayern bei der Landesleitung der CSU, während die CDU-Bundesgeschäftsstelle für die restlichen Bundesländer verantwortlich war. Das strategische und politische Zentrum, in dem die Wahlkampfführung abgestimmt wurde, lag jedoch für beide Parteien in Berlin. Anders als die SPD entschied sich die Union dabei nicht für eine Ausgliederung aus der Parteizentrale, sondern beließ die Führung der Kampagne im Konrad-AdenauerHaus. Neben einer Umstrukturierung der klassischen Hauptabteilungen der Bundesgeschäftsstelle wurde im selben Haus die Arena 02 eingerichtet. In ihr wurden einzelne Arbeitseinheiten, zu deren Aufgabengebieten - ähnlich wie in der Kampa - etwa Medienbeobachtung oder Online-Wahlkampf gehörten, zusammengefasst. Hinzu kam noch ein Team der von den Unionsparteien beauftragten Werbeagentur McCann-Erickson. Die strategischen und inhaltlichen Entscheidungen wurden im Team 40 plus getroffen. In diesem Gremium saßen die 142 Vgl. Fengler/Jun: Kopie der Kampa 98 im neuen Kontext (2003), S. 179f. Vgl. Tartler: Stoiber-Team dirigiert Unions-Wahlkampf, in: Financial Times Deutschland vom 18.01.2002. 143 50 führenden Politiker beider Parteien, Vertreter der Bundestagsfraktion, der Leiter des Stoiber Teams, Michael Spreng, sowie die Ministerpräsidenten der von der CDU geführten Landesregierungen. Daneben gab es das Kompetenzteam. Dessen vorrangige Aufgabe war es, die verschiedenen Politikfelder mit Fachleuten aus der Union zu verknüpfen. Auf das größte Interesse der Medien stieß aber das Stoiber Team. Unter der Leitung des ehemaligen Chefredakteurs der Bild am Sonntag hatte es die Aufgabe, das persönliche Profil Stoibers zu stärken und mediengerecht in Szene zu setzen: „Seine Aufgabe bestand in der Entwicklung der Kommunikationsstrategie für den Kanzlerkandidaten und der Gestaltung und Begleitung seines Medienauftritts“144. Dementsprechend entstammten auch die Mitarbeiter des Teams vorwiegend aus dem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie aus der Medienbranche. Insgesamt wollte die Union dem erwarteten personalisierten Wahlkampf der SPD mit der Betonung der Begriffe „Kompetenz“ und „Team“ einen Sach- und Themenwahlkampf gegenüberstellen: „Die Betonung des Team-Gedankens fußte auf der Überlegung, Schröder als isolierten, von der Partei gelösten Solisten darzustellen und gleichzeitig die eigene Geschlossenheit zu unterstreichen.“145 Den Grünen standen mit einem Wahlkampfbudget von rund 2,5 Millionen Euro mit Abstand am wenigsten Mittel im Wahlkampf zur Verfügung. An eine Ausgliederung der Kampagnenzentrale oder eine große Zahl von Mitarbeitern war daher nicht zu denken. Die Wahlkampfzentrale wurde daher in der Bundesgeschäftsstelle eingerichtet, deren 15 Mitarbeiter die wesentliche Organisation übernahmen. Neben dem Wahlkampfmanager, Rudi Hoogvliet, wurden lediglich zwei Mitarbeiter zusätzlich eingestellt. Weitere Unterstützung gab es lediglich von maximal zehn Praktikanten146. Der Wahlkampfstab, der für die Beschlüsse verantwortlich war, bestand aus dem Spitzenkandidaten der Partei, Joschka Fischer, sowie einem siebenköpfigen Team und kam einmal wöchentlich zur Beratung zusammen. Mit der Firma „Zum Goldenen Hirschen“ engagierten die Grünen erstmals eine unabhängige Werbeagentur. Deren Mitarbeiter waren ebenfalls in den Sitzungen anwesend. Die weitere innerparteiliche Kommunikation erfolgte vor allem über regelmäßig durchgeführte Telefonkonferenzen und ein SMS-Verteiler-System. Neben einem 144 Röseler: Union wie noch nie (2003), S. 209. Ebd., S. 210. 146 Vgl. Becher: Grün wirkt (2003), S. 248. 145 51 erstmals aufgestellten Spitzenkandidaten und einer unabhängigen Werbeagentur gab es noch eine weitere Neuerung im Wahlkampf der Grünen: Erstmals führte die Partei eine systematische Gegnerbeobachtung durch. Allerdings war lediglich ein einziger Mitarbeiter ausschließlich mit dieser Aufgabe betraut. Die FDP richtete ihre Kampagne ganz auf das Ziel aus, 18 Prozent der Wählerstimmen zu erhalten. Dementsprechend wurde das wichtigste Gremium in der Wahlkampfplanung der Partei auch als Team 18/2002147 bezeichnet. Diese Gruppe, der unter anderem Parteichef Guido Westerwelle, Generalsekretärin Cornelia Pieper und Bundesgeschäftsführer Hans-Jürgen Beerfelz angehörten, traf sich einmal wöchentlich zur Sitzung. In sechs Arbeitsgruppen, den sogenannten „Tischen“, wurden die Sitzungen des Teams 18/2002 vor- und nachbereitet. Diese „Tische“ waren jeweils für einen eigenen Arbeitsbereich zuständig. So etwa für die Erarbeitung von Strategien zu bestmöglichen medialen Übermittlung der relevanten Wahlkampfinhalte der FDP oder zur Kampagnenentwicklung zu Schwerpunktthemen. Wie bereits im Beschluss des Düsseldorfer Parteitages festgehalten, konzentrierten sich die Teams dabei auch verstärkt auf die unkonventionelle Präsentation von Werbebotschaften in den Medien. Ausdruck für diese Strategie war nicht zuletzt die Präsentation Guido Westerwelles als eigenständiger Kanzlerkandidat der FDP. Das WahlQuartier 2002 der PDS befand sich in einem gläsernen Pavillon, aus dem heraus auch schon der vorhergehende Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus organisiert worden war. Geleitet wurden die knapp 30 Mitarbeiter von der Juristin Halina Wawzyniak, allerdings wurde de facto Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch als eigentlicher Wahlkampfmanager angesehen148. Zusammen mit diesem standen die damalige Parteivorsitzende Gaby Zimmer, Fraktionschef Roland Claus und die ehemalige Landesvorsitzende Petra Pau als Vierer-Team der Zentrale vor. Das Wahlkampfbudget der Partei war dabei mit knapp sechs Millionen Euro noch größer als das der FDP. Bei der Wahl der Werbeagentur griff die Partei auf das Berliner Unternehmen Trialon zurück, mit der sie bereits seit 1993 regelmäßig zusammenarbeitet. Eine klare Strategie war bei der PDS allerdings nicht auszumachen. So sah auch Richard Hilmer den PDS-Wahlkampf 2002 „eigenartig 147 148 Vgl. Kapferer/Chatzimarkakis: FDP: Auf dem Weg zur 18 (2003), S. 215. Vgl. Damme: PDS: Absturz aus dem Wahlquartier (2003), S. 270. 52 uninspiriert und lustlos“149. Eine klare Struktur war anders als bei den anderen Parteien somit bei der PDS nicht erkennbar. Betrachtet man die Organisationsstrukturen der Wahlkampfteams der einzelnen Parteien, wird deutlich, dass sie, mit Ausnahme der PDS, gut gerüstet waren für einen Medienwahlkampf. Die klar strukturierte innerparteiliche Kommunikation mit Telefonkonferenzen und regelmäßigen Sitzungen zwischen den einzelnen Verantwortungsträgern war eine wichtige Voraussetzung, um in der Öffentlichkeit ein Bild der Geschlossenheit abzugeben. Die Einrichtung einzelner Arbeitsgruppen, die sich auf einzelne Schwerpunktthemen wie Internetwahlkampf, Umgang mit den Medien oder dem Erscheinungsbild des jeweiligen Kandidaten in der Öffentlichkeit konzentrieren sollten, waren Garant für ein professionelles Auftreten in diesen Bereichen. Viel Wert gelegt wurde zudem auf eine deutliche Personalisierung. Neben Schröder, der ohnehin als Medienkanzler150 gilt, wurde dies durch die Tatsache verdeutlicht, dass die CDU/CSU ein eigenes Team hatte, dessen einzige Aufgabe es war, das Image Stoibers zu verbessern und die Grünen und die FDP erstmals überhaupt mit einem Spitzenkandidaten beziehungsweise einem eigenen Kanzlerkandidaten antraten. Festzuhalten ist allerdings auch, dass im Gegensatz zu den USA die Hauptverantwortung für den Wahlkampf nicht etwa allein bei den Kandidaten, sondern im Wesentlichen bei der Parteiführung lag. Auch die Rolle der Wahlkampfmanager läßt sich nicht ohne weiteres mit den Spin Doctors amerikanischer Art vergleichen. So wurden Machnig und Spreng zwar in den Medien oft als die „Kanzlermacher“151 dargestellt. Tatsächlich waren sie jedoch gemeinsam mit den jeweiligen Entscheidungsprozesse Kandidaten, Partei- eingebunden und und Fraktionsführungen hatten keine in die alleinige Entscheidungsvollmacht. Insbesondere in der SPD gab es im Verlauf des Wahlkampfes Uneinigkeit über die Kompetenz Machnigs. Als die SPD bei den Umfragewerten im August 2002 noch immer rund sieben Prozent hinter der Union lag, berichtete der Spiegel: „Matthias Machnig [...] wurde ohne formellen 149 Hilmer: Bundestagswahl 2002 (2003), S. 198. Vgl. Goffart: Nur der Sieg zählt, in: Handelsblatt vom 12.07.2002. 151 Vgl. Leersch: Die Kanzlermacher, in: Die Welt vom 13.08.2002. 150 53 Gremienbeschluss entmachtet“ und zitiert Machnig selbst mit den Worten: „Der Generalsekretär greift jetzt stärker ins operative Geschäft ein“152. Im folgenden Abschnitt soll nun untersucht werden, wie die Parteien ihre Organisationsstrukturen zur Selbstdarstellung in den Medien genutzt haben. 4.3 Selbstdarstellung der Parteien in den Medien Zweck und Aufgabe des Wahlkampfes in modernen Demokratien wurden ebenso wie die herausragende Rolle, die die Medien dabei spielen, oben bereits (siehe 2.1) erläutert. An dieser Stelle soll nun darauf eingegangen werden, wie sich die Parteien und ihre Kandidaten im einzelnen während des Bundestagswahlkampfes 2002 in der Öffentlichkeit dargestellt haben. Dabei soll das Augenmerk vor allem darauf gerichtet werden, ob, beziehungsweise in welchem Ausmaß, sich bei der Selbstdarstellung der Parteien die zuvor beschriebenen Merkmale der „Amerikanisierung“ wiederfinden lassen. Vier Aspekte der Selbstdarstellung sollen dabei angesprochen werden. Zur Klassischen Parteienwerbung ist all das zu zählen, was mit den Begriffen Paid Media umschrieben wird, also jegliche von den Parteien bezahlte Darstellung von Inhalten und Personen. In erster Linie lassen sich dazu Parteienspots und Wahlplakate zählen. Im Abschnitt Medienstrategien soll die Aufmerksamkeit auf das Bemühen der Parteien gerichtet werden, ihre Themen und Kandidaten in den redaktionellen Teil der Berichterstattung, also die Free Media, zu bringen. Hierzu gehören etwa das Themenmanagement oder die Inszenierung von Ereignissen. Da der OnlineWahlkampf als relativ neues Wahlkampfmittel immer mehr an Bedeutung gewinnt, beschäftigt sich ein eigenständiger Punkt mit der Internetpräsentation der Parteien. Da schließlich die Fernsehduelle ein Novum in der Geschichte des deutschen Wahlkampfes darstellten und ein erhebliches Echo in der Medienlandschaft hervorriefen, wird ihnen ebenfalls ein gesonderter Abschnitt gewidmet. 4.3.1 Klassische Parteienwerbung Im Gegensatz zur Berichterstattung im redaktionellen Teil der Medien ist anhand der klassischen Parteienwerbung die gewählte Strategie der einzelnen Parteien schnell 152 Vgl. Der Spiegel, Nr. 33/2002, S. 22. 54 erkennbar, obliegt es doch allein ihrer Entscheidung, wie Wahlplakate und Fernsehspots gestaltet werden und welche Botschaft sie vermitteln sollen. Wahlplakate stellen in der Bundesrepublik eines der wesentlichen Mittel der klassischen Parteienwerbung dar. So bewerteten alle Kampagnenmanager mit Ausnahme der PDS die Bedeutung von Plakaten im Wahlkampf 2002 zum Teil deutlich höher als Wahlspots im Fernsehen oder Kino153. Dies ist vor allem im Vergleich zum Wahlkampf in den USA auffällig, da Wahlplakate dort nur sehr sporadisch eingesetzt werden, während Wahlwerbung durch Fernsehspots die größte Bedeutung hat. Doch auch im Bundestagswahlkampf 2002 wurden allein in den vier Wochen vor der Wahl 428 Wahlwerbespots mit einer Gesamtlänge von 224 Minuten im privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet154. Die Wahlplakate der SPD verdeutlichten die Strategie der Partei, die Person Schröders in den Mittelpunkt zu rücken. Auf vielen Plakaten war lediglich der Bundeskanzler allein neben dem Parteilogo abgebildet. Die dazu gehörigen Slogans konzentrierten sich entweder auf die Person selbst – „Der Kanzler der Mitte“ oder „Ein moderner Kanzler für ein modernes Land.“ – oder sie transportierten minimale Ziele der Partei: „Das Ziel meiner Arbeit? Dass alle Arbeit haben.“ Ein zweiter Schwerpunkt lag in dem Angriff auf den politischen Gegner, wobei dieser fast ausschließlich in der Union gesehen wurde. Dabei wurde die Personalisierungsstrategie erneut deutlich, da nicht die beiden Unionsparteien als solche, sondern lediglich deren Kandidat, Stoiber, angegriffen wurde. So wurde etwa kurz nachdem dieser als Kanzlerkandidat feststand ein Motiv mit der Überschrift „Endlich: Der Kandidat der CDU/CSU ist da.“ plakatiert. Anstatt eines Fotos von Stoiber war vor einem weißen Hintergrund jedoch lediglich zu lesen: „Leider nicht im Bild, da zu weit rechts.“ Mit ihren Angriffsplakaten wollte die SPD vier zentrale Botschaften vermitteln: „Stoiber verstellt sich, Stoiber steht für die Vergangenheit, Stoiber hat nur negative Botschaften und die Versprechen der Union sind unseriös“. Die Angriffe sollten dabei „nicht aggressiv und verbissen, sondern originell und ironisch“155 wirken. Die im Vergleich zu diesen beiden Schwerpunktthemen wenigen Plakate, die politische Inhalte vermitteln sollten, konzentrierten sich überwiegend auf Familienpolitik, Bildungs- und Wissenschaftsförderung 153 oder Vgl. Müller, Marion: Parteienwerbung im Bundestagswahlkampf (2003), S. 634. Vgl. Müller, Dieter: Wahlwerbung im Fernsehen (2002), S. 623. 155 SPD-Parteivorstand: Die Kampagne zur Bundestagswahl 2002, S. 13. 154 55 betonten die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Eines der wenigen Plakate, die für die SPD als Ganzes warben, zeigte die deutsche Flagge in Großaufnahme mit dem Satz: „In Deutschland ist die Mitte rot.“ Personalisierung und Angriff kamen auch in den Werbespots der SPD zum Ausdruck. Ein Fernsehspot zeigte Schröder bei der Arbeit am Schreibtisch und im ernsten Gespräch mit Finanzminister Eichel und Mitarbeitern des Kanzleramtes. Damit sollte das Bild eines „dynamischen, entschlossenen“156 Kanzlers präsentiert werden. Gleichzeitig war der Spot mit einem Originalton Schröders unterlegt, so dass auch politische Inhalte transportiert wurden. Insbesondere wurde das Ziel betont, die Zahl der Arbeitslosen zu reduzieren. Die Angriffsstrategie wurde vor allem in einem Kinospot ersichtlich, in dem Filmausschnitte von putzenden Hausfrauen in den 1950er Jahren gezeigt wurden. Mit dem Schriftzug: „Die Zukunft. Wie Herr Stoiber sie sich vorstellt.“ am Ende des Spots „sollte das rückwärts gewandte Frauen- und Familienbild Stoibers und der Union karikiert und auf ironische Weise – besonders für ein vorwiegend jugendliches Kinopublikum – thematisiert werden“157. Die Strategie der Unionsparteien baute auf Umfragewerten auf, die besagten, dass Stoiber mehr wirtschaftspolitische Kompetenz zugetraut wurde als Schröder158. Dementsprechend konzentrierten sich auch die Wahlplakate vorwiegend auf Personalisierung und Angriff. So hatte das Plakat, das allein Stoiber mit dem Slogan: „Kantig. Echt. Erfolgreich.“ zeigt, mit 350,000 Kopien die größte Auflage von den Motiven der Union159. Gleichzeitig gab es jedoch auch zwei Motive, die Stoiber zusammen mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel zeigten. Dies sollte Geschlossenheit von CDU und CSU demonstrieren und den Verdacht von Unstimmigkeiten, die in Folge der Entscheidung für Stoiber als Kanzlerkandidaten hätten vermutet werden können, ausräumen. Die Angriffskampagne stellte vor allem die wirtschaftspolitische Kompetenz der Bundesregierung in Frage. Im Kampagnenbericht der CDU heißt es: “Zentrales Ziel der Angriffs-Kampagne der CDU gegen Rot-Grün war es, deren schlechte wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Bilanz in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte zu rücken“160. Die Kritik wurde dabei überwiegend an der Person Schröders festgemacht. Ein Plakat zeigte 156 Ebd., S. 21. Ebd., S. 20 158 Vgl. Kampagnenbericht der CDU, S. 16. 159 Vgl. ebd., S. 30. 160 Ebd., S. 11. 157 56 beispielsweise lediglich den Kopf Schröders, der aus dem Wasser ragte. Darunter war die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen von über vier Millionen zu lesen. Da die Zahl in Form eines Kilometerzählers dargestellt war, wurde impliziert, dass sie weiter steigen wird. Ein anderes Motiv zeigte einen Zwerg, der das SPD-Logo und eine rote Laterne trägt mit dem Slogan: „Schlußlicht durch Schröder. Kleinstes Wirtschaftswachstum in Europa“. Die Plakate, mit denen sich die Union bei den Wählern als bessere Alternative darstellen wollte, zeigten in der Regel kein Motiv. Stattdessen war vor blauem Hintergrund und dem Parteilogo zu lesen: „Zeit für Taten.“ oder „Deutschland braucht eine bessere Regierung“. Bei den Wahlwerbespots der Union fiel auf, dass sie darin weniger auf eine Personalisierungsstrategie setzten als etwa die SPD. Während etwa in einem Spot verschiede Bürger zu sehen waren, wurden aktuelle Probleme wie die hohe Arbeitslosigkeit angesprochen und Lösungsvorschläge der Union vorgestellt. Erst in den letzten Sekunden des Spots war Stoiber an der Seite Merkels zu sehen und ein Originalton des Kanzlerkandidaten zu hören. Daneben wurde ähnlich wie bei der SPD ein Werbespot produziert, der hauptsächlich im Kino ausgestrahlt wurde und in erster Linie junge Wähler ansprechen sollte161. Die darin dargestellten Szenen zeigten unterschiedliche Situationen eines Wechsels, so etwa ein Trikottausch zwischen Fußballern oder das Umziehen in einer Umkleidekabine. Die letzte Szene zeigte eine junge Autofahrerin, die ein Foto von Schröder am Armaturenbrett ihres Wagens durch eines von Stoiber ersetzt. Der Wechsel der Bundesregierung wurde damit in eine Reihe mit alltäglichen Handlungen gestellt und auf diese Weise als etwas ganz Natürliches dargestellt. Auch die Grünen setzten bei der Gestaltung ihrer Wahlplakate auf Elemente der Personalisierung. Allerdings fällt auf, dass sie sich dabei im Gegensatz zu SPD und CDU/CSU nicht ausschließlich auf ihren Spitzenkandidaten konzentrierten. So waren neben Joschka Fischer auch andere Minister sowie Vertreter der Partei- und Fraktionsspitze abgebildet. Die bedeutende Rolle, die Fischer im Wahlkampf spielte, wurde dennoch deutlich. Auf die Plakate, die ihn unter der Überschrift zeigten: „Wählen Sie den Außenminister!“ wurde kurz vor der Wahl noch zusätzlich ein gelber Aufkleber, in der Werbesprache auch Störer genannt, mit dem Satz: „Zweitstimme ist Joschka-Stimme!“ angebracht. Mehrere Wahlplakate der Grünen enthielten auch 161 Vgl. ebd., S.18. 57 Angriffe auf die politische Konkurrenz. Sie waren überwiegend gegen die Unionsparteien und die FDP gerichtet. Allerdings dominierte der Angriffswahlkampf nicht sosehr wie bei SPD und CDU. Zudem schien er auch nicht konsequent einer bestimmten Strategie zu folgen. Ein Plakat zeigte etwa Stoiber und Merkel unter der Überschrift: „No Sex, no Drugs, no Rock ’n‘ Roll. – Eine Warnung von Bündnis 90/Die Grünen.“, während ein anderes Stoiber mit Westerwelle vor dem übergroßen Gesicht Jürgen W. Möllemanns und dem Satz zeigte: „Damit der Albtraum nicht Wirklichkeit wird“. Darüber hinaus kommunizierten die Grünen auf ihren Wahlplakaten wesentlich mehr politische Inhalte als die anderen Parteien. Angesprochen wurden vor allem die traditionellen Themen der Grünen, wie etwa: Atomausstieg, Klimaschutz, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Zuwanderung, Verbraucherschutz und Familienpolitik. Damit grenzten sich die Grünen deutlich von SPD und CDU ab, die auf ihren Plakaten hauptsächlich Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt thematisierten. Außerdem bekannte sich die Partei kurz vor der Wahl mit ihren Plakatmotiven zur Fortsetzung der Koalition mit der SPD. In den letzten drei Wochen vor der Bundestagswahl war auf Großplakaten unter der Überschrift: „Kein BSE, kein AKW, kein Stoiber, keine FDP“ nebeneinander grünes und rotes Gemüse - die Parteifarben von Grünen und SPD - abgebildet. Anders als die Plakate waren die Werbespots der Grünen ganz auf den Spitzenkandidaten Joschka Fischer konzentriert. Dabei wurde vor allem sein hoher Beliebtheitsgrad in der Bevölkerung genutzt. So erklärte er in einem Spot, wer ihn weiterhin als Außenminister wolle, müsse die Grünen wählen. Ein anderer Spot, der für das Kino und den Musiksender MTV und damit eher auf junge Wähler zugeschnitten war, war humorvoller gestaltet. In Anspielung auf Stoibers Herkunft war darin bayerische Blasmusik zu hören, während Fischer mit gequältem Gesicht zu sehen war. Anschließend wurde der Satz eingeblendet: „Joschkas Rezept gegen den Sound der Vergangenheit:“, worauf Fischer sagt: „Wählt Grün am 22. September“. Die Motive auf den Wahlplakaten der FDP standen ganz im Zeichen der Strategie „Projekt 18“. Diese Zahl tauchte auf sämtlichen Plakaten der Partei auf. Auf einem war sie sogar allein mit dem Parteilogo abgebildet. Darüber hinaus fällt auf, dass die Partei bei der Gestaltung ihrer Wahlplakate etwas weniger stark auf Personalisierung setzte als SPD, CDU und Bündnis ‘90/ Die Grünen. Nichtsdestotrotz verzichtete auch die FDP nicht auf dieses Element, zumal sie erstmals einen Kanzlerkandidaten 58 aufgestellt hatte. So wurde vor allem Guido Westerwelle dargestellt; meist im Gespräch mit Bürgern. Auch der Angriffswahlkampf unterschied sich von dem anderer Parteien. So wurden die politischen Gegner selten direkt attackiert. Vielmehr wurden auf den Wahlplakaten aktuelle Probleme angesprochen und die Bundesregierung damit indirekt kritisiert. Die beiden Themenschwerpunkte stellten dabei die Abgabenlast durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge und das in der PISA-Studie der OECD ermittelte unterdurchschnittliche Bildungsniveau162 deutscher Schüler. So zeigte ein Plakat asiatische Schriftzeichen zusammen mit der Aufforderung: „Lesen Sie das, und Sie fühlen sich wie jeder vierte Schüler im Deutschunterricht“. Mit diesem Vorgehen war es der Partei möglich, Kritik an der Bundesregierung zu üben und gleichzeitig die eigenen Ziele - Senkung von Steuern und Beiträgen sowie mehr Ausgaben für Bildung - darzustellen. Einige Motive griffen auch die politischen Gegner direkt an. So etwa ein Plakat, das zwei schmutzige Handtücher an einem schwarzen und einem roten Haken zeigte, während daneben ein sauberes an einem blau-gelben – die Parteifarben der FDP - Haken hing, und damit auf die Spendenaffären der SPD und der CDU anspielte. In den Werbespots der FDP war eine Personalisierung eindeutig erkennbar. Ein Spot zeigte ausschließlich Guido Westerwelle, abwechselnd als Privatmann in der Natur und als Politiker vor dem Reichstag. Die wichtigsten Themen, die er in dem Spot ansprach, entsprechen denen auf den Wahlplakaten: Steuern und Bildungspolitik. Abschließend war neben dem Parteilogo wieder die Zahl 18 eingeblendet. In einem anderen Spot präsentierte sich die FDP als modern und zukunftsorientiert. Außerdem enthielt er Elemente eines Angriffswahlkampfs. So war etwa in einer Szene der Satz „Früher standen Frauen am Herd.“ eingeblendet, während eine Hubschrauberpilotin zu sehen war. Nach weiteren, ähnlichen Szenen war zu lesen „Früher wählte man SPD oder CDU/CSU“. Die Wahlplakate der PDS unterschieden sich deutlich von denen der anderen vier Parteien. Personalisierung war lediglich im Ansatz zu erkennen. So waren auf den Plakaten nur sehr selten Parteimitglieder abgebildet. Die drei unter dem Slogan: „Gysis junge Truppe“ auf einem Plakat abgebildeten relativ jungen Mitglieder besaßen zudem keinerlei Bekanntheitsgrad. Angriffe auf die Konkurrenzparteien 162 Im Dezember 2001 veröffentlichte die OECD eine Studie, die bei Schülern aus 32 Ländern die Leistungen in Mathematik, Naturwissenschaften und Leseverständnis verglich. Die Bundesrepublik zählte in allen drei Gebieten zum unteren Drittel. Vgl. Der Spiegel, Nr. 50/2001, S. 60ff. 59 fanden in den unterschiedlichen Motiven überhaupt keinen Ausdruck. Bei den politischen Inhalten war als einziger Schwerpunkt die Anti-Kriegs-Haltung der Partei, die sich in den meisten Plakaten widerspiegelte, eindeutig zu erkennen. Zu anderen Inhalten gab es nur vereinzelte Motive: „Macht den Osten stark“, „Nazis raus aus den Köpfen“ oder „Vermögenssteuer wieder einführen“ waren als entsprechende Slogans zu lesen. Auf einigen Plakaten wurden überhaupt keine politischen Inhalte thematisiert: „Das Leben ist Deine Party: PDS“ oder „Immer wieder PDS“ sind hierfür zwei Beispiele. Darüber hinaus fiel die Gestaltung der einzelnen Plakate sehr unterschiedlich aus. Außer dem Parteilogo waren kaum Elemente zu sehen, die eine Zuordnung der einzelnen Motive zur PDS erleichtert hätten. Die Aussage des Bundesgeschäftsführers Dietmar Bartsch, „ein typisches PDS-Plakat ist auch aus einem mit 250 Stundenkilometern dahinrauschenden ICE eindeutig als solches zu identifizieren“163, muss somit angezweifelt werden. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Werbespots der PDS betrachtet. Auch darin waren keine Personalisierung und kein Angriff auf andere politische Parteien enthalten. Die Themen der PDS wurden ebenfalls nicht eindeutig benannt. So deutete ein in schwarzweiß gehaltener Spot lediglich in einzelnen Szenen an, auf welche Problemfelder sich die Partei konzentriert. So waren etwa zwei junge Männer zu sehen, die den Spruch „Frieden kommt von Frieden“ an eine Mauer sprühen. In zwei anderen Szenen wurde eine alte Fabrikhalle geschlossen, woraufhin ein Jugendlicher seine Heimat in den neuen Bundesländern verlässt, da er dort keine Arbeit bekommt. Unterlegt war der Spot mit einem Lied, dessen Hauptaussage sich in der Zeile „Dass keiner verliert, ist das Ziel“ widerspiegelte. Zum Schluss des Spots wurde das Parteilogo eingeblendet. Untersucht man die Plakatmotive des Bundestagswahlkampfes 2002, wird deutlich, dass die Parteien sich vor allem auf Personalisierung und Angriffswahlkampf konzentriert haben. Politische Inhalte werden dagegen nur sehr begrenzt übermittelt. Dies darf zwar nicht verwundern, da Wahlplakate nicht das geeignete Medium sind, um Themen und Programme ausführlich vorzustellen. Allerdings fällt auf, dass manche Parteien, insbesondere die Grünen, trotzdem stärker als andere auch ihre politischen Ziele auf Plakaten angesprochen haben. 163 Bartsch, zitiert nach: Damme: PDS: Absturz aus dem Wahlquartier (2003), S. 279. 60 Ähnlich verhält es sich mit den Wahlwerbespots. Auch hier setzen die Parteien oft auf Personalisierung und Angriffswahlkampf. Allerdings fällt gerade bei der Union auf, dass die Spots weniger die Person Stoiber in den Mittelpunkt stellen als sie dies auf den Plakaten tut. Daneben vermitteln die Werbespots mehr politische Inhalte, was unter anderem auf die Vorteile des Mediums, Bild und Ton zu kombinieren, zurückzuführen ist. 4.3.2 Medienstrategien Ein professioneller Umgang mit den Massenmedien kann den Parteien im Wahlkampf viele Vorteile bringen. Wer es versteht, Ereignisse geschickt zu inszenieren und damit die von ihm gewünschten Themen und Bilder in die redaktionelle Berichterstattung zu bringen, erhält nicht nur kostenlose Wahlwerbung. Die in den Nachrichten der Print- und Rundfunkmedien dargestellten Ereignisse besitzen in den Augen der Zuschauer oft auch eine größere Glaubwürdigkeit als bezahlte Wahlwerbung, da die entsprechenden Beiträge letztendlich nicht von den Parteien, sondern von Journalisten ausgewählt werden und die Werbeabsicht weniger offensichtlich ist. Die Medienexperten in den Wahlkampfteams bemühen sich daher permanent durch Themenmanagement und die Inszenierung von Ereignissen, die Themenauswahl der Journalisten zu beeinflussen, um in den Free Media präsent zu sein. So kommt auch der Form dieser Free Media eine deutlich größere Bedeutung zu als der bezahlten Wahlwerbung 164. Auch im Bundestagswahlkampf 2002 waren die Anstrengungen der Parteien, sich auf diese Weise in die öffentliche Aufmerksamkeit zu bringen, deutlich erkennbar. Die dafür eingesetzten Methoden waren dabei sehr unterschiedlich und vielfältig. Sie reichten von der medienwirksamen Inszenierung der Diskussion um den Spitzenkandidaten der Union über den sogenannten „Spaßwahlkampf“165 der FDP bis hin zum gemeinsamen Auftritt von Gerhard Schröder und Joschka Fischer vor dem Brandenburger Tor in Berlin wenige Tage vor der Wahl. Im Abschnitt 3.1.4 wurde bereits erläutert, wie wichtig die Produktion und Darstellung von Bildern in einer mediatisierten Gesellschaft ist. Nun sollen im Folgenden die Vorgehensweise der einzelnen Parteien und die wichtigsten Inszenierungen von Ereignissen im Wahlkampf dargestellt werden. 164 Vgl. Fengler/Jun: Kopie der Kampa 98 im neuen Kontext (2003), S. 174. 61 Die Kampa gab frühzeitig ein Wahlkampfhandbuch mit dem Titel „Moderner Wahlkampf“ heraus, das jedem Wahlkampfteam zur Verfügung stand. Damit sollte die Wahlkampfführung der SPD bis auf die Kreisebene aufeinander abgestimmt werden. Insbesondere enthielt es auch Anleitungen und Tipps zum Umgang mit den Medien. So wird etwa unter dem Stichwort „Inszenierte Termine“ darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, die Vorstellung von politischen Forderungen mit geplanten Aktionen vor Ort zu verbinden. Dabei müsse darauf geachtet werden, wo sich günstige Gelegenheiten für die Medien ergeben, Pressebilder oder Fernsehaufnahmen zu machen166. Einen besonderen Vorbildcharakter für diese Anregungen hatte die Wahlkampfpraxis der SPD auf Bundesebene. Ob auf dem G-8Gipfel in Kanada, beim Besuch der deutschen Nationalmannschaft nach dem Finale der Fußballweltmeisterschaft oder bei der Besichtigung der Hochwassergebiete in Gummistiefeln und Regenjacke im August; stets war Gerhard Schröder um einen medienwirksamen Auftritt bemüht. Dabei war ihm zwar sein Amtsbonus von großem Vorteil: Viele Termine im Wahlkampf nahm Schröder aufgrund seiner Funktion als Bundeskanzler und nicht in erster Linie als Wahlkämpfer wahr und konnte sich daher von vornherein des Interesses der Medien sicher sein. Allerdings wurde auch bei diesen Terminen das Bemühen Schröders deutlich, sich in Szene zu setzen und positive Bilder zu produzieren. So wurde etwa sein Inspektionsbesuch bei den in Afghanistan stationierten Einheiten der Bundeswehr im Mai auch dazu genutzt, vor laufenden Kameras zusammen mit Franz Beckenbauer Fußbälle an Straßenkinder in Kabul zu verteilen. Des Medieninteresses an dieser inszenierten Szene konnte er sich dabei gewiss sein. Neben diesen Terminen absolvierte Schröder im August und September die sogenannte „Kanzler-Tour“, bei der er insgesamt 39 Großveranstaltungen in ganz Deutschland besuchte. Darüber hinaus fanden weitere 120 Veranstaltungen mit Bundesministern statt167. Neben dem persönlichen Kontakt zu den Wählern wurden auch diese Auftritte dazu genutzt, um medientaugliche Szenen zu produzieren. Bilder, auf denen Schröder im Gespräch mit Bürgern oder beim Händeschütteln gezeigt wurde, demonstrierten dabei Offenheit und Bürgernähe. Den Höhepunkt dieser Veranstaltungen bildete der gemeinsame Auftritt von Schröder und dem grünen Außenminister Joschka Fischer vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Auf 165 Löhe/Neubacher: "Zur Munterkeit verdammt", in: Der Spiegel, Nr. 35/2002, S. 38. Vgl. Wahlkampfhandbuch der SPD, S. 19f. 167 Vgl. ebd., S. 29. 166 62 Interesse bei den Medien stieß dieses Ereignis nicht nur wegen des bunten musikalischen Rahmenprogramms und einer Zuschauerzahl von rund 20 000 Menschen, sondern auch aufgrund des gemeinsamen Wahlkampfes von Spitzenkandidaten zweier unterschiedlicher Parteien. Noch nie war in der Bundesrepublik derart eindeutig für eine Regierungskoalition Wahlkampf gemacht worden. Die Auswahl der Themenschwerpunkte stellte sich für die SPD zunächst schwierig dar. Einen Bilanzwahlkampf hinsichtlich der Wirtschaftspolitik zu führen, bot sich aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und der stagnierenden Wirtschaftsentwicklung nicht an. Da aber vor allem die Union ihren Wahlkampf auf diesen Bereich konzentrierte, musste dem ein alternatives Konzept entgegengestellt werden. Zu diesem Zweck thematisierte die SPD die Ergebnisse der Hartz-Kommission, die im Auftrag der Bundesregierung ein Konzept zur Reduzierung der Arbeitslosenquote erarbeitet hatte. Der Vorsitzende der Kommission, Peter Hartz, behauptete, mit dem Konzept könne die Arbeitslosigkeit innerhalb von drei Jahren halbiert werden168. Angesichts einer solch optimistischen Prognose und der Absichtserklärung Schröders, das Konzept schnellstmöglich umsetzen zu wollen, fand das Thema breite Beachtung in den Medien. Gegen Ende des Wahlkampfes wurden noch zwei weitere Themen von der SPD forciert. Zum einen erklärte Schröder angesichts eines drohenden Angriffs der USA auf den Irak, dass es unter ihm als Bundeskanzler einen Einsatz der Bundeswehr in dem Konflikt unter keinen Umständen geben würde. Damit grenzte er sich deutlich von der Position der Union ab. Zum anderen versuchte er, sich nach den Überflutungen im Osten Deutschlands als Katastrophenhelfer zu profilieren, indem er den Opfern des Hochwassers schnelle Hilfe durch die Bundesregierung versprach und die Bürger zu Spenden aufrief. Angesichts der Besetzung dieser beiden Themen - Krieg und Umweltkatastrophe - durch die SPD konnten die Massenmedien gar nicht umhin, der Partei und vor allem dem Kanzler breite Aufmerksamkeit in der Berichterstattung zu geben. Bei der CDU/CSU sorgte bereits die Debatte um die Spitzenkandidatur der Union für große Aufmerksamkeit in den Medien. Die Umstände, unter denen die Vorsitzende der CDU, Angela Merkel, zugunsten Edmund Stoibers auf eine Kandidatur verzichtete, fanden noch lange Nachhall in der Berichterstattung und brachten dem 63 Wahlkampf der Union frühzeitig eine breite öffentliche Beachtung ein169. Nachdem Stoiber als Spitzenkandidat feststand, wurde die Zusammensetzung des um ihn gebildeten Kompetenzteams ein wichtiges Instrument, um medienwirksame Bilder zu erzeugen. Als etwa die SPD versuchte, Stoiber ein veraltetes Rollenverständnis zwischen Männern und Frauen zu unterstellen, wurde im Juli die 28-jährige Katharina Reiche in das Team berufen. Die Bilder von der erfolgreichen, unverheirateten Mutter, die zudem zu diesem Zeitpunkt schwanger war, sorgten für großes Interesse in den Medien und stellten ein geeignetes Mittel dar, die Vorwürfe der SPD zu widerlegen. Eine ähnliche Funktion hatte bereits im Mai die Benennung Lothar Späths in das Kompetenzteam. Der ehemalige Baden-Württembergische Ministerpräsident, der erfolgreich den Jenoptik-Konzern saniert hatte, sollte die wirtschaftliche Kompetenz Stoibers unterstreichen. Auch sonst war die Union permanent darum bemüht, werbewirksame Bilder zu erzeugen. So ließ Stoiber sich beim Besuch eines Freizeitparks im Mai mit seiner Tochter und seinen Enkelkindern vor einem Modell des Reichstagsgebäudes ablichten. Genau wie Schröder flog auch er nach Japan, um sich nach dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft zusammen mit der Nationalmannschaft fotografieren zu lassen. Außerdem besuchte auch er im August die Hochwassergebiete, um sich mit den Freiwilligen einer Hilfsorganisation sehen zu lassen. Medienwirksam ist dabei vor allem ein Bild, auf dem er zusammen mit einem Helfer einen Sandsack auf eine Flutbarriere legt. Schließlich entstanden auch bei Stoibers Besuch in den USA werbewirksame Bilder. Während bereits die Aufnahmen von Stoiber am Ground Zero in New York hohen Wert für den Wahlkampf der Union hatten, ist den Bildern, die ihn mit George W. Bush im Weißen Haus zeigen, eine noch größere Bedeutung beizumessen. Welche Bedeutung das ständige Bemühen um die Inszenierung von Bildern hat, wird indes Anfang September auf einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in Düsseldorf deutlich. Den rund 10 000 Gästen der Veranstaltung wurde zunächst ein umfangreiches und medienwirksames Rahmenprogramm mit Hochseilakrobaten und Musik geboten, so dass die Nachrichtensendung Tagesthemen kommentierte: „Musik und Stimmung wie bei einem Boxkampf“170. Auf dem Weg zum Rednerpult geriet Stoiber jedoch ins straucheln, fing den Sturz mit den Händen ab und ist daher für 168 Vgl. Peter Hartz im Spiegel-Interview: "Ich bin ein Überzeugungstäter", in: Der Spiegel, Nr. 26/2002, S. 37. 169 Vgl. u.a. Der Spiegel, Nr. 3/2002. 64 einen Moment auf allen Vieren zu sehen. Trotz des ansonsten professionell inszenierten Auftritts, ist es vor allem diese Szene, die in der Berichterstattung Beachtung fand. Der Spiegel beschrieb die Symbolik entsprechend: „Wie einer, der ins Ziel robben muss“171. Die eindeutig wichtigsten Themen, auf die sich der Wahlkampf der Union fixierte, waren die Wirtschaftslage und die hohe Zahl der Arbeitslosen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wurden diese beiden Aspekte angesprochen. Besonders deutlich wurde dies beim zweiten Fernsehduell, bei dem Stoiber grundsätzlich bei jeder Frage versuchte, diese Bereiche zu thematisieren. Auch in Interviews und öffentlichen Auftritten waren dies die zentralen Punkte, so dass die Medien wenig Gelegenheit hatten, andere Wahlkampfinhalte in Verbindung mit der Union zu thematisieren. Den Grünen garantierte ähnlich wie Gerhard Schröder bei der SPD Joschka Fischers Amtsbonus als Außenminister eine regelmäßige Berichterstattung in den Massenmedien. Zusammen mit dem hohen Beliebtheitsgrad, den Fischer in der Bevölkerung genoss172, stellte diese Tatsache für die Partei eine gute Grundlage für den Wahlkampf dar. So sagt auch Rudi Hoogvliet: „Wenn man schon den beliebtesten Politiker Deutschlands in seinen Reihen hat, ist es klar, dass sich die Wahlkampfführung auf diese Person konzentrieren muss“.173 Daher setzten die Grünen weniger stark auf spektakuläre Inszenierungen, um die Aufmerksamkeit der Medien zu erhalten als etwa SPD, Union und FDP. Zwar schreibt Becher, dass man „im Vorfeld der heißen Phase [...] auf die mediale Berichterstattung von Präsentationen und Veranstaltungen“174 setzte. So begab sich Fischer etwa mit einem auffällig lackierten Reisebus, der die Aufschrift „Joschka“ trug, auf eine ausgedehnte Wahlkampftour durch die Bundesrepublik. Im Vergleich zu den Methoden anderer Parteien, wie etwa dem Einsatz des „Guidomobils“ bei der FDP, waren die Bemühungen der Grünen, das Medieninteresse auf sich zu ziehen, viel zurückhaltender. Eine Ausnahme bildet dabei allerdings der bereits erwähnte gemeinsame Auftritt Fischers mit Gerhard Schröder am Brandenburger Tor in Berlin. 170 ARD-Tagesthemen vom 1.9.2002. Spiegel, Nr. 38/2002, S. 71. 172 Siehe Fn. 132. 173 Interview mit Hoogvliet vom 04.07.2003. 174 Becher: „Grün wirkt“ mit wenig Ressourcen (2003), S. 262. 171 65 Bei der Themenauswahl stellten die Grünen ihre bereits erreichten Ziele in den Mittelpunkt. Dazu gleichgeschlechtlicher gehörten insbesondere Lebensgemeinschaften, die rechtliche Anerkennung Atomausstieg, Klimaschutz, Zuwanderung und Verbraucherschutz. Insbesondere beim Thema Klimaschutz wurde der Partei nach den Überschwemmungen im Osten Deutschlands im August noch einmal verstärkte Aufmerksamkeit durch die Medien zuteil. Gleichzeitig wurden auch die Leistungen Fischers als Außenminister betont und thematisiert, was zu einer weiteren Personalisierung führte. Angesichts der herausragenden Rolle, die Fischer im Wahlkampf der Grünen spielte, behauptet Deupmann sogar: „Niemand weiß, ob die Partei ohne ihn überhaupt eine Zukunft hat“175. Die FDP wurde mit ihrer Medienstrategie ihrem auf dem Bundesparteitag in Düsseldorf formulierten Anspruch gerecht, einen unkonventionellen Wahlkampf führen zu wollen176. So gut wie alle Wahlkampfaktionen standen unter dem Motto des „Projekts 18“. So sorgte Guido Westerwelle für Aufsehen, als er in der politischen Talkshow „Sabine Christiansen“ mit einer auf seine Schuhsohlen geschriebenen Ziffer 18 auftrat. Die wichtigste Inszenierung für die Medien war jedoch die Wahlkampftour Westerwelles mit dem „Guidomobil“. Sechs Wochen lang besuchte der Spitzenkandidat der FDP Veranstaltungen in allen Bundesländern. Zwar sollte auf diese Weise auch der direkte Kontakt zur Bevölkerung hergestellt werden. In erster Linie sollte jedoch der auffällige, in den Farben der Partei angestrichene Bus die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen. Angesichts dieser Wahlkampfmethoden kommentierte der Tagesspiegel: „Die Liberalen werden das Image nicht los, es zumindest manchmal mit der Politik nicht ganz so ernst zu meinen“177. So schien der Einsatz unkonventioneller Wahlmethoden vor allem nach dem Hochwasser an der Elbe Mitte August nicht mehr angemessen zu sein. Die Aufmerksamkeit, die die Partei damit auf sich gezogen hatte, entwickelte sich sogar zusehends zum Bumerang. Eine Wahlkampfführung, die auf eine Vielzahl heiterer Elemente setzte, schien angesichts der ernsten Lage im Osten Deutschlands nicht mehr angebracht178. 175 Deupmann: Der rot-grüne Herbergsvater, in: Der Spiegel, Nr. 36/2002, S. 24. Siehe Fn. 138. 177 von Rimscha: Ganz im Ernst, in: Der Tagesspiegel vom 10.05.2002. 178 Vgl. Löhe/Neubacher: "Zur Munterkeit verdammt", in: Der Spiegel, Nr. 35/2002, S. 38. 176 66 Doch die FDP bediente sich auch anderer Methoden, um in den Medien präsent zu sein. So ist etwa die Verfassungsklage der Partei auf Teilnahme ihres Spitzenkandidaten an den Fernseh-Duellen zwischen Schröder und Stoiber zumindest zum Teil als solche zu werten. Guido Westerwelle konnte sich nur wenig Hoffnung machen, mit der Beschwerde Erfolg zu haben. Zumal entsprechende Klagen bereits zuvor vom Verwaltungsgericht Köln und dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen abgelehnt worden waren. Dass die Beschwerde indes auf Interesse der Medien stoßen würde, war abzusehen, ging es doch nicht zuletzt um die Zulässigkeit des in dieser Form neuen Sendeformats in der Bundesrepublik. Auf diese Weise gelang es der FDP, nochmals die Tatsache, dass sie ebenfalls einen Kanzlerkandidaten aufgestellt hatte, in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken. Thematisch konzentrierte sich die FDP, wie bereits bei der klassischen Parteienwerbung deutlich wurde, vor allem auf die Kritik an einer zu hohen Abgabenlast für die Bürger und die Einführung niedrigerer Steuersätze. Forderungen danach wurden in fast allen öffentlichen Auftritten und Interviews angesprochen und so in der öffentlichen Wahrnehmung gehalten. Auch das Wahlkampfteam der PDS war darum bemüht, medienwirksame Bilder zu produzieren. So mietete Wahlkampfveranstaltungen. die Bei Partei den einigen Berliner Zirkus Vorstellungen trat „Harlekin“ für dabei der Europaabgeordnete der PDS, André Brie, als Zirkusdirektor auf. Außerdem wurde eine Schiffstour mit der „MS Socialist“ auf der Elbe durchgeführt und vor allem für jüngere Wähler Konzerte und Partys organisiert. Diese Inszenierungen änderten jedoch nichts daran, dass die PDS Schwierigkeiten hatte, eigene Themen zu besetzen, für sich einzunehmen und in der Berichterstattung der Medien zu platzieren. Dies wurde besonders gegen Ende des Wahlkampfes deutlich. Die Unterstützung, die die Opfer des Hochwassers an der Elbe vor allem auch aus den alten Bundesländern erhielten, ließ die Versuche der PDS, sich weiterhin als Partei für den Osten zu präsentieren, zusehends verblassen. Mit der kategorischen Ablehnung eines Bundeswehreinsatzes in einem möglichen Irakkonflikt durch den Bundeskanzler konnte sie sich zudem mit ihrer strikten pazifistischen Gesinnung nicht mehr gegen die SPD abgrenzen. Als schließlich kurz vor dem Wahltermin ein Sieg der SPD wieder im Bereich des Möglichen lag, war 67 auch der Versuch zum Scheitern verurteilt, die Wähler dazu aufzurufen, PDS zu wählen, um zu verhindern, dass Stoiber Bundeskanzler wird 179. Im Nachhinein hat sogar die Tatsache, dass die PDS bis auf die zwei Direktmandate nicht in den Bundestag gewählt wurde, eine erneute Mehrheit von SPD und Grünen im Parlament erst ermöglicht. Betrachtet man die Inszenierungen von Ereignissen der Parteien im Wahlkampf insgesamt, wird deutlich, dass der Medientauglichkeit der jeweiligen Veranstaltungen größte Bedeutung zugemessen wird. Ob mit Akrobaten und Musikern auf Parteiveranstaltungen, bunt lackierten Transportmitteln auf den Wahlkampftouren oder gemeinsamen Auftritten der Spitzenkandidaten mit Sportlern und anderen Prominenten – die Wichtigkeit der Bildkommunikation war im vergangenen Bundestagswahlkampf klar erkennbar. Die Parteien hofften auf diese Weise, verstärkt die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, um ihre Themen einem möglichst großem Publikum unterbreiten zu können. Politische Inhalte werden dabei nicht überflüssig. Sie erfordern jedoch offensichtlich entsprechende Inszenierungen, um von den Medien wahrgenommen und so in die Öffentlichkeit transportiert werden zu können. Althaus schreibt in diesem Zusammenhang: „Politische Inhalte müssen mit echten Bildern gerahmt werden. [...] Metaphern reichen nicht mehr; man muss sehen lassen, was man zu sagen hat“180. 4.3.3 Internetpräsentation Das noch relativ neue Medium Internet bietet den politischen Parteien im Wahlkampf eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Selbstdarstellung. So ermöglicht es die vergleichsweise preisgünstige und schnelle Verbreitung von Informationen, ohne dass diese einer journalistischen Auswahl oder Kommentierung unterliegen. Neben Wahl- und Parteiprogrammen können auch Wahlwerbespots, Bilder von aktuellen Geschehnisse oder Interviews mit Politikern im Netz bereitgestellt werden. Darüber hinaus ist es auch möglich, Diskussionsforen einzurichten, in denen die Nutzer des Internets entweder untereinander oder mit Politikern der jeweiligen Parteien über aktuelle Themen diskutieren können. Da es außerdem möglich ist, Informationen jederzeit bereit zu stellen, kann schnell auf Äußerungen und Handlungen der 179 180 Vgl. Damme: PDS: Absturz aus dem Wahlquartier. S. 277. Althaus: Kameratauglich in die Kampagne. S. 317. 68 politischen Konkurrenz reagiert werden, was etwa den Einsatz von Elementen des Angriffswahlkampfes begünstigt. Trotz dieser Vorteile und obwohl sich die technischen Möglichkeiten seit der Bundestagswahl 1998 deutlich verbessert haben, bewerten die Wahlkampfmanager der Parteien laut der Studie von Marion Müller die Relevanz des Internetauftritts für den Wahlkampf 2002 jedoch geringer als vier Jahre zuvor181. Lediglich die SPD schätzt demnach die Bedeutung leicht höher ein als 1998. Dies mag zum einen daran liegen, dass das Internet nicht mehr den Reiz eines gänzlich neuen Instruments für die Wahlkampfführung hat wie dies noch 1998 der Fall war. Zum anderen erreicht es kein so breites Publikum wie etwa das Fernsehen. Zwar ist die Zahl der Internetnutzer in den vergangenen Jahren stark angestiegen. So sieht etwa Bieber eine sukzessive Entwicklung des Neztes vom Zielgruppen- zum Massenmedium182. Nach wie vor greifen aber hauptsächlich männliche Nutzer im Alter von 14 bis 29 Jahren und Personen mit höherer Schulbildung auf das Angebot im Netz zurück183. Darüber hinaus muss auf die Werbung der Parteien im Internet aktiv zugegriffen werden. Dies bedeutet, dass vor allem ohnehin politisch interessierte Gruppen die Online-Angebote der Parteien nutzen. Ähnlich sieht es Alexander Geisler: „Dass über das Internet der Kontakt mit bislang politisch Uninteressierten hergestellt werden kann, ist dagegen eher unwahrscheinlich“184. Nichtsdestotrotz nutzten die einzelnen Parteien im Bundestagswahlkampf 2002 das Instrument Internet intensiv und waren mit den unterschiedlichsten Formaten präsent. Der SPD stand mit der Webseite »bundeskanzler.de«185 von vornherein ein Format zur Verfügung, dass sich auf die Person Gerhard Schröder konzentriert. Allerdings handelt es sich dabei um ein amtliches Angebot, das nicht zu Wahlkampfzwecken benutzt werden darf. Trotzdem enthält es Elemente, die sich auch auf den Webseiten anderer Parteien – wie etwa der CDU/CSU – wiederfinden lassen und die für den Wahlkampf nützlich waren, ohne eine direkte Werbung darzustellen. Abgerufen werden können beispielsweise die Biografie Schröders, seine Reisestationen im In- 181 Vgl. Müller, Marion: Parteienwerbung im Bundestagswahlkampf (2992), S. 634. Vgl. Bieber: Online-Wahlkampf (2002), S. 282. 183 Vgl. Eimeren/Gerhard/Frees: ARD/ZDF-Onlinestudie (2001), S. 383. 184 Geisler: Alte Gladiatoren, neue Arenen (2002), S. 203. 185 Aufgrund des besseren Leseflusses wird bei der Angabe von Internetseiten auf den Gebrauch des Kürzels „www“ verzichtet. 182 69 und Ausland, die Zielsetzungen der Politik der Bundesregierung sowie Reden und Zitate. Was daher das Element der Personalisierung im Internet betrifft, profitierten die SPD und Schröder im Wahlkampf auch im Internet von dessen Amtsbonus. Zusätzlich richtete die Partei ab Juli 2002 mit »gerhard-schroeder.de« noch eine weitere Internetseite ein, die im Wesentlichen auf die Person Schröders ausgerichtet war und die in erster Linie zur Wahlwerbung genutzt wurde. Nachzulesen waren dort aktuelle Wahlkampfberichte, eine ausführlichere Darstellung von Schröders Lebenslauf und eine regelmäßig erscheinende Kolumne der Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf. Daneben ist die Seite mit zahlreichen Fotos versehen, die Schröder bei der Arbeit, auf Reisen oder auch als Privatmann zeigen. Dagegen diente die SPD-Seite »nichtregierungsfaehig.de« – wie der Name vermuten lässt - ausschließlich dem Angriffswahlkampf. So wurden darin Auftritte und Reden von Politikern der konkurrierenden Parteien dargestellt und kritisch kommentiert. In erster Linie konzentrierte sich die Seite dabei allerdings auf die Kritik an dem Spitzenkandidaten der CDU/CSU, Stoiber, so dass sie sich „zu einer Art Anti-StoiberPortal“186 entwickelt hatte. Mit der Adresse »kampa02.de« bekam auch die Wahlkampfzentrale der SPD einen eigenen Internetauftritt. Diese Seite war weniger auf Personalisierung oder Angriff ausgerichtet, sondern diente vor allem der Information über Aufbau und Arbeitsweise des Wahlkampfteams. Nutzer konnten sich hier über Wahlkampftermine informieren, aktuelle Ereignisse aus im Kampa-Tagebuch nachschlagen oder sich Audio- und Videoclips von Politikerauftritten der SPD herunterladen. Schließlich gab es noch die Webseite »spd-online.de«. Diese wurde als Portal für die interne Kommunikation zwischen Parteimitgliedern, Funktionären und Mitarbeitern genutzt. So wurden dort Hintergrundinformationen zum Wahlkampf bereit gehalten, um die Wahlkampfführung besser abzustimmen. Von der Gestaltung her fügte sich der Internetauftritt der SPD gut in das Gesamtbild des sonstigen Wahlkampf ein. Eine Ausnahme bildete jedoch die Seite »gerhard-schroeder.de«, die sich im Design von den anderen Webseiten der Partei unterschied. Das Pendant zur Personalisierungsstrategie der SPD im Internet bildete bei der Union die Seite »stoiber.de«, die bereits Anfang Mai 2002 bereit gestellt wurde. Unter den Stichpunkten „Mein Leben“, „Meine Arbeit“, und „Meine Ziele“ konnten 186 Bieber: Online-Wahlkampf (2002), S. 278. 70 beispielsweise die Biografie Stoibers oder seine politischen Einstellungen zu bestimmten Themen abgerufen werden. Damit sollten, ähnlich wie bei »gerhardschroeder.de«, in erster Linie die persönlichen Eigenschaften des Kandidaten der CDU/CSU herausgestellt werden. Unter dem neutral klingenden Seitennamen »wahlfakten.de« brachte die Union Elemente des Angriffswahlkampfs in den Wahlkampf ein. Dabei setzte sie mit dem Prinzip der Rapid Response erstmals in der Bundesrepublik ein Instrument ein, das sie der US-amerikanischen Wahlkampfführung entnommen hatte. Zweck dieses Instrumentes ist es, während der Reden von Politkern der konkurrierenden Parteien deren Inhalte aufzulisten, zu analysieren und kritisch zu kommentieren. Um den Eindruck von Neutralität zu wahren, wurden die Positionen der CDU/CSU gleichzeitig mit „objektiven Fakten und Quellenangaben belegt“187. Aufgrund der subjektiven Auswahl, sowohl von Zitaten als auch von Belegen, besteht jedoch kein Zweifel, dass es sich bei »wahlfakten.de« um ein Wahlkampfinstrument gehandelt hat. Die so gesammelten Zitate und die dazu gehörigen Kommentare wurden anschließend archiviert und waren jederzeit, nach Themen geordnet, wieder abrufbar. Erstmals wurde dieses Instrument bereits im November 2001 zur Rede Gerhard Schröders auf dem Bundesparteitag der SPD angewendet188. Die Zielgruppe der Seite stellten hauptsächlich politisch interessierte Bürger und Journalisten dar. Ergänzt wurde der Internetauftritt der Union durch das im Juni 2002 eingerichtete Portal »zeit-fuer-taten.de«. Laut dem Kampagnenbericht der CDU diente es als ein „umfassender Informationsservice für alle Wählerinnen und Wähler“189. Auf Personalisierung und polemische Angriffe auf die konkurrierenden Parteien wurde daher weitgehend verzichtet. Stattdessen fanden die Nutzer Zugang über die Einzelrubriken „Themen“, „Menschen“ und „Regionen“. Der Inhalt bestand aus Informationen über die Ziele der Union, Auswirkungen ihrer Vorhaben auf einzelne Berufsgruppen und Lösungsvorschlägen zu spezifischen Problemen in einzelnen Regionen. Die Seite »wahlkreis300.de« stellte schließlich eine Politiksimulation dar, die vorwiegend Jung- und Erstwähler ansprechen sollte. Dabei sollte in einem fiktiven Internet-Wahlkreis ein Abgeordneter gewählt werden. Allerdings stellte die Union 187 Kampagnenbericht der CDU, S. 27. Vgl. ebd. 189 Ebd., S. 26. 188 71 hierbei lediglich den Rahmen und gab Kommunikationsanreize, während die kommunikative Tätigkeit der Teilnehmer im Vordergrund stand190. Auffällig ist, dass die Union bei der Bezeichnung ihrer Internetauftritte mit »wahlfakten.de« und »wahlkreis300.de« neutralere Adressen wählte als dies bei der SPD der Fall war. Für die Informationsseite »zeit-fuer-taten.de« wurde jedoch auch eine Überschrift verwendet, die bereits als Motto aus der klassischen Parteienwerbung bekannt war. Auch die Grünen trugen der Popularität des Außenministers Fischer in der Bevölkerung mit einem personalisierten Internetauftritt Rechnung. Unter der Adresse »joschka.de« richteten sie eine Webseite ein, die ganz auf ihren Spitzenkandidaten zugeschnitten war. In den Rubriken „Joschka lebt“, „Joschka wirkt“ und „Joschka kämpft“ konnten die Wähler Texte und Bilder über seinen Lebenslauf, seinen politischen Werdegang und seine aktuellen Wahlkampfaktivitäten erlangen. Darüber hinaus setzt sich die Seite auch kritisch mit der linksradikalen Vergangenheit Fischers auseinander. Die eigentliche Wahlkampfseite der Grünen war unter »gruen-wirkt.de« zu finden. Die Adresse gibt gleichzeitig das Motto „Grün wirkt“ wieder, das sich durchgängig durch den gesamten Wahlkampf der Partei zog. Inhaltlich bot die Seite die Wahl- und Grundsatzprogramme sowie verschiedene Videos an. Daneben konnte man sich über die Ziele grüner Politik informieren und den Wahlkampfverlauf verfolgen. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, der Partei online Geld zu spenden. Merkmale des Angriffswahlkampfs sind auf der Internetseite der Grünen kaum zu finden. Dagegen werden verstärkt die Ziele betont, die die Partei während der ersten Legislaturperiode in der Bundesregierung erreicht hat. Rein äußerlich fügten sich die in grün gehaltenen Internetseiten nahtlos in das Erscheinungsbild der Partei im gesamten Wahlkampf ein. Da die FDP mit Guido Westerwelle erstmals auch einen Kanzlerkandidaten aufstellte, kann es nicht verwundern, dass auch sie mit einer personalisierten Seite im Internet vertreten war. Unter »guido-westerwelle.de« präsentierte sich der Spitzenkandidat als „Der Kanzler für mehr Netto, mehr Bildung, mehr Arbeit“. Ähnlich wie bei den auf Personen zugeschnittenen Seiten der anderen Parteien erhielt man auch hier 190 Vgl. Bieber: Online-Wahlkampf (2002), S. 278. 72 Hintergrundinformationen zu zentralen Aussagen Westerwelles oder Termine seiner Wahlkampfauftritte. Daneben bestand die Möglichkeit, sich Programme wie etwa Bildschirmschoner im FDP-Design herunterzuladen. Anders als bei den anderen Parteien sind aber auf dieser Seite keine Informationen zu Westerwelles Biografie zu finden. Passend zur bereits angesprochen Tour durch Deutschland im „Guidomobil“ wurde außerdem die Seite »guidomobil.de« eingerichtet. Den Schwerpunkt bildete dabei das sogenannte Tourtagebuch, in dem Bilder und Informationen zu den einzelnen Stationen abgerufen werden konnten, sowie Presseberichte über die Tour selbst. Politische Inhalte oder Angriffe auf die anderen Parteien waren hier nicht zu finden. Schließlich stellte die FDP - ähnlich wie die Grünen - mit »achtzehnzweitausendzwei.de« ein Online-Spendenportal bereit, was für Bieber „den möglicherweise gewagtesten Versuch zur Übernahme amerikanischer Wahlkampfformate“191 darstellt. Diese Möglichkeit zu spenden wurde immerhin von 227 Internetnutzern wahrgenommen und brachte einen Betrag von knapp 21 000 Euro ein192. Wie bei den Grünen entsprach auch die Internetpräsentation der FDP dem sonstigen Bild der Partei im Wahlkampf. Die Seiten waren vorwiegend in blau und gelb gehalten und die Zahl 18 war durchgehend präsent. Auch beim Auftritt im Internet weicht die PDS von den Personalisierungsstrategien der übrigen Parteien ab. Als einzige Partei hatte sie im Bundestagswahlkampf 2002 keine eigene Seite für einen Spitzenkandidaten. Stattdessen war auf der Wahlkampfseite »pds2002.de« das „Spitzenquartett“ Bartsch, Zimmer, Claus und Pau zu sehen. Angriffe auf die politische Konkurrenz standen auf der Seite der PDS nicht im Vordergrund. Das inhaltliche Angebot stellte sich dafür allerdings sehr umfangreich dar. Unterschiedliche Kategorien informierten über Kandidaten, Positionen, aktuelle Meldungen, Statistiken und die Bundestagswahl selbst. Daneben waren auch interaktive Angebote mit Spielen und einem Chat-Bereich aber auch die Möglichkeit zu spenden vorhanden. Dass die PDS mit ihrem Internetauftritt auch Erstwähler ansprechen wollte, wird an dem Link „Erste (Wahl)hilfe“ deutlich. In 191 Ebd. 73 diesem Bereich werden der Stimmzettel zur Bundestagswahl erläutert und politische Begriffe erklärt. Äußerlich wirkt die Webseite der PDS eher unübersichtlich. Auch fügt sich das Design nicht in ein Gesamtbild mit dem sonstigen Auftreten der Partei. Betrachtet man die Internetauftritte aller Parteien, fällt zunächst auf, dass für den Wahlkampf durchgehend neue Seiten eingerichtet wurden. Die Hauptseiten der Parteien dienten dabei in erster Linie als Portal zu diesen speziellen Wahlkampfadressen. Bis auf die PDS legten alle Parteien großen Wert auf die Personalisierung ihrer jeweiligen Spitzenkandidaten, was in der Einrichtung von strikt personenbezogenen Internetseiten zum Ausdruck kommt. Über Webseiten, die hauptsächlich auf einen Angriffswahlkampf gegen die politische Konkurrenz ausgerichtet waren, verfügten lediglich SPD und CDU/CSU. Dabei kritisierten sich diese Parteien und deren Kandidaten vorwiegend gegenseitig. Wahlkampfauftritte von Politikern und medienwirksame Aktionen der eigenen Partei wurden in der Regel im Internet nochmals thematisiert, aufbereitet und kommentiert. Für Bieber dokumentieren diese Webseite daher „den Trend der permanenten Mediatisierung allen Wahlkampfhandelns“193. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die jeweilige Selbstdarstellung der Parteien im Internet in der Regel einen professionellen Eindruck machte und sich gut in das Gesamtbild, das die jeweiligen Parteien von sich vermitteln wollten, einfügte. 4.3.4 Die Fernsehduelle Mit den beiden Fernsehduellen zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber, die im August und September 2002 jeweils zeitgleich in den Privatsendern RTL/SAT1 und den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD/ZDF ausgestrahlt wurden, gab es ein Novum in der Geschichte Bundesdeutscher Wahlkämpfe. Nach dem Vorbild der amerikanischen Debatten vor den Präsidentschaftswahlen in den 1970er und 1980er Jahren standen sich der Bundeskanzler und der Kanzlerkandidat der CDU/CSU jeweils 75 Minuten gegenüber, um ihre Positionen zu verschiedenen politischen Themen darzulegen. Dabei sahen die Regeln, auf die sich die Wahlkampfteams geeinigt hatten, weniger vor, dass die Politiker direkt miteinander diskutieren sollten. Vielmehr stand ihnen ein streng begrenztes Zeitlimit zu, um auf Fragen der Moderatoren 192 zu antworten. Die Durchführung Vgl. Biesel: Kampagne mit Gewinn (2003), S. 241. 74 von Fernsehduellen führte zwangsläufig zur Zuspitzung einer ohnehin schon beobachtbaren Tendenz zur Personalisierung im Wahlkampf. Bei keinem anderen Wahlkampfauftritt hatten Kanzler und Kandidat eine so ausführliche Gelegenheit, sich selbst vor einem Massenpublikum in Szene zu setzen. Im öffentlichen Interesse der Zuschauer und der Medien standen denn auch nicht nur die Sachargumente und die politische Programmatik, sondern vor allem der direkte Vergleich des persönlichen Auftretens der Politiker vor laufenden Kameras. Deutlich wurde dies besonders in der Auswertung der Duelle in den Massenmedien, die direkt im Anschluss an die Sendungen einen Sieger zu bestimmen versuchten und sich dabei häufig auf das persönliche Auftreten der Duellanten bezogen194. So vermutet auch Donsbach, dass die persönliche Performance der Politiker für die Mehrheit der Zuschauer von größerem Interesse war als die angesprochenen politischen Themen: „Die Menschen tendieren dazu, Personen, die sie auf dem Bildschirm sehen, nach gleichen Kriterien zu beurteilen, egal ob sie Showmaster oder Politiker sind“195. Trotz der strengen Regeln, die für beide Duelle gleichermaßen galten, waren in den Sendungen Unterschiede in Auftreten und Selbstdarstellung der beiden Kontrahenten zu beobachten. Im ersten Duell hielten sich Schröder und Stoiber sehr streng an den vorgegebenen Rahmen. Im Urteil der Zuschauer wurde diese starre Einhaltung der Regeln zwar durchaus heftig kritisiert196, sie schien aber gerade für Edmund Stoiber von Vorteil zu sein. Dem von vornherein als weniger medienkompetent geltenden Kandidaten der Union kam der formale Rahmen sehr zupass, während er Gerhard Schröder eher hinderlich zu sein schien. Im Ergebnis wurde die erste Sendung dann auch meist als Remis zwischen den beiden Politikern gewertet. So schreibt Hilmer: „In der ersten Debatte gelang es Stoiber, in Auftreten, Kompetenz und Glaubwürdigkeit mitzuhalten, in punkto Überzeugungskraft lag er im Zuschauerurteil sogar vor dem Kanzler. Er widerlegte damit das Klischee, Schröder im Hinblick auf die Medienwirkung weit unterlegen zu sein“197. Thematisch konzentrierte sich Stoiber dabei auf die Kritik der Wirtschafts- und Steuerpolitik der Bundesregierung. Schröder hingegen thematisierte mehr Hochwasserkatastrophe und die Umweltschutzpolitik. 193 Vgl. Bieber: Online-Wahlkampf (2002), S. 279. Vgl. u.a. Herzinger: And the Winner is: Gerhard, in: Die Zeit, Nr. 37/2002. 195 Donsbach: Sechs Gründe gegen Fernsehduelle (2002), S. 22. 196 Vgl. Dehm: Fernsehduelle im Urteil der Zuschauer (2002), S. 602. 197 Hilmer: Bundestagswahl 2002 (2003), S. 199. 194 75 die Folgen der Im zweiten Duell galten zwar noch immer dieselben Regeln. Allerdings wurden diese des Öfteren vor allem vom Bundeskanzler durchbrochen, indem er etwa gelegentlich sein Zeitlimit überschritt und Aussagen Stoibers zum Teil direkt kommentierte. Auf diese Weise konnte er seine Medienkompetenz wesentlich besser zur Geltung bringen. Donsbach beurteilt die veränderte Situation wie folgt: „Auf diesem neuen Terrain war Edmund Stoiber chancenlos. Er war nicht viel anders und nicht merklich schlechter als beim ersten Mal. Aber er hatte einen von Fesseln befreiten Gegner und damit einen anderen Resonanzboden für seine ihm eigene Art“ 198. Die Taktik Schröders ging sogar so weit, dass er versuchte, Stoiber als lächerlich hinzustellen. Etwa indem er ihn, als dieser sich bei dem Wort Sechshundertdreißig-Mark-Gesetz zweimal versprach: „Sechssssdreißig Mark...Sechssssdreißig-Mark-Gesetz“199, gutmütig lächelnd verbesserte: „Das heißt: Sechshundertdreißig.“ Schröder selbst beschreibt den Unterschied zwischen den beiden Sendungen wie folgt: „Die Moderatoren der ersten Sendung hatten sich sehr darauf beschränkt, anstatt ein Gespräch in Gang zu bringen, mit der Stoppuhr zu agieren. Das haben die beiden Damen beim zweiten Durchgang besser gemacht“200. In der Folge wurde Schröders Auftreten in einer Umfrage von Infratest dimap nach dem persönlichen Profil in den Bereichen Sympathie, Kompetenz, Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit und Fairness durchgehend deutlich positiver bewertet als das von Stoiber201. Inhaltlich setzte Stoiber seinen Schwerpunkt erneut beim Thema Wirtschaftspolitik. Außerdem versuchte er stets, die hohe Zahl der Arbeitslosen anzusprechen, auch dann, wenn gerade ganz andere Themen im Gespräch waren. Schröder dagegen thematisierte bei diesem Duell vor allem die Familien- und Außenpolitik. Bei letzterer nutzte er hauptsächlich den drohenden Irakkonflikt zu der Aussage, dass sich die Bundeswehr unter seiner Kanzlerschaft unter keinen Umständen an einem Einsatz in dem arabischen Land beteiligen werde. Bei den Wählern stieß das neuartige Format auf großes Interesse. Beide Sendungen verfolgten jeweils mehr als 15 Millionen Zuschauer. Damit erreichten die beiden TVDuelle ein weitaus größeres Publikum als jede andere Wahlsendung202. Dagegen 198 Donsbach: Sechs Gründe gegen Fernsehduelle (2002), S. 25. Hier zitiert nach: Der Spiegel, Nr. 38/2002, S. 71. 200 Vgl. Gerhard Schröder im Spiegel-Interview: "Die haben zu früh triumphiert", in: Der Spiegel, Nr. 38/2002, S. 37. 201 Vgl. Untersuchung von Infratest dimap zum TV-Duell der Kanzlerkandidaten am 8. September 2002: www.infratest-dimap.de/wahlen/tvduell02/default.htm 202 Vgl. Dehm: Fernsehduelle im Urteil der Zuschauer (2002), S. 600. 199 76 wurde die Bedeutung, die die TV-Duelle im Wahlkampf besaßen, von den Wahlkampfmanagern der Parteien sehr unterschiedlich beurteilt. Dabei ist auffällig, dass die CDU/CSU, obwohl sie sich für die Durchführung der Duelle eingesetzt hatte, diesem Sendeformat in der Untersuchung von Marion Müller nur sieben von möglichen zehn Punkten gab. Die SPD dagegen spricht den beiden Sendungen die höchste Bedeutung aller Wahlwerbemittel zu. Da die kleineren Parteien nicht an den Duellen beteiligt waren, ist es nicht verwunderlich, dass sie für die Grünen und die PDS nur eine geringe Bedeutung hatten. Die FDP allerdings, die gegen den Ausschluss Guido Westerwelles von der Teilnahme an den Duellen Verfassungsbeschwerde erhob, maß deren Bedeutung wie auch die SPD den höchsten Wert für die Wahlkampfführung zu 203. Die Beschwerde der FDP unterstreicht dabei einen Kritikpunkt an den Fernsehduellen, der auch allgemein häufig geäußert wurde: die Benachteiligung kleiner Parteien. Donsbach schreibt: „Die Zuspitzung des politischen Kampfes auf zwei Kanzlerkandidaten lässt die kleineren Parteien in der öffentlichen Wahrnehmung verblassen und verringert damit ihre Chancen“204. Dementsprechend sah auch die FDP ihre Chancengleichheit im Wahlkampf bei einer Nichtteilnahme nicht mehr gewahrt. Die Klage wurde allerdings vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung vorausgegangene angenommen. Entscheidungen Damit des bestätigte das Verwaltungsgerichts Gericht Köln und zwei des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen. Zur Begründung hieß es, bei den TVDuellen handele es sich um eine redaktionell gestaltete und von den Rundfunkanstalten verantwortete Sendung, die trotz einer von ihr möglicherweise ausgehenden Werbewirkung nicht als Wahlwerbesendung qualifiziert werden könne. Damit würde die Gestaltung der Sendungen Artikel 5 GG, der das Recht auf Pressefreiheit und Freiheit der Berichterstattung beinhaltet, unterliegen. Das Konzept der Sendungen sei darüber hinaus so gestaltet, dass diejenigen Politiker einander gegenüber gestellt würden, die allein ernsthaft damit rechnen könnten, zum Bundeskanzler gewählt zu werden. Dies sei beim Spitzenkandidaten der FDP nicht der Fall. Diese Tatsache sei von der Partei als Folge der bestehenden politischen Kräfteverhältnisse hinzunehmen205. 203 Vgl. Müller, Marion: Parteienwerbung im Bundestagswahlkampf (2002), S. 634. Donsbach: Sechs Gründe gegen Fernsehduelle (2002), S. 22. 205 Vgl. BVerfG (2. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. v. 30.08.2002 – 2 BvR 1332/02. 204 77 Trotz dieses Beschlusses muss die Nutzung des Formates von Fernsehduellen in bundesdeutschen Wahlkämpfen kritisch hinterfragt werden. So sieht auch Rudi Hoogvliet die Gefahr, dass „die Fokussierung auf die beiden großen Parteien durchaus einen Einfluss auf das Wahlergebnis haben kann“206. Die Benachteiligung kleinerer Parteien ist dabei jedoch nur einer von mehreren Aspekten. So muss auch der Hinweis des Bundesverfassungsgerichts auf das redaktionelle Konzept der Sendungen skeptisch betrachtet werden. Auf das Format mit seinen strengen Regeln einigten sich schließlich in erster Linie die beiden Wahlkampfteams von SPD und Union. Zwar ist es richtig, dass letztendlich die Sender über das Sendeformat bestimmen. Allerdings ist es fraglich, ob sich die beiden Parteien auch dann auf ein Duell eingelassen hätten, wenn das Konzept der Rundfunkanstalten von ihren Vorgaben abgewichen wäre. So bestätigt Röseler, dass sich die Wahlkampfteams weitgehend über das Format einig waren, während sich die Sender ursprünglich für eine „wesentlich lockerere Gesprächsatmosphäre“207 ausgesprochen hätten. Zudem besteht die Gefahr, dass die strikte Übernahme des Sendeformats aus dem amerikanischen Wahlkampf bei den Zuschauern zu einer verzerrten Wahrnehmung der deutschen Verfassungswirklichkeit führt. Die extreme Personalisierung in den Fernsehduellen kann leicht den Eindruck erwecken, der Bundeskanzler könne direkt gewählt werden. Die bedeutende Rolle, die der Bundestag bei der Wahl des Kanzlers spielt, wird völlig ausgeblendet. Ähnlich verhält es sich mit der Rolle der Parteien, deren Bedeutung bei der Aufstellung ihrer Kandidaten bei der Konzentration auf die Persönlichkeiten der Politiker in den Fernsehduellen verblasst. Daher muss bezweifelt werden, ob dieses Fernsehformat mit unserem politischen System vereinbar ist. 4.4 Alles anders? Ein Vergleich mit früheren Wahlkämpfen Die Untersuchung des Bundestagswahlkampfes 2002 hat gezeigt, dass sich in der Selbstdarstellung der Parteien in den Medien häufig die Merkmale widerspiegeln, die mit dem Schlagwort „Amerikanisierung“ assoziiert werden. Dies reicht von der professionellen Planung der Wahlkampfführung über Personalisierung und Angriffswahlkampf bis zur medienwirksamen Inszenierung von Politikerauftritten. Doch wie neu und innovativ sind die geschilderten Elemente des Wahlkampfes? An dieser Stelle soll schlaglichtartig dargestellt werden, welche Merkmale bereits in 206 Interview mit Hoogvliet vom 04.07.2003. 78 vorangegangenen Bundestagswahlkämpfen auftauchten und bei welchen es sich wirklich um eine neue Form der Wahlkampfführung handelt. Betrachtet werden soll zunächst die Professionalisierung der Wahlkampfführung. Wie bereits dargestellt wurde, zeichnete sich die Organisation des Wahlkampfes 2002 insbesondere bei SPD und Union durch ein hohes Maß an Planung und Koordination aus: einzelne Arbeitsgruppen konzentrierten sich auf spezielle Bereiche, die Kommunikation wurde eng und regelmäßig zwischen Bundestagsfraktionen, den Regierungen der Bundesländer und der Partei selbst abgestimmt und die Hauptverantwortung lag in der Hand erfahrener Medienprofis. Albrecht Müller, der unter anderem als Ghostwriter für den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller tätig war, weist jedoch darauf hin, dass bereits der Wahlkampf 1969 sehr professionell geführt worden sei. So seien etwa die Fernsehspots der SPD von einem bekannten Fernsehregisseur gedreht worden und insbesondere Schiller habe mit intensiver Medienarbeit darauf geachtet, Journalisten rechtzeitig vor medienrelevanten Ereignissen über deren Stattfinden zu informieren 208. Die Tatsache, dass Schiller selbst die Planung dieser Ereignisse durchführen ließ, zeigt allerdings, dass die Wahlkampforganisation keineswegs so zentralisiert durchgeführt wurde, wie dies 2002 der Fall war. Auch sonst wurden bei vielen Wahlkämpfen zwar schon unabhängige Werbeagenturen und Medienexperten für die Planung und Durchführung der Parteienwerbung engagiert. Eine von vornherein so gründlich strukturierte Wahlkampfleitung wie sie 1998 mit der Kampa eingeführt wurde und die bei der vergangenen Wahl in ähnlicher Form auch bei der Union zu beobachten war, gab es bis dahin aber noch nicht. Auch die Rollen der beiden hauptverantwortlichen Wahlkampfmanager bei SPD und Union, Machnig und Spreng, kommen den Aufgaben von professionalisierten Spindoctors näher als dies bei ihren Vorgängern der Fall war. Zwar weist Albrecht Müller auch hier darauf hin, dass seine Arbeit bei Schiller nichts anderes als Spindoctoring209 gewesen sei. Von den Entscheidungsbefugnissen unabhängiger Spindoctors nach amerikanischem Vorbild war er jedoch noch wesentlich weiter entfernt, als dies bei Machnig und Spreng der Fall war. Was die Personalisierung betrifft, so waren auch die meisten früheren Wahlkämpfe auf Personen fokussiert. So weist Bösch darauf hin, dass sich bereits die 207 Interview mit Röseler vom 24.06.2003. Vgl. Müller, Albrecht: Von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie (1999), S. 51ff. 209 Vgl. ebd., S. 52f. 208 79 Wahlkämpfe der CDU 1953 und 1957 stark auf die Person Konrad Adenauers konzentrierten: „Die Wähler entschieden sich mehrheitlich weniger für die CDU als für deren Spitzenkandidaten“210. So wurden schon damals Plakate mit dem Konterfei Adenauers gedruckt, auf denen zum Teil selbst das Parteilogo fehlte 211. Auch als Privatmann ließ sich Adenauer häufig für die Medien fotografieren. Am bekanntesten sind wohl die Bilder, die ihn beim Boule-Spielen im Kreise der Familie zeigen. Aber auch in den folgenden Wahlkämpfen spielten Personen eine wichtige Rolle. So warb die CDU 1969 auf einem Wahlplakat, das Kurt Kiesinger zeigte, mit dem Slogan: „Auf den Kanzler kommt es an“. Ähnlich textete die SPD 1972: „Willy Brandt muss Kanzler bleiben“. Auch Helmut Schmidt für die SPD und Franz Josef Strauß für die Union standen deutlich im Mittelpunkt der Wahlkämpfe 1976 und 1980. Und schließlich warb auch die FDP gerne mit ihren Spitzenpolitikern Walter Scheel und HansDietrich Genscher. Eine Zuspitzung der Personalisierung, die 2002 letztendlich auf die Frage „Ich oder der“212 hinauslief, war in diesem Ausmaß in vorangegangenen Wahlkämpfen jedoch kaum zu beobachten. Dazu beigetragen haben zum einen die erstmals durchgeführten Fernsehduelle nach amerikanischem Vorbild, die sich zwangsläufig auf die Personen Schröder und Stoiber beschränkten. Doch der Duellcharakter des Wahlkampfs war auch schon vor der Ausstrahlung dieser Sendungen erkennbar. So gab es bereits im Vorfeld entsprechende Duelle in verschiedenen Printmedien213. Im Vorwahlkampf ließ zudem das Medieninteresse an der unionsinternen Diskussion über den Spitzenkandidaten eine starke Ausrichtung des Wahlkampfes an Personen erwarten. Schließlich weist auch die erstmalige Nominierung eines Spitzenkandidaten bei den Grünen und die Aufstellung eines Kanzlerkandidaten durch die FDP auf eine stärkere Bedeutung der Personalisierung im Bundestagswahlkampf 2002 hin. Dagegen schien der Angriffswahlkampf auf die politischen Gegner bei der Bundestagswahl 2002 keine neue Qualität zu haben. So zeigten 1980 Wahlplakate der Union zwei Affen unter der Überschrift: „Eine Affenschande, was die SPD/FDPKoalition mit uns macht“. Die SPD druckte im selben Wahlkampf ein Plakat mit einem Zitat von Adenauer: „Wenn einem so de Affären nachlaufen, wie dem Herrn Strauß, dat kommt nit von allein“. 1976 prägte die CDU in Bezug auf die SPD den Slogan: 210 Bösch: Vorreiter der modernen Kampagne (2002), S. 443. Ein ähnliches Plakat der CDU, das 1994 lediglich Helmut Kohl inmitten einer Menschenmenge zeigte, wurde weiter oben bereits erwähnt. 212 Der Spiegel, Nr. 35/2002, S. 48. 213 Vgl. u.a. Bild vom 06.07.2002. 211 80 „Freiheit statt Sozialismus“. Und auch persönliche Angriffe blieben bei Wahlkämpfen nicht aus. So wies Adenauer 1961 auf die uneheliche Geburt Brandts hin; 1972 wurden dessen Vorlieben für Alkohol und seine Affären mit Frauen von der politischen Konkurrenz für Wahlkampfzwecke benutzt.214 Im vergangenen Wahlkampf ermöglichte der technische Fortschritt den Parteien zwar Angriffe gegen die Konkurrenz schneller und umfangreicher zu veröffentlichen. In Bezug auf Qualität und Aggressivität brachte der Angriffswahlkampf vor der Bundestagswahl 2002 dagegen keine Neuerung. Auch die Methode des Ereignismanagements konnte in früheren Wahlkämpfen oft beobachtet werden. Die Parteien waren schon immer bemüht, die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. So begab sich Adenauer schon 1957 mit einem luxuriös ausgestatteten Sonderzug in Begleitung zahlreicher Journalisten auf Wahlkampftour. Und die SPD verwendete 1969 erstmals Anzeigen, in denen Prominente für sie warben – ein Ereignis, das sich zu dieser Zeit der Aufmerksamkeit der Medien sicher sein konnte. Daneben berichtet Müller von gezielten Planungen der SPD-Wahlkampfleitung ausländischen Gästen von 1969, Willy Auslandsreisen Brandt und durchführen zu Inlandsreisen lassen, um mit die Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen215. Dennoch scheint das Ausmaß der Inszenierungen im Bundestagswahlkampf 2002 eine neue Qualität erreicht zu haben. Insbesondere der „Spaßwahlkampf“ der FDP erweckte den Eindruck, dass die Inszenierungen medienwirksamer Ereignisse nicht allein den Sinn hatten, das Interesse der Journalisten zu wecken, um so die politischen Botschaften der Partei besser transportieren zu können. Vielmehr wirkten die Wahlkampfaktionen der FDP, als seien die Inszenierungen selbst der eigentliche Zweck und dienten ausschließlich dazu, medientaugliche Bilder zu produzieren. Doch auch die Veranstaltungen von SPD und Union mit umfangreichen Rahmenprogrammen drängten politische Inhalte zu Gunsten von medialen Inszenierungen weiter in den Hintergrund als dies in früheren Wahlkämpfen der Fall war. Dieser kurze Vergleich zu früheren Wahlkämpfen zeigt, dass die in der Literatur angeführten Merkmale von „Amerikanisierung“ zum Teil auch schon in früheren Wahlkämpfen zu beobachten waren. Häufig waren sie jedoch nicht so ausgeprägt wie dies vor der Bundestagswahl 2002 der Fall war. Insbesondere beim Ausmaß der 214 Vgl. Schöllgen: Willy Brandt (2001), S. 184. 81 Personalisierung und des Ereignismanagements hat der letzte Wahlkampf neue Akzente gesetzt. Zudem zeigte sich eine starke Professionalisierung in der Wahlkampfplanung. Dies ist vor allem auf die Einführung der Kampa 1998 zurückzuführen. 5. Fazit Die vorangegangene Darstellung hat gezeigt, dass die Selbstdarstellung der Parteien in den Medien im Wahlkampf 2002 mehrere Elemente aufwies, die in der wissenschaftlichen Literatur als Merkmale einer „Amerikanisierung“ angeführt werden. Insbesondere war die Absicht der Parteien erkennbar, ihre jeweilige 215 Vgl. Müller, Albrecht: Von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie (1999), S. 46f. 82 Kampagne professionell zu managen, ihre Spitzenkandidaten in den Vordergrund zu stellen und die Darstellung ihrer politischen Themen in medienwirksam inszenierten Ereignissen zu verpacken. Die Gründe dafür können zum einen in den medialen und politischen Rahmenbedingungen gesehen werden. Mit einer im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen verstärkten Personalisierung und Ereignisinszenierung tragen die Parteien einem sich weiterentwickelnden Mediensystem Rechnung. Dieses hat Mitte der 1980er Jahre mit der Einführung des privaten Rundfunks eine einschneidende Zäsur erfahren, in deren Folge die Konkurrenz unter den Sendern und damit das Interesse an der Produktion von publikumswirksamen Bildern deutlich zugenommen hat. Die rasante Entwicklung des Internets, die rund zehn Jahre später einsetzte und der Berichterstattung eine nie dagewesene Aktualität ermöglicht, verstärkt die Veränderung der medialen Landschaft zusätzlich. Hinzu kommt eine abnehmende Parteiidentifikation der Bürger, in deren Folge die Mobilisierungsfunktion der Parteien zunehmend an Bedeutung verliert. Stattdessen wird diese Aufgabe verstärkt von den Massenmedien übernommen. Dies bedeutet, dass die Parteien stärker als früher auf die Medienberichterstattung und deren Regeln angewiesen sind, wenn sie Wählerstimmen für sich gewinnen wollen. Der Wahlkampf 2002 hat jedoch auch gezeigt, dass der Produktion medienwirksamer Bilder um jeden Preis Grenzen gesetzt sind. So versuchte insbesondere die FDP mit unkonventionellen Methoden, die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Diese Vorgehensweise schien zwar anfangs erfolgversprechend zu sein. Als jedoch mit dem Hochwasser der Elbe und dem drohenden Irakkonflikt ernsthafte gesellschaftliche Probleme in den Mittelpunkt des Interesses rückten, schien dieser „Spaßwahlkampf“ zunehmend unangebracht. Die Möglichkeiten der politischen Parteien, sich der Medienlogik und ihrem Bedarf nach spektakulären Bildern zu unterwerfen, sind also nicht unbegrenzt. Zum anderen haben sich einige Elemente des Wahlkampfes 2002 eindeutig auch an amerikanischen Methoden orientiert. Dies zeigte sich in der erstmaligen Nutzung des Formats der Fernsehduelle am deutlichsten. Aber auch am Einsatz bestimmter Internetinstrumente, wie etwa dem Online-Fundraising und dem Einsatz von Rapid Response, oder an der Durchführung von bunt gestalteten Parteiveranstaltungen war dies erkennbar. Sucht man nach Gründen dafür, sind vor allem die politischen und medialen Systemunterschiede zwischen den USA und der Bundesrepublik zu 83 beachten. So finden Wahlen in den USA wesentlich häufiger statt. Der Präsident wird alle vier Jahre, das Repräsentantenhaus sowie ein Drittel des Senats werden alle zwei Jahre neu gewählt. Hinzu kommen Wahlen auf bundesstaatlicher Ebene. Die Wahlkampfführung ist dabei nicht zentralisiert, sondern findet für jeden Kandidaten gesondert statt. Da zudem die politischen Parteien wesentlich unbedeutender sind als in Deutschland, werden überwiegend private Unternehmen mit der Organisation und Durchführung von Wahlkämpfen beauftragt. Schließlich ist auch das Mediensystem der USA schon immer fast vollständig in der Hand privater Unternehmen, so dass Wahlkämpfer in diesem Bereich eine lange Erfahrung bei der Produktion medienwirksamer Ereignisse haben. All diese Faktoren machen die USA zu einem idealen Experimentierfeld in Sachen Wahlkampfführung. Neuen Methoden und Innovationen bieten sich aufgrund des Wettbewerbs vieler Beraterfirmen wesentlich mehr Chancen, getestet zu werden. Gleichzeitig ist deren Erfolg oder Misserfolg aufgrund der Vielzahl von Wahlen leichter auszumachen als in der Bundesrepublik. Daher verwundert es nicht, wenn sich deutsche Parteien für ihre Wahlkampfplanung an erfolgreichen amerikanischen Konzepten orientieren. Ob angesichts dessen allerdings die Anwendung des Begriffes „Amerikanisierung“ auf den deutschen Wahlkampf gerechtfertigt ist, darf bezweifelt werden. So setzen gerade die angesprochenen Systemunterschiede einer grundsätzlichen Übernahme amerikanischer Methoden auch enge Grenzen. Vor diesem Hintergrund ist daher auch die Übernahme der Fernsehduelle nach amerikanischem Vorbild in den deutschen Wahlkampf problematisch zu beurteilen. Ist dieses Sendeformat in einem Präsidentschaftswahlkampf, bei dem sich lediglich zwei Personen dem Votum der Wähler stellen, durchaus ein sinnvolles Instrument der Wahlkampfführung, verzerrt es in einem parlamentarischen Regierungssystem mit gewollter pluralistischer Parteienlandschaft wie der Bundesrepublik leicht die Verfassungswirklichkeit. Beim Publikum entsteht der Eindruck, die beiden Kontrahenten könnten direkt durch das Volk in das Amt des Bundeskanzlers gewählt werden. Die tragenden Rollen, die die Parteien bei der Aufstellung der Kandidaten und der Bundestag bei der Bestimmung des Regierungschefs haben, werden dabei völlig ausgeblendet. Zudem lässt ein Medienereignis, das auf ein solch großes öffentliches Interesse stößt und sich dabei nur auf die Spitzenvertreter der beiden größten Parteien konzentriert, die Wahrnehmung der kleineren Parteien in den Hintergrund rücken. Aus diesen Gründen ist die direkte Übernahme dieses 84 Sendeformats kaum mit dem politischen System in der Bundesrepublik vereinbar. Nichtsdestotrotz lässt der mediale Erfolg der beiden Duelle eine Wiederholung dieses Formates auch in zukünftigen deutschen Wahlkämpfen erwarten. Die Fernsehduelle stellten im vergangenen Wahlkampf allerdings die einzige Methode zur Selbstdarstellung der Parteien nach amerikanischem Muster dar, die nicht mit dem politischen System vereinbar ist. Die Professionalisierung der Wahlkampforganisation oder die stärkere Rolle einzelner Wahlkampfmanager etwa, die in ihren Kompetenzen den Political Consultants in den USA näher standen als ihre Kollegen früherer Jahre, stehen nicht schon allein deswegen im Widerspruch zum politischen System, weil sie sich zum Teil an amerikanischem Vorbildern orientieren. Sofern sie dazu beitragen, einen einheitlicheren Auftritt aller Parteiebenen zu schaffen, können sie sogar von Vorteil sein. Über die Folgen einer zunehmenden Personalisierung ließe sich zwar diskutieren. Wie gezeigt wurde, kann Politik jedoch weder ganz ohne sie auskommen, noch ist sie eine neue Erscheinung in Wahlkämpfen. Was den Angriffswahlkampf betrifft, waren 2002 in Hinsicht auf dessen Qualität keine Intensivierung festzustellen. Das Internet trug lediglich zu einer schnelleren Verbreitung der Kritik an der politischen Konkurrenz bei. Relativ neu ist dagegen die Diskussion, die über die Wahlkampfführung nicht nur wie bisher in der wissenschaftlichen Literatur, sondern auch in der Berichterstattung der Massenmedien geführt wird. Das große Medieninteresse war bereits im Wahlkampf 1998 im Zusammenhang mit der Einführung der Kampa zu beobachten und setzte sich 2002 fort. Damit wird die politische Kommunikation selbst zum Gegenstand des öffentlichen Interesses. Dies schafft Transparenz und ermöglicht es den Wählern, sich ein genaueres Bild von den Wahlkampfmethoden der Parteien zu machen. Für politisch interessierte Bürger kann dies als partieller Ausgleich für eine zunehmende Orientierung der Parteien an den Gesetzen der Medien gesehen werden. Aus den genannten „Amerikanisierung“, von Gründen einer ist es daher fortschreitenden zutreffender, anstatt Modernisierung von deutscher Wahlkämpfe zu sprechen, die in erster Linie dem Wandel der Medienlandschaft und der Beziehung zwischen Wählern und Politik Rechnung trägt. Dass sich die politischen Akteure bei ihrer Selbstdarstellung in den Medien dabei punktuell auch an amerikanischen Vorbildern orientieren, war im Bundestagswahlkampf 2002 klar erkennbar. Insgesamt gesehen kann dies aber die Anwendung des Begriffs „Amerikanisierung“ auf deutsche Wahlkämpfe nicht rechtfertigen. 85 Literatur Adams, Angela/Adams, Willi Paul (Hrsg.): Hamilton/Madison/Jay. Die FederalistArtikel, Paderborn/München/Wien/Zürich 1994. Albers, Markus: Modern, medientauglich, ratlos, in: Welt am Sonntag, 21.07.2002. Althaus, Marco: Kameratauglich in die Kampagne, in: Althaus, Marco/Cecere,Vito (Hrsg.): Kampagne!2. Neue Strategien für Wahlkampf Münster/Hamburg/London 2003, S. 314-345. 86 PR und Lobbying, Althaus, Marco: Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying, Münster 2002. Althaus, Marco: Professionalismus im Werden: Amerikas Wahlkampfberater im Wahljahr 2000, in: Schatz, Heribert/Rössler, Patrick/Nieland, Jörg-Uwe (Hrsg.): Politische Akteure in der Mediendemokratie. Politiker in den Fesseln der Medien?, Wiesbaden 2002, S. 79-99. Althaus, Marco: Wahlkampf als Beruf. Die Professionalisierung der Political Consultants in den USA, Frankfurt/Main 1998. Altmeppen, Klaus-Dieter/Löffelholz, Martin: Zwischen Verlautbarungsorgan und „vierter Gewalt“. Strukturen, Abhängigkeiten und Perspektiven des politischen Journalismus, in: Sarcinelli, Ulrich (Hrsg.): Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, Opladen 1998, S. 97-124. Andersen, Uwe/Woyke, Wichart (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2000. Backes, Uwe/Jesse, Eckhard: Parteien, Wahlrecht und Wahlen, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Informationen zur politischen Bildung, Nr. 207/1996. Parteiendemokratie, S. 37-40. Becher, Marcus R.: „Grün wirkt“ mit wenig Ressourcen, in: Althaus, Marco/Cecere,Vito (Hrsg.): Kampagne!2. Neue Strategien für Wahlkampf PR und Lobbying, Münster/Hamburg/London 2003, S. 245-266. Becker, Bernd: New Labour auf dritten Wegen. Tony Blairs Politikmarketing – und was die SPD daraus lernte, in: Althaus, Marco (Hrsg.): Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying, Münster 2002, S. 258-275. Bergsdorf, Wolfgang: Die 4. Gewalt. Einführung in die politische Massenkommunikation, Mainz 1980. Bieber, Christoph: Online-Wahlkampf 2002. Formate und Inhalte der digitalen Politikarena, in: Media Perspektiven, Nr. 6/2002, S. 277-283. Biesel, Martin: Kampagne mit Gewinn. Fundraising: Bürgerfonds 18/2002, in: Althaus, Marco/Cecere,Vito (Hrsg.): Kampagne!2. Neue Strategien für Wahlkampf PR und Lobbying, Münster/Hamburg/London 2003, S. 229-244. Bösch, Frank: Vorreiter der modernen Kampagne. Die Adenauer-Wahlkämpfe 1953 und 1957, in: Die Neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte, Juli/August 2002, S. 439443. 87 Brettschneider, Frank: Kanzlerkandidaten im Fernsehen, in: Media Perspektiven, Nr. 6/2002, S. 263-276. Bruns, Tissy: Der Politiker ist die Message. Das Verhältnis von Medien und Politik verändert sich radikal, in: Der Tagesspiegel, 03.02.2001. Brunner, Wolfram: Wahlkampf in den USA, in: Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.): Broschürenreihe, Nr. 38, Sankt Augustin 2002. CDU-Bundesvorstand (Hrsg.): Kampagnenbericht 2002, Hannover 2002. Cecere, Vito: Man nennt es Oppo. Opposition Research als systematische Beobachtung des Gegners, in: Althaus, Marco (Hrsg.): Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying, Münster 2002, S. 65-80. Damme, Nora: Absturz aus dem Wahlquartier, in: Althaus, Marco/Cecere,Vito (Hrsg.): Kampagne!2. Neue Strategien für Wahlkampf PR und Lobbying, Münster/Hamburg/London 2003, S. 267-281. Dehm, Ursula: Fernsehduelle im Urteil der Zuschauer. Eine Befragung des ZDF zu einem neuen Sendungsformat bei der Bundestagswahl 2002, in: Media Perspektiven, Nr. 12/2002, S. 600-609. Deupmann, Ulrich: Der rot-grüne Herbergsvater, in: Der Spiegel, Nr. 36/2002, S. 2426. Dörner, Andreas/Vogt, Ludgera: Der Wahlkampf als Ritual. Zur Inszenierung der Demokratie in der Multioptionsgesellschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 1516/2002, S. 15-22. Donges, Patrick: Amerikanisierung, Professionalisierung, Modernisierung? Anmerkungen zu einigen amorphen Begriffen, in: Kamps, Klaus (Hrsg.): TransAtlantik-Trans-Portabel? Die Amerikanisierungsthese in der politischen Kommunikation. Wiesbaden 2000, S. 27-40. Donsbach, Wolfgang: Sechs Gründe gegen Fernsehduelle. Zur politischen Bewertung einer medialen Inszenierung, in: Die politische Meinung, Nr. 396/November 2002, S. 19-25. Eimeren, Birgit van/Gerhard, Hainz/Frees, Beate: ARD/ZDF-Online-Studie 2001: Internetnutzung stark zweckgebunden, in: Media Perspektiven, Nr. 8/2001, S. 382397. Falter, Jürgen: Alle Macht dem Spin Doctor. Die Amerikanisierung der Wahlkämpfe ist auch in Deutschland Fortgeschritten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.04.1998. 88 Falter, Jürgen W./Römmele, Andrea: Professionalisierung bundesdeutscher Wahlkämpfe, oder: Wie amerikanisch kann es werden?, in: Berg, Thomas: Moderner Wahlkampf, Blick hinter die Kulissen, Opladen 2002. S. 49-63. Fengler, Susanne/Jun, Uwe: Kopie der Kampa 98 im neuen Kontext, in: Althaus, Marco/Cecere,Vito (Hrsg.): Kampagne!2. Neue Strategien für Wahlkampf PR und Lobbying, Münster/Hamburg/London 2003, S. 168-198. Gallus, Alexander: Demoskopie in Zeiten des Wahlkampfs. „Wirkliche Macht“ oder „Faktor ohne politische Bedeutung“?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 1516/2002, S. 29-36. Geisler, Alexander: Alte Gladiatoren, neue Arenen: Der Wahlkampf hält Einzug ins Internet, in: Berg, Thomas (Hrsg.): Moderner Wahlkampf. Blick hinter die Kulissen, Opladen 2002, S. 193-207. Genz, Andreas/Schönbach, Klaus/Semetko, Holli, A.: „Amerikanisierung“? Politik in den Fernsehnachrichten während der Bundestagswahlkämpfe 1990-1998, in: Klingemann, Hans-Dieter/Kaase, Max (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 1998, Wiesbaden 2001, S. 401-414. Goffart, Daniel: Nur der Sieg zählt, in: Handelsblatt, 12.07.2002. Hartz, Peter: "Ich bin ein Überzeugungstäter", Interview in: Der Spiegel, Nr. 26/2002, S. 36-38. Herzinger, Richard: And the Winner is: Gerhard, in: Die Zeit Nr. 37/2002. Hilmer, Richard: Bundestagswahl 2002. Eine zweite Chance für Rot-Grün, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Nr. 1/2003, S. 187-219. Hoffman-Riem, Wolfgang: Politiker in den Fesseln der Mediengesellschaft, in: Politische Vierteljahresschrift, Nr. 41/2000, S. 107-126. Hofmann, Gerhard: Das große Zittern. Vor den Fernsehduellen Schröder-Stoiber, in: Die Neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte, Juli/August 2002, S. 427-432. Holzer, Werner: Von Hexenmeistern und Media-Handwerkern. Politische Öffentlichkeitsarbeit in den USA – ein (un-)heimliches Wesen, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Politik überzeugend vermitteln. Wahlkampfstrategien in Deutschland und den USA, Gütersloh 1996, S. 117-148. Holtz-Bacha, Christina: Bundestagswahlkampf 1998. Modernisierung und Professionalisierung, in: Holtz-Bacha, Christina (Hrsg.): Wahlkampf in den Medien. Wahlkampf mit den Medien, Wiesbaden 1999, S. 9-23. 89 Holtz-Bacha, Christina: Das Private in der Politik: Ein neuer Medientrend?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 41-42/2001, S. 20-26. Holtz-Bacha, Christina: Massenmedien und Wahlen: Die Professionalisierung der Kampagnen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 15-16/2002, S. 23-28. Holtz-Bacha, Christina/Kaid Lynda Lee: A Comparative Perspective on Political Advertising. Media and Political System Characteristics, in: Kaid, Lynda Lee/HoltzBacha, Christina: Political Advertising in Western Democracies. Parties & Candidates on Television, Thousand Oaks/London/Neu Delhi 1995, S. 8-18. Jarren, Ottfried: „Mediengesellschaft“. Risiken für die politische Kommunikation, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 41-41/2001, S. 10-19. Jarren, Ottfried: Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit im Wandel, in: Sarcinelli, Ulrich (Hrsg.): Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, Opladen 1998, S. 74-94. Jun, Uwe: Der Wahlkampf der SPD zur Bundestagswahl 1998: Der Kampf um die „Neue Mitte“ als Medieninszenierung, in: Hirscher, Gerhard/Sturm, Roland (Hrsg.): Die Strategie des „Dritten Weges“, Legitimation und Praxis sozialdemokratischer Regierungspolitik, München 2001, S. 51-95. Kamps, Klaus: Politik in Fernsehnachrichten, Baden-Baden 1999. Kapferer,Stefan/Chatzimarkakis, Jorgo: Auf dem Weg zur 18, in: Althaus, Marco/Cecere,Vito: Kampagne!2. Neue Strategien für Wahlkampf PR und Lobbying, Münster/Hamburg/London 2003, S. 213-228. Kepplinger, Hans Mathias: Die Demontage der Politik in der Informationsgesellschaft, Freiburg/München 1998. Kepplinger, Hans Mathias: Massenkommunikation. Rechtsgrundlagen, Medienstrukturen, Kommunikationspolitik, Stuttgart 1982. Klein, Markus/Ohr, Dieter: Gerhard oder Helmut? ‚Unpolitische‘ Kandidateneigenschaften und ihr Einfluss auf die Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl 1998, in: Politische Vierteljahresschrift, Nr. 41/2000, S. 199-222. Kleinsteuber, Hans J.: Medien und öffentliche Meinung, in: Adams, Paul/Lösche, Peter (Hrsg.): Länderbericht USA, Bonn 1998, S. 375-392. Klingemann, Hans-Dieter/Wattenberg, Martin P.: Zerfall und Entwicklung von Parteiensystemen. Ein Vergleich der Vorstellungsbilder von den politischen Parteien in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland, in: 90 Kaase, Max/Klingemann, Hans-Dieter (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1987, Opladen 1990, S. 324-344. Leersch, Hans-Jürgen: Die Kanzlermacher, in: Die Welt, 13.08.2002. Leif, Thomas: Macht ohne Verantwortung. Der wuchernde Einfluss der Medien und das Desinteresse der Gesellschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 4142/2001, S. 6-9. Löhe, Fabian/Neubacher, Alexander: Zur Munterkeit verdammt, in: Der Spiegel, Nr. 35/2002, S. 38. Machnig, Matthias: Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft, in: Machnig, Matthias: Politik – Medien – Wähler. Wahlkampf im Medienzeitalter, Opladen 2002. Mauss, Alexander: Filtern, fragen und beraten. Das Ohr an der öffentlichen Meinung durch quantitative Politikforschung, in: Althaus, Marco (Hrsg.): Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying, Münster 2002, S. 81-96. Meyer, Thomas: Die Transformation des Politischen, Frankfurt am Main 1994. Meyn, Hermann: Massenmedien in Deutschland, Konstanz 1999. Müller, Albrecht: Von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie, Opladen 1999. Müller, Dieter K.: Wahlwerbung im Fernsehen. ARD und ZDF als Werbeträger nach 20.00 Uhr, in: Media Perspektiven, Nr. 12/2002- S, 623-628. Müller, G. Marion: Parteienwerbung im Bundestagswahlkampf 2002, in: Media Perspektiven, Nr. 12/2002, S. 629-637. Oberreuter, Heinrich: Mediatisierte Politik und politischer Wertwandel, in: Böckelmann, Frank E. (Hrsg.): Medienmacht und Politik, Berlin 1989, S. 31-41. Ohr, Dieter: Wird das Wählerverhalten zunehmen personalisierter, oder: Ist jede Wahl anders? Kandidatenorientierungen und Wahlentscheidung in Deutschland von 1961 bis 1998, in: Klein, Markus/Jagodzinski, Wolfgang/Mochmann, Ekkehard/Ohr, Dieter (Hrsg.): 50 Jahre Empirische Wahlforschung in Deutschland. Entwicklung, Befunde, Perspektiven, Daten, Wiesbaden 2000, S. 272-302. Papier, Hans-Jürgen/Möller, Johannes: Presse- und Rundfunkrecht, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1999, S. 449-468. 91 Pfetsch, Barbara/ Schmitt-Beck, Rüdiger: Amerikanisierung von Wahlkämpfen? Kommunikationsstrategien und Massenmedien im politischen Mobilisierungsprozeß, in: Jäckel, Michael/ Winterhoff-Spurk, Peter (Hrsg.): Politik und Medien. Analysen zur Entwicklung der politischen Kommunikation, Berlin 1994, S. 231-252. Pfetsch, Barbara: „Amerikanisierung“ der politischen Kommunikation? Politik und Medien in Deutschland und den USA, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 4142/2001, S. 27-36. Plasser, Fritz: Globalisierung der Wahlkämpfe. Praktiken der Campaign Professionals im weltweiten Vergleich, Wien 2003. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Medienbericht 1998. Bericht der Bundesregierung über die Lage der Medien in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1998. Radunski, Peter: Politisches Kommunikationsmanagement. Die Amerikanisierung der Wahlkämpfe, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Politik überzeugend vermitteln. Wahlkampfstrategien in Deutschland und den USA, Gütersloh 1996, S. 33-52. Rimscha, Robert von: Ganz im Ernst, in: Der Tagesspiegel, 10.05.2002. Röseler, Oliver: Union wie noch nie, in: Althaus, Marco/Cecere,Vito (Hrsg.): Kampagne!2. Neue Strategien für Wahlkampf PR und Lobbying, Münster/Hamburg/London 2003, S. 199-211. Sarcinelli, Ulrich: Parteien und Politikvermittlung: Von der Parteien zur Mediendemokratie?, in: Sarcinelli, Ulrich (Hrsg.): Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft. Beiträge zur politischen Kommunikationskultur, Opladen/Wiesbaden 1998, S. 273-296. Sarcinelli, Ulrich/Geisler, Alexander: Die Demokratie auf dem Opferaltar kampagnenpolitischer Aufrüstung?, in: Machnig, Matthias (Hrsg.): Politik – Medien – Wähler. Wahlkampf im Medienzeitalter, Opladen 2002, S. 153-163. Saxer, Ulrich: Mediengesellschaft: Verständnisse und Mißverständnisse, in: Sarcinelli, Ulrich (Hrsg.): Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, Bonn 1998, S. 52-73. Schmitt-Beck, Rüdiger: Ein Sieg der „Kampa“? Politische Symbolik in der Wahlkampagne der SPD und ihre Resonanz in der Wählerschaft, in: Klingemann, Hans, Dieter/Kaase, Max (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 1998, Wiesbaden 2001, S. 133-161. Schöllgen, Gregor: Willy Brandt. Die Biographie, Berlin/München 2001. 92 Schröder, Gerhard: „Die haben zu früh triumphiert“, Interview in : Der Spiegel, Nr. 38/2002, S. 36-38. Schulz, Winfried: Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, Opladen/Wiesbaden 1997. Schulz, Winfried: Wahlkampf unter Vielkanalbedingungen, in: Media Perspektiven, Nr. 8/1998, S. 378-391. Shell, Kurt L.: Das politische System – Kongreß und Präsident, in: Adams, Paul/Lösche, Peter (Hrsg.): Länderbericht USA, Bonn 1998, S. 207-248. SPD-Parteivorstand (Hrsg.): Die Kampagne zur Bundestagswahl 2002, Dokumentation, Berlin 2002. SPD-Parteivorstand (Hrsg.): Moderner Wahlkampf - Wahlkampfhandbuch 2002, Berlin 2002. Stern, Eva/Graner, Jürgen: It’s the Candidate, Stupid? Personalisierung der bundesdeutschen Wahlkämpfe, in: Berg, Thomas: Moderner Wahlkampf. Blick hinter die Kulissen, Opladen 2002, S. 145-170. Stoiber, Edmund: "Kampf um beste Lösungen", Interview in: Der Spiegel, Nr. 3/2002, S. 30. Tartler, Jens: Stoiber-Team dirigiert Unions-Wahlkampf, in: Financial Times Deutschland, 18.01.2002. Timm, Andreas: Die SPD-Strategie im Bundestagswahlkampf 1998, Hamburg 1999. Wasser, Hartmut: Politische Parteien und Wahlen, in: Adams, Paul/Lösche, Peter (Hrsg.): Länderbericht USA, Bonn 1998, S. 305-339. Wasser, Hartmut: Institutionen im politischen System, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Informationen zur politischen Bildung, Nr. 199, Bonn 1997. S. 6-24. Wirth, Werner/Voigt, Ronald: Der Aufschwung ist meiner! Personalisierung von Spitzenkandidaten im Fernsehen zur Bundestagswahl 1998, in: Holtz-Bacha, Christina (Hrsg.): Wahlkampf in den Medien. Wahlkampf mit den Medien, Wiesbaden 1999, S. 136-160. Woyke, Wichard: Stichwort Wahlen. Ein Ratgeber für Wähler, Wahlhelfer und Kandidaten, Opladen 1998. Interviews: 93 Röseler, Oliver: Stellvertretenden Leiter der Abteilung strategische Planung und Wahlkämpfe der CDU. Im Wahlkampf 2002 Mitglied des Stoiber.Teams. Interview am 24.06.2003. Hoogvliet, Rudi: Vorstandsreferent der Fraktion von Bündnis‘90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. Im Wahlkampf 2002 Wahlkampfmanager von Bündnis‘90/Die Grünen. Interview am 04.07.2003. Internet:216 www.achtzehnzweitausendzwei.de www.bundeskanzler.de www.bundesregierung.de www.cdu.de www.fdp-bundesverband.de www.gerhard-schroeder.de www.gruene.de www.gruen-wirkt.de www.guidomobil.de www.guido-westerwelle.de www.gwu.edu www.infratest-dimap.de www.joschka.de www.kampa02.de www.liberale.de www.nichtregierungsfaehig.de www.pds2002.de www.presserat.de www.sozialisten.de www.spd.de www.spd-online.de 216 Hinweis: Einige der angegebenen Internetseiten wurden nach dem Wahlkampf 2002 abgeschaltet. 94 www.stoiber.de www.theaapc.org www.wahlkreis300.de www.wahlfakten.de www.zeit-fuer-taten.de Abkürzungsverzeichnis AAPC American Association of Political Consultants (=Verband der amerikanischen Politikberater) Abs. Absatz ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland Art. Artikel Beschl. Beschluss 95 BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts; amtliche Sammlung (zitiert: Band, Seite) CDU Christlich Demokratische Union CSU Christlich Soziale Union d.h. das heißt Ebd. Ebenda f. folgende (Seite) FDP Freie Demokratische Partei ff. folgende (Seiten) Fn. Fußnote GG Grundgesetz i.d.F. In der Fassung OECD Organization for Economic Cooperation and Development (=Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ORB Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg PDS Partei des Demokratischen Sozialismus PISA Programme for International Student Assesment (= Internationale Studie der OECD zur Bewertung schulischer Leistungen) PR Public Relation (=Öffentlichkeitsarbeit) RTL Radio Télé Luxembourg S. Seite SFB Sender Freies Berlin SMS Short Message System (=System zur Übermittlung von Textnachrichten zwischen Mobiltelefonen) Sic! Wirklich so! SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands u.a. unter anderem USA United States of America (=Vereinigte Staaten von Amerika) Vgl. Vergleiche z.B. zum Beispiel ZDF Zweites Deutsches Fernsehen 96 Anhang Abildung der beschriebenen Wahlplakate Ehrenwörtliche Erklärung 97 98 99 100 101