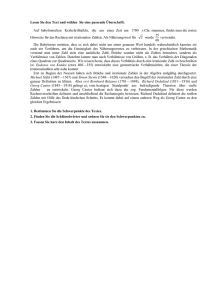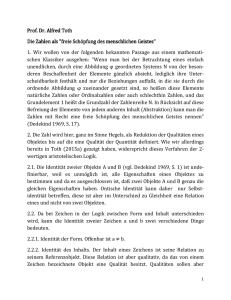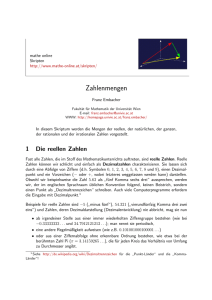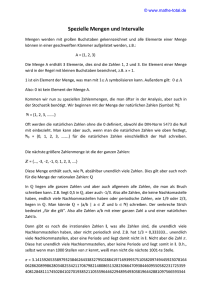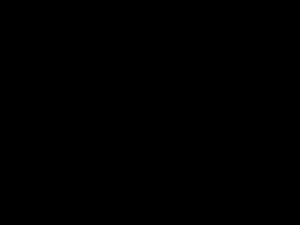Word-Datei (doc, 3 MByte) - Technische Universität Braunschweig
Werbung
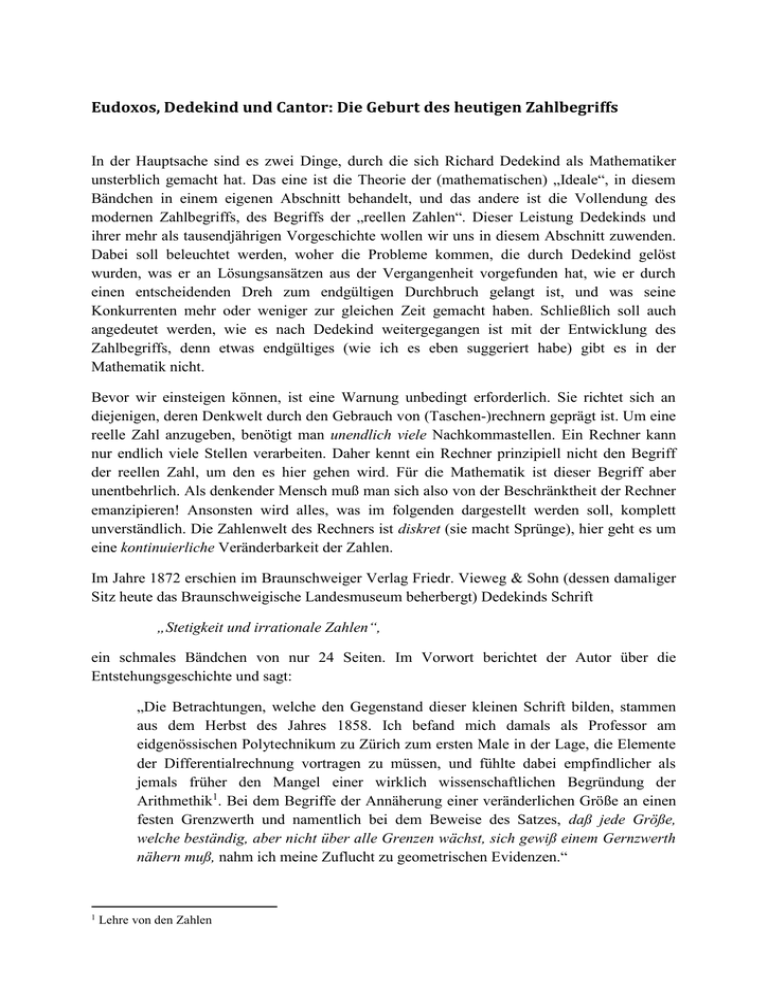
Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs In der Hauptsache sind es zwei Dinge, durch die sich Richard Dedekind als Mathematiker unsterblich gemacht hat. Das eine ist die Theorie der (mathematischen) „Ideale“, in diesem Bändchen in einem eigenen Abschnitt behandelt, und das andere ist die Vollendung des modernen Zahlbegriffs, des Begriffs der „reellen Zahlen“. Dieser Leistung Dedekinds und ihrer mehr als tausendjährigen Vorgeschichte wollen wir uns in diesem Abschnitt zuwenden. Dabei soll beleuchtet werden, woher die Probleme kommen, die durch Dedekind gelöst wurden, was er an Lösungsansätzen aus der Vergangenheit vorgefunden hat, wie er durch einen entscheidenden Dreh zum endgültigen Durchbruch gelangt ist, und was seine Konkurrenten mehr oder weniger zur gleichen Zeit gemacht haben. Schließlich soll auch angedeutet werden, wie es nach Dedekind weitergegangen ist mit der Entwicklung des Zahlbegriffs, denn etwas endgültiges (wie ich es eben suggeriert habe) gibt es in der Mathematik nicht. Bevor wir einsteigen können, ist eine Warnung unbedingt erforderlich. Sie richtet sich an diejenigen, deren Denkwelt durch den Gebrauch von (Taschen-)rechnern geprägt ist. Um eine reelle Zahl anzugeben, benötigt man unendlich viele Nachkommastellen. Ein Rechner kann nur endlich viele Stellen verarbeiten. Daher kennt ein Rechner prinzipiell nicht den Begriff der reellen Zahl, um den es hier gehen wird. Für die Mathematik ist dieser Begriff aber unentbehrlich. Als denkender Mensch muß man sich also von der Beschränktheit der Rechner emanzipieren! Ansonsten wird alles, was im folgenden dargestellt werden soll, komplett unverständlich. Die Zahlenwelt des Rechners ist diskret (sie macht Sprünge), hier geht es um eine kontinuierliche Veränderbarkeit der Zahlen. Im Jahre 1872 erschien im Braunschweiger Verlag Friedr. Vieweg & Sohn (dessen damaliger Sitz heute das Braunschweigische Landesmuseum beherbergt) Dedekinds Schrift „Stetigkeit und irrationale Zahlen“, ein schmales Bändchen von nur 24 Seiten. Im Vorwort berichtet der Autor über die Entstehungsgeschichte und sagt: „Die Betrachtungen, welche den Gegenstand dieser kleinen Schrift bilden, stammen aus dem Herbst des Jahres 1858. Ich befand mich damals als Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich zum ersten Male in der Lage, die Elemente der Differentialrechnung vortragen zu müssen, und fühlte dabei empfindlicher als jemals früher den Mangel einer wirklich wissenschaftlichen Begründung der Arithmethik1. Bei dem Begriffe der Annäherung einer veränderlichen Größe an einen festen Grenzwerth und namentlich bei dem Beweise des Satzes, daß jede Größe, welche beständig, aber nicht über alle Grenzen wächst, sich gewiß einem Gernzwerth nähern muß, nahm ich meine Zuflucht zu geometrischen Evidenzen.“ 1 Lehre von den Zahlen Dabei muß man sich vor Augen halten, daß die Züricher Studenten wohl künftige Ingenieure waren, und daß Ingenieurstudenten naturgemäß und mit Recht nicht in erster Linie an den gedanklichen Grundlagen der Mathematik, sondern an anwendbaren Rechenverfahren interessiert sind. Um diesem Publikum eben jene für seine Bedürfnisse gemachte „höhere Mathematik“ befriedigend zu erklären, fehlte Dedekind und seinen Zeitgenossen, wie er feststellte, immer wieder eine ganz bestimmte wesentliche begriffliche Grundlage, etwas, worauf man sich hätte berufen müssen, was aber nicht da war. Es handelt sich dabei um etwas ganz unauffälliges, dessen immense Bedeutung keineswegs auf den ersten Blick ersichtlich ist. Wir wollen daher den knappen Hinweisen von Dedekind an dieser Stelle etwas nachgehen und erläutern, was es auf sich hat mit dem im obigen Text (von mir) hervorgehobenen „Satz, daß jede Größe, …. sich gewiß einem Grenzwerth nähern muß“ und wozu man diesen Satz denn braucht. Quadratwurzeln und das Supremumsprinzip. Dazu (und nur dazu) will ich ein etwas handgestricktes Verfahren schildern, das die Berechnung der Quadratwurzel einer reellen Zahl erlaubt (es ist angeregt durch ein von Isaac Newton stammendes, viel professionelleres Verfahren). Wir denken uns eine Zahl c größer als 4 gegeben und suchen eine Quadratwurzel dazu, also eine Zahl b mit . Wir wollen uns dem gesuchten b schrittweise nähern und beginnen, indem wir die ganzen Zahlen 1,2,3,… durchprobieren und die die größte nehmen, deren Quadrat nicht größer ist als ; wir nennen sie a. Dann ist also Die gesuchte Zahl sollte also die Form haben mit einem x zwischen 0 und 1. Wir wollen haben, aber diese Gleichung ist eher schwerer zu lösen als , deshalb vereinfachen wir sie (zunächst noch ohne Rechtfertigung, warten Sie etwas ab!) zu Im Gegensatz zu x läßt sich dies y leicht berechnen, aber was ist es wert? Nun, schauen wir uns das einmal an. Die Gleichung für zusammen mit der ausmultiplizierten Ungleichung ergibt Subtraktion von , woraus folgt (am Schluß haben wir noch benutzt). Division durch die positive Zahl wir ergibt ; mit zusammen haben und somit . Nun vergleichen wir einmal (hierdurch haben wir nach mit dem Quadrat von ja eingeführt), und somit . Wir haben . Das bedeutet aber, daß der Abstand von zu gleich ist, und von dieser Zahl hatten wir gesehen, daß sie zwischen 0 und liegt, also höchstens ein Drittel des Abstandes von beträgt. Mit anderen Worten: das Quadrat von und ausmacht, welcher ja genau ist zwar immer noch nicht gleich , aber es liegt nicht mehr so sehr daneben wie das Quadrat von . Wiederholen wir diese Prozedur unendlich oft, so erhalten wir eine Folge von Zahlen , deren Quadrate dem Ziel c immer näher kommen, sie konvergieren gegen c: Das sieht schon sehr verführerisch aus, aber jetzt kommt Dedekinds Problem: Können wir aus der zuletzt gemachten Feststellung den Schluß ziehen, daß die Zahlen selbst konvergieren, und daß ihr Grenzwert b die Eigenschaft hat, womit sich b als Quadratwurzel qualifizieren würde? Ist also wirklich, wie wir vermuten, ?? Die Antwort auf diese Frage ist ja, aber um so zu schließen brauchen wir den Satz von den beständig, aber nicht über alle Grenzen wachsenden Größen, von dem Dedekind spricht: Jedes ist größer als sein Vorgänger in der Folge, und alle sind kleiner als c, also gibt es den Grenzwert b; auch um die Gleichung zu begründen, muß man allerdings noch einmal argumentieren, dazu später mehr. Der besagte Satz heißt heute das Supremumsprinzip, und daß dieses Prinzip für reelle Zahlen gilt und eine fundamentale Aussage über sie macht, ist die eigentliche Erkenntnis und das Anliegen Dedekinds. Das Unendliche im Endlichen. Nun versuchen Sie bitte einmal, sich die Folge der Zahlen aus der obigen Überlegung bildlich vorzustellen. Dazu benutzen wir die zu Dedekinds Zeiten längst übliche Vorstellung, daß die Zahlen auf einer Geraden angeordnet liegen, und zwar liegt eine positive Zahl d im Abstand d rechts von einem willkürlich gewählten, mit 0 bezeichneten Bezugspunkt, und die negative Zahl liegt im gleichen Abstand links von 0. Wir haben unendlich viele Zahlen . Sie werden ständig größer (sie rücken weiter nach rechts), bleiben aber alle unterhalb einer festen Schranke c. Welche Alternative gibt es denn zu der gewünschten Eigenschaft, daß solche Zahlen einem Grenzwert zustreben? Die Anschauung sagt, daß sie aus Platzgründen immer enger zusammenrücken müssen, und wenn an der Stelle, wo das passiert, keine Zahl ist, dann hat die Gerade an dieser Stelle ein Loch, ein schwarzes Loch gewissermaßen, das unsere Zahlen für großes n verschlingt. Woher wissen wir also, daß das nicht passiert? Das ist Dedekinds Problem. Wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um eine Frage über die wirkliche Welt, denn weder Zahlen noch die Punkte einer Geraden finden in der wirklichen Welt statt, es sind vielmehr Abstraktionen unseres Geistes, begriffliche Schöpfungen des Menschen. Die Antwort auf die Frage, ob die Gerade Löcher hat oder nicht, kann also nur dadurch gegeben werden, daß man den Zahlbegriff in einer Weise präzisiert, die zu einer definitiven Entscheidung unserer Frage führt. Mit anderen Worten, der Mathematiker muß selbst entscheiden, ob er eine Zahlengerade mit oder ohne Löcher haben will. Dedekind erkennt und benennt dies mit der für ihn typischen Klarheit, wenn er sagt2: Und wüßten wir gewiß, daß der Raum unstetig3 wäre, so könnte uns doch wieder nichts hindern, falls es uns beliebte, ihn durch Ausfüllung seiner Lücken in Gedanken zu einem stetigen zu machen; diese Ausfüllung würde aber in einer Schöpfung von neuen Punct-Individuen bestehen….. Das hört sich verführerisch einfach an, man füllt einfach die Lücken aus, wenn welche da sind, ist es aber nicht. Zuerst ist die Frage, woran erkennt man, wo Löcher sind? Wie spricht man einzelne von ihnen an? Womit füllt man sie aus? Wie garantiert man, daß man beim Ausfüllen alter Löcher keine neuen reißt? Wie arbeitet man mit dem schließlich entstehenden Zahlsystem, ist es überhaupt handhabbar, kann man damit rechnen? Fragen über Fragen! Um weiterzukommen, müssen wir weit ausholen und die Vorgeschichte seit der Antike, die Dedekind natürlich bestens bekannt war, in einem zwangsläufig etwas flüchtigen Durchgang vorstellen. Daß hier etwas unheimliches vorgeht, wenn unendlich viele Zahlen auf endlichem Raum Platz finden, haben zuerst die Griechen der Antike bemerkt, namentlich Zenon von Elea (etwa 490 bis 430 v.u.Z, Bild siehe im Abschnitt über das Unendliche), von dem uns das Paradox von Achill und der Schildkröte überliefert ist, das in diesem Bändchen schon einmal auftrat. Der für seine Schnelligkeit berühmte Achill tritt gegen die Schildkröte zum Wettrennen an. Fairerweise gibt er ihr einen Vorsprung, sagen wir 100 Meter. Nehmen wir an, Achill brauche 10 Sekunden für diese 100 Meter, aber die Schildkröte ist die schnellste unter ihren Artgenossen und schafft in den 10 Sekunden 10 Meter. Nach einer weiteren Sekunde ist Achill an dieser Stelle angekommen, aber auch die Schildkröte hat schon wieder 1 Meter zurückgelegt. Achill macht das in Sekunde wett, nur um zu sehen, daß die Schildkröte immer noch einen Vorsprung hat, der jetzt Meter beträgt. Wie man sieht, kann Achill die Schildkröte nicht einholen, weil beim Zurücklegen des alten Vorsprungs immer ein neuer entsteht. Jede der eben betrachteten Stationen des Wettlaufs findet zu einem Zeitpunkt statt, der als endliche Teilsumme der unendlichen Summe 2 3 a.a.O., §3 gemeint ist: daß er Löcher hat angegeben werden kann. Dies entspricht exakt der Situation in unseren Betrachtungen zum Wurzelziehen, wo wir die unendliche Summe antrafen, auf deren endliche Teilsummen das Supremumsprinzip paßt; ebenso ist es auch hier, und aus heutiger Sicht ist es so, daß das Supremumsprinzip uns für die Folge der AchillZahlen einen endlichen Grenzwert (nämlich die Zahl 11,111111…, unendlich viele Einsen hinter dem Komma) liefert, und genau zu diesem Zeitpunkt sind Achill und die Schildkröte exakt gleichauf; danach gewinnt Achill einen Vorsprung. Für die alten Griechen war dieses Auftreten des Unendlichen im Endlichen extrem beunruhigend, aber ihre ungeheure Leistung ist, daß sie es erstens bemerkt haben und zweitens überaus konstruktiv auf die Beunruhigung reagiert haben, nämlich indem sie eine außerordentlich aufwendige Untersuchung über den Zahlbegriff und über die Geometrie der Strecken auf einer Geraden angestellt haben. Davon soll im nächsten Abschnitt die Rede sein. Euklid und die Proportionenlehre des Eudoxos. Die Erfahrung mit Zenons Paradox hatte die griechischen Mathematiker äußerste Vorsicht gelehrt; sie wußten, daß allzu naßforsche mathematische Argumente sehr schnell in eine Aporie, d.h. in die Ausweglosigkeit, führen konnten. Daher bestanden sie darauf, eine strenge Trennung zwischen den Begriffen Zahl und Länge (von Strecken) durchzuhalten; dabei waren Zahlen nur die zum Zählen geeigneten, also 2, 3, 4 und so weiter. Schon die Einbeziehung der Eins war nicht selbstverständlich, an eine Zahl 0 war nicht zu denken, ganz zu schweigen von negativen Zahlen. Außerdem wurden mathematische Argumente nur akzeptiert, wenn sie auf wenigen klar formulierten Grundlagen (Axiomen) fußten und jeder kleine Gedankenschritt mit größtmöglicher Strenge durchgeführt war. Euklid von Alexandria (etwa 360 – 300 v.u.Z.) hat in einer in 13 „Bücher“ gegliederten Enzyklopädie mit dem Titel Elemente das mathematische Wissen seiner Zeit festgehalten. In Buch V, etwa aus dem Jahre 325, stellt er die Proportionenlehre seines älteren Kollegen Eudoxos von Knidos (etwa 410 – 350 v.u.Z.) dar. Es geht dabei um eine Art von „Rechnen“ mit Streckenlängen, das ausschließlich auf geometrischen Überlegungen beruht und daher als gut gefeit gegen unerwartete Aporien gelten konnte. Wie wir sehen werden, hat Eudoxos diese Streckenrechnung zu solcher Reife gebracht, daß man sich schon große Mühe geben muß, um zu erkennen, daß er Dedekinds Leistung nicht etwa vorweggenommen hat. Bei all dem darf man nie vergessen, daß die Griechen dieses Niveau des Denkens um des Denkens willen ohne ebenbürtige Vorläufer in sehr kurzer Zeit erreicht haben. Zunächst muß klar gesagt werden, daß die Proportionenlehre ohne eine Definition des Begriffs der Länge von Strecken auskommt; nur der Begriff der Strecke ist nötig. Er ist durch die Axiome der Geometrie abgesichert. Nun ist zunächst zu klären, wann zwei Strecken als gleichlang (oder, kurz gesprochen, als gleich) anzusehen sind --- nämlich dann, wenn man sie durch Verschieben und nötigenfalls Drehen der einen Strecke zur völligen Deckung bringen kann. Nun kann man Strecken addieren (d.h., längs einer Geraden aneinandersetzen), und man kann eine kürzere von einer längeren abziehen. Das Resultat ist jeweils wieder eine Strecke. Nun ist klar, dass man auch sinnvoll von der doppelten, dreifachen, vierfachen Strecke und so weiter sprechen kann. Bezeichnen wir Strecken einfach indem wir die Namen ihrer Endpunkte nebeneinander schreiben, etwa AB, und ist n eine der natürlichen Zahlen 1,2,3,…, so wollen wir das n-fache der Strecke AB mit nAB bezeichnen. Kommensurable Streckenpaare. Dies genügt offensichtlich noch nicht, um zwei beliebige Strecken der Länge nach vergleichen zu können. Zum Beispiel könnte das Verhältnis der Längen, in heutiger Ausdrucksweise gesagt, ein Bruch sein, zum Beispiel. Diese Situation wird bei Eudoxos durch den Begriff der kommensurablen Streckenpaare erfaßt. Zwei Strecken AB und CD heißen kommensurabel, wenn sie ein gemeinsames Vielfaches haben, wenn es also Zahlen m und n gibt, derart, daß ist. Die folgende Figur zeigt das Beispiel : Die Figur zeigt außerdem, daß es eine dritte Strecke UV gibt, von der beide gegebenen Strecken Vielfache sind; es ist nämlich und . Dies ist der Grund, warum die gegebenen Strecken kommensurabel heißen: sie haben das gemeinsame Maß UV. Wählt man dieses Maß als Grundeinheit, so kann man beide Strecken durch ganze Zahlen (hier 2 und 3) beschreiben. Das ist nicht nur bei diesem Beispiel so. Um zunächst ein weiteres Beispiel zu betrachten, nehmen wir an es sei ; dann kann man die Strecke CD verdoppeln und davon die Strecke AB abziehen, um ein gemeinsames Maß UV zu erhalten (probieren Sie es aus!). Allgemein gilt für ein Streckenpaar mit , daß es ein gemeinsames Maß UV gibt, und daß sowie ist. Um das so allgemein einzusehen, benutzt Euklid das Verfahren der Wechselwegnahme, das heute noch jeder Mathematikstudent im ersten Semester in algebraischem Gewand und unter der Bezeichnung Euklidischer Algorithmus kennenlernt. Wir neigen dazu, den Sachverhalt sofort mit unserer heutigen Interpretation zu versehen. Wir bleiben nicht wie Eudoxos und Euklid dabei stehen, zu sagen, dass die Strecke AB sich zur Strecke CD verhält wie die Zahl m zur Zahl n; wir wollen gleich den weiteren Schritt machen und sagen, daß dies Verhältnis wieder durch eine Zahl ausgedrückt wird, nämlich durch den Bruch . Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, das Euklid aus Sicherheitsgründen nicht wagen kann und darf einen solchen Schritt zu tun. Proportionen sind für ihn keine Zahlen, sondern Verhältnisse zwischen zwei Strecken oder allenfalls zwischen zwei Zahlen. So etwas wie unsere Brüche hatte er einfach nicht! Stattdessen betrachten Eudoxos und Euklid die Proportionen als selbständige neue Objekte ihres Denkens. Ein kommensurables Streckenpaar mit hat die Proportion , und ein anderes Streckenpaar hat dieselbe Proportion wie das Paar mit denselben Zahlen m und n die Gleichung , falls gültig ist. Bis jetzt ist die Welt in Ordnung. Die Beschreibung der Längenverhältnisse von Streckenpaaren durch Zahlen funktioniert so gut, und sie hat obendrein, wenn man an Längen von Saiten eines Musikinstruments denkt, einen unmittelbaren Bezug zur Harmonie der Töne, daß aus diesen Erkenntnissen ein großartiger Traum wurde, der Traum, alle Verhältnisse zwischen beliebigen Dingen, die es in der Welt gibt, irgendwann einmal durch Zahlenverhältnisse beschreiben zu können. Daß das zumindest bei Streckenpaaren immer geht, hielt man für ausgemacht. Diesen Traum nährte die Schule der Pythagoreer, benannt nach Pythagoras, dessen Satz über die Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken wir alle in der Schule gelernt haben und auch heute auf Schritt und Tritt brauchen (seine Ursprünge sind aber älter als Pythagoras). Aber der Traum der Pythagoreer hatte ein jähes Ende: Der Schock der Inkommensurabilität. Ausgerechnet an ihrem eigenen Logo, einem sternförmig gezeichneten regelmäßigen Fünfeck, mußten die Pythagoreer feststellen, daß nicht einmal alle Streckenpaare sich durch Zahlenverhältnisse vergleichen lassen. Die Diagonale eines regelmäßigen Fünfecks ist nicht kommensurabel zur Seite desselben Fünfecks. Die Pythagoreer würde man heute als Geheimbund bezeichnen, und man weiß nicht sicher, wer der Unglückliche war, der das heilige System zum Einsturz brachte indem er dies bewies und die peinliche Kunde aus dem Geheimbund nach außen schleuste; man vermutet es sei Hippasos von Metapont gewesen. Verschiedene Legenden besagen, daß er geächtet und schließlich ermordet oder in den Selbstmord getrieben wurde, oder aber von den Göttern bestraft wurde, die ihn durch Schiffbruch umkommen ließen. Man merkte dann, daß es einfachere Beispiele von inkommensurablen Streckenpaaren gibt, zum Beispiel Seite und Diagonale eines Quadrats. Nehmen wir an, daß die Quadratseite die Länge 1 hat (in moderner Denkweise, für Euklid ist die Länge keine Zahl!), dann sagt der Satz des Pythagoras, daß die Diagonale die Länge hat. Wären die Strecken kommensurabel, so müßte diese Zahl sich als Bruch und q. Wenn schreiben lassen, mit ganzen Zahlen p das geht, dann gibt es auch einen gekürzten Bruch mit demselben Wert und wir können annehmen, daß unser Bruch schon gekürzt ist. Dann kann höchstens eine der beiden Zahlen p und q eine gerade Zahl sein. Andererseits ergibt sich aus unserer Annahme sofort, daß ist, also muß p gerade sein und q ist dann ungerade. Aber wenn man in obige Gleichung einsetzt und durch 2 kürzt, sieht man, daß q doch auch gerade sein muß, ein Widerspruch zu dem was wir wissen. Also kann es solche Zahlen p und q nicht geben. Irrationale Proportionen. Man würde es gut verstehen, wenn die Griechen nach dieser niederschmetternden Erkenntnis ihre kühnen Träume einfach aufgegeben hätten. Das haben sie aber nicht getan, sondern jetzt kommt die eigentliche Leistung des Eudoxos: Er zeigte, wie man über die Proportionen inkommensurabler Streckenpaare nicht nur sprechen und (das ist das erste Grundbedürfnis) erklären kann, wann zwei solche Proportionen gleich sind, sondern wie man mit diesen Proportionen im erweiterten Sinne all das machen kann, was man bis dahin für die Proportionen der kommensurablen Paare schon konnte. Man konnte sie bereits der Größe nach ordnen, und man konnte mit ihnen rechnen ― also all das, was wir mit Brüchen gewohnt sind zu tun. Im Grunde handelt es sich ja auch nur um eine andere Betrachtungsweise der Brüche. Nun mache man sich das erste Problem, vor dem Eudoxos stand, zunächst einmal klar. Ein kommensurables Streckenpaar ist vergleichbar, man kann seine innere Beziehung durch die eines Zahlenpaares ausdrücken. Ein inkommensurables Paar ist eben nicht vergleichbar (in sich selbst), wie kann man da hoffen, zwei in sich unvergleichbare Paare miteinander zu vergleichen? Aber Eudoxos schafft genau das! Seine Definition der Gleichheit lautet wie folgt: Zwei beliebige (eventuell inkommensurable) Streckenpaare definieren dieselbe Proportion, geschrieben , wenn diejenigen Zahlenpaare m,n, für die die Beziehung ausfällt, genau dieselben sind, für die gilt. Dabei bedeutet das Zeichen < einfach, daß die links stehende Strecke kürzer ist als die rechts stehende, was ebenso wie bei der Gleichheit von Streckenlängen durch Verschieben der Strecken festgestellt wird. Die obige Definition ist einleuchtend: wenn man kein Zahlenpaar findet, das genau paßt, um die Proportion zu beschreiben, dann verlegt man sich darauf, zu prüfen, bei welchen Zahlenpaaren die linke Strecke zu kurz bzw. zu lang wird. Aber sie ist kompliziert und entsprechend schwierig in der Handhabung. Es ist eine wirkliche Meisterleistung, daß Eudoxos und Euklid es schaffen, auf der Grundlage dieser Definition ein komplettes Lehrgebäude zu errichten, in dem unter anderem gezeigt wird, wie man diese erweiterten Proportionen der Größe nach vergleichen und mit ihnen rechnen kann. Erweiterungen des Zahlbegriffs. In gewisser Weise ist das System der Proportionen ebenbürtig dem System der reellen Zahlen, wie es Dedekind viel später geschaffen hat, und es beruht auf demselben Grundgedanken. Der Hauptnachteil des Systems von Eudoxos besteht in der kompletten Abhängigkeit von der Geometrie. Um zu zeigen, daß es eine bestimmte Proportion gibt, muß man ein Streckenpaar mit dieser Proportion geometrisch konstruieren. Man weiß heute, daß das nicht immer geht; zum Beispiel ist es nicht möglich, den Umfang eines Kreises auf diese Weise zu erfassen. Aber es fehlen noch viele andere Dinge, die wir heute für selbstverständliche Aspekte eines funktionierenden Zahlensystems halten: es fehlte die Null, es fehlten die negativen Zahlen, vor allem gab es keine Division. Man lasse sich nicht täuschen, die Proportionen erscheinen uns zwar so, als würde Bruchrechnung getrieben, aber dabei wurde nicht ans Teilen gedacht! In diesem Abschnitt wollen wir daher kurz skizzieren, wie in kleinen Schritten über die Jahrhunderte der Begriff der Zahl immer mehr erweitert wurde. Typisch für diese Entwicklung ist, daß jeder neue Erweiterungsschritt mit großem Mißtrauen aufgenommen wurde, Mißtrauen, von dem wir heute oft nichts mehr spüren, außer bei den jüngsten Schritten wie etwa der Einführung der komplexen Zahlen. Aber die Namen der jeweils neuen Zahlentypen sind geblieben, und sie drücken dieses Mißtrauen manchmal sehr unverblümt aus: irrationale Zahlen, transzendente Zahlen, imaginäre Zahlen, surreale Zahlen, Nichtstandard-Zahlen ― aber jetzt gehe ich schon über Dedekind hinaus, also zurück zur historischen Reihenfolge! Brüche in unserem Sinne kannten schon die Babylonier vor viertausend Jahren. Ein Bruch soll ausdrücken, daß ein ganzes in m gleiche Teile gebrochen wird und daß wir n solche Teile zusammen in die Hand nehmen. Sie konnten damit auch rechnen, sogar quadratische Gleichungen lösen. Zu uns gekommen ist diese Kunst auf dem Umweg über die Araber, zuerst wohl in dem 1202 erschienenen Liber Abbaci von Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci, der uns hauptsächlich durch seinen Versuch bekannt ist, die Vermehrung von Kaninchen mathematisch zu beschreiben, was sich allerdings mehr für die Mathematiker als für die Kaninchenzüchter segensreich ausgewirkt hat. Gleichzeitig brachte Fibonacci die heute übliche Zahlenschreibweise (die Dezimalzahlen) zu uns, womit das Elend der schwerfälligen römischen Zahlen endlich ausgestanden war. Im gleichen Buch hat er auch dritte Wurzeln eingeführt und näherungsweise berechnet, während Quadratwurzeln schon den Babyloniern und auch den Griechen bekannt waren. 1 Eine Seite aus dem Liber Abbaci 2 Simon Stevin Gedanklich scheint besonders die Einführung der Null schwierig gewesen zu sein. Sie ist ebenfalls durch Fibonacci zu uns gelangt, aber es gibt eine lange Vorgeschichte, auf die wir hier nicht eingehen können. Jedenfalls muß man unterscheiden zwischen der Rolle der Null in der Dezimalschreibweise von Zahlen und ihrer Rolle als gleichberechtigte Zahl, mit der man rechnen kann wie mit jeder anderen. Beides kostete langwierige Kämpfe. Noch länger dauerte es, bis negative Zahlen voll akzeptiert waren. Negative Zahlen als Lösungen von Gleichungen wollte erst der französische Mathematiker Albert Girard 1629 erlauben. Schon wesentlich früher, nämlich 1585, hatte sich der Belgier Simon Stevin dafür stark gemacht, Lösungen von Polynomgleichungen als richtige Zahlen anzusehen (wenn sie positiv sind). Dabei handelt es sich um die Lösungen von Gleichungen wie , oder, in der allgemeinsten möglichen Form, , mit ganzzahligen Koeffizienten . Um die Berechnung der Lösungen dieser Art von Gleichungen wurde jahrhundertelang gerungen, und dies hat sehr erheblich zur Entwicklung der Mathematik beigetragen. Am Anfang steht die allgemein bekannten Formel für quadratische Gleichungen (das ist der Fall ), die schon die Babylonier kannten: die Gleichung hat die beiden Lösungen . 3 Girolamo Cardano 4 Carl Friedrich Gauß Danach gab es rasche Fortschritte erst im 16. Jahrhundert. Zunächst entwickelte Girolamo Cardano 1545 eine entsprechende Formel für kubische Gleichungen ( ), danach leistete sein Schüler Lodovico Ferrari (1522 – 1565) dasselbe für die Gleichungen vierten Grades ( ). Das nährte bei den Mathematikern die Überzeugung, nun müsse es für größere Grade n genauso weitergehen, mit einer passenden Formel für jeden Grad, die allenfalls vielleicht etwas schwieriger zu finden und zu gebrauchen sein würde, wenn der Grad groß wird. Hier gab es jedoch eine herbe Enttäuschung. Nachdem viele Mathematiker sich vergeblich bemüht hatten, war wohl der in Braunschweig geborene Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855) der erste, der den Verdacht äußerte, daß es eine solche Formel vielleicht nicht geben könne, daß sie also nicht nur schwer zu finden, sondern eine Unmöglichkeit sei. Im Jahre 1824 hat das dann für den Grad 5 ein sehr junger norwegischer Mathematiker bewiesen, der bald darauf infolge seiner Mittellosigkeit an Schwindsucht starb, Nils Henrik Abel (1802 – 1829). Noch etwas weitergehend zeigte der Franzose Evariste Galois (1811 – 1832, also ebenfalls sehr jung verstorben, und zwar in einem Duell), daß es oft genug auch nicht möglich ist, für eine einzelne Lösung einer einzelnen Polynomgleichung irgendeine Beschreibung zu finden, in der nur die gegebenen ganzzahligen Koeffizienten der Gleichung sowie die Rechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie Wurzeln (vom Grad zwei oder höher, auch ineinandergeschachtelt) verwendet werden. 5 Nils Henrik Abel 6 Evariste Galois Und was gibt es noch für Krankheiten? Diese Frage stellte meine Tochter mir als kleines Kind immer wieder. Offenbar wollte sie endlich einen Überblick über alle denkbaren Bedrohungen erhalten. Ähnlich ist es mit den Mathematikern (wahrscheinlich sollte man hier die ganze Menschheit einbeziehen), die wissen wollen, ob all diese Bemühungen um den ultimativen Zahlbegriff denn jemals von einem abschließenden Erfolg gekrönt sein können, ob es eine Erweiterung des Zahlenreiches gibt, nach der keine weitere Erweiterung mehr nötig ist. Blicken wir noch einmal zurück auf die Hierarchie der Zahlen, wie sie sich uns jetzt darstellt. Am Anfang stehen die natürlichen Zahlen 1,2,3,…, die zum Zählen verwendet werden. Ergänzt durch Null und die negativen Zahlen -1,-2,-3,… bilden sie die ganzen Zahlen, im Gegensatz zu den gebrochenen oder rationalen Zahlen. Dann kommen als wiederum umfassenderer Bereich die algebraischen Zahlen, darunter die Wurzeln, aber auch andere Zahlen, die sich durch keinen noch so komplizierten Wurzelausdruck darstellen lassen. Ist nun endlich Schluß? Leider nein! Oder, je nach Standpunkt, glücklicherweise nicht. Um es zunächst einmal vom heutigen Wissensstand aus zu betrachten: Im Abschnitt über die Bändigung des Unendlichen können Sie nachlesen, daß es überabzählbar viele reelle Zahlen gibt. Die Anzahl der algebraischen Zahlen ist aber noch abzählbar, denn für die Koeffizienten eines Polynoms gibt es abzählbar viele Möglichkeiten (die ganzen Zahlen), und ein einzelnes Polynom hat nur endlich endlich viele Nullstellen; daher kann man eine Abzählung ähnlich einrichten wie Cantor es für die rationalen Zahlen getan hat. Die Hauptmasse der Zahlen ist unseren Bemühungen also immer noch entgangen! 7 Sir Isaac Newton 8 Leonhard Euler Der erste, der gesehen hat, daß offenbar noch etwas fehlt, war der Brite Sir Isaac Newton (1643 – 1727). In Buch I seiner Principia Mathematica untersucht er Kurven in der Ebene. In Lemma 28 stellt er fest, daß der Inhalt der von einer ovalen Kurve umschlossenen Fläche niemals eine 4 algebraische Zahl sein kann . Unter diese Feststellung fällt insbesondere die Fläche eines Kreises, womit also die Kreiszahl als nicht algebraische Zahl erkannt ist. Für solche nicht algebraischen Zahlen prägte der schweizerische Mathematiker Leonhard Euler (1707 – 1783) später den Begriff transzendent. Die Argumente von Newton mögen noch etwas lückenhaft sein. Besser begründete Nachweise für die Existenz transzendenter Zahlen lieferte der Franzose Joseph Liouville (1809 – 1992). Er konstruierte transzendente Zahlen zuerst 1844 durch sogenannte unendliche Kettenbrüche, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen, sodann 1851 durch unendliche Summen, wie wir sie schon bei Achill und der Schildkröte, und davor bei der Quadratwurzelberechnung kennengelernt haben. Er zeigt beispielsweise, daß der Grenzwert der folgenden Summe transzendent ist: 4 Zitiert nach P. Pesic: Abels Beweis, Springer 2005, Seite 61 Dabei bedeutet zum Beispiel 4! (lies: 4 Fakultät) die Zahl allgemein ist , und das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen. Die obige Summe kann man sich gut 9 Joseph Liouville 10 Carl Louis Ferdinand von Lindemann in Dezimalschreibweise vorstellen. Sie hat eine Null vor dem Komma und überall hinter dem Komma außer an den wenigen Stellen, deren laufende Nummer eine Fakultät ist; an diesen Stellen steht immer eine 1. Weitere konkrete und prominente Beispiele transzendenter Zahlen sind die Kreiszahl , wie schon erwähnt und unabhängig von Newton bewiesen durch Ferdinand von Lindemann (1852 – 1939), sowie die Euler-Zahl e, die Basis des naürlichen Logarithmus. Auch diese Zahl ist der Grenzwert einer unendlichen Summe, nämlich . Dedekind-Schnitte. Noch immer konnte man den Eindruck haben, es würde immer so weitergehen mit der uferlosen Entdeckung neuer Zahlentypen und man würde nie einen Überblick gewinnen. Aber nun kommt die Leistung Dedekinds. Er zeigt, wie man in einem einzigen Schritt, ausgehend von den rationalen Zahlen, also den Brüchen, das System der Zahlen zum Abschluß bringen kann, wobei dann alle algebraischen und transzendenten Zahlen auf einmal erfaßt sind. Er geht dabei von der alten Idee des Eudoxos aus; lesen Sie vielleicht an dieser Stelle noch einmal dessen Definition der Gleichheit von Proportionen im nicht kommensurablen Fall nach. Er kombiniert diese Idee nun aber mit der radikal neuen Denkweise, die er in die Mathematik hineingebracht hat und die auch seiner Idealtheorie zugrundeliegt. Er wagt es, nicht nur bekannte Objekte, zum Beispiel Zahlen, zu Mengen zusammenzufassen, nein, er geht noch einen Schritt weiter und bildet auf noch höherer Stufe Mengen, deren Elemente selbst Mengen (z.B. von Zahlen) sind. Anders gesagt, er betrachtet Mengen von bekannten Zahlen als neue Zahlen und fügt sie den alten hinzu. Wie geht das? Nun, ganz einfach: Um das Vorgehen mit dem von Eudoxos vergleichen zu können, stellen wir uns vorübergehend die Zahlen als Längen von Strecken vor. Ist d die Länge von A und hat CD die Länge Eins, so können wir außerdem die Zahl d mit der Proportion gleichsetzen (Eudoxos hört uns nicht, es würde ihn grausen). Um diese Proportion mit anderen zu vergleichen, bildet Eudoxos bereits eine Menge von Zahlenpaaren, auch wenn er diesen Begriff gar nicht kennt ― nämlich die Menge derjenigen Zahlenpaare m,n, für die gilt (Sie erinnern sich?). In heutiger Lesart heißt das . Für Eudoxos ist die Proportion (Zahl) d also bestimmt durch die Menge aller Brüche, die größer sind, die Obermenge von d. Ebenso bilden wir jetzt die Untermenge aller ; sie besteht aus allen Brüchen, die kleiner sind als d oder gleich d. Nun können wir die Geometrie und Eudoxos wieder vergessen, wir halten einfach fest, daß jede bisher bekannte Zahl d auf diese Weise eine Unter- und eine Obermenge definiert, die folgende Eigenschaften haben: Jeder Bruch aus ist kleiner als jeder Bruch aus , und jede rationale Zahl gehört genau einer dieser beiden Mengen an. Man nennt ein solches Paar von zwei Mengen rationaler Zahlen, das diese beiden Eigenschaften hat, heute einen Dedekind-Schnitt. Der Dedekind-Schnitt, der zur Zahl d gehört, beschreibt genau deren Position, sie paßt in die Lücke zwischen und , und sie ist die einzige, die dort hineinpaßt. Soweit ist noch alles wie bei Eudoxos. Jetzt kommt die genial einfache und doch unerhörte Idee: Wenn ein Dedekind-Schnitt nicht von einer schon bekannten Zahl herrührt (in der beschriebenen Weise), dann nimmt Dedekind ihn einfach als neue Zahl zu den bestehenden hinzu! Da die alten Zahlen ja ebenfalls durch Dedekind-Schnitte beschrieben waren, läuft das einfach darauf hinaus, daß man alle alten Zahlen vergessen kann und als neue Zahlen sämtliche Dedekind-Schnitte der Menge der rationalen Zahlen erklärt. Man muß dann allerdings auch noch sagen, wie man solche neuen Kunst-Zahlen der Größe nach ordnen und wie man mit ihnen rechnen will, aber das hat im Grunde alles Eudoxos schon vorgemacht. Man nennt die neugewonnenen Zahlen in ihrer Gesamtheit (einschließlich aller zuvor bekannten) die reellen Zahlen. Was ist nun gewonnen? Der Anspruch dieser Erweiterung des Zahlsystems lautet, daß danach keine weitere Erweiterung mehr nötig ist. Alle algebraischen und transzententen Zahlen und sonstigen Gespenster sind ein für allemal eingefangen. Wie kann man da so sicher sein? Nun, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die Dedekind alle aufführt: Das Supremumsprinzip gilt, das heißt, alle Lücken auf der Zahlengeraden sind nun geschlossen. Das liegt unmittelbar daran, daß eine eventuell vorhandene Lücke einen Dedekind-Schnitt definieren würde ( ist alles links von der Lücke, ist alles rechts von ihr), und dieser würde die Lücke ausfüllen. Hieraus folgt, daß man das ganze Lehrgebäude der Differential- und Integralrechnung nunmehr bestens absichern kann und es den Ingenieurstudenten in Zürich erklären kann. Eine Wiederholung der Prozedur würde nichts neues mehr bringen. Ja, denn wenn alle Lücken schon geschlossen sind, findet man auch keine Dedekind-Schnitte mehr, in die keine bereits bekannte Zahl hineinpaßt. Die Rechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sind stetig. Hören wir hierzu Dedekinds eigene Worte: Noch viel größere Weitläufigkeiten scheinen in Aussicht zu stehen, wenn man dazu übergehen will, die unzähligen Sätze der Arithmetik der rationalen Zahlen … auf beliebige reelle Zahlen zu übertragen. Dem ist jedoch nicht so; man überzeugt sich bald, daß hier alles darauf ankommt, nachzuweisen, daß die arithmetischen Operationen selbst eine gewisse Stetigkeit besitzen. Hiermit ist gemeint, daß die Summe (das Produkt, der Quotient) zweier Zahlen sich nur geringfügig ändern, wenn man die beteiligten Zahlen selbst geringfügig ändert. Diese Tatsache (die leicht einzusehen ist), reicht aus um jedes Gesetz, das im Bereich der rationalen Zahlen gültig ist, auf die reellen Zahlen zu übertragen. Dabei spielt es eine wesentliche Rolle, daß die rationalen Zahlen in der Menge aller reellen Zahlen dicht liegen, das heißt, beliebig nah bei jeder reellen Zahl findet man rationale Zahlen; auch dies eine unmittelbare Folge der Definition der reellen Zahlen mit Hilfe der Dedekind-Schnitte. An dieser Stelle können wir die letzte offene Frage über unser eingangs beschriebenes Verfahren zur Quadratwurzelberechnung klären. Die Zahlenfolge konvergiert gegen b, also konvergiert wegen der Stetigkeit der Multiplikation die Folge gezeigt haben, daß sie auch gegen c konvergiert, muß gegen . Da wir früher sein, denn eine Folge kann nicht zwei verschiedene Grenzwerte haben. Cauchy-Folgen konvergieren. Was mit dieser in moderner Terminologie formulierten Aussage gemeint ist, lassen wir am besten wieder Dedekind selbst sagen: Läßt sich in dem Änderungsprocesse einer Größe x für jede positive Größe δ auch eine entsprechende Stelle angeben, von welcher ab x sich um Weniger als δ ändert, so nähert sich x einem Grenzwerth. Heute sagen wir so: um zu zeigen, daß eine Folge konvergiert, muß man den Gernzwert nicht im Voraus kennen; dann kann man zwar nicht nachweisen, daß sich die Glieder der Folge diesem Grenzwert beliebig stark annähern, aber das muß man auch gar nicht, es reicht, zu zeigen, daß sich die Glieder untereinander beliebig stark annähern. Folgen mit der zuletzt genannten Eigenschaft heißen heute Cauchy-Folgen nach Augustin Louis Cauchy, 1789 – 1857. Die oben formulierte Aussage ist für sich allein schon wichtig, aber uns interessiert sie hier besonders deshalb, weil sie die Brücke zwischen Dedekind und seiner Konkurrenz schlägt, wovon im nächsten Abschnitt die Rede sein soll. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß außer der Konvergenz der Cauchy-Folgen auch das Supremumsprinzip und die Stetigkeit der Rechenoperationen in Cauchys Werken schon auftauchen, wenn auch ohne befriedigende Begründung und ohne die Einsicht, welche Bedeutung diese Eigenschaften haben. 11 Augustin Louis Cauchy 12 Georg Cantor Wege anderer Mathematiker zu den reellen Zahlen. Hier ist in erster Linie Georg Cantor zu nennen, von dem im Abschnitt über die Bändigung des Unendlichen schon ausführlich die Rede war. Er war mit Dedekind befreundet und schickte ihm 1872, gerade als Dedekind das Vorwort zu „Stetigkeit und Irrationalzahlen“ schrieb, eine Arbeit zu, in der er einen unabhängigen eigenen Zugang zu den reellen Zahlen beschreibt. Lassen wir Dedekind mit seiner Reaktion selbst zu Wort kommen: Und während ich an diesem Vorwort schreibe (20. März 1872), erhalte ich die interessante Abhandlung „Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen“, von G. Cantor (Math. Annalen von Clebsch und Neumann, Bd. 5), für welche ich dem scharfsinnigen Verfasser meinen besten Dank sage. Wie ich bei raschem Durchlesen finde, so stimmt das Axiom in §.2 derselben, abgesehen von der äußeren Form der Einkleidung, vollständig mit dem überein, was ich unten in §.3 als das Wesen der Stetigkeit bezeichne5. Welchen Nutzen aber die 5 Gemeint ist die Eigenschaft, daß jeder Dedekind-Schnitt durch eine reelle Zahl ausgefüllt ist wenn auch nur begriffliche Unterscheidung von reellen Zahlgrößen noch höherer Art gewähren wird, vermag ich gerade nach meiner Auffassung des in sich vollkommenen reellen Zahlgebietes noch nicht zu erkennen. Die Bemerkung am Schluß dieses Zitats legt den Finger in eine Wunde: Dedekind hat sofort eine Unausgegorenheit in Cantors Artikel erkannt und benennt sie, ohne im mindesten verletzend zu sein, auf sehr vornehme Weise. Dazu unten mehr. Zunächst halten wir fest, daß auch Cantor die reellen Zahlen konstruiert und daß sein Produkt dem von Dedekind mathematisch völlig gleichwertig ist. Jedoch wählt er eine völlig andere Konstruktionsmethode: Er geht aus von den Cauchy-Folgen rationaler Zahlen, von denen sehr viele im Bereich der rationalen Zahlen keinen Grenzwert haben. Seine Idee ist nun, die Cauchy-Folgen von rationalen Zahlen selbst als die neuen Zahlen zu nehmen. Nur gibt es dabei ein technisches Problem, denn mehrere Cauchy-Folgen können z.B. gegen dieselbe rationale Zahl konvergieren, und es ist zu erwarten, daß auch dann, wenn der Grenzwert eine Zahl ist, die erst neu erschaffen werden muß, dasselbe passiert. Das heißt, man muß stets (unendlich) viele Cauchy-Folgen zu einer neuen Zahl bündeln. Wann zwei Folgen zusammengehören, ist klar: genau dann, wenn aus ihnen durch Zusammenfügen nach dem Reißverschluß-Prinzip wieder eine Cauchy-Folge entsteht. Somit ist bei Cantor jede reelle Zahl eine Menge von unendlich vielen Cauchy-Folgen rationaler Zahlen, ein nicht minder kühner Gebrauch des Mengenbegriffs als bei den Dedekind-Schnitten. Die Technik läuft nach dieser Idee dann wieder geradlinig ab; man muß zeigen, daß sich alle wesentlichen Eigenschaften der rationalen Zahlen auf die reellen Zahlen übertragen, daß aber eine neue Eigenschaft hinzukommt, die besagt, daß man nunmehr alle wünschenswerten Zahlen erreicht hat. In diesem Fall ist das die Eigenschaft, daß in den reellen Zahlen jede Cauchy-Folge bereits konvergent ist. Wir erinnern uns, daß Dedekind die entsprechende Eigenschaft für seine reellen Zahlen bewiesen hat. Umso verblüffter muß er gewesen sein, daß Cantor in seinem Artikel zumindest den Eindruck macht, als glaubte er, man müsse seine Prozedur mehrfach, vielleicht unendlich oft, wiederholen. Darum geht es in der oben schon kommentierten Bemerkung aus Dedekinds Vorwort. In Wirklichkeit ist es so, daß auch Cantors Verfahren nach einmaliger Anwendung endgültig abgeschlossen ist. Aus manchen Gründen wird es heute gegenüber dem Dedekindschen oft bevorzugt. Einer der Gründe ist, daß Dedekind eine Ordnung (die Begriffe größer und kleiner) unter den rationalen Zahlen braucht um seine Schnitte zu definieren. Cantors Verfahren bewährt sich auch dann, wenn eine solche Ordnung nicht gegeben ist, was in vielen für die Mathematik interessanten Situationen der Fall ist (aber natürlich nicht bei den rationalen Zahlen). Um zu verstehen, warum Cantor glaubt, seine Konstruktion müsse mehrfach angewendet werden, muß man sich anschauen, was eigentlich sein Anliegen war. Der Titel seiner Arbeit (in obigem Dedekind-Zitat erwähnt) sagt es deutlich: seine Arbeit handelt von einem sehr konkreten Problem der Analysis, das mit dem Konvergenzverhalten sogenannter trigonometrischer Reihen zu tun hat (wie man sie bei der Frequenzanalyse von Schwingungsvorgängen antrifft). Um sein Ergebnis formulieren zu können, mußte er eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen von Zahlenmengen einführen, und eigentlich war die Hinzunahme von Grenzwerten aller Cauchyfolgen nur dazu gedacht, zu zeigen, daß alle die von ihm unterschiedenen Mengentypen tatsächlich auftreten. In diesem Zusammenhang spielte dann die Anzahl der Wiederholungen dieser Konstruktion eine Rolle. Cantor hat aber dann bemerkt, daß seine Konstruktion nebenbei auch das alte Problem löst, das System der Zahlen zu einem endgültigen Abschluß zu bringen, und er hat das ebenso nebenbei und etwas hastig in dieselbe Arbeit eingebaut, ohne sich darüber klar zu sein, oder zumindest ohne dem Leser deutlich zu sagen, daß er an einigen Stellen der Arbeit an Teilmengen des Systems der reellen Zahlen denkt und an anderen Stellen an das System aller reellen Zahlen. Man spürt einen gewaltigen Kontrast zwischen diesen beiden Mathematikercharakteren. Dedekind hat nach jahrelangem Nachdenken eine abgeklärte und in jedem Detail perfekte und ausgereifte Lösung eines klar umrissenen Problems vorgelegt. Cantor dagegen steht mitten in einem Kampfgetümmel, bei dem es um etwas ganz anderes geht, man spürt, wie er von den neuen Ideen und Feststellungen hingerissen ist, und ohne sich Zeit nehmen zu können um die Dinge sich setzen zu lassen, schreibt er eine Arbeit, in der alles heraus muß, was er gefunden hat. 13 Karl Weierstraß 14 Bernard Bolzano Zumindest erwähnen wollen wir, daß auch der Berliner Mathematiker Karl Weierstraß (1815 - 1897) in seinen unveröffentlichten Vorlesungen 1865 eine gleichwertige, aber im Weg abweichende Konstruktion der reellen Zahlen durchgeführt hat. Dieser Zugang wurde 1867 von seinem Schüler Hermann Hankel (1839 – 1873) veröffentlicht und ist damit die erste im Druck erschienene Konstruktion der reellen Zahlen. Zwei weitere, ungefähr gleichzeitige Veröffentlichungen mit ähnlichem Inhalt stammen von Heinrich Eduard Heine (1821 -1881) und Charles Méray (1835 – 1911). Der früheste bekannte Versuch, die reellen Zahlen zu konstruieren, wurde in den Jahren nach 1817 von dem Prager Bernard Bolzano (1781 – 1848) unternommen, aber nicht veröffentlicht. Er erkannte seine Arbeit später selber als fehlerhaft, soll allerdings dann auch eine erfolgreiche Korrektur gefunden haben. Heutige Mathematikstudenten lernen übrigens Bolzano und Weierstraß in ihrem ersten Semester als Gespann kennen, weil ein fundamentaler Satz der Analysis, der eng mit dem Supremumsprinzip zusammenhängt, von ihnen stammt und nach ihnen benannt ist. Diese Häufung von mehr oder weniger erfolgreichen Angriffen auf das Problem, die reellen Zahlen auf eine solide Grundlage zu stellen, zeigt offenkundig, daß das Problem „sturmreif“ war. Die Mathematiker hatten es lange genug umkreist und von allen Seiten betrachtet, und die Begriffe der Mengenlehre, die in der Luft lagen, gaben genügend Hilfsmittel her, um die Festung zu besiegen. Dennoch bleibt es das Verdienst Dedekinds, als erster einen erfolgreichen Zugang gefunden zu haben; außerdem ist seine gedankliche Durchdringung des ganzen Komplexes wohl die ausgereifteste und tiefschürfendste unter den Konkurrenten. 15 René Descartes Jedes Ende ist zugleich ein Anfang. Auf den vorangegangenen Seiten haben wir mehrmals das Wort „endgültig“ für die angestrebte und schließlich durch Dedekind erreichte Erweiterung des Zahlbegriffes gebraucht, aber wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, daß das nicht ganz ernstgemeint ist. In der Mathematik ist nie etwas endgültig in dem Sinne, daß danach nichts mehr kommen kann (wohl in dem anderen Sinn, daß mathematische Wahrheiten nicht „verfallen“ können). Tatsächlich war lange vor Dedekind klar, daß nach den reellen Zahlen noch mehr kommen muß. Beim Lösen quadratischer Gleichungen stößt man bereits auf den Fall, daß man nach der Quadratwurzel einer negativen Zahl zu suchen hat, etwa bei der Gleichung . Eine reelle Lösung kann es dafür nicht geben, denn das Quadrat einer reellen Zahl ist nie negativ. Hier war es noch möglich, zu sagen, daß diese Gleichung eben keine Lösung besitzt, aber bei Gleichungen dritten Grades kann es vorkommen, daß die Gleichung drei reelle Lösungen hat (mehr kann es nicht geben), und dennoch in den Lösungsformeln von Cardano als Zwischenstadium der Berechnung Wurzeln aus negativen Zahlen gebildet werden müssen. Man fing also irgendwann an, auch mit Wurzeln aus negativen Zahlen zu rechnen, allerdings mit großem Unbehagen, das sich in dem von René Descartes (1596– 1650) geprägten Namen imaginäre Zahlen (d.h. soviel wie scheinbare, bloß vorgestellte Zahlen) ausdrückt. Carl Friedrich Gauß prägte viel später den Ausdruck komplexe Zahlen für Zahlen, die aus einem reellen und einem imaginären Bestandteil als Summe zusammengesetzt sind, und er stellte diese Zahlen als Punkte einer Ebene, der komplexen Zahlenebene, dar. Noch wichtiger war, daß Gauß in seiner Doktorarbeit 1799 (also mit etwa 22 Jahren) den Fundamentalsatz der Algebra bewies, der besagt, daß jede Polynomgleichung mindestens eine komplexe Lösung besitzt. (Natürlich sind dabei Gleichungen der Form ausgenommen, in denen gar keine Unbekannte x auftritt). Dies hatten bereits Descartes und der ebenfalls schon einmal erwähnte Albert Girard ohne Beweis behauptet. Durch Dedekinds Absicherung des Begriffs der reellen Zahlen standen auch die komplexen Zahlen auf solidem Grund, denn man kann sie leicht aus den reellen Zahlen entwickeln (etwa als Paare reeller Zahlen mit bestimmten einfachen Rechenregeln). 16 Sir William Rowan Hamilton 17 Arthur Cayley Nun könnte man wieder meinen, daß damit endlich allen moralisch gerechtfertigten Bedürfnissen abgeholfen wäre, aber weit gefehlt. Schon früh entwickelte der Ire Sir William Rowan Hamilton (1805 – 1865) den Traum, auch mit Tripeln reeller Zahlen so rechnen zu können wie Gauß mit Paaren. Das verlockte ihn deshalb, weil man die Drehungen der Ebene mit den komplexen Zahlen (aufgefaßt als Gaußsche Zahlenebene) wunderschön beschreiben kann, und er hoffte, daß ihm etwas ähnliches mit den viel schwierigeren Drehungen des Raumes gelingen könnte. Darum hat er viele Jahre gekämpft, bis er einsah, daß es nicht ging (und man weiß heute, daß es nicht gehen konnte), aber daß es mit Quadrupeln (aus 4 reellen Zahlen bestehend) möglich ist. Statt der komplexen Zahlen mit der imaginären Einheit i und dem Rechengesetz schuf er nun 1843 die Quaternionen mit gleich drei imaginären Einheiten i,j,k und den Gesetzen sowie , , . Man sieht, daß es bei dieser Multiplikation auf die Reihenfolge der Faktoren ankommt, eine für „Zahlen“ höchst merkwürdige Eigenschaft. Dennoch, oder gerade deshalb, erwiesen sich die Quaternionen als äußerst nützlich, wenn auch vielleicht nicht ganz so nützlich wie Hamilton es meinte. Aber es stimmt, daß sie hervorragend für die Berechnung von Drehungen geeignet sind. Ein Fachmann für Raketensteuerung hat mir erzählt, daß der winzige Computer an Bord der Apollo-Mondfähre niemals in der Lage gewesen wäre, die Raketenmanöver zu berechnen, wenn nicht bei seiner Programmierung diese Vorteile der Quaternionen ausgenutzt worden wären. Nachzutragen ist hier, daß Hamilton sich auch eine zeitlang vergeblich um die Konstruktion der reellen Zahlen bemüht hatte. Nun wundert es nicht mehr, daß es danach eine weitere Station gibt: Arthur Cayley (1821 – 1895) entwickelte 1845 die Oktaven mit nunmehr sieben imaginären Einheiten, mit deren Hilfe man die Drehungen eines siebendimensionalen Raumes beschreiben kann. Eher ist es jetzt überraschend, daß nun doch einmal ein Satz bewiesen wird, der besagt, daß es auf diesem Wege nicht mehr weitergeht. Ferdinand Georg Frobenius (1849 – 1917) zeigt nämlich im Jahre 1878, daß eine nochmalige Verdopplung der Oktaven nichts sinnvolles mehr bringen kann, ja, daß in gewissem Sinne nun mit diesen vier Systemen (reelle und komplexe Zahlen, Quaterionen und Oktaven) alle denkbaren Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 18 Ferdinand Georg Frobenius Es ist dennoch keineswegs so, daß mit dem Satz von Frobenius Grabesruhe eingekehrt wäre; die wird es in der Mathematik nie geben, und der Satz besagt ja auch nur, daß es auf diesem Wege nicht mehr weitergeht. Eine durchschlagende Neuerung gab es zum Beispiel in den 1960er Jahren, als Abraham Robinson (1918 – 1974) die sogenannten Nichtstandard-Zahlen (heute auch als hyperreelle Zahlen bezeichnet) entwickelte. Dieses Zahlsystem hat auch Platz für unendlich kleine Zahlen (näher bei Null als jede reelle Zahl) und für unendlich große Zahlen (größer als jede reelle Zahl). Damit läßt sich der Begriff der infinitesimalen Größe, den Leibnitz und Newton bei ihrer Einführung der Differential- und Intergalrechnung sehr intuitiv verwendet haben, recht- fertigen, und man hat klare Regeln, welche Schlüsse damit erlaubt sind und welche nicht. Dies ist eine große Leistung; sie war zunächst nur deshalb möglich, weil in den Jahren zuvor die mathematische Logik entscheidende Fortschritte gemacht hatte. Allerdings gibt es inzwischen auch einfachere Zugänge zu diesem neuen Zahlenreich. Wie um die Behauptung zu beweisen, daß es in der Mathematik nie einen endgültigen Schluß gibt, stellte John Conway dann nochmals eine Erweiterung vor, die über die hyperreellen Zahlen hinausgeht und mit einer Konstruktion ähnlich den Dedekindschen Schnitten erreicht wird. Donald E. Knuth, der Schöpfer des wunderbaren (hier leider nicht verwendeten) Textverarbeitungssystems TEX, hat diese surrealen Zahlen 1974 in einem Roman ausführlich beschrieben. Erst danach erschien (1976) ein Fachbuch von Conway mit dem Titel „On Numbers and Games“, in dem diese Zahlen mathematisch präsentiert werden. Sie haben engen Bezug zu Spielen und den darin verwendeten Strategien. Wer wüßte jetzt nicht gerne, was in tausend Jahren der Stand der „Zahlenfrage“ sein wird? Und wer würde nicht gern etwas zu dieser unendlich spannenden Geschichte beitragen?