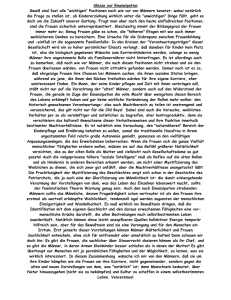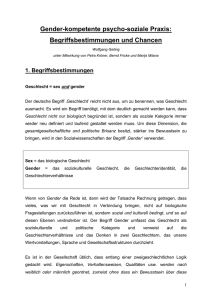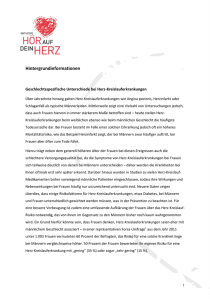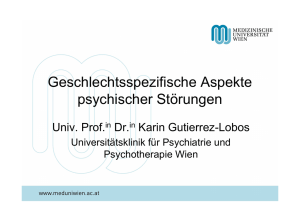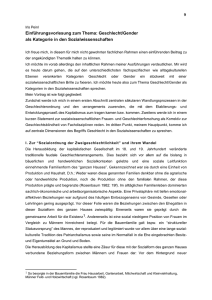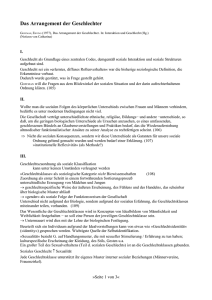Effekte des biologischen Geschlechts
Werbung
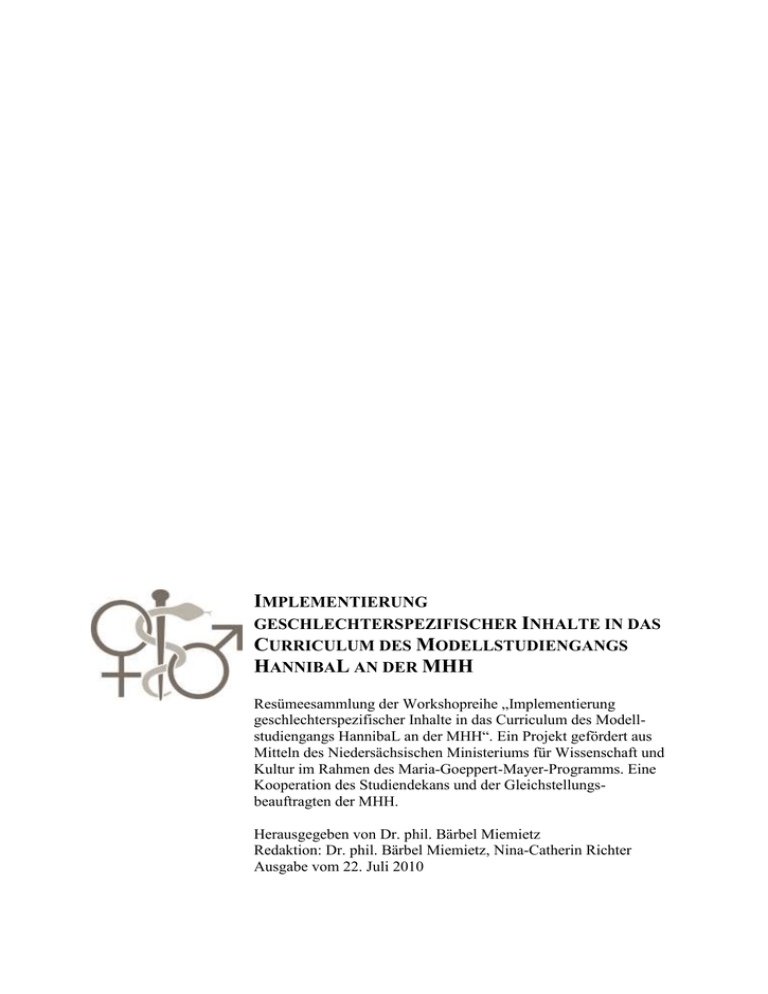
IMPLEMENTIERUNG GESCHLECHTERSPEZIFISCHER INHALTE IN DAS CURRICULUM DES MODELLSTUDIENGANGS HANNIBAL AN DER MHH Resümeesammlung der Workshopreihe „Implementierung geschlechterspezifischer Inhalte in das Curriculum des Modellstudiengangs HannibaL an der MHH“. Ein Projekt gefördert aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur im Rahmen des Maria-Goeppert-Mayer-Programms. Eine Kooperation des Studiendekans und der Gleichstellungsbeauftragten der MHH. Herausgegeben von Dr. phil. Bärbel Miemietz Redaktion: Dr. phil. Bärbel Miemietz, Nina-Catherin Richter Ausgabe vom 22. Juli 2010 Medizin und Geschlecht INHALT I Workshop (Nephrologie) 11. April 2008 Warum haben Frauen rote Wangen? VON PROFESSORIN DR. MARION HAUBITZ Geschlechterspezifische Aspekte des akuten Nierenversagens VON PROFESSORIN DR. FAIKAH GÜLER II Workshop (Rechtsmedizin) 19. September 2008 Häusliche Gewalt - ein Thema für die universitäre Medizin? VON PROFESSORIN DR. BRIGITTE LOHFF Diagnostik und Intervention bei Gewaltopfern – eine interdisziplinäre Herausforderung VON PD DR. ANETTE SOLVEIG DEBERTIN Geschlecht, Gewalt und Gesundheit – Rechtsmedizinische Aspekte in Praxis und Forschung VON PD DR. HILDEGARD GRAß UND PROFESSORIN DR. STEFANIE RITZ-TIMME III Workshop (Anästhesiologie und Intensivmedizin) 30. Oktober 2008 GESCHLECHTERUNTERSCHIEDE UND LEBENSWISSENSCHAFTEN - HISTORISCH BETRACHTET VON PROFESSORIN DR. BETTINA WAHRIG Geschlechterspezifische Aspekte in der Schmerzmedizin VON PROFESSOR DR. MATTHIAS KARST Geschlechterspezifische Unterschiede bei einem schweren Verbrennungstrauma VON PROFESSOR DR. HANS-OLIVER RENNEKAMPFF Geschlechterspezifische Aspekte in der Katastrophenmedizin VON PROFESSOR DR. HANS ANTON ADAMS 5 Medizin und Geschlecht IV Workshop (Gastroenterologie und Hepatologie) 16. Januar 2009 Geschlechtsunterschiede bei Lebererkrankungen VON PD DR. KINAN RIFAI Geschlechterspezifische Aspekte Gastrointestinaler Tumoren Am Beispiel von Ösophaguskarzinom, Hepatozellulärem Karzinom, Pankreaskarzinom und Kolonkarzinom VON PROFESSOR DR. MICHAEL P. MANNS, DR. BENITA WOLF, PROFESSOR DR. NISAR P. MALEK V Workshop (Kardiologie) 13. Februar 2009 Geschlechterspezifische Aspekte in der Intensivmedizin VON PROFESSORIN DR. URSULA MÜLLER-WERDAN Geschlechterspezifische Aspekte kardiovaskulärer Erkrankungen jenseits von Arteriosklerose und Herzinsuffizienz: Vitien und Rhythmusstörungen VON DR. MECHTHILD WESTHOFF-BLECK Die peripartale Kardiomyopathie VON PROFESSORIN DR. DENISE HILFIKER-KLEINER VI Workshop (Humangenetik) 13. März 2009 Väterlich und mütterlich geprägte Gene VON DR. BRIGITTE PABST Erblicher Brustkrebs - auch Männer haben es in sich VON DR. DOROTHEA GADZICKI VII Workshop (Neurologie) Geschlecht im Hirnbild - K(l)eine Unterschiede VON PROFESSORIN DR. BRITTA SCHINZEL Geschlechterspezifische Aspekte bei Neuro-AIDS VON PROFESSORIN DR. GABRIELE ARENDT Geschlechterspezifische Aspekte bei neuromuskulären Erkrankungen VON PROFESSORIN DR. SUSANNE PETRI Epilepsie bei Frauen – eine besondere Situation VON DR. CLAUDIA WENZEL 6 24. April 2009 Medizin und Geschlecht VIII Workshop (Hämatologie) 25. September 2009 „Geschlechterspezifische Aspekte bei Gerinnungserkrankungen“Auswirkungen von Gerinnungsstörungen bei Frauen VON DR. ROSWITH EISERT Geschlechterspezifische Unterschiede in hämatologischer Toxizität und Gesamtüberleben bei Patienten mit Hodgkin Lymphom und anderen Neoplasien VON DR. BEATE KLIMM IX Workshop (Pharmakologie und Toxikologie) 23. Oktober 2009 GESCHLECHTERSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE IN DER TOXIZITÄT VON ARZNEIMITTELN AM BEISPIEL VON PSYCHOPHARMAKA VON DR. KATHARINA WENZEL-SEIFERT Geschlechterspezifische Unterschiede in der Wirkung von PDE5 Inhibitoren bei “Male Erectile Dysfunktion (ED) & Female Sexual Dysfunction (FSD)” VON DR. PETER SANDNER Geschlechterspezifische Unterschiede in der Pharmakologie kardiovaskulärer Erkrankungen VON DR. SABINE OERTELT-PRIGIONE Geschlechtsunterschiede in der Kreislaufregulation VON DR. KARSTEN HEUSSER X Workshop (Jugendmedizin) 20. November 2009 BIOLOGIE + KULTUR = GESCHLECHTERROLLENVERTEILUNG ODER WIE WERDEN WIR ZU MÄDCHEN/JUNGEN? VON PROFESSORIN DR. UTE THYEN BEWÄLTIGUNG CHRONISCHER KRANKHEIT IM KINDES- UND JUGENDALTER: GESCHLECHTERSPEZIFISCHE RISIKEN UND BERATUNGSANGEBOTE VON PROFESSORIN DR. KARIN LANGE 7 Medizin und Geschlecht XI Workshop (Pneumologie) 30. April 2010 GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE IN DER (PULMONALEN) LEISTUNGSDIAGNOSTIK VON PROFESSOR DR. RALF EWERT LUNGENKREBS – GIBT ES UNTERSCHIEDE ZWISCHEN MÄNNERN UND FRAUEN? VON DR. NICOLAS DICKGREBER ZUGESAGT BIS ZUM 22. JULI 2010 COPD – GESCHLECHTERSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN – EFFEKTIVE PNEUMOLOGISCHE REHABILITATION VON DR. KARIN TAUBE GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE BEI DER RAUCHPRÄVENTION VON DR. RICHARD LUX SCHLAF UND NÄCHTLICHE ATEMSTÖRUNGEN – GESCHLECHERSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE VON DR. BIRGIT HOFFMANN-CASTENDIECK XII Workshop (Arbeitsmedizin) WHY ADAM IS NOT EVE AT WORK – GRUNDLAGEN UND BEISPIELE EINER GESCHLECHTERSPEZIFISCHEN ARBEITSMEDIZIN VON DR. CHRISTINE KALLENBERG MÄNNER SIND ANDERS – FRAUEN NICHT! – PRÄVENTION UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG GESCHLECHTERGERECHT GESTALTEN VON THOMAS ALTGELD ZUR GESUNDHEIT WEIBLICHER FÜHRUNGSKRÄFTE DR. BETTINA BEGEROW 8 28. Mai 2010 Medizin und Geschlecht NEPHROLOGIE 11. APRIL 2008 9 Medizin und Geschlecht 10 Medizin und Geschlecht WARUM HABEN FRAUEN ROTE WANGEN? VON PROFESSORIN DR. MARION HAUBITZ Unter geschlechterspezifischer Medizin versteht „Mann“ meist gesundheitsspezifische Bereiche für Frauen (wie gynäkologische Erkrankungen, Schwangerschaft und Menopause, allenfalls noch Osteoporose und Venenleiden). Diese Sicht ist allerdings etwas einseitig, da geschlechterspezifische Unterschiede sich nicht nur auf diese Bereiche, ja nicht nur auf Frauen beziehen, wie am Beispiel des systemischen Lupus Erythematosus (SLE) deutlich werden soll. Der SLE ist eine Autoimmunerkrankung. Wie die meisten Autoimmunerkrankungen tritt er bei Frauen häufiger auf. Das Übergewicht für die Frauen ist bei dieser Erkrankung besonders ausgeprägt, es liegt bei 9:1 (bei der multiplen Sklerose beispielsweise 3:1, bei der Myasthenia gravis 2:1). Der SLE ist eine durch komplexe Störungen der zellulären und humoralen Immunantwort charakterisierte Systemerkrankung, bei der unterschiedliche Organe befallen sein können und bei der Autoantikörper gegen unterschiedliche Zellantigene nachgewiesen werden. Das klinische Bild ist sehr variabel. Erste Symptome sind häufig Hautveränderungen (wie die roten Wangen, das Schmetterlingserythem) und Arthralgien. Die Nieren sind klinisch bei bis zu 80 % der Patientinnen und Patienten im Krankheitsverlauf betroffen. Das Spektrum der Nierensymptomatik reicht von geringen Auffälligkeiten im Urinstatus bis zum akuten Nierenversagen. Für die Langzeitprognose der Patientinnen und Patienten ist die Nierenbeteiligung entscheidend. Als pulmonale Manifestation können sich eine Pleuritis, eine Alveolitis und später eine Lungenfibrose und/oder eine pulmonale Hypertonie entwickeln. Die häufigste Herzbeteiligung ist eine Perikarditis, aber auch eine Myokarditis bzw. Endokarditis wird beobachtet. Eine Lupusmanifestation des zentralen Nervensystems kann sich in Wesensveränderungen, Anfällen, Hirninfarkten oder Kopfschmerzen äußern. Eine hämatologische Manifestation kann alle drei Zellreihen betreffen. Als Allgemeinsymptome werden Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust und Fieber sowie Übelkeit beobachtet. Lymphknotenvergrößerungen und Splenomegalie finden sich bei einem Viertel der Patientinnen und Patienten. Der SLE führt zu einer Verkürzung der Lebenserwartung mit einem 10-Jahres-Überleben von ca. 80 %. Hierfür ist nicht nur die Krankheitsaktivität und Therapienebenwirkungen, sondern auch eine akzelerierte Atherosklerose verantwortlich. So erhöht sich bei Frauen im Alter zwischen 35 und 44 Jahren das Risiko für eine koronare Herzerkrankung bis um das 50fache. 11 Medizin und Geschlecht Bei der Ätiologie des SLE scheinen die weiblichen Sexualhormone, genetische und Umweltfaktoren eine Rolle zu spielen. So liegt der Erkrankungsgipfel zwischen 15 und 40 Jahren (gebärfähiges Alter). Eine Hormontherapie und Schwangerschaften können einen Schub auslösen. Für die Bedeutung des genetischen Hintergrundes spricht die familiäre Häufung, die Konkordanz (bei monozygoten Zwillingen ist der zweite zu 25-30 % erkrankt, bei dizygoten nur zu 5 %), ethnische Unterschiede (dreimal so viele Erkrankte bei Afroamerikanerinnen und -amerikanern) und eine Assoziation zu bestimmten HLA-Antigenen und zu Polymorphismen in der Pathogenese relevanter Proteine. Außerdem finden sich bei einem Teil der Patientinnen und Patienten Komplementdefekte und Veränderungen, die zu einer reduzierten Elimination von Immunkomplexen führen. Umweltfaktoren sind vor allem UV-Licht, aber auch Medikamente und Infektionen kommen als Auslöser der Erkrankung in Betracht. Faktoren der Pathogenese scheinen eine polyklonale Hyperaktivität der B-Zellen und/oder Defekte der T-Zell-Autoregulation zu sein, so dass autoreaktive TZellen die Deletion im Thymus überleben. Von pathogenetischer Relevanz scheint außerdem eine Störung in der Apoptose bzw. der Elimination apoptotischer Zellen zu sein, die zu einer Vermehrung von Kernantigenen bzw. Nukleosomen in der Zirkulation führen und damit zur Aktivierung von THelfer-Zellen mit der Folge einer Stimulation von autoreaktiven B-Zellen, was zur Produktion von Autoantikörpern führt. Diese Autoantikörper bestimmen den weiteren Krankheitsverlauf, indem sie zu histiozytotoxischen bzw. Immunkomplexreaktionen führen. So können Autoantikörper gegen Blutzellen zu einer Zytopenie führen, solche gegen Plasmaprotein zu einer Blutungsneigung, anti-Phospholipid-Antikörper zu vermehrten Thrombosen, Antikörper gegen Gewebeantigene zur Immunkomplexbildung. Für die Pathogenese der Lupusnephritis ist die Immunkomplexbildung entscheidend. Diese induzieren die Freisetzung bzw. Hochregulation von Mediatoren und führen zur vermehrten Expression von Adhäsionsmolekülen und zu einer Chemotaxis und Aktivierung myelomonozytärer Zellen mit der Folge eines Entzündungsprozesses. In Bezug auf die Thematik der Workshopreihe stellt sich die Frage, worin die unterschiedliche Geschlechterprävalenz des SLE ätiologisch und pathogenetisch begründet liegt. Hierzu gibt es einige Annahmen (Frauen haben ein „kraftvolleres“ Immunsystem, Östrogene stimulieren das Immunsystem, Frauen sind resistenter gegenüber einer stressbedingten Hemmung des Immunsystems), aber nur wenige Daten. So wurden Störungen im Östrogenmetabolismus bei einer Gruppe von SLE-Patientinnen beobachtet. Außerdem verändern Östrogene 12 Medizin und Geschlecht die B-Zellreifung und führen im Mausmodell zu einer Akzeleration der Erkrankung. Das Hypophysenvorderlappen-Hormon Prolaktin (hauptsächlich für Brustwachstum und Milchsekretion verantwortlich) hat einen immunstimulatorischen Effekt und begünstigt Autoimmunität. So stört Prolaktin die negative Selektion autoreaktiver B-Zellen; es erhöht den proliferativen Response auf spezifische Antigene und die Entwicklung antigen-präsentierender Zellen und die Expression kostimulatorischer Moleküle. So haben Patientinnen mit einer Hyperprolaktinämie eine Vielzahl von Autoantikörpern, auch solche, die beim SLE nachgewiesen werden. Umgekehrt können allerdings nur bei 15 bis 33 % der SLE-Patientinnen erhöhte Prolaktinspiegel nachgewiesen werden. Im Tiermodell korrelieren die Prolakatinspiegel mit der Krankheitsaktivität, eine Prolaktinhemmung verbessert das Überleben. Allerdings sind die Ergebnisse bei Patientinnen widersprüchlich. Letztendlich ist die Ursache der erhöhten Prävalenz des SLE bei Frauen nicht geklärt, wäre jedoch von großer Bedeutung. Es würden auch die betroffenen Männer profitieren. Interessanterweise ist die Prognose bei an SLE erkrankten Männern deutlich schlechter. Die Diagnose wird oft später gestellt, da angesichts der Geschlechtsdominanz bei Männern nicht an die Erkrankung gedacht wird. Erschwerend kommt eine gegenüber Frauen veränderte Symptomatik (andere Hautmanifestationen, weniger Muskelund Gelenkmanifestationen, jedoch häufiger Serositis) hinzu. Nierenbeteiligungen sind häufiger, und trotz vergleichbarer Therapie ist der Verlauf aggressiver, und Männer entwickeln häufiger eine terminale Niereninsuffizienz. Die Folge sind eine deutlich erhöhte Mortalität und Morbidität. Es ist wichtig, auf diese Unterschiede hinzuweisen, um die Erkrankung in der Zukunft auch bei Männern frühzeitig zu diagnostizieren. Ob eine aggressivere oder auch nur andere immunsuppressive Therapie notwendig ist, müssen Studien zeigen. Aufgrund des Umfangs der Thematik soll hier auf die Therapie des SLEs nicht weiter eingegangen werden. Es sei nur darauf hingewiesen, dass vor allem die Gonadentoxizität der Frauen mit der Folge einer möglicherweise permanenten Infertilität bzw. vorzeitigen Menopause als wichtige Nebenwirkung einer Standardtherapie (mit Cyclophosphamid) einer der Auslöser für die Suche nach Therapiealternativen war. So haben Erkenntnisse in Bezug auf die Entstehung der Autoantikörper zur Entwicklung neuer Therapieansätze für die Zukunft geführt, die zurzeit in Studien erprobt werden. Kontakt Prof’in Dr. Marion Haubitz Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen Medizinische Hochschule Hannover 13 Medizin und Geschlecht Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 24 29 E-Mail: [email protected] 14 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE DES AKUTEN NIERENVERSAGENS VON PROFESSORIN DR. FAIKAH GÜLER Das akute Nierenversagen (ANV) stellt ein wichtiges internistisches Krankheitsbild dar. Es ist durch einen plötzlich auftretenden Verlust der Nierenfunktion mit deutlicher Einschränkung oder gänzlichem Verlust der Urinausscheidung gekennzeichnet. Der Verlust der Nierenfunktion führt zu einem Anstieg von Kreatinin und Harnstoff, sowie zu einer Akkumulation harnpflichtiger Substanzen, was zu akut lebensbedrohlichen Situationen führen kann. Verschiedene Faktoren können ein ANV auslösen, dazu gehören: Einschränkung der Nierendurchblutung (ischämisches ANV), Einfluss toxischer Substanzen auf die Niere (z.B. Aminoglykosid Antibiotika oder Kontrastmittelgabe), Druckschädigung der Niere (z.B. bei Abschlussstörungen durch beidseitige Nierensteine, Vergrößerung der Prostata bei älteren Männern oder Rückstau bei Fehlbildungen der Harnwege - Refluxnephropathie). Bestimmte Situationen erhöhen das Risiko, ein ANV zu entwickeln, so können nach Herzoperationen 5-20 % der Patientinnen und Patienten meist durch mangelhafte Durchblutung der Niere bedingt ein ANV entwickeln. Etwa 15-50 % der Patientinnen und Patienten mit einer Sepsis und 5-20 % der Patientinnen und Patienten, die eine Therapie mit Aminoglykosidhaltige Antibiotika erhalten, entwickeln ein ANV (Schrier et al. 2004). Durch eine zunehmende Zahl an präklinischen und klinischen Studien weiß man inzwischen, dass Männer und Frauen unterschiedlich auf die verschiedenen Schädigungsmechanismen reagieren, die zu einem ANV führen. Erst kürzlich wurde eine Studie veröffentlicht, die zeigte, dass von 1600 Patientinnen und Patienten nach einer Bypassoperation 3 % ein schweres ANV erlitten und dass ein wesentlicher Risikofaktor dafür hohes Alter und weibliches Geschlecht war. In einer anderen Studie an über 1200 Patientinnen und Patienten konnte gezeigt werden, dass nach schweren Unfällen Männer ein doppelt so hohes Risiko wie Frauen haben eine Sepsis (31 versus 17 %) oder ein Multiorganversagen (30 versus 16 %) zu entwickeln (Oberholzer et al. 2000). In dieser Studie wie auch in weiteren Studien (Spery et al. 2008) wurde herausgefunden, dass Männer mit einem deutlich höheren Anstieg von pro-inflammatorischen Zytokinen (Interleukin-6) auf einen Unfall reagierten als Frauen. Bei dem Krankheitsbild der obstruktiven Uropathie führt die Abflussstörung des Urins zu einem Rückstau in die Nieren und dementsprechend zu druckbedingten Schäden. Auch für dieses Krankheitsbild konnte gezeigt werden, dass männliche 15 Medizin und Geschlecht Geschlechtshormone einen Einfluss auf die Krankheitsausprägung haben. Testosteron fördert die Freisetzung von pro-inflammatorischem TNF-alpha (Tumor Nekrose Faktor-alpha) und dem profibrotischen TGF-beta (Transforming growth factor-beta), was zu stärkeren Entzündungsreaktionen und Bindegewebsneubildung (Fibrosierung) der Niere und somit zu einer stärkeren Schädigung führt (Metcalf et al. 2008). Genaue molekulare Untersuchungen zu Signalwegen, die durch männliche bzw. weibliche Geschlechtshormone unterschiedlich beeinflusst werden, wurden mittels tierexperimenteller Studien durchgeführt. Bei Untersuchungen an Mäusen, die ein Cisplatin induziertes toxisches ANV entwickelten, konnte festgestellt werden, dass weibliche Tiere deutlich anfälliger für die Krankheit waren als männliche Tiere (Wei et al. 2005). Die größere Anfälligkeit des weiblichen Geschlechtes auf toxische Substanzen scheint sich in klinischen Studien zu bestätigen. So konnte an einem Kollektiv von 5200 Patientinnen und Patienten gezeigt werden, dass doppelt so viele Frauen wie Männer allergische Reaktionen nach Kontrastmittelgabe zeigten (Lang et al. 1995). Wie sich die Kontrastmittelgabe auf die Entwicklung eines ANV in Hinblick auf geschlechterspezifische Unterschiede auswirkt, ist jedoch noch nicht hinlänglich untersucht. Viele Untersuchungen sind noch erforderlich, um genauer die Mechanismen zu verstehen, die zu der unterschiedlichen Empfänglichkeit für bestimmte Arten des ANV führen, um ggf. später daraus sinnvolle Therapien ableiten zu können. Es ist wichtig, die geschlechterspezifischen Aspekte bereits frühzeitig in die Lehre zu implementieren, um eine Sensibilität der Lernenden gegenüber der unterschiedlichen Anfälligkeit von Männern und Frauen für die Ausbildung bestimmter Krankheitsbilder zu wecken. Dies kann später im klinischen Alltag helfen, Risikopatienten und -patientinnen frühzeitig zu erkennen, um präventive Maßnahmen zu ergreifen. Literatur Doddakula K et al. Predictors of acute renal failure requiring renal replacement therapy post cardiac surgery in patients with preoperatively normal renal function. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2007 Jun;6(3):314-18 Lang DM et al. Gender risk for anaphylactoid reaction to radiographic contrast media. J Allergy Clin Immunol. 1995 Apr;95(4):813-17 Oberholzer A et al. Incidence of septic complications and multiple organ failure in severely injured patients is sex specific. J Trauma. 2000 May;48(5):932-37 Schrier RW et al. Acute renal failure and sepsis. N Engl J Med. 2004 Jul;351(2):159-69 16 Medizin und Geschlecht Sperry JL et al. Inflammation and the Host Response to Injury Investigators. Male gender is associated with excessive IL-6 expression following severe injury. J Trauma. 2008 Mar;64(3):572-78 Wei Q et al. Differential gender differences in ischemic and nephrotoxic acute renal failure. Am J Nephrol. 2005 Sep-Oct;25(5):491-99 Kontakt Prof’in Dr. Faikah Güler Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str.1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 47 08 E-Mail: [email protected] 17 Medizin und Geschlecht RECHTSMEDIZIN 19. SEPTEMBER 2008 18 Medizin und Geschlecht 19 Medizin und Geschlecht HÄUSLICHE GEWALT - EIN THEMA FÜR DIE UNIVERSITÄRE MEDIZIN? VON PROFESSORIN DR. BRIGITTE LOHFF Grundlagen des Handelns 1. Januar 2002 Gewaltschutzgesetz (GewSchG): Gewalt von Männern gegen (Ehe-)Frauen ist grundsätzlich gesetzeswidrig und z.B. als (schwere oder gefährliche) Körperverletzung, Vergewaltigung, Nötigung oder Bedrohung strafbar. Jede/r, die/der von den Straftaten eines Mannes weiß, kann diese anzeigen. Die von Gewalt betroffenen Frauen haben auch das Recht, den Täter durch die Polizei der Wohnung verweisen zu lassen. 1. Aufforderung zum Handeln für medizinische Berufe im Jahr 2000: Erfahrungen und die Erkenntnis aus internationalen Frauengesundheitsberichten führten zu der Forderung der WHO, dass neben juristischen und polizeilichen Stellen auch die medizinischen Berufsgruppen in diesem Thema aus- und weitergebildet werden müssen. 2. Aufforderung zum Handeln für medizinische Berufe: Recommendation CM/Rec(2008)1 of the Committee of Ministers to member states on the inclusion of gender differences in health policy. Definition von Gewalt Körperliche Gewalt wie Ohrfeigen, Faustschläge, Stöße, Fußtritte, Würgen, Fesseln, Angriffe mit Gegenständen, Schlag-, Stich-, Schusswaffen, Mordversuche bis zu Tötungsdelikten; Sexualisierte Gewalt von Nötigungen bis zu Vergewaltigungen oder zum Zwang zur Prostitution; Psychische Gewalt wie Drohungen, der Frau/ihren Kindern etwas anzutun, Beleidigungen, Demütigungen, Erzeugen von Schuldgefühlen, Essensentzug und Einschüchterungen; Ökonomische Gewalt wie Arbeitsverbot oder Zwang zur Arbeit, die alleinige Verfügungsmacht über finanzielle Ressourcen durch den Partner; kurz die Herstellung und Aufrechterhaltung einer ökonomischen Abhängigkeit; Soziale Gewalt das Bestreben des Partners, die Frau sozial zu isolieren, indem ihre Kontakte kontrolliert, unterbunden oder verboten werden. 20 Medizin und Geschlecht Somatische Beschwerden - Thoraxschmerz - Herzrasen, Arrhythmie - Verdauungsbeschwerden - Asthma bronchiale - Zervical-, Schulter-Arm-Syndrom Kopfschmerz, Migräneattacken Atemstörungen Menstruationsbeschwerden akute psychosoziale Symptomatik oder Verhaltensauffälligkeiten - Angstzustände/Panikattacken - Schlafstörungen/Alpträume - Essstörungen - Alkohol-/Tablettenabusus - Isolation - Depression - Ekel gegenüber dem eigenen Körper - Autoaggression Strategien zur Thematisierung von häuslicher Gewalt im medizinischen Umfeld Studien zeigen, dass häusliche Gewalt ein häufiges Problem bei Patientinnen einer Kriseninterventionsstation darstellt. Aus der Literatur ist zu vermuten, dass dies auch in anderen medizinischen Settings wie etwa auf allgemeinen Notfallstationen zutrifft. Die Erfassung dieser Problematik scheint also dringend notwendig. In der Hektik des Klinikalltags wird die Befragung hierzu aber häufig „vergessen” oder – sei es aus Zeitgründen, sei es aus falscher Scham – unterlassen. Wenn Ärzten/Ärztinnen und Pflegern/Schwestern ein Instrument im Sinne eines Screenings an die Hand geben wird, ließe sich die Problematik möglicherweise zuverlässig und schnell erfassen. Zusätzlich ist es notwendig, Lehrprogramme zur Diagnose von häuslicher Gewalt zu entwickeln, welche nicht exklusive einzelne Veranstaltungen sind, sondern integraler Bestandteil im gesamten Curriculum der medizinischen Ausbildung. Ferner sollten konkrete Modellprojekte initiiert werden, in die Ärzte und Ärztinnen, Schwestern, Pfleger und Studierende integriert sind. Modellprojekt, um das Thema häusliche Gewalt an der MHH zu implementieren und wissenschaftlich zu begleiten 1. Bildung eines internen Arbeitskreises an der MHH bestehend aus zukünftig dafür verantwortlichen Vertreterinnen und Vertretern aus folgenden Kliniken und Bereichen: Sozialpsychiatrie, Trauma-Ambulanz, Gynäkologie Unfallchirurgie, Pädiatrie, Pflegedienst, Gerichtsmedizin, Sozialdienst 2. Aufgaben des MHH-internen Arbeitskreises - Erstellen eines Aufgabenprofils der Schnittstelle - Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Team - Interne Fort- und Weiterbildung zum Thema für die Mitglieder des Arbeitskreises - Kontaktaufnahme und Beratung 21 Medizin und Geschlecht - externe Beratungsstellen: Frauenhäuser Polizei etc. - Berechnung der Personalkosten und des Zeitbudgets - Klärung eventueller rechtlicher Fragen - Formulierung von Anträgen für die finanzielle Unterstützung der Schnittstelle - Formulierung von Anträgen für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung Literatur Adopted by the Committee of Ministers on 30 January 2008 at the 1016th meeting of the Ministers' Deputies Brzank P et al. Häusliche Gewalt gegen Frauen: Gesundheitsfolgen und Versorgungsbedarf – Ergebnisse einer Befragung von Erste-Hilfe-Patientinnen im Rahmen der S.I.G.N.A.L. – Begleitforschung. Gesundheitswesen 2004;66:164-69 Nyberg E et al. Screening domestic violence. A Germanlanguage screening instrument for domestic violence against women. Screening Partnergewalt. Ein deutschsprachiges Screeninginstrument für häusliche Gewalt gegen Frauen. Fortschr Neurol Psychiatr 2008;76(1):28-36 Kontakt Prof’in Dr. Brigitte Lohff Institut für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 42 78 E-Mail: [email protected] 22 Medizin und Geschlecht DIAGNOSTIK UND INTERVENTION BEI GEWALTOPFERN – EINE INTERDISZIPLINÄRE HERAUSFORDERUNG VON PD DR. ANETTE SOLVEIG DEBERTIN Die Untersuchung von Gewaltopfern zählt seit langem zu den Kernaufgaben der klinischen Rechtsmedizin. Im Jahr 2007 haben wir in der Rechtsmedizin Hannover insgesamt 279 Opfer (häusliche Gewalt, Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch, Körperverletzungsdelikte, Sexualdelikte etc.) und 87 Beschuldigte untersucht. Mit diesen Untersuchungen haben die Ermittlungsbehörden uns beauftragt. Dieser arbeitsintensive und wachsende Tätigkeitsschwerpunkt der Rechtsmedizin ist leider selbst in Medizinerkreisen noch nicht ausreichend bekannt. In langjähriger erprobter Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden haben wir einen wissenschaftlich fundierten Erfahrungsschatz bei der Abklärung nichtakzidenteller Verletzungen in der Abgrenzung zu echten Unfällen und weiteren Differentialdiagnosen erworben. Die klinische Rechtsmedizin verfügt insofern über spezifische forensische Kenntnisse bei der Beurteilung und Interpretation von Verletzungsmustern, der Rekonstruktion von Tathergängen und der Zuordnung von Tatwerkzeugen zu Verletzungen. Hierzu haben sich innerhalb der rechtsmedizinischen Fachgesellschaft u. a. die Arbeitsgemeinschaft „Klinische Rechtsmedizin“ und der Arbeitskreis „forensisch-pädiatrische Diagnostik“ gebildet. Die Erfahrung aus der interdisziplinären Zusammenarbeit zeigt, dass mithilfe dieser Spezialkenntnisse der Rechtsmedizin bei der Untersuchung von Gewaltopfern eine wichtige Lücke geschlossen werden kann: Hängt doch die Diagnostik und Befunderhebung entscheidend davon ab, ob klinischtherapeutische Fragen oder kriminalistisch-juristische Aspekte im Vordergrund stehen. So zeigt sich, dass einigen kurativ tätigen Kollegen teilweise die Bereitschaft, aber auch spezielle Kenntnisse fehlen, die Zeichen von Gewalt an Opfern zu diagnostizieren. Die Ergebnisse verschiedener Prävalenzstudien zur „häuslichen Gewalt“ zeigen erschreckend hohe Zahlen – bei vermutlich hoher Dunkelziffer. Schätzungen zufolge soll etwa jede dritte bis fünfte Frau körperliche oder sexuelle Übergriffe durch Beziehungspartner erlebt haben – mit teilweise ernstzunehmenden gesundheitlichen Folgen. 23 Medizin und Geschlecht Im Hinblick auf Geschlechterdifferenzierung fällt auf, dass sich interessanterweise viele Informationen, Arbeitshilfen und Anlaufstellen überwiegend an Frauen als Opfer richten. Und so wird suggeriert: Gewalt ist männlich! Insofern scheint sich die „häusliche Gewalt“ an sich schon geschlechterspezifisch darzustellen. Andere Studien und vergleichende Analysen gehen dagegen von einer Gleichverteilung der Geschlechter aus. Viele Opfer von Gewalt wenden sich an Ärztinnen und Ärzte aller Fachgebiete, ohne ihnen die Ursache ihres Leidens zu nennen. Nur ein kleiner Prozentsatz der dabei festgestellten Verletzungen soll auf häusliche Gewalt zurückgeführt werden. Deswegen gelangen viele Opfer mit akuten Verletzungen mehrfach in notfallmedizinische Behandlung, ehe die eigentliche Verletzungsursache herausgefunden wird. Insbesondere das Erkennen von Kindesmisshandlungsverletzungen erweist sich für viele kurativ tätige Kolleginnen und Kollegen oft als schwierig und heikel: man könnte Eltern Unrecht tun oder Kinder durch Nicht-Erkennen möglicherweise weiterer Gewalttätigkeit aussetzen. Darüber hinaus stellen medizinische Besonderheiten beim sexuellen Missbrauch und die Kenntnis von Verletzungsfolgen und deren Heilungsverlauf noch eine junge Wissenschaft dar; d.h. viele Kenntnisse sind neu und haben bisher noch keine Verbreitung gefunden. Gerade in diesem sensiblen Bereich können falsche Diagnosen zu verheerenden Folgen für die Kinder und die Familien führen. Der klinischen Rechtsmedizin kommt so aufgrund der besonderen kriminalistischen Arbeitsweise und Spezialisierung auf Untersuchungen von Gewaltopfern – unter Abwägung zahlreicher differentialdiagnostischer Aspekte – eine herausragende, aktuelle und immer bedeutendere Rolle zu. Das stetig wachsende Arbeitsfeld der klinischen Rechtsmedizin, die Implementierung diesbezüglicher Inhalte in die rechtsmedizinische Vorlesung und Pflichtseminare und Inhalte einer erstmalig wissenschaftlich evaluierten Präventionskampagne zum Schütteltrauma werden im Workshop dargestellt. Kontakt PD Dr. Anette Solveig Debertin Institut für Rechtsmedizin Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 45 89 E-Mail: [email protected] 24 Medizin und Geschlecht GESCHLECHT, GEWALT UND GESUNDHEIT – RECHTSMEDIZINISCHE ASPEKTE IN PRAXIS UND FORSCHUNG VON PD DR. HILDEGARD GRAß UND PROFESSORIN DR. STEFANIE RITZ-TIMME Im medizinischen Fächerkanon befasst sich die Rechtsmedizin regelhaft mit der Untersuchung und Begutachtung von Gewaltspuren am menschlichen Körper. Wurde in der Rechtsmedizin zunächst vorrangig zu den damit unmittelbar zusammenhängenden Fragestellungen, z.B. Korrelation einer definierten energetischen Einwirkung und deren traumatischer Auswirkung, auch wissenschaftlich gearbeitet, so hat sich nicht nur das gesamte Aufgabenspektrum im Fach Rechtsmedizin deutlich erweitert, auch die Forschungsansätze sind entsprechend weiter gefasst. Dies trifft insbesondere für die Themenfelder „Gewalt und Geschlecht“ zu, ist doch dieses Begriffspaar nicht von einander zu trennen und wirft es gleichzeitig so vielfältige Fragen auf: - - - - - Wie kann Geschlecht definiert werden? Dies kann schon rechtsmedizinischmolekularbiologisch, rein naturwissenschaftlich-humangenetisch Schwierigkeiten bereiten. Wie soll Gewalt definiert werden? Die Spanne von der körperlichen Dimension bis in die psychische Ebene ist groß. In welchem Kontext stehen Gewalt, Geschlecht und Gesellschaft? Vielfältige Probleme der sozialen, ethischen, ökonomischen [....] Ebene sind zu bedenken. Welche Dimensionen aus dem Themenkreis „Gewalt und/oder Geschlecht“ haben direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Gesundheit? Hier wird es zukünftig bedeutsam sein, auf diese Einflussfaktoren in der körperlichen und seelischen Folge/Traumatisierung in den verschiedenen Stufen und Fachbereichen der medizinischen Aus- und Weiterbildung hinzuweisen. Die Versorgung von Menschen, die durch Gewalteinwirkung welcher Art auch immer traumatisiert wurden, deren besondere Bedürfnisse in der Ansprache, Befundsicherung, Befundinterpretation und die möglichen weiteren Betreuungsangebote und Begleitoptionen, all das sind Aspekte, die in einer guten Aus- und Weiterbildung enthalten sein sollten. Wie kann der „Gender“-Gedanke in die medizinische Aus- und Weiterbildung implementiert werden? Sowohl Patientinnen als auch Patienten sind mit ihren 25 Medizin und Geschlecht Bedürfnissen in gleicher Weise wahr- und ernst zu nehmen, wie auch Ärztinnen und Ärzte in ihren Geschlechterrollen. Auch dieser generelle Aspekt der geschlechterdifferenzierten oder -sensiblen Betrachtung von Gesundheit und gesundheitsbezogenen Diagnose- und Therapiestrategien ist als integraler Bestandteil einer guten Medizin zu verankern. Am Düsseldorfer Institut für Rechtsmedizin wurde mit der Berufung der neuen Leitung, Professorin Stefanie Ritz-Timme, ein neuer Schwerpunkt der (Frauenund) Geschlechterforschung initiiert. Konkret wurden bis dato folgende Punkte umgesetzt: - - - Implementierung einer Gewaltopferambulanz und eines interdisziplinären Versorgungsnetzes am Universitätsklinikum, Begleitende Forschung mit verschiedenen Schwerpunkten zum Themenfeld „Gewalt, Geschlecht und Gesundheit“, Aus- und Weiterbildungsangebote zum Schwerpunkt „Gewalt und Gender“. Diese Beispiele zeigen die vielfältigen Ansätze von rechtsmedizinischen Tätigkeiten zum Themenkreis „Gewalt und Geschlecht“ in enger Anbindung an den Begriff der „Gesundheit“, wobei wir den Begriff „Geschlecht“ sowohl im Sinne von „Gender“ (sozial definiertes Geschlecht) als auch von „Sex“ (biologisches Geschlecht) verstanden wissen möchten. Literatur Graß H et al. Frauen- und Geschlechterforschung, Gewaltopfer und Rechtsmedizin, Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universität. Düsseldorf 2005/06:107-18 Kontakt PD Dr. Hildegard Graß Institut für Rechtsmedizin Universitätsklinikum Düsseldorf Moorenstraße 5 40225 Düsseldorf Telefon: 0211 / 8 10 40 58 Email: [email protected] 26 Medizin und Geschlecht 27 Medizin und Geschlecht ANÄSTHESIOLOGIE UND INTENSIVMEDIZIN 30. OKTOBER 2008 28 Medizin und Geschlecht 29 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERUNTERSCHIEDE UND LEBENSWISSENSCHAFTEN - HISTORISCH BETRACHTET VON PROFESSORIN DR. BETTINA WAHRIG Die überwiegende Mehrzahl der Menschen in der westlichen Welt ordnet sich selbstverständlich einem von zwei Geschlechtern zu. Gleichzeitig ist Gleichstellung im Zuge der Deklaration von Peking und der in den Gesetzen der Europäischen Union verankerten Gender-Mainstreaming-Politik ein anerkanntes Ziel von Politik geworden, selbst wenn die praktischen Konsequenzen aus diesen Grundsätzen – das heißt Anstrengungen für eine tatsächliche Gleichstellung – noch immer wieder eingeklagt werden müssen. Danach scheint die Aufgabenstellung klar zu sein: Es gibt zwei und genau zwei menschliche Geschlechter, die sich biologisch voneinander unterscheiden, und nun kommt es darauf an, diesem Unterschied so gerecht zu werden, dass keine Benachteiligung aus diesen Unterschieden geschieht und dass gleichzeitig den unterschiedlichen Bedürfnissen der beiden Geschlechter Gerechtigkeit widerfährt. Die Sache ist jedoch nicht so einfach: Was biologische Unterschiede genau sind, wie sie festgestellt werden können und welche kulturellen und sozialen Auswirkungen sie haben, ist im Laufe der Geschichte auf die verschiedenste Weise be- und verhandelt worden. Und die Diskussionen hierüber halten an. Schien es in den 1950er Jahren nun festzustehen, dass der wesentliche Unterschied zwischen Männern und Frauen in ihren verschiedenen Chromosomensätzen liegt, so ist heute bekannt, dass für die Erscheinungsformen des männlichen und des weiblichen Geschlechts längst nicht nur die Geschlechtschromosomen verantwortlich sind und dass Gene das Individuum nicht ein- für allemal festlegen, sondern während der verschiedenen Entwicklungsphasen in einem komplizierten Wechselspiel mit dem zellulären Stoffwechsel stehen. Die Grundthese dieses Abstracts ist, dass sich – historisch gesehen – Vorstellungen über die Natur der Geschlechter und Vorstellungen über die Ordnung der Geschlechter gegenseitig bedingt und unterstützt haben, dass sich die Konstellation dieser beiden Vorstellungsarten aber im Laufe der Geschichte erheblich verändert hat. Vorstellungen über die Natur der Geschlechter beinhalteten z.B. Fragen der Reproduktion, aber auch der körperlichen und geistigen Fähigkeiten, und sie wurden häufig mobilisiert, um soziale Differenzen, besonders zwischen Männern und Frauen, zu rechtfertigen. Dominanzverhältnisse zwischen den Geschlechtern haben wiederum im Laufe 30 Medizin und Geschlecht der Geschichte andere Dominanzverhältnisse (z.B. zwischen Klassen) gerechtfertigt und fundiert. So war die Gebärfähigkeit der Frau zumindest bis vor wenigen Jahren häufig ein Argument, um ihren Anteil am Erwerbsleben quantitativ und qualitativ zu beschränken, während andererseits in vielen Gesellschaften die Entscheidung über die Nachkommenproduktion dem (männlichen) Familienoberhaupt zugeschrieben wurde. In jüngster Zeit haben besonders Diskussionen über unterschiedliche kognitive Fähigkeiten von Frauen und Männern für Streit gesorgt: Haben Frauen aufgrund eines von weiblichen Geschlechtshormonen beeinflussten Gehirns eine geringere Fähigkeit zum mathematischen, mindestens aber zum räumlichen Denken? Oder sind junge Männer im Lernen benachteiligt, weil Testosteron ihr Gehirn überflutet und vom Denken abhält? So zumindest kamen wissenschaftliche Studien in den öffentlichen Debatten an. Aber auch hochrangige Akademiker, die es besser wissen müssten, vertreten bis auf den heutigen Tag solche Thesen. Als Historikerin kann ich zur Debatte über die Validität und Verallgemeinerbarkeit solcher Studien nichts beitragen (außer der Aufforderung, den gesunden Menschenverstand niemals auf dem Journal-Cover oder im Gestrüpp der Suchmaschinen zu vergessen). Aber ich kann zeigen, wie sich die Vorstellungen über die Natur der Geschlechter und – damit zusammenhängend – über die sozialen Rollen von Männern und Frauen in der Geschichte verändert haben. In der historischen Gender-Forschung ist gelegentlich die These vertreten worden, dass das vorherrschende Modell von Geschlecht von der Antike bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts das sogenannte "Ein-Geschlechter-Modell" gewesen sei (Thomas Laqueur 1992). Demnach habe man sich männliche und weibliche Körper als Varianten eines einzigen Körpers gedacht. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen seien nur gradweise gewesen. Dies bezog sich einerseits auf die Geschlechtsorgane, welche auch z.T. dieselben Namen hatten: Etwa hießen Hoden und Ovarien bei antiken Autoren wie Galen, aber auch noch bei dem bedeutenden frühneuzeitlichen Anatomen Andreas Vesalius (1542) gleichermaßen "testes"; die Ovarien erschienen als im Körperinnern verbliebene Testes, und die Vagina wurde als nach innen gekehrter Penis verstanden. Dem entsprach die Idee, dass nach der Viersäftelehre (Humoralpathologie) der menschliche Körper grundsätzlich aus vier verschiedenen Säften (Blut, Schleim, schwarze Galle und gelbe Galle) bestand, wobei der Unterschied zwischen Männern und Frauen vor allem im unterschiedlichen relativen Anteilen dieser Säfte bestand. Männliche Körper sollten sich vor allem durch das Überwiegen der warmen Säfte gelbe Galle und Blut auszeichnen, weibliche durch das von Schleim und schwarzer Galle, die als kalt galten. Dass die weiblichen Genitalien 'nach innen gekehrt' waren, konnte 31 Medizin und Geschlecht dann als Resultat einer unzureichenden Wärme gedeutet werden. Wärme verweist auf das Element des Feuers, welches metaphorisch mit dem Konzept der Vernunft verbunden war, so dass dem Mann auch eine größere Vernunftfähigkeit zugeschrieben werden konnte. Insgesamt ermöglichte dieses Modell zu erklären, warum sich Männer und Frauen in ihren Tätigkeiten und Fähigkeiten recht ähnlich sind, während es gleichzeitig eine implizite Hierarchisierung erlaubte: Der Körper der Frau erschien sozusagen als Minusvariate des männlichen Körpers. Dieses hier skizzierte Modell ist natürlich sehr stark vereinfacht: Kaum ein einzelner Autor der Frühen Neuzeit hat es in dieser Radikalität vertreten. Wissenschaftliche Erklärungen haben sich auch in der Vergangenheit nicht auf einfache, einheitliche, von allen akzeptierte Prinzipien reduzieren lassen, sondern gerade in der Vielfalt und im Streit lag auch schon damals die Produktivität. Nichstdestotrotz ergab sich Mitte des 18. Jahrhundert eine neue Art, auf die Geschlechterdifferenz zu schauen: Nunmehr interessierten besonders zwei Fragen: War das Gehirn von Frauen dem der Männer gleichwertig oder unterlegen? Ließen sich hieraus Schlüsse auf ihre Fähigkeit und Berechtigung zu wissenschaftlicher Tätigkeit ziehen? Verwies umgekehrt der Körperbau von Frauen besonders auf ihre Gebärfunktion? Im 18. Jahrhundert setzte sich allmählich in den bürgerlichen Schichten die bis ins 20. Jahrhundert verbreitete bürgerliche Arbeitsteilung durch: Die soziale Rolle von Frauen wurde vorrangig im Kindergebären und der Kinderaufzucht gesehen, die der Männer in der Teilhabe an der Öffentlichkeit und im Broterwerb (dieses Rollenverständnis herrschte in den kulturellen Eliten vor, nicht in der gesamten Gesellschaft). Solche veränderten Zuschreibungen waren nicht unumstritten: Viele Frauen und eine Minderheit von Männern fochten mit der Feder gegen diese seit Rousseau häufig für natürlich erklärte Arbeitsteilung, aber viele verteidigten sie auch – mit Feder und Skalpell. In der Anatomie führten diese Debatten dazu, dass Skelette von Frauen und Männern unterschiedlich dargestellt wurden. Nunmehr wurde besonders auf komplementäre Geschlechterunterschiede abgestellt: Der weibliche Körper wurde nicht als 'minderwertiger' männlicher sondern als dem männlichen entgegengesetzter gesehen, der dessen Funktion ergänzte, etwa durch ein breit ausladendes Becken und einen relativ kleinen Kopf (Schiebinger 1993). Weibliche reproduktive Funktionen wurden aufgewertet. Dennoch bedeuteten diese biologischen Zuschreibungen für die Frauen, dass sie mit Verweis auf ihre biologischen Besonderheiten in den häuslichen Bereich verwiesen wurden. Die Bedeutung der historischen Studien, von denen hier nur Schiebinger genannt werden kann, liegt darin, dass sie eines bewusst gemacht 32 Medizin und Geschlecht haben: Gesellschaftliche Rahmenbedingungen wirken mit bei der Suche nach Differenzen und bei deren Interpretation. Im 19. Jahrhundert ist es nicht bei diesem 'komplementären' Geschlechtermodell geblieben: Mit der Entdeckung der inneren Sekretion und der Sexualhormone, aber auch mit der zunehmenden Erforschung der Embryonalentwicklung fanden sich viele Argumente, die doch dafür sprachen, dass es in biologischer Hinsicht Übergänge zwischen 'männlichen' und 'weiblichen' Körpern gibt. Für die psychosexuelle Entwicklung postulierte etwa Sigmund Freud, dass der Mensch ursprünglich bisexuell ist und dass die sexuelle Differenzierung und Identitätsentwicklung im Wechselspiel zwischen dem Kind mit seinen emotionalen und biologischen Bedürfnissen auf der einen und seiner Umwelt auf der anderen Seite erfolgt. Dennoch kann man auch für jene Zeit immer wieder feststellen, dass stereotype, dichotome Zuordnungen zwischen biologischen Faktoren auf der einen und den Eigenschaften 'männlich' bzw. 'weiblich' auf der anderen Seite vorgenommen wurden. Folgende Thesen sollen zum Abschluss das Gesagte zusammenfassen: 1. Die Vorstellungen über die 'biologischen' Bedingungen von 'männlich' und 'weiblich' veränderten und verändern sich - im Wechselspiel mit der jeweiligen Kultur - zwischen den Extremen eines dipolaren Geschlechtermodells und eines „Einheitskörpers“ mit allmählichen Übergängen. 2. Methodische Probleme entstehen durch implizite Vorannahmen: - so werden konstante Differenzen zwischen den Geschlechtern leicht für biologische Differenzen gehalten - biologische Differenzen werden für biologisch verursacht gehalten, während man besser (und hier war die Vorstellungswelt zwischen Antike und Früher Neuzeit häufig offener als etwa das 19. Jahrhundert) von eine Wechselwirkung zwischen biologischen und sozialen Faktoren sprechen sollte. 3. Gesellschaftliche Probleme im Wechselspiel von Person und Geschlecht entstehen durch - Pathologisierung von Verhalten, welches für das jeweilige Geschlecht als untypisch gilt, denn - in unserer Kultur bedeutet 'Diagnose', ob wir das wollen oder nicht, immer auch eine Wertung - den unsicheren Umgang mit 'uneindeutigem' Geschlecht, mit den Personen, die sich nicht oder anders zuordnen als dies die Mehrheitsgesellschaft 33 Medizin und Geschlecht erwartet. Literatur Laqueur, Thomas (1992): Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud. Frankfurt/M.: Campus Schiebinger, Londa (1993): Schöne Geister. Frauen in den Anfängen der modernen Wissenschaft. 2. Aufl., Stuttgart: Klett-Cotta Kontakt Prof’in Dr. Bettina Wahrig Technische Universität Braunschweig Institut Geschichte der Naturwissenschaften, Pharmaziegeschichte Beethovenstr. 55 38106 Braunschweig Tel: 0531/ 391- 5990 E-Mail: [email protected] 34 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE IN DER SCHMERZMEDIZIN VON PROFESSOR DR. MATTHIAS KARST Bei Frauen werden mit größerer Häufigkeit und längerer Dauer höhere Schmerzintensitäten beobachtet. Es sind mehr Körperregionen betroffen, der Leidensdruck ist größer und es werden mehr Analgetika eingesetzt. Bei Frauen treten häufiger Erkrankungen oder Symptomkomplexe auf, die mit chronischen Schmerzen assoziiert sind, wie z.B. Migräne, Colon irritabile, craniomandibuläre Dysfunktion, Fibromyalgie und Autoimmunerkrankungen (Hurley & Adams 2008). Im Vergleich zu Männern ist die Prävalenz bei den meisten Schmerzarten etwa um das 2-fache erhöht (Greenspan et al. 2007). Hierzu kontrastiert der Mythos, dass Frauen mehr Schmerzen aushalten oder sich Schmerzen einbilden, eine Vorstellung, die dazu führen kann, dass Therapeutinnen und Therapeuten nicht zuhören, wenn Frauen über Schmerzen klagen. Die epidemiologischen und klinischen Befunde lassen sich auch experimentell bestätigen. Frauen sind vor allem empfindlicher bei den thermischen Schmerzschwellen und der mechanischen Druckschmerzschwelle (Rolke et al. 2006; Coghill et al. 2003) und zeigen dabei auch mehr Gehirnaktivität in spezifischen der „Schmerzmatrix“ zugeordneten Gehirnregionen und eine stärkere kognitiv-sprachliche Verarbeitung (Coghill et al. 2003; Henderson et al. 2008). Ursachen hierfür dürften einerseits in genetischen und hormonellen Faktoren und andererseits in Umwelteinflüssen zu suchen sein. So ist bekannt, dass die Aktivität der Katechol-O-Methyltransferase (COMT), welche im Zentralen Nervensystem (ZNS) u. a. die endogene Opioidproduktion reguliert, unter Östrogen-Einfluss inhibiert wird (Xie et al. 1999). Weitere die Schmerzmechanismen verstärkende Effekte von Östrogenen sind u. a. die Erhöhung der Konzentration von Nervenwachstumsfaktoren in den Ganglienzellen der afferenten Spinalnerven, die c-Fos Expression im Hippocampus, die Aktivierung der Mitogen-aktivierten-Protein-Kinase und die verstärkte Bindung von Glutamat an N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren (IASP Fact Sheets 2007-2008). Dabei scheinen Östrogene eine duale Beeinflussung der Schmerzverarbeitung aufzuweisen. Hohe Dosen haben antinozizeptive Effekte, indem sie die Funktion des endogenen Opioidsystems verstärken können. Testosteron dagegen reduziert Halswirbelsäulen- und Schulterbeschwerden bei 35 Medizin und Geschlecht Fabrikarbeiterinnen und reduziert die Schmerzschwelle bei stabiler Angina pectoris (IASP Fact Sheets 2007-2008). Hinweise für Umwelteinflüsse auf die Schmerzverarbeitung konnten in experimentellen Studien gezeigt werden. Unter der Simulation sozialer Ausgrenzung in virtueller Realität kam es zu einer Aktivierung der „Schmerzmatrix“ vergleichbar mit der Gehirnaktivität als Antwort auf einen physikalischen Reiz (Eisenberger et al. 2003). Bei gleichzeitiger Applikation eines physikalischen Schmerzreizes wurde das Gefühl des Zurückgewiesenseins stärker empfunden und umgekehrt (Eisenberger et al. 2006). Schmerz verstärkende kulturelle und psychosoziale Faktoren sind eher mit dem weiblichen Geschlecht verbunden. Dazu gehören das Stereotyp der Frauenrolle, das Versorgungskonzept, Hypervigilanz gegenüber potenziell bedrohlichen Situationen, größere Körperwahrnehmung und die größere Prävalenz von Depressionen und Angststörungen (Wiesenfeld-Hallin 2005). Im Zusammenhang mit Schmerzerleben lassen sich auch Geschlechtsunterschiede im Empathieverhalten finden: Männer sind weniger empathisch, wenn sie sich hintergangen fühlen. Die dabei auftretenden Rachegefühle korrelieren mit einer verstärkten Aktivität des Nucleus accumbens, welche bei Frauen ausbleibt (Singer et al. 2006). Studien zum Melanocortin-1-Rezeptorgen (MC1R)-Polymorphismus haben gezeigt, dass bei Frauen mit zwei varianten Allelen des MC1R unter dem kAgonisten Pentazocin mehr Schmerzreduktion erreicht wird als bei Männern mit der gleichen Genvariation (Mogil et al. 2003). Dieses Ergebnis zeigt, dass Geschlechtsunterschiede auch eine Auswirkung auf die Therapie von Schmerzen haben. Dazu kontrastiert, dass in Tierversuchen männliche Tiere die Norm darstellen und bis 1993 Frauen von pharmakologischen Studien gänzlich ausgeschlossen waren (Greenspan et al. 2007; Lund & Lundeberg 2008). Es kann geschlussfolgert werden, dass Schmerzen in Abhängigkeit vom Geschlecht unterschiedlich verarbeitet werden, was zu einer unterschiedlichen Schmerzausprägung führt. Hierfür sind biologische und psychosozial-kulturelle Faktoren verantwortlich. Diese Erkenntnisse sollten bei der Diagnostik und Therapie von Schmerzen Berücksichtigung finden. Literatur Coghill RC et al. Neural correlates of interindividual differences in the subjective experience of pain. PNAS 2003;100:8538-42 36 Medizin und Geschlecht Eisenberger NI et al. Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science 2003;302:290-92 Eisenberger NI et al. An experimental study of shared sensitivity to physical pain and social rejection. Pain 2006;126:132-38 Greenspan JD et al. Studying sex and gender differences in pain and analgesia: a consensus report. Pain 2007;132:26-45 Henderson LA et al. Gender differences in brain activity evoked by muscle and cutaneous pain: a retrospective study of single-trial fMRI data. Neuroimage 2008;39:1867-76 Hurley RW et al. Sex, gender, and pain: an overview of a complex field. Anesth Analg 2008;107:309-17 IASP Fact Sheets: sex hormones and pain. www.iasp-IASP, 2007-08 Lund I et al. Is it all about sex? Acupuncture for the treatment of pain from a biological and gender perspective. Acupunct Med 2008;26:33-45 Mogil JS et al. The melanocortin-1 receptor gene mediates female-specific mechanisms of analgesia in mice and humans. PNAS 2003;100:4867-72 Rolke R et al. Quantitative sensory testing in the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS): standardized protocol and reference values. Pain 2006;123:231-34 Singer T et al. Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others. Nature 2006;439:466-69 Wiesenfeld-Hallin Z. Sex differences in pain perception. Gender Med 2005;2:137-45 Xie T et al. Characterization and implications of estrogenic down-regulation of human catechol-o-methyltransferase gene transcription. Mol Pharmacol 1999;56:31-38 Kontakt Prof. Dr. Matthias Karst Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 31 08 E-Mail: [email protected] 37 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE BEI DEM SCHWEREN VERBRENNUNGSTRAUMA VON PROFESSOR DR. HANS-OLIVER RENNEKAMPFF Das Verbrennungstrauma stellt ein schwerwiegendes Krankheitsbild dar. Das Verbrennungstrauma ist im Wesentlichen durch das Ausmaß (betroffene Körperoberfläche oder KOF) und die Verbrennungstiefe gekennzeichnet. Während bis zu einer Verbrennungsfläche von 15-20 % lokale Veränderungen und der Verlust der Haut die Therapie bestimmen, sind bei Verbrennungen über 20 % KOF erhebliche systemische Mitreaktionen (die sogenannte Verbrennungskrankheit) zu erwarten und machen eine intensivmedizinische Behandlung notwendig. Die Prognose der Patientin/des Patienten verschlechtert sich mit zunehmender Fläche und zunehmenden Alter. Aber auch das Inhalationstrauma, also die Schädigung der Lunge durch Inhalation von toxischen Gasen, erhöht die Letalität. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass Alkoholismus und die COPD die Prognose ebenfalls verschlechtern (Germann et al.). Im Rahmen von empirischen Beobachtungen wurde bereits in den 1980er Jahren festgestellt, dass Frauen nach schwerer Verbrennung eine schlechtere Prognose haben als Männer. Dieser Beobachtung wird seit der Einführung des Abbreviated Burn Severity Index (ABSI) als Score zur Prognoseabschätzung mit einem zusätzlichen Punkt Rechnung getragen. So kann bereits das Geschlecht ’weiblich’ zu einer Zuordnung in eine Kategorie mit erheblich schlechterer Überlebenswahrscheinlichkeit führen. Auch die Aufarbeitung eigener Daten des Schwerbrandverletztenzentrums der Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie bei Gasexplosionsverletzungen (Busche et al.) belegt, dass Frauen bei gleicher Verbrennungsfläche und gleichem Alter eine höhere Sterblichkeitsrate haben als Männer. Im eigenen Krankengut wurde für Männer eine Sterblichkeit von 19 % bei einem ABSI von 6, für Frauen eine Sterblichkeit von 33 % bei einem ABSI von 7 (6 + 1 für weiblich) festgestellt. Mehrere retrospektive Arbeiten (Germann et al., Gomez et al., Kerby et al.) konnten den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Überleben nach einem schwereren Verbrennungstrauma nachweisen. Das weibliche Geschlecht hat einen signifikant negativen Einfluss auf das Überleben. Pathophysiologisch sind die Östrogen- und Testosteronspiegel der entscheidende Faktor. Nach einer 38 Medizin und Geschlecht schweren Verbrennung ist der Östrogenspiegel um das 10- bis 15-fache erhöht, während der Testosteronspiegel erniedrigt ist. Weiterhin wurde berichtet, dass auch das Priming von Neutrophilen geschlechterabhängig ist, ebenso wie die Interleukin -8- und Prostaglandin -E- Spiegel. Bei Kindern (1-16 Jahre) fand sich kein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Überleben; allerdings konnten andere geschlechterabhängige Veränderungen (Cytokinprofile, Muskelproteinverlust, Energiebedarf) festgestellt werden (Jeschke et al.). In tierexperimentellen Untersuchungen (Bird et al.) wurde der Einfluss des Geschlechts beim Verbrennungstrauma im Vergleich zum hämorrhagischen Schock auf den outcome untersucht. In diesen tierexperimentellen Untersuchungen konnte der Zusammenhang zwischen erhöhtem Östrogenspiegel und Letalität nach einer Verbrennung eindrücklich gezeigt werden. Auch Genderaspekte wie soziale Herkunft und Lebensgewohnheiten spielen in der Behandlung und Prognose beim Verbrennungspatientinnen und -patienten eine große Rolle. Nachweislich erleiden Männer in wesentlich höherem Maße Verbrennungen. Auch die Wahrnehmung von Narben und Funktionseinschränkungen scheint geschlechterspezifisch und genderabhängig zu sein. Zusammenfassend zeigt sich, dass die schwere Verbrennung eine eigene Traumaentität darstellt und sich grundsätzlich vom hämorrhagischen Trauma unterscheidet. Erhöhte Östrogenspiegel nach einer Verbrennung haben einen negativen Einfluss auf den Cytokinspiegel und die Immunitätslage. Frauen haben damit bei gleichem Verbrennungsausmaß ein 1,3-fach erhöhtes Risiko an einer Verbrennung zu sterben. Derzeit haben diese Erkenntnisse noch keinen Eingang in die Therapie gefunden. Der Pathophysiologie dieser geschlechterspezifischen Unterschiede muss auch in Forschung und Lehre Rechnung getragen werden. Literatur Bird MD et al. Sex differences and estrogen modulation of the cellular immune response after injury. Cell Immunol 2008;252,57-67 Busche, K. et al. Die unsichtbare Gefahr-Analyse von 71 intensivpflichtigen Verbrennungen durch Gasexplosionen. Vortrag Jahrestagung der Deutschen Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen, Stuttgart 2008 39 Medizin und Geschlecht Germann et al. The impact of risk factors and pre existing conditions on the mortality of burn patients and the precision of predictive admission scoring systems. Burns 1997;23,195-203 Gomez M et al. The FLAMES score accurately predicts mortality risk in burn patients. J Trauma 2008;65,636-45 Jeschke et al. Gender differences in pediatric burn patients: Does it make a difference? Ann Surg 2008;248,126-36 Kerby et al. Sex differences in mortality after burn injury. J Burn Care Rehabil 2006;27,452-56 O’Keefe et al. An evaluation of risk factors for mortality after burn trauma and the identification of gender-dependent differences in outcomes. J Am Coll Surg 2001;192,153-60 Kontakt Prof. Dr. Hans-Oliver Rennekampff Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 27 10 E-Mail: [email protected] 40 Medizin und Geschlecht GENDER-ASPEKTE IN DER KATASTROPHENMEDIZIN VON PROFESSOR DR. HANS ANTON ADAMS Einführung Die geschlechterspezifische Medizin befasst sich mit dem sozialen und damit auch dem kulturellen Geschlecht bzw. der Geschlechterrolle von Mann und Frau. Sie geht über den rein biologischen Ansatz hinaus und findet zunehmendes Interesse auch in der klinischen Medizin. In diesem Beitrag werden einige Effekte des biologischen Geschlechts im Hinblick auf die Bewältigung bestimmter Krankheitsbilder, Geschlechteraspekte der allgemeinen Notfallmedizin sowie wichtige Gender-Aspekte der Katastrophenmedizin dargestellt. Effekte des biologischen Geschlechts Frink et al. 2007 untersuchten 106 Männer und 37 Frauen mit Mehrfachverletzungen. Frauen unter dem 50. Lebensjahr wiesen geringere Zytokin-Spiegel sowie eine geringere Inzidenz von Multiorgandysfunktion und Sepsis auf, was die Autoren einen protektiven Effekt weiblicher Sexualhormone vermuten ließ. Dagegen fanden Sperry et al. 2008 bei Patientinnen und Patienten mit hämorrhagischem Schock in einer Subgruppenanalyse von 680 Männern und 356 Frauen bei den Frauen sowohl prä- wie postmenopausal weniger Infekte und Multiorganversagen. Bezüglich des Zentralen Nervensystems sind bei Patientinnen und Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma keine geschlechtsbedingten Unterschiede evident; es wird aber ein antiödematöser Effekt von Progesteron postuliert. Bei Patientinnen mit Epilepsie ist die Anfallsrate in Zyklusphasen mit vermindertem Östrogen- und ProgesteronSpiegel erhöht und bei Männern scheint sinkendes Testosteron in der Andropause die Folgen einer zerebralen Ischämie zu verschlimmern. Eine renale Ischämie führt bei Frauen – zumindest außerhalb kardiochirurgischer Eingriffe – seltener zum akuten Nierenversagen, und auch die Transplantatfunktion ist nach einer Nierentransplantation bei Frauen besser als bei Männern. Die koronare Herzkrankheit geht bei Frauen mit einer von Männern abweichenden Klinik – häufig ohne „typischen“ Brustschmerz – einher. Weiter fanden sich bei Frauen engere Koronarien, mehr diastolische Dysfunktionen und eine schlechtere Erholung nach Revaskularisation; als Hauptursache werden Koronarspasmen vermutet. Notfallund katastrophenmedizinisch sind insbesondere die Geschlechtsunterschiede im Bereich von Schmerz und Analgesie relevant. Schmerzempfinden und Schmerzäußerung hängen jedoch von vielen Faktoren 41 Medizin und Geschlecht ab, und die bislang vorliegenden Befunde sind nicht ohne weiteres in die Klinik zu übertragen. Insgesamt werden die geschlechterspezifischen Opioid-Effekte offensichtlich von der interindividuellen Streuung überdeckt und erfordern ein individuelles Vorgehen. Gender-Aspekte der allgemeinen Notfallmedizin Einige Gender-Aspekte der allgemeinen Notfallmedizin sind auch für die Bewertung katastrophenmedizinischer Szenarien relevant. Dazu zählen: - Die „männliche“ Risiko-Bereitschaft, - das Mitmachen, Mitleiden und wohl auch Mitverursachen von Frauen, - der Leidensdruck und die Leidensfähigkeit der „Frau und Mutter“, - das spezifische, jeweils kulturell geprägte Familienbild, - Täter und Opfer von häuslicher Gewalt und Suizid usw., wo fast immer Verzweiflung im Spiel ist und das Elend nicht auf Frauen und Kinder begrenzt bleibt. Allgemeine Aspekte Die Katastrophenmedizin ist gegenüber der allgemeinen Notfallmedizin insbesondere durch den quantitativen Aspekt mit der Vervielfachung von Not und Leid gekennzeichnet. Großschadensereignisse und Katastrophen jeder Art sind jederzeit und überall möglich. Mögliche Szenarien sind Verkehrsunfälle mit Bus, Zug, Flugzeug und Schiff, Gefahrgutunfälle, allgemeingefährliche Infektionskrankheiten sowie terroristische Anschläge. Naturkatastrophen sind in hiesigen Breiten selten, können aber nicht völlig ausgeschlossen werden. Bei allen Szenarien muss mit Paniksituationen gerechnet werden. Die Panikreaktion eines bzw. einer Einzelnen entsteht aus unbeherrschter überwältigender Angst - ob begründet oder unbegründet. Die Panikreaktion einer Menschenmasse ist eine Primitivreaktion auf eine vermeintliche oder echte Bedrohung mit Herdentrieb. Studien World Trade Center – 11. September 2001 Stuber et al. 2006 führten bei 2.752 New Yorker Einwohnerinnen und Einwohnern 6-9 Monate nach dem Ereignis eine telefonische Befragung durch. In dieser Untersuchung wiesen Frauen eine höhere geschätzte LebenszeitPrävalenz für eine anhaltende Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auf als Männer. Kofaktoren waren ein vorheriger sexueller Übergriff, eine psychische Vorerkrankung, die ethnische Zugehörigkeit („Black“, „Hispanic“) und der Familienstand mit dem Schutzfaktor „verheiratet“. Frauen waren während des Ereignisses anfälliger für eine Panikreaktion als die befragten Männer. 42 Medizin und Geschlecht Weissmann et al. 2001 befragten 7-16 Monate nach dem Ereignis Patientinnen und Patienten eines allgemeinen Krankenhauses und konnten 982 komplette Datensätze auswerten. Eine PTBS fand sich besonders bei weiblichen „Hispanics“; Kofaktoren waren insbesondere „alleinlebend ohne festen Partner“, geringe Bildung und geringes Einkommen. Depressive Störungen waren bei Frauen häufiger als bei Männern; hier wurde der Drogenabusus als Kofaktor identifiziert. Marmara-Erdbeben 1999 Aksaray et al. 2006 untersuchten 184 Patienten (79 Männer, 105 Frauen) eines psychiatrischen Dienstes 6-10 Wochen nach dem Ereignis. Frauen wiesen gegenüber Männern signifikant häufiger eine PTBS, depressive Störungen, Hoffnungslosigkeit und Somatisierungen auf. Livanou et al. 2002 untersuchten 1.027 Betroffene, davon 77 % Frauen, die im Mittel 14 Monate nach dem Ereignis spontan Hilfe suchten. Es fanden sich insgesamt 63 % PTBS und 42 % depressive Störungen. Die PTBS korrelierte u. a. mit Angst, weiblichem Geschlecht, geringer Bildung sowie Verlust von Angehörigen und Besitz. Depressive Störungen korrelierten mit weiblichem Geschlecht, geringer Bildung, Verlust von Angehörigen und psychischer Vorerkrankung. Alcio lu et al. 2003 untersuchten 20 Monate nach dem Ereignis 586 Betroffene, die nicht aus eigenem Antrieb Hilfe gesucht hatten und noch in einer Behelfsunterkunft lebten. 39 % der Untersuchten wiesen eine PTBS und 18 % eine depressive Störung auf. Die PTBS korrelierte mit Angst, weiblichem Geschlecht, höherem Alter, persönlichem Einsatz bei Rettungsarbeiten, Verschüttung und psychischer Vorerkrankung; die depressiven Störungen mit höherem Alter, Verlust von Angehörigen, dem Status „alleinlebend“, einer psychischen Vorerkrankung und dem weiblichem Geschlecht. Erdbeben in Taiwan September 1999 Lai et al. 2004 untersuchten 252 Betroffene 10 Monate nach dem Ereignis und berichteten über eine Rate von 10,3 % PTBS und 19,0 % unterschwelliger PTBS. Eine höhere Inzidenz fand sich bei Frauen, längerer Traumaexposition, psychischer Vorerkrankung und Behinderung. Chen al. 2007 untersuchten 6.412 Betroffene, die ihre Häuser verloren hatten, zwei Jahre nach dem Ereignis und fanden bei 20,9 % eine PTBS und bei 39,8 % eine allgemeine psychiatrische Morbidität. Eine PTBS wiesen vor allem Frauen sowie Menschen in einer Behelfsunterkunft, mit geringer Bildung und 43 Medizin und Geschlecht komplettem Eigentumsverlust auf. Psychiatrische Erkrankungen lagen hauptsächlich bei Frauen sowie bei Älteren und Menschen mit geringer Bildung und Leben in einer Behelfsunterkunft vor. Wu et al. 2006 untersuchten 405 Betroffene drei Jahre nach dem Ereignis und berichteten über eine Rate von noch 4,4 % PTBS und 6,4 % depressiven Störungen. Die Lebensqualität wurde (wie zu erwarten) in den Gruppen mit PTBS und depressiver Störung geringer bewertet als im Vergleichskollektiv. Prädiktoren für verminderte Lebensqualität waren höheres Alter, weibliches Geschlecht, wirtschaftliche Probleme, somatische Erkrankung und sozialer Abstieg. Sonstige Naturkatastrophen Armagan et al. 2006 untersuchten 33 türkische Helferinnen und Helfer einen Monat nach ihrer Rückkehr vom Tsunami-Hilfseinsatz 2004/05 und berichteten über eine Rate von 24,2 % PTBS (8 von 33 Helfern). Die Inzidenz war bei Frauen und Männern insgesamt vergleichbar, aber die Symptomatik war bei Frauen, Pflegepersonal und bei Teilnahme an mehr als drei vorherigen Einsätzen stärker ausgeprägt. Kar et al. 2006 untersuchten 108 Jugendliche, die 14 Monate zuvor in Indien einem Wirbelsturm ausgesetzt gewesen waren und fanden insgesamt 37,7 % PTBS, depressive oder Angststörungen mit gleicher Prävalenz bei Frauen und Männern, aber mit unterschiedlicher Symptomatik. Golfkrieg 1990/91 Vogt et al. 2005 untersuchten 10 Jahre nach dem Einsatz 495 US-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen am Golfkrieg 1990/91. Frauen berichteten über häufigere sexuelle Belästigung und geringe soziale Unterstützung in der Gruppe, Männer über mehr Kampfeinsätze. Die Inzidenz von PTBS und depressiver Störung war bei Männern und Frauen vergleichbar; bei Frauen war die Inzidenz von Ängstlichkeit erhöht. Sexuelle Belästigung und geringe soziale Unterstützung in der Gruppe hatten bei Frauen einen stärkeren Einfluss auf die psychische Gesundheit als bei Männern. Fakten, Fragen und zusammenfassende Wertung Es liegen zahlreiche weitere Untersuchungen zu den Folgen individueller psychischer und physischer Traumatisierung außerhalb von Katastrophenszenarien vor, auf die hier nicht näher eingegangen wird. Eine vorsichtige Bewertung der oben vorgestellten Daten ergibt folgendes Bild: - Die Inzidenz von PTBS und depressiven Störungen ist bei Frauen höher als bei Männern. 44 Medizin und Geschlecht - Die Symptomatik ist uneinheitlich und zeigt geschlechterspezifische Unterschiede. - Die Inzidenz von Panikreaktionen ist bei Frauen höher als bei Männern. - Die direkte Noxe hat einen hohen, aber keinen absoluten Stellenwert. Es gehen zahlreiche starke Kofaktoren wie Alter, Sozialstatus, Vorereignisse, Ethnie und kulturelles Umfeld ein. Geschlechteraspekte werden im Katastrophenschutz noch nicht oder nur wenig beachtet. Das ist bei akuter Lebensgefahr erforderlich und richtig. Weiter sind Männer in Grenzsituationen traditionell geneigt, Frauen zu schützen. Es besteht aber Anlass zum Nachdenken über viele offene Fragen. Bedeutet die unterschiedliche Stressresistenz bei Frauen a priori auch unterschiedliche Panikbereitschaft? Wer versorgt vornehmlich die Kinder und den Haushalt? Wie unterscheiden sich vorübergehende von lang anhaltenden Notsituationen usw.? Zusammenfassend scheinen Frauen biologisch bevorzugt und sozial benachteiligt zu sein. Sie erscheinen weniger stress- und panikresistent, sind aber wohl auch höher belastet. Die Beachtung von Geschlechteraspekten ist wichtig, aber stets gehen viele und starke Kovariablen ein. In Katastrophensituationen sind nicht die Frauen, sondern die Schwachen allgemein besonders betroffen. Solange es nichts Besseres gibt, gilt wohl weiter der androzentrische Zugang: Frauen und Kinder zuerst. Dafür gibt es eine Fülle guter Vorbilder und Beispiele - aber auch Männer wissen Schutz und Hilfe zu schätzen. Literatur Aksaray G et al. Gender differences in psychological effect of the August 1999 earthquake in Turkey. Nord J Psychiatry 2006;60:387-91 Alcio lu E et al. Long-term psychological outcome for non-treatment-seeking earthquake survivors in Turkey. J Nerv Ment Des 2003;191:154-60 Armagan Eet al. Frequency of post-traumatic stress disorder among relief force workers after the tsunami in Asia: Do rescuers become victims? Prehosp Disast Med 2006;21:168-72 Bochnik HJ. Panikreaktion Einzelner und Panik als Massenphänomen Verstehen, Vermeiden, Bekämpfen. In: Hempelmann G, Adams HA, Sefrin P (Hrsg): Notfallmedizin. Stuttgart: Thieme 1999;604-11 Chen Chet al. Long-term psychological outcome of 1999 Taiwan earthquake survivors: a survey of a high-risk sample with property damage. Comprehensive Psychiatry 2007;48:269-75 45 Medizin und Geschlecht Chin ML et al. Sex, gender, and pain: “Men are from Mars, women are from Venus…”. Anesth Analg 2008;107:4-5 Dahan A et al. Sex-specific responses to opiates: Animal and human studies. Anesth Analg 2008;107:83-95 Frink M et al. Influence of sex and age on MODS and cytokines after multiple injuries. Shock 2007;27:151-56 Gelb K et al. Sex and gender in the perioperative period: Wake Up to Reality. Anesth Analg 2008;107:1-3 Hurley RW et al. Sex, gender, and pain: An overview of a complex field. Anesth Analg 2008;107:309-17 Hutchens MP et al. Renal ischemia: Does sex matter? Anesth Analg 2008;107:239-49 Kar N et al. Post-traumatic stress disorder, depression, and generalised anxiety disorder in adolescents after a natural disaster: a study of comorbidity. Clin Pract Epidemiol Mental Health 2006;2:1-7 Lai TJ et al. Full and partial PTSD among earthquake survivors in rural Taiwan. J Psychiatric Res 2004;38:313-22 Livanou M et al. Traumatic stress responses in treatment-seeking earthquake survivors in Turkey. J Nerv Ment Des 2002;190:816-23 Matyal R. Newly appreciated pathophysiology of ischemic heart disease in women mandates changes in perioperative management: A core review. Anesth Analg 2008;107:37-50 O’Donnell ML et al. Posttraumatic stress disorder and depression following trauma: Understanding comorbidity. Am Journal Psychiatry 2004;161:139096 Rhudy JL et al. Gender differences in pain: Do emotions play a role? Gender Medicine 2005;2:208-26 Sperry JL et al. Characterization of the gender dimorphism after injury and hemorrhagic shock: Are hormonal differences responsible? Crit Care Medicine 2008;36:1838-45 Stuber J et al. Gender disparities in posttraumatic stress disorder after mass trauma. Gender Medicine 2006;3:54-67 Vagnerova K et al. Gender and the injured brain. Anesth Analg 2008;107:20114 Verner L et al. Geschlechterforschung - Einführung und anästhesiologische Aspekte. Anästh Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2005;40:191-98 Vogt DS et al. Deployment stressors, gender, and mental health outcomes among Gulf War I veterans. J Traumatic Stress 2005;18:115-27 Weissman MM et al. Gender differences in posttraumatic stress disorder among primary care patients after the World Trade Center attack of september 11, 2001. Gender Medicine 2005;2:76-87 46 Medizin und Geschlecht Wu HC et al. Survey of quality of life and related risk factors for a Taiwanese village population 3 years post-earthquake. Australian New Zealand J Psychiatry 2006;40:355-61 Kontakt Prof. Dr. Hans Anton Adams Interdisziplinäre Notfall- und Katastrophenmedizin Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 34 95 -34 96 E-Mail: [email protected] 47 Medizin und Geschlecht GASTROENTEROLOGIE UND HEPATOLOGIE 16. JANUAR 2009 48 Medizin und Geschlecht 49 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE BEI LEBERERKRANKUNGEN VON PD DR. KINAN RIFAI Die mittlere Lebenserwartung von Frauen in Deutschland ist über fünf Jahre höher als die der Männer. Die Ursachen sind vielfältig, aber auch in einer unterschiedlichen Disposition für bestimmte Erkrankungen und deren Verläufe begründet. So findet sich bei Frauen eine deutlich höhere Rate an Autoimmunerkrankungen, während infektiöse Erkrankungen bei Männern oft einen schwereren Verlauf aufweisen. Dies gilt auch für Erkrankungen der Leber, die insgesamt weit verbreitet sind (ca. 15 Millionen Patientinnen und Patienten in Europa). Die beiden wichtigsten infektiösen Lebererkrankungen, die Hepatitis B und die Hepatitis C, weisen beide bei Männern einen schwereren Verlauf und konsekutiv eine höhere Sterblichkeit auf: Dabei ist die Rate an spontaner Viruselimination bei Männern geringer, während sie eine höhere Fibroseprogression und Zirrhoserate bei chronischen Verläufen aufweisen. Auch das Risiko für die Entwicklung eines Hepatozellulären Karzinoms im Rahmen einer chronischen Hepatitis ist bei Männern deutlich höher als bei Frauen. Es gibt Hinweise, dass all diese Unterschiede auch auf Hormonwirkungen v. a. der Östrogene zurückzuführen sind. Im Gegenzug führen die Geschlechtsunterschiede bei Frauen zu einer sehr viel höheren Rate an Autoimmunerkrankungen der Leber in Form der Autoimmunhepatitis und der Primär Biliären Zirrhose. Interessanterweise ist der Verlauf beider Erkrankungen jedoch bei Männern und Frauen weitgehend gleich. Die dritte autoimmune Lebererkrankung, die Primär Sklerosierende Cholangitis, ist insofern atypisch, als sie bei Männern gehäuft auftritt. Die häufigsten Lebererkrankungen sind toxisch-metabolischer Art, nämlich die alkoholische Lebererkrankung und die Fettleber bzw. nicht-alkoholische Steatohepatitis. Obwohl gut belegt ist, dass Alkohol bei Frauen mengenbezogen einen größeren Leberschaden bewirkt, ist die alkoholische Lebererkrankung ebenso wie die Fettleber bei Männern (noch) wesentlich häufiger zu finden. Eine fast nur bei Männern auftretende Lebererkrankung ist die genetisch bedingte Hämochromatose (Eisenspeicherkrankheit). Entscheidend ist hier der Eisenverlust durch die Menstruationsblutung bei Frauen. Zusammengefasst finden sich viele hochsignifikante Geschlechtsunterschiede bei Lebererkrankungen, die nicht nur die Prävalenz, sondern häufig auch den Verlauf der Erkrankung wesentlich beeinflussen und somit von besonderem Interesse sind. 50 Medizin und Geschlecht Kontakt PD Dr. Kinan Rifai Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 34 15 E-Mail: [email protected] 51 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE GASTROINTESTINALER TUMOREN AM BEISPIEL VON ÖSOPHAGUSKARZINOM, HEPATOZELLULÄREM KARZINOM, PANKREASKARZINOM UND KOLONKARZINOM VON PROFESSOR DR. MICHAEL P. MANNS, DR. BENITA WOLF, PROFESSOR DR. NISAR P. MALEK Gastrointestinale Tumoren sind so heterogen und zahlreich, dass über deren Entstehung, Verlauf und Therapie nur wenige einheitliche Aussagen getroffen werden können. Geschlechterspezifische Unterschiede in der Epidemiologie, Pathogenese, Schwere der Erkrankung und Mortalität Gastrointestinaler Tumoren finden bisher weder in der klinischen Betreuung, noch in der „Literatur“ ausreichend Beachtung. Am Beispiel der Tumore des Ösophagus, der Leber, der Bauchspeicheldrüse und des Dickdarms sollen nachfolgend wesentliche Konzepte und neue Erkenntnisse geschlechterspezifischer Unterschiede erläutert werden. Zunächst bestehen für die meisten Gastrointestinalen Tumoren bemerkenswerte epidemiologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Gründe dafür wurden in der Vergangenheit am häufigsten im Risikoprofil der einzelnen Malignome gesucht, welches von Männern deutlich häufiger bedient wird als von Frauen. So stellen Unterschiede in Ernährung, Bewegung, Gewohnheiten im Tagesablauf sowie der Konsum von Alkohol und Tabak eine wesentliche Ursache für geschlechterspezifische Unterschiede bezüglich der Erkrankungshäufigkeit und Mortalität bei Gastrointestinalen Tumoren dar. Gesunde Lebensweise, Ernährung und Bewegung scheinen Frauen (noch) vor bestimmten Tumorentitäten zu schützen. Damit lässt sich aber nicht erklären, warum postmenopausale Frauen zum Beispiel ebenso häufig an einem Kolonkarzinom erkranken, wie die gleichaltrige männliche Bevölkerung. Der Einfluss der Geschlechtshormone auf die Entstehung Gastrointestinaler Tumoren ist in der Vergangenheit nur wenig erforscht worden. Ergebnisse neuerer Studien deuten vor allem auf einen Schutzeffekt der Östrogene vor der Entstehung der meisten GI-Tumoren hin. Allerdings gibt es auch vermehrt Daten, die das karzinogene Potenzial der Östrogene belegen. 52 Medizin und Geschlecht Männer in Deutschland erkrankten 2004 dreimal häufiger und im Mittel 4,5 Jahre früher am Ösophaguskarzinom als Frauen. Zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung des Plattenepithelkarzinoms des Ösophagus zählen Alkohol und Tabakkonsum. Dabei wirkt die Kombination verstärkend. Adenokarzinome entstehen auf der Basis des Barrett-Ösophagus. Die Inzidenz des Adenokarzinoms des Ösophagus steigt seit 1975 kontinuierlich an, sowohl bei Männern, als auch unter Frauen, wobei letzteres nicht genügend Beachtung in der Fachwelt erfährt. Dabei ist das Überleben nach Diagnosestellung für Männer deutlich eingeschränkter als für Frauen, Ursachen dafür sind bisher nicht ausreichend untersucht. In einer britischen Studie wurde lediglich festgestellt, dass Männer vor allem in Karzinomen des intestinalen histologischer Subtypen Prädominanz zeigen, die vor allem dadurch bedingt ist, dass Frauen wesentlich später im Leben, aber ebenso häufig, an diesem Tumor erkranken. Das primäre Leberzellkarzinom gilt als der fünfhäufigste Tumor weltweit und als die dritthäufigste Ursache von Tumorsterblichkeit. In allen bisher untersuchten Populationen hatten Männer höhere Erkrankungsraten als Frauen, die zwischen 2:1 und 5:1 liegen. Die höhere Inzidenz bei Männern könnte allein durch das durch die Lebensführung bedingte höhere Risiko für Lebererkrankungen zu erklären sein. Männer rauchen mehr, trinken mehr Alkohol, stecken sich häufiger mit Hepatitis B und C an und haben erhöhte Eisenspeicher. Dem widerspricht das 2-8fach höhere Auftreten von Hepatozellurären Karzinomen (HCC) bei männlichen Mäusen. Diese Daten unterstützen die Hypothese, dass Androgene die HCC Progression mehr beeinflussen als geschlechterspezifische Exposition zu Risikofaktoren. In allen untersuchten Populationen lag die Spitzenaltersgruppe für HCC Erkrankung bei Frauen fünf Jahre später als bei Männern. Zahlreiche Arbeiten deuten weiterhin auf eine Rolle von oralen Kontrazeptiva in der Entstehung von Leberneubildungen hin. Hepatozyten besitzen nukleare Östrogenrezeptoren. Ihre Expression ist in HCC Tumorzellen erhöht, was auf eine mögliche Hormonsensitivität dieser Tumoren hinweist. Östrogen und Progesteronkomponenten der oralen Kontrazeptiva können, wie im Tiermodell gezeigt wurde, Lebertumoren induzieren und unterhalten. Einen klaren epidemiologischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von oralen Kontrazeptiva und der Entstehung des HCC gibt es bisher jedoch nicht. Bisher existieren darüber nur widersprüchliche Studiendaten. 53 Medizin und Geschlecht In Deutschland erkranken mit ca. 6300 vs. 6600 jährlich etwa gleich viele Männer und Frauen am Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse, der häufigsten bösartigen Neubildung des Organs. Das mittlere Erkrankungsalter jedoch liegt für Männer bei etwa 69, für Frauen bei etwa 76 Jahren. Tabak und Alkohol werden ebenso wie eine an tierischen Fetten reiche Ernährung als Risikofaktoren diskutiert. Übergewicht wirkt sich ebenfalls nachteilig aus. Risiko mindernd kann eine Ernährungsweise sein, die durch einen hohen Anteil an Gemüse und Obst gekennzeichnet ist. Die geschätzten Neuerkrankungsraten wie auch die Sterblichkeit an Bauchspeicheldrüsenkrebs bleiben in Deutschland bei Männern seit Ende der 1980er Jahre konstant. Bei den Frauen steigen Inzidenz und Mortalität leicht an. Viele Studien befassen sich mit der Expression von Östrogenrezeptoren in Pankreastumoren, mit divergierenden Ergebnissen. Ursache dafür ist vorwiegend, dass in den meisten veröffentlichten Studien ausschließlich die Östrogenrezeptor-Isoform α und selten bis nie die Isoform β Beachtung fand. In einer Studie am soliden pseudopapillären Pankreaskarzinom konnte der Östrogenrezeptor β erhöhter Expression nachgewiesen werden. Dies wäre eine mögliche Erklärung, warum an diesem Tumor vorwiegend junge Frauen erkranken. Ebenso stellen papilläre zystische Tumoren eine Entität dar, an der vorwiegend junge Frauen erkranken. In einer Studie von Morales et al. wurden 2003 dabei in 7 von 8 Fällen erhöhte Level des Östrogenrezeptors β gefunden. Trotz vermehrter Hinweise auf eine Beteiligung der Östrogene an der Genese des Pankreaskarzinoms bleibt deren Rolle zunächst ungewiss. So existieren einerseits einzelne klinische Studien, in denen die Substanz Tamoxifen, ein Anti-Östrogen, für Pankreaskarzinompatienten bzw. -patientinnen eine Überlebensverlängerung von 3 auf 7 Monate bewirkte, andererseits existieren Studien, die keinerlei Therapieeffekt nachweisen konnten. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Adenokarzinom, als häufigster Pankreaskarzinomtyp betrifft nur selten junge Frauen. Postmenopausal nimmt die Inzidenz jedoch deutlich zu, was einen schützenden Effekt der Östrogene vermuten lässt. Seltene Pankreaskarzinomtypen betreffen jedoch vorwiegend junge Frauen, dort scheint Östrogen und seine Rezeptoren entscheidend zur Karzinogenese beizutragen. Darmkrebs ist bei beiden Geschlechtern die zweithäufigste Krebserkrankung. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen in Deutschland wird für Männer auf über 37.000 und Frauen auf etwa 36.000 geschätzt. Männer erkranken im Mittel mit 69, Frauen mit 75 Jahren. Obwohl Inzidenz und Mortalität nur geringe Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufweisen, bestehen unterschiedliche Einstellung zu Prävention und Screeningprogrammen. So 54 Medizin und Geschlecht scheint die Koloskopie bei Frauen als Screeninguntersuchung weniger akzeptiert als unter Männern. Bei Männern besteht weiterhin ein stärkerer Zusammenhang zwischen Inzidenz des Kolonkarzionoms und Fettleibigkeit. Weiterhin findet sich bei Frauen ein stärkerer Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und Inzidenz des Kolonkarzinoms: Unter Raucherinnen ist die Inzidenz wesentlich höher. Wie schon bei Pankreas- und Leberzellkarzinom scheint die prämenopausale orale Kontrazeption sowie die postmenopausale Hormonersatztherapie auch gegen das kolorektale Karzinom einen Schutzfaktor darzustellen. Frauen und Männer scheinen unterschiedlich auf Umweltfaktoren zu reagieren, was sich einerseits in einer Verminderung des Risikos, andererseits in einer besseren Verträglichkeit von Therapien äußert. Auf zellulärer Ebene korrelieren diese Entdeckungen v. a. mit Polymorphismen der 5,10Methylenetetrahydrofolatreduktase, die bei Frauen deutlich protektivere Wirkung zeigten, als bei Männern. Weitere Polymorphismen wurden für das Apolipoprotein E gefunden. Träger des Genotyps epsilon2/3 tragen ein deutlich erhöhtes Darmkrebsrisiko, was ebenfalls bei Männern stärker zum Tragen kommt. Jüngere Frauen scheinen weiterhin deutlich häufiger an Karzinomen des proximalen Kolon zu erkranken, wobei dabei vermehrt Mikrosatelliteninstabilitäten gefunden wurden, während Chromosomeninstabilitäten für die Karzinogenese distaler Kolonkarzinome pathognomisch sind. Mit zunehmendem Alter erkranken auch Frauen vermehrt an Karzinomen des distalen Kolons, wobei mit zunehmendem Alter auch die Expression des Östrogenzeptors in der Darmschleimhaut abnimmt. Das weibliche Geschlecht scheint außerdem ein positiver prognostischer Faktor für das Ansprechen auf Chemotherapie zu sein. Eine Ursache hierfür kann eine deutlich verminderte Expression von Dihydropyrimidin Dehydrogenase (DPD), ein für den 5-Fluorouracil-Metabolismus entscheidendes Enzym bei Frauen im Vergleich zu Männern, sein. Eine verminderte Expression von DPD im Tumor würde demnach mit einer verbesserten Wirkung von 5-FU korrelieren. Zusammenfassend betrachtet erkranken Frauen deutlich seltener an Gastrointerenalen-Tumoren. Östrogene haben vielfach einen Tumor-supressiven Effekt, wobei Hormone auch einen positiven Einfluss auf das Überleben zu haben scheinen. Unterschiede in der Metabolisierung von Zytostatika (z.B. 5FU) können ein besseres Therapieansprechen erklären. Literatur 55 Medizin und Geschlecht Anton-Culver H. Smoking and other risk factors associated with the stage and age of diagnosis of colon and rectum cancers. Cancer Detect Prev 1991;15(5):345-50 Bakkevold KE et al. Tamoxifen therapy in unresectable adenocarcinoma of the pancreas and the papilla of Vater. Br J Surg 1990 Jul;77(7):725-30 Curtin K et al. MTHFR C677T and A1298C polymorphisms: diet, estrogen, and risk of colon cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004 Feb;13(2):285-92 Derakhshan MH et al. Oesophageal and gastric intestinal-type adenocarcinomas show the same male predominance due to a 17 year delayed development in females. Gut 2009 Jan; 58(1):16-23 El-Serag HB et al. Hepatocellular carcinoma: epidemiology and molecular carcinogenesis. Gastroenterology 2007 Jun;132(7):2557-76 Geers C et al. Solid and pseudopapillary tumor of the pancreas--review and new insights into pathogenesis. Am J Surg Pathol 2006 Oct;30(10):1243-49 Horimi T et al. The beneficial effect of tamoxifen therapy in patients with resected adenocarcinoma of the pancreas. Hepatogastroenterology 1996 Sep;43(11):1225-29 Karner-Hanusch J et al. Aspects of gender in colorectal tumors. Wien Med Wochenschr 2006 Oct;156(19-20):541-44 Keating JJ et al. A prospective randomised controlled trial of tamoxifen and cyproterone acetate in pancreatic carcinoma. Br J Cancer 1989 Nov;60(5):789-92 Macinnis RJ et al. Body size and composition and colon cancer risk in women. Int J Cancer 2006 Mar 15;118(6):1496-500 Morales A et al. The beta form of the estrogen receptor is predominantly expressed in the papillary cystic neoplasm of the pancreas. Pancreas 2003 Apr;26(3):258-63 Rudolph KL et al. Inhibition of experimental liver cirrhosis in mice by telomerase gene delivery. Science 2000 Feb 18;287(5456):1253-58 Slattery ML et al. Hormone replacement therapy and improved survival among postmenopausal women diagnosed with colon cancer (USA). Cancer Causes Control 1999 Oct;10(5):467-73 Wong A et al. Survival benefit of tamoxifen therapy in adenocarcinoma of pancreas. A case-control study. Cancer 1993 Apr 1;71(7):2200-03 Younes M et al. Incidence and survival trends of esophageal carcinoma in the United States: racial and gender differences by histological type. Scand J Gastroenterol 2002 Dec;37(12):1359-65 Yu MC et al. Environmental factors and risk for hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2004 Nov;127(5 Suppl 1):72-78 56 Medizin und Geschlecht Kontakt Prof. Dr. Nisar P. Malek Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 45 85 -59 63 E-Mail: [email protected] 57 Medizin und Geschlecht KARDIOLOGIE 13. FEBRUAR 2009 58 Medizin und Geschlecht 59 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE IN DER INTENSIVMEDIZIN VON PROFESSORIN DR. URSULA MÜLLER-WERDAN Östrogenrezeptoren und kardiovaskuläre Östrogenwirkungen Die unterschiedliche Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen zwischen Männern und Frauen wurde bislang überwiegend dem günstigen Einfluss der Östrogene auf die Serumkonzentrationen von Lipoproteinen zugeschrieben. Jedoch ist mittlerweile erkannt, dass zahlreiche Organe direkte Effektoren der Östrogene sind, zum Beispiel auch Gefäße, Herz, Knochen und das Gehirn. Schätzungsweise sind nur etwa ein Drittel der klinisch beobachteten protektiven Östrogenwirkungen unmittelbar der günstigen Beeinflussung der Serumlipidprofile zuzuschreiben; direkte Wirkungen am Gefäßsystem tragen offenbar wesentlich zur geringeren kardiovaskulären Morbidität bei Frauen bei. Östrogene entfalten an zahlreichen Zellspezies genomische Effekte durch Aktivierung der beiden bekannten Östrogenrezeptoren α und ß, die beide zur Superfamilie der Steroidrezeptoren gehören und als Ligand-aktivierte Transkriptionsfaktoren die Expression Östrogen-responsiver Elemente des Genoms induzieren. Daneben zeitigen Östrogene noch wenig verstandene rasche, nicht-genomische Effekte, etwa eine NO-abhängige Vasodilatation 5-20 Minuten nach Gabe von Östrogen, die nicht durch eine Veränderung der Genexpression zustande kommt, sondern durch eine direkte Einflussnahme auf zytosolische Signalkaskaden. Die beiden Östrogenrezeptoren können sowohl als Homo- als auch als Heterodimere biologische Wirkungen entfalten, die darüber hinaus durch Koaktivatoren oder Korepressoren moduliert werden. Die Erforschung der Komplexität und Pleiotropie von Östrogenwirkungen ist ein „evolving field“ mit einem hohen Wissenszuwachs seit der Klonierung des Östrogen-ß-Rezeptors vor erst wenigen Jahren. Sexueller Dimorphismus der Immunantwort Frauen haben im Vergleich zu Männern zwar einen Vorteil hinsichtlich der Entwicklung atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen, jedoch treten Autoimmunerkrankungen bei Frauen deutlich häufiger auf (z.B. systemischer Lupus erythematodes, Hashimoto Thyreoditis, rheumatoide Arthritis). Experimentelle und klinische Untersuchungen belegen geschlechterspezifische Unterschiede in der humoralen und zellulären Immunantwort. So haben Frauen im Mittel höhere Plasmaantikörperspiegel als Männer, und die zelluläre Immunantwort ist bei weiblichen Säugetieren verstärkt. Rezeptoren für Sexualhormone wurden auf verschiedenen Zellen des Immunsystems 60 Medizin und Geschlecht nachgewiesen und bilden die Basis für diesen sexuellen Dimorphismus der Immunantwort. Der Krankheitsverlauf bei Sepsis, Schock und Trauma wird wesentlich von der akut eskalierenden Entzündungsreaktion des Organismus determiniert, zu der sowohl die angeborene als auch die erworbene Immunität beitragen. Im Tiermodell werden sowohl eine bakterielle Sepsis als auch ein hämorrhagisches Trauma von weiblichen Mäusen deutlich besser toleriert. Die Arbeitsgruppe von Chaudry konnte so nachweisen, dass männliche Mäuse nach hämorrhagischem Trauma eine deutlich schlechtere Herzfunktion haben als weibliche und dass sich die Herzfunktion dieser männlichen Tiere durch Kastration oder Testosteronantagonisten verbessern ließ. Barrow et al berichteten 1990 über einen erstaunlichen Unterschied bei der Letalität von Mädchen (n = 67) und Jungen (n = 118), die im Mittel 5,1 bzw. 5,8 Jahre alt waren, nach schweren Brandverletzungen: trotz ähnlichem Schweregrad der erlittenen Verbrennungen war die Sterblichkeit der Knaben (15 von 118) signifikant größer als die der Mädchen (3 von 67). Diese Beobachtung wirft die Frage auf, inwieweit bereits bei Kindern vor der Pubertät Unterschiede im Immunsystem bestehen. Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede bei Intensivpatientinnen und -patienten? Zwei große, prospektiv angelegte Beobachtungsstudien fanden keinen geschlechterspezifischen Sterblichkeitsunterschied – in Relation zum Krankheitsschweregrad, insgesamt war jedoch die Zahl der Intensivpatientinnen geringer als die der Intensivpatienten. In einer der Studien wurden Männern häufiger invasive Prozeduren zuteil, trotz etwas niedrigeren Krankheitsschweregrads. Geschlechtsunterschiede bei der menschlichen Sepsis - Beobachtungsstudien Mehrere Beobachtungsstudien weisen auf einen Überlebensvorteil von Frauen bei schwerer Sepsis bzw. eine verminderte Inzidenz septischer Komplikationen nach Trauma hin. Dem könnte der sexuelle Dimorphismus der humoralen und zellulären Immunantwort zugrunde liegen, die bei Frauen und weiblichen Säugetieren verstärkt ist. Interessante neue Studien zeigen darüber hinaus, dass bestimmte Polymorphismen des TNF- und LBP-Genlocus nur bei Männern mit einer schlechteren Prognose der Sepsis assoziiert sind. Derzeit wird diskutiert, ob sich daraus die Notwendigkeit einer geschlechterspezifischen Behandlung der Sepsis ableiten lässt. Genotyp und Sepsis – gibt es Geschlechtsunterschiede? TNF-α ist ein zentraler Mediator der natürlichen Immunabwehr und gilt als wesentlicher Trigger der eskalierenden systemischen Entzündungsreaktion in 61 Medizin und Geschlecht der Sepsis. Der TNF Genlocus (Gene für TNF-α und TNF-ß) des Menschen ist innerhalb des major histocompatibility complex (MHC) auf dem kurzen Arm des Chromosoms 6 angesiedelt. Es sind mehrere Polymorphismen des TNFLocus identifiziert worden. Homozygotie für das Allel TNFB2 des TNFn Polymorphismus (NcoI), der innerhalb des ersten Introns des TNF-ß-Gens liegt, ist bei septischen Patientinnen/Patienten assoziiert mit einer verstärkten Freisetzung von TNF-α und einer erhöhten Letalität. Eine weitere Studie fand überraschend, dass nur bei Männern – nicht bei Frauen – der Genotyp TNFB2/TNFB2 mit einer erhöhten Letalität der schweren Sepsis assoziiert ist. Der Mann als Intensivpatient Aufgrund der aktuellen experimentellen und klinischen Datenlage kann davon ausgegangen werden, dass für Männer eine stärkere Gefährdung besteht, auf infektiöse und nicht-infektiöse Stimuli mit einer schweren Sepsis zu reagieren. Insbesondere die Arbeitsgruppe von Chaudry hat sich der Frage angenommen, ob eine geschlechterspezifische Behandlung der Sepsis erforderlich und möglich ist. Im Tiermodell konnten Kastration, Testosteronrezeptorantagonisten oder Östrogenbehandlung die Organdysfunktionen bei hämorrhagischem Schock bessern. Literatur Fowler RA et al. Sex- and age-based differences in the delivery and outcomes of critical care CMAJ 2007;177:1513-1519 Müller-Werdan U Die Frau als Intensivpatientin als Intensivpatientin: Sepsis, Beatmung, Sedierung. Intensivmed 2004;41:203-206 Schröder J et al. Gender differences in sepsis: genetically determined?. Shock 2000 Sep;14(3):307-13 Valentin A et al. Gender-related differences in intensive care: a multiple-center cohort study of therapeutic interventions and outcome in critically ill patients. Crit Care Med 2003 Jul;31(7):1901-1907. Kontakt Prof’in Dr. Ursula Müller-Werdan Poliklinik für Innere Medizin III Universitätsklinikum Halle (Saale) Ernst Grube Str. 40 06097 Halle Telefon: 0345 / 5 57 28 16 -45 45 E-Mail: [email protected] 62 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE KARDIOVASKULÄRER ERKRANKUNGEN JENSEITS VON ARTERIOSKLEROSE UND HERZINSUFFIZIENZ: VITIEN UND RHYTHMUSSTÖRUNGEN VON DR. MECHTHILD WESTHOFF-BLECK Kongenitale Vitien Durch verbesserte chirurgische und interventionelle Techniken erreichen immer mehr Patientinnen und Patienten auch mit komplexen Vitien das Erwachsenenalter. Dies führt zu der Frage, ob ähnlich wie bei der koronaren Herzerkrankung unterschiedliche geschlechterspezifische Aspekte bestehen, die im Kindesalter eine untergeordnete Rolle spielen, im Erwachsenenalter aber evident werden. Die Prognose bei kongenitalen Vitien hängt wesentlich von der Komplexität der zugrunde liegenden Erkrankung ab. Die Inzidenz komplexer Vitien unter Beteilung der großen Gefäße ist beim männlichen Geschlecht häufiger zu finden, bei Frauen besteht eine erhöhte Inzidenz von Vitien, die die AVKlappenebene betreffen, Mitralklappenanomalien und Vorhofseptumdefekte. Dieses legt die Vermutung nahe, dass auf den Gonosomen die kardivaskuläre Entwicklung zumindest partiell kodiert ist. Hierfür sprechen die kardiovaskulären Anomalien, die beim XO-Syndrom, dem Turner-Syndrom, zu finden sind. Da beim männlichen Geschlecht ebenfalls nur ein X-Chromosom vorhanden ist, erhöht dies die Auftretenswahrscheinlichkeit rezessiver xchromosomal abhängiger Vererbungsgänge. Beim Turner-Syndrom bestehen als häufigste Gefäßanomalie Aortenanomalien mit resultierenden Aortenaneurysmen, die ein hohes Dissektionsrisiko aufweisen. Die unterschiedliche Inzidenz von Vitien legt die Vermutung nahe, dass bei angeborenen Herzfehlern geschlechtsabhängig nicht nur unterschiedliche Vitien sondern auch eine andere Prognose zu erwarten ist. Daten aus dem nationalen Register für angeborene Herzfehler in den Niederlanden belegen, dass Frauen eine signifikant schlechtere Prognose bezüglich des Auftretens einer pulmonalarteriellen Hypertonie haben. Ursächlich wird dies auf eine erhöhte Inzidenz von Vitien mit dem Risiko einer resultierenden pulmonalen Hypertonie aber auch auf hormonelle Effekte (vasokonstriktorische Spaltprodukte des Estradiols) und hämodynamische Belastungen während der Schwangerschaft zurückgeführt. Junge Männer hatten einen schlechteren aortalen outcome (definiert als Aneurysma, Dissektion und 63 Medizin und Geschlecht Operation wegen einer aortalen Erkrankung) und häufiger eine Defibrillator Implantation. Neben einer erhöhten Inzidenz von Vitien mit aortaler Beteiligung spielt beim aortalen outcome wahrscheinlich auch die Tatsache eine Rolle, dass Männer aufgrund der Körpergröße größere Aortendiameter aufweisen und somit eher, sofern der Aortendiameter nicht auf die Körperoberfläche bezogen wird, die Indikation zur Operation gestellt wird. Obwohl eine vergleichbare Inzidenz von ventrikulären Tachykardien bei Männern und Frauen bestand, erfolgte bei Männern häufiger die Implantation eines Defibrillators. Es ist wahrscheinlich, dass bei der Indikationsstellung zur Implantation eines Defibrillators die Tatsache, dass der plötzliche Herztod dreimal häufiger bei Männern als bei Frauen auftritt, zu einer großzügigen Indikationsstellung zur Implantation bei Männern geführt hat. Somit bestehen im Verlauf auch bei kongenitalen Vitien neben unterschiedlichen anatomischen Aspekten, die die Prognose beeinflussen, ebenfalls Unterschiede in der Behandlung. Geschlechterspezifische Aspekte von Rhythmusstörungen Bei Männern und Frauen bestehen unterschiedliche, hormonell abhängige elektrophysiologische Gegebenheiten. Männer haben einen erhöhten Sympathikotonus. Bei Frauen besteht vor der Menopause eine überwiegende Parasympathikusaktivität. Während der Sympathikus direkt das gesamte Erregungsleitungssystem und das Myokard innerviert, beeinflusst der Parasympathikus lediglich das supraventrikuläre Erregungsleitungssystem. Dies beeinflusst die Inzidenz von Rhythmusstörungen und plötzlichem Herztod. Beim plötzlichen Herztod besteht bedingt durch den erhöhten Sympathikotonus bei Männern häufiger ein Kammerflimmern und eine Assoziation mit physischen Belastungen. Bei Frauen tritt häufiger eine Asystolie auf, ferner besteht eine Assoziation des plötzlichen Herztodes mit psychischen Belastungen. Insgesamt haben Männer eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit an einem plötzlichen Herztod zu versterben. Die erhöhte Inzidenz bei Männern beruht in erster Linie auf der in früherem Lebensalter auftretenden koronaren Herzerkrankung, die in 80 % bei Männern und in nur 45 % bei Frauen die zugrunde liegende kardiale Erkrankung darstellt. Hingegen haben Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit einen plötzlichen Herztod zu überleben, da Männer häufiger Kammerflimmern (durch eine Defibrillation gut behandelbar) und eine bekannte Herzerkrankung haben. Frauen sind in der Regel älter, haben häufiger eine Asystolie und erleiden häufiger unbeobachtet einen plötzlichen Herztod. Das Risiko eines Medikamenten induzierten langen QT-Syndroms mit resultierenden Torsade de pointes Tachykardien (Antidepressiva, Neuroleptika, Antibiotika, Antihistaminika etc.) ist bei Frauen höher als bei Männern, da zum einen pharmakokinetische Unterschiede aber auch eine hormonabhängige Beeinflussung von die Depolarisation beeinflussenden Kaliumkanälen bestehen. 64 Medizin und Geschlecht Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Therapie bedürftigen Rhythmusstörungen. Männer weisen eine höhere Inzidenz auf. Als zugrunde liegende Erkrankung besteht am häufigsten eine koronare Herzerkrankung. Mit zunehmendem Alter ist eine erhöhte Inzidenz bei Frauen zu beobachten, wobei als ursächliche Erkrankung am häufigsten eine Hypertonie und eine Hyperthyreose vorliegen. Frauen sind in der Regel symptomatischer und haben eine höhere Rezidivneigung nach Kardioversionen. Dabei spielen unter anderem die unterschiedlichen strukturellen Herzerkrankungen mit diastolischer Dysfunktion aber auch der postmenopausal fehlende protektive Östrogeneffekt mit unter anderem bestehendem höheren Sympathikotonus eine Rolle. Männer und Frauen profitieren gleichermaßen von einer Antikoagulation zur Prävention thrombembolischer Komplikationen, allerdings haben Frauen eine erhöhte Blutungsneigung, was eine sorgfältige Kontrolle der Antikoagulation erfordert. Insgesamt bestehen grundlegende rhythmologische geschlechterspezifische Unterschiede, die im klinischen Alltag relevant sind. Literatur Fang MC et al. Gender difference in the risk of ischemic stroke and peripheral embolism in atrial fibrillation. Circulation 2005 Sep 20;112(12):1687-91 Hara M et al. Effects of gonadal steroids on ventricular repolarization and on the response to E4031. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1998;285:1068-72 Hreiche R et al. Drug-induced long QT syndrome in women: review of current evidence and remaining gaps. Gender Medicine 2008 Jun;5(2):124-35 Kim C et al. Out-of-hospital cardiac arrest in men and women. Circulation 2001 Nov 27;104(22):2699-703 Shuba YM et al. Testosterone-mediated modulation of HERG blockade by proarrythmogenic agents. Biochem Pharmacol. 2001 Jul 1;62(1):41-9 Verheugt CL et al. Gender and outcome in adult congenital heart disease. Circulation. 2008 Jul 1;118(1):26-32 Kontakt Dr. Mechthild Westhoff-Bleck Klinik für Kardiologie und Angiologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 25 69 E-Mail: [email protected] 65 Medizin und Geschlecht DIE PERIPARTALE KARDIOMYOPATHIE VON PROFESSORIN DR. DENISE HILFIKER-KLEINER Die peripartale Kardiomyopathie (PPCM) ist eine schwere Erkrankung unklarer Genese. Die Inzidenz wird in Europa auf 1:2300 bis 1:4000 Schwangerschaften geschätzt. Die PPCM entspricht in ihrem klinischen Erscheinungsbild einer dilatativen Kardiomyopathie (DCM), unterscheidet sich aber von anderen DCMFormen in Bezug auf ihre Assoziation mit einer Schwangerschaft, ihre schnelle Progression (bei vielen diagnostizierten Fällen liegt eine schwere Herzinsuffizienz bis hin zur Indikation für eine Herztransplantation vor) und einer möglichen Heilung. Epidemiologie Bis anhin gibt es kein definiertes Risikoprofil für eine PPCM. Diskutierte Risikofaktoren für PPCM sind Präeklampsie, Bluthochdruck, die Einnahme tokolytischer Medikamente, Rauchen, Kaiserschnitt, Substanzmissbrauch, Zwillingsschwangerschaften, Teenagerschwangerschaften und Schwangerschaften bei älteren Frauen. Trotz dieser bekannten Risikofaktoren sind ein Viertel bis ein Drittel aller PPCM-Patientinnen junge, offensichtlich gesunde, erstgebärende Frauen. Der genetische Hintergrund scheint mit eine Rolle zu spielen, da es z.B. unter der schwarzen Bevölkerung Haitis (1:299) und Afrikas (1:100 bis 1:1000) eine sehr hohe Inzidenz für PPCM gibt. Zu beachten ist, dass das Risiko und die Schwere einer PPCM bei einer erneuten Schwangerschaft nach einer PPCM sehr viel höher ist; eine besondere Gefährdung liegt vor, wenn die Patientin zuvor keine Normalisierung der Pumpfunktion erreicht hatte. Es ist deshalb besonders wichtig, dass PPCMPatientinnen diagnostiziert werden. Eine kleine Pilotstudie in Südafrika mit Patientinnen in einer Folgeschwangerschaft nach einer PPCM sowie wenige Heilversuche in Deutschland zeigten, dass eine Therapie mit Bromocriptin zusammen mit adäquater Herzinsuffizienztherapie unmittelbar nach der Niederkunft einen Rückfall verhindern könnte. Die Anzahl der beschriebenen Fälle ist aber zu klein, um hier auf ein effizientes Therapiekonzept schließen zu können, deshalb gilt nach wie vor, dass PPCM-Patientinnen von einer weiteren Schwangerschaft abgeraten werden sollte. Diagnose und Therapie der PPCM Die klinischen Beschwerden der betroffenen Frauen sind sehr unterschiedlich und ähneln häufig normalen physiologischen Adaptationsvorgängen während der Schwangerschaft und Geburt oder Infektionskrankheiten. Dazu kommt, dass bei jungen Frauen ohne bekannte kardiovaskuläre Vorerkrankung nicht primär 66 Medizin und Geschlecht an ein kardiologisches Problem gedacht wird, insbesondere, da das EKG auch bei schwerer PPCM normal erscheinen kann. Dies führt dazu, dass, obwohl die Diagnosekriterien klar definiert sind, eine PPCM häufig erst spät diagnostiziert wird. Zur sicheren Diagnose muss eine Echokardiographie oder/und eine Magnetresonanztomographie herangezogen werden. Die Klinik der PPCM entspricht einer DCM. Somit besteht die Indikation für eine Herzinsuffizienztherapie nach den Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Kardiologie mit ACE-Hemmern, Diuretika, Aldosteron-Antagonisten und, soweit die Patientinnen hämodynamisch stabil sind, mit β-Blockern. Die Prognose zeigt bei 9-23 % der Patientinnen terminale Herzinsuffizienz, Stabilisierung und Verbesserung bei 50 %, komplette Erholung nur bei ca. 30 % der Fälle. Diese Zahlen sind bei allen internationalen prospektiven Studien vergleichbar und reflektieren auch die Befunde des deutschen PPCM-Registers (Hilfiker-Kleiner D, unveröffentlicht). Neue Forschungsergebnisse eröffnen jetzt einen spezifischeren Therapieansatz. Experimentelle und erste klinische Studien haben einen pathophysiologischen Zusammenhang zwischen der PPCM, erhöhtem peripartalem oxidativem Stress und einer proteolytischen Spaltung des Stillhormons Prolaktin in ein angiostatisches Subfragment aufzeigt. In einer kleinen Pilotstudie und einer Anzahl Heilversuche hat sich gezeigt, dass eine systemische Prolaktinblockade mit Bromocriptine, einem häufig zum Abstillen eingesetzten Dopamin Rezeptor Antagonisten, der Entstehung und der Progression der PPCM entgegen wirken könnte. Die Wirkung von Bromocriptin in der akuten PPCM wird gegenwärtig in zwei laufenden randomisierten Studien in Deutschland und Südafrika getestet. Schlussfolgerung Die PPCM ist eine seltene, aber potenziell lebensgefährliche Erkrankung, die durch das Auftreten unspezifischer Zeichen der Herzinsuffizienz in Assoziation mit einer Geburt charakterisiert ist. Bei früher Diagnosestellung und entsprechender Behandlung mit der Standardtherapie der Herzinsuffizienz ist die Prognose der Patientinnen deutlich besser. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass gespaltenes Prolaktin ein wichtiger Faktor der Pathophysiologie der PPCM ist. Da mit Beginn der klassischen Herzinsuffizienztherapie mit ACE-Hemmern auf das Stillen verzichtet werden sollte, ist die Prolaktinblockade mit Bromocriptin nicht nur für unkompliziertes Abstillen zu erwägen, vielmehr sprechen erste Beobachtungen dafür, dass eine prolongierte Therapie mit Bromocriptin sich günstig auf den klinischen Verlauf auswirkt. Zu beachten ist, dass bei Bromocriptin Gabe eine Kombination mit niedrig dosiertem Heparin angezeigt ist. 67 Medizin und Geschlecht Literatur Habedank D et al. Recovery from peripartum cardiomyopathy after treatment with bromocriptine. Eur J Heart Fail. 2008 Nov;10(11):1149-51 Hilfiker-Kleiner D et al. A Cathepsin D-Cleaved 16 kDa Form of Prolactin Mediates Postpartum Cardiomyopathy. Cell 2007;128:589-600 Hilfiker-Kleiner D et al. Die postpartale Kardiomyopathie. Deutsches Ärzteblatt 2008;105:751-56 Hilfiker-Kleiner D et al. Peripartum cardiomyopathy: recent insights in its pathophysiology. Trends Cardiovasc Med 2008;18:173-79 Hilfiker-Kleiner D et al. Recovery from postpartum cardiomyopathy in 2 patients by blocking prolactin release with bromocriptine. J Am Coll Cardiol 2007;50:2354-55 Pearson GD et al. Peripartum cardiomyopathy: National Heart, Lung, and Blood Institute and Office of Rare Diseases (National Institutes of Health) workshop recommendations and review. Jama 2000;283:1183-88 Sliwa K et al. Peripartum cardiomyopathy. Lancet 2006;368:687-93 Kontakt Prof’in Dr. Denise Hilfiker-Kleiner Klinik für Kardiologie und Angiologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 25 31 E-Mail: [email protected] 68 Medizin und Geschlecht 69 Medizin und Geschlecht HUMANGENETIK 13. MÄRZ 2009 70 Medizin und Geschlecht 71 Medizin und Geschlecht VÄTERLICH UND MÜTTERLICH GEPRÄGTE GENE VON DR. BRIGITTE PABST Aus genetischer Sicht ist der offensichtlichste Unterschied zwischen Männern und Frauen die Chromosomenkonstitution. Der diploide Chromosomensatz eines Menschen besteht aus 46 Chromosomen, davon zählen 22 Chromosomenpaare zu den Autosomen (Nicht-Geschlechtschromosomen) und 1 Chromosomenpaar zu den Gonosomen (Geschlechtschromosomen). Frauen tragen zwei X-Chromosomen und Männer ein X- und ein Y-Chromosom als Gonosomen. Der Karyotyp lautet entsprechend 46,XX bzw. 46,XY. Das väterliche und das mütterliche Genom unterscheiden sich allerdings nicht nur durch die Gonosomenkonstitution. So entwickelt sich eine parthenogenetisch aktivierte Eizelle zu einem Ovarialteratom, das unorganisiert Gewebsstrukturen aller drei Keimblätter enthalten kann, aber keine extraembryonalen Trophoblastzellen. Im Gegensatz dazu ist die Blasenmole das Resultat einer befruchteten Eizelle mit einem rein diploiden männlichen Chromosomensatz. Der weibliche Chromosomensatz ist verloren gegangen. Hier finden sich nur molig aufgetriebene Trophoblastzellen ohne embryonale Strukturen. Auch Triploidien, dies sind Chromosomenstörungen mit einem dreifachen Chromosomensatz (meist 69,XXX), unterscheiden sich im klinischen Erscheinungsbild in Abhängigkeit von der Herkunft des überzähligen haploiden Chromosomensatzes. Die diandrische Triploidie ist charakterisiert durch eine große, zystische Plazenta und einen mikrozephalen Feten. Bei digynischen Triploidien hingegen weist der Fetus eine Entwicklungsretardierung und Makrozephalie auf. – Diese Beobachtungen und tierexperimentelle Untersuchungen belegen, dass das väterliche und das mütterliche Genom sich funktionell unterscheiden und für eine regelrechte Embryonalentwicklung das Genom beider Eltern nötig ist (McGrath J 1984 und Surani MA et al. 1984). Gründe für die funktionellen Unterschiede finden sich in Genen, deren Expression abhängig ist von der elterlichen Herkunft. Diesen Mechanismus der Genregulation nennt man elterliche Prägung bzw. genomisches Imprinting. Die genomische Prägung bewirkt, dass nur eine Genkopie (monoallelisch) exprimiert wird und die andere durch Methylierung inaktiviert ist. Es wird heute angenommen, dass etwa 100 der ca. 25.000 menschlichen Gene in Clustern angeordnet eine elterliche Prägung zeigen. Im Verlauf der Entwicklung der Keimzellen (Gameten) erhalten die betroffenen Chromosomenregionen ihre geschlechterspezifische Prägung. In der Samenzelle die väterliche und in der Eizelle die mütterliche. Die befruchtete Eizelle (Zygote) trägt von jedem Chromosomenpaar eine väterliche und eine mütterliche Kopie. Die Prägung 72 Medizin und Geschlecht wird an alle somatischen Zellen weitergegeben. In den primordialen Keimzellen werden die elternspezifischen Prägungen gelöscht, und in den sich entwickelnden Keimzellen kommt es dann zur Umschaltung der Prägung in Abhängigkeit des Geschlechts des Feten auf rein paternal bzw. rein maternal. Der zeitliche Ablauf der Prägung ist geschlechts- und genspezifisch (Bourc'his D et al. 2001, Haaf T 2001, Sasaki H et al. 2008). Das genomische Imprinting hat sich möglicherweise zusammen mit der Plazenta entwickelt. Bei Metatheria und Eutheria wachsen die Nachkommen auf Kosten der Mutter heran. Bei Protheria zum Beispiel befinden sich alle notwendigen Ressourcen im Dotter des Eies (Hore TA et al. 2007). Der Nährstofftransfer zwischen Fetus und Mutter wird auch durch einige geprägte Gene gesteuert, wobei die paternal exprimierten Gene eher wachstumsfördernd und die maternal exprimierten Gene wachstumshemmend wirken. Darauf gründet sich die Hypothese des Geschlechterkonflikts, die davon ausgeht, dass der Mann daran interessiert ist, dass seine Nachkommen und damit seine Gene eine optimale Versorgung in utero erhalten. Die Frau allerdings muss auf ihr eigenes Überleben achten, um auch in weiteren Schwangerschaften den Nachkommen Ressourcen zur Verfügung stellen zu können (Moore T 1991). Abgesehen von den parental spezifischen Methylierungsmustern (s. o.) kommt es in der Zygote zu umfangreichen De- und Remethylierungsprozessen, um die Totipotenz der embryonalen Zellen zu erreichen. Hierbei erfolgt die aktive Demethylierung des paternalen Genoms unter maternaler Kontrolle. Das maternale Genom wird passiv im Verlauf der frühen Zellteilungen demethyliert (Haaf T 2001). Fehler im Imprintingmuster zeigen sich bei bekannten Syndromen, wie z.B. Angelman Syndrom, Prader-Willi Syndrom, Beckwith-Wiedemann Syndrom, Silver-Russell Syndrom und Transientem Neonatalem Diabetes mellitus. Mechanismen, die zu einer gestörten Prägung und damit zum Verlust der einzigen aktiven Genkopie führen können, sind z.B. Mikrodeletionen des nicht geprägten Allels. Mikrodeletionen stellen die häufigste Ursache für ein PraderWilli oder Angelmann Syndrom dar. Störungen der Etablierung bzw. Weitergabe des Imprintings findet man unter anderem bei dem BeckwithWiedemann Syndrom, das zu den Großwuchs Syndromen zählt und bei dem Silver-Russell Syndrom, das durch einen ausgeprägten prä- und postnatalen Kleinwuchs charakterisiert ist (Horsthemke et al. 2008, Eggermann T et al. 2008). Des Weiteren können maternale bzw. paternale uniparentale Disomien (UPD) mit klinischen Auffälligkeiten einhergehen. Der Transiente Neonatale Diabetes Mellitus ist bedingt durch eine paternale UPD 6 (Mackay DJ et al. 2005). Unter einer UPD versteht man das Vorkommen zweier mütterlicher bzw. 73 Medizin und Geschlecht väterlicher Kopien eines Chromosoms. Aufgrund des mit steigendem mütterlichen Alter assoziierten erhöhten Fehlverteilungsrisikos in Eizellen erhöht sich das Risiko für maternale UPDs (Engel E 1980, Kotzot D 2008). Schätzungsweise sind 10-15 % aller Paare ungewollt kinderlos. Mit Einführung der assistierten Reproduktionstechniken (ART), der in vitro Fertilisation (IVF) und der intracytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI), stehen Paaren zwei Methoden zur Behandlung der Sub- bzw. Infertilität zur Verfügung. In den letzten Jahren wurden Fallbeschreibungen über Patientinnen und Patienten mit Angelman Syndrom bzw. Beckwith-Wiedemann Syndrom publiziert, die durch ART gezeugt wurden und Imprintingfehler aufweisen (Cox GF et al. 2002, Halliday J et al. 2004). Nach derzeitigem Kenntnisstand geht man davon aus, dass mehrere Faktoren Einfluss auf ein fehlerhaftes Imprinting nehmen könnten. Neben den mit der Methode der künstlichen Befruchtung verbundenen Faktoren, wie Hormonstimulation der Frau, Zellkultivierung der Gameten und der Zygote und Manipulation der Gameten, scheint auch die Infertilität bzw. Subfertilität per se einen Risikofaktor darzustellen. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Angelmann Syndroms bzw. Beckwith-Wiedemann Syndroms nach ART bleibt nach heutigem Kenntnisstand dennoch gering (<1 %). Weitere Untersuchungen werden in Zukunft zeigen, inwieweit Störungen der Fertilität assoziiert sind mit Veränderungen des Imprintingmusters (Ludwig M et al. 2005, Bertelsmann H et al. 2008, Manipalviratn S et al. 2009). Literatur Bertelsmann H et al. Fehlbildungsrisiko bei extrakorporaler Befruchtung. Deutsches Ärzteblatt 2008;105:11-17 Bourc'his D et al. Delayed and incomplete reprogramming of chromosome methylation patterns in bovine cloned embryos. Curr Biol. 2001;11:1542-46 Cox GF et al. Intracytoplasmic sperm injection may increase the risk of imprinting defects. Am J Hum Genet. 2002 Jul;71:162-64 Eggermann T et al. Growth retardation versus overgrowth: Silver-Russell syndrome is genetically opposite to Beckwith-Wiedemann syndrome. Trends Genet. 2008;24:195-204 Engel E. A new genetic concept: uniparental disomy and its potential effect, isodisomy. Am J Med Genet.1980;6:137-43 Haaf T. The battle of the sexes after fertilization: behaviour of paternal and maternal chromosomes in the early mammalian embryo. Chromosome Res. 2001;9(4):263-71 Halliday J et al. Beckwith-Wiedemann syndrome and IVF: a case-control study. Am J Hum Genet. 2004;75:526-28 74 Medizin und Geschlecht Hore TA et al. Construction and evolution of imprinted loci in mammals. Trends Genet. 2007;9:440-48 Horsthemke B et al. Genomic imprinting and imprinting defects in humans.Adv Genet. 2008;61:225-46 Kotzot D. Complex and segmental uniparental disomy updated.J Med Genet. 2008 Sep;45:545-56 Ludwig M et al. Increased prevalence of imprinting defects in patients with Angelman syndrome born to subfertile couples. J Med Genet. 2005;42:28991 Mackay DJ et al. Bisulphite sequencing of the transient neonatal diabetes mellitus DMR facilitates a novel diagnostic test but reveals no methylation anomalies in patients of unknown aetiology. Hum Genet. 2005;116:255-61 Manipalviratn S et al. Imprinting disorders and assisted reproductive technology. Fertil Steril. 2009 Feb;91:305-15 McGrath J et al. Completion of mouse embryogenesis requires both the maternal and paternal genomes. Cell 1984; 37:179-83 Moore T et al. Genomic imprinting in mammalian development: a parental tugof-war. Trends Genet 1991;7:45–49 Sasaki H et al. Epigenetic events in mammalian germ-cell development: reprogramming and beyond. Nat Rev Genet. 2008;9:129-40 Surani MA et al. Development of reconstituted mouse eggs suggests imprinting of the genome during gametogenesis. Nature 1984;308:548-50 Links Informationen zu den genannten Erkrankungen finden sich unter: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=OMIM http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php Kontakt Dr. Brigitte Pabst Institut für Humangenetik Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 85 50 E-Mail: [email protected] 75 Medizin und Geschlecht ERBLICHER BRUSTKREBS – AUCH MÄNNER HABEN ES IN SICH VON DR. DOROTHEA GADZICKI Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Etwa eine von zehn Frauen erkrankt irgendwann in ihrem Leben an Brustkrebs. Diese Erkrankung kann zufällig, das heißt, sporadisch auftreten, ist aber in wenigen Fällen auch erblich bedingt. Man geht heute davon aus, dass etwa 5 bis 10 % aller Brustkrebserkrankungen erblich bedingt sind. Daneben sind auch etwa 10 % der Eierstockkrebserkrankungen genetisch bedingt. Dies bedeutet nicht, dass man die Krebserkrankung selbst erbt, sondern lediglich eine Veranlagung hierfür; das heißt man erbt Erbinformationen, die mit einem im Vergleich zur Normalbevölkerung erhöhten Erkrankungsrisiko für Brust- und/oder Eierstockkrebs einhergehen. Bislang sind zwei Gene bekannt, die für die Entstehung von erblichem Brustund/oder Eierstockkrebs verantwortlich sind: BRCA1 und BRCA2. Falls eine Frau eine Veränderung (Mutation) im BRCA1- oder BRCA2-Gen geerbt hat, hat sie nach jetzigem Wissen ein Risiko von bis zu 85 % irgendwann im Laufe ihres Leben an Brustkrebs zu erkranken. Dies bedeutet, dass nicht wie in der übrigen Bevölkerung von 100 Frauen bis zu 10 Frauen, sondern von 100 Frauen mit einer BRCA1- oder BRCA2-Mutation bis zu 85 Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkranken. Im Gegensatz zu dem Bevölkerungsrisiko von 1 bis 2 % an Eierstockkrebs zu erkranken, ist das Risiko für Eierstockkrebs bei Trägerinnen einer BRCA-Mutation deutlich erhöht. Bei BRCA1-Mutationen wird es mit bis zu 60 % und bei BRCA2-Mutationsträgerinnen mit bis zu 40 % angegeben. Zudem ist zu beachten, dass auch bereits an Brust- und/oder Eierstockkrebs erkrankte Trägerinnen von Genmutationen in BRCA1 oder BRCA2, ein erhöhtes Risiko haben, eine zweite Krebserkrankung zu bekommen. Neben den aktuell bekannten, mit erblichem Brust- und Eierstockkrebs assoziierten Genen kann in etwa 50 % der offenbar erblichen Fälle kein verantwortliches Gen identifiziert werden. Möglicherweise handelt es sich hierbei um Veränderungen in bislang nicht bekannten Genen oder um komplexe Mechanismen, an denen andere Gene beteiligt sind. In Familien mit der erblichen Form des Brust- oder Eierstockkrebses treten gehäuft auch andere so genannte assoziierte Tumoren auf. Das Risiko für Magen- und Darmkrebs, Gallenwegs- und Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie 76 Medizin und Geschlecht Hautkrebs scheint im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung etwas erhöht zu sein. Für Frauen besteht darüber hinaus ein leicht erhöhtes Risiko für Gebärmutter- und Gebärmutterhalskrebs. Männer haben zudem ein erhöhtes Erkrankungsrisiko für früh auftretenden Prostatakrebs und können ebenfalls an Brustkrebs erkranken. Das Risiko für Männer, die eine BRCA2-Mutation tragen, im Laufe des Lebens an Brustkrebs zu erkranken, ist vergleichbar mit dem Brustkrebserkrankungsrisiko von Frauen aus der Normalbevölkerung: etwa 10 %. Männer mit einer BRCA1-Mutation erkranken im Vergleich seltener. Weibliche und männliche Träger einer Mutation, egal ob sie selbst erkrankt sind oder nicht, können die Mutation an ihre Nachkommen weitergeben. Träger einer Mutation haben jeweils eine veränderte und eine normale Erbanlage. Sie geben nach dem Zufallsprinzip entweder die veränderte oder die normale Erbanlage an ihre Kinder weiter. Somit hat jedes Kind jeweils ein Risiko von 50 %, die veränderte Anlage zu erben. Die Mutation kann somit sowohl von der Mutter als auch vom Vater ererbt werden. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig zielgerichtete Therapien zur Behandlung BRCA-assoziierter Tumoren verfügbar sein werden. Erste klinische Studien hierzu, z.B. mit PARP-Inhibitoren laufen derzeit. Daher ist es zunehmend wichtiger, bereits zum Zeitpunkt der Brustkrebs-Diagnosestellung den BRCA-Mutationsstatus zu kennen. Bei auffälliger Familiengeschichte hinsichtlich Brust- und Eierstockkrebs wird Frauen eine molekulargenetische Analyse der Gene BRCA1 und BRCA2 angeboten. Es wird angenommen, dass 50 % der aufgrund einer BRCA-Mutation erkrankten Frauen mit diesem Vorgehen nicht als Mutationsträgerinnen identifiziert werden. Der Grund hierfür sind scheinbar unauffällige Stammbäume aufgrund kleiner Familien oder aufgrund der Vererbung über die väterliche Linie. Es bleibt daher die Herausforderung der Zukunft, a) Männer aus Familien mit erblichen Brustkrebs über ihr eigenes Erkrankungsrisiko zu informieren und b) auf scheinbar unauffällige Stammbäume von Familien, in welchen die Erkrankung über die väterliche Linie vererbt wird, zu achten. Literatur Bryant H et al. Specific killing of BRCA2-deficient tumours with inhibitors of poly(ADP-ribose) polymerase. Nature 2005;434:913-17 Farmer H et al. Targeting the DNA repair defect in BRCA mutant cells as a therapeutic strategy. Nature 2005;434:917-21 Foulkes WD. Inherited susceptibility to common cancers. N Engl J Med 2008;359:2143-53 77 Medizin und Geschlecht King MC et al. Breast and ovarian cancer risks due to inherited mutations in BRCA1 and BRCA2. Science 2003;302:643-46 Liede A et al. Cancer risk for male carriers of germline mutations in BRCA1 or BRCA2: a review of the literature. J Clin Oncol 2004;22:735-42 Narod SA et al. BRCA1 and BRCA2: 1994 and beyond. Nature Rev Cancer 2004;4:665-76 Tai YC et al. Breast cancer risk among male BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst 2007;99:1811-14 Venkitaraman AR. A growing network of cancer-susceptibility genes. N Engl J Med 2003;348:1917-19 Kontakt Dr. Dorothea Gadzicki Institut für Zell- und Molekularpathologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 94 32 E-Mail: [email protected] 78 Medizin und Geschlecht 79 Medizin und Geschlecht NEUROLOGIE 24. APRIL 2009 80 Medizin und Geschlecht 81 Medizin und Geschlecht GESCHLECHT IM HIRNBILD – K(L)EINE UNTERSCHIEDE VON PROFESSORIN DR. BRITTA SCHINZEL Während im Kontext der Krankenversorgung, also etwa der Klinik und der Pharmakologie die bisher meist zugunsten männlicher Probanden und Kranken vernachlässigte Unterscheidung nach Geschlecht ein wichtiges Desiderat ist, stellt sich die Frage nach der Geschlechterdifferenz für Fragen des Verhaltens, der Intelligenz oder der Emotionen deutlich anders dar. Hier sind die Einflüsse der Sozialisation und der individuellen Erfahrungen, auch auf die physischen Erscheinungsformen im Gehirn, erheblich größer, weshalb eine feste Zuordnung von Geist oder Gefühlen nach Geschlecht äußerst problematisch wird. Tatsächlich sollten Sozialisationsdaten für klinische und pharmakologische Forschung ebenfalls viel mehr Berücksichtigung finden als diese in der Regel in den medizinischen Standardfragebögen erhoben werden, denn ihr Körper lässt sich nicht so sauber von den soziokulturellen Einflüssen auf eine Person trennen. In der naturwissenschaftlichen medizinischen Forschung geht die Richtung von Forschung und Interpretationen der Ergebnisse vom Körper zum Geist, vom Gen zum Verhalten. Die geschlechterspezifischen Untersuchungen in Medizin, Naturwissenschaften (und Technik) hingegen integriert auch geistes- und sozialwissenschaftliche Ansätze in ihre Forschungen, und sie verhilft so auch der anderen Richtung mit zu ihrem Recht. Dies entspringt der Beobachtung, dass auch „objektive“ naturwissenschaftliche Forschung kontingente Ziele verfolgt und in sie kontingente epistemologische Annahmen, Forschungsprozesse und Interpretationen der Ergebnisse einfließen, die aktuellen Epistemen und Schulen folgen und den Forschenden oft nicht bewusst sind. Insbesondere versuchen sie auch Annahmen über dichotome Geschlechter und Geschlechterdifferenzen zu „dekonstruieren“, u. a. um Hierarchien zwischen den Geschlechtern zu vermeiden. Dies geschieht, indem beispielsweise historische, philosophische oder soziokulturelle Kategorien in die Forschung mit einbezogen werden und indem die Konstruktionsprozesse wissenschaftlicher Ergebnisse, auch der ihnen verhelfenden technischen Geräte, genauer beobachtet werden. Hier hat das – heute technisch konstruierte – Bild als Wissen vermittelndes Medium gerade auch in der Medizin eine große Bedeutung. Die Bereitstellung von suggestiven Bildern und „Visiotypen“ wie Histogrammen, Diagrammen, Grafiken und Bildern erlaubt eine raschere Detektion und erzeugt Evidenz mit einem Blick („ein Bild sagt mehr als tausend Worte“). Sie hat auch eine epistemische Wende in der Diagnose von der 82 Medizin und Geschlecht Labormedizin zur Bild-Medizin nach sich gezogen, die nicht nur wissenstheoretisch relevant ist, sondern auch ganz reale Auswirkungen auf die medizinische Praxis und die Patientenversorgung hat. Von besonderer Bedeutung sind seit Erfindung der Röntgenfotografie die Bilder des Körperinneren, denen sich gerade in jüngster Zeit eine Reihe von komplexen Verfahren hinzugesellt hat, von Sonografie über CT (Computertomographie) zu MRT (Magnetresonanztomographie) und für die funktionelle Bildgebung des Gehirns MEG (Magnetoencephalographie) und EEG, PET (positron emission tomography) und SPECT (single photon emission CT), TMS (transcranial magnetic stimulation), MRS (MRI Spektroskopie), NIRS (near infrared spectroscopy) und fMRT (functional magnetic resonance imaging). Diese Bilder sind jedoch nicht bloße Abbilder des – dieses ist und bleibt unsichtbar, sondern durch komplizierte Visualisierungsmethoden konstruierte Artefakte. Visuelle Evidenz wird absichtsvoll erzeugt, indem an die menschliche Kognition und unsere kulturellen Seherfahrungen angeschlossen wird. Bildliche Darstellungen können dann bestimmte wissenschaftliche Theorien herausstellen, andere können nur schlecht ins Bild gesetzt werden. Besonders problematisch werden die Verbildlichungen, wenn situativ bedingte Ergebnisse als objektiv und unverrückbar erscheinen und so als Normen missverstanden werden, die den „gesunden Standardkörper“ oder auch die Abweichung oder Krankheit darstellen. Insonderheit befassen sich die geschlechterspezifischen Untersuchungen mit Darstellungen, die den Mann als Norm und die Frau als Abweichung von der Norm zeigen, aber auch mit solchen, die Geschlechterdifferenzen herausstellen und so Vorstellungen von „natürlichen“ Kompetenzunterschieden begünstigen. Gerade mit durch BOLD fMRT gewonnenen Hirnbildern werden wir inzwischen mit Aktivierungsbildern des Gehirns überflutet, und es gibt neben den Kognitionswissenschaften kaum einen Wissenschaftszweig, der sich nicht dem Präfix Neuro- schmückt, um mit solchen Bildern Argumente zu führen. Neuropädagogik, Neuroökonomie, Neurotheologie, Neuroforensik sind nur einige solcher Neubildungen. Dabei werden auch oft Geschlechtsunterschiede ins Bild gesetzt, wobei jene Untersuchungen, die keine signifikanten Unterschiede zeitigen, erheblich geringere Veröffentlichungschancen haben als solche, die diese feststellen. Es gibt einen publication bias mit Bezug auf die Detektion von Unterschieden ganz allgemein – sie werden für interessanter gehalten ohne Rücksicht darauf, dass für Nichtpublikation die Wiederholungsgefahr derselben Untersuchungen besteht – aber nochmals verstärkt in Bezug auf Geschlechtsunterschiede. 83 Medizin und Geschlecht Insbesondere sind auch in populären Medien Untersuchungen über Geschlechtsunterschiede für Sprachkompetenz und Raumkognition bekannt geworden, wobei Frauen bessere Sprachfähigkeiten und Männern bessere Raumorientierung zugesprochen wurden. Tatsächlich sind auch in den dazu immer wieder zitierten psychologischen Arbeiten die Gesamteffekte sehr gering, die Unterschiede sind in der 30-40jährigen Geschichte solcher Findungen immer kleiner geworden und bezüglich der Sprachkompetenzen ganz verschwunden. Ziel der neurowissenschaftlichen Analyse war es mithin, anatomische und funktionelle Grundlagen im Gehirn zu finden, die zur Erklärung von Sprachleistungen und als Ursache von Geschlechterunterschieden dienen sollten. Das derzeitige Paradigma zur Sprache ist die Lateralitätshypothese, welche anatomisch eine strukturelle kortikale Asymmetrie feststellt, d.h. die beiden Hirnhälften und Kortexareale können unterschiedlich groß sein. Andererseits zeigt sich eine funktionale Lateralität, d.h. die Verarbeitung ist unterschiedlich auf die Hirnhälften aufgeteilt. Folgende Geschlechtsunterschiede werden bezüglich der Lateralität behauptet: bei Mädchen und Frauen sei die Aktivierung im Gehirn gleichmäßiger auf beide Hirnhälften verteilt (Bilateralität), während bei Jungen und Männern die Aktivierung im Gehirn stärker auf die Hirnhälften aufgetrennt erscheine (Lateralität). Gestützt werde die geschlechtsdifferente Lateralitätshypothese durch anatomische Unterschiede, die sich vor allem in dem größeren Corpus Callosum von Frauen zeige. Doch haben sich diese Daten als wenig signifikant herausgestellt. Neuere Paradigmen, insbesondere zur Plastizität des Gehirns, konnten diese Unterschiedsbehauptungen auch als nicht essentiell relativieren, etwa indem die Händigkeit bei der Ausformung der Verbindungswege zwischen den Gehirnhälften (des Corpus Callosum) eine starke Rolle spielt. Zur Stützung der Differenzannahme jedoch wird vor allem in den populären Medien eine Arbeit mittels Hirnaktivierungsbildern von Shaywitz et al. 1995 herangezogen, welche eine fragwürdige Selektion ihrer Findungen für die sprachliche Reimerkennung vornimmt. Bei 19 männlichen Probanden wurde eine stärkere linksseitige Aktivierung im vorderen Hirnlappen vorgefunden, bei 11 von 19 Probandinnen eine ausgeprägte beidseitige Aktivierung, bei 8 von ihnen jedoch nicht. Es wurde aber kein Unterschied in Kompetenz in der gleichen Studie vorgefunden! Trotzdem ziehen Shaywitz et al. 1995 diesen sowohl hinsichtlich der Geschlechterdifferenz als auch der Sprachkompetenzen stark verallgemeinernden Schluss. Hinfort wird diese Studie falsch zitiert, nämlich als Beleg für Beidseitigkeit bei Frauen. 84 Medizin und Geschlecht Eine spätere fMRT-Studie von Julie Frost et al. 1999 stellte keine signifikanten Geschlechtsunterschiede fest. Sie wird aber außerhalb der Genderforschung kaum zitiert. Dabei wurden 50 Männer und 50 Frauen für die semantische Erkennung von Wortkategorien untersucht. Männer und Frauen zeigten sehr ähnliche, stark linksseitige Aktivierungsmuster, jedoch keine signifikanten Unterschiede bezüglich Asymmetrie in keiner der untersuchten Hirnregionen. Um die statistische (In-)Signifikanz zu untermauern, wählten sie überdies zwei zufällig ausgewählte Gruppen von je 50 Personen (die oberen beiden Zeilen) aus und verglichen die Hirnbilder. Die Unterschiede entsprechen denen zwischen Männern und Frauen und sind wieder insignifikant. Sie ziehen den Schluss: „These data argue against substantive differences between men and women in the large-scale neural organization of language processes.“ und “…differences are likely to be small in comparison with the degree of similarity…” Schließlich verglich jüngst Annelis Kaiser zusammen mit der Basler Neuroanatomin Cordula Nitsch die fMRT-Bilder von 50 Probandinnen und Probanden bezüglich ausgewählter Sprachkompetenzen, und sie visualisierten die Aktivierung unter drei verschiedenen medizinisch anerkannten Schwellwerten. Beim größten Schwellwert wurde bei beiden Geschlechtern linksseitige Aktivierung im Broca-Zentrum gefunden, beim mittleren zeigten die Brocazentren der Männer bilaterale Aktivierung, aber nicht die der Frauen, beim schwächsten zeigte sich bei Frauen eine rechtsseitige Aktivierung, bei Männern eine linksseitige. All diese widersprüchlichen Befundlagen zeigen, dass es wohl kaum essentielle Geschlechtsunterschiede im Kontext der Sprachkompetenzen gibt, und Ähnliches wäre auch für die Raumorientierung festzustellen. Vielmehr ist das Gehirn so plastisch, dass die Variationen in Abhängigkeit von Erfahrungen, Beruf, Alter, Kultur etc. nicht nur interindividuell enorm sind, sondern auch intraindividuell. Hier weiß man nicht nur von Altersabhängigkeit, sondern auch von solcher der Hormonexposition etc.. Literatur Frost JA et al. Language processing is strongly left lateralized in both sexes. Evidence from functional MRI. Brain. 1999 Feb;122 (Pt 2):199-208 Shaywitz BA et al. Sex differences in the functional organization of the brain for language. Nature. 1995 Feb 16;373(6515):607-09 85 Medizin und Geschlecht Kontakt Prof’in Dr. Britta Schinzel Institut für Informatik und Gesellschaft Universität Freiburg Friedrichstr. 50 79098 Freiburg Telefon: 0761 / 2 03 49 53 E-Mail: [email protected] 86 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE BEI NEURO-AIDS VON PROFESSORIN DR. GABRIELE ARENDT Einleitung Die HIV-Infektion ist eine Pandemie; weltweit sind knapp über 50 % aller Infizierten Frauen, in Deutschland ca. 22 %. Studien beschreiben, dass HIVpositive Frauen bei niedrigerer Plasmaviruslast und höheren CD4+-Zellzahlen sterben als HIV-positive Männer, außerdem mehr unter den Nebenwirkungen der hochaktiven, antiretroviralen Therapie (HAART) leiden. Es gibt also geschlechterspezifische Unterschiede im Verlauf der systemischen HIVInfektion. Methode Es wurde in einer Auswertung prospektiv erhobener Daten der Düsseldorfer Neuro-AIDS-Datenbank der Frage nachgegangen, ob es solche geschlechterspezifischen Unterschiede auch bei neurologischen Systemmanifestationen der HIV-Infektion gibt. Es wurden die HIV-assoziierte Demenz und ihre Vorstufen, die asymptomatische, HIV-assoziierte, neurokognitive Einschränkung und das milde, HIV-assoziierte, neurokognitive Defizit, denen genaue Definitionen zugrunde liegen, fokussiert und die Daten von 1693 Männern und 253 Frauen ausgewertet, die sich auf die üblichen Hauptbetroffenengruppen, homo- und bisexuelle Männer, heterosexuelle Männer und Frauen, intravenöse Drogen gebrauchende Menschen und Migrantinnen und Migranten verteilten. Ergebnisse Frauen sind bei der Diagnose „HIV-Positivität“ signifikant jünger als Männer, was für Menschen kaukasischen und nicht kaukasischen Ursprungs gilt und mit den obligatorischen HIV-Tests bei Schwangerschaften zusammenhängt. Frauen kaukasischer und nicht-kaukasischer Herkunft entwickeln signifikant häufiger dementive Symptome als Männer, insbesondere bei langer Infektionsdauer. Dies gilt auch in der HAART-Ära, obwohl einigen Studien zufolge Frauen höhere Plasmaspiegel der antiretroviralen Therapie erreichen als Männer. Schlussfolgerung Wie die systemische HIV-Infektion scheint auch Neuro-AIDS bei Frauen anders in Erscheinung zu treten als bei Männern. Die Gründe hierfür müssen erforscht werden. 87 Medizin und Geschlecht Literatur Arendt G et al. Women and Neuro-AIDS Conditions in the Era of HAART. In: The Spectrum of neuro-AIDS Disorders, Pathophysiology, Diagnosis and Treatment, Karl Goodkin, Paul Shapshak, Ashok Verma Eds., ASM Press, 2008 Clark R. Considerations for the antiretroviral management of women in 2008. Womens Health (Lond. Engl.). 2008;4(5):465-77 Kontakt Prof’in Dr. Gabriele Arendt Neurologische Klinik Universitätsklinikum Düsseldorf Moorenstr. 5 40225 Düsseldorf Telefon: 0211 / 8 11 89 81 E-Mail: [email protected] 88 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE BEI NEUROMUSKULÄREN ERKRANKUNGEN VON PROFESSORIN DR. SUSANNE PETRI Das neuromuskuläre System des Menschen lässt sich unterteilen in zentrale und periphere Anteile. Die sog. ersten oder oberen Motoneurone liegen im primärmotorischen Kortex des Gehirnes und sind über die Pyramidenbahn mit den zweiten/unteren Motoneuronen im Vorderhorn des Rückenmarks verbunden. Die Fortsätze der zweiten Motoneurone entspringen als Nervenwurzeln aus dem Rückenmark und werden schließlich zum peripheren Nerven, der über die Synapse (neuromuskuläre Endplatte) mit dem Skelettmuskel verbunden ist. Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist die häufigste Motoneuronerkrankung des Erwachsenenalters und zeichnet sich durch einen Befall sowohl des ersten als auch des zweiten Motoneurons aus. Sie tritt zu 90 % sporadisch, zu 10% familiär auf, mit einer Inzidenz von 1-3 / 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem Altersgipfel zwischen 50 und 65 Jahren. Die mittlere Überlebenszeit beträgt 3-5 Jahre, es existieren keine spezifischen diagnostischen Marker. Die wichtigste Zusatzdiagnostik der ALS liegt in der elektromyographischen Untersuchung. Bisher existiert nur ein einziges Medikament, der Glutamat-Antagonist Riluzol, mit geringfügig krankheitsverzögernder Wirkung. Einige Faktoren sprechen für eine Rolle von Geschlechtshormonen bei der Amyotrophen Lateralsklerose: Männer sind im Verhältnis 1,5:1 häufiger von ALS betroffen, Frauen erkranken seltener und in höherem Lebensalter, in der Regel postmenopausal. Zudem konnte gezeigt werden, dass bei ALSPatientinnen, die Menarche später eintrat und die Menopause früher, d.h., dass die reproduktive Periode signifikant verkürzt war. Aus diesen epidemiologischen Beobachtungen ergab sich die Fragestellung nach der Rolle von Sexualhormonen in der Pathogenese der Erkrankung. Dies wurde in transgenen ALS-Tiermodellen weiter untersucht. In einer Arbeit von Suzuki et al. aus dem Jahre 2007 konnte gezeigt werden, dass weibliche ALS-Ratten einen späteren Krankheitsbeginn und eine verlängerte Überlebenszeit aufweisen. In einem ALS-Mausmodell wurde nachgewiesen, dass die Ovarektomie in weiblichen ALS-Mäusen zu einer signifikanten Akzeleration des Krankheitsverlaufs führt, die Behandlung mit 17-beta Estradiol zu einer Krankheitsverzögerung. Neuroprotektive Effekte von Östrogenen konnten auch in anderen Tiermodellen gezeigt werden, so z.B. in einem Schlaganfall-Modell. Eine auf diesen tierexperimentellen Daten basierende retrospektive Analyse von 89 Medizin und Geschlecht ALS-Patientinnen mit oder ohne postmenopausale Hormonsubstitution zeigte allerdings einen früheren Krankheitsbeginn und höheren Prozentsatz von ALSPatientinnen in der Gruppe mit Östrogensubstitution, hieraus ließ sich also keine Evidenz für neuroprotektive Effekte der Hormontherapie gewinnen. Eine weitere Motoneuronerkrankung, die ausschließlich das zweite/untere Motoneuron betrifft, ist die spinobulbäre Muskelatrophie (Kennedy-Syndrom). Sie ist mit einer Inzidenz von 1-2/100.000 Einwohnerinnen und Einwohner etwas seltener als die ALS und tritt aufgrund des x-chromosomal-rezessiven Erbgangs ausschließlich bei männlichen Patienten auf. Ursache ist eine CAGrepeat expansion im Exon 1 des Androgenrezeptor-Gens. Klinisch äußert sich die Erkrankung in Muskelschwund und Lähmungen sowie einer Vergrößerung der Brust (Gynäkomastie), typischerweise zeigen sich zusätzlich auch Schluckund Sprechstörungen aufgrund einer Degeneration der im Hirnstamm lokalisierten motorischen Kerngebiete. Die repeat-Länge des CAG-repeats korreliert invers mit dem Manifestationsalter der Erkrankung, der Vielfalt und Ausprägung der klinischen Symptome sowie mit dem Ausmaß regionaler Atrophien des Gehirns; die Zusammenhänge sind allerdings noch nicht hinreichend bekannt. Die CAG-repeat Mutation beim Kennedy-Syndrom führt zu einem partiellen Funktionsverlust des Androgenrezeptors und damit zu endokrinologischen Auffälligkeiten (Gynäkomastie, Infertilität mit Oligo-/AzooSpermie). Zusätzlich entsteht ein sog. „Gain of function“, d.h. ein toxischer Funktionsgewinn des mutierten Gens, was zu zellschädigenden Effekten durch intrazelluläre Akkumulation des mutierten Androgenrezeptors und damit zu der für die Erkrankung typischen neurologischen Symptomatik führt. Während man initial dachte, dass die Gabe von Androgenen beim KennedySyndrom therapeutisch wirksam sein könnte, konnte in der Zwischenzeit gezeigt werden, dass Patientinnen und Patienten mit einer kompletten Androgeninsensivität keine neurologische Symptomatik entwickeln, dementsprechend ist die Androgen-Gabe beim Kennedy-Syndrom nicht klinisch wirksam. Weibliche Trägerinnen der Mutation zeigen allenfalls subklinische Manifestationen; als Ursache hierfür wird ein Schutz durch das Fehlen zirkulierender Androgene angenommen. Daraus leitet sich die Evidenz für eine Anti-Testosterontherapie ab. Diese Fragestellung wurde zunächst tierexperimentell bearbeitet. In einem Mausmodell, in dem das humane Androgenrezeptor-Gen mit der entsprechenden Mutation exprimiert wird, und das eine progressive Muskelatrophie entwickelt, führte eine AntiTestosterontherapie mit Leuprorelin (einem Gonatotropin-releasing HormonAntagonisten) zu einer deutlichen klinischen Besserung. In einer daraufhin initiierten klinischen Phase II-Studie kam es innerhalb eines ersten 48 Wochen andauernden Beobachtungszeitraumes nicht zu einer Besserung des 90 Medizin und Geschlecht Gesamtbefundes, jedoch zeigte sich eine Abnahme der Schluckstörungen. Über einen längeren Beobachtungszeitraum von 96 Wochen kam es dann auch zu einer Verbesserung weiterer funktioneller Parameter. Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass Sexualhormone eine Rolle bei Motoneuronerkrankungen spielen. Die neuroprotektive Wirkung von Östrogenen wurde bei der ALS nur im Tiermodell hinreichend belegt. Bei der spinobulbären Muskelatrophie scheint eine androgene Therapie wirksam und verträglich zu sein, Langzeitbeobachtungen hierzu stehen jedoch noch aus. Literatur Suzuki M et al. Amyotroph Lateral Scler. 2007 Feb;8(1):20-25 Kontakt Prof’in Dr. Susanne Petri Klinik für Neurologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 37 40 E-Mail: [email protected] 91 Medizin und Geschlecht EPILEPSIE BEI FRAUEN – EINE BESONDERE SITUATION VON DR. CLAUDIA WENZEL Die Betreuung und medikamentöse Behandlung an Epilepsie erkrankter Frauen umfasst zahlreiche relevante geschlechterspezifische Aspekte wie beispielsweise die hormonelle Beeinflussung der Anfallsfrequenz, Interaktionen zwischen antiepileptisch wirksamen Medikamenten (AED) und oralen Kontrazeptiva, Effekte der AED auf den Knochenstoffwechsel, endokrine Regulationsstörungen sowie besondere Aspekte der Schwangerschaft und Stillzeit. Die Modifikation der Anfallshäufigkeit durch die zyklusabhängig sezernierten Östrogene und Gestagene ist gut untersucht. Diese beeinflussen die neuronale Erregbarkeit in unterschiedlicher Weise: Während Östradiol zu einer Zunahme der neuronalen Erregbarkeit in epileptogenen Herden führt und somit prokonvulsive Effekte hat, bewirkt Progesteron eine Reduktion der neuronalen Entladungsrate in epileptischen Arealen, woraus eine antikonvulsive Wirkung resultiert. Ein relatives Überwiegen der Östradiolwirkung fördert somit die Manifestation epileptischer Anfälle periovulatorisch oder perimenstruell. Vermittelt werden diese gegensätzlichen Effekte über die Beeinflussung der Aktivität relevanter inhibitorischer (GABA) und exzitatorischer (Glutamat) Neurotransmitter. Phasen wesentlicher hormoneller Umstellung wie Menarche, Schwangerschaft und Menopause können die Anfallshäufigkeit entscheidend beeinflussen, auch physiologische Schwankungen der ovariellen Steroidhormone während des Menstruationszyklus haben in allen experimentellen Epilepsie-Modellen zu einer Beeinflussung der Anfallsbereitschaft geführt. Die Wirkung oral eingenommener Kontrazeptiva kann in Kombination mit AED, die auf das hepatische Cytochrom P450-System Enzym induzierend wirken, unter Umständen vermindert sein. Der Pearl-Index wird in dieser Situation mit bis zu 6 % angegeben. AED, die eine Induktion des Cytochrom P450-System und somit einen erhöhten Metabolismus von Vitamin D bewirken, können zudem eine Abnahme der Knochendichte und Störung des Knochenstoffwechsels bewirken, was häufig die Entwicklung einer Osteoporose mit erhöhtem Frakturrisiko zur Folge hat. Eine besondere Gefährdung besteht dabei aufgrund eines ohnehin erhöhten Osteoporoserisikos für Frauen in der Postmenopause. 92 Medizin und Geschlecht Frauen, die an Epilepsie erkrankt sind, haben eine gegenüber gesunden Frauen um 1-2:3 reduzierte Geburtenrate. Dazu tragen zum einen soziale Faktoren (fehlende Partnerschaft, Angst vor Risikoschwangerschaft) bei, zum anderen aber auch endokrine Störungen, die mit dem Auftreten von Anfällen und AED assoziiert sind. So beeinflussen AED, die auf das Cytochrom P450-System modifizierend wirken, gleichzeitig auch den Metabolismus der Sexualhormone. Zudem werden anovulatorische Zyklen, die bei Chronifizierung zu Infertilität führen können, bei mehr als 30 % der Frauen mit Epilepsie beschrieben. Auch das polyzystische Ovariensyndrom (PCOS), das Infertilität zur Folge haben kann, betrifft etwa 10-25 % der Epilepsiepatientinnen7, hingegen liegt die allgemeine Prävalenz bei Frauen im gebärfähigen Alter bei 7-10 %. Klinisch bedeutsam kann die während einer Schwangerschaft veränderte Anfallshäufigkeit, bedingt durch hormonelle Umstellungen, veränderten Metabolismus der AED, veränderte Schlafgewohnheiten und reduzierte Einnahme-Compliance aus Furcht vor teratogenen Effekten, sein. Zahlreiche physiologische Veränderungen während der Schwangerschaft können die Pharmakokinetik und damit die messbare Konzentration von AED beeinflussen. Viele der älteren AED, insbesondere Benzodiazepine, Phenytoin, Carbamazepin und Valproat, besitzen teratogene Effekte. Hinsichtlich der neueren, seit 1993 eingeführten AED liegen noch wenige Erkenntnisse zur Teratogenität vor, die ausführlichsten Daten finden sich zum Einsatz von Lamotrigin. Das Risiko von Malformationen steigt mit der Verwendung mehrerer AED und höherer Dosierungen. Während einer Schwangerschaft sollte eine antiepileptische Monotherapie in der kleinsten wirksamen Dosierung angestrebt werden, die verwendete Substanz sollte dabei die für den jeweiligen Anfallstyp am besten geeignete und verträgliche sein. Derzeit existieren keine allgemeingültigen Empfehlungen zum bevorzugten Einsatz eines bestimmten AED in der Schwangerschaft. AED treten in variablem Ausmaß – u. a. abhängig von der Eiweißbindung und Lipophilie der jeweiligen Substanz – in die Muttermilch über. Epilepsiekranke Frauen sollten die Frage des Stillens ihres Neugeborenen daher sorgfältig überdenken. Allgemein wird jedoch davon ausgegangen, dass die Vorteile des Stillens das relativ kleine Risiko unerwünschter Wirkungen durch AED überwiegen. Fazit Die Berücksichtigung endokriner Störungen sollte Teil einer über die Anfallsbehandlung hinausgehenden modernen antiepileptischen Pharmakotherapie sein; von besonderer Bedeutung ist dabei, die Dokumentation endokriner Funktionen überhaupt in die Beratung und Betreuung der Patientin 93 Medizin und Geschlecht zu integrieren. Eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Neurologen, Gynäkologen und Endokrinologen trägt dazu bei, Epilepsien in ihrer komplexen Gesamtheit wahrzunehmen und die Behandlung nicht allein antikonvulsiv auszurichten. Literatur Finn DA et al. The estrous cycle, sensitivity to convulsants and the anticonvulsant effect of a neuroactive steroid. J Pharmacol Exp Ther 1994;271:164-70 Herzog AG et al. Reproductive endocrine disorders in women with partial seizures of temporal lobe origin. Arch Neurol 1986;43:341-46 Knochenhauer ES et al. Prevalence of the polycystic syndrome in unselected black and white women of the southeastern United States: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3078-82 Morrell MJ et al. Predictors of ovulatory failure in women with epilepsy. Ann Neurol 2002;52:704-11 Pack AM et al. Treatment of women with epilepsy. Sem Neurol 2002;22(3):28997 Perucca E. Clinical implications of hepatic microsomal enzyme induction by antiepileptic drugs. Pharmacol Ther 1987;33:139-44 Pschirrer E et al. Seizure disorders in pregnancy. Obstet Gynecol Clin 2001;28:601-11 Schmitz B. Lamotrigin bei Frauen mit Epilepsie – Ein Überblick über die Datenlage. Der Nervenarzt 2003; online publiziert 23.07.03 Schupf N et al. Likelihood of pregnancy in individuals with idiopathic/cryptogenic epilepsy: social and biological influence. Epilepsia 1994;35:750-56 Woolley CS et al. Hormonal effects on the brain. Epilepsia 1998;39(Suppl.8):28 Kontakt Dr. Claudia Wenzel Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str.1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 35 15 E-Mail: [email protected] 94 Medizin und Geschlecht 95 Medizin und Geschlecht HÄMATOLOGIE 25. SEPTEMBER 2009 96 Medizin und Geschlecht 97 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE BEI GERINNUNGSERKRANKUNGENAUSWIRKUNGEN VON GERINNUNGSSTÖRUNGEN BEI FRAUEN VON DR. ROSWITH EISERT Aufgrund ihrer sich monatlich wiederholenden physiologischen (Perioden-) Blutung können Gerinnungsstörungen bei Frauen häufig mit Beginn der Geschlechtsreife erkannt und nachgewiesen werden. Trotzdem wird die Diagnose immer wieder spät oder gar nicht gestellt. Eines der ältesten Beispiele einer hämorrhagischen Diathese bei Frauen findet sich im Neuen Testament, Markus 4:25-29. Die häufigsten Ursachen einer hämorrhagischen Diathese stellen dabei die unterschiedlichen Arten und Schweregrade des vonWillebrand-Syndroms dar neben deutlich selteneren Thrombopathien und anderen plasmatischen Mangelzuständen. Die Therapiemöglichkeiten sind vielfältig und oft erfolgreich durch Gabe von Kontrazeptiva, Fibrinolysehemmer, Vasopressin-Analoga in Form von Nasenspray und seltenste Gabe von Faktorenpräparaten. Da eine Anämie eine Blutungsneigung unterhält, ist eine Eisensubstitution meist intermittierend oder dauerhaft notwendig. Auf der anderen Seite stellt eine (hereditäre) Thromboseneigung eine potenzielle z. T. lebensbedrohliche Gefährdung dar. Sie entwickelt sich meist aus einer Kombination aus u. a. Übergewicht, Bewegungsmangel, Nikotinkonsum, Exsikkose und Einnahme eines Kontrazeptivums. In diesem Zusammenhang stellt die Schwangerschaft und hier insbesondere die 6-wöchige postpartale Zeitspanne ein besonders hohes Risiko für Thrombosen und Lungenembolien dar. Hier gilt es zusätzliche exoge Risiken zu vermeiden und durch physikalische Maßnahmen wie Bewegung, Kompressionsstrümpfe, Hydratation, ausgewogene Ernährung mit ggfs. Einnahme von Vitaminpräparaten die Gefäßund Gefäßwandsituation zu stabilisieren und in Abhängigkeit aller Risiken auch eine gerinnungshemmende Medikation mit niedermolekularen Heparinen einzusetzen. 98 Medizin und Geschlecht Kontakt Dr. Roswith Eisert Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Stammzelltransplantation Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 41 47 E-Mail: [email protected] Onkologie und 99 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE IN HÄMATOLOGISCHER TOXIZITÄT UND GESAMTÜBERLEBEN BEI PATIENTINNEN UND PATIENTEN MIT HODGKIN LYMPHOM UND ANDEREN NEOPLASIEN VON DR. BEATE KLIMM Aufgrund neuer Therapiestrategien und zunehmend besserer Prognose bei Patientinnen und Patienten mit Hodgkin Lymphomen, fokussiert sich das wissenschaftliche Interesse insbesondere auf Hochrisikogruppen. Trotz beachtlicher Forschungserfolge, moderner stadienangepasster Chemotherapie und besserer Strahlentherapietechniken bleibt eine kleine Gruppe von Patientinnen und Patienten, die auch unter aktuellen Therapiestandards eine rezidivierende oder eine primär therapierefraktäre Erkrankung aufweisen. Bis heute gibt es trotz intensiver Forschung keine verlässlichen biologischen Parameter, die entweder Therapieversager oder aber eine erhöhte Toxizität unter Chemotherapie vorhersagen können, um auf diese Weise eine an das individuelle Risikoprofil angepasste Therapieintensivierung oder -reduktion zu ermöglichen. Des Weiteren sind Einfluss und Bedeutung individueller patientenbezogener Faktoren wie Geschlecht, Polymorphismen in CytochromEnzymen der Leber, Metabolismus und Substanzeliminierung nur unzureichend charakterisiert. Das Spektrum maligner Erkrankungen von Männern und Frauen ist unterschiedlich. Jedoch weisen auch männliche und weibliche Patienten mit der gleichen Erkrankung oftmals ein unterschiedliches Gesamtüberleben auf. Studienergebnisse bei Patientinnen und Patienten mit Hodgkin Lymphom und mit anderen Malignomen beschreiben ein besseres Gesamtüberleben weiblicher im Vergleich zu männlichen Krebspatienten. Eine retrospektive Analyse der Deutschen Hodgkin Studiengruppe (GHSG), die 4626 Patientinnen und Patienten mit Hodgkin Lymphom einschloss, war die erste größere Analyse, die systematisch geschlechterspezifische Unterschiede und deren Einfluss auf die Therapie und das Überleben untersuchte. Nach fünf Jahren zeigten weibliche im Vergleich zu männlichen Patienten ein signifikant besseres ereignisfreies Überleben (81 % vs. 74 %, P<.0001) und Gesamtüberleben (90 % vs. 86 %; P<.0001). Bei Frauen wurde mehr Chemotherapie assoziierte hämatologische Toxizität beobachtet, insbesondere eine hochgradige Leukopenie (WHO Grad 3 und 4). Dies korrelierte mit besserem Überleben. Die hochgradige Leukopenie 100 Medizin und Geschlecht ging nicht mit einer erhöhten Rate an schweren Infektionen einher. Des Weiteren zeigte sich geschlechtsunabhängig, dass alle Patientinnen und Patienten, die zu Beginn oder zu irgendeinem Zeitpunkt der Therapie eine hochgradige Leukopenie aufweisen hatten, ein besseres outcome hatten. Auch bei fortgeschrittenen soliden Tumoren wie nichtkleinzelliges und kleinzelliges Bronchialkarzinom wurden inzwischen ähnliche Ergebnisse berichtet. Bis vor kurzem gab es kaum Daten über die geschlechterspezifische Pharmakokinetik und Pharmakodynamik der Zytostatika, da deutlich mehr Männer als Frauen in klinische Studien eingeschlossen wurden und da die Ergebnisse oftmals nicht nach Geschlechtern getrennt veröffentlicht wurden. Diese Art der Veröffentlichung ändert sich jedoch allmählich, so dass geschlechterspezifische Überlebensdaten zunehmen. Dies könnte dabei helfen, in Zukunft adäquatere Methoden für die Dosierung von Zytostatika zu entwickeln, als die derzeit übliche Praxis, die sich rein auf die Schätzung der Körperoberfläche bezieht. Ein unterschiedlicher Enzymstatus mit einem langsameren SubstanzEliminationsweg bei Frauen kann also nicht nur zu einer erhöhten systemischen Toxizität sondern auch zu einer besseren Effektivität der Chemotherapie führen. Cytochrom (CYP)-P450-Enzyme der Leber sind an der Metabolisierung vieler Substanzen beteiligt. Bei diesen CYP-Enzymen existieren genetische Polymorphismen, die signifikante Veränderungen der metabolischen Aktivität verursachen und bedeutenden Einfluss auf die Variabilität der menschlichen Pharmakokinetik haben. Dies bedingt zum Teil die intra-individuellen Unterschiede in der Toxizität, in der Substanzinteraktion und im Therapieansprechen. Die Expression und die Aktivität dieser Enzympolymorphismen wird durch Faktoren wie Geschlecht, Rauchen, Steroidhormone und parallele Applikation anderer Substanzen beeinflusst. Die komplexen Mechanismen dieser CYP Enzyme sind bislang noch unzureichend untersucht; allerdings werden oftmals alters- und geschlechtsbezogene Unterschiede der Enzymexpression gefunden. Die Implementierung geschlechterspezifischer und an die hämatologische Toxizität angepasster Therapiestrategien, die auf der individuellen Pharmakokinetik basieren, könnte sowohl zu besser vorhersehbarer Toxizität als auch zu besserem Gesamtüberleben in zukünftigen klinischen Studien beitragen. 101 Medizin und Geschlecht Kontakt Dr. Beate Klimm Klinik für Innere Medizin I Hämatologie / Onkologie Universitätsklinikum Köln Kerpener Str. 62 50924 Köln Telefon: 0221 / 4 78 35 57 E-Mail: [email protected] 102 Medizin und Geschlecht 103 Medizin und Geschlecht PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 23. OKTOBER 2009 104 Medizin und Geschlecht 105 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE IN DER TOXIZITÄT VON ARZNEIMITTELN AM BEISPIEL VON PSYCHOPHARMAKA VON DR. KATHARINA WENZEL-SEIFERT Obwohl die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) 1993 in einer neuen Richtlinie zur Durchführung klinischer Arzneimittelzulassungsstudien „Guideline for the Study and Evaluation of Gender Differences in Clinical Evaluation of Drugs“ forderte, dass Frauen und Männer in allen Phasen der klinischen Prüfung neuer Arzneistoffe in gleicher Häufigkeit repräsentiert sein sollten, betrug der Anteil von Frauen in der frühen Phase I, die für die Ermittlung pharmakokinetischer Daten wichtig ist, in den Jahren 1995 bis 2007 nur ca. 25 %. Erst in den Phasen II und III lassen sich adäquate Anteile beider Geschlechter nachweisen. Studiert man die Ergebnisse geschlechtssensibler klinischer Zulassungsstudien, so wurden in den letzten Jahren zwar zunehmend geschlechtsabhängige pharmakokinetische Unterschiede beschrieben. Diese Erkenntnisse schlugen sich jedoch kaum in geschlechtsdifferenzierenden Dosierungsempfehlungen in den Fachinformationen zu den Arzneimitteln wieder. Am Beispiel der Psychopharmaka soll untersucht werden, ob geschlechtsabhängige pharmakokinetische Unterschiede bestehen und inwieweit diese klinische Konsequenzen haben. In der Datenbank der Arbeitsgemeinschaft Arzneimitteltherapie bei psychiatrischen Erkrankungen (AGATE), einem freiwilligen Pharmakovigilanzverbund aller psychiatrischen Versorgungskrankenhäuser in Bayern, betrafen im Zeitraum 1995-2009 ca. 60 % aller gemeldeten schweren unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen (UAW) unter Psychopharmakotherapie Frauen. Bei genauerer Aufschlüsselung typischer antipsychotikainduzierter UAW wie extrapyramidal-motorischen Störungen, kardialen Rhythmusstörungen, Hemmung der Hämatopoese und allergische Hauterscheinungen sind Frauen ebenfalls deutlich überrepräsentiert. Lediglich epileptische Krampfanfälle und Leberfunktionsstörungen werden für beide Geschlechter gleich häufig gemeldet. Diese Daten stimmen mit der Literatur überein, in der darüber hinaus berichtet wird, dass die für einige der neueren Antipsychotika typische erhebliche Gewichtszunahme Frauen ebenfalls häufiger betrifft als Männer. Da unerwünschte Nebenwirkungen häufig dosisabhängig sind, liegt es nahe zu untersuchen, ob Frauen häufiger überdosiert werden als Männer. Zur Klärung 106 Medizin und Geschlecht dieser Frage wurde die Datenbank von Plasmakonzentrationsbestimmungen im Rahmen therapeutischen Drug Monitorings (TDM) des Institutes für Klinische Pharmakologie der Universität Regensburg ausgewertet. Hierbei fand sich, dass Frauen bei Therapie mit einer Vielzahl von Antipsychotika und Antidepressiva häufiger als Männer Wirkstoffkonzentrationen oberhalb des therapeutischen Referenzbereiches aufweisen. Bezieht man diese Werte auf die Plasmakonzentrationen, die rechnerisch unter Berücksichtigung der ClearanceKonstanten dieser Arzneistoffe und der verabreichten Dosierung ermittelt werden können, ergibt sich, dass insbesondere diese dosisabhängigen Werte bei Frauen häufiger überschritten werden. Das heißt, die Dosierungsempfehlungen der Fachinformationen, die auf diesen aus den frühen pharmakokinetrischen Untersuchungen der klinischen Zulassungsstudien stammenden ClearanceKonstanten basieren, sind für häufig schwer kranke und multimorbide Patientinnen nicht gültig und müssten in Nachzulassungsstudien überarbeitet werden. Was führt zur unterschiedlichen Pharmakokinetik vieler Arzneistoffe bei Männern und Frauen? Die Pharmakokinetik eines Arzneistoffes hängt vor allem von der Resorption aus dem Magen-Darm-Trakt, über die Haut oder die Lunge, der Verteilung im Körper und vom Metabolismus in der Leber sowie der renalen Elimination ab. Im Durchschnitt haben Frauen ein niedrigeres Körpergewicht, ein geringeres Plasmavolumen und einen höheren Fettanteil als Männer. Auf Grund dieser Unterschiede sollte insbesondere die Dosierung von Pharmaka mit enger therapeutischer Breite an das Körpergewicht angepasst werden. Auch beim hepatischen Metabolismus gibt es geschlechtsabhängige Unterschiede. Die Aktivität der für den Metabolismus vieler Pharmaka wichtigen CytochromP450-Isoformen CYP1A2 und CYP2D6 ist bei Frauen moderat niedriger als bei Männern. Die Aktivität von CYP2C19 wird deutlich durch Ethinylestradiol, einem Bestandteil oraler Antikonzeptiva, gehemmt. Daraus können überhöhte Plasmakonzentrationen der betroffenen Arzneistoffe resultieren. Auch die glomeruläre Filtrationsrate ist bei Frauen durchschnittlich um 10 % niedriger als bei Männern. Hinzu kommt eine bei beiden Geschlechtern zu berücksichtigende Altersabhängigkeit der Nierenfunktion. Schlussfolgerungen 1. Die pharmakokinetischen Daten und Dosierungsempfehlungen von Arzneimitteln sollten in Nachzulassungsstudien Phase IV überprüft werden. 2. Für die Untersuchung geschlechtsabhängiger UAW und Pharmakokinetik stellen effektiv arbeitende Pharmakovigilanzsysteme sowie die Auswertung von TDM-Daten wertvolle Hilfsmittel dar und sollten daher weiter ausgebaut werden. 107 Medizin und Geschlecht 3. Bei der Pharmakotherapie mit Substanzen mit hohem Risiko für das Auftreten schwerwiegender Nebenwirkungen, wie den Antipsychotika, sollte geschlechtsabhängig dosiert werden. Solange keine geschlechtsdifferenzierenden Dosierungsempfehlungen der Hersteller vorliegen, sollte die Plasmakonzentration mit Hilfe von TDM überwacht werden. Bei der Dosierung vorwiegend renal eliminierter Pharmaka, sollte die Kreatininclearance mit Hilfe der Schätzformel von Cockroft und Gault berechnet und berücksichtigt werden. Literatur Aichborn W et al. Neuere Antipsychotika. Unterschiede im Nebenwirkungsprofil bei Männern und Frauen. Nervenarzt 2007;78:45-52 Anderson GD. Sex and racial diffences in pharmacological response: Where is he evidence? Pharmacogenetics, pharmacokinetics, and pharmacodynamics. J Women’s Health 2005;14(1):19-29 Chue P. Gender differences in psychopharmacology. In: Principles of Gender Specific Medicine, M.J. Legato (Hrsg.). Amsterdam 2004;145-54 Gandhi M et al. Sex differences in pharmacokinetics and pharmacodynamics Annu Rev Pharmacol Toxicol 2004;44:499-523 Garber E. Sex-related differences in pharmacokinetics and drug effects, in Geschlechterforschung in der Medizin, V.Regitz-Zagrosek and J. Fuchs (Hrsg.). Frankfurt. 2006;49-67 Goodnick PJ et al. Women’s issus in mood disorders. Exp Opin Pharmacother 2000;1(5):903-16 Gorman JM. Gender differences in depression and response to psychotropic medication. Gender Medicine 2006;3(2):93-109 Haack S et al. Sex-specific differences in side effects of psychotropic drugs: genes or gender? Pharmacogemics 2009;10(9):1511-26 Haefeli WE. Dosisanpassung bei Niereninsufffizienz. Heidelberg 2009. http:www.dosing.de/index.htm (Zugriff 16.11.2009) Hreich R et al. Drug-induced long QT-syndrome in women: Review of current evidence and remaining gaps. Gender Medicine 2008;5(2):124-35 Seeman MV. Gender Differences in the prescribing of antipsychotic drugs, Am J Psychiatry 2004;161(8):1324-33 Thürmann PA. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Pharmakotherapie. In: Gender Medizin. Geschlechtsspezifische Aspekte für die klinische Praxis A. Rieder und B. Lohff (Hrsg.). Wien 2008;32-47 108 Medizin und Geschlecht Kontakt Dr. Katharina Wenzel-Seifert Klinische Pharmakologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Straße 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 29 14 E-Mail: [email protected] 109 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE IN DER WIRKUNG VON PDE5 INHIBITOREN BEI “MALE ERECTILE DYSFUNKTION (ED) & FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION (FSD)” VON DR. PETER SANDNER Der NO/cGMP/PKG Signaltransduktionsweg stellt einen sehr wichtigen Signalweg dar, der über Zellen, Gewebe und Organe hinweg konserviert ist. Diese Signaltransduktionskaskade beginnt mit der Bildung und Freisetzung von extrazellulärem Stickstoffmonoxid (NO), verläuft weiter über die NO-induzierte Aktivierung der löslichen Guanylatcyclase (sGC) und der Bildung von cyclischem Guanosin-Monophosphat (cGMP). Intrazelluläres cGMP reguliert die Aktivität der Proteinkinase G (PKG), welche verschiedene Zielmoleküle durch Phosphorylierung beeinflusst. Dieser Signalweg wird über die Spaltung von aktivem cGMP in inaktives GMP durch die Phosphodiesterase 5 (PDE5) abgeschaltet. Inhibitoren der PDE5 stellen daher eine effektive pharmakologische Intervention zur Verstärkung des NO/cGMP Weges dar. Dies führte zur Zulassung von PDE5 Inhibitoren (PDE5i) für die Behandlung von Erektiler Dysfunktion (ED) und Pulmonal-Arterieller Hypertonie (PAH). PDE5 wird in männlichen Genitalorganen exprimiert, und PDE5i zeigten sich in isolierten Organbadassays in männlichem Schwellkörpergewebe wie auch in Tiermodellen in verschiedenen Spezies als funktionell wirksam. Diese Ergebnisse konnten in den klinischen Studien in Patienten mit ED bestätigt und erweitert werden, was zur Zulassung der PDE5i Sildenafil (Viagra®), Vardenafil (Levitra®) und Tadalafil (Cialis®) zur Behandlung von männlicher ED führte. PDE5 wird ebenfalls in weiblichen Sexualorganen exprimiert und PDE5i relaxieren in isolierten Organbadassays weibliches Vaginal- und Clitoralgewebe. Da zudem in weiblichen Tieren eine Erhöhung des genitalen Blutflusses gezeigt wurde, sollten klinische Studien eine Wirksamkeit von PDE5i bei weiblicher sexueller Dysfunktion (FSD) belegen. Diese Studien waren z. T. bei objektivmessbaren Parametern (z.B. Dopplermessungen des genitalen Blutflusses) positiv, zeigten aber kaum Effekte auf subjektive Parameter von FSD. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass PDE5 in männlichen und weiblichen Genitalorganen exprimiert wird, dass cGMP Erhöhung durch PDE5i zu einer geschlechterunabhängigen genitalen Gefäßrelaxation und 110 Medizin und Geschlecht Durchblutungssteigerung führt, dass allerdings eine Wirksamkeit bei weiblichen FSD Patienten – im Gegensatz zu männlichen ED Patienten – nicht gefunden werden konnte. Diese Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit einer geschlechterspezifischen Pharmakotherapie für ED und FSD sowie einer interdisziplinären Vorgehensweise bei Therapieansätzen für FSD. Kontakt Dr. Peter Sandner Pharmaforschungszentrum Wuppertal Bayer Schering Pharma AG Aprather Weg 18a 42096 Wuppertal Telefon: 0202 / 36 55 27 E-Mail: [email protected] 111 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE IN DER PHARMAKOLOGIE KARDIOVASKULÄRER ERKRANKUNGEN VON DR. SABINE OERTELT-PRIGIONE Frauen und Männern unterscheiden sich im Bedarf und Stoffwechsel von Arzneimitteln. Unterschiede betreffen sowohl Körpergröße, als auch Körperfettanteil und Nierenfunktion. Der Arzneimittelstoffwechsel unterscheidet sich in der Verdauung im Magentrakt, im Lebermetabolismus durch wesentliche Unterschiede der Aktivität der Enzyme der Cytochrom-P450Familie und schließlich in der Nierenexkretion. Im kardiovaskulären Bereich, finden sich Geschlechterunterschiede nach Gabe von Digitalis, das bei Frauen leichter überdosiert wird, Beta-Blockern, bei denen bei Frauen leichter höhere Plasmaspiegel auftreten, und ACE-Hemmern, die bei Frauen zu mehr Nebenwirkungen führen. Acetylsalicylsäure wirkt bei Frauen in der Primärphrophylaxe des Schlaganfalls, aber nicht in der des Myokardinfarkts, bei Männern ist es umgekehrt. Antikoagulanzien und Gerinnungshemmer führen bei Frauen häufiger zu Blutungskomplikationen, QT-Zeit verlängernde Pharmaka häufiger zu Arrhythmien. All diese Unterschiede müssen bei der Wahl der adäquaten Therapie berücksichtigt werden und sollten die Basis für die Erstellung geschlechterspezifischer kardiologischer Leitlinien darstellen. Literatur Anderson GD. Gender differences in pharmacological response. Int Rev Neurobiol. 2008;83:1-10. Review Lehmkuhl E et al. Implications of gender-specific aspects in the therapy of cardiovascular diseases. Ther Umsch. 2007 Jun;64(6):311-17. Review Oertelt-Prigione S et al. Gender Aspects in Cardiovascular Pharmacology. J Cardiovasc Transl Res. 2009 Sep;2(3):258-66 Regitz-Zagrosek V. Therapeutic implications of the gender-specific aspects of cardiovascular disease. Nat Rev Drug Discov. 2006 May;5(5):425-38. Review Schwartz JB. Gender-specific implications for cardiovascular medication use in the elderly optimizing therapy for older women. Cardiol Rev. 2003 SepOct;11(5):275-98. Review 112 Medizin und Geschlecht Kontakt Dr. Sabine Oertelt-Prigione Institut für Geschlechterforschung in der Medizin Charité Universitätsmedizin Berlin Luisenstraße 65 10117 Berlin Telefon: 030 / 4 50 53 91 09 E-Mail: [email protected] 113 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE IN DER KREISLAUFREGULATION VON PD DR. KARSTEN HEUSSER Mit zunehmendem Alter steigt das kardiovaskuläre Risiko bei beiden Geschlechtern. Eine zentrale Rolle hierbei spielen Hypertonie, Dyslipidämie, Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht und Diabetes mellitus. Obwohl Frauen in jüngeren und mittleren Jahren weniger gefährdet sind als Männer, verschiebt sich diese Relation in höherem Alter Nach den Mechanismen für diese Entwicklung wurde und wird geforscht. Es bestand die Hoffnung, dass sich eine Hormonersatztherapie bei Frauen in der Menopause günstig auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkt. Leider hat sich diese Hypothese als falsch herausgestellt. Andere Faktoren, wie die Funktion des sympathischen Nervensystems, sind in der Diskussion. Die ursprüngliche Auffassung, dass das sympathische Nervensystem lediglich eine Rolle in der Kurzzeit-Regulation des Kreislaufs spielt, ist revidiert worden. Nicht zuletzt die verbesserten Methoden der Quantifizierung sympathischer Aktivität trugen zu dieser neuen Sicht bei. Eine dieser Methoden, die sog. Mikroneurografie, ermöglicht es, sympathische vasokonstriktorische Aktivität zum Skelettmuskel (MSNA) am wachen Menschen direkt zu messen. Dazu wird eine spezielle Nadelelektrode in einen peripheren Nerven eingestochen und in einem Bündel sympathischer Nervenfasern platziert. Die Geschlechtsspezifität der sympathischen Kreislaufsteuerung ist Gegenstand aktueller Forschung. Es konnte gezeigt werden, dass der Zusammenhang zwischen Blutdruck und MSNA bei Frauen stärker ist als bei Männern und dass beide Parameter mit zunehmendem Alter bei Frauen stärker ansteigen. Ferner hat sich herausgestellt, dass einige Annahmen zur autonomen Kreislaufsteuerung, die für Männer gelten, auf Frauen nicht zutreffen. So sind beispielsweise die MSNA und die Auswurfleistung des Herzens bei Frauen nicht assoziiert, darüber hinaus scheint keine Beziehung zwischen MSNA und zentraler Adipositas bei Frauen zu bestehen. Der wichtigste Transmitter, der bei einer Aktivierung des Sympathikus in der Peripherie ausgeschüttet wird, ist Noradrenalin. Seine Wirkung an den Organen wird u. a. dadurch zeitlich begrenzt, dass er von den sympathischen Nervenenden wieder aufgenommen wird. Der hierfür verantwortliche Noradrenalin-Transporter wird von verschiedenen Medikamenten, z.B. einigen 114 Medizin und Geschlecht Psychopharmaka und Medikamenten zur Gewichtsreduktion, gehemmt. Die daraus resultierende Wirkung auf den Blutdruck hängt von der Ausgangsaktivität des Sympathikus ab. Da bei jüngeren Frauen die sympathische Aktivität geringer ist als bei Männern gleichen Alters, unterscheiden sich die Kreislaufwirkungen der Noradrenalin-WiederaufnahmeHemmer zwischen den Geschlechtern. Ein erhöhter Tonus des sympathischen Nervensystems spielt auch bei der Präeklampsie eine Rolle, einer gefährlichen Komplikation in der Schwangerschaft. Basierend auf diesem Befund stellten wir uns die Frage, ob der Anstieg der Sympathikusaktivität einer Präeklampsie vorausgeht, oder diese als Sekundärphänomen lediglich begleitet. In die entsprechende Studie wurden nur Frauen eingeschlossen, die in einer vorangegangenen Schwangerschaft eine Präeklampsie entwickelt hatten. Bei ausnahmslos allen Frauen stieg die MSNA während der aktuellen Schwangerschaft an, doch nur ein Drittel wurde letztlich präeklamptisch. Eine Zunahme der Sympathikusaktivität während der Schwangerschaft führt also nicht zwangsläufig zu einer Präeklampsie. Wahrscheinlich gibt es vasodilatatorische Mechanismen, die in den meisten Fällen einen Blutdruckanstieg verhindern können, sofern sie ausreichend potent sind. Eine englische Arbeitsgruppe hat auch bei gesunden Schwangeren eine sympathische Aktivierung gefunden, die jedoch deutlich geringer ausfällt als bei Frauen, die einen Schwangerschaftshochdruck entwickeln. Die momentane Datenlage lässt offen, ob ein Anstieg der MSNA zu einer normalen Schwangerschaft gehört oder ein Indiz für eine Risiko-Schwangerschaft darstellt. Diese Frage kann nur in einer größeren, prospektiven Studie geklärt werden. Wenn es künftig gelingt, die pathophysiologischen Zusammenhänge zwischen Immunsystem, Wachstumsfaktoren, Endothelfunktion und Sympathikus zu verstehen, könnten sich daraus pharmakologische TherapieAnsätze ableiten lassen. Trainierte Apnoe-Taucher sind in der Lage, über mehrere Minuten ihre Luft anzuhalten. Dabei tritt eine enorme Aktivierung vasokonstriktorischer Aktivität auf, und der Blutdruck steigt an. Unsere vorläufigen Befunde deuten darauf hin, dass die sympathische Aktivierung bei weiblichen Tauchern stärker ist als bei Männern. Messungen unter Extrembedingungen wie bei dieser willkürlichen Form der Asphyxie könnten künftig dazu beitragen, die Geschlechtsunterschiede in der autonomen Kreislaufregulation detaillierter zu verstehen. 115 Medizin und Geschlecht Literatur Evangelista O et al. Review of cardiovascular risk factors in women. Gend Med. 2009;6 Suppl 1:17-36. Review. Fischer T et al. Pregnancy-induced sympathetic overactivity: a precursor of preeclampsia. Eur J Clin Invest. 2004;34:443-48 Grassi G. Assessment of sympathetic cardiovascular drive in human hypertension: achievements and perspectives. Hypertension. 2009 Oct;54(4):690-97 Greenwood JP et al. Sympathetic neural mechanisms in normal and hypertensive pregnancy in humans. Circulation. 2001;104:2200-04 Greenwood JP et al. Sympathetic nerve discharge in normal pregnancy and pregnancy-induced hypertension. J Hypertens. 1998;16:617-24 Hagbarth KE et al. Pulse and respiratory grouping of sympathetic impulses in human muscle-nerves. Acta Physiol Scand. 1968;74:96-108 Hart EC et al. Sex Differences in Sympathetic Neural-Hemodynamic Balance. Implications for Human Blood Pressure Regulation. Hypertension. 2009 Mar;53(3):571-76 Heusser K et al. Cardiovascular regulation during apnea in elite divers. Hypertension. 2009;53:719-24 Heusser K et al. Influence of sibutramine treatment on sympathetic vasomotor tone in obese subjects. Clin Pharmacol Ther. 2006;79:500-08 Manson JE et al. Estrogen plus progestin and the risk of coronary heart disease. N Engl J Med. 2003 Aug 7;349(6):523-34 Narkiewicz K et al. Gender-selective interaction between aging, blood pressure, and sympathetic nerve activity. Hypertension. 2005;45:522-25 Rossouw JE et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002 Jul 17;288(3):321-33 Schobel HP et al. Preeclampsia - a state of sympathetic overactivity. N Engl J Med. 1996;335:1480-85 Tank J et al. Influences of gender on the interaction between sympathetic nerve traffic and central adiposity. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:4974-78 Kontakt Dr. Karsten Heusser Institut für Klinische Pharmakologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 116 Medizin und Geschlecht 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 27 23 E-Mail: [email protected] 117 Medizin und Geschlecht 118 Medizin und Geschlecht JUGENDMEDIZIN 20. NOVEMBER 2009 119 Medizin und Geschlecht 120 Medizin und Geschlecht BIOLOGIE + KULTUR = GESCHLECHTERROLLENVERTEILUNG ODER WIE WERDEN WIR ZU MÄDCHEN/JUNGEN? VON PROFESSORIN DR. UTE THYEN Das genetische Geschlecht wird durch den Chromosomensatz bestimmt. Ein 46,XY oder 46,XX-Karyotyp legt das chromosomale Muster fest und markiert den Beginn einer komplexen Kaskade von genetischen Ereignissen, die zur Entwicklung der männlichen oder weiblichen Gonade, also Hoden oder Ovar, führen. Die Gonade ist einzigartig unter allen Organanlagen. Sie entwickelt sich zwischen dem 10. und 12. Tag post-conzeptionem aus den Primordialzellen, ist bipotent angelegt, kann sich also in zwei Richtungen, die weibliche und die männliche, entwickeln. Die Entwicklung zum weiblichen Geschlecht erfolgt ohne die Mitwirkung spezifischer Entwicklungsgene und ist weitgehend unabhängig von hormonellen Einflüssen. Für die Entwicklung zum männlichen Geschlecht werden Gene auf dem Y Chromosom sowie weitere autosomale Gene benötigt, um den Prozess der Vermännlichung der bipotenten Gonade zu veranlassen. Diese Festlegung wird als Sexualdeterminierung bezeichnet, die spätere hormonell beeinflusste Entwicklung der inneren und äußeren Geschlechtsorgane als Sexualdifferenzierung. Entwicklung der Gonaden 121 Medizin und Geschlecht Abb. 1: Elektronenmikrospoische Darstellung der Primordialfalte im Alter von 10-12 Tagen post-conceptionem. Gekennzeichnet sind die Strukturen der bipotenten Gonade. Zur Entwicklung dieser Anlage sind die Funktion der Gene WT1, LIM1, SF1 erforderlich. Für die weitere Entwicklung zum Hoden insbesondere das auf dem Y Chromosom gelegene SRY, aber auch SOX9 und DMRT. Die Entwicklung des funktionsfähigen Ovars wird durch WNT4 und DAX1 unterstützt. Geschlechtsentwicklung Abb 2: Die peripheren Geschlechtshormone werden im Hoden von Leydig-Zellen und im Ovar von Thecazellen gebildet. Die in den Thecazellen gebildeten Androgene werden fast vollständig zu Östrogenen aromatisiert. Der Regulationsmechanismus die Hypophysenvorderlappenhormone LH und FSH als negative feed-back Schleife erfolgt durch die peripheren Geschlechtshormone und das in Sertolizellen und Granulosazellen gebildete Inhibin. 122 Medizin und Geschlecht Biosynthese der Steroidhormone Eine weitere gemeinsame Quelle von Geschlechtshormonen ist die Nebennierenrinde, die aus dem gemeinsamen Vorläufer Cholesterin Glucocorticoide, Mineralokortikoide und Androgene produziert. Bei Mädchen wie bei Jungen ist der Beginn der Menarche und der Adrenarche mit Entwicklung der sekundären Körperbehaarung von der Aktivität der Nebennierenrinde abhängig. Einflüsse auf die Entwicklung der Geschlechtsrolle und Identität Neben der Sexualdeterminierung (unter dem Einfluss der chromosomalen Ausstattung) und Sexualdifferenzierung (unter dem Einfluss der peripheren Geschlechtshormone) spielen bei der Ausprägung der Geschlechtsidentität, der Geschlechtsrolle und der sexuellen Orientierung auch psychologische, soziale und kulturelle Einflüsse eine Rolle. Eine direkte Hormonwirkung, insbesondere der Androgene auf die Hirnentwicklung und Reifung wird ebenfalls angenommen sowie ein positiver feed-back Mechanismus zwischen eigener körperlicher Entwicklung, Körperbild und Körperwahrnehmung. 123 Medizin und Geschlecht Abb. 3: Geschlechtsrollenverhalten, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sind voneinander unabhängige Konstrukte, die jeweils einzeln von jedem Individuum erfragt werden müssen. Auch wenn eine klare weibliche Geschlechtsidentität meistens mit einem überwiegend weiblichen Geschlechtsrollenverhalten und in der Regel mit einer sexuellen Orientierung zu Männern einhergeht, kann die Konstellation jedoch auch untypische Entwicklung zeigen, die keinen Störungscharakakter haben. Untypische Entwicklungen bergen allenfalls das Risiko, die betroffenen Individuen durch soziale Stigmatisierung und Isolation zu belasten. Geschlechtsrollenverhalten (gender role) Alles was eine Person sagt und macht, um anderen oder sich selbst zu zeigen, in welchem Ausmaß sie männlich, weiblich oder androgyn ist. Es handelt sich um die öffentlich präsentierte soziale Rolle. Geschlechtsidentität (gender identity) Das Fortdauern, die Einheit der eigenen Identität als männlich, weiblich oder androgyn in mehr oder minder starkem Ausmaß. Die Geschlechtsidentität wird im Selbstbewusstsein erlebt und im Verhalten erfahren. Sexuelle Orientierung Bezeichnet die Präferenz des Geschlechts eines Sexualpartners. Typisches Geschlechtsrollenverhalten Wenige Verhaltensunterschiede von Männern und Frauen sind eindeutig biologischen, d. h. genetischen Ursachen zuzuordnen. Dies ist der Fall, wenn bestimmte Verhaltensmuster kulturunabhängig und über die Zeiten konstant signifikant unterschiedliche Ausprägungen bei den Geschlechtern zeigen. Das 124 Medizin und Geschlecht Merkmal, z.B. prosoziales Verhalten, kann zwar bei beiden Geschlechtern gleichermaßen beobachtet werden, ist aber bei Mädchen und Frauen häufiger zu beobachten. Vermutlich handelt es sich um anthropologische über lange Zeit herausgebildete funktionelle, epigenetische Muster, die in gewissem Umfang auch durch äußere Einflüsse veränderbar sind. Forschungsergebnisse belegen eine Reihe solcher kulturübergreifender, geschlechtstypischer Eigenschaften und Fähigkeiten: - visuell-räumliche Fähigkeiten (in einigen Aspekten bei Männern ↑) - Aggression (Männer ↑) - prosoziales Verhalten (Frauen ↑) - sprachliche Fähigkeiten (in einigen Aspekten bei Frauen ↑) - Interesse an okkassionellen Sexualkontakten (Männer ↑) - Neigung zu homosexuellen Kontakten (Männer ↑) Altersbedingte Erfahrung mit Sexualität Die psychosexuelle Entwicklung des Kindes beginnt nicht erst mit den dramatischen Veränderungen während der Pubertät, sondern bereits im ersten Lebensjahr. Die Festlegung auf eine Geschlechtsrolle ist meist im Alter von 2 Jahren erfolgt, spätestens im Alter von 4 Jahren ist die Geschlechtsidentität im Selbstbild verankert. Diese Entwicklungen haben immer eine interpersonelle, soziale Dimension und sind abhängig auch von den Erfahrungen und der Lebensumwelt des Kindes. Alter Säuglingsalter Kleinkind- und Vorschulalter Schulalter Pubertät Erwachsenenalter Erfahrungen elterliches Wickelverhalten elterlicher Umgang mit Genitalentdeckung, Doktorspiele, Körperscham Klassenfahrten, Sportunterricht, Peer-Group Körperliche Veränderungen, sexuelle Erfahrungen, „anders sein“ Partnerschaft, Kinder Menschen mit Störungen der Geschlechtsentwicklung berichten Angeborene Besonderheiten der Geschlechtsentwicklung wurden unter dem Oberbegriff „Störungen der Geschlechtsentwicklung (“Disorders of sex development“ -DSD) gefasst. Ihre Ursache liegt in den oben beschriebenen Störungen der frühen –intrauterinen– sexuellen Determinierung und Differenzierung. Von vielen erwachsenen Betroffenen, aber auch von Eltern und Fachkollegen wurden die bisher benutzten Begriffe wie „testikuläre Feminisierung“, „Pseudohermaphroditismus“, oder auch Sammelbegriffe wie „Zwitter“ und „Intersexualität“ als wenig medizinisch informativ und häufig 125 Medizin und Geschlecht eher als diskriminierend kritisiert. DSD betrifft insgesamt etwa 2:10.000 Neugeborene, einige dieser Störungen treten sehr viel seltener auf (1:100.000). DSD liegt also vor, wenn chromosomales, gonadales und phänotypisches Geschlecht nicht übereinstimmen. Abb. 4 Richtlinien zur „optimalen Geschlechtszuweisung nach John Money et al. (1955) Abb. 5: Der Fall Joan-John erreichte internationale Publizität. Ein kleiner Junge wurde im Säuglingsalter aufgrund einer Penisverstümmelung zum Mädchen „umoperiert“ und schien sich in den Augen der Ärzte und Eltern zunächst unproblematisch in dieser Rolle zu entwickeln. Später trat große 126 Medizin und Geschlecht Unzufriedenheit und Zeichen einer scheinbaren Geschlechtsidentitätsstörung bei dem Mädchen auf, es erfolgte im Jugendalter ein Geschlechtsrollenwechsel in die männliche Rolle. Die traurige Lebensgeschichte endete im mittleren Erwachsenenalter mit einem Suizid. Die Empfehlung zur Geschlechtszuweisung bei einem Kind mit uneindeutigem Genital basierten zunächst auf der „otimal gender policy“, die für eine frühzeitig eindeutige Geschlechtszuweisung und operative Angleichung plädierte und auf eine so unbeeinträchtigte psychosexuelle Entwicklung der Kinder hoffte. Die Kinder wurden häufig nicht oder nur in geringem Umfang aufgeklärt. Empfehlungen zur Geschlechtszuweisung heute Folgende Fragen werden von der Fachwelt diskutiert: - Gilt die optimal gender policy nach Money noch? Was muss verändert werden? - Sollen/können operative Maßnahmen bis zur Einwilligungsfähigkeit des Kindes zurückgestellt werden? - Kann es eine Erziehung in einem „dritten“ Geschlecht geben? - Wie können Eltern unterstützt werden, eine Entscheidung im besten Interesse des Kindes zu treffen? - Wie können irreversible Eingriffe weitgehend vermieden/aufgeschoben werden, ohne dass es zu einer Stigmatisierung und Isolierung des Kindes kommt? - Wie können Kinder altersangemessen aufgeklärt werden? - Was bedeutet die Forderung nach einer „full consent policy“? Aspekte der medizinsch-psychologischen Betreuung Menschen mit Störungen der Geschlechtsentwicklung sollten interdissziplinär betreut werden und Zugang zu Zentren mit notwendiger Expertise und entsprechenden Teamstrukturen haben. 127 Medizin und Geschlecht Aufgaben der medizinischen Betreuung - Biologisches Geschlecht Ursache für Diagnose Vererbung Medikamenteneinnahme Körperliche Entwicklung Interdisziplinäre Aufgaben - Erstgespräche bzw. Erstkontakte - Elternbetreuung - Übergangsangebote für Jugendliche - Reproduktion Kontakt Prof’in Dr. Ute Thyen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Universität zu Lübeck Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck Tel: 0451 / 5 00 26 05 E-Mail: [email protected] 128 Psychosoziale Angebote - Unsicherheiten bzgl. Geschlechtszuweisung - Geschlechtsidentität - Schuldgefühle - Außenstehende einweihen - Kontaktwunsch - Informationswunsch - Krisensituation Medizin und Geschlecht BEWÄLTIGUNG CHRONISCHER KRANKHEIT IM KINDES- UND JUGENDALTER: GESCHLECHTERSPEZIFISCHE RISIKEN UND BERATUNGSANGEBOTE VON PROFESSORIN DR. KARIN LANGE Aktuelle Studien zur Prävalenz chronischer Krankheiten im Kindes- und Jugendalter in der Bundesrepublik zeigen, dass weit über 10 % der unter 19jährigen von einer oder mehreren langfristig zu behandelnden gesundheitlichen Störungen betroffen sind (KiGGS, Kamtsiuris et al. 2007). An erster Stelle stehen bei den primär somatischen Erkrankungen das Asthma bronchiale und Allergien, gefolgt von Neurodermitis, angeborenen Herzfehlern, Epilepsie, Typ 1 Diabetes und diversen seltenen oft aufwändig zu behandelnden Krankheiten wie Mukoviszidose, juvenile chronische Arthritis, seltene genetische Syndrome, PKU und weitere Stoffwechselstörungen. Geschlechterunterschiede in der Lebenszeitprävalenz finden sich hier abgesehen von der Hämophilie nur bei wenigen Krankheitsbildern. Obstruktive Bronchitis und Asthma werden bei männlichen Jugendlichen häufiger beobachtet, bei weiblichen Jugendlichen sind es Schilddrüsenkrankheiten und Migräne. Bei den primär psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters finden sich dagegen deutliche Geschlechterunterschiede: Jungen sind zwei- bis dreifach häufiger von einer ADHS betroffen, die Zahl männlicher Jugendlicher mit einer Substanzabhängigkeit übersteigt die Zahl der weiblichen Jugendlichen bei weitem. Dagegen werden bei jugendlichen Mädchen mehrfach häufiger affektive Störungen (Angst und/oder Depression) oder eine Essstörung diagnostiziert (Hölling H et al. 2008). Mit Blick auf die Langzeitprognose bei primär somatischen Krankheitsbildern deuten sich unvorteilhaftere Daten für weibliche Jugendlichen, vor allem bei der Mukoviszidose und beim Typ 1 Diabetes an (Hoey et al. 2001; Gerstl et al. 2008). Diesen in westlichen Industriestaaten erhobenen Daten stehen diejenigen aus Schwellenländern mit dramatischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern gegenüber. So zeigen Kaira et al. (2009) in einer repräsentativen Studie in Nordindien, dass das Verhältnis der Prävalenz von Typ 1 Diabetes bei den 15-30jährigen 1:0,46 zu Ungunsten der Patientinnen beträgt, obwohl die Inzidenz für beide Geschlechter identisch ist. Eine große Zahl der Familien ist demnach nicht in der Lage oder Willens die lebensnotwendige Therapie für die Mädchen zu finanzieren. Die Autoren schließen ihre Publikation wie folgt: „Di129 Medizin und Geschlecht abetes workers mention the reasons for this as social gender bias, which lead to less medical care and less nutrition for girls with diabetes. The data highlight the social and medical factors which contribute to discrimination against girls with diabetes.” Am Beispiel es Diabetes mellitus Typ 1 als eine Stoffwechselstörung mit hohem täglichen Therapieaufwand werden im Folgenden geschlechterspezifische Risiken und Beratungsangebote vorgestellt. Das Krankheitsbild erfordert eine kontinuierliche Anpassung der medikamentösen Therapie (Insulingaben) an die Ernährung, körperliche Aktivität, psychische Belastungen und diverse andere Faktoren des Alltags. Durch regelmäßige Bestimmung des Blutglukosespiegels (sechs- bis achtmal täglich) wird der Erfolg der Therapie überprüft und diese ggf. angepasst, um akuten Krisen und langfristigen Komplikationen vorzubeugen. Kinder bis weit in das Schulalter hinein sind mit dieser Aufgabe überfordert und auf die kontinuierliche kompetente Überwachung durch Erwachsene angewiesen. Da es bis dato in Deutschland keine gesetzliche Regelung oder Verpflichtung für Kindertagesstätten und Schulen zur Versorgung chronisch kranker Kinder gibt (Lange et al. 2009), betrifft die Diabetesmanifestation bei einem Kind eine Vielzahl von Müttern. Um eine adäquate Versorgung der Kinder zu gewährleisten, sehen sich derzeit die Mehrheit der Mütter und auch einige wenige Väter zur Aufgabe der eigenen Berufstätigkeit gezwungen (Lange et al. 2004). Eine Anerkennung dieser Betreuungsleistung, z.B. im Rahmen der Pflegeversicherung, findet jedoch in der Regel nicht statt. Im Kindesalter finden sich beim Diabetes, wie auch bei den anderen chronischen somatischen Krankheiten keine nennenswerten geschlechterabhängigen Unterschiede im Behandlungs- und Betreuungsbedarf. Beratungs- und Schulungskonzepte setzen auf die Vermittlung von Wissen und den Aufbau funktionaler Erwartungen zu Krankheit und Behandlung. Weiterhin wird das Symptommanagement im Falle einer akuten Exazerbation sowie das Krankheitsund Selbstmanagement während der symptomaren Intervalle trainiert. Schließlich kommt der Krankheitsbewältigung individuell und in Familiensystem und Peergruppe eine zentrale Stellung zu (Lange et al. 2007; Noeker 2008). Damit soll das Selbstbewusstsein und die Fertigkeit zum eigenverantwortlichen Handeln gefördert werden. Mit dem Einsetzen der Pubertät und dem Übertritt in das Jugendalter ergeben sich geschlechterspezifische Unterschiede im Beratungs- und Schulungsbedarf der jungen Patienten. Sie stehen in engem Zusammenhang mit den alterstypischen Entwicklungsaufgaben, der Identitätsund Autonomieentwicklung und krankheitsunabhängigen Risiken (Sawyer et al. 130 Medizin und Geschlecht 2007). Jugendliche Mädchen und auch Jungen stellen sich Fragen ob und in welcher Weise ihre körperliche Entwicklung, Sexualität, ihre Fertilität und die Gesundheit möglicher eigener Kinder durch die chronische Krankheit beeinflusst werden kann. Mädchen benötigen weiterhin spezifische Informationen darüber, welche Methoden der Kontrazeption mit ihrer Krankheit und deren Therapie vereinbar sind. Besonders dann, wenn es besondere Risiken und Funktionsbeeinträchtigungen gibt, sind sensible und geschlechterspezifische Beratungen bereits bei jüngeren Jugendlichen erforderlich, um deren Identitätsentwicklung zu unterstützen (Lange 2010). Damit eng verbunden ist die Integration in die gleichaltrigen Peergruppen und die Förderung sozialer Kompetenz, damit Jugendliche ihre Therapie trotz gegenläufiger Aktivitäten anderer Jugendlicher aufrechterhalten. Speziell für männliche Jugendliche geht es in der Beratung und Schulung durch das pädiatrische Behandlungsteam um das alterstypische „sensation seeking“ mit hoher körperlicher Belastung und Risiken, ggf. Leistungssport, aber auch den Konsum von Alkohol und anderen Drogen. Die Abstimmung mit der medikamentösen Therapie spielt hier ebenso eine Rolle, wie die Prävention von akuten, vital bedrohlichen Risiken und notwendige Sicherheitsvorkehrungen. Jugendliche Mädchen mit Diabetes sind häufiger als Jungen und häufiger als andere Gleichaltrige von subklinischen psychischen Störungen betroffen. Dies gilt vor allem für Depression, Angst und Essstörungen. Alle diese Störungen wirken sich negativ auf die Stoffwechselsituation und damit die langfristige Prognose aus. In evidenzbasierten Leitlinien wird daher heute empfohlen, regelmäßig nicht nur das körperliche, sondern auch das seelische Befinden der Jugendlichen zu überprüfen, um ggf. frühzeitig therapeutisch zu intervenieren. Spezielle Schulungsangebote für ältere Mädchen haben daher das Essverhalten, die Auseinandersetzung mit körperlichen Idealen und dem Schlankheitsdruck, sinnvolle und riskante Maßnahmen zur Gewichtskontrolle und vor allem die Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein zum Ziel. Letzteres gilt auch für den selbstverantwortlichen Umgang mit der erforderlichen Diabetestherapie im Alltag, deren Integration in Schule und Ausbildung (Lange et al. 2009). Fragen der Partnerschaft und die Akzeptanz der Krankheit durch den Partner, vor allem aber durch dessen Familie stellt ältere Jugendliche und junge Erwachsene mit verschiedensten körperlichen Beeinträchtigungen vor weitere psychische Belastungen, die einer geschlechtersensiblen Beratung durch das Behandlungsteam bedürfen. Literatur Gerstl E et al. (2008) Metabolic control as reflected by HbA1c in children, adolescents and young adults with type 1 diabetes mellitus. Eur J Pediatr 167:447-53 131 Medizin und Geschlecht Hoey H et al. (2001) For the Hvidøre Study Group for Childhood Diabetes Good metabolic control is associated with better quality of life in 2.101 adolescents with type 1 diabetes. Diabetes Care 24:1923-28 Hölling H et al. (2008) Ressourcen / Risiken für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Kinderärztliche Praxis 79:217-22 Kaira S et al. (2009) The case of the missing girls: low female vs. male ratio in youth with diabetes in North India. Pediatric Diabetes 10:13 Kamtsiuris P et al. (2007) Prävalenz von somatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Bundesgesundheitsbl– Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 50:686-700 Lange K (2010) Umgang mit chronisch kranken Kindern. In: O. Hiort, T. Danne, M. Wabitsch (Hrsg.): Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, p. 101-18 Lange K et al. (2009) Diabetes bei Jugendlichen: ein Schulungsprogramm. 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Kirchheim, Mainz Reader 1: Diabetes Basics p 1-167; Reader 2: Insulintherapie für Profis p 1-91; Reader 3: Diabetes Specials p 1-135; Reader 4: Pumpentherapie p 1-95. Lange K et al. (2004) Diabetesmanifestation im Kindesalter: Alltagsbelastungen und berufliche Entwicklung der Eltern. DMW 129:1130-34 Lange K et al. (2009) Diabetes care in schools – the disturbing facts. Pediatric Diabetes 10:S13:28-36 Lange K et al. (2007) Prerequisites for age-appropriate education in type 1 diabetes: a model programme for paediatric diabetes education in Germany. Paediatric Diabetes (2007) 8 (Suppl. 6): 63-71 Noeker M (2008) Das Gemeinsame im Speziellen: Krankheitsübergreifende Module und Lernziele der Patientenschulung. Präv Rehab 20:2-11 Sawyer SM et al. (2007) Adolescents with a chronic condition: challenges living, challenges treating. Lancet 369: 1481-89 Kontakt Prof’in Dr. Karin Lange Medizinische Psychologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Telefon: 0511 / 5 32 44 37 E-Mail: [email protected] 132 Medizin und Geschlecht PNEUMOLOGIE 30. APRIL 2010 133 Medizin und Geschlecht 134 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE IN DER (PULMONALEN) LEISTUNGSDIAGNOSTIK PROFESSOR DR. RALF EWERT Es steht außer Frage, dass eine Vielzahl von Leistungs- (besser) Funktionswerten eine Abhängigkeit von physiologischen, anthropometrischen und geschlechterspezifischen Parametern aufweist. Eine Reihe dieser Werte zeigen zudem im Altersverlauf eine Veränderung. Zusätzlich existieren soziokulturelle, geografische und ethnische Einflussfaktoren, welche insbesondere bei der Erarbeitung von Normwerte einen teilweise schwer zu kalkulierenden Einfluss aufweisen. Es sollte daher angestrebt werden, die in der pneumologischen Diagnostik verwendeten Normwerte aus regionalen Kollektiven zu erheben und diese auch in gewissen Abständen auf ihre Gültigkeit (bzw. Veränderungen) zu überprüfen. Unter besonderer Berücksichtigung geschlechterspezifischer Fragen soll in dem vorliegenden Beitrag ein kleiner Überblick über ausgewählte Funktionsuntersuchungen und deren Normalwerte gegeben werden. Die dafür verwendeten Daten stammen überwiegend aus der „Study of Health in Pommerania“ (SHIP), welche eine Längsschnittuntersuchung in Nordvorpommern darstellt. In diese Studie wurden anhand einer repräsentativen Stichprobe (auf der Basis der Melderegister) Probandinnen und Probanden ab dem 25. Lebensjahr eingeschlossen. Eine erste Untersuchung erfolgte im Zeitraum 1997-2001 mit 4310 Probandinnen und Probanden (SHIP 0) und eine zweite im Zeitraum 2002-2006 mit 3300 Probandinnen und Probanden (SHIP 1). Aktuell werden die Probandinnen und Probanden in einem zweiten Followup untersucht (SHIP 2, Zeitraum 2008-2011). Die methodischen Grundlagen sowie konzeptionelle Informationen wurden kürzlich publiziert. Für die Bewertung der gewonnenen Daten ist es unverzichtbar darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung Vorpommern eine gewisse Sonderstellung im gesamtdeutschen Rahmen einnimmt. Dieses wird u. a. dadurch deutlich, dass die mittlere Lebenserwartung der lebendgeborenen Mädchen und Jungen immer noch unter dem Durchschnitt anderer Regionen liegt. Zudem ist im 3. Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung (2008) ausgewiesen, dass die sozialökonomischen Bedingungen vergleichsweise schlechter als in anderen Regionen sind. Bei Betrachtung der kardiovaskulären Risikofaktoren (u. a. Prävalenz der arteriellen Hypertonie, Übergewicht in der Bevölkerung als auch Anteil der Raucher) in allen Altersklassen vergleichsweise hoch ist. 135 Medizin und Geschlecht In diesem „Risikokollektiv“ von Probandinnen und Probanden haben wir für ausgewählte pneumologische Funktionsuntersuchungen Normwerte erhoben. 1. Spirometrische Befunde Von den initial 1.809 untersuchten Probandinnen und Probanden konnten letztlich nach Ausschluss aller Personen mit kardialen und pulmonalen Erkrankungen 904 Gesunde ausgewertet werden. Bei der statistischen Verwendung von 5. und 95. Konfidenzintervall (CI) wurde deutlich, dass die erhobenen Werte teilweise deutlich über den international empfohlenen Normwerten liegen. Dieser Sachverhalt trifft für beide Geschlechter in gleicher Weise zu. Dieses ist kein isoliertes Ergebnis aus SHIP, sondern zeigt sich auch bei anderen deutschen Erhebungen. Somit sind die in Deutschland gewonnenen Daten gut vergleichbar. Es muss jedoch darauf verwiesen werden, dass methodische Fragen der Datenerhebung einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Besonders deutlich wird dies bei den Prävalenzstudien zur Häufigkeit von Patientinnen und Patienten mit COPD. Wenn man die Daten aus Hannover mit denen aus SHIP vergleicht, zeigt sich in den untersuchten Altersgruppen eine unterschiedliche Prävalenz der COPD. 2. Werte für den muskulären Atemantrieb Für diese Werte liegen gute Daten aus Deutschland vor, die bei 504 Gesunden zwischen 18 und 82 Jahren einen mittleren PIMAX von 9,95 kPa bei Männern und einen Wert von 7,43 kPa bei Frauen ausweisen. Aus klinischer Sicht sind jedoch die niedrigsten normalen Werte (LLN), welche bei Frauen 59 % und für Männer 60 % der vorausgesagten maximalen Werte darstellten. In unserer Analyse aus den SHIP Daten lagen die LLN-Werte für beide Geschlechter unter denen der Untersuchung aus München. 3. Werte der Spiroergometrie Für ausgewählte Werte der Spiroergometrie liegen seit Jahrzehnten etablierte Normwerte vor, wobei hierbei zwischen ergometrischen Parametern (Pulsfrequenz, Leistung, Belastungsdauer und Blutdruck unter Belastung) sowie den eigentlichen spiroergometrischen Befunden (Sauerstoffaufnahme an bestimmten Punkten, Werte der Atemeffizienz, Sauerstoffpuls) unterschieden werden sollte. Es ist seit langem bekannt, dass die ergometrischen Werte wesentlich von dem gewählten Protokoll der Belastung abhängig sind. Dagegen sind die eigentlichen spiroergometrischen Werte nicht protokollabhängig, was mittlerweile für verschiedene Patientinnen- und Patientengruppen gezeigt wurde. Wir haben für die Belastung auf dem Fahrradergometer nach einem Jones-Protokoll 1.708 Probandinnen und Probanden untersucht. Nach Ausschluss aller Patientinnen und Patienten mit Charakteristika, welche die 136 Medizin und Geschlecht Belastbarkeit beeinflussen (Confounder), wurden letztlich 534 Personen (253 Frauen) zwischen 25-80 Jahren ausgewertet. Vergleicht man die gewonnen Daten mit etablierten Normwerten, fällt erstens die breite Streuung der Normalwerte und zweitens eine ausreichende Vergleichbarkeit der mittleren Werte im mittleren Lebensalter auf. Bei den älteren Probandinnen und Probanden liegen die von uns erhobenen Werte jedoch im Mittel deutlich über den Werten anderer Autorinnen und Autoren. Aus klinischer Erfahrung haben wir es aber in der täglichen Praxis nicht mit „normalen“ Personen zu tun, sondern es sind die Patientinnen und Patienten mit ihren vielfältigen Risikofaktoren (Übergewicht, Raucher und Raucherinnen) und Besonderheiten (Einnahme von Betablockern). Wir haben daher an unseren Probanden untersucht, welchen Einfluss diese Faktoren auf ausgewählte Ergebnisse der Spiroergometrie haben. Dabei wird u. a. deutlich, dass geschlechterspezifische Unterschiede vorliegen. So wird die Atemeffizienz durch das Rauchen bei beiden Geschlechtern signifikant beeinflusst, die Sauerstoffaufnahme unterschiedet sich bei jedoch nur bei Rauchern und Nichtrauchern und nicht bei Raucherinnen und Nichtraucherinnen signifikant. Fazit Bei Betrachtung kardiopulmonaler Funktionsuntersuchungen wird deutlich, dass neben geschlechterspezifischen eine Reihe weiterer Faktoren einen Einfluss auf die gewonnenen Werte besitzen. Aus pragmatischen Erwägungen werden daher „Normwerte“ häufig (neben dem Geschlecht) auf das Alter und Körpergewicht bezogen, um eine Standardisierung zu ermöglichen. Es ist jedoch seit Jahren hinreichend bekannt, dass insbesondere soziokulturelle und ethnische Faktoren einen wichtigen Einfluss auf die Parameter der kardiopulmonalen Funktion besitzen. Vor diesem Hintergrund sollte überdacht werden, ob die Erstellung von internationalen Normwerten wirklich gerechtfertigt ist. Für die spirometrischen Funktionsgrößen konnten wir zeigen, dass erstens verschiedene Untersuchungen in Deutschland vergleichbare Daten ergaben und zweitens diese von internationalen Werten abweichen. Diese international verwendeten Normwerte wurden an Lungenfunktionsuntersuchungen der Jahre 1954-1980 von verschiedenen Studienpopulationen, inklusive aktiver Raucherinnen und Raucher, sowie unter Zusammenfassung verschiedener Untersuchungstechniken erstellt und folglich lagen keine repräsentativen Stichproben im eigentlichen Sinne vor. Aktuelle Arbeiten weisen darauf hin, dass die Anwendung historischer Referenzwerte für die Spirometrie zu einer beträchtlichen Unterschätzung der bevölkerungsbezogenen Lungenfunktionswerte führen kann. Die dringende Überarbeitung der historischen Referenzwerte wird dementsprechend empfohlen, und es sollten Männer und Frauen in gleichem Umfang in solche Analysen einbezogen werden. 137 Medizin und Geschlecht Literatur BMAS, 2008, Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung Buist AS et al. Int J Tuberc Lung Dis 2008; 12:703-08 Gläser S et al. BMC Pulmonary Medicine 2008, 8:3 Gläser S et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Mar 18 [Epub ahead of print] Gläser S et al. Respiration. 2010 Feb 5 [Epub ahead of print] Hautmann H et al. Respir Med 2000;94:689-93 Koch B et al. Dtsch Med Wochenschr. 2009;134:2327-32 Koch B et al. Eur Respir J 2009;33:389-97 Koch B et al. Unpublished Midgley AW et al. Sports Med 2008;38:441-47 Schnabel E Respir Res 2010 Respiratory Research 2010; 11:40 Völzke H et al. Ärzteblatt MV 2007 (2), 49-53 Völzke H et al. Int J Epidemiol. 2010 Feb 18 [Epub ahead of print] No abstract available Kontakt Prof. Dr. Ralf Ewert Klinik Innere Medizin B der Medizinischen Fakultät Universitätsklinikum Greifswald / Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Loeffler Str. 23a 17487 Greifswald Telefon: 03834 / 86 67 76 E-Mail: [email protected] 138 Medizin und Geschlecht COPD – GESCHLECHTERSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN – EFFEKTIVE PNEUMOLOGISCHE REHABILITATION. VON DR. KARIN TAUBE Einleitung Pneumologische Rehabilitation ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Therapie vieler Erkrankungen der Atmungsorgane und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wie auch in anderen Bereichen der Medizin trägt die Beachtung geschlechterspezifischer Unterschiede zur Verbesserung von Diagnostik, Therapie und Erfolg bei. Definition der pneumologischen Rehabilitation Medizinische Rehabilitation generell bezieht sich auf das biologischpsychosoziale Modell von funktionaler Gesundheit und deren Beeinträchtigung. Die entsprechende Klassifikation ist die ICF, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Kurative Versorgung dagegen ist a priori kausal orientiert. Ihr konzeptionelles Bezugssystem ist das biomedizinische Krankheitsmodell und die entsprechende Klassifikation, die ICD, Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Gerade im Bereich der Pneumologie beruhen die angewandten rehabilitativen Methoden auf einer breiten Basis internationaler wissenschaftlicher Untersuchungen. Die amerikanischen und europäischen Fachgesellschaften definieren daher pneumologische Rehabilitation als eine evidenzbasierte, multidisziplinäre und umfassende Behandlung für Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, die Symptome aufweisen und in ihren Alltagsaktivitäten eingeschränkt sind. Eine kürzlich erschienene Prognos-Studie hat ergeben dass die pneumologische Rehabilitation im Vergleich zu den anderen häufigsten Indikationen die größte Effektstärke in Bezug auf die Prä-Post-Veränderungen aufweist. Gesetzliche Grundlagen der Rehabilitation In Deutschland ist die medizinische Rehabilitation in das gegliederte System der sozialen Sicherung mit seinen unterschiedlichen Zuständigkeiten und Trägerstrukturen eingebunden (SGB IX, SGB V, SGB IV, SGB VII). Ihrer Aufgabe entsprechend haben die verschiedenen Träger spezifische Zielsetzungen. In Übereinstimmung mit dem SGB IX formuliert das deutsche 139 Medizin und Geschlecht Renten-, Kranken- und Unfallversicherungsrecht für die Atemwegs- und Lungenerkrankten, die Krankheitsfolgen aufweisen, ausdrücklich einen Anspruch auf Rehabilitation. Indikation von pneumologischer Rehabilitation Rehabilitative Maßnahmen sind bei vielen Erkrankungen der Atmungsorgane indiziert. Zu den wichtigsten gehören die Volkserkrankungen Asthma bronchiale und Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Die COPD ist die Erkrankung, die den größten Teil der pneumologischen Rehabilitanden ausmacht. Beispielhaft waren bei den 745 Patientinnen und Patienten, die 2006 und 2007 an einer ambulanten Maßnahme in der Atem-Reha Hamburg teilgenommen haben, 462 (62 %) an einer COPD erkrankt. Ca. 1/3 davon waren Frauen. Diese Verteilung ist wahrscheinlich als repräsentativ anzusehen, da die Einrichtung von allen Kostenträgern belegt wird. Inhalte der Rehabilitation bei COPD Zur Durchführung der Rehabilitation bei COPD wurde 2007 eine S2-Leitlinie erstellt. Das übergeordnete Ziel soll die Normalisierung des Lebens und die Wiederherstellung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit sein, soweit dies möglich ist. Dabei sind funktionale, somatische, psychosoziale und edukative Therapieziele zu berücksichtigen. Das wird nur erreicht durch eine multidisziplinäre und multimodale Maßnahme (Tab.1), wobei die medizinische Trainingstherapie eine Kernkomponente ist. Die Ergebnisse der Rehabilitation bei COPD sind auf Grund umfangreichen wissenschaftlicher Untersuchungen mit höchsten Evidenzgrad gesichert (Tab.2). Geschlechterspezifische Differenzierung ist bei den Studien nur selten erfolgt. Bisherige Untersuchungen weisen aber darauf hin, dass diese im Krankheitsspektrum der COPD aber eine Rolle spielen und berücksichtigt werden sollten. Tabelle 1 Bei der pneumologischen Rehabilitation handelt es sich um ein Komplexangebot zur Beeinflussung von biologisch-psychosozialen Krankheitsfolgen bestehend aus: - Tabakentwöhnung - Ernährungstherapie - medikamentöse Therapie - Hilfsmittelversorgung - körperlichem Training - psychosozialem Support - Patientenschulung - Sozialmedizin - Physiotherapie/Ergotherapie Die ambulante oder stationäre starke Empfehlung pneumologische Rehabilitation soll insbesondere bei COPD-Patient/inn/en ab einem mittleren Schweregrad und auch bei höherem Lebensalter durchgeführt werden als wirksame Komponente des langfristig 140 Medizin und Geschlecht ausgerichteten Managements der COPD Tabelle 2 Nutzen der pneumologischen Rehabilitation Gesteigerte körperliche Leistungsfähigkeit Abnahme der Atemnot Steigerung der Lebensqualität Abnahme von COPD assoziierter Angst und Depression Verbesserung von Kraft und Ausdauer der Armmuskeln bei gezieltem Training Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Atemmuskeln bei speziellem Training, insbesondere in Kombination mit allgemeinem körperlichen Training Besserung von psychischen Störungen, Förderung durch psychosoziale Intervention Evidenzgrad A A A A B B C Prävalenz Dank der Burden of Obstructive Lung Disease Studie (BOLD-Studie) hat sich die Datenlage in Bezug auf die Prävalenz der COPD verbessert. Die Untersuchung für Stadt und Region Hannover ergeben eine Prävalenz von 13,2 % für die Population über 40 Jahre. Wurde früher die COPD als eine Erkrankung der Männer angesehen, so zeigt sich nun, dass in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahre schon mehr Frauen als Männer daran erkrankt sind. Dieser Trend bestätigt sich ebenso in anderen Ländern z.B. in der Region Salzburg. Die Ursache liegt einmal an den veränderten Rauchgewohnheiten der Geschlechter, z.B. waren in der BOLD-Studie aus der Region Hannover in den unteren Altersklassen mehr Frauen aktive Raucherinnen als Männer aktive Raucher. Zum anderen aber spielt wahrscheinlich die stärkere Empfindlichkeit der Frauen gegenüber Tabakrauch eine Rolle. Diagnostik Noch 2001 wurde von Chapman in Nordamerika festgestellt, dass bei Frauen die COPD von Allgemeinärztinnen und -ärzten unterdiagnostiziert wurde. In der deutschen BOLD-Studie zeigt sich auch hier ein Wandel. In dem Gesamtkollektiv von 683 Probandinnen und Probanden war die COPD bei 7,7 % aller Probandinnen und Probanden schon ärztlich diagnostiziert. In dieser Gruppe waren in fast allen Altersklassen die Frauen in der Überzahl. Auch in einer amerikanischen Untersuchung waren bei den jüngeren COPD-Patientinnen und Patienten mehr Frauen als Männer schon ärztlich diagnostiziert. Pathomorphologie 141 Medizin und Geschlecht Die COPD wird definiert als eine chronische Lungenerkrankung, mit nach Gabe von Bronchodilatatoren und/oder Kortikoiden nicht vollständig reversibler Atemwegsobstruktion auf dem Boden einer chronischen Bronchitis und/oder Lungenemphysem. Allerdings mehren sich Hinweise, dass die Entzündungsvorgänge, die dabei eine Rolle spielen, nicht nur auf das Organ Lunge beschränkt sind, sondern auch zu Veränderungen der Skelettmuskulatur, von Herz und Gefäßen, des Skelettsystems, des Endokriniums und von Blut und Psyche führen. Die Berücksichtigung all dieser Faktoren erklärt die für den Krankheitsverlauf typische Abwärtsspirale mit zunehmender Beeinträchtigung, Inaktivität und Dekonditionierung. Pathomorphologisch sind bei Frauen besonders die Atemwege betroffen. Funktionell macht sich das bemerkbar durch den stärkeren Abfall der Einsekundenkapazität (FEV1) bei gleichem Rauchverhalten. Erklärt wird dies durch die stärkere Empfindlichkeit der Frauen auf den Zigarettenrauch. Neben der vermehrten Ablagerung schädlicher Partikel bei kleinerem Durchmesser der Atemwege sind wahrscheinlich biochemische Prozesse die Hauptursache. Östrogene verursachen eine up-regulation der Expression und Aktivität von Cytochrom P 450. Dies wiederum erhöht den Metabolismus von Bestandteilen des Zigarettenrauchs von denen einige potente Oxidantien sind. Da Östrogene die Expression oder Aktivität von detoxifizierenden Enzymen nicht beeinflusst, haben rauchende Frauen einen höheren oxidativen Stress besonders im Bereich der Atemwege. Emphysematöse Veränderungen dagegen sind stärker bei den Männern ausgeprägt, wie in dem Kollektiv des National Lung Screening Trial/NLST festgestellt worden ist. Außer im Stadium 2 ist der Unterschied signifikant. Ähnliche Ergebnisse zeigen die Daten der multizentrischen International COPD Genetic Network-Untersuchung(ICGN). Symptome Geschlechterspezifische Unterschiede sind auch bei den für die COPD typischen Symptomen vorhanden. 1. Atemnot Dieses Hauptsymptom der COPD ist bei Frauen stärker ausgeprägt. In der Confronting COPD Beobachtungsstudie (Survey), die von August 2000 bis Januar 2001 in den USA, Canada, Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlanden, Spanien und UK bei 3465 Patientinnen und Patienten mit einer ärztlich diagnostizierten COPD in Form einer Befragung durchgeführt wurde, überwog der Frauenanteil in den höheren Scores der Medical Research Council-Atemnotskala (MRC), die Atemnot bei Alltagsaktivitäten beschreibt. Auch in der National Emphysema Treatment Trial-Studie (NETT), in der 1053 Patientinnen und Patienten (38,8 % Frauen) untersucht wurde, litten Frauen an hoch signifikant stärkerer Atemnot auch unter 142 Medizin und Geschlecht Berücksichtigung des Alters, des FEV1 in Prozent des Solls und der Ausprägung des Lungenemphysems. 2. Depression, Angst, Panik In der gleichen Studie stellte sich auch heraus, dass Frauen mit COPD signifikant häufiger und stärker an Depressionen leiden. Im Beck-Depression Inventory (BDI), ein häufig verwendeter Fragebogen zur Messung von Depression, fanden sich bei Frauen deutlich höhere Werte als bei den Männern. Weiterhin zeigten Frauen niedrigere Werte im psychischen Summenscore des 36 Item short form (SF-36), eines Verfahrens zur Bestimmung der generischen Lebensqualität. Vermehrte psychische Störungen wie Angst, Phobie und Panik hat auch Laurin bei Frauen mit COPD nachgewiesen. Lebensqualität Wieder in der NETT-Studie konnte gezeigt werden, dass Frauen bei gleichem COPD-Schweregrad eine signifikant schlechtere krankheitsbezogene Lebensqualität haben, die mit dem Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) erfasst wurde. Bestätigt wurde dies auch in einer anderen Untersuchung an einem speziellen Kollektiv, von jeweils 53 Männer und Frauen aus Teneriffa und Boston mit COPD gleichen Schweregrades, die in eine Klinik eingewiesen wurden. Die Skalen Symptome und Aktivität des SGRQ waren bei den Frauen signifikant stärker beeinträchtig als bei den Männern. Mortalität Trotz stärkerem Leidensdruck wurde im Observationsstudie, ein Parameter, der eine und Prädiktion erlaubt, festgestellt, dass vergleichbar schwerer Erkrankung (FEV 1 niedriger ist. Rahmen der aktuellen BODEbessere Krankheitsklassifizierung die Mortalität bei Frauen bei % des Solls und BODE-Index) Therapie 1. Medikamente In der Vergangenheit wurden bei Medikamentenstudien nur selten geschlechterspezifische Aspekte berücksichtigt, was sich aber zunehmend ändert. Die Tristan-Studie, die im Vergleich zu Placebo einen signifikanten Effekt von Salmaterol und Fluticason auf den FEV1, Lebensqualität (SGRQ) und Exazerbationen ergab, zeigt in Bezug auf das Geschlecht keine signifikanten Unterschiede auf. 2. Sauerstofflangzeittherapie In einer prospektiven Studie aus Schweden, in der 5689 sauerstoffpflichtige Patientinnen und Patienten während eines Zeitraums von 1987 bis 2000 untersucht wurden, zeigt sich, dass die Inzidenz und Prävalenz bei Frauen 143 Medizin und Geschlecht schneller ansteigt als bei Männern. Auch in dieser Untersuchung kommt wieder eine bessere Überlebensrate der Frauen zur Darstellung. 3. Hospitalisierung Im Rahmen der NETT-Studie hat man weiterhin festgestellt, dass in der Kontrollgruppe, die nicht operiert wurden, weibliches Geschlecht bei Adjustierung nach Schweregrad der COPD, assoziiert war mit einem erhöhten Risiko von Krankenhausbehandlung wegen respiratorischer Erkrankungen (OR 1,5:95 % CI,1.01-2.28). 4. Krankheitsmanagement Eine der Gründe könnte sein, dass bei Frauen das Management der Erkrankung schlechter ist. In einer Untersuchung benutzten bei gleicher Beschwerdesymptomatik nur 59 % der Frauen ein Anticholinergikum gegenüber 69 % der Männer. Bei Exazerbationen der COPD nahmen in den ersten 24 h 25 % der Frauen und 36 % der Männer eine Notfallbehandlung in Anspruch. Geschlechterspezifische Beeinflussung der Rehabilitationsergebnisse Besonders unter Berücksichtigung der geschlechterspezifischen Unterschiede in Bezug auf die biologisch-psychosoziale Krankheitskomponente der COPD sollten bei einer Rehabilitationsmaßnahme geschlechterspezifische Therapieansätze berücksichtigt werden. Zu diesen Fragen gibt es allerdings nur eine dürftige und heterogen Datenlage. 1. Geschlechterspezifische Unterschiede sind feststellbar Beschränkt sich die rehabilitative Therapie nur auf eine körperliche Trainingstherapie, so profitieren Frauen in Bezug auf die Lebensqualität, bestimmt mit dem Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) weniger als Männer, auch wenn das Training über 18 Monate fortgesetzt wird. Die Autoren folgern daraus, dass bei Frauen zusätzlich andere Rehabilitationsinhalte wichtig sind. In einer älteren multizentrischen Studie mit 164 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus zehn amerikanischen Rehabilitationseinrichtungen zeigte sich bei der Eingangsuntersuchung, dass die Männer älter waren und mehr geraucht hatten. Funktionell bestand bei der Einsekundenkapazität (FEV 1) kein Unterschied. Die Frauen hatten jedoch einen signifikant schlechteren 6-Minuten-Gehtest. Niedriger war auch der Gesamtscore der Pulmonary Function Status Scale und zwar bei den funktionellen Aktivitäten, Atemnot, Angst, sozialen Bindungen und der Subscores Mobilität. Am Ende der Rehabilitation kam es bei den Frauen im Vergleich zu den Männern zu einer signifikant stärkeren Verbesserung der psychosozialen Parameter und der Lebensqualität bestimmt mit dem CRQ, wobei dies den Domänen Stimmungslage und Krankheitsbewältigung zuzuschreiben war. In einer neueren Untersuchung über ein 12-wöchiges 144 Medizin und Geschlecht Rehabilitationsprogramm (3x/Woche) aus Kanada zeigte sich, bei sonst unterschiedsloser Verbesserung der Endergebnisse eine signifikant stärkere Abnahme der Atemnot bei den Frauen. Eine Untersuchung aus Schweden ergab nach einer 4-wöchigen intensiven Maßnahme in Bezug auf den 6Minuten-Gehtest nur bei den 22 Männern eine Verbesserung des 6-MinutenGehtestes und nicht bei den 18 teilnehmenden Frauen. 2. Geschlechterspezifische Unterschiede sind nicht feststellbar In einer weiteren Untersuchung dieser Arbeitsgruppe zeigte sich jedoch, dass nach 4 Wochen Rehabilitation sowohl die 46 Männern als auch die 46 Frauen eine signifikante Steigerung der Leistungsfähigkeit zeigten, die sich nicht unterschied. Auch die positiven Effekte auf Lebensqualität und Angst waren direkt nach der Rehabilitation bei Männern und Frauen gleich. Auch in unserer Arbeitsgruppe konnten wir in einer retrospektiven Untersuchung keine geschlechterspezifischen Unterschiede in Bezug auf die Rehabilitationserfolge feststellen. 210 COPD-Patientinnen und -Patienten (41 % Frauen und 59 % Männern), die in den Jahren 2005/2006 15 Tage an einer intensiven Maßnahme mit den in Tabelle 1 aufgezählten Inhalten und einer täglichen Nettotherapiezeit von 5 Stunden teilgenommen hatten, wurden retrospektiv überprüft. Erreicht wurde eine signifikante Steigerung der 6Minuten-Gehstrecke, eine Abnahme der Atemnot (BORG) bei Belastung (Abschluss 6-Minuten-Gehtest) und eine Steigerung des körperlichen und psychischen Summenscor des SF-36. Geschlechterspezifische Unterschiede kamen nicht zur Darstellung. Zusammenfassung Die Prävalenz der COPD nimmt bei Frauen zu und die Erkrankung zeigt geschlechterspezifische Unterschiede, insbesondere in Bezug auf psychische Symptome. Obwohl eine umfangreiche Literatur die Effekt der Rehabilitation bei COPD mit höchstem Evidenzgrad gesichert hat, ist in Bezug auf geschlechterspezifische Auswirkungen die Datenlage unzureichend. Die bisherigen Ergebnisse sind heterogen. Zuwenig wurden die bestehenden geschlechterspezifischen Besonderheiten einbezogen und die geeignete Assessmentparameter erfasst. In der pneumologischen Rehabilitationsforschung sollte daher in Zukunft dieser Aspekt stärker berücksichtigt werden. Literatur BAR Rahmenempfehlungen zur ambulanten Rehabilitation. Frankfurt am Main 2008 Barnes PJ et al. Systemic manifestations and comorbidities of COPD. Eur Respir J 2009;33:1165-85 145 Medizin und Geschlecht Barr RG et al. Patient Knowledge and Disease Management in a National Sample of Patients with COPD. The American Journal of Medicine 2009; 122:348-55 Buist AS et al. International variation in the prevalence of COPD (The Bold Study): a population -based prevalence study. Lancet 2007;370:741-50 Camp PG et al. Sex differences in emphysema and airway disease in smokers . Chest 2009;136:1480-88 Casaburi R. Exercise Training in Chronic Obstuctive Lung Disease. In Carsaburi R, Petty TL (Hrsg) Principles and Practice of Pulmonary Rehabilitation. Philadelphia Saunders Company 1993 Chapmann KR et al. Gender Bias in the Diagnosis of COPD. Chest 2001;119:1691-95 Cohen SBZ et al. The Growing Burden of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Lung Cancer in Women. Am J Respir Crit Care Med 2007;176:11320 Cydulka et al. Gender Differences in Emergency Department Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation. ACAD EMERG MED 2005;12:1173-79 de Torres JP et al. Gender and COPD in patients attending a pulmonary clinic. Chest 2005; 128:2012-16 de Torres JP et al. Sex differences in mortality in patients with COPD. Eur Respir J 2009;33:528-35 Dransfield MT et al. Racial and gender differences in susceptibility to tobacco smoke among patients with chronic obstructive pulmonary disease Dransfield MT et al. Gender differences in the severity of CT emphysema in COPD. Chest 2007;132: 464-70 Fan VS, Ramsey SD, Giardino ND, Make BJ, Emery CF, Diaz PT, Benditt JO, Mosenifar Z, McKenna R, Curtis JL, Fishman AP, Martine FJ, ( for NETT). Sex, Depression and Risk of Hospitalisation and Mortality in Chronic Obstructive Pulmonary disease. Arch Intern Med 2007;167:2345-53 Fischer J et al. Rehabilitation von Patienten mit Chronisch Obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). S2-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (DGRW). Pneumologie 2007;61:233-48) Foy CG et al. Woodard CM. Gender Moderates the Effects of Exercise Therapy on Health-Related Quality of Life Among COPD Patients. Chest 2001;119:70-76) Franklin KA et al. Survival and future need of long-term oxygen therapie for chronoc obstructive pulmonary disease – gender differences. Respir Med 2007;101:1506-11 146 Medizin und Geschlecht Geldmacher H et al. Die Prävalenz der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) in Deutschland. Ergebnisse der BOLD-Studie. DMW 2008;133:2609-14 Haave E et al. Gender Consideration in Pulmonary Rehabilitation. Haggerty MC et al. Functional Status in Pulmonary Rehabilitation Participants. J Cardiopulmonaey Rehabil 1999; 19:35-42 Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation & Prevention 2008;28:215-19 Laurin C et al. Sex Differences in the Prevalence of Psychiatric Disorders and Psychological Distress in Patients with COPD. Chest 2007; 132: 148-55 Laviolette L et al. Chronic obstructive pulmonary disease in women. Can Respire J.2007;14:93-98 Martinez FJ et al. Sex Differences in Severe Pulmonary Emphysema. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 243-52 Nationale Versorgungsleitlinie COPD Version 1/7 Februar 2010, www.versorgungsleilinien.de Nici L et al. American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement on Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 173:1390-13 Prognos Die medizinische Rehabilitation Erwerbstätiger – Sicherung von Produktivität und Wachstum. Basel 10.08.2009 Respiratory Medicine 2006; 100:1110-16 Schirnhofer L et al. COPD prevalence in Salzburg, Austria: results from the Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD) Study. Chest; 2007;131:2936). Skumlien S et al. Four weeks ìntensive rehabilitation generates significant Health effects in COPD patients. Chronic Respiratory Disease 2007;1:5-13 Vestbo L et al. Gender does not influence the response to the combination of salmeterol and fluticason proprionate in COPD. Repir Med 2004; 98:1045-50 von Leupoldt A et al. Effects of 3-week Outpatient Pulmonary Rehabilitation on Exercise Capacity, Dyspnea and Quality of Life in COPD. Lung 2008;186:387-91 Watson L et al. Gender differences in the management and experience of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Respiratory Medicine 2004;98:1207-13 Kontakte Dr. Karin Taube Atem-Reha GmbH Jungestraße 10 20535 Hamburg Tel: 040 / 88 30 69 69 Fax: 040 / 25 49 95 21 147 Medizin und Geschlecht E-Mail: [email protected] 148 Medizin und Geschlecht GESCHLECHTERSPEZIFISCHE ASPEKTE BEI DER RAUCHPRÄVENTION VON DR. RICHARD LUX Die Entwicklungen der Rauchprävalenz und des Raucheinstiegsalters verliefen in den vergangenen Jahrzehnten bei den Geschlechtern unterschiedlich. Analog zu diesen Entwicklungen lässt sich mit zeitlicher Latenz insbesondere bei Frauen ein Anstieg pneumologischer Erkrankungen, die mit dem Tabakkonsum assoziiert sind, beobachten. Diese tabakepidemischen Verläufe besitzen Modellcharakter. Aus dem daraus ableitbaren Modell und der höheren Empfänglichkeit (Suszeptibilität) bzw. Verletzbarkeit (Vulnerabilität) lässt sich auch für die Zukunft eine Zunahme weiblicher, aus dem Rauchverhalten resultierender Morbidität und Mortalität folgern. Als Konsequenz haben (1) die weiblichen Anteile in den rauchenden Bevölkerungsgruppen, (2) die auf Mädchen und Frauen fokussierte Prävention des Tabakkonsums und (3) die Nikotinentwöhnung bei Raucherinnen für die Versorgungsbereiche im Gesundheitswesen an Bedeutung gewonnen. Diesbezüglich sind sowohl aus präventiver als auch aus kurativer Sicht die Gründe, warum a) Mädchen mit dem Rauchen beginnen, b) Frauen das Rauchen beibehalten, c) Raucherinnen der Ausstieg aus dem Tabakkonsum schwerer fällt als Rauchern und d) postabstinent eher einen Rückfall erleiden, zu berücksichtigen. Neben der Geschlechterzugehörigkeit der Konsultierten beeinflusst die Geschlechterzugehörigkeit der Konsultierenden die interpersonalen Prozesse während der Analyse-, Beratungs- und Umsetzungsphase einer begleiteten Tabakabstinenz und Nikotinentwöhnung. Inhalt und Umfang einer eruierenden und motivierenden Kommunikation können in Abhängigkeit vom ärztlichen Geschlecht differieren. Geschlechterunterschiedliche Reaktionen auf den selbst- bzw. fremdinitiierten Rauchverzicht und auf die ggf. medikamentös unterstützte Nikotinentwöhnung lassen sich durch soziokulturelle – in geringerem Ausmaß auch sozioökonomische – bzw. psychosoziale Einflüsse erklären. Einerseits sind bei Raucherinnen und Rauchern, die den Ausstieg vorbereiten und praktizieren, hinsichtlich der physiologischen und pharmakologischen Effekte Ähnlichkeiten 149 Medizin und Geschlecht vorhanden. Andererseits gibt es präventions- und therapierelevante Unterschiede der Wirkung und Wirksamkeit von Nikotinentzug und Medikation. Strukturelle Präventionsmaßnahmen sind zumeist geschlechterneutral ausgelegt. Dennoch können sie sich unterschiedlich auf das Verhalten und die Rahmenbedingungen von Raucherinnen und Rauchern bzw. von Frauen und Männern, die passiv gegenüber Tabakrauch exponiert sind, auswirken. Somit ziehen solche Ansätze trotz ihrer unspezifischen Ausrichtung geschlechterspezifische Folgen nach sich. Einen wesentlichen Ansatz, Geschlechteradäquatheit in der Prävention des Tabakkonsums und bei der Nikotinentwöhnung zu steigern, stellt die Implementierung von Geschlechteraspekten in der ärztlichen Sozialisation dar. Dies beinhaltet die Identifikation neuer Zielgruppen in Vorbeugung und Behandlung sowie die Aneignung standardisierter und zugleich spezifizierter Beratung, Motivation und Therapie von (zukünftigen) Raucherinnen bzw. Rauchern und ihres sozialen Umfeldes. Das breite Spektrum unterstützender und therapeutischer Angebote ermöglicht eine Anpassung an die geschlechterbezogenen Bedürfnisse und Eigenschaften. Eine Beteiligung an der Ein- und Durchführung von strukturellen Präventionsmaßnahmen ist auch in Hinblick auf den Geschlechterbezug lohnens-, das Hinwirken auf eine geschlechterspezifische Ausgestaltung solcher Strategien wünschenswert. Literatur Burgess DJ et al. (2009) Employment, gender, and smoking cessation outcomes in low-income smokers using nicotine replacement therapy. Nicotine Tob Res 11 (12):1439-47 Cawley J et al. (2004) Lighting up and slimming down: the effects of body weight and cigarette prices on adolescent smoking initiation. J Health Econ 23 (2):293-311 Klein JD et al. (2001) Delivery of smoking prevention and cessation services to adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 155 (5):597-602 Manchón Walsh P et al. (2007) Effects of partner smoking status and gender on long term abstinence rates of patients receiving smoking cessation treatment. Addict Behav 32 (1):128-36 McKee SA et al. (2005) Perceived risks and benefits of smoking cessation: gender-specific predictors of motivation and treatment outcome. Addict Behav 30 (3):423-35 O’Hara P et al. (1998) Early and late weight gain following smoking cessation in the Lung Health Study. Am J Epidemiol 148 (9):821-30 150 Medizin und Geschlecht Sin DD et al. (2007) Understanding the biological differences in susceptibility to chronic obstructive pulmonary disease between men and women. Proc Am Thorac Soc 4 (8):671-74 Swan GE et al. (2005) Dopamine receptor DRD2 genotype and smoking cessation outcome following treatment with bupropion SR. Pharmacogenomics J 5 (1):21-29 Kontakt Dr. Richard Lux Institut für Patientensicherheit Universität Bonn Stiftsplatz 12 53111 Bonn Telefon: 0228 / 73 83 07 E-Mail: [email protected] 151 Medizin und Geschlecht WAS MACHT DIE FRAU IM SCHLAF ANDERS ALS DER MANN? WAS MACHT DEN SCHLAF DER FRAU ANDERS? VON DR. BIRGIT HOFFMAN-CASTENDIEK Schlaf allgemein Der Schlaf ist im Gegensatz zum ruhigen Anblick einer schlafenden Person ein hochkomplexes Geschehen, an dem weitgehend alle Teile des Gehirns beteiligt sind. Die Schlafstruktur ist bei Männern und Frauen gleich. Unser Schlaf verläuft in Zyklen von etwa 90 Minuten Dauer, insgesamt drei bis fünf Zyklen pro Nacht. In jedem Zyklus kommt zu einem Übergang vom Stadium „Wach“ über das Einschlafen (S1) in ein mittleres Schlafstadium (S2), das insgesamt etwa 50 % einer Nacht einnimmt, weiter zum Tiefschlaf (S3), auch Slowwaves-sleep genannt, der in den REM-Schlaf (Repid-Eye-Movement-Schlaf) mündet. Der REM-Schlaf, in dem Träume sehr gut erinnert werden, hat wahrscheinlich eine Schlüsselfunktion, Tagesereignissen „aufzuarbeiten“ und ggf. in das Langzeitgedächtnis zu übernehmen. Nur wenn der zyklische Schlafablauf mit ausreichend langen, ungestörten Phasen von Tief- und REMSchlaf gewährleistet ist, fühlen wir uns am Folgetag wach und ausgeruht. Ein Schlüsselhormon der Schlafsteuerung ist das zykisch ausgeschüttete Hormon Melatonin, das erst ab dem dritten Lebensmonat gebildet wird und ab dem mittleren Lebensalter abnimmt. Es ist mit dafür verantwortlich, dass sich im höheren Lebensalter die Schlafkontinuität verschlechtert. Die meisten Menschen in unserem Kulturkreis schlafen nachts zwischen sechs und acht Stunden. Ohne externen Zeitgeber schlafen Frau 9,8 h und Männer 8,4 h (Wever, Sleep 2004). Ob ein Mensch Kurzschläfer (5,5 bis 6,5 h Schlaf oder weniger) oder Langschläfer (9,5 h Schlaf oder mehr) ist, ist genetisch festgelegt. Zu den Langschläfern zählen nach einer britischen Studie (Groeger et al, J Sleep Res. 2004) 2 % der Männer und 5 % der Frauen. Zu den Kurzschläfern gehören nach einer deutschen Umfrage (Meier, Somnologie 2004) 1,5 % der Männer und 2,5 % der Frauen. Frauen ordnen eher ihr Schlafverhalten den familiären Bedürfnissen unter und haben oft dadurch kurze Schlafzeiten. Frauen klagen doppelt so oft wie Männer darüber, dass sie nicht genug Schlaf bekommen. Sehr kurze (< 6 h) oder lange (> 7 h) Schlafzeiten erhöhen bei Frauen die Mortalität (Nurse Health Study, Sleep 2004). Auch erhöhen kurze Schlafzeiten das Risiko für arteriellen Hypertonus und Koronare Herzkrankheiten (KHK), nicht aber bei Männern (Whitehall II Study). Gleichzeitig reagieren Entzündungsparameter, 152 Medizin und Geschlecht wie Interleukin-6 (IL-6) und C-reaktive Proteine (CRP), bei Männern und Frauen, die sehr kurz oder sehr lang schlafen, ganz uneinheitlich, teilweise gegenläufig. Hier sind noch keine Aussagen möglich, welche Bedeutung diese Unterschiede haben. Frauen gehen tendenziell abends früher ins Bett, liegen morgens aber auch länger im Bett als Männer, wenn es die äußeren Umstände zulassen. Insgesamt brauchen Frauen im Schnitt 45 min mehr Schlaf als Männer. Untersuchungen von Dittami im Wiener Schlaflabor an Studenten zeigte, dass Frauen besser und kontinuierlicher schlafen, wenn sie alleine schlafen, während die Männer besser schliefen, wenn sie eine Partnerin an ihrer Seite hatten. Neben dem Melatonin spielt die Körpertemperatur eine wesentliche Rolle beim Einschlafvorgang. So induziert der abendliche Rückgang einen Schlafdrang. Ein zu schneller Abfall aber verhindert ein Einschlafen. Bei Männern sinkt aufgrund der meist größeren Körpermasse die Körpertemperatur langsamer ab. Als Folge wird vermutet, dass Frauen, wenn sie mit einem Mann das Bett teilen, aufgrund des langsameren Temperaturabfalls leichter einschlafen. Frauen variieren ihr Schlafverhalten stärker nach externen Bedürfnissen zwischen Arbeitswoche und Wochenende, während bei den Männern die täglichen Schlafzeiten eher gleich bleiben. Letzteres stabilisiert die Schlafstruktur und verbessert das Ein- und Durchschlafen. Frauen wachen nachts häufiger auf und sind geräuschempfindlicher. Einerseits kann dies auf genetisch festgelegte Verhaltensmuster zurückgeführt werden z.B. das nächtliche Erwachen durch Geräusche eines zu versorgenden Kleinkindes. Andererseits obliegt es auch im heutigen Rollenverhalten meistens der Frau, das Familienleben zu koordinieren und zu organisieren. Es besteht sozusagen ein „Radar-Verhalten“ bis in den Schlaf hinein, das den Schlaf erschwert. Träume (Michael Schredl, DGSM-Tagung 2008) Frauen erinnern sich häufiger an Träume. Männern träumen meist nur von wenigen Personen, häufiger von Unbekannten und überwiegend von Männern. Die Träume finden vor allem „draußen“ statt und beinhalten mehr körperliche Aktivitäten und konfliktreiche soziale Interaktionen. Frauen träumen meist von bekannten Personen, gleichhäufig von Männern und von Frauen. In den Träumen kommt es mehr zu „freundlichen“ sozialen Kontakten, seltener zu sexuellen Interaktionen. Die Träume „spielen“ innerhalb von Räumen. Schlafstörungen Schlafstörungen werden ab dem 50. Lebensjahr von Männern und Frauen nach der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes von knapp 40 % der Frauen und 153 Medizin und Geschlecht knapp 20 % der Männer berichtet. Auffällig ist dabei, dass berufstätige Frauen seltener über Insomnie klagen als hauptberufliche Hausfrauen. Beamte klagen insgesamt am seltensten über Schlafstörungen. Hohes eigenes Einkommen und hoher Bildungsgrad schützen vor Insomnie. Obwohl Ein- und Durchschlafstörungen in den Medien präsenter sind, hat ihr Anteil zwischen 1958 und 2001 nicht zugenommen. Als „Einschlafdroge“ nutzen Männer vorrangig Fernsehen (21,1 %) oder Alkohol (19,5 %). Schlafmittel spielen kaum eine Rolle (2,1 %). Frauen nutzen zu 15,3 % das Fernsehen als Einschlafhilfe, Alkohol zu 10,9 % und Schlafmittel mit 5,3 %. Frauen leiden doppelt so oft wie Männer an Schlafstörungen. Sie sind aber auch häufiger von Depression betroffen. Hier ist die Abgrenzung schwierig, da eine Depression in der Regel immer mit einer Insomnie einhergeht, während die primäre Insomnie das Risiko für eine Depression erhöht. Im praktischen Alltag erfolgt wahrscheinlich oft unter falscher Verdachtsdiagnose die falsche Behandlung. Atemstörungen im Schlaf Schlafbezogene Atemstörungen bestehen nach vielfältigen epidemiologischen Untersuchungen bei 4 % der Männer und bei 2 % der Frauen. Ursache ist vorrangig ein Zurückfallen der Zunge mit Verlegen der oberen Atemwege. Wichtigster Risikofaktor ist Adipositas. Im Jahr 2002 wurde bei stationären Krankenhausaufhalten bei den Frauen bei 200 von 100.000 und bei den Männern bei 800 von 100.000 Einwohnern die Diagnose Schlafapnoe gemäß des Statischen Bundesamtes erfaßt. Die obstruktive Schlaf-Apnoe mit lautem, unregelmäßigem Schnarchen wird meist als typische Männererkrankung wahrgenommen. Folge ist, dass Frauen sehr viel seltener als Männer weitergehend im Schlaflabor untersucht werden. Je nach Zentrum liegen die dokumentierten Raten bei 1:2 bis 1:10, im eigenen Patientinnen- und Patientengut zwischen 2004 und 2007 bei 1:5,3. Neben Schnarchen ist eine vermehrte Tagesmüdigkeit Leitsymptom für schlafbezogene Atemstörungen. Die Tagesmüdigkeit wird anhand von einfachen Fragebögen erfasst. Weit verbreitet und auch gebräuchlich in der MHH ist der Epworth Sleepiness Scale. Nach eigenen, noch nicht validierten Untersuchungen geben Frauen dabei bei gleichem Schweregrad der nächtlichen Atemstörungen einen geringeren Müdigkeitswert an als Männer. Auf Befragung hin äußern sie selten das typische Symptom Tagesmüdigkeit, sondern berichten eher von Abgeschlagenheit und Depression. 154 Medizin und Geschlecht Die Verdachtsdiagnose für schlafbezogene Atemstörungen wird meist zuerst durch niedergelassene Pneumologinnen und Pneumologen oder HNO-Ärztinnen und -Ärzte gestellt, die eine Polygraphie durchführen. Diese Screeninguntersuchung führt die Patientin oder der Patient ähnlich wie ein Langzeit-EKG zuhause durch. Eine Validierung der Daten erfolgt meist nicht, da die Vergütung dieser Untersuchung im ambulanten Bereich schlecht ist. Besonders vermeintlich leichtgradige Befunde sind nach klinischer Erfahrung oft unzuverlässig. Erst aufgrund einer positiven Polygraphie darf der niedergelassene Arzt eine Polysomnographie (PSG) im Schlaflabor veranlassen. Bei PSG-Analysen ist aufgefallen, dass Frauen bei gleichem Body-Mass-Index (BMI) weniger Atemstörungen haben als Männer. Die Atemstörungen treten bei Frauen vermehrt im REM-Schlaf auf. Bei gleichem Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) sind die Frauen meist 10 Jahre älter. Als Ursache für diese Unterschiede wird der Einfluß von Geschlechtshormonen vermutet. Gleichzeitig wird postuliert, dass die kürzere Anatomie der oberen Atemwege bei Frauen ein Zurückfallen der Zunge verhindert. Anhand von Daten aus der Sleep heart health study (AJRCCM 2010) wird ein Zusammenhang zwischen AHI im Non-REM-Schlaf mit Tagesmüdigkeit gesehen. Eine mögliche Theorie aus diesen und weiteren Daten ist, dass Männer, die Atemstörungen im REM und Non-REM-Schlaf haben, eher über Tagesmüdigkeit klagen, während Frauen mit überwiegend REM-assoziiertem AHI Depression äußern, und somit gar nicht weiter schlafmedizinisch untersucht werden. In einer eigenen, noch laufenden Studie, bei der alle Frauen mit schlafbezogenen Atemstörungen im Schlaflabor erfasst werden, ist aufgefallen, dass ein sehr hohe Anteil in diesem vorselektierten Patientengut an Depression leidet, während es bei den Männern nur Einzelfälle sind. Frauen äußern als vorrangige Beschwerden Abgeschlagenheit, Fatigue, Probleme, den Alltag zu bewältigen und Ein- und Durchschlafstörungen, während die Männer die „klassischen“ Symptome aus Schnarchen, Tagesmüdigkeit und Nykturie aufweisen. Im eigenen Patientinnen- und Patientengut haben die Frauen, wie bereits bekannt ist, vorrangig im REM-Schlaf Atemstörungen. Dies führt dazu, bezogen auf die ganze Nacht, dass der Gesamt AHI bei Frauen deutlich niedriger liegt als bei Männern (26,8 vs 36,6 im eigenen Patientinnen- und Patientengut), während der AHI im REM-Schlaf bei Frauen deutlich höher lag (43,1 vs 36,99). Da der AHI der Gesamtnacht bereits bei der Screeniguntersuchung entscheidet, ob der oder die Betroffene überhaupt weiter untersucht wird, ist zu vermuten, dass hier bereits auf der Ebene der niedergelassen Ärztinnen und Ärzte Frauen nicht zur weiterführenden Diagnostik überwiesen werden, da sie vermeintlich zu leichtgradig sind. Über die Bedeutung von REM-Schlaf assoziierten Atemstörungen gibt es keine 155 Medizin und Geschlecht Untersuchungen. Bei der Therapieentscheidung im eigenen Patientinnen- und Patientengut wurden gleichviele Männer und Frauen mit der Standardtherapie Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) versorgt. Es haben mehr Männer als Frauen (21 % vs 13 %) eine indizierte CPAP-Therapie abgelehnt oder nach kurzem Versuch abgebrochen. Obwohl die Frauen primär einen geringeren Schweregrad der Schlaf-Apnoe hatten, benötigte ein höherer Anteil eine differenzierte Atemunterstützung im Sinne einer Heimbeatmung (12 vs 8 %). Auch nach effektiver Therapieeinleitung berichteten Frauen häufiger über Tagesmüdigkeit und Ein- und Durchschlafstörungen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass aufgrund anderer geäußerter Beschwerden und formal geringer ausgeprägtem Befund Frauen seltener eine weitergehende Diagnostik im Schlaflabor erhalten. Bei Frauen ist die Bedeutung von REMSchlafassoziierten Atemstörungen hinsichtlich Morbidität und Mortalität völlig unklar. Ziel muss sein, dass Frauen mit schlafbezogenen Atemstörungen früher und besser erkannt werden. Literatur Groeger JA et al. Sleep quantity, sleep difficulties and their perceived consequences in a representative sample of some 2000 British adults. J Sleep Res. 2004 Dec;13(4):359-71 Kölsch G et al. Aufgedeckt: Wie Paare miteinander schlafen 2009 Meier U, Das Schlafverhalten der deutschen Bevölkerung: eine repräsentative Studie. Somnologie 2004 (8):87-94 Virtanen M et al. Overtime work and incident coronary heart disease: the Whitehall II prospective cohort study. Eur Heart J (2010) doi:10.1093/eurheartj/ehq124 Kontakt Dr. Birgit Hoffmann-Castendiek Klinik für Pneumologie Medizinische Hochschule Hannover 30625 Hannover Tel: 0511 / 5 32 24 86 E-Mail: [email protected] 156 Medizin und Geschlecht 157 Medizin und Geschlecht ARBEITSMEDIZIN 28. MAI 2010 158 Medizin und Geschlecht 159 Medizin und Geschlecht WHY ADAM IS NOT EVE AT WORK GRUNDLAGEN UND BEISPIELE EINER GESCHLECHTERSPEZIFISCHEN ARBEITSMEDIZIN VON DR. CHRISTINE KALLENBERG Als Arbeitsmedizinerin beschäftige ich mich seit Jahren mit dem Thema und habe heute folgende Ziele: Ich möchte für das Gender Thema sensibilisieren, Zahlen, Daten, Fakten vermitteln, Geschlechterspezifische Belastungen und Beanspruchungen im Beruf vorstellen, arbeitsmedizinische Aspekte und Schwerpunkte herausarbeiten, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erläutern, Gefährdungsbeurteilung und Begehung beschreiben, Beispiele für das Gesundheitsförderparadox nennen, für eine Gute Praxis werben, weiterführende Quellen nennen, Fact sheets von OSHA vorstellen und zu eigenen Aktivitäten anzuregen. Vertrag von Amsterdam 1997 Die Zugehörigkeit zum weiblichen oder männlichen Geschlecht ist noch immer eine der prägendsten und bedeutsamsten gesellschaftlichen Unterscheidungen. Dies wirkt sich auch auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit aus. Gender bezeichnet im englischen Sprachraum die gesellschaftlich und kulturell geprägten Geschlechterrollen von Männern und Frauen. Sie sind in einem historischen Kontext sozial erlernt und somit veränderbar. Im Unterschied dazu bezeichnet sex das biologische Geschlecht. Mainstreaming steht für Hauptströmung. Eine bestimmte Vorgabe wird zum zentralen Bestandteil bei allen Entscheidungen, Maßnahmen und Prozessen gemacht. Gender Mainstreaming ist eine Methode, Politik geschlechtergerecht auszugestalten. Ziel des Gender Mainstreamings ist es, eine horizontale und vertikale Chancengleichheit für Männer und Frauen zu erreichen. Voraussetzung ist in der Arbeitsmedizin eine geschlechtersensible Datenerhebung und Gesundheitsberichterstattung. In Deutschland haben wir etwa 400 Ausbildungsberufe. Mädchen wählen davon schwerpunktmäßig 10 Berufe, vor allem Bürokauffrau, Arzthelferin, Friseurin, Krankenschwester und Erzieherin, an der Universität Sprachen, Pädagogik und Psychologie. Jungen wählen aus einem breiten Spektrum vorwiegend gewerblich-technische Berufe, an der Universität natur-wissenschaftliche und technische Fächer. 160 Medizin und Geschlecht Frauenarbeiten in Europa vorwiegend in den folgenden Bereichen Gesundheitswesen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Reinigungsgewerbe, Lebensmittelherstellung, Catering und Gaststättengewerbe, Textil- und Bekleidungsindustrie, Wäschereien, Keramikindustrie, „Leichte“ Produktion, Callcenter, Bildungswesen, Frisörsalons, Büros und Landwirtschaft. Entsprechend angepasst und spezifisch soll die arbeitsmedizinische Betreuung erfolgen. Männer haben andere Beruf und andere Risiken Unfälle, Heben von schweren Lasten, Lärm/Hörverlust, arbeitsbedingte Krebserkrankungen. Beide Geschlechter sind durch Stress, ungünstige Arbeitszeiten und in ihrer reproduktiven Gesundheit belastet. Nach wie vor gibt es ein in den verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich ausgeprägtes Lohngefälle, genannt Gender pay gap. Je nach Untersuchung verdienen in Deutschland Frauen zwischen 20-25 % weniger als Männer bei gleicher Qualifikation. In den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen finden wir unterschiedliche Grenzwerte für Männer und Frauen für Laborwerte, unterschiedliche Normwerte für die Lungenfunktionsprüfungen und Ergometrie; außerdem gibt es eine umfangreiche Gesetzgebung zum Thema Mutterschutz für Frauen. Instrumente des klassischen Arbeitsschutzes waren seit dem 19. Jahrhundert vorwiegend technische Lösungen, Ge- und Verbote. Im Kontext des Arbeitsschutzgesetzes ist jetzt eine aktive Beteiligung der Beschäftigten möglich und erwünscht. Als Hilfe bietet die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz OSHA eine gendersensible Gefährdungsbeurteilung mit dem Schlüsselaspekt einer positiven Einstellung zur Geschlechterthematik an. Im betrieblichen Alltag spielt das Thema Gesundheitsförderung im Rahmen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements eine zunehmende Rolle. Für Männer gilt das Gesundheitsförderparadox Männer verfügen über eine geringere Lebenserwartung. Sie haben für einige Erkrankungen deutlich höhere Prävalenzen und sie nehmen geschlechtsneutrale Gesundheitsförderungsangebote wenig in Anspruch, darüber hinaus lassen sie sich gewinnen, wenn wenig Aufwand erforderlich ist z.B. am Arbeitsplatz. 161 Medizin und Geschlecht Gender Mainstreaming führt bei konsequenter Umsetzung zu einer Win-WinSituation für beide Geschlechter. Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner sollten für das Thema sensibilisiert werden, an einem Gender-Training teilnehmen, genderkompetente Gefährdungsbeurteilungen durchführen, Genderanalysen beherrschen, geschlechtersensible Präventionsprogramme anbieten und evaluieren. Der Europäische Fahrplan 2006 – 2010 hat sich folgende Ziele gesetzt Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und Männer Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Ausgewogenen Repräsentanz in Entscheidungsprozessen Beseitigung aller Formen geschlechterbezogener Gewalt Beseitigung von Geschlechterstereotypen Förderung der Gleichstellung in Außen- und Entwicklungspolitik Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Literatur Badura B et al 2007, Fehlzeitenreport BMFSFJ (Hrsg.) 2005, 1. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik BMFSFJ (Hrsg.) 2009, Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland Milczarek M 2010, European Agency for Safety and Health at Work (EUOSHA), Maintenance and Occupational Safety and Health: A statistical picture Kontakt Dr. Christine Kallenberg Arbeitsmedizin/Gesundheitsmanagement Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG Schuetzenstrasse 87 88212 Ravensburg Tel. 0751-3700-4637 E-Mail: [email protected] 162 Medizin und Geschlecht MÄNNER SIND ANDERS – FRAUEN AUCH! PRÄVENTION UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG GESCHLECHTERGERECHT GESTALTEN VON THOMAS ALTGELD Die Zielgruppengerechtigkeit von Gesundheitsförderungsund Präventionsangeboten unter der Geschlechterperspektive zu betrachten, bedeutet insbesondere auch, den Blick auf Männer zu richten. Männer zeigen nicht nur in vieler Hinsicht ein stärker gesundheitsriskantes Verhalten, sondern sie nutzen auch seltener Angebote der Gesundheitsförderung. Dabei zeigt sich, dass der aktuell in bestimmten Medien und Forschungsvorhaben sehr beliebte risiko- und defizitorientierte Männlichkeits-Diskurs nicht sehr hilfreich ist, um Gesundheitsbedürfnisse und Präventionspotenziale von Jungen und Männern auszuloten. Die Präventionsberichte über die Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung in der Primärprävention zeigen Jahr für Jahr das gleiche Bild, was die Erreichbarkeit von Männern für Kursangebote nach dem individuellen Ansatz anbelangt: Männer nehmen dieses Angebot nicht nennenswert in Anspruch. In dem aktuellen Präventionsbericht 2009 wird dieser Sachverhalt eingeleitet mit dem lapidaren Satz: „Kursangebote nach dem individuellen Ansatz wurden – wie in den Berichtsjahren zuvor – überdurchschnittlich häufig von Frauen in Anspruch genommen. Ihr Anteil lag bei 77 % aller Kursteilnehmer, der Anteil der männlichen Kursteilnehmer lag hingegen bei 23 %“ (Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V., 2009, S. 74). Differenziert nach den einzelnen Handlungsfeldern zeigt sich folgendes Bild: Tab. 1 Inanspruchnahme nach Geschlecht in den jeweiligen Handlungsfeldern (eigene Darstellung) (Präventionsbericht 2009) 163 Medizin und Geschlecht Die Nichterreichbarkeit von Männern über diese Angebotsstruktur und bei anderen präventiven Angeboten wird offenbar hingenommen wie ein Naturereignis und gar nicht erst hinterfragt. Insbesondere wird von den Krankenkassen nicht thematisiert, ob die Angebotsstruktur selbst und die vorgegebenen Inhalte (Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung und Suchtprävention) der Grund für niedrige Männerraten in den Kursangeboten sein könnten. Damit leisten diese primärpräventiven Kursangebote der eigentlichen Intention des Gesetzesauftrages entgegen wahrscheinlich einen Beitrag schlimmstenfalls zur Vergrößerung, bestenfalls zur Beibehaltung ungleicher Gesundheitschancen zwischen den Geschlechtern. Die Forderung nach mehr effektiven Präventionsund Gesundheitsförderungsangeboten, die Männer als Zielgruppe adressieren und erreichen ist keineswegs neu, allerdings wird sie insbesondere von den Leistungsanbietern und Kostenträgern der größten Präventionsschienen nie besonders nachdrücklich erhoben. Hinze und Samland forderten bereits 2004 „die Beseitigung einer die Geschlechterdisparität betreffenden extremen Schieflage in der Prävention und Gesundheitsförderung“. Die geschlechterspezifische Inanspruchnahme der Gesundheitsbildungsangebote variiert aber erheblich nach Bundesländern, dabei schneiden die kleineren alten Bundesländer besser ab, was die erreichten Männer anbelangt, als die neuen Bundesländer, wie Altgeld 2007 analysiert hat. Einer der Gründe für die relativ hohe Männerteilnahmerate in Bremen könnte der deutlich höhere Anteil an berufs- und arbeitsplatzbezogenen Gesundheitsbildungsangeboten in Bremen sein. Diese hohe Varianz in den Inanspruchnahmeraten der Männer zwischen den einzelnen Bundesländern zeigt, dass die Angebotsstruktur sich männerspezifischer und -gerechter gestalten lässt. Männergesundheitsforschung steht noch am Anfang Für Männer und die kaum existente Männergesundheitsforschung ergibt sich eine fast schon paradoxe Situation. Auf der einen Seite boomt national und international der Männergesundheitsmarkt, der mehr oder weniger sinnvolle (medizinische) Dienstleistungen erfolgreich an den Mann bringt und damit auch zeigt, dass Männer kein unerreichbares Geschlecht für Gesundheitsangebote sind. Auf der anderen Seite will ein etwas wehleidiger, risikobetonter und rein bipolar angelegter Männergesundheitsdiskurs nicht verstummen. Denn das Infragestellen starker Männerbilder sowie in Folge davon die Neuentdeckung des gesundheitlich eigentlich „schwachen Geschlechts“ der Männer hat in bestimmten Teilen der gesundheitswissenschaftlichen Literatur mittlerweile Tradition. 164 Medizin und Geschlecht Die statistisch nachweisbare kürzere Lebenszeit der Männer in Deutschland verführt gemeinsam mit erhöhten Morbiditätsrisiken für eine Reihe von verhaltensbedingten Erkrankungen (z.B. des Herz-Kreislauf-Systems, der Lungen oder der Leber) zu dem (Kurz-)Schluss, dass Männer im Vergleich zu den diesbezüglich besser abschneidenden Frauen gesundheitlich vielleicht das „schwächere Geschlecht“ sein könnten. Das wird schon an den Titeln einiger Publikationen deutlich, z.B. „Der frühe Tod des starken Geschlechts (Klotz et al. 1998), „Männerdämmerung“ (Hollstein, 1999) oder „Konkurrenz, Karriere, Kollaps – Männerforschung und der Abschied vom Mythos Mann“ (Bründel et al. 1999). Aber die meisten Publikationen zur Männergesundheit bleiben ebenfalls auf einer oberflächlich-beschreibenden Ebene stehen. In fast allen geschlechtervergleichenden Analysen wird beinahe schon stereotyp die höhere Risikobereitschaft und vermeintlich geringere Gesundheitsbewusstheit von Männern diagnostiziert. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf Risikosportarten, den Konsum legaler und illegaler Drogen oder die Nahrungsmittelzufuhr mit fettreicheren Lebensmitteln und Süßgetränken. Außerdem bezieht sich der gesamte Diskurs, wie Dinges betont, „noch zu oft auf ein überholtes monolithisches Bild von Männlichkeit. Ein statistischer Durchschnittsbefund – also ein Mehrheitsverhalten – reicht zur Behauptung einer ‚Essenz der Männlichkeit’ nicht aus“ (Dinges 2007). Tiefer gehende Erklärungen für diese höhere Risikobereitschaft werden jedoch kaum angeboten. „In vielen Kulturen macht es der Prozess der männlichen Sozialisation – aus Jungs ‚richtige’ Männer zu machen – den Männern oft schwer, Schwäche zu zeigen. Dies hält sie möglicherweise davon ab, Vorschläge für Gesundheitsförderung ernst zu nehmen und bei Problemen einen Arzt/eine Ärztin aufzusuchen. So sind viele Männer sich selbst ein Hindernis, was einen möglichst optimalen Nutzen des Gesundheitssystems angeht.“ (Doyal 2004) Diese fast schon ontologisierte „männertypische“ Sozialisation scheint dann der einzige Grund dafür zu sein, dass Männer kaum auf ihren Gesundheitszustand achten und sich weniger anfällig gegenüber Krankheiten fühlen. Die zentrale Frage ist jedoch, ob nicht gerade die auf den ersten Blick riskanteren gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen von Männern wesentlicher Teil ihrer Art, „ihren Mann zu stehen“, sind. Das heißt, wenn Männlichkeitskonzepte und Rollenerwartungen sich nicht verändern, werden Männer diese Verhaltensweisen kaum aufgeben können, ohne den Verlust ihrer männlichen Identität und ihrer gesellschaftlich nach wie vor privilegierten Situation zu riskieren. Dinges ist der einzige, der im deutschen Sprachraum einen Blick auf die Normen von Männlichkeit, insbesondere bei Heranwachsenden, wirft und sie auf ihren Präventionsbezug hin genauer 165 Medizin und Geschlecht analysiert. Er stellt fest, das damit konkurrierende Botschaften vermittelt werden: „Gesundheitsdiskurse, die auf Risikovermeidung in der Jugendphase setzen, stehen also in einer Spannung zu anderen gesellschaftlich vermittelten Anforderungen an Männer. (…) Auf Risikovermeidung zielende Gesundheitsdiskurse sollten nicht bei der Abwertung eines gängigen Verhaltens junger Männer als gesundheitsschädlich verharren, sondern die historischen Gründe für die Erziehung zur Härte und den rezenten Wandel in der Arbeitswelt reflektieren und ihre Botschaften darauf einstellen“ (Dinges 2007). Bevor die Frage nach männergerechten Gesundheitsangeboten befriedigend beantwortet werden kann, stellen sich zunächst ganz andere Fragen: An welchen Leitbildern orientieren sich Männer und Frauen? Wie viel Platz für Gesundheit gibt es in diesen geschlechterspezifischen Orientierungen? Kann die Gesundheitsversorgung überhaupt effektiv geschlechtsneutral organisiert werden? Wenn man sich die Gestaltung der meisten Gesundheitsinformation anschaut, dann werden dort immer sehr hehre Botschaften an vermeintlich geschlechtslose Wesen gerichtet. Eigenverantwortung für Gesundheit, verantwortlicher Umgang mit dem eigenen Körper scheinen überhaupt nicht von geschlechterspezifischen Sozialisationen abhängig zu sein, sondern irgendwie für jeden (zweckrationalen) Menschen lebbar und möglich zu sein. Diese Gesundheitsbotschaften konkurrieren jedoch mit sehr vielen anderen Botschaften, und vor allem konkurrieren sie eben mit einer geschlechtstypischen Sozialisation, in der Männer immer noch lernen, keinen Schmerz zu kennen oder für außenorientiertes Verhalten mehr belohnt werden als Frauen. In ganz anderen Sozialisationsbereichen werden die Grundlagen für gesundheitsbewusstes Verhalten gelegt als in der Hygiene- und Gesundheitserziehung selbst. Eine bessere Ausdifferenzierung von Zielgruppen ist notwendig Die Broschüren- und Medienproduktion ist ein klassischer Weg der Gesundheitsaufklärung und entspricht nicht immer den Routinen und Bedarfen der Zielgruppen. Die PISA-Studie hat sehr detailliert nachgewiesen, dass die relativen Risiken von Jungen, zur Gruppe schwacher Leser zu gehören, um etwa 70 % höher sind als die für Mädchen (Artelt et al. 2001). Deshalb führt die leselastige Materialproduktion in der Gesundheitsaufklärung und -information zu einer höheren Akzeptanz bei Mädchen und Frauen. Die Ergebnisse von PISA zeigen zudem, dass es Jungen im Vergleich zu Mädchen deutlich größere Schwierigkeiten bereitet, Texte und ihre Merkmale kritisch zu reflektieren und zu bewerten. Auch bei den benannten Hobbys von Jungen taucht Lesen nicht einmal bei einem Fünftel als liebstes Hobby auf, während mehr als zwei Fünftel der Mädchen dies als liebstes Hobby angeben. In diesem Zusammenhang kann es eine gute Strategie sein, Männern den Zugang zu Gesundheitsinformationen 166 Medizin und Geschlecht via Internet zu eröffnen. Wünschenswert wäre hier ein „Männergesundheitsportal“ analog zu der von der BZgA entwickelten und betreuten Fachdatenbank „Frauengesundheitsportal“, in der Datenquellen und Informationen über Links erschlossen werden können. Den größten gesundheitlichen Nutzen für Jungen und Männer hätte wahrscheinlich nachhaltige geschlechterreflektierende Praxis in den frühen Bildungseinrichtungen sowie die Teilmaskulinisierung des dortigen Personals. Darüber hinaus muss eine zielgruppengerechtere Arbeit in allen Präventionsund Gesundheitsförderungsbereichen erreicht werden. Altgeld et al. haben 2006 deutlich gemacht, dass sich Zielgruppengerechtigkeit von Präventionsprogrammen in vier Schritten erreichen lässt: - die Wahl der Zugangswege, - der Entwicklung der Methodik, - einer effektiven Ansprache, - gelingenden Sozialraum- und Lebensweltorientierung Für die Gesundheitsförderung und weite Bereiche anderer gesundheitsbezogener Präventionsansätze ist ein sich ausdifferenzierendes Spektrum von Handlungsoptionen wie beispielsweise in der Suchtprävention noch nicht zu erkennen. Die verschiedenen Präventionsbereiche profitieren zudem noch zuwenig von dem in jeweils anderen Feldern gemachten Erfahrungen, auch wenn die Herausforderungen vielfach dieselben sind: das Erreichen sogenannter bildungsferner Schichten sowie die Verankerung von Ansätzen in Lebenswelten. Die Ergebnisse einer Umfrage des 2006 gegründeten Netzwerkes für Männergesundheit zeigen, dass die benannten relevanten Themen bisher kaum innerhalb des Mainstreams der von öffentlichen Händen oder Kassen finanzierten Prävention abgedeckt werden, weil Bewegung und Ernährung nach dieser Umfrage an letzte Stelle der genannten Themen stehen. Ganz oben auf der Hitliste stehen dagegen Work-Life-Balance, Stressbewältigung, Sexualität und Bilder von Männlichkeit. Mit der Wahl der richtigen Themen und dem stärkeren Anknüpfen an Ressourcen im männlichen Lebensverlauf könnte eine effektive Neuorientierung der Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote eingeleitet werden. Altgeld hat darüber hinaus 2004 vier Haupthandlungsfelder für die Entwicklung einer männergerechteren Gesundheitsförderung und Prävention skizziert: - Sensibilisierung und Qualifizierung von Multiplikatoren im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich für männerspezifische Gesundheitsproblematiken und Gesundheitsförderungsansätze, 167 Medizin und Geschlecht - Entwicklung einer jungen- und männerspezifischen Gesundheitskommunikation, - Ausdifferenzierung von klar umrissenen Subzielgruppen, - Implementation von Gender Mainstreaming als Querschnittsanforderung und Qualitätsmerkmal von Gesundheitsförderung und Prävention Insbesondere für den Bereich der Qualifizierung von Multiplikatoren für männerspezifische Gesundheitsproblematiken und der männerspezifischen Gesundheitskommunikation gibt es bislang zu wenig Angebote und Strategien. Neben der Entwicklung geeigneter geschlechtersensibler Kommunikationsansätze muss vor allem mehr zielgruppenorientiert und nicht orientiert an zugeschriebenen Risiken gedacht und gehandelt werden. Zudem fehlt es an pharmaindustrie- unabhängiger Männergesundheitsforschung (insbesondere zu Prostatakrebs, sexuellen Störungen, Depression und ADS/ADHS). Die Genderkompetenz von Anbietern im Feld könnte neben der durchgängigen Implementierung von Gender Mainstreaming als Qualitätsmerkmal auch durch die Entwicklung von Medienprüfsteinen für die Medienentwicklung erhöht werden. Diese Medienprüfsteine sollten nicht nur die Vermeidung von Geschlechterstereotypen, sondern auch die Berücksichtung unterschiedlicher Rezeptionsgewohnheiten und Interessen beider Geschlechter berücksichtigen. Die Entwicklung innovativer Strategien zur Förderung der Männergesundheit darf nicht weiterhin allein dem Männergesundheitsmarkt überlassen werden, weil darüber bestenfalls ohnehin gesundheitsbewusstere Männer erreicht werden. Jungen und Männer sind bei frühzeitigem Einbezug mit der richtigen Themenauswahl und dem Einsatz geeigneter Strategien eben kein unerreichbares Geschlecht für Gesundheitsförderung und Prävention. Literatur Altgeld, T (2007): Warum weder Hänschen noch Hans viel über Gesundheit lernen – Geschlechtsspezifische Barrieren der Gesundheitsförderung und Prävention, in: Prävention und Gesundheitsförderung 2, 90-97 Altgeld, T (Hrsg.) (2004). Männergesundheit – Neue Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention. Weinheim/München Artelt, C et al. (Hrsg.) (2001). PISA 2000 – Zusammenfassung zentraler Befunde. Berlin Bründel, H et al. (1999): Konkurrenz, Karriere, Kollaps – Männerforschung und der Abschied vom Mythos Mann. Stuttgart Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2009): Evaluationsbericht Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz 2009. Berlin 168 Medizin und Geschlecht Dinges, M (2007): Was bringt die historische Forschung für die Diskussion zur Männergesundheit?, in: Blickpunkt DER MANN 5(2), 6-9 Doyal, L (2004): Sex und Gender: Fünf Herausforderungen für Epidemiologinnen und Epidemiologen, in: Das Gesundheitswesen 66, 15357 Helfferich, C (2006). Ist Suchtprävention ein „klassisches“ Feld geschlechtergerechter Prävention?, in: Kolip, P.; Altgeld, T. (Hrsg.) Geschlechtergerechte Gesundheitsförderung und Prävention, Weinheim und München: Juventa Verlag, S. 27-40 Hinze, L et al. (2004) Gesundheitsbildung – reine Frauensache?, in: Altgeld, T (Hrsg.) Männergesundheit – Neue Herausforderungen für Gesundheitsförderung und Prävention. Weinheim und München: Juventa Verlag, S.171-82 Hollstein, W (1999): Männerdämmerung: von Tätern, Opfern, Schurken und Helden. Göttingen Klotz, T et al. (1998): Männergesundheit und Lebenserwartung: Der frühe Tod des starken Geschlechts, in: Deutsches Ärzteblatt 95, A-460-64 Kolip, P. & Altgeld, T. (Hrsg.) (2006). Geschlechtergerechte Gesundheitsförderung und Prävention,. Weinheim und München: Juventa Verlag Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V.(MDS)/ GKV-Spitzenverband (Hrsg.) (2009): Präventionsbericht 2009 – Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primarprävention und betriebliche Gesundheitsförderung. Berichtsjahr 2008. Essen Kontakt Thomas Altgeld Landesvereinigung für Gesundheit und Niedersachsen e.V. Fenskeweg 2 30165 Hannover Tel.: 0511 / 3 88 11 89 0 E-Mail: [email protected] Akademie für Sozialmedizin 169 Medizin und Geschlecht ZUR GESUNDHEIT WEIBLICHER FÜHRUNGSKRÄFTE VON DR. BETTINA BEGEROW UND ANDREAS WEBER Einleitung Frauen verfügen über vergleichbare Ausbildungsqualitäten wie Männer und sind zu einem ähnlichen Anteil berufstätig. Ihre Präsenz in einigen Berufsfeldern und in Führungspositionen ist noch nicht gleich verteilt, hat sich aber in den vergangenen Jahren deutlich angeglichen. Demnach ist auch die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Frauen in Führungspositionen ein wichtiger betriebswirtschaftlicher Faktor für Unternehmen geworden. Betriebliche Maßnahmen zur Gesundheitssicherung von Führungskräften orientieren sich jedoch noch immer am Bedarf der männlichen Mitarbeiter. Die Konsequenzen liegen in zunehmenden Ausfallzeiten von Frauen und im Ausstieg aus bzw. Verzicht auf Führungspositionen. Ziel Zur gesundheitlichen Unterstützung von Frauen in Führungspositionen, entsprechend ihrer Neigungen und Fähigkeiten, ist es notwendig, spezifische Vulnerabilitäten zu identifizieren und zu berücksichtigen. Material und Methoden In Datenbanken der Disziplinen Medizin, Psychologie, Sozialwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft wurden Originalarbeiten durch verschiedene Verwendung und Verknüpfung relevanter Suchbegriffe recherchiert und nach methodischen Gesichtspunkten und im Hinblick auf die Fragestellung nachselektiert. Ergebnisse Die kombinierte Verknüpfung der Begriffe „betriebliche Gesundheitsförderung“ und „weibliche Führungskräfte“ ergab keine analysierbaren Treffer. Korrespondierende Themenkomplexe brachten folgende Zusammenhänge hervor: 1. Statistische Angaben zu Häufigkeiten von Frauen in Führungspositionen und zu demographischen Besonderheiten ergaben, dass Frauen im Alter der Familiengründung selten Führungspositionen bekleiden und dass weibliche Führungskräfte häufiger als ihre männlichen Kollegen alleine leben. 2. Arbeiten zu gesundheitlichen Risiken berufstätiger Frauen beschreiben geschlechtsimmanente Erkrankungen, deren Heilung und Verlauf oftmals durch Tätigkeiten mit starken körperlichen Anforderungen, Gefahrenstoffen und Kälte negativ beeinflusst werden. 170 Medizin und Geschlecht 3. 4. Unterschiedliche Verläufe und Einflüsse bei sogenannten geschlechtsneutralen Erkrankungen zeigten sich für den Herzinfarkt, für Rückenleiden und psychische Symptome. Untersuchungen zu Betrieblicher Gesundheitsförderung haben ergeben, dass Frauen von beratenden und Trainingsmaßnahmen im Hinblick auf körperlichen Beschwerderückgang und Zuversicht profitieren. Organisatorische Arbeitsumgestaltung verbesserten Motivation und Produktivität. Schlussfolgerungen Die Beschreibung der Gesundheit weiblicher Führungskräfte weist widersprüchliche Aussagen zur Doppelrolle und ihren belastenden und begünstigenden Auswirkungen auf die Gesundheit auf, die nahelegen, Selektionsfaktoren zur Homogenisierung der Untersuchungskollektive hinzuzufügen. Bedarfsorientierte betriebliche Präventionsmaßnahmen könnten Frauen die Ausführung von Führungspositionen erleichtern und ihre Arbeitskraft für das Unternehmen stärken. Literatur Artazcoz L et al. Social inequalities in the impact of flexible employment on different domains of psychosocial health. Journal of Epidemiology and Community Health 2005;59(9):761-67 Badura B et al. Fehlzeiten-Report 2005 - Arbeitsplatzunsicherheit und Gesundheit. Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft. Springer-Verlag 2006, Berlin Gabler Wirtschaftslexikon. Alisch K et al. (Hrsg.) 2005; Gabler Verlag, Wiesbaden, 16. Aufl. Habermann-Horstmeier L Gesundheitliche Risiken von Frauen in Führungspositionen – das Problem Alkohol. Arbeitmed.Sozialmed.Umweltmed 2006;41(1):21-25 Habermann-Horstmeier L Restriktives Essverhalten bei Frauen in Führungspositionen. Sozialmedizin 2007;42(6):326-37 Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Kurzbericht 1 2004 und 2 2006;24.2 www.iab.de Johnson LA. Menopause years especially tough for female executives. Canadian Press 2005;25 Maki N et al. The response of Male and Female Managers to Workplace Stress and Downsizing. NA J Psy 2005;7(2):297-314 Moore S et al. A longitudinal exploration of alcohol use and problems comparing managerial and non-managerial men and women. Addictive Behaviour 2003;28:687-703 171 Medizin und Geschlecht Pelfrene E et al. Use of benzodiazepine drugs and percieved job stress in a cohort of working men and women in Belgium. Results from the BELSTRESSstudy. Socscimed 2004;59:433-42 Pfeiffer W et al. Wie gesund sind Führungskräfte? Eine Querschnittsstudie zum kardiovaskulären Risikofaktorenprofil von Managern. Arbeitsmed.Sozialmed.Umweltmed.2001;36(3):126-31 Pfister G. Frauen in Führungspositionen – theoretische Überlegungen im deutschen und internationalen Diskurs. In: Doll-Tepper G, Pfister G (Hrsg.) Hat Führung ein Geschlecht? Genderarrangements in Entscheidungsgremien des deutschen Sports. 2004;35-58. Köln: Sport und Buch Strauß Stadler P et al. Gesundheitsförderliches Führen – Defizite erkennen und Fehlbelastungen der Mitarbeiter reduzieren. Arbeitmed. Sozialmed. Umweltmed. 2005;40(7):384-90 Stansfeld S et al. Psychosocial work environment and mental health – a metaanalytic review. Scand J Work Environ Health 2006;32:443-59 Ulmer J et al. Ist betriebliche Gesundheitsförderung männlich? GuG Gesundheitsforschung und Gesundheitsförderung H. Böckler-Stiftung 2004 Voß A. Frauen sind anders krank als Männer. Hugendubel, München 2007 Weber A et al. (Hrsg.). Psychosoziale Gesundheit im Beruf. Genthner Verlag, Stuttgart 2007;1 Weber A et al. Psychische und Verhaltensstörungen - die Epidemie des 21. Jahrhunderts ? Dtsch Ärztebl. 2006;103(A): 834-41 Kontakt Dr. Bettina Begerow Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation Deutsche Sporthochschule Köln Eupener Str. 20 50933 Köln Telefon: 0221 / 27 75 99 21 E-Mail: [email protected] 172 Medizin und Geschlecht 173 Medizin und Geschlecht Notizen 174 Medizin und Geschlecht Notizen 175 Medizin und Geschlecht Notizen 176 Medizin und Geschlecht Notizen 177 Medizin und Geschlecht K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Dr. phil. Bärbel Miemietz Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Hochschule Hannover Sprecherin des Kompetenzzentrums für geschlechtersensible Medizin Carl-Neuberg-Straße 1 Tel: 0511/ 532- 6501 Fax: 0511/ 532- 3441 E-Mail: [email protected] Nina-Catherin Richter Projektkoordinatorin „Medizin und Geschlecht“ Carl-Neuberg-Straße 1 Tel: 0511/ 532- 6474 Fax: 0511/ 532- 3441 E-Mail: [email protected] 178