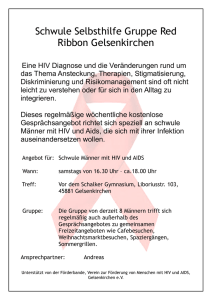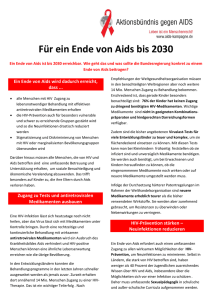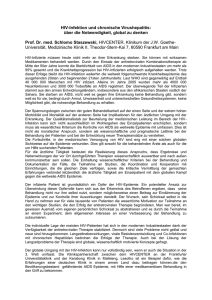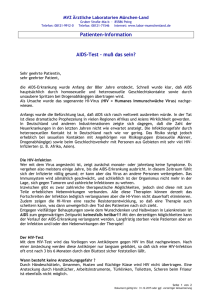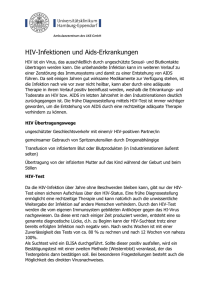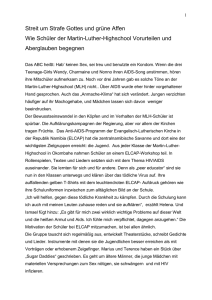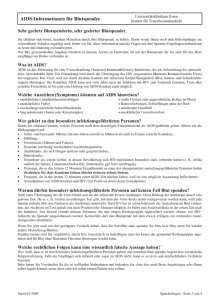1. Einleitung - Ihre Homepage bei Arcor
Werbung

Etiam si futurum est, quid iuvat dolori suo occurrere? Satis cito dolebis, cum venerit: interim tibi meliora promitte. Quid facies lucri? Tempus.1 „Auch wenn etwas Schlimmes wirklich bevorsteht – was hat es für einen Sinn, seinem Schmerz noch entgegenzugehen? Du wirst noch früh genug traurig sein, wenn er da ist; unterdessen hoffe auf Besseres. Was wirst Du damit gewinnen? Zeit!“ (Seneca, 4 v. Chr.) Quelle: Schoeck, G. (1994). Seneca. Frankfurt a. M.. Insel Verlag. Inhaltsverzeichnis 2 Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG .............................................................................................................................. 4 2. ALLGEMEINE ZUSAMMENHÄNGE ..................................................................................... 6 3. EINFÜHRUNG IN DAS KRANKHEITSBILD AIDS ............................................................ 10 3.1. EPIDEMIOLOGIE (KRANKHEITSAUSBREITUNG) ..................................................................... 13 3.2. ÄTIOLOGIE UND PATHOGENESE (KRANKHEITSENTSTEHUNG) ............................................ 13 3.3. INFEKTION ................................................................................................................................ 14 3.4. INKUBATIONSZEIT ................................................................................................................... 14 3.5. THERAPIE ................................................................................................................................. 14 3.6. KRANKHEITSSTADIENEINTEILUNG VON AIDS ...................................................................... 16 3.7. MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN IN IHRER BEDEUTUNG BEI HIV UND AIDS ......................... 20 3.7.1. ALLGEMEINE VIROLOGIE ....................................................................................................... 20 3.7.2. ALLGEMEINE IMMUNOLOGIE ................................................................................................. 23 3.7.3. PSYCHONEUROIMMUNOLOGIE................................................................................................ 27 4. DAS KONZEPT SOZIALER RÜCKHALT............................................................................ 33 4.1. „THE SUICIDE“, EMILE DURKHEIM (1897) ............................................................................ 34 4.2. BEGRIFFSBESTIMMUNG ........................................................................................................... 38 4.3. DIE SOZIALE INTEGRATION .................................................................................................... 38 4.4.DIE ERWARTETE UNTERSTÜTZUNG......................................................................................... 39 4.5. DIE ERHALTENE UNTERSTÜTZUNG ........................................................................................ 40 4.6. DIE ARTEN VON UNTERSTÜTZUNG ......................................................................................... 41 4.6.1. DIE EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG ...................................................................................... 41 4.6.2. DIE INSTRUMENTELLE UNTERSTÜTZUNG............................................................................... 42 4.6.3. DIE INFORMATIONELLE UNTERSTÜTZUNG ............................................................................. 42 4.6.4. DIE BEWERTUNGS- UND EINSCHÄTZUNGSUNTERSTÜTZUNG ................................................. 42 4.7. DIE EFFEKTE DER SOZIALEN UNTERSTÜTZUNG .................................................................... 43 4.7.1. DIE UNTERSTÜTZUNGS- UND MOBILISIERUNGSMODELLE ..................................................... 45 4.7.2. DIE WAHRNEHMUNG UND TATSÄCHLICHE WIRKUNG ........................................................... 49 4.8. QUELLEN DER SOZIALEN UNTERSTÜTZUNG .......................................................................... 49 4.8.1. FAMILIE. EIN SOZIALES SYSTEM ............................................................................................ 50 4.8.2. MERKMALE DER FAMILIE ....................................................................................................... 50 4.8.3. FAMILIENSTRUKTURELLES MODELL UND SEINE GRENZEN ................................................... 54 4.8.4. DIE EMOTIONALE BELASTUNG DER BETROFFENEN UND DEREN LEBENSPARTNER ............... 57 4.8.5. UNTERSTÜTZUNG DURCH FREUNDE ....................................................................................... 57 4.8.6. UNTERSTÜTZUNG DURCH ARBEITSKOLLEGEN UND NACHBARN ........................................... 58 4.8.7. UNTERSTÜTZUNG DER SELBSTHILFEGRUPPEN ....................................................................... 58 4.8.8. UNTERSTÜTZUNG DURCH PROFESSIONELLE BERATER .......................................................... 59 4.9. SOZIALE UNTERSTÜTZUNG UND GESUNDHEIT ...................................................................... 60 Inhaltsverzeichnis 3 5. DAS KONZEPT LEBENSQUALITÄT ................................................................................... 63 5.1. LEBENSQUALITÄT IN DER HEUTIGEN FORSCHUNG ............................................................... 65 5.2. BEGRIFFSBESTIMMUNG ........................................................................................................... 69 5.3. LEBENSQUALITÄT ALS ERGEBNIS EINES BEWÄLTIGUNGSPROZESSES ................................. 71 5.4. DIE KOMPONENTEN VON LEBENSQUALITÄT ......................................................................... 72 5.5. LEBENSQUALITÄTSFORSCHUNG UND RESULTIERENDE PROBLEME ..................................... 75 6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER AKTUELLEN BEFINDLICHKEIT IN ABHÄNGIGKEIT DES ERHALTENEN SOZIALEN RÜCKHALTES BEI HIV- UND AIDS PATIENTEN .................................................................................................................................. 76 6.1. EINFÜHRUNG ............................................................................................................................ 76 6.1.1. DATENERHEBUNG UND AUSWERTUNGSMETHODE ................................................................. 77 6.1.2. DIE FRAGESTELLUNG DER VORLIEGENDEN UNTERSUCHUNG................................................ 78 6.1.3. ABLEITUNG DER HYPOTHESEN............................................................................................... 80 6.2. VORSTELLUNG DER MESSINSTRUMENTE ............................................................................... 82 6.2.1. DER SOZIODEMOGRAPHISCHE FRAGEBOGEN ......................................................................... 82 6.2.2. DIE SYMPTOM-CHECK-LISTE (SCL-90-R) ............................................................................. 82 6.2.2.1. Die Entwicklung der SCL-90-R .......................................................................................... 82 6.2.2.2. Die Symptom-Check-Liste SCL-90-R nach Derogatis ....................................................... 83 6.2.2.3. Die Skalen der SCL-90-R ................................................................................................... 85 6.2.2.4. Die Anwendung der SCL-90-R ........................................................................................... 88 6.2.2.5. Die Auswertung der SCL-90-R ........................................................................................... 89 6.2.3. DER FRAGEBOGEN ÜBER „ERHALTENE“ SOZIALE UNTERSTÜTZUNG (UNTERST) ............... 90 6.3. BESCHREIBUNG DER STICHPROBE .......................................................................................... 92 6.3.1. SOZIODEMOGRAPHISCHE DATEN ........................................................................................... 92 6.4. ANALYSE DER MESSINSTRUMENTE ........................................................................................ 98 6.4.1. DIE SCL-90-R ........................................................................................................................ 99 6.4.2. DER FRAGEBOGEN ZUR ERHALTENEN UNTERSTÜTZUNG (UNTERST) ................................. 99 6.5. ERGEBNISSE ........................................................................................................................... 102 6.5.1. ERGEBNISSE DER SCL-90-R ................................................................................................. 102 6.5.2. ERGEBNISSE DES FRAGEBOGENS ZUR „ERHALTENEN“ UNTERSTÜTZUNG (UNTERST)...... 111 6.5.3. OFFENE KATEGORIEN........................................................................................................... 115 6.5.4. HYPOTHESENRELEVANTE ERGEBNISSE ................................................................................ 115 6.5.4.1. Interindividuelle Unterschiede .......................................................................................... 117 6.5.4.2. Die Regressionsanalyse ..................................................................................................... 120 6.6. DISKUSSION DER ERGEBNISSE .............................................................................................. 121 6.7. AUSBLICK ............................................................................................................................... 125 7. DANKSAGUNG ....................................................................................................................... 127 8. LITERATURLISTE ................................................................................................................ 129 8.1. ABBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................................................... 145 8.2. TABELLENVERZEICHNIS ........................................................................................................ 147 8.3. INTERNETQUELLEN................................................................................................................ 149 8.4. ERKLÄRUNG ........................................................................................................................... 150 Einleitung 4 1. Einleitung AIDS stellt eine nicht behandelbare Erkrankung des Immunsystems nach Infektion mit dem HI-Virus dar (http://www.hivnet.de/iagprot.htm). Gesellschaftlich betrachtet ist das Problem der HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung durch die medizinische Wissenschaft allein, trotz Integration ihres Wissens in Diagnose und Therapie, gegenwärtig nicht hinreichend gelöst. Die soziale Problematik läßt sich schon daran erkennen, daß klassische Supportsysteme bei AIDS versagen. Jäger (1989) spricht von einem „Abrücken der Verwandten“. Keine andere Erkrankung verbindet so viele unterschiedliche Lebensbereiche und Lebensstile einschließlich der daraus resultierenden diskriminierenden gesellschaftlichen Betrachtungsweisen (Franke, 1990). Das Studium der Medizin und die klinische Tätigkeit ließ eine reduktionistische Betrachtungsweise der Krankheit AIDS erkennen. Seit Beginn der HIV-Ära beschäftigt sich die Medizin rein disziplinär mit den Gebieten der Neurologie, Psychiatrie, Dermatologie und Ophthalmologie im Hinblick auf HIV und AIDS. Bemerkenswerte interdisziplinäre Ansätze lassen sich bis heute nicht erkennen (http://www.medonline.de). Mein Studium der Erziehungswissenschaft zeigte integrierende psychosoziale Problematiken und die Bemühungen, chronische Erkrankungen interdisziplinär zu verstehen. Laut Franke (1990) besteht demzufolge ein Mangel an psychosozialen Studien über HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung. Demzufolge hat der zentrale Ansatz dieser Arbeit einen interdisziplinären Charakter. Die Thematik „Gesundheit“ findet zunehmend Einzug in andere Disziplinen, wodurch der Zweig der Gesundheitspsychologie entstand. Gesundheitsverhalten und gesundheitsrelevante Kognitionen werden hinsichtlich Prävention und Intervention erforscht (Hurrelmann & Laaser, 1993). Ein interdisziplinärer Ansatz zwischen medizinischen, gesellschaftswissenschaftlichen und psychologischen Disziplinen wird hierbei angestrebt (Badura, 1994). Die Diskrepanz von medizinischen und gesellschaftswissenschaftlichen Ansätzen ist der Grund dafür, dem Mangel an psychosozialen Studien über HIV und AIDS durch eine eigene interdisziplinäre Untersuchung abzuhelfen. Einleitung 5 Zentral bei meiner Arbeit ist der Versuch, soziale und medizinische Konzepte gegenüberzustellen und die Erkenntnisse in der vorliegenden Arbeit zu verbinden, um zu einem genaueren Verständnis der Situation HIV- und AIDS Erkrankter bei gleichzeitiger Optimierung der Behandlung und sozialer Betreuung beizutragen. Allgemeine Überlegungen in Integration der behandelnden Thematik im aktuellen Kontext werden vorangestellt, um in die Multidimensionalität von AIDS aus sozialer, psychologischer und medizinischer Perspektive einzuführen. In dem empirischen Teil stelle ich meine eigene Untersuchung an 150 HIV- und AIDS Patienten vor, die ich im Zeitraum von September 1998 bis April 1999 querschnittlich in allen Erkrankungsstadien durchgeführt habe. Um eine solidarische Umgehensweise bemüht, wäre es wünschenswert, wenn die Qualität der vorliegenden Arbeit gerade von Erkrankten selbst beurteilt werden würde. Alle in der Arbeit verwendeten Termini gelten selbstredend für Frauen und Männer. Allgemeine Zusammenhänge 6 2. Allgemeine Zusammenhänge Die Diagnose der HIV-Seropositivität ist für die Betroffenen und deren soziales Umfeld ein plötzliches und in all seinen Folgen oft unbekanntes Ereignis. Eine sichere, klar umgrenzte Lebenssituation, die bis zu der Erkrankung von einem zumeist festen sozialen Umfeld, klar umschriebenen Lebensvorstellungen, Wünschen, Plänen und Erwartungen sowohl in privater als auch beruflicher Hinsicht gekennzeichnet ist, ändert sich in den allermeisten Fällen schlagartig, denn die mit der Erkrankung einhergehenden physischen, psychischen und sozialen Problematiken müssen sowohl von den HIV-Infizierten und AIDS-Erkrankten als auch von deren Umfeld in einem langen, schwierigen Prozess verstanden, angenommen, verarbeitet und bewältigt werden. Die unmittelbaren Lebensverrichtungen und auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erschweren sich im Verlauf der HIV-Erkrankung zunehmend. Diese schlagartig auftretende Lebensveränderung geht mit einer Veränderung der Lebensumstände, des Leistungspotentials, eines psychischen Traumas und einer Adaptionsproblematik einher, für die fehlende familiäre und außerfamiliäre Unterstützung verantwortlich sein können (Görres, 1994; Evans et al., 1992; Novack et al., 1991; Kallert, 1993). Weitere Beeinträchtigungen ergeben sich im Hinblick auf die Aktivitäten zu Hause, sexuelle Beziehungen sowie die Freizeitbeschäftigungen innerhalb und außerhalb des Hauses bei Patienten in einem langsam voranschreitenden Krankheitsprozess (Niemi et al., 1988; Görres, 1988a; Görres et al.; 1988; de Haan et al., 1993). Jäger (1989) spricht von einem „zweifachen Abrücken der Verwandten“. Klassische Systeme der sozialen Unterstützung versagen bei AIDS häufig gänzlich, wodurch für die Betroffenen eine chronische Überforderungssituation entsteht, welche die Phasen zwischen Erholung und Anstrengung des Bewältigungsprozesses verschiebt, mit den Folgen der aus der Psychosomatik bekannten Beschwerden, der Reaktionsbildung auf chronischen Stress. Laut Säring (1988) werden diese sekundären Symptome zu leicht als vegetative Labilität oder neurotisches Verhalten bewertet. Trotz enormer Fortschritte hat die Angst vor Infektionskrankheiten, gerade mit Beginn der neuen Krankheit AIDS nicht abgenommen. Mangelnde Erfahrungen im Umgang mit Behandlung und Therapie lassen AIDS für das soziale Umfeld als auch für Krankenschwestern und Ärzte zum Problem werden, denn als ansteckende Allgemeine Zusammenhänge 7 Infektionskrankheit ist jeder bedroht. Eine diffuse Infektionsangst in Kombination mit einem Maß an praktizierter isolierender Hygiene der Betroffenen isoliert zusätzlich. Wissen wir doch seit Kinsey, dass Sexualität und Sucht, beides Punkte die gerade mit AIDS in Verbindung gebracht werden, in jeder Form im Krankenhaus eine aus dem Bewusstsein der dort Arbeitenden weitgehend gemiedene Größe ist. Im Bereich der klinischen und vor allem in der psychosozialen Versorgung sind die AIDSSelbsthilfegruppen mittlerweile weltweit durch ihr Engagement ein unentbehrliches Bindeglied zum traditionellen Gesundheitssystem. Sie leisten Hilfe, wo soziale Hilfestellungen versagen, und korrigieren die für Patienten zusätzlich sehr belastenden unreflektierten Vorurteile und Ängste von Ärzten und Klinikpersonal. Friedrich (1981) postuliert eindringlich die Notwendigkeit supervisorischer Betreuung. Ziele und Erwartungshaltungen sollen hierbei richtig eingeschätzt werden, um seelische Beeinträchtigungen zu minimieren. Mit aller Perfektion wird um Leben in medizinischen Einrichtungen gekämpft, doch versagen alle Therapien, setzen nach Feifel et al. (1989) und Rogers (1983) alle Verhaltensweisen ein, die auch unsere Gesellschaft nach wie vor beherrschen – die Angst vor Sterbenden und vor dem Tod. Somit wird eine Ausgrenzung AIDS-Kranker, selbst im klinischen Bereich als Akt des Selbstschutzes anschaulich. Kaplan et al. (1977) zeigten bereits anschaulich, dass diese Ängste bei Krankenschwestern und Ärzten nicht geringer, sondern deutlich größer sind als in der Durchschnittsbevölkerung. Kurze Visiten, seltene und kurze Schwesternkontakte und soziale räumliche Isolation Sterbender signalisieren diese Situation (Kaplan, 1977; Kübler-Ross, 1886; Waldvogel et al., 1989). Durch Infektion und Sterben in jungen Jahren kommt es dazu, dass diese Sterbenden an eigene unerledigte Probleme ihres Umfeldes rühren. Kübler-Ross (1986) spricht hierbei von unfinished business (unerledigte Geschäfte). Im Sterbeprozess auftretende Wut, Resignation, sind bei jungen Sterbenden dynamischer und unübersehbarer als entsprechende Probleme älterer und alter Menschen (Kübler-Ross, 1986). Hieraus ergibt sich selbstverständlich, wie schwer es ist, die letzten Lebensphasen bei AIDS zu begleiten und gleichzeitig erwähnter Isolation menschenwürdig entgegenzuwirken. Nach Jäger (1989) greifen bei AIDS keine der benötigten Supportsysteme. Mit Abrücken ist zum einen die offizielle Diagnosemitteilung gemeint, wobei das Umfeld, vielleicht gegen den Willen des Erkrankten, erfährt, dass er zum Beispiel drogenabhängig oder homosexuell ist, und zum anderen die oftmals unbegründete Angst vor Ansteckung. Allgemeine Zusammenhänge 8 Die Krankheitsangst vor AIDS ist eine Angst vor Kontrollverlust, da die Krankheit die Kontrolle über das eigene Leben entzieht. AIDS wäre dann ein Zustand, dem man hilflos ausgesetzt zu sein scheint. Angst vor der Ansteckung, vor dem Krankheitsausbruch, vor der sozialen Ausgrenzung, vor der rücksichtslosen Diskriminierung am Arbeitsplatz, in der Freizeit, auf Behörden und nicht zuletzt die Angst vor dem Tod sind zentrale Ängste bei AIDS. Unterdrückung der Angst macht keinen Sinn, denn Angst vor dem Virus hat jeder zu Recht. AIDS verknüpft viele Dinge miteinander, Sexualität und Lebensbedrohung durch das Virus, unterschiedliche Sexualformen und unterschiedliche Lebensstile einschließlich der daraus resultierenden diskriminierenden gesellschaftlichen Bewertung (Franke, 1990). Irgendwie obliegt das Handeln der Einzelnen in unserer Gesellschaft einer Verwechslung: nicht vor den Infizierten, sondern vor der Infektion muss man sich schützen (Jäger, 1989). Gesellschaftlich betrachtet ist das Problem AIDS gegenwärtig nicht hinreichend gelöst. Gesundheitsverhalten und gesundheitsrelevante Kognitionen werden hinsichtlich Prävention und Intervention erforscht (Hurrelmann & Laaser, 1993). Eine interdisziplinäre Interaktion zwischen verschiedenen Einzeldisziplinen wird hierbei angestrebt (Badura, 1994). Laut Schwarzer (1990a) liefert die Gesundheitspsychologie einen wissenschaftlichen Beitrag zur: 1.) Förderung und Erhaltung der Gesundheit. 2.) Prävention und Therapie von Krankheiten. 3.) Bestimmung von Risikoverhaltensweisen. 4). Diagnose und Ursachenbestimmung von gesundheitlichen Störungen. 5.) Rehabilitation. 6.) Verbesserung des Systems gesundheitlicher Versorgung. Wachsende Bedeutung gewinnt hier die Public-Health-Lehre, die gerade durch ihren multidisziplinären Ansatz der Umweltmedizin, den Sozialwissenschaften, der medizinischen Soziologie und Psychologie charakterisiert ist. Zudem etablieren sich seit den 90er Jahren ebenfalls universitäre Ausbildungsprogramme in den Gesundheits- und Pflegebereichen in Ergänzung zur universitären medizinischen Ausbildung Allgemeine Zusammenhänge 9 (Schwartz, 1998). Public-Health-Forschung ist bevölkerungs- und systembezogen, und in dieser perspektivischen Ergänzung zu tradierten Wissenschaften entwickeln sich zunehmend andere Beobachtungs- und Beurteilungslevels. Dies ermöglicht einen erweiterten Erkenntnisraum bezogen auf Umwelt, Lebensweisen, menschliche Biologie und Gesundheitsversorgungssystemen. Gerade AIDS erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Sozial- und Naturwissenschaften, um die Komplexität dieser Infektionskrankheit ganzheitlich patientenorientiert zu erfassen. Da es bei einem so umfassenden Gebiet wie AIDS keine simple technische Lösung geben wird, ist es um so verwunderlicher, dass seit der von der WHO durchgeführten grossen AIDS-Konferenz im April 1985 in Atlanta, USA, virologische und epidemiologische Ansätze gegenüber den präventiven dominieren. Bis heute ist es wissenschaftlich umstritten, wie HIV-Infizierte beschrieben werden sollen, die keine klinischen Symptome aufweisen. Sollen sie gesund oder asymptomatisch genannt werden (Jäger, 1989). Die Definition von Gesundheit, welche die Weltgesundheitsorganisation vornimmt, soll, laut Jäger, weiter ausgelegt werden. Laut WHO ist „Gesundheit... nicht allein die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand vollkommenen sozialen, psychischen und physischen Wohlbefindens“ (Hasford, 1991,29). Die Menschen, die sich als gesund empfinden, sollten auch so beschrieben werden. Das Rollendilemma der HIV-Infizierten bezeichnet Scheidegger (1989) und Zenz (1989) als unheilbar gesund. Dennoch stellen HIV und AIDS eine Erkrankung dar, die das tägliche Leben stark beeinflussen, wodurch Betroffene auf viele Lebensbereiche verzichten müssen, was mit einer verminderten Lebensqualität einher zu gehen scheint. Somit ist AIDS kein rein medizinisches Problem, sondern ein viel größeres soziales Problem. Aus der Betrachtung der Einschränkungen Betroffener hinsichtlich gesundheitspolitischer und sozialer Aspekte stellt sich die Frage, welche Faktoren verändert werden können, um die physischen, psychischen und sozialen Problematiken AIDS-Kranker zu verbessern. In der eigenen hier vorliegenden Untersuchung geht es darum zu erfassen, inwieweit Betroffene durch ihre Erkrankung in einem Zusammenhang mit sozialer Unterstützung stehen. Bestätigt sich ein Zusammenhang, so bildet dies eine Grundlage für die Verbesserung des aktuellen Status medizinischer und sozialer Konzepte in der Situation chronisch Kranker in unserer Gesellschaft unter Berücksichtigung verbesserter Effizienz E10 Einführung in das Krankheitsbild AIDS gesundheitlicher Ressourcen bei gleichzeitiger Reduzierung eskalierender Kosten im Gesundheitswesen. 3. Einführung in das Krankheitsbild AIDS Das folgende Kapitel führt in das Immundefektsyndrom AIDS ein. Betrachtet man den Verlauf dieser langsam verlaufenden chronischen Infektionskrankheit im Hinblick auf die zunehmenden gesundheitlichen Einschränkungen, ist es für die Prävention im psychosozialen und medizinischen Bereich unerlässlich zu wissen, welche psychischen, physischen und sozialen Symptome unter dem Begriff „Immundefektsyndrom“ zusammengefasst werden, um die Betroffenen in ihrer Adaptionsproblematik adäquat unterstützen zu können. Aufgrund des interdisziplinären Anliegens dieser Arbeit wird im folgenden auf das Krankheitsbild AIDS eingegangen und im Anschluss daran auf die relevantesten medizinischen und medizinisch-psychologischen Konzepte um zu einem genaueren Verständnis der Immunschwäche AIDS beizutragen. Objektive medizinische oder psychosoziale Daten alleine zu betrachten würde der Komplexität dieser chronischen Infektionskrankheit nicht gerecht (vgl. Kapitel 1). Ein großes Problem in bezug auf die HIV Prävention ist, dass Erfolge der derzeitigen Kombinationstherapie als Heilung fehlinterpretiert werden. Dies führt zu einer Vernachlässigung des Schutzes vor der HIV Infektion (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/anfenge.htm). Somit ist es für die psychosoziale Betreuung und Präventionsarbeit unerlässlich die Grundlagen viraler, immunologischer und psychoneuroimmunologischer Mechanismen, Ansteckungs- und Übertragungswege sowie die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten zu kennen, um die Gesamtsituation Betroffener optimieren zu können. AIDS heißt acquired immuneo deficiency syndrome (erworbenes Immundefektsyndrom) aufgrund einer vorausgehenden Infektion mit dem HI-Virus (Human Immune Deficiency Virus). Erstmals wurde es 1981 in den USA als erworbenes Immundefektsyndrom beschrieben. 1982 wurden in der Bundesrepublik Deutschland die ersten AIDS-Fälle in den Städten Frankfurt am Main, München und Berlin bekannt (Hamouda & Schwartländer, 1996). E11 Einführung in das Krankheitsbild AIDS Das HI-Virus, zu Beginn LAV/HTLV III-Virus genannt, Lymphadenopathie – assoziiertes – humanes – T – Zell – lymphotropes Retrovirus, stieß eine enorme Anzahl aller bisherigen Dogmen der medizinischen Mikrobiologie um. In der Zeit vor HIV stand fest, dass sich eine Virusinfektion erst dann in der entsprechenden Krankheit manifestiert, wenn eine große Anzahl von Zellen von den Viren zerstört wurde. Das HI-Virus hingegen lässt sich im Blut Infizierter selbst nicht nachweisen. Ob jemand HIV positiv, also Träger des Virus ist, lässt sich nur anhand vorhandener Antikörper nachweisen, die das Immunsystem gegen das Virus gebildet hat. Auch die Regeln der Immunität wurden durch das HI-Virus revolutioniert. Bis zur HIV-Ära war die Medizin der Meinung, dass, wenn sich Antikörper im Blut eines Menschen gegen ein bestimmtes Virus nachweisen lassen, immun gegen eine Erkrankung sei, die von diesem Virus ausgeht. Bei der HIV-Infektion ist es genau umgekehrt. Der Körper bildet zwar die nachweisbaren Antikörper gegen das HI-Virus, doch bilden diese Antikörper keine Immunität gegen die multiplen Krankheitsformen von AIDS (Lanier et al., 1998; Geesing, 1991; Nye & Parkin, 1994). Die Krankheiten, die unter dem AIDS-Vollbild auftreten, sind, auch entgegen aller bisherigen medizinischen Lehren, keine HIV-typischen Leiden, wie etwa die Masern nach Infektion mit dem Masernvirus. AIDS ist keine Krankheit mit einem fest umrissenen eindeutigen Bild. AIDS ist ein Syndrom (gr. Syndromus: Symptomenkomplex, gleichzeitig und zusammen auftretende Krankheitszeichen), das heißt, man kannte alle einzelnen Krankheiten schon lange vor Beginn der HIV-Ära. Diese Krankheiten, isoliert, das heißt also nicht als Syndrom, treten auch als tödliche Erkrankungen bei Nicht-Infizierten auf. Immunforscher sind heute der Meinung, HIV alleine löse die tödliche Erkrankung der Pneumonia cranii, eine gefährliche Lungenentzündung, oder den sehr bösartigen Hauttumor Kaposi, nicht aus. Pilzinfektionen der Lunge sind die häufigste Todesursache bei AIDS (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/immunschwaech.htm) Seit der sexuellen Emanzipation in den 70er Jahren hält das Sexdoping Einzug in viele menschliche Lebensformen. In Zusammenhang mit dem Sexdoping, bezüglich der Entstehung der Krankheit AIDS, sei die Droge Poppers genannt. Epidemiologische Untersuchungen belegen eine Korrelation zwischen Gebrauch von Poppers und der Entwicklung von AIDS hinsichtlich des Kaposi - Sarkom (KS), (bösartiger Hauttumor). Bei AIDS-Fällen wird das KS fast ausschließlich bei jungen Homosexuellen, die Poppers benutzten, diagnostiziert. Fast nie bei anderen Betroffenengruppen. Einführung in das Krankheitsbild AIDS E12 (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/immunschwaech.htm). Poppers reduziert die Fähigkeit des Blutes Sauerstoff zu transportieren, bewirkt eine Anämie (Blutarmut), schädigt die Lunge und verursacht zelluläre Schäden, indem die nitrithaltigen Bestandteile im Körper als Nitrosamine die ungeschützte DNS (Desoxyribonukleinsäure), (vgl. Kapitel 3.7.1.) der Mitochondrien verändert und Krebserkrankungen auslöst. Ferner kann Poppers durch die direkte cardiovasculäre (herzgefäßbedingte) Wirkung Kollaps oder Infarkt und den Gehirntod bewirken. Demzufolge ist AIDS das gehäufte Auftreten längst bekannter Krankheiten und ihre Kombination miteinander. Man stirbt nicht an AIDS selbst, auch nicht an der HIVInfektion, sondern letztlich an Krankheiten, die vielleicht latent vorhanden waren, sich aber erst durch die Kombination immunschwächender Faktoren wie zum Beispiel des Sexdopings und des HIV-Virus durchsetzen konnten (Ruf, Pohle, Goebel & L’age, 1996; Jäger, 1989). Erst im fortgeschrittenen Stadium dieser slow-virus-infection AIDS treten persistierende (anhaltende) oder rezidivierende (wiederkehrende) Erkrankungen auf, die auf die viralen Defekte des Immunsystems durch das HI-Virus zurückzuführen sind. Der wichtigste Hinweis auf diesen Immundefekt ist das Auftreten therapeutisch nur schwer beherrschbarer oder gar letaler Infektionen mit opportunistischen Erregern und Parasiten (Moormann et al., 1998). Unter opportunistischen Erregern versteht man solche, die unter bestimmten Bedingungen krankheitsverursachend sind (Dressler & Wienold, 1996; Pschyrembel, 1990). Solche Bedingungen treten generell bei Patienten mit reduziertem Allgemeinzustand auf, bei Verbrennungspatienten, Frischoperierten, Patienten während oder nach Chemotherapie, Frühgeborenen, bettlägerigen Patienten und HIV-Infizierten. Durch den reduzierten Allgemeinzustand kann es zu Probleminfektionen durch Pilzinfektionen (Candida albicans), Bakterieninfektionen (Staphylococcus albus, E. coli) und Virusinfektionen kommen. Ferner kommt es im Rahmen der AIDS-Erkrankung zu malignen (bösartigen) Erkrankungen und Tumoren der Haut, des ZNS (Zentralnervensystem), des Blutes und des retikulo-endothelialen-Systems (RES). Das RES ist eine biologisch aktive funktionelle Einheit im Sinne der Immunkörperbildung, die als Endothelzellen gewissermaßen die resorbierende Innenfläche des Körpers bilden, zum Beispiel die Retikulumzellen von Milz, Lymphknoten und Knochenmark (Rohen ,1984; Frick, Leonhardt & Starck, 1987). E13 Einführung in das Krankheitsbild AIDS 3.1. Epidemiologie (Krankheitsausbreitung) Erste Krankheitsfälle von AIDS wurden in den USA im Jahre 1981 zunächst in folgenden Bevölkerungsgruppen gefunden: intravenös Drogenabhängige, Personen aus der Karibik, Hämophilie-Patienten (Bluter) und Männern mit häufig wechselnden Sexualpartnern, häufig aus dem Homosexuellenbereich kommend. Seit 1981 steigt die Zuwachsrate der an HIV- und AIDS-Erkrankten kontinuierlich (Pschyrembel, 1990). Bis 1989 galten oben erwähnte Gruppen als Hauptrisikogruppen, da die Erkrankung offensichtlich durch Sexualkontakte beziehungsweise Blut oder Blutprodukte übertragen wird, doch inzwischen betrifft die Erkrankung auch Personengruppen, die keiner dieser Risikogruppen zuzuordnen sind, so zum Beispiel heterosexuelle Frauen oder Kinder. Die Inzidenz in der Bevölkerung ist unverändert steigend. In der vorliegenden Arbeit wird die eigentlich diskriminierende Begrifflichkeit der Risikogruppe durch den Begriff Betroffene ersetzt. 3.2. Ätiologie und Pathogenese (Krankheitsentstehung) Bei Infektionen mit HIV und verwandten Virusklassen, zum Beispiel HIV 2, welches erstmals 1986 bei Patienten aus Zentralafrika isoliert wurde, handelt es sich um ein Retrovirus (siehe hierzu Kapitel allgemeine Virologie). Zielzellen des HI-Virus sind die im Blut vorkommenden T4 -Helfer-Zellen, CD4+, als Subpopulation der T-Lymphozyten sowie die Suppressorzellen OKT4+ (Nye & Parkin, 1994; Burmester & Pezzutto, 1998; Pschyrembel, 1990). Die persistierende Infektion führt durch eine kontinuierliche antigene Stimulation zu zellulären Entzündungsprozessen (Löffler & Petrides ,1990). Durch Zerstörung der infizierten Zellen kommt es zur Schwächung der zellulären Immunität, wodurch die Helferzellen kontinuierlich abnehmen. T4-Zellwerte unter 200 gelten als Indikator für eine HIV-Infektion (http://www.rki.de/INFEKT/AIDS_STD/WAD/WAD.HTM). Die T4-Zellwerte Nicht- E14 Einführung in das Krankheitsbild AIDS Infizierter variieren zwischen 250 und 2500 (http://pweb.uunet.de/pr- leitner.DO/statistik.htm ). 3.3. Infektion Das HI-Virus wurde im lymphatischen Gewebe, Blut, Vaginalsekret, Samenflüssigkeit, Speichel, Muttermilch und anderen Körperflüssigkeiten, zum Beispiel in Gelenkergüssen, infizierter Personen gefunden. Als epidemiologisch gesichert gilt nur die Übertragung durch parenterale Inokulation von infizierten Körperflüssigkeiten wie Blut, Blutbestandteilen, Injektionen, Transfusionen sowie Geschlechts- und Analverkehr (Schleimhautlaesionen als Eintrittspforte). Nach 4 – 7 Wochen entwickeln sich infizierte Antikörper, die im Serum nachweisbar sind (Wiesmann, 1982; Pschyrembel, 1990). 3.4. Inkubationszeit Die Inkubationszeit liegt bei durchschnittlich 0,5 – 8 Jahren, in Einzelfällen länger, diese Personen werden aufgrund erhöhter CD8 antiretroviraler Wirkung zu den Langzeitüberlebenden gezählt (siehe Kapitel 3.7.2.) Dies bedeutet, vorsichtig ausgedrückt, dass nicht alle Infektionen zum Vollbild AIDS führen. Bei 80 – 90% HIV-infizierter Neugeborener kommt es innerhalb der ersten 18 Lebensmonate zur Manifestation der HIVSymptome (Pschyrembel, 1990). 3.5. Therapie Eine spezifische Therapie der AIDS-Erkrankung ist zur Zeit nicht bekannt. Der Schwerpunkt der derzeitigen Therapie besteht darin, die lebensbedrohlichen opportunistischen Infektionen sowie die Neoplasien (bösartige Neubildungen) zu bekämpfen (Moormann et al., 1998). Alle derzeit erhältlichen Medikamente sind nicht fähig, eine HI-Virusreplikation dauerhaft zu unterdrücken. Das bedeutet, dass es keine Langzeitvorteile unter dem Einsatz antiretroviraler Medikamente gibt. Hohe Kosten, toxische Nebenwirkungen und die Wahrscheinlichkeit einer Resistenzentwicklung stellen Faktoren dar, die gut abgewogen E15 Einführung in das Krankheitsbild AIDS werden sollten, wenn es um den Therapiebeginn bei noch asymptomatischen Patienten geht. Derzeitiger Stand der Forschung ist die früheste Inhibition der Virusreplikation nach Infektion mit dem HI-Virus. Die Umsetzung neuerer Forschungsergebnisse in die klinische Praxis zeigt bis jetzt nur geringe Erfolge (Mertgen & Flemming, 1995). Demzufolge ist zu vermuten, dass Probanden der eigenen Untersuchung unter Nebenwirkungen der antiretroviralen Therapie leiden. Im folgenden werden die wichtigsten derzeit eingesetzten antiretroviralen Medikamente vorgestellt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit verzichte ich an dieser Stelle auf eine detaillierte pharmakologische Darstellung. Folgende Medikamentengruppen werden derzeit zur Behandlung von HIV und AIDS eingesetzt: 1. Reverse-Transkriptase-Hemmer, Beispiel: Retrovir® (AZT), (vgl. Kapitel 3.7.1.). 2. Nicht-Nukleosidale-Reverse-Transkriptase-Hemmer, Beispiel: Lovirid®. 3. Protease-Hemmer, Beispiel: Saquinavir®. (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/giftrezept.htm) Diese Medikamente bewirken eine Verzögerung des symptomatischen Stadiums und können somit zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Patienten beitragen (Lauritsen, 1990). Zwölf Medikamente der Nicht-Nukleosidale-Reverse-Transkkriptase-Hemmer (NNRTH) und der Protease-Hemmer befinden sich derzeit noch in klinischen Studien (http://www.hivnet.de/iagausbli.htm). Alle genannten Medikamentengruppen hemmen das HIV-typische Enzym Reverse Transkriptase (vgl. Kapitel 3.7.1.). Eine Mono- oder Kombinationstherapie dieser Medikamente kann AIDS nicht heilen, sondern nur, unter Abwägung der Nebenwirkungen, hinsichtlich der aktuellen körperlichen Verfassung Krankheitszeichen mildern. All diese antiretroviralen Medikamente beschreiben folgende Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen, Hautrötungen, Fieber, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen, Blutbildveränderungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit Leberentzündungen. Einführung in das Krankheitsbild AIDS E16 3.6. Krankheitsstadieneinteilung von AIDS Obwohl es mittlerweile eine neue Verfassung der AIDS-Klassifikation gibt, erwies sich in der eigenen Untersuchung die aufgeführte Stadieneinteilung als effektiver bezüglich des Verständnisses seitens betroffener Patienten (neue Klassifikation: Walter-Reed-Stufe I-VI). In einem Drittel der Fälle manifestiert sich die HIV-Infektion mit neurologischpsychiatrischen Symptomen, vor allem psychopathologischen Veränderungen im Sinne eines depressiven Syndroms, organischen Psychosyndroms, mnestische Schwierigkeiten oder einer Demenz. In 40 – 50% kommt es zu einer Mitbeteiligung des zentralen Nervensystems (ZNS): ZNS - Infektionen und ZNS – Tumore (Pschyrembel, 1990). E17 Einführung in das Krankheitsbild AIDS Tab. 3.1.: AIDS-Stadien. (in Anlehnung an Pschyrembel, 1990. Auflage 265.; Stadieneinteilung nach Definitionen des Centers for Disease Control, Atlanta,USA. Stadien Symptome und Erkrankungen I. akute HIV Infektion Infektionen des lymphatischen Gewebes mit Blutbildveränderungen II. asymptomatische HIV Infektion Keine III. persistierende generalisierte 3 Monate Lymphadenopathie bestehende Lymphknotenschwellung an mind. zwei versch. Körperabschnitten IV. andere mit HIV in Verbindung stehende Erkrankung IV.A. Allgemeinsymptome Nachtschweiß, Durchfälle, Hautveränderungen IV.B. neurologische Symptome HIV-Encephalopathie (Hirnschädigungen) IV. C. sekundäre Infektionskrankheiten herpes simplex (Lippenbläschen), herpes zoster (Gürtelrose), Lungenentzündung, Pilzerkrankung IV.D. maligne Erkrankungen Bösartige Tumore der Haut (Kaposi) und des Blutes IV.D. andere Erkrankungen Thrombozytopenie(verursacht Schleimhautblutungen) Die Stadien AIDS I-IV wurden in der eigenen Untersuchung durch die Stadien HIV keine Beschwerden, gelegentliche (http://www.aids98.ch). Beschwerden und öfters Beschwerden ergänzt E18 Einführung in das Krankheitsbild AIDS Eine Bewältigung von Anforderungssituationen resultiert aus kognitiven Einschätzungen und Bewertungen, sowie der Mobilisierung personaler und sozialer Ressourcen ( Feifel & Strack, 1989; Schwarzer, C., 1992). Gerade AIDS erfordert die Einbindung psychosozialer Konzepte in die Flut objektiver medizinischer Daten. Die durch HIV bedingten organischen hirnmorphologischen Veränderungen interagieren mit psychosozialen Folgen und emotionalen Verarbeitungsweisen (Hofmann, 1981). Der aktuelle Zustand der Betroffenen ist immer von direkten (organisch bedingten) und indirekten (durch die Persönlichkeit und der emotionalen Verarbeitung) cerebralen Schädigungsfolgen durch das HI-Virus geprägt (Hempel & Hermes, 1989). Die mit AIDS einhergehenden neurophysiologischen und neuropsychologischen Defizite, welche häufig mit hirnorganisch affektiven Veränderungen gekoppelt sind, schränken die psychischen Bewältigungsmöglichkeiten (Coping) und die soziale Kompetenz weiter ein und werden zu einem zusätzlichen erheblichen Belastungsfaktor. Dies ist einer der wesentlichsten Unterschiede von AIDS verglichen zu anderen chronischen Krankheiten. Neben der medikamentösen Therapie sollte es bei den neuropsychologischen Störungen Ziel sein, eine Besserung der sekundären Beeinträchtigungen der Hirnfunktionen bzw. eine Umorientierung der Betroffenen im Sinne einer Adaptation an das Restpotential, zu erreichen (Hempel & Hermes, 1989). Nach Hempel und Hermes (1989) treten folgende speziellen psychopathologischen Symptome, aufgrund der veränderten Hirnmorphologie, auf: - allgemeine Hirnleistungsschwäche wie Verlangsamung, Ablenkbarkeit, mangelnde Belastbarkeit, Störungen der Zielgerichtetheit des Denkens und Handelns - Teilleistungsstörungen der Informationsverarbeitung über die verschiedenen Sinneskanäle und des Gedächtnisses - Veränderungen der Affektivität und des Verhaltens, wie Einschränkungen der Kontrolle über Gefühle, Grundbedürfnisse und Verhalten, emotionale Reduktion, Ausdrucksarmut und Antriebsschwäche sowie unkritische Selbsteinschätzung. In Anlehnung an die Tabelle „Die psychologischen Auswirkungen erworbener Hirnschäden“ (Hofmann, 1981) lassen sich für HIV und AIDS modifiziert, folgende Beziehungen aufzeigen. Einführung in das Krankheitsbild AIDS E19 Tab.3.2.: Psychologische Auswirkungen erworbener Hirnschäden (Hofmann, 1981), modifiziert von Hartkopf, D.. Die Tatsache allein lebenslang Medikamente nehmen zu müssen, stellen Wöller et al. (1993) als eine chronische Bedrohung dar. Antiretrovirale Medikamente gegen AIDS müssen lebenslang eingenommen werden um den Ausbruch des AIDS-Vollbildes zu verzögern. Diese Tatsache ist ein weiterer Unterschied der Krankheit AIDS zu anderen chronisch verlaufenden Erkrankungen. Aus pharmakologischer Sicht heißt das für AIDS „es gibt keinen Weg zurück“. Medizinische Grundlagen 20 3.7. Medizinische Grundlagen in ihrer Bedeutung bei HIV und AIDS 3.7.1. Allgemeine Virologie Der Ursprung der Viren ist nicht sicher bekannt. Es werden mehrere Möglichkeiten diskutiert. Am wahrscheinlichsten erscheint die Theorie wonach Viren von zellulären Nukleinsäuren (Desoxyribonukleinsäure, DNS und Ribonukleinsäure, RNS) abstammen. Die Nukleinsäuren sind das genetische Material der Viren. Diese selbständige Nukleinsäure stammt von der Kern-DNS ab und hat die Fähigkeit erworben sich zu replizieren (vermehren), (Löffler & Petrides, 1990). Viren sind als infektiöse biochemische Einheit die kleinsten Infektionserreger und besitzen im Gegensatz zu den Bakterien und Pilzen keine Zellstruktur. Die Nukleinsäuren wurden erstmals von Friedrich Miescher (1869) entdeckt. Abb.3.1.: Friedrich Miescher (1844-1895) (http://www.mpib-tuebingen.mpg.de/miescher.htm). Bei ihrer Vermehrung sind die Viren auf die Syntheseleistung (Aufbau) ihrer Wirtszelle angewiesen. Hierbei wird der Zellmetabolismus (Zellstoffwechsel) der Wirtszelle auf die Medizinische Grundlagen 21 Produktion von infektionstauglichen Viruspartikeln umprogrammiert (Kreutzig, 1992). Neue Befunde zeigen eine virale Replikation (Vermehrung) von 10 Billionen HI-Viren pro Tag (vgl. Kapitel 3.7.4.1.), (Schedel, 1996). Die Folgen der Virusinfektion einer Wirtszelle sind Zellzerstörungen (zytopathischer Effekt) oder persistierende Infektionen (anhaltende therapieversagende Infektion). Die Gürtelrose (herpes zoster), die Lippenbläschen (herpes simplex) und die HIV-Infektion sind Beispiele für eine persistierende Infektion beim Menschen (Wiesmann, 1982). Durch Reize wie z.B. UV-Strahlen, Menstruation, Stress und Immunsuppression (Antibiotika und Chemotherapie) kann der Virus jederzeit reaktiviert werden und sogenannte Rezidiverkrankungen (wiederauftretende Erkrankung) auslösen. Grundeigenschaften der Viren Die folgende Tabelle zeigt in einer Übersicht die Grundeigenschaften der Viren. Diese Eigenschaften gelten für alle Virusklassen. Tab.3.3.: Grundeigenschaften der Viren (in Anlehnung an Silbernagl & Despopoulos, 1983). Die Grundeigenschaften der Viren Die kleinsten menschenpathogenen Infektionserreger Größe: von 20 nm – 300 nm Viren können bakteriendichte Filter passieren Nur DNS oder RNS, nie beides Vermehrung erfolgt intrazellulär in lebenden Zellen Den Viren fehlt ein Stoffwechselsystem Antibiotika sind nicht wirksam Nur wenige antivirale Chemotherapeutika hemmen eine Replikation (vgl Kapitel 3.7.4.) Viren sind potentiell pathogen mit hoher Wirtsspezifität Medizinische Grundlagen 22 Retroviren Das HI-Virus ist ein Retrovirus. Die „Reverse Transkriptase“ ist das wichtigste Enzym aller Retroviren. Enzyme sind Biokatalysatoren die alle chemischen Prozesse im Körper regeln und beschleunigen. Die pharmakologische Forschung beschäftigt sich seit der HIVÄra mit der Synthese von Wirkstoffen welche die „Reverse Transkriptase“ des HI-Virus hemmen können (vgl. Kapitel 3.7.4.2.). Das gebildete virale Erbmaterial wird durch die enzymatische Wirkung in das genetische Material der Wirtszelle integriert und zieht eine fortlaufende Bildung von spezifischer Nukleinsäure nach sich (Silbernagl & Despopoulos, 1983). Mit Hilfe der „Reversen Transkriptase“ verankert sich das HI-Virus in seiner Zielzelle, der T4 – Helfer – Zelle (immunkompetente Blutzelle, vgl. Kapitel 3.7.2.), und wirkt stark zytotozid (zelltötend). Das klinische Bild heißt AIDS. Die Bedeutung der Viruslast (viral load) Erst nach einigen Jahren ist das Immunsystem nicht mehr in der Lage, die kontinuierliche HI-Virus-Vermehrung zu verkraften. Die HI-Virusanzahl im Blut steigt stetig, und die T4 – Helfer – Zellen nehmen im gleichen Zeitraum parallel ab. Dieser Zeitpunkt stellt den Übergang von der krankheitsfreien Phase zum Erkrankungsstadium dar (Mertgen & Flemming, 1995). Neue Befunde zeigen, dass über den gesamten Verlauf der Infektion eine virale Replikation von 10 Billionen HI-Viren pro Tag stattfindet (Schedel, 1996). Dieses viral load stellt einen wesentlichen prognostischen Marker für das Voranschreiten der Erkrankung dar und gibt die Menge der HI-Viren in einem bestimmten Volumen Blut an (viral load/ ml Plasma), (Schedel, 1996). So ist es möglich, anhand des viral load und der CD4 – Zellen (vgl. Kapitel 3.7.2.) Aussagen darüber zu machen, wie hoch das Risiko ist, innerhalb der nächsten 2 Jahre Krankheitssymptome zu entwickeln. HIV Betroffene mit mehr als 500 CD4 – Zellen und gleichzeitig hoher viral load haben ein 5%iges Risiko, innerhalb der nächsten 2 Jahre an AIDS zu erkranken, wohingegen HIV Betroffene mit weniger als 50 CD4 – Zellen bei zeitgleich hoher viral load ein 70%iges Risiko haben, an AIDS zu erkranken Medizinische Grundlagen 23 (Schedel, 1996; Gürtler, 1996). Auf dieser Basis wird das viral load als Kriterium herangezogen, ab wann mit einer antiretroviralen Therapie begonnen werden sollte (Gürtler, 1996). Bei 5000-10.000 Viren-Kopien/ml Blut unter Berücksichtigung der CD4 – Zellen oder bei 30.000-50.000 Viren-Kopien/ml Blut ohne Berücksichtigung weiterer Laborparameter sollte mit der antiretroviralen Therapie begonnen werden (http://www.hivnet.de/ipi1haupt.htm). 3.7.2. Allgemeine Immunologie Um einen so hoch differenzierten und anpassungsfähigen organismischen Abwehrmechanismus als System zu entwickeln, benötigte die Evolution über 400 Millionen Jahre (Burmester, 1998). Im Bereich der Immunologie, als einem Teilgebiet der Biologie, geht es um besondere Systeme, nämlich in erster Linie um menschliche Organismen. Organismen gehören zur Klasse der autopoietischen, das heißt der sich selbst erhaltenden Systeme (an der Heiden, Roth & Schwegler, 1989). In diesem selbst herstellenden System bedingen sich die Teile und das Ganze gegenseitig, da keines ohne das andere existieren kann. Die Steuerung eines solchen Systems funktioniert über „Rückkopplungssysteme“. In dieser Form sind sie typisch für biologische Systeme. Abb.3.2.: Rückkopplungsfunktion biologisch und technisch (in Anlehnung an, an der Heiden, 1998). Medizinische Grundlagen 24 Aus den Bemühungen, Krankheitsformen als auch den Übergang von Gesundheit zu Krankheit durch mathematische Modelle zu verstehen, entspringt das Konzept der dynamischen Krankheit (Bélair, Glass, et al., 1995). Der Schutz des Körpers gegen bakterielle, virale und parasitäre Infektionen wird von einem System geleistet, das hierarchisch angeordnet ist. Natürliche Barrieren Unspezifische Abwehr Spezifische Abwehr Abb.3.3.: Die Anordnung des Immunsystems (in Anlehnung an Zänker, 1996). Im Sinne eines evolutionären Prozesses ist die unspezifische und spezifische Abwehrfunktionsleistung nicht abgeschlossen. Sie muss sich neuen Anforderungen, wie z.B. dem HI-Virus, anpassen. Eine immunologische Aktivierung wird durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen spezifischer und unspezifischer Immunfunktion bestimmt (Hennig, 1998). Hierbei erfüllt die immunologische Unterscheidung zwischen körpereigenen und körperfremden Substanzen den Zweck, die Individualität und besonders die Unversehrtheit eines Lebewesens zu garantieren. Der Fortschritt höher entwickelter Organismen und die Komplexität des Immunsystems liegt darin, dass mit der spezifischen Erkennung von Erregern und Noxen (Gifte) die Fähigkeit des Systems verbunden ist, aus diesen immunologischen Reaktionen zu „lernen“(Gemsa, Kalden & Resch, 1997). Erkrankt ein Kind nach der Infektion mit dem Masernvirus an Masern, Medizinische Grundlagen 25 wird das Kind bei einem erneuten Kontakt mit dem Virus nicht mehr erkranken, es ist immun. Für das HI-Virus gilt das nicht. Es gibt keine Immunität gegen die multiple Formen des HIV. Wenn sich der Organismus mit einem Virus auseinandersetzt, führt das zur Bildung von bestimmten Eiweißen (Proteinen), welche wiederum auf spezifische Weise mit dem Virus reagieren (Gemsa, Kalden & Resch, 1997). Chemisch gehören diese Proteine zu den Globulinen und werden aufgrund ihrer Funktion als „Antikörper“ bezeichnet. Diese sogenannten Immunglobuline (Ig) werden von den weißen Blutkörperchen produziert und dienen der Erkennung von körperfremdem Material (Burmester & Pezzutto, 1998). Diese Immunglobuline haben eine wesentliche Bedeutung bei der Auswirkung psychosozialer Stressoren auf das Immunsystem HIV-Infizierter und AIDS-Erkrankter. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem Immunglobulin A (Ig A) zu. Das Ig A ist die Klasse, die am stärksten in Tränenflüssigkeit, Verdauungssekreten und auf den Schleimhäuten vorkommt (Schimpl, 1997). Aufgrund seiner Lokalisation bietet das Ig A einen direkten Schutz bei lokalen viralen, bakteriellen und parasitären Infektionen. Immundefekt bei HIV und AIDS Das HI-Virus verursacht eine langsam verlaufende Systemerkrankung (slow-virusinfection), (Burmester & Pezzutto, 1998). Die Zielzellen des HI-Virus sind die im Blut vorkommenden T4-Helfer-Zellen. Diese Zellen sind spezialisierte Zellen des Immunsystem zur Abtötung pathogener (krankheitsverursachender) Keime. Im Verlaufe der Infektion werden sie durch das HI-Virus zerstört (Zänker, 1996). Die quantitative Erfassung der sogenannten CD4 – Helfer –Zellen ist bis heute der wichtigste Laborwert für den HIV Verlauf (L`age-Stehr & Koch, 1997). Diese Zellen sind hochempfänglich für das HI-Virus, besonders für das HIV-Hüll-Glykoprotein gp 120. Die daraus resultierende immer wiederkehrende Infektion der Zielzellen ist die zentrale Reaktion für die Pathogenese der HIV Erkrankung und den nachfolgenden klinischen Komplikationen (Schedel, 1996). Der Grund für den starken zytopathischen (zelltötenden) Effekt ist die Anhäufung und die gesteigerte Produktion von HIV-gp 120. Medizinische Grundlagen 26 HIV spezifische Immunreaktion Die CD8 – Helfer - Zellen sind diejenigen Zellen, die einen Schutz gegen das HIV darstellen. Diese Zellen wirken durch direkten Kontakt zytotoxisch gegenüber HIV infizierten Zellen (Kotler, Tierney & Francisco, 1989). Eine vermehrte Anzahl an CD8 – Helfer – Zellen schützt somit menschliche Zellen vor dem HI-Virus und geht mit einer Abnahme der Krankheitssymptome einher. Diese Aktivität der spezifischen Helferzellen wird als Charakteristikum von Betroffenen mit Langzeitüberleben (bestehende Infektion seit 10 Jahren) diskutiert (Levy, 1993; Levy, 1994). Tab.3.4.: Charakteristika von Patienten mit Langzeitüberleben (in Anlehnung an Levy, 1993). Charakteristika von Langzeitüberlebenden Geringe Viruslast (vgl.Kapitel 3.7.4.1.) Gering virulenter Typ Antikörper gegen HIV Produktion bestimmter Immunzellen (Zytokine) Hohe antivirale Aktivität der CD8 – T – Zellen Medizinische Grundlagen 27 3.7.3. Psychoneuroimmunologie Die Psychoneuroimmunologie (PNI) beschäftigt sich mit den Schnittstellen zwischen dem Zentralnervensystem (ZNS), dem endokrinen System (hormonelles System), der Immunologie und den psychosozialen Stressbelastungen in bezug auf ihre wechselseitige Beeinflussung. Laut Schwartz, Siegrist und von Troschke (1997) beeinflussen psychische Prozesse Gesundheit und Krankheit. Die ersten Zusammenhänge zwischen zentralem Nervensystem (ZNS) und dem Immunsystem erforschte bereits 1878 der Immunologe Louis Pasteur. Er bewies eine deutlich höhere Infektionsanfälligkeit unter Stressbedingungen im Tierversuch. Der japanische Arzt Tohru Ishigami beschreibt in seinen Arbeiten zur Tuberkulose hinsichtlich Inzidenz und Verlauf der Infektionskrankheit die Gemeinsamkeit emotionaler Faktoren bei allen Erkrankten. Durch die Arbeiten des russischen Physiologen Iwan Pawlow setzte sich in den 20iger Jahren eine neue Richtung durch. Pawlow postulierte die Antikörperproduktion als Reflexphänomen. Jedoch erwies sich seine Untersuchungsreihe in der Konditionierungsliteratur als unzulänglich. 1929 zeigte der Forscher Wittkower eine Blutbildveränderung in Abhängigkeit von Affekten wie Wut oder Trauer. Im Jahr 1962 beobachteten Meyer und Haggerty ein Jahr lang mehrere Familien und zeigten den Einfluss von psychosozialem Stress als Risikofaktor für die Entstehung einer Blutinfektion (beta-hämolytische Streptokokkeninfektion). Erst die Arbeiten der Forscher Ader und Cohen (1975) bewiesen eine konditionierte Immunsuppression. Die Publikation dieser Studie kann als die Geburtsstunde der Psychoneuroimmunologie betrachtet werden (Hennig, 1998). Medizinische Grundlagen 28 PNI in ihrer wechselseitigen interdisziplinären Beeinflussung Die 1975 geschaffene interdisziplinäre Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie ermöglicht durch ihre Forschungsergebnisse über die jeweils begrenzte Perspektive der Einzeldisziplinen hinaus zuschauen, um interdisziplinär Barrieren in der Erforschung schwieriger Krankheitszusammenhänge, wie zum Beispiel AIDS, zu überbrücken (Adler, 1976; Laudenslager, Fleshner, Hofstadter, Held & Simons, 1988; Nye & Parkin, 1994). Garner, Garfinkel, Schwartz und Thompson (1980) stellten in ihrer Überblicksarbeit Verbindungen zwischen psychosozialen Faktoren und den sich daraus pathologisierenden Mechanismen für den menschlichen Organismus dar. Demzufolge können psychosoziale Faktoren das Immunsystem schwächen und eine Abnahme der T4 – Helfer – Zellen bei HIV und AIDS begünstigen (Ruf, Pohle, Goebel & L`age, 1996; Petersen, Baatrup, Brandslund, Teisner, Rasmussen & Svehag, 1986). Die enge Interaktion zwischen endokrinen (hormonellen), neuronalen und immunologischen Systemen zeigt, dass das Gehirn nicht nur auf antigene, interne, sondern ebenfalls auf externe Reize, wie zum Beispiel „psychische Stimuli“, reagiert (Blalock, 1984; Besedovsky, Sorkin et al., 1977; Besedovsky & del Rey, 1996; Hennig & Netter, 1996; Lampl, Mayer, Osenbrügge & Hillemann, 1990; Stein, 1989; Brooks & Walmann, 1989). PNI und ihre Bedeutung bei HIV und AIDS Den Zusammenhang zwischen belastenden Lebensereignissen, als psychische Belastung, und den daraus resultierenden Gesundheitsfolgen zeigten die Forscher Filipp und Aymanns (1987) auf. Die HIV- und AIDS Erkrankung und die sich daraus ergebenden Lebens- und Umweltveränderungen erfordern von den Betroffenen enorme Anpassungs- und Veränderungsleistungen. Der Bewältigungsmisserfolg durch fehlende Unterstützung und die damit verbundene erhöhte Aktivität zur Erreichung sozialer und persönlicher Medizinische Grundlagen 29 Bedürfnisbefriedigung führen zu einer Chronifizierung einer Situation, in der der Wechsel zwischen Anstrengung und Erholung langfristig gestört ist (Jäger, 1989). Glaser, Glaser-Kiecolt, Speicher und Holliday (1985) postulieren in ihren Studien die Beziehung zwischen einer gesteigerten viralen Aktivität, wie bei AIDS, und stressauslösenden psychosozialen Faktoren. Belastungssituationen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Immunsystem erscheinen komplex und multifaktoriell abhängig von modulierenden Variablen wie „mitmenschliche Unterstützung“ (Glaser et al., 1985), „Einsamkeit“ (Glaser et al., 1985) und „Coping“ (Locke et al., 1984). Eine psychosoziale Belastung führt zu einer hormonellen Veränderung im Sinne einer Aktivierung der „Hypophysen1-Nebennierenrinden-Achse“ (siehe Abb. 3.4.) mit der Folge einer vermehrten Ausschüttung des Stresshormons „Cortisol“. Das Cortisol wirkt zusätzlich immunsuppressiv. Medizinische Grundlagen 30 Stress Noxen Emotionen Hypothalamus CRF (Cortico-tropin releasing Faktor) HVL Hypophysenvorderlappen ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) NNR Nebennierenrinde Cortisol Abb.3.4.: Die Einflüsse der Hormone auf die stressinduzierte Cortisolausschüttung (in Anlehnung an Kreutzig, 1992). 1 Hypophyse = Hirnanhangdrüse, hormonelle Steuerung des menschlichen Körpers (Pschyrembel, 1992) Medizinische Grundlagen 31 Laut Dillmann (1977) kommt es infolge des ständig erhöhten Cortisolspiegels zu einer Dysfunktion und demzufolge zu einer zusätzlich eingeschränkten Immunabwehrleistung bei HIV- und AIDS Erkrankten. Gerade die oberen Luftwege stellen für HIV- und AIDS Erkrankte eine wichtige Eintrittspforte für Krankheitserreger dar. Eine psychoneuroimmunologische Forschungsfrage ist, wie das Immunsystem der Atmungsorgane durch psychische Belastungen beeinflusst wird. Das feuchtwarme Milieu der oberen Luftwege bietet ein ideales Klima für Mikroorganismen. Epidemiologische Studien belegen, dass Personen mit häufigen Infekten der oberen Luftwege über eine starke psychische Belastung klagen (Graham et al., 1986; Cohen et al., 1991). Daraus lässt sich schließen, dass psychische Belastungen die Immunfunktion beeinträchtigen und somit die Infektanfälligkeit ansteigt. Im Immunsystem der oberen Luftwege spielt das Immunglobulin A (Ig A) eine bedeutsame Rolle (vgl. Kapitel 3.7.2.), (Rohen, 1984; Roitt & Lehner, 1980; Jemmott & Clelland, 1989). Eine Funktion des Ig A ist die Neutralisation von Viren, Bakterien und Pilzen. Diese Mikroorganismen sind potentielle Gefahrenquellen der Immunschwäche AIDS (Mestecky et al., 1986, 1993). Niedrige Ig A Werte gehen mit einer höheren Infektionsmöglichkeit einher (Jasnoski & Kugler, 1987; Kugler, 1991; van Rood et al., 1993; Kugler, 1994). Für AIDS bedeutet dies, dass neben der physischen Abwehrschwäche ein weiterer immunschwächender psychosozialer Faktor vorliegt, und beide immunsuppressive Faktoren die gefährliche opportunistische Infektion der oberen Luftwege und der Lunge begünstigen oder sogar auslösen (Kugler, 1996; Schedlowski et al., 1993). Kugler (1996) postuliert zudem, dass Persönlichkeitsmerkmale von Personen die sich im Hinblick auf eine Belastungseinschätzung und –Bewältigung als dysfunktional erweisen, weniger Ig A sezernieren. Fazit Eine psychische Belastung kann als das Produkt der Interaktion zwischen Situations- und Personenbedingungen verstanden werden. Die Stimulusqualität, wie Dauer und Intensität bestimmt eine psychische Belastung. Medizinische Grundlagen 32 In Anlehnung an Selyes Stresstheorie postuliert die psychoneuroimmunologische Forschung, dass eine chronische Belastung, wie zum Beispiel die HIV Infektion, eine Hemmung der Ig A Sekretion bewirkt, und somit das Infektionsrisiko für die gefährlichen opportunistischen und persistierenden Erkrankungen bei AIDS ansteigt. Von einer generellen belastungsinduzierten Immunsuppression aus psychoneuroimmunologischer Sicht ist derzeit noch nicht zu sprechen. Die derzeitigen Erkenntnisse des psychoneuroimmunologischen Wissens bringen Nutzen für weitere Therapieentwicklung und Prävention sowohl in psychosozialer als auch in medizinischer Hinsicht. Ferner erfordern diese Ergebnisse ein neues Verständnis hinsichtlich immunologischer Regulationsprozesse durch psychische Stimuli (Buske-Kirschbaum, Kirschbaum & Hellhammer, 1990). Wie biochemisch und physiologisch genau chronische Belastungen auf das Immunsystem mediiert werden, ist derzeit Gegenstand intensiver Forschung. Das Konzept Sozialer Rückhalt 33 4. Das Konzept Sozialer Rückhalt Es liegt nahe, dass die Art, wie die Erkrankung AIDS von den Betroffenen und deren Angehörigen verarbeitet wird, nicht nur den aktuellen Zustand entscheidend mit beeinflusst, sondern die gesamte weitere Entwicklung der Betroffenen und Angehörigen. Von entscheidender Bedeutung ist die Eingliederung in ein „normales“ Leben im Sinne der Aufrechterhaltung oder Neugestaltung einer funktionierenden Familien-, Sozial- und Partnerschaftsstruktur. Untersuchungen von DePompei (1987), Spanbock (1987), Durgin (1989), Kaplan (1991) und Kallert (1993) belegen die wichtige Rolle der sozialen Unterstützung durch Angehörige und das restliche soziale Umfeld. Im Interesse pädagogischer und psychologischer Arbeit stehen weniger die mechanistischen Systeme einer Regeltechnik als vielmehr die lebenden Systeme der Biokybernetik (Miller, 1978). In einer sich ständig verändernden Umwelt kann ein biologisches System nur dann überleben, wenn es sich in einem ständigen Austausch mit der Umwelt befindet und seine Elemente sich untereinander austauschen können. Ein solcher Austausch zwischen den Einzelteilen eines Systems ist die Grundlage der Erfahrungsbildung und kann nur über eine gut funktionierende Kommunikation gelingen. Die Kommunikation ermöglicht dann auch eine Differenzierung in gegliederte Strukturbereiche innerhalb des Systems. Es zeigt sich, dass ein System mit einer bestimmten Komplexität nur stabil ist, wenn es Subsysteme und sich selbst regelnde Unterstrukturen bildet und diese durch Kommunikation und Interaktion miteinander vernetzt sind. Was im Falle der hier vorliegenden Problematik, der Krankheit AIDS, eine Störung dieser Stabilität durch Störung der Kommunikation und Interaktion in der bisher von den Mitgliedern des Systems gewöhnten Form bedeutet. Die Einflüsse auf einen Krankheitsverlauf und der Krankheitsbewältigung können den prämorbiden sozialen Status der betroffenen Patienten als auch den sich aus der Erkrankung ergebenden Veränderungen seiner sozialen Situation zugeschrieben werden. Soziale Faktoren können eine Krankheitsmanifestation bewirken (Kallert, 1993). Es ist bekannt, dass als gravierend erlebte Faktoren sozialer Desintegration, wie es gesellschaftlich bei AIDS der Fall ist, zu einer Störung des psychobiologischen Gleichgewichts und somit zu einer Verschlechterung des klinischen Zustandes führen können. Daraus lässt sich folgern, dass sozial gut eingebettete Patienten mehr psychische Ressourcen zur Verfügung haben, die sie zu einer Krankheitsbewältigung einsetzen können. Untersuchungen nach Fondacaro Das Konzept Sozialer Rückhalt 34 (1987) und Holahan (1987) zeigen, dass eine ausgeprägte Unterstützung mit einem stärkeren Gebrauch von Herangehens-Coping und gleichzeitig geringerem Gebrauch von Vermeidungs-Coping einhergeht. So kann familiäre Unterstützung zu einer emotionalen Entlastung führen und einen Prädikator für die Verringerung eines Vermeidungs-Coping im zeitlichen Verlauf darstellen. Muss die Hoffnung auf eine vollständige Heilung des Patienten, wie in der vorliegenden Problematik, aufgegeben werden und lassen sich virale hirnmorphologisch bedingte Persönlichkeitsveränderungen und Verhaltensauffälligkeiten erkennen, nehmen soziale Trennungen und soziale Desintegration deutlich zu (siehe Kapitel 3), (Jäger, 1989). Angesichts der Bedeutung von sozialem Rückhalt für die Bewältigung chronischer Krankheit kann die detaillierte Analyse von sozialen Wechselbeziehungen zum Verständnis von Krankheitsbewältigung beitragen. Im folgenden wird nun detaillierter auf das Konzept der sozialen Unterstützung eingegangen. Die Begriffe „soziale Unterstützung“, „social support“ und „sozialer Rückhalt“ werden synonym angewandt. Die Begriffe social support, sozialer Rückhalt oder soziale Unterstützung beschreiben die Beziehungen zwischen Menschen. Obwohl diese Netzwerke dem Individuum helfen, da sie bestehende Werte und Handlungsmuster bereitstellen, wodurch ein Mensch seine Identität entwickeln und sozialisieren kann, werden die Wirkungen dieser Netzwerke erst seit den 70er Jahren systematisch untersucht (Schwarzer & Leppin, 1989a). 4.1. „The suicide“, Emile Durkheim (1897) Die ersten Untersuchungen zur sozialen Unterstützung waren Studien über „Selbstmord“ des Soziologen Emile Durkheim (1897), welche bis heute zur Bedeutung dieses Konstruktes beigetragen haben. „Biography: Emile Durkheim, french Sociologist and Philosopher, 1858-1917.Sociologist, born in Epinal, France, generally regarded as one of the founders of sociology. He studied in Paris, and became teacher, then taught at the university of Bordeaux, 1887, and at the Sorbonne. His writings include „Les Règles de la méthode sociologique“ (1894, The Rules of Sociological Method) and a definitive study of „ suicide (1897)“. He is perhaps best Das Konzept Sozialer Rückhalt 35 known for his concept of „collective representations“, the social power of ideas stemming from their development through the the interaction of many minds (http://www.venturetech.com/philo/phils/durkheim.html)“. Emile Durkheim Abb.4.5.: Durkheim, E., (http://www.venturrtech.com/philo/phils/durkheim.html). Durkheim beschäftigte sich in seinen Studien damit, den Selbstmord als soziales Phämomen zu erklären, und weniger den Selbstmord aufgrund persönlicher Problematiken. Anhand sozialer Statistiken zeigte Durkheim eine Prävalenz von Selbstmordraten bei Personengruppen mit geringer sozialer Anbindung (Brownell & Shumaker, 1984; Münch, 1991). Die vier nach Durkheim beschriebenen Formen des Selbstmordes stehen alle in einer engen Beziehung zu der gesellschaftlichen Situation und nehmen so Bezug zu der Begrifflichkeit des „sozialen Rückhaltes“. Den „egoistischen Selbstmord“ beschreibt Durkheim als die Folge von exzessivem Individualismus. In der Untersuchung hinsichtlich Religionszugehörigkeit und Familienstand fand Durkheim eine höhere Selbstmordrate bei Protestanten als bei Katholiken und eine noch höhere Selbstmordrate bei Juden. Starke und ausgeprägte Hierarchien der katholischen Gemeinde bedingen eine höhere soziale Kontrolle und Integration ihrer Mitglieder als es bei protestantischen Gemeinden der Fall ist (Münch, 1991). Allen Gemeinden gemein ist die Tatsache, dass die Zusammengehörigkeit das Gefühl sozialen Rückhaltes vermittelt. Durch die stärkeren sozialen Kontrollen der katholischen Gemeinde fühlen sich Menschen möglicherweise stärker integriert und greifen dann eher auf diese Schutzmechanismen der Glaubensgemeinde in eigenen Das Konzept Sozialer Rückhalt 36 Krisensituationen zurück. Das bedeutet, je stärker die Anbindung als solche ist, desto mehr potentieller Rückhalt steht den Individuen zur Verfügung. Das lässt den Rückschluss zu, dass, je schwächer das Maß der Integration in eine Gruppe ist, desto weniger erfolgreich wird eine Lebenskrise hinsichtlich der Bewältigung eingeschätzt. Eine starke Eigenverantwortlichkeit einzelner Menschen einer Glaubensgemeinschaft bedingt eine erschwerte Lösungsfindung in kritischen Lebenssituationen. Die Bedeutung des Gottesbildes hinsichtlich seiner Bedeutung in diesem Zusammenhang soll hier nicht erörtert werden. Die Anzahl der Kinder und der Familienstand stehen ebenfalls in Verbindung zur Selbstmordrate. Lebenspartner und Eltern vieler Kinder weisen eine niedrigere Selbstmordrate auf als verwitwete, unverheiratete oder kinderlose Personen. Viele sozialepidemiologische Studien belegen diesen Befund in der heutigen Support- und Gesundheitsforschung (Schwarzer & Leppin, 1989 ; Hall, 1990). Personen, die keine partnerschaftliche Beziehung führen, kinderlose Personen, oder Personen, die ihren Lebensabschnittspartner verloren haben, sind weniger durch sozialen Rückhalt geschützt. Durch die so fehlende emotionale Nähe und weniger soziale Unterstützung sehen diese Menschen durch den Selbstmord möglicherweise eine Bewältigungsalternative. Die Tatsache, dass aufgrund einer guten sozialen Einbettung Individuen einen subjektiv hohen Support erwarten, korreliert nicht mit der Tatsache, inwiefern die Individuen subjektiv erwarteten Support auch als befriedigend empfinden, was leicht zu Resignation und Enttäuschung führen kann. Der „altruistische Selbstmord“ ist kein Phänomen der Neuzeit, sondern trat schon in alten Kulturen, wie zum Beispiel im Hinduismus, auf. Unter altruistischem Selbstmord versteht man das Beenden des eigenen Lebens aufgrund gesellschaftlichen Drucks, um soziale Ziele zu wahren. Der individuelle Wert des Einzelnen ist hierbei nicht von Bedeutung, sondern nur die Gruppe der einzelnen Individuen als Ganzes. Durch Ehrverletzung oder schuldhaftes Verhalten einzelner Individuen verlangt die Gesellschaft die Selbsttötung des Betroffenen. Den altruistischen Selbstmord fand Durkheim sowohl im hinduistischen Kulturkreis als auch in der Armee. Durch die Bedeutung des gesamten Militärkörpers kommt dem einzelnen Individuum eine gewisse Bedeutungslosigkeit zu. Das Konzept Sozialer Rückhalt 37 Den „anomischen Selbstmord“ bringt Durkheim in Zusammenhang mit den politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten einer Gesellschaft. Anomie beschreibt den Zustand der Regellosigkeit in einer Gesellschaft. Die Beziehung von Selbstmord zu der wirtschaftlichen Situation beschreibt Durkheim folgendermaßen: „... wenn also Wirtschafts- oder Finanzkrisen die Selbstmordzahlen nach oben treiben, dann nicht infolge der wachsenden Armut, Konjunkturen haben die gleiche Wirkung; die Selbstmorde nehmen einfach zu wegen der Krisen, dass heißt wegen der Störungen der kollektiven Ordnung...“ (Durkheim, 1973, 278 ). Der anomische Selbstmord ist somit Folge einer für den Menschen unkontrollierbaren gestörten sozialen Dynamik in der Gesellschaft. Im Anpassungsprozeß an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen kann es zu einem Verlust wichtiger Supportquellen kommen, wodurch sich die gesamte Akteurkonstellation als hilfloser im Umgang mit schwierigen Problemen zeigen würde. Laut Durkheim korrelieren ebenfalls anomische Selbstmordraten mit hohen Scheidungsraten, da eine Scheidung den Verlust von Unterstützung bedeuten kann unter der Berücksichtigung der individuellen kulturellen und gesellschaftlichen Bewertung. Dies impliziert eine Neuorientierung in der Gesellschaft, andere soziale Rollen oder einen gesellschaftlichen Auf- oder Abstieg. Gesellschaftlicher Wandel ist auch Gegenstand der heutigen Forschungen zu sozialem Rückhalt. Zerbricht der Mensch an den Regeln und Normen und an der Starrheit der Gesellschaft, spricht Durkheim von dem „fatalistischen Selbstmord“. Der Rückhalt in zum Beispiel autoritären Staatsformen wird als nicht positiv erlebt und der Selbstmord wäre so die letzte Möglichkeit, dieser Rigidität zu entkommen. Als positiv könnte die Unterstützung erlebt werden, wenn gesellschaftliche Bedingungen eher den jeweiligen Bedürfnissen der Gesellschaftsmitglieder angepasst sind. Durch seine Untersuchungen zeigte Durkheim die Zusammenhänge zwischen einer sozialen Einbettung und dem subjektiven Wohlbefinden auf. Heckhausen (1989) spricht hierbei von der „social affilation“, den Wunsch nach sozialer Anbindung. Dieses Bedürfnis reguliert das Verhalten und die Wahrnehmung und ist somit kognitiv und behavioral handlungssteuernd. Sozialer Rückhalt hat demzufolge bei der AIDS-Erkrankung eine kognitive und handlungssteuernde Funktion in der Krankheitsbewältigung. Das Konzept Sozialer Rückhalt 38 4.2. Begriffsbestimmung Dunkel-Schetter, Blasband, Feinstein und Bernett (1991) beschreiben insgesamt drei Konzepte zu sozialem Rückhalt: die soziale Integration, die wahrgenommene und die erhaltene Unterstützung. Sozialer Rückhalt allgemein findet sich in alltäglichen Situationen ebenso wie in Situationen, in denen bestimmte Schwierigkeiten aufgetreten sind. Die Bezugsgruppe, zu der sich ein Individuum zugehörig fühlt, dient der persönlichen Orientierung, da bestehende Werte und Handlungsmuster bereitgestellt werden. Die Netzwerkmitglieder sind somit auch gleichzeitig Verhaltensmodelle. Tab.4.5.: Begriffliche Differenzierung von sozialem Rückhalt (Schwarzer, 1993a). Quantitativ-strukturell qualitativ-funktional Soziale Integration soziale Unterstützung - erwartete Unterstützung . emotionale Unterstützung . instrumentelle Unterstützung . informationelle Unterstützung . Einschätzungsunterstützung 4.3. Die soziale Integration - erhaltene Unterstützung . emotionale Unterstützung . instrumentelle Unterstützung . informationelle Unterstützung . Einschätzungsunterstützung Die soziale Integration umfasst die Präsenz und die Quantität von Sozialbeziehungen, also die Größe des Netzwerkes und die Kontakthäufigkeit (Schwarzer & Leppin, 1991b). Die Interaktionsstruktur zwischen Präsenz und Quantität ist ebenfalls ein Indikator für die soziale Integration. Hierbei interessieren nicht nur die Sozialbeziehungen von einer Person zu anderen Mitgliedern eines Netzwerkes, sondern auch die Beziehungsstrukturen, die zwischen den anderen Personen dieses Netzwerkes vorliegen. Die soziale Integration meint hier die Interdependenz der Sozialbeziehungen und die Ausgestaltung des Netzwerkes, Das Konzept Sozialer Rückhalt 39 wobei die Größe und Dichte, Dauerhaftigkeit, räumliche Nähe, Kontaktfrequenz, Homogenität, die vermittelten Inhalte und die Reziprozität von Bedeutung sind (Schwarzer & Leppin, 1989b). Die Größe des Netzwerkes ist jedoch bei der subjektiven Bewertung von sozialem Rückhalt nicht entscheidender als die Qualität sozialer Beziehungen. Quantitativ weniger aber qualitativ hohe Kontakte scheinen demnach eine optimale Wirkung, unter Berücksichtigung der Supportquelle, auf das Wohlbefinden von Personen zu haben. Cohen (1988) postuliert, dass der Rückhalt bei einer Erkrankung und der Rückhalt in Phasen von Gesundheit unabhängig sein können. Wichtig erscheint also, in welchem Maße Personen mit dem Rückhalt zufrieden sind und von welcher Quelle der Rückhalt ausgeht. Die Untersuchungen zu erwarteter und erhaltener Unterstützung geben Einblick in die Interaktionsstrukturen von Personen, und erlauben somit in der Analyse Aussagen zu den positiven oder negativen Effekten von Supportsystemen. 4.4.Die erwartete Unterstützung Diese Form der Unterstützung lässt sich nicht an reellen Gegebenheiten festmachen, sondern spiegelt die subjektive Einschätzung einer Person, hinsichtlich der Wahrnehmung, Erwartung, Gefühle in Bezug auf die soziale Einbettung, wider. Hierbei handelt es sich um Support auf kognitiver Ebene, denn laut Sarason, Sarason und Shearin (1986) ist es entscheidend, unabhängig von den Fähigkeiten und Bedingungen, inwieweit sich eine Person als sozial akzeptiert sieht. Laut Leppin (1994) kann die erwartete Unterstützung als eine Persönlichkeitsdisposition aufgefasst werden, welche die Einschätzung und die Bewältigung kritischer Lebensereignisse beeinflusst. Die Annahme, dass es sich bei sozialem Rückhalt um eine stabile Persönlichkeitsvariable handelt, ist laut Bowlby (1969) darauf zurückzuführen, dass die Überzeugung, geliebt und angenommen zu werden, aus Erfahrungen in früher Kindheit herrührt. „...aus diesen frühen Erfahrungen entwickeln sich generelle Erwartungen bezüglich der Verfügbarkeit und Verlässlichkeit von Bindungspersonen und hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten, Bindungsverhalten zu aktivieren...“ (Schwarzer & Leppin, 1989). Laut Schwarzer und Leppin (1989) überschätzen Menschen ihre sozialen Ressourcen und auch ihre eigenen Fähigkeiten. Für die Qualität von sozialem Rückhalt ist damit eine Überschätzung des tatsächlich zur Verfügung stehenden Rückhaltes gemeint. Erhaltener Das Konzept Sozialer Rückhalt 40 und erwarteter Rückhalt können in einer schwierigen Problematik weit auseinander liegen, entweder weil sich das Netzwerk nicht wie erwartet verhält oder weil eine optimistische Fehlerwartung hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Supportqualität vorliegt. Ob und wie subjektiv wahrgenommener Rückhalt zur Bewältigung einer kritischen Lebenssituation beiträgt, obliegt einer hypothetischen Einschätzung. Erwartete Unterstützung ist nicht als einachsiger Prozess zu verstehen, sondern als Interaktionsprozess der Netzwerkmitglieder. Laut Lazarus und Folkman (1987) hat die Erwartung von Rückhalt bei der Ressourceneinschätzung eine große Bedeutung, und so sprechen Pearlin, Menaghan, Liebermann und Mullan (1981) davon, dass die wahrgenommene Bereitstellung von sozialem Rückhalt die negativen Folgen von Stress mildert. Somit ist der subjektiv erwarteten Unterstützung ein protektiver Faktor in der Lebensbewältigung zuzuschreiben. 4.5. Die erhaltene Unterstützung Die Wahrscheinlichkeit soziale Unterstützung in der richtigen Form und zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten ist groß, wenn 1.) direkt um entsprechende Hilfe gebeten wird (Sachgüter oder emotionale Hilfe), 2.) das Problem genau umschrieben werden kann, 3.) um Zuwendung und 4.) um Rat gebeten wird (Cutrona, Suhr & Mac Farlane, 1990). Laut Schwarzer und Leppin (1989a, 1990) schätzen Personen, die wenig Support wahrnehmen, bei einer subjektiven Beurteilung tatsächlich erhaltener Unterstützung, diese geringer ein. Der Zusammenhang zwischen Coping und erhaltener Unterstützung ist sowohl von den Bewältigungsstrategien einer Person, als auch von deren Fähigkeit Hilfe entgegenzunehmen abhängig. Empfinden Personen Gefühle der Anspannung und Verpflichtung oder sehen sie gar ihr Selbstwertgefühl und ihren sozialen Status bedroht, werden sie nur schwer Hilfe annehmen (Suls, 1982). Das soziales Bewältigungsverhalten die Verfügbarkeit von Unterstützung bestimmt, beschreiben viele Autoren, so Schwarzer, Dunkel-Schetter, Weiner und Woo (1992) sowie Sarason und Sarason (1985a). Unzureichendes Bewältigungsverhalten Unterstützung“ kann einhergehen. so Hier mit einer treten tatsächlichen gesellschaftliche Abnahme „erhaltener Zuschreibungsprozesse (Attribuierung) in Kraft. Personen die sich durch Bluttransfusionen mit HIV infiziert haben, und auch Kinder werden nicht in dem Maße für ihre Erkrankung verantwortlich Das Konzept Sozialer Rückhalt 41 gemacht wie i.v. Drogenabhängige und Homosexuelle mit HIV, und erhalten viel eher gesellschaftliches Mitgefühl und tatsächliche Unterstützung (Franke, 1990). Übertragen lässt sich diese Situation auch auf viele andere Erkrankungen und die gesellschaftliche Bewertung darauf. Aus der Kardiologie ist bekannt, dass ein Myocardinfarkt als selbst verschuldet angesehen wird, wenn der Betroffene als Risikopatient gelebt hat, sich falsch ernährte, nie Sport getrieben hat, rauchte und adipös war (Hall, 1990). Laut Schwarzer und Leppin (1991a) zeigen erwartete und erhaltene Unterstützung keine Korrelation: „...das Konzept der wahrgenommenen Unterstützung bewegt sich zwischen konkreten zukunftsbezogenen Erwartungen an das Verhalten und Empfinden anderer einerseits und Schemata sozialer Identität andererseits. Erhaltene soziale Unterstützung dagegen bezieht sich retrospektiv auf behaviorale Prozesse, das heißt hier auf das konkrete Handeln anderer, bezogen auf die eigene Person...“ (Leppin, 1994, 93). 4.6. Die Arten von Unterstützung Wie die Tabelle 4.5. zeigt wird die erwartete und erhaltene Unterstützung in unterschiedliche Arten unterteilt: in die emotionale, die instrumentelle, die informationelle Unterstützung und den Bewertungs- und Einschätzungssupport. 4.6.1. Die emotionale Unterstützung Laut Schwarzer und Leppin (1989a) besteht die emotionale Unterstützung sowohl aus positiven Sozialbeziehungen als auch aus der Hilfe bei der Lebensbewältigung, wobei das Zugehörigkeitsgefühl und das Gefühl des Angenommenseins zentrale Faktoren sind. Direkte emotionale Unterstützung ist das Verbalisieren positiver Gefühlsäußerungen, als auch einfach jemanden in den Arm zu nehmen. Eine Atmosphäre emotionaler Unterstützung kann auch allein durch die Anwesenheit bestimmter Personen, gemeinsame Unternehmungen oder einfaches Zuhören geschaffen werden. Oft nehmen Freunde, Familie und/oder Lebensabschnittspartner diese Rolle ein. Das Konzept Sozialer Rückhalt 42 4.6.2. Die instrumentelle Unterstützung Durch die instrumentelle Unterstützung wird die Lebensbewältigung durch die Herstellung eines bestimmten Zielzustandes, begünstigt oder erleichtert. Für konkrete Handlungen hieße das zum Beispiel, jemandem Geld zu leihen, benötigte Güter zu schenken, bei schwierigen oder auch körperlich schweren Aufgaben zu helfen oder andere Gefälligkeiten zu erledigen. Kranke und behinderte Menschen sind auf diese Form der Unterstützung angewiesen, um zu überleben. Je schwieriger eine Aufgabe ist, desto kleiner ist der Personenkreis, der sich zu der Erledigung dieser Aufgabe bereit erklärt. Die schwierigsten Aufgaben übernehmen oft nur Personen, die zu den engeren Sozialbeziehungen gehören. 4.6.3. Die informationelle Unterstützung Bei der informationellen Unterstützung wird immaterielle Hilfe benötigt. Die hilfesuchende Person beschäftigt ein Problem und sucht nach einer Lösung. Die helfende Person kann durch Tips und Hinweise dazu beitragen, das Problem von einer anderen Perspektive betrachten zu können (Toshima, Kaplan & Ries, 1992). Diese Art von Unterstützung leisten Spezialisten wie zum Beispiel pädagogische Berater, Psychologen, Juristen, Ärzte etc.. So verzeichneten Gesundheitsbehörden der USA und der BRD einen deutlichen Rückgang der an Kaposi-Sarkom erkrankten und verstorbenen AIDS-Patienten nach intensiven Aufklärungskampagnen über den Gebrauch und die Wirkung der Sexdoping Droge Poppers (siehe Kapitel 3). 4.6.4. Die Bewertungs- und Einschätzungsunterstützung Bei dieser Form der Unterstützung beziehen sich die helfenden Informationen auf das Verhalten einer Person. Die betreffende Person bekommt durch ein Feedback die Möglichkeit, eigenes Verhalten zu reflektieren. Laut Schwarzer und Leppin (1989a) hat die Person dadurch die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse besser einzuschätzen. Das Konzept Sozialer Rückhalt 43 4.7. Die Effekte der sozialen Unterstützung Die Supportforschung geht davon aus, dass es eine Korrelation zwischen Social Support und Distress gibt. Unter Distress versteht man Krankheiten oder negative Befindlichkeiten. Im Intensitätsverlauf zeigen sich zwei parallele Steigungen von Stress und Distress, das heißt je mehr Stress eine Person hat und empfindet, desto größer ist auch der Distress. In der gegenseitigen Abhängigkeit ist Social Support die unabhängige Variable, und der Distress die abhängige Variable, das bedeutet, je mehr Unterstützung wahrgenommen wird, desto weniger Distress empfindet eine Person. Die Möglichkeit, dass die Korrelation durch einen dritten Faktor bedingt, positive als auch negative Zustände bewirkt, muss ausgeschlossen werden. Es gibt nach Schwarzer (1989) Modelle, die, in Pfaddiagrammen ausgedrückt, den Zusammenhang und die Wirkung von Stress und Social Support erklären. Stress + Distress Social Support - Abb.4.6.: Das Kompensationsmodell, (Schwarzer & Leppin, 1989a, 41). Sowohl der Stress als auch die soziale Unterstützung wirken im additiven Modell auf das Distressempfinden ein. Positiv empfundene Erlebnisse können die Stressempfindung reduzieren oder ausgleichen, wobei stark empfundener Stress den Distress fördert, Social Support ihn jedoch mindert. Das Konzept Sozialer Rückhalt 44 1. Das Präventionsmodell Social Support Stress + Distress Abb.4.7.: Das Präventionsmodell (Schwarzer & Leppin, 1989,42). Im Präventionsmodell ist kein direkter Effekt von Social Support auf den Distress zu beobachten. Eine Unterstützung wird schon vor Einsetzen eines Stressfaktors gegeben, und dies impliziert , dass das Auftreten von Stressoren gemindert oder gar verhindert wird. So können durch Verhaltensregeln Probleme umgangen oder gar vermieden werden. Es ist davon auszugehen, dass sozial gut eingebettete Personen Probleme als geringer belastend einschätzen als Personen ohne soziales Netzwerk. Stress Social Support + - Distress Abb.4.8.: Das weniger restriktive Modell, (Schwarzer & Leppin, 1989a, 43). Bei den Modellen 1 und 2 geht man von einer Nullkorrelation aus. Beim weniger restriktiven Modell geht man von einer direkten mindernden Wirkung des Social Support auf den Distress aus. Der zweite Effekt ist ein indirekter über den Stress. Das Konzept Sozialer Rückhalt 45 4.7.1. Die Unterstützungs- und Mobilisierungsmodelle Während das Kompensationsmodell von zwei unabhängigen Variablen, Support und Stress, ausgeht, gehen die beiden Präventionsmodelle davon aus, dass sich Social Support positiv auf die Wahrnehmung des Stressgeschehens auswirkt. Im Gegensatz dazu stehen die Support-Mobilisierungsmodelle. Bei folgenden Mobilisierungsmodellen ist die soziale Unterstützung Folge von Stress. Werden Netzwerkmitglieder auf ein Problem aufmerksam, bieten sie von sich aus Hilfe an, oder die hilfesuchende Person sucht aktiv Hilfe, jeweils mit dem Ziel, einen anderen Blickwinkel für die Stresswahrnehmung und Stressbewältigung zu erlangen. Im Folgenden werden diese Mobilisierungsmodelle vorgestellt: 1. Streß + Support Abb.4.9.: Vier Support Mobilisierungsmodelle,1 (Schwarzer & Leppin, 1989). Durch das Mobilisieren von Unterstützung wird der Distress vermieden. 2. + Stress Support + + Distress Abb.4.10.: Vier Support Mobilisierungsmodelle,2 (Schwarzer & Leppin, 1989). Das Konzept Sozialer Rückhalt 46 Hierbei wirkt sich der Stress sowohl direkt als auch indirekt auf die Unterstützung aus. Stress erzeugt Distress, aber durch mobilisierte Unterstützung wird die Wirkung des Stresses auf den Distress abgeschwächt. 3. + Stress Support + + Distress Abb.4.11.:Vier Support Mobilisierungsmodelle,3 (Schwarzer & Leppin, 1989) Dieses Diagramm stellt eine verzögerte Hilfesuche dar. Der Stressor an sich ist für eine Person nicht Anlass genug, Hilfe zu suchen. Erst durch eintretende Distresserfahrungen wird eine Person Unterstützung mobilisieren. Das Konzept Sozialer Rückhalt 47 2. Dieses Modell ist eine Erweiterung zu Modell 3. + Support Stress + + Distress 1 Distress 2 Abb.4.12.: Vier Support Mobilisierungsmodelle,4 (Schwarzer & Leppin, 1989). Der Unterschied der Modelle 3 und 4 liegt darin, dass das 4. Modell eine zeitliche Komponente beinhaltet. Die Distress 1 Erfahrung kann erst nach Einsetzen von Unterstützung als Distress 2 abgeschwächt werden (Vier Support-Mobilisierungsmodelle, Schwarzer & Leppin, 1989a, 45). Stress + Support Distress - Abb.4.13.: Das Support-Verringerungsmodell (Schwarzer & Leppin, 1989a, 46). Das Konzept Sozialer Rückhalt 48 Bei dem sogenannten Supportverringerungsmodell wird ein Stressor gegeben, welches gleichzeitig mit dem Verlust der Bezugsperson einhergeht, zum Beispiel dem Tod des Lebensabschnittpartners oder einer Trennung. Durch den Tod oder die Trennung der Bezugsperson ist eventuell auch die wichtigste Quelle von Unterstützung verloren. So lässt dieses Diagramm erkennen, dass Stress Distress erzeugt und der Stress wiederum die Unterstützung abschwächt, die den Distress mindern könnte. Ein großes Netzwerk (quantitativ hoch), welches potentiell viel Unterstützung geben könnte, kann neben den positiven Effekten immer auch negative Aspekte beinhalten. Durch Anforderungsverhalten des Netzwerkes an seine einzelnen Mitglieder kann es innerhalb dieser Bezugsgruppe zu Spannungen kommen. Die Supportforschung schenkte den positiven Effekten der sozialen Unterstützung mehr Beachtung. Der soziale Konflikt in einem Netzwerk kann direkte belastende Effekte auslösen, und so kann ein negativer Sozialkontakt in einer zusätzlich stressreichen Situation eine Verstärkerfunktion haben. Dies bedeutet, dass negative Sozialkontakte eine Verstärkung des Stressors bedingen, wohingegen der soziale Rückhalt Puffereffekte auslöst. Laut Schwarzer und Leppin (1989) stellen die soziale Unterstützung und die soziale Interaktion zwei voneinander unabhängige Dimensionen dar. Die soziale Unterstützung kann als ein Spezialfall von sozialer Interaktion angesehen werden, der sowohl positive, als auch negative Wirkungen hervorrufen kann (Schwarzer, 1996, 177). Eine vermeintlich gut gemeinte Handlung erzielt so zum Beispiel das Gegenteil der gewünschten Wirkung. Eine der häufigsten Ursachen dieser Konflikte ist das Unwissen, welches durch dann folgende unangemessene Verhaltensweisen Schuldgefühle o.ä., und somit weitere Distresserfahrungen auslösen kann. Ebenso besagt die Equity Theorie, dass Personen nach einer Homöostase ihrer sozialen Beziehungen streben. Das lässt den Rückschluss zu, dass ungleichgewichtige Beziehungen negative Emotionen auslösen. So werden nur dann Hilfeleistungen mit positiven Gefühlen angenommen, wenn der Hilfeempfänger dies hinterher in irgendeiner Form wieder ausgleichen kann, um dem Entstehen von Abhängigkeitsgefühlen entgegenzuwirken. Je enger und intimer eine Beziehung ist, desto geringer ist die erwartete Gegenleistung. Das Konzept Sozialer Rückhalt 49 Kommt es in Partnerschaften oder sehr engen Freundschaften zu Ungleichgewichten, wird dies länger toleriert, als es bei flüchtigen Bekanntschaften je der Fall sein würde. Brehm und Abele (1990) beschreiben in der Reaktanztheorie, dass Individuen bestrebt sind, ihre Entscheidungsfreiheit aufrecht zu erhalten (Schwarzer & Leppin, 1989). Nach der Attributionstheorie (Jones, 1990; Kelly, 1991) hinterfragen Individuen, aus welchen Gründen ihnen geholfen wurde und ob diese Hilfe wirklich benötigt wurde. Der Grund Hilfe zu geben oder nicht entgegenzunehmen, kann unterschiedlich motiviert sein. So kann die Sorge oder auch nur das Pflichtgefühl die Motivgrundlage sein. Schätzt ein Hilfesuchender die zu erhaltene Hilfe als gute Absicht des Gebers ein, wird dieser die angebotene Hilfe eher annehmen unter der Berücksichtigung einer möglichen Bedrohung des Selbstwertgefühls. 4.7.2. Die Wahrnehmung und tatsächliche Wirkung Es gibt Unterstützung, die zwar als positiv empfunden wird, aber in Wirklichkeit nicht hilfreich ist. So können Bindungen und auch Hilfeleistungen zur emotionalen Abhängigkeit führen. Froh darüber zu sein, einen Beistand zu haben, birgt in solchen Konstellationen langfristig eine Reduzierung der eigenen Bewältigungskapazität (Schwarzer & Leppin, 1989). Um die gewünschte Wirkung einer sozialen Unterstützung zu erzielen müssen folgende Punkte vorhanden sein: „...sie muss die Bedrohung verringern, die von den aktuellen Lebensproblemen ausgeht, und sie muss die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Person in Zukunft erfolgreich mit dem Problem umgeht, ohne von fremder Hilfe abhängig zu sein...“ (Fisher et al., 1982). Die soziale Unterstützung sollte individuell auf die Problematiken und die Bedürfnisse abgestimmt werden ohne dass die Betroffenen ihre Autonomie verlieren. 4.8. Quellen der Sozialen Unterstützung Quellen sozialer Unterstützung können alle zum sozialen Umfeld gehörenden Personen eines Individuums sein. Laut Cohen (1985), Lin (1986), Schwarzer und Leppin (1989a) können spezifische Supportarten durch die Vermittlung von bestimmten Personen helfen. Alle möglichen Personen-Umwelt-Bezüge und Interaktionspartner in einer sozialen Das Konzept Sozialer Rückhalt 50 Akteurkonstellation vorzustellen, ist aufgrund der Komplexität in dieser Arbeit nicht möglich. In der vorliegenden Arbeit werden Supportquellen vorgestellt, die fast jedes Umfeld aufzeigt: Familie, Lebensabschnittspartner, Freunde und Arbeitskollegen. 4.8.1. Familie. Ein soziales System Die Systemtheorie begründet sich aus der Idee, dass Gesetzmäßigkeiten in verschiedenen Gebieten zu finden seien und sich gleichen, sobald ihre Strukturen beobachtet werden, die ihren Systemcharakter ausmachen (Bertalanffy, 1956, 1972; Schlippe, 1993). Das System beschreibt ein Ganzes, welches durch die Art der Beziehung der einzelnen Teile untereinander und ihre Interdependenz gebildet wird (Bavelas & Segal, 1982). Aspekte der Dynamik und Regelung verbindet die Systemelemente untereinander und durch Abhängigkeit und Abweichung wird ein Gleichgewicht aufrecht erhalten. Ein System mit seiner bestimmten Komplexität ist nur dann stabil, wenn es Subsysteme und sich selbst regelnde Unterstrukturen bildet. 4.8.2. Merkmale der Familie Die Familie ist ein offenes, sich selbst regulierendes System, deren Mitglieder in Interdependenz untereinander und ihrer Umwelt stehen. So richtet sich der Fokus bei Untersuchungen chronischer Krankheiten nicht auf Motive und individuelle Reaktionen einzelner Familienmitglieder, sondern vielmehr auf die Interaktionsveränderungen innerhalb der Familie. Daher spricht Jäger (1989) bei AIDS von einem Abrücken der Verwandten. Durch die Veränderung des Systems durch das Auftreten chronischer Krankheiten, wie zum Beispiel AIDS, ist das bestehende Gleichgewicht des Systems gefährdet, so dass Bemühungen mobilisiert werden können, das Gleichgewicht zu erhalten oder wieder herzustellen. Das Konzept Sozialer Rückhalt 51 Es gibt einige Dimensionen, welche die Funktionsfähigkeit eines Familiensystems beschreiben (Beutel, 1988): 1. Differenzierung des Systems. Familiensysteme sind in Subsysteme, wie zum Beispiel Eltern, Kinder etc., differenziert und durch Interaktion, Interessen und Aktivität charakterisiert. Die Durchlässigkeit des Systems gilt als Indikator für die Differenzierung. 2. Durchlässigkeit . In den meisten Ansätzen nimmt dieses Konzept Durchlässigkeit, obwohl schwer präzisierbar, einen zentralen Stellenwert ein (Minuchin, 1977). Regeln und die Art, auf welche eine Interaktion stattfindet, sowie die Klarheit und die Eindeutigkeit der Grenzen zwischen den Subsystemen sind wichtige Kennzeichen der familiären Systeme. - Eng verflochtene Systeme zeigen eine deutlich geringere Autonomie und entmutigen so selbständiges Problemlösen bei gleichzeitig starken Gefühlen der Zugehörigkeit. In einem solchen System wirkt sich die Belastung einer chronischen Erkrankung stark auf alle anderen Mitglieder aus. - Disengagierte und gespaltene Systeme zeichnen sich aus durch fehlende Loyalität, fehlendes Zugehörigkeitsgefühl sowie fehlende Fähigkeit, gegenseitige Unterstützung zu geben oder zu suchen bei zeitgleich hoher Autonomie der einzelnen Mitglieder. - Ein klar abgegrenztes System ist laut Minuchin (1977) optimal für Support und die persönliche Handlungsfähigkeit. Laut Balck et al. (1982) sind offene Familiensysteme zugleich mit anderen Netzsystemen synergistisch verknüpft, welches die Klarheit und Durchlässigkeit von Grenzen zur Umwelt, im Sinne adaptiver Funktionen, bedingt. 3. Stabilität Nach dem biokybernetischen Ansatz zeigen Familiensysteme, wie alle Lebenssysteme, eine homöostatische Tendenz hinsichtlich der Umgehung störender Einflüsse sowie der Das Konzept Sozialer Rückhalt 52 Veränderungsfähigkeit (Selvini-Palazzoli et al., 1978). Negative Rückkopplungsprozesse (siehe Kapitel 3.7.2.) stellen diesen Wechselgrad zwischen Gleichgewicht und Ungleichgewicht dar. 4. Adaptionsfähigkeit Zentraler Gedanke ist hierbei, inwieweit sich familiäre Systeme als flexibel zeigen, hinsichtlich der Mobilisierung alternativer Interaktionsmuster, der Integration übereinstimmender gemeinsamer Familienthemen und Familienziele, der Erreichung des Grades der persönlichen Befriedigung als auch die Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse ( Friedrich ,1981). 5. Ganzheitlichkeit und Holismus Als Ganzheit sind die Mitglieder eines familiären Systems über Kommunikation und Interaktion verbunden, welche sich qualitativ klar umrissen von der quantitativen Merkmalsausprägung unterscheiden. Ändert sich die Ganzheit, zum Beispiel durch die AIDS-Erkrankung eines Mitgliedes dieses Systems, ändert sich das gesamt System Familie. Im Umkehreffekt ist es möglich, dass die Ganzheit des Systems verantwortlich für das veränderte Verhalten eines einzelnen Mitgliedes sein kann. Um veränderte Verhaltensweisen einzelner Mitglieder zu verstehen, müssen interpersonelle als auch intrapersonale Sichtweisen berücksichtigt werden. 6. Zielorientierung, Prozessualität Das gemeinschaftliche Leben wird nach konkreten Zielen ausgerichtet, die dem Zusammenleben in der Familie dienen und Kontinuität vermitteln. Dies impliziert eine prozesshafte zeitlich bedingte Veränderung. Die Ziele selbst obliegen den Inhalten der einzelnen Subsysteme (Eltern, Kinder, Geschwister unter sich, Partner unter sich), (Duvall, 1977). Erkrankt nun ein Mitglied des familiären Systems an AIDS, erfahren alle Mitglieder des Systems eine Störung hinsichtlich der familiären und individuellen Zielbenennung und Zielerreichung durch die gesamte Beeinträchtigung aufgrund der Erkrankung. Das Konzept Sozialer Rückhalt 53 7. Selbstregulation Durch diese Selbstregulationsfähigkeit werden familiäre Systeme befähigt, Ziele zu erreichen. Die Erkenntnisse positiver und negativer Rückkopplung familiärer und biologischer Systeme (Siehe Kapitel 3.7.2.) dienen dem grundlegenden Verständnis der Selbstregulation. Wenn sich die Eltern auseinandersetzen, es zur Eskalation inklusive der Reihenfolge erst streiten, dann schreien und dann schlagen, kommt es zur abweichungsverstärkenden positiven Rückkopplung, welches zum Zerbrechen des Systems führen könnte. Schon vor der Eskalation müsste die negative Rückkopplung einsetzen, um präventiv größere Schäden zu vermeiden. Tritt in solchen Fällen nie die negative Rückkopplung ein, kann es zu einem circulus vitiosus kommen, der sich jeglicher Kontrolle entzieht. Es gibt kein lebensfähiges System, das ohne negative Rückkopplung funktioniert (Vester ,1985). 8. Kalibrierung ( Neueinstellung ) Die Entwicklung der Familie vollzieht sich stufenweise, nicht linear und erfordert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Sinne der Modifikationsfähigkeit bestehender Regeln während des gesamten Lebens (Kalibrierung), (Duvall, 1977). Sowohl intrafamiliäre Prozesse als auch externe Bedingungen (Kindergarten, Schule, Ausbildung oder Studium) erfordern eine ständige Kalibrierung, was vielen Familiensystemen schon bei einkalkulierbaren gesellschaftlichen (zum Beispiel Einschulung) und biologischen Situationen (zum Beispiel Pubertät) schwerfällt. Als unlösbares Problem erscheint dann die chronische Erkrankung eines Mitgliedes dieses Systems. Eine Kalibrierung kann nicht stattfinden. 9. Regeln Regeln erhalten die Balance und steuern das Verhältnis zwischen Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Regeln determinieren Richtlinien für das Zusammenleben in einem sozialen System (Hehl, 1988). Systemregeln können mehr oder weniger internalisiert sein, sind aber richtungsweisend dafür, inwieweit sie als wichtig wahrgenommen werden, sich Das Konzept Sozialer Rückhalt 54 mit den Bedürfnissen der Systemmitglieder decken und ob sie der jeweiligen Entwicklungsstufe des familiären Systems angepasst sind. 4.8.3. Familienstrukturelles Modell und seine Grenzen Das Familiensystem ist durch äußere Grenzen und seine innere Struktur (innere Begrenzung, Subsysteme) gekennzeichnet (Minuchin, 1977). Minuchin unterscheidet drei Formen von Grenzen: - rigide, undurchlässige Grenzen - flexible, klare Grenzen - diffuse, verwischte Grenzen. In der Tabelle 4.6. Matrix der Identität postuliert Minuchin, dass die Einhaltung der Grenzen die Verantwortung für die gesunde Entwicklung der Familienmitglieder sei. Gemeint ist eine Autonomie bei gleichzeitigem Zugehörigkeitsgefühl als wesentlichen Aspekt des Identitätsgefühls. Tab.4.6.: Die Matrix der Identität (Minuchin, 1977). Das Konzept Sozialer Rückhalt 55 Isolierung Klarheit Verstrickung - - - rigide, undurchlässige Grenzen Flexible, klare Diffuse, verwischte Grenzen Grenzen Die Mitglieder der - Die Autonomie des Zugehörigkeitsgefühl Subsysteme Einzelnen ist schlecht ausgeprägt vollziehen beeinträchtigt Keine Möglichkeit um - ihre Funktionen Hilfe zu bitten ohne unzulässige kognitiv-affektiven - Größte Angst: Nähe Einmischung von Fähigkeiten - Protektive Funktionen außen - - Loyalität und behindert - - - - Kontakt zu anderen Beschneidung von Größte Angst: Trennung - Mangelnde Mitgliedern Differenzierung der anderer Subsysteme Subsysteme ist möglich . Unklare, verschwommene und diffuse Grenzen zwischen den Personen behindern eine Entwicklung zur autonomen Persönlichkeit. Wenn andere Personen für andere sprechen oder antworten, spricht man von verstrickten Familien, wo über Generationen hinweg die Bindungskräfte dominieren. Diese Familiensysteme grenzen sich als geschlossene Systeme nach außen ab, wobei die Grenzen zwischen den Subsystemen und auch zwischen den Generationen unscharf sind. Laut Ritschl (1987) bestehen zwischen Mitgliedern dieses Systems keine Geheimnisse, und es bilden sich Legenden und Mythen über die Güte und Stärke der Familie. Das System ist durch ein hohes Maß an Kommunikation und Das Konzept Sozialer Rückhalt 56 wechselseitiger Anteilnahme verbunden. Verstrickte Familien sind stolz auf die Familienatmosphäre und ihre Loyalität, wobei das pathologische Ausmaß von Interesse und Engagement völlig verkannt wird. In losgelösten oder gespaltenen Familien bestehen rigide und undurchlässige Grenzen. Sie sind gekennzeichnet durch einen Mangel an Bezogenheit, und die dominanten zentrifugalen Kräfte drohen das soziale System zu zerstören. In einer extremen Ausprägung sorgt das System dafür, dass ein unter Belastung stehendes Mitglied des Systems die starren Grenzen nicht überschreiten kann. Eine individuelle Belastung eines Familienmitgliedes macht sich bei verstrickten Familien schnell bemerkbar, wohingegen schon eine sehr hohe Belastung in einer gespaltenen Familie auftreten muss, um stützende Mechanismen zu aktivieren. Laut Minuchin erlauben nur klare und flexible Grenzen eine gesunde individuelle Entwicklung bei gleichzeitigem Gefühl der Zugehörigkeit. Stierlin et al. (1980) glauben, dass das typische Muster in der gespaltenen Familie über Generationen hinweg aufrecht erhalten wird. Laut Minuchin et al. (1975) kann man davon ausgehen, dass die vorherrschende Familienstruktur maßgeblich zur Verarbeitung chronischer Krankheit und der Krankheitsbewältigung (Coping) beiträgt. Das bedeutet, dass gestörte Beziehungen und unverarbeitete Konflikte aus der eigenen Herkunftsfamilie bis in die neue Generation reichen, sich hier verdichten, symptomatisch niederschlagen und so bei chronischer Krankheit, wie bei AIDS, zu einer erschwerten Krankheitsbewältigung führen können (Roedel, 1990, 1994). Laut Anderson und Burry (1988) kann sich Familiensupport positiv als auch negativ auswirken. Angehörige können bei der Betreuung zum Beispiel chronisch Krebserkrankter die Hilflosigkeit eher noch verstärken (Schwarzer, 1982) im Sinne ihrer eigenen persönlichen Betroffenheit in bezug auf biographisch verankerte Erlebens- und Auseinandersetzungsformen. Überfürsorglichkeit oder Verleugnung der Krankheit können negative Konsequenzen des Coping nach sich ziehen. Das Konzept Sozialer Rückhalt 57 4.8.4. Die emotionale Belastung der Betroffenen und deren Lebenspartner Aufgrund der dargestellten Störungsbilder sind die Partner oftmals überfordert in der Alleinübernahme familiärer Aufgaben, insbesondere der Krankenpflege und Betreuung des erkrankten Partners und durch die Notwendigkeit, mit der sozialen Reaktion fertig zu werden. Nach infausten Prognosen, wie AIDS, nehmen, wie erwähnt, soziale Trennungen und weitere Desintegration zu. Die Art und Weise seitens der Patienten, gesundheitliche Einschränkungen zu bewältigen, ist abhängig von (Kallert, 1993): 1. Alter, Geschlecht, Bildungsstand, prämorbider Persönlichkeit. 2. von den biographisch verankerten Erlebens- und Auseinandersetzungsformen. 3. von dem Selbstbild der Person. 4. von dem Grad der Überzeugung, die Situation mit HIV gestalten, verändern und kontrollieren zu können (siehe hierzu Kapitel „Lebensqualität“ zu ‚Fremd- und Selbsteinschätzung‘). 5. von dem Differenzierungsgrad der Zukunftsperspektive. 6. von der Kompetenz der Person, wobei sowohl die objektiv gegebene, als auch die subjektiv erlebte Kompetenz von Bedeutung ist (Fremd- versus Selbsteinschätzung). 7. von dem Ausmaß sozialer Integration und sozialer Unterstützung. 8. von der Gesamtsituation der Person zu der neben objektiven Faktoren (Beruf, Partner, gesundheitliche und wirtschaftliche Situation, Wohnungssituation) auch die subjektiv erlebten Faktoren gehören. 9. Familien- und sozialanamnestische Vorerfahrungen der Patienten und ihrer Angehörigen. 4.8.5. Unterstützung durch Freunde Procidano und Heller (1983) postulieren eine Unterscheidung zwischen familiärem Support und Support durch Freunde, da betroffene Patienten in unterschiedlichem Maße von familiärer und non-familiärer Unterstützung profitieren. Über die Entwicklungsphasen erfährt eine Person die sich immer wieder verändernde Bedeutung von Freunden. Je komplizierter und persönlicher die Krise ist, in der Support benötigt wird, desto enger wird die Beziehung zu den potentiellen Unterstützern sein (Schwarzer & Leppin, 1989). Im Laufe einer voranschreitenden Infektionskrankheit durchlaufen die Patienten Stadien der Verweigerung, der Emotionalität, der Verhandlung, der Depression und der Annahme (Kübler-Ross, 1986), und so verändern sich demzufolge die Bedürfnisse nach Support in Das Konzept Sozialer Rückhalt 58 den verschiedenen Phasen. Eine Langzeituntersuchung an Witwen zeigte, dass sich in den Phasen der Anpassung und Bewältigung Freunde als hilfreicher erwiesen als besorgte Familienmitglieder (Schwarzer, 1982; Schwarzer & Leppin, 1989). Hierbei sind Freunde vielleicht eher an der Aufnahme einer neuen Beziehung und an einem neuen Leben des Freundes/der Freundin interessiert als im Vergleich zu der Familie. 4.8.6. Unterstützung durch Arbeitskollegen und Nachbarn Bezug nehmend auf Untersuchungen von Kobasa (1982) weisen Schwarzer und Leppin (1989a) daraufhin, dass physische und psychische Beeinträchtigungen als Arbeitsplatzstressfolge durch den Support von Vorgesetzten positiv beeinflusst werden können. Für Support der Familie konnte dies nicht bestätigt werden. Geht es um Umstrukturierungen von Arbeitsplätzen bei chronischen Erkrankungen, ließ sich im Fall der vorliegenden Problematik AIDS kaum Supportverhalten seitens Arbeitskollegen oder Vorgesetzten finden. Berentungen, Kündigungen oder Versetzungen zeigen doch eher diskriminierendes Verhalten als integrierendes Verhalten und Wohlwollen chronisch kranken Menschen gegenüber (siehe „unfinished business“ von Kübler-Ross im Konzept Lebensqualität). Aufgrund der räumlichen Nähe können gute Beziehungen zu den Nachbarn im Falle von Krankheit und Gebrechlichkeit von Vorteil zur Befriedigung der alltäglichen Bedürfnisse sein (Erledigung von Einkäufen, Hilfestellung bei der Verrichtung von Haushaltspflichten, etc.), (Jäger, 1989). 4.8.7. Unterstützung der Selbsthilfegruppen Die AIDS-Hilfe ist mittlerweile unersetzliches Bindeglied zu den tradierten medizinischen Wissenschaften und der professionellen Krankenpflege geworden. Mit der Hilfe zur Selbsthilfe wird instrumentelle, informationelle als auch emotionale Unterstützung dort zur Verfügung gestellt, wo klassische Supportsysteme bei HIV und AIDS versagen. Grundund Behandlungspflege, Einkäufe, Haushaltshilfen, Behördengänge, Begleitung in die HIV-Ambulanzen, regelmäßige Medikamentenapplikationen wie auch, unter Berücksichtigung des Erkrankungsstadiums, Freizeitaktivitäten, Begleitung und Das Konzept Sozialer Rückhalt 59 Betreuung bei stationären Aufenthalten und therapeutische Beratung sind im Verlaufe dieser Erkrankung unerlässlich geworden. Zu diesen wesentlichen Quellen der Unterstützung kann gesagt werden, dass die oftmals ehrenamtlich Arbeitenden Techniken des Stressmanagements vermitteln, um die enormen Bewältigungsanstrengungen der Patienten im Sinne Lebensqualitätssicherung einer zu patientenorientierten erleichtern. Die Versorgung Ressourcen der bei zeitgleicher Bewältigung von krankheitsbedingten (emotional und aufgabenbezogen) Anforderungen müssen mit dem jeweiligen Lebenskontext der Person und dem Zeitpunkt, in dem ein kritisches Ereignis eintritt, in Verbindung stehen. 4.8.8. Unterstützung durch professionelle Berater Eine weitere Beratungsstellen Quelle geben der Unterstützung ist Ratsuchenden die professionelle instrumentelle, Beratung. informationelle und Die auch Einschätzungsunterstützung. Für viele chronische Erkrankungen stehen professionelle Beratungsstellen zur Verfügung: die AIDS-Hilfen, Mucoviscidose-Liga, Liga für Patienten mit chronischer Polyarthritis, Anonyme Alkoholiker (AA) etc.. In der eigenen Untersuchung wurde diese Form von Support als sehr hilfreich beurteilt. Es ist in der Arbeit aufgezeigt worden, das Unterstützung sowohl negative als auch positive Effekte haben kann. Schwarzer (1992c) wies in Untersuchungen nach, das erhaltener sozialer Rückhalt „...auch scheitern oder sogar Schaden anrichten kann...“ (Schwarzer, 1992c) und so sollte sozialer Rückhalt als ein Spezialfall sozialer Interaktion mit sowohl positiven als auch negativen Konsequenzen zu verstehen sein. Die Schwierigkeit der sowohl positiven als auch negativen Effekte des Support umgehen einige Autoren. Hierbei wird Support generell in Verbindung mit positiver Wirkung in Verbindung gebracht und andere Beziehungsmuster als soziale Konflikte bezeichnet (Schwarzer & Leppin, 1989). Der wichtige Faktor ist die Beziehung zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebenden, was Schwarzer (1992c) wie folgt beschreibt: „...die Art und Weise der Kommunikation spielt Das Konzept Sozialer Rückhalt 60 eine Rolle, die Mitteilung von Erwartungen, Rückmeldungen und die Wahrnehmung von Gegenseitigkeit, Verbindlichkeit und Interdependenz...“. Die Signale zwischen Geber und Empfänger sind also wesentlich für eine soziale Interaktion. Auch Hobfoll (1985) postuliert, im Hinblick auf positive oder negative Wirkung, auf situative und personale Determinanten „...ecological congruence...is defined as the fit of a given resource or set of recources to meet the emotional and task requirements of a given stress situation, for a given group, at a given point of their lives, and at a given time in relationship to the occurance of a crisis event...“ (Hobfoll, 1985, 396). Somit ist Support nur dann wirkungsvoll, wenn emotionale und aufgabenbezogene Ressourcen zur Bewältigung sowohl in Verbindung zum jeweiligen Lebenskontext als auch zu dem Zeitpunkt des kritischen Ereignisses steht. 4.9. Soziale Unterstützung und Gesundheit In einigen Untersuchungen, Eysenck (1991a), Siegrist (1985) und Hall (1990) zeigen die Autoren, dass es verschiedene Persönlichkeitsvariablen gibt, die ein erhöhtes Risiko mit sich tragen, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken. Extraversion, Emotionsunterdrückung und rational-anti-emotionales Verhalten sind einige Variablen, die zu einer Karzinogenese führen können. Gleichzeitig wirken diese Variablen auch negativ auf die Bewältigung von Krebserkrankungen. Die Variable Hardiness (Kobasa, 1982) bedeutet großes berufliches Engagement hinsichtlich des Gefühls des Wahrnehmens, Kontrolle und Effektivität zu haben. In bezug auf das gesundheitliche Befinden zeigt Hardiness eine stärkere Wirkung als Social Support. Der Social Support wird dann wichtig, wenn ein Stressor dauerhaft bleibt oder wenn kein starkes Selbstkonzept vorhanden ist. Der Persönlichkeitsfaktor dominiert gegenüber Social Support (Hobfoll, 1988). Carver (1993) postuliert, dass Optimisten und Personen mit einem starken Selbstwertgefühl mehr Social Support erhalten als Pessimisten und Personen mit weniger ausgeprägtem Selbstwertgefühl. Bei einer hohen internalen Kontrollüberzeugung scheinen Personen die vorhandenen Ressourcen effektiver nutzen zu können, wodurch sie mehr von der Unterstützung Das Konzept Sozialer Rückhalt 61 profitieren. Laut Schwarzer und Leppin (1989) ist es hierbei wichtig, dass die Person an die Effektivität des hilfesuchenden Verhaltens glaubt. Ferner gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung und Social Support zwischen Männern und Frauen. Frauen empfinden ihre Netzwerke als größer, intensiver und erleben sie als hilfreicher. Frauen ist das Netzwerk wichtiger, und ferner zählen sie mehr Personen aus ihrem Netzwerk zu den Bezugspersonen. Weiterhin finden sich Unterschiede in den Beziehungen bezüglich der Intimität. Beziehungen von Frauen zu Personen aus ihrem Netzwerk sind intimer als die Beziehungen zwischen den Männern. In einer Partnerschaft sind Frauen oft die vertrautesten Gesprächspersonen des Mannes. Männer erhalten so in einer Partnerschaft und im Falle einer chronischen Erkrankung mehr Social Support (Siegrist, 1985; Hall, 1990; Schwarzer & Leppin, 1990). Ein weiteres Merkmal, das in Zusammenhang mit Krankheit eine Rolle spielt, ist die soziale Schicht. Personen aus niedrigeren sozialen Schichten sind eher durch Stressoren belastet und haben geringere Coping-Ressourcen. Nach Siegrist (1985) haben Menschen aus unteren sozialen Schichten ungünstigere Persönlichkeitsmerkmale. Ihr Selbstwertgefühl ist geringer, sie sind unflexibler und stressanfälliger als Menschen der Mittel- und Oberschicht. Man findet daher auch ausgeprägtere soziale Netzwerke in der Mittel- und Oberschicht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Menschen mit großer sozialer Kompetenz eher befähigt sind, geeignete Netzwerke aufzubauen und darüber hinaus über mehr Coping-Ressourcen verfügen. Für das Gesundheitsverhalten ist sozialer Rückhalt eine der wichtigsten Ressourcen. Das Netzwerk vermittelt Normen und Verhaltensvorschriften, aber auch Risikoverhalten wird durch die Bezugsgruppe beeinflusst. Der Wille, gesundheitsschädliche Eigenschaften abzustellen, kann durch das soziale Netzwerk stimuliert werden, indem das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, sich ändern zu können, gestärkt wird und der Anreiz des Gesundheitsgewinns dominiert (Schwarzer, 1996). Dieser Punkt ist von Bedeutung bei der sexuellen Aufklärung hinsichtlich praktiziertem Safer-Sex in der Bevölkerung. Auf die Beziehung zwischen Social Support und Gesundheit gehen die Autoren Schwarzer und Leppin (1990) in ihrem Kausalmodell ein. „...Größeres Wohlbefinden durch positive Sozialkontakte könnte zum Beispiel den Immunstatus stärken, oder die Wahrnehmung vorhandener sozialer Ressourcen könnte die Stresseinschätzung einer Person in einer Das Konzept Sozialer Rückhalt 62 kritischen Situation dämpfen, so dass potentiell schädliche physiologische Reaktionen unterbleiben...“ (Schwarzer & Leppin, 1989b, 356). In dem Prozess der Stresseinschätzung werden situative Anforderungen abgewägt und hinsichtlich der eigenen Coping-Ressource überprüft, welches insgesamt die physiologischen Prozesse beeinflusst. Diese physiologischen Prozesse nehmen wiederum Einfluss auf die Krankheit in Diagnose und Prognose. Diese Zusammenhänge sind bedeutsame Erkenntnisse für Therapie und Verlauf bei HIV und AIDS. Laut Schwarzer und Leppin (1990) wirkt sich die Struktur eines sozialen Netzwerkes auf das Bewältigungsverhalten aus. Bewältigungsverhalten subsumiert die Mobilisierung und Evaluation erhaltener Unterstützung als auch Gesundheits- und Krankheitsverhalten. Das Bewältigungsverhalten beeinflusst hierbei nicht nur physiologische Prozesse, sondern auch, wie sich eine Erkrankung ätiologisch verhält, das heißt, sich entwickelt, manifestiert und verändert. Ebenso nimmt die Persönlichkeit Einfluss auf subjektiv Bewältigungsverhalten wahrgenommene Unterstützung und somit hinsichtlich der Stresseinschätzung und infolge auf das auf die physiologischen Prozesse. Das Modell von Schwarzer und Leppin (1990) zeigt komplexe Zusammenhänge zwischen sozialem Rückhalt und Gesundheit. In meiner eigenen Untersuchung ist diese Komplexität auf die Aspekte erhaltene Unterstützung, und physiologische Prozesse (die Symptom-Check-Liste SCL-90-R nach Derogatis) in Auswirkung auf die Befindlichkeit von HIV-Infizierten und AIDS-Patienten reduziert. In den bisher erarbeiteten Kapiteln zeigen sich die symptomatischen Faktoren des Immundefektsyndroms AIDS und welch enorme Bedeutung dem Konzept Sozialer Rückhalt zukommt. Es entspricht oft dem klinischen Alltag, dass die kartesianische Anschauung von der Unabhängigkeit seelischer und körperlicher Faktoren in Diagnose und Therapie beibehalten wird. Aufgrund dieser Tatsache stellt sich die Frage, wie chronisch Kranke die eigene LeibSeele-Beziehung selbst, unabhängig von der Fremdeinschätzung seitens der Behandelnden, einschätzen. Das folgende Kapitel wird sich von daher mit dem Konstrukt Lebensqualität auseinandersetzen, um aufzuzeigen, inwieweit ethische Fragen eine Berücksichtigung im Leben chronisch Kranker finden. Das Konzept Lebensqualität 63 5. Das Konzept Lebensqualität Die Grundzüge des Diskussionsgegenstandes der Lebensqualität sind seit der Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit zur Zeit der griechischen Antike bis in unser heutiges Jahrhundert identisch. Laut Seiffert (1992) findet die Diskussion aber erst zu Anfang dieses Jahrhunderts Einzug in den deutschen Sprachraum. Selbst die kontrahären Diskussionsstandpunkte bezüglich der Dimension der Lebensqualität unter den Philosophen Platon (geb. 427 v. Chr. Athen, gest. 348 v. Chr.) und Aristoteles (geb. in Stagira 384 v. Chr., gest. in Chalkis 322 v. Chr.) finden sich auch in unserer heutigen Gesellschaft. Mit dem alleinigen Vorkommen der Dimension Lebensqualität in ihrer schlichten Gegebenheit kann man sich, philosophisch betrachtet, nicht zufrieden geben. Lebensqualität ist ein Konstrukt und damit etwas, was sich von sich selber her nicht einfach sehen lässt. Beziehungen des Konstruktes zu psychischem Befinden oder zu äußeren sozialen Eingebundenheiten müssen zuallererst gefunden und hergestellt werden (König, 1978). Damit wir uns in der Welt orientieren können, ist Begründen und derartiges Verknüpfen von Beziehungen eine unserer notwendigsten geistigen Tätigkeiten, um die Welt nach rationaler Planung zu verstehen, zu gestalten und auch zu verändern. Schon in der Zeit der griechischen Antike, aus der unsere europäische Neuzeit nun einmal hervorgegangen ist, galt die Ansicht, dass alles in der Welt einen Grund haben müsse, und in einer Kausalbeziehung zueinander stehen müsste, was zur Folge hatte, dass sich die Philosophie über Jahrhunderte mit der Problematik befasst hat und in die Tiefen der Metaphysik führte. Inmitten der Vielfalt aller weltlichen Ereignisse führen aber genau diese Kausalbeziehungen, in einer sich ständig wandelnden Wirklichkeit, zu Gesetzförmigkeiten, an deren Erkennungsobjektivität eine für uns qualifizierende Realität geknüpft ist (Descartes, R.). Sowohl Descartes (1596 – 1650), der Begründer der neuzeitlichen Philosophie als auch 1814 Laplace (1749 – 1827), oder auch mehr als ein Jahrhundert später Sir Isaac Newton (1643 – 1727) reflektierten, unabhängig ihres wissenschaftlichen Tuns, philosophisch die Frage nach den Kausalbeziehungen nach Tatbeständen und Konstrukten (König, 1978). Das Konzept Lebensqualität 64 Wo irrte Descartes ? Abb.5.14.: René Descartes. Descartes René, latinisiert Renatus Cartesius, am 31.3.1596 in Touraine geboren und am 11.2.1650 in Stockholm gestorben. Der französische Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler gilt als erster systematischer Denker der Neuzeit. Seine einzige Gewißheit ist die durch methodische Zweifel gewonnene Einsicht des „Ich denke, also bin ich“ (Cogito ergo sum). Die Res extensa (Ausdehnung, Körper) und die Res cogitans (Geist, Innenwelt) und seine grundsätzliche Unterscheidung als metaphysikalischer Dualismus ist im neuzeitlichen Denken die Grundlage der Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt. Quelle : The Mac Tutor History of Mathematics archive. St. Andrews University, United Kingdom.(http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uK/history) Die Bedeutung des geschichtlichen Exkurses soll anhand des Philosophen Renè Descartes aufgezeigt werden. Sein philosophisches Werk ist für die westliche Welt und ihr Denken bis in unser heutiges Jahrhundert prägend. Descartes trennte in seinen philosophischen Werken das « Denkende (das Gehirn) « , als res cogitans bezeichnet, vom « NichtDenkenden (dem Körper) », als res extensa bezeichnet. Dieser Reduktionismus übertrug sich bis in die Neuzeit in die Wissenschaften Medizin, Biologie und Anthropologie. Seiner Meinung nach musste Denken, Emotionen, ethisches Handeln sowie seelischer Schmerz unabhängig vom Körper existieren. Diese kartesianische Anschauung hält sich bis heute. Das Konzept Lebensqualität 65 Neuere Ansätze der Neuzeit postulieren jedoch die Ganzheitlichkeit neuronaler, emotionaler, soziokultureller und verhaltensgesteuerter Ansätze. Descartes Paradigmen bewirkten in der Medizin, dass seelisch-emotionale Befindlichkeiten als vernachlässigbar gegenüber medizinischer Befunderhebung galten. Durch Methodenreflexion und erneuten ethischen Fragestellungen soll eine Leib-SeeleBeziehung erneuten Zugang in eine patientennahe Versorgung finden (Zänker, 1996). Zentrale Dogmen gehören nicht in wissenschaftliche Bücher. Fortschritt wird behindert, wenn neue Erkenntnisse unbedingt in Einklang mit alten Modellen gebracht werden müssen. Der Fortschritt wird behindert, wahre Erkenntnis kann nicht stattfinden, Fehlannahmen bereiten sich aus und Forschungsergebnisse können fehlinterpretiert werden (Kölle, 1997). Der Philosoph Platon war der Meinung, dass über den Wert des Lebens chronisch Kranker aufgrund objektiver Einschätzung entschieden werden sollte und das zu solcher Einschätzung nur der Arzt berechtigt sei. Ferner sollten nach Platon die Mediziner die alleinige Entscheidung treffen, wann und ob eine Therapie eingestellt werden solle. Die Mündigkeit betroffener Patienten war irrelevant. Seit dieser Ansicht im Jahre 340 v. Chr. besteht eine sehr kontroverse Diskussion bis in die heutige Zeit, allen voran sei hier Professor Julius Hackethal (1992) als großer Verfechter dieser Ansicht, und seine revolutionären Bemühungen um eine patientennahe Betreuung, genannt. Aristoteles hingegen postulierte schon 335 v. Chr. in Peripatos, dass Lebensqualität von inneren als auch von äußeren Faktoren abhänge. Das heißt, dass psychisches Befinden und äußere Bedingungen, wie soziales Eingebundensein, in Beziehung zueinander stehen. 5.1. Lebensqualität in der heutigen Forschung Erst seit den 70er Jahren ist nun das Konstrukt Lebensqualität Gegenstand wissenschaftlicher Forschung (Bullinger & Pöppel, 1988). Objektive medizinische Daten allein können keine Aussage über die Lebensqualität eines Menschen treffen, da individuelle Beurteilungen auf der Basis verschiedenster Kriterien in der medizinischen Forschung keine Berücksichtigung finden. Die Das Konzept Lebensqualität 66 Lebensqualitätsforschung berücksichtigt auch andere wissenschaftliche Disziplinen, die herkömmliche medizinische Forschung nicht, und diese Tatsache ist laut Tüchler und Lutz (1991) der deutlichste Unterschied. Seiffert (1992) postuliert, dass gerade die Einbeziehung vieler Betrachtungsweisen für das Verstehen und die Analyse chronischer Erkrankungen von enormer Bedeutung sei, da Kranksein immer mit einem Verlust an Lebensqualität einhergeht. Gerade im Zeitalter der High-tech-Medizin und ihrer enormen Fortschritte in Diagnose und Therapie, der Intensivmedizin, Anästhesiologie sowie die gefundene Lücke zwischen biologischem Tod und Hirntod in den letzten Jahren, welche sich die Transplantationsmedizin zu Eigen machte, ungeachtet vieler ethischer Problemfragestellungen, stellt sich auch laut Filipp (1992) die kontroverse Frage, Überlebensdauer versus Lebensqualität. In dubio pro homine heißt die Devise der medizinischen Behandlung, doch die Perspektive betroffener Patienten bleibt unbeachtet. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass nur eine offizielle Patientenverfügung den Patienten vor einer „Entmündigung“ seitens aller Behandelnden im Falle einer intraoperativen schweren Hypoxie (Sauerstoffmangel) schützt. Obwohl schwere körperliche und geistige Schäden nach Hypoxie-Zwischenfällen zu erwarten sind, wird in der Regel hier nicht in dubio pro homine entschieden, sondern, ungeachtet aller Folgen reanimiert. Im Rahmen dieser schwierigen Diskussion „Wiederbelebung versus Lebensqualität“ führten die Niederlande patientennahe Rechte ein, wie zum Beispiel das Euthanasierecht bei Infaust-Prognosen (Tödliche Prognose) unter Berücksichtigung ethischer Fragen und der patientenorientierten Frage nach der Lebensqualität. Williams (1989) weist auf den Zusammenhang zwischen Einschränkung oder Verlust der Lebensqualität und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Betroffenen hin: „There is a reduction in the ability to carry out social, sexual, recreational and vocational activities of daily living and as a consequence of all these factors anxiety, dependency and loss of self-esteem“. Für Patienten mit HIV-Infektion oder manifester AIDS-Erkrankung kann sich folgender Einfluss auf die Lebensqualität zeigen, wobei zu berücksichtigen ist, im Gegensatz zu anderen chronischen Erkrankungen, unter welch teilweise starken sozialen Konflikten, Das Konzept Lebensqualität 67 seitens der direkten Umwelt oder sei es, wie AIDS in unserem Zeitalter bewertet wird. Die Interdependenz zwischen physischer Einschränkung und einhergehender Verminderung der Lebensqualität sowie die soziale Etikettierung ist bei keiner anderen chronischen Erkrankung so deutlich wie bei AIDS. Zu viele gesellschaftliche Tabus kollidieren mit AIDS. Die gesellschaftliche Unfähigkeit des einfühlenden Verstehens zeigte sich in der Diskussion um die Einführung seuchenhygienischer Zwangsmaßnahmen und Quarantänemaßnahmen, um die Infektion einzudämmen (Rühmann, 1986). Für die Einführung von Zwangstestung und Meldepflicht setzte sich noch im Jahre 1985 der CSU-Politiker Gauweiler vehement ein, im Glauben eine mikrobiologische Gefahr politisch zu besiegen. Der Gedanke daran führt ins Mittelalter. Geschichtlich zeigen sich Parallelen zwischen AIDS, Aussatz und vierhundert Jahre lang bei der Lues. Sind Ursachen einer Erkrankung unbekannt, werden die Gründe dafür im Moralischen gesucht. Als in diesem Jahrhundert das AIDS-Virus isoliert wurde, richtete sich das Stigma an die sogenannten Risikogruppen. Diese Infektionskrankheit, in einem geschichtlichen Vergleich, zeigt, dass Luetiker auf dem Höhepunkt der Infektionsausbreitung im Mittelalter nicht annähernd so viel aktives Meidungsverhalten (aus dem Weg gehen) und passives Meidungsverhalten (nicht kümmern) erfahren mussten, wie es heutzutage, an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, AIDS-Kranke erfahren müssen (Bleibtreu-Ehrenberg, 1986). Folgende Faktoren nehmen Einfluss auf die Lebensqualität im Leben mit einer HIVInfektion oder AIDS-Erkrankung: Psychisch: Die Konfrontation mit dem seropositiven Testergebnis, das heißt HIV +, in zumeist jungen Jahren, geht einher mit Angst vor Krankheit, frühem Tod, Angst vor Leiden, Wut, Trauer (Dysphoria), trauriger Stimmung (Feeling sad), Pessimismus (Discouraged about future), Weinen (Crying) und Reizbarkeit (Irritability). In fortgeschrittenem Stadium zeigen sich oft psychische Veränderungen wie Psychosen oder neurotisches Fehlverhalten (Pschyrembel, 1990). Physisch: Schlafstörungen (Sleep), Appetitverlust (Appetite) , sexuelles Desinteresse (Interest in sex), Ermüdbarkeit (Tiredness), Arbeitsstörungen (Effort needed to work), opportunistische Infektionen, persistierende Infektionen der Lunge und des ZNS, Das Konzept Lebensqualität 68 neurologische Erkrankungen, bösartige Tumore der Haut, des Magen-Darm-Traktes, des ZNS und des Blutes. Hinzu kommen vielerlei Nebenwirkungen, die nur bedingt einzustellen sind, da diese antiretroviralen Medikationen lebenslang eingenommen werden müssen. Häufige Nebenwirkungen sind Beschwerden wie Übelkeit, häufige Durchfälle, Magenkrämpfe, Müdigkeit. Sozial: Sozialer Rückzug (Interest in other people), Hoffnungslosigkeit (Hopelessness), Lebenssituation der Familie, die Rollenverteilung innerhalb der Familie, die Wohnsituation, die berufliche Situation, die finanzielle Situation, die Erfahrung mit der Erkrankung und die Resonanz des Umfeldes, die Bedeutung, Patient zu sein, Erwartungen an die Zukunft. Unter Berücksichtigung all dieser Dinge und der gesellschaftlichen Stigmatisierung leiden die Betroffenen unter der sozialen Ausgrenzung als HIV-Erkrankte, als auch darunter, dass manche zusätzlich zu der HIV-Erkrankung als Homosexuelle und/oder Drogenabhängige, trotz scheinbarer Toleranzversuche, doppelt diskriminiert werden. Gedanken an den Tod und die Sexualität an sich sind jedoch immer noch gesellschaftliche Tabus. Der Tod in zumeist frühen Jahren verursacht nicht nur bei den Betroffenen selbst Ängste, sondern auch irrationale Ängste des direkten Umfeldes (Kübler-Ross, 1986). Erkrankte im Finalstadium sind in ihrer gesamten Lebensgestaltung und Freizeitaktivität auf Hilfe und Pflege angewiesen. Arbeit, Schule, Kindergarten, Familien- und Sozialleben erfahren Einschränkungen bei allen HIV-Erkrankten: Kinder, Hämophile, Patienten nach Transfusionszwischenfällen und sexuell erworbene Infektionen. Asymptomatische HIV-Patienten zeichnen sich, laut Franke (1990), oft darin aus, zwanghaft, nun mit dem Wissen um ihre Seropositivität, nach Symptomen, die die Krankheit auszeichnen, zu suchen. Sie erhalten Tips zur Ernährungsumstellung, gesunder Lebensführung, sicheren Sexualpraktiken, erhalten Medikamente und weitere Angebote zur therapeutischen Unterstützung. Beim Durchlaufen all dieser Instanzen werden die Betroffenen auf Dauer zum „Zwangspatienten“. Marx, Mellis, Peat, Woolcock und Leeder (1994) verdeutlichen den Zusammenhang der Notwendigkeit regelmäßiger Medikamenteneinnahme Lebenserwartung noch einmal recht anschaulich. und eine niedrigeren Das Konzept Lebensqualität 69 5.2. Begriffsbestimmung Eine Transzendenz der Begrifflichkeit Lebensqualität verdeutlicht, abhängig von der eingenommenen Perspektive, das manche Wissenschaftler unterschiedliche Sichtweisen integrieren, während andere eine Festlegung vermeiden oder nur eine Sichtweise zulassen oder auch Lebensqualität dem Glück zuschreiben (Sebestyén, 1991). Hierbei sind objektive medizinische Daten, die Selbsteinschätzung der Patienten wie auch die gesellschaftlichen sozialen Rollen mögliche Bezüge für eine Begriffsbestimmung. Als Beispiel zur Vermeidung einer genauen Begriffserklärung sei Bortz (1991) genannt, der Lebensqualität so umschreibt: „...ein sehr individuelles Phänomen, an dessen Zustandekommen viele und vor allem der Betroffene selbst beteiligt sind“. Nach Filipp (1987) bedeutet Lebensqualität aus motivationstheoretischer Perspektive entweder die Erreichung von Lebenszielen oder die Befriedigung vieler Bedürfnisse, also zwei unterschiedliche theoretische Ansätze. Dies würde bedeuten, je mehr Bedürfnisse des Menschen befriedigt sind, desto größer ist die Lebensqualität (Maslow, 1954; Filipp & Aymanns, 1987). Kognitive Betrachtungsweisen betonen stärker die kognitive Facetten von Lebensqualität. Eine positive Grundeinstellung des Menschen zu seinem eigenen Leben wird gleichgesetzt mit Lebensqualität. Dies impliziert eine Personeneigenschaft, welcher abzuleiten ist, dass Menschen in unterschiedlichem Maße glücksfähig sein sollen (Filipp & Ferring, 1992). Individuelle komplexe Bewertungs- und Urteilsprozesse hinsichtlich des eigenen Lebens ist die Sichtweise von Lebensqualität aus psychologischer Sicht. Die Faktoren, die sich auf diese Bewertungs- und Urteilsprozesse beziehen, können aber laut Filipp und Ferring (1992) als Konstrukt nicht definitorisch präzisiert werden. Laut Filipp und Ferring (1992) ist das, was sich im subjektiven Urteil jedes Individuums, bezogen auf sein ganzes Leben oder nur auf Ausschnitte seines Lebens, als Lebensqualität bezeichbar. Aufgrund der Subjektivität der wahrgenommenen Qualität, ist es etwas, da selbstreflexierend, was nicht von Außenstehenden eingeschätzt und eingestuft werden kann und basiert infolgedessen auf einer hypothetischen Dimension. Dagegen sprechen Koch (1992), Seifert (1992) und auch Küchler (1990) von einer Multidimensionalität als zentrale Bedeutung für den Begriff der Lebensqualität. Multidimensionalität berücksichtigt dabei das psychische Befinden, die körperliche Das Konzept Lebensqualität 70 Verfassung, die soziale Integration und die funktionelle Kompetenz des Individuums. Lebensqualität soll laut Koch (1992), das subjektive Befinden, körperliche, psychische und soziale Komponenten samt der eigenen Bewertung dieser Komponenten, umfassen. Küchler (1990) setzt die Lebensqualität aus somatischen, psychischen, interpersonellen, sozio-ökonomischen und spirituellen Dimensionen zusammen, welche sich unter Beeinflussung der Bezugsgruppen der Kultur und der Zeit fortlaufend verändert. Er enthebt die Lebensqualität somit gewissen statischen Elementen. Lehr (1990) setzt den Begriff Lebensqualität mit der WHO-Definition „Gesundheit ist ... nicht alleine Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand vollkommenen sozialen, psychischen und physischen Wohlbefindens“ gleich (Bullinger & Hasford, 1992). Raspe (1990) geht davon aus, dass Lebensqualität ein Werturteil sei, wobei Krankheit oder Gesundheit nur eine Determinante darstellt, und Schmidt (1990) beschreibt Lebensqualität sogar als Operationalisierungsansatz in Bezug auf Zustands- und Veränderungsmessung. Ein wesentlicher Punkt, nach Kaplan (1987), ist die Prognose im Hinblick auf Einschätzungs- als auch auf Copingprozesse. Da einige Autoren Lebensqualität mit sozialen Beziehungen des Menschen in Verbindung setzen, zeigt sich hier eine Schnittstelle der Begriffe „Lebensqualität“ und „sozialer Rückhalt“. In meiner hier vorliegenden Arbeit werden beide Begrifflichkeiten in getrennten Kapiteln bearbeitet, aber als zwei nicht ganz voneinander verschiedene Theoriegebilde betrachtet, unter Berücksichtigung einer teils unterschiedlichen Bedeutung für den Adaptions- und Bewältigungsprozess chronischer Erkrankungen. Soziale Unterstützung wird als Umweltressource hinsichtlich der Anforderungen und den Bewältigungsanstrengungen betrachtet (Lazarus & Folkman, 1987). Laut Siegrist (1990) ist soziale Unterstützung von enormer Bedeutung als CopingRessource in Bezug auf chronische Erkrankungen, wohingegen Lebensqualität als das Ergebnis eines Verarbeitungsprozesses diskutiert wird. Reaktionen auf einen stressauslösenden Faktor sind abhängig von individueller Disposition und der sozialen Integration und somit ist das Ergebnis eines Stressbewältigungsprozesses abhängig von personalen, sozialen und situativen Faktoren (Lazarus & Folkman, 1987). Das Konzept Lebensqualität 71 5.3. Lebensqualität als Ergebnis eines Bewältigungsprozesses Die subjektive Selbsteinschätzung in Bezug auf das Befinden bei einer chronischen Erkrankung ist hinsichtlich des Begriffes Lebensqualität variabel und für jedes Individuum ein unterschiedlich umschriebenes Ziel (Koch, 1992). Die Einstellung zu Gesundheit oder Krankheit hängt von der jeweiligen Lage ab. Oft wird Gesundheit erst dann hoch bewertet, wenn ätiologische Bedingungen beginnen oder sich langsam manifestieren. Nach motivationstheoretischen Ansätzen, im Hinblick auf die Menge der befriedigten Bedürfnisse, haben demnach chronisch Kranke eine ständig verminderte Lebensqualität. Man muss jedoch bedenken, dass, je nach Erkrankung, Betroffene durchaus in der Lage sein können, ihre Krankheit zu bewältigen und eine gleich hohe Lebensqualität erreichen können. Brickmann, Coates und Janoff-Bulman verglichen hierzu 1978 Personen, die in der Lotterie gewonnen hatten mit Personen, die an einer posttraumatischen Querschnittslähmung litten hinsichtlich ihrer jeweiligen subjektiven Einschätzung ihrer Lebensqualität unter Berücksichtigung von Zeitpunkten in der Zukunft und ihre Einschätzung diesbezüglich. Die Versuchsgruppen unterschieden sich bezüglich ihrer Einschätzung für die zukünftige Lebensqualität kaum. Die subjektive Einschätzung über ihre momentane Lebensqualität zeigte hingegen starke Unterschiede. Es lässt sich somit nicht von objektiven Faktoren auf die subjektive Lebensqualität der Versuchsgruppen schließen, jedoch zeigte sich, dass sich lebensqualitätsverändernde Bedingungen mit der Zeit entkräften und somit Adaptionsprozesse in fast jeder Lebenslage zu finden sind. Die subjektive Einschätzung der Lebensqualität ist also von der jeweiligen Situation des Individuums abhängig, das heißt, dass lediglich die Kriterien zur Beurteilung von Lebensqualität Unterschiede zwischen Gesunden und Kranken zeigen. Es ist natürlich auch eine Frage, inwieweit Individuen in der Lage sind, eine chronische Erkrankung in ihr Leben zu integrieren Beurteilung der (Patzig, 1992). Laut Filipp und Ferring (1992) hängt eine eigenen Lebensqualität auch von überdauernden Persönlichkeitsmerkmalen ab. Sind die einzelnen Individuen in der Lage, sich mit den mit der Erkrankung einhergehenden Veränderungen leicht zu arrangieren, werden diese ihre eigene Lebensqualität höher bewerten als solche, die sich nicht oder nur schwer auf Veränderungen aufgrund ihrer Erkrankung einstellen können. So können die Das Konzept Lebensqualität 72 Selbsteinschätzung der Lebensqualität seitens der Erkrankten und die Fremdeinschätzung der behandelnden Mediziner stark differieren. Laut Siegrist (1990) stellt gerade diese individuelle, psychosoziale und physische Realität der Patienten-Perspektive die Grundlage zur Untersuchung der Lebensqualität dar. Lebensqualität scheint somit kaum oder nur gering mit objektiven medizinischen Daten zu korrelieren. Die Persönlichkeit eines Individuums spielt eine ebenso wichtige Rolle wie die Perspektive, aus der heraus dieses Individuum seine Situation beurteilt. Subjektive Indikatoren für Lebensqualität korrelieren mit Personenvariablen (Filipp & Ferring, 1992). 5.4. Die Komponenten von Lebensqualität Die sozio-ökonomische und die gesundheitsbezogene Dimension sind die beiden größeren Bereiche, in denen Lebensqualität unterteilt wird. Lebensumstände, Bruttosozialprodukt, Lebenserwartung, Sterblichkeitsrate, Bildungsstand und das Verhältnis von Arbeit zu Freizeit beschreiben die sozio-ökonomischen Indikatoren (Bullinger & Hasford, 1992). Gesundheitsbezogene Komponenten sind körperliches, psychisches Befinden als auch die sozialen Beziehungen eines Menschen. Hier zeigen sich noch einmal die Berührungspunkte von Lebensqualität und sozialem Rückhalt. Nach Bullinger und Pöppel (1988) umfasst die Lebensqualität folgende Komponenten: 1. Das psychische Befinden der Patienten (traurig, ängstlich, beunruhigt), 2. Die Funktionsund Leistungsfähigkeit in verschiedenen Lebensbereichen (Freizeitaktivität, Sport, häusliche Aufgaben), 3. Quantität und Qualität der mitmenschlichen Beziehungen und die physische Verfassung: bösartige Tumore des ZNS, der Haut, des Gastrointestinaltraktes, Zervixcarcinom körperliche (Gebärmutterhalskrebs), Schwäche und Kachexie, neurologische Anämie Erkrankungen, (Blutarmut), allgemeine ophthalmologische Erkrankungen (Augenerkrankungen), opportunistische und persistierende Infektionen insbesondere des Respirationstraktes (siehe Kapitel „Psychoneuroimmunologie“) sowie die Nebenwirkungen der antiretroviralen Medikation. Das Konzept Lebensqualität 73 Muthny (1991) gliedert folgendermaßen: Psychosozial: 1. Emotionales Befinden, 2. Beziehungen (familiär, partnerschaftlich und mitmenschliche Beziehungen), 3. Sexualität, 4. Beruf, 5. Freizeitverhalten, 6. Behandlungszufriedenheit. Medizinisch: 1. Allgemeine körperliche Verfassung, 2. Mobilität, 3. Körperliche Leistungsfähigkeit, 4. Körperliche Beschwerden, 5. Schmerzen. Hier zeigt sich die Schnittstelle zwischen dem Konzept Lebensqualität und dem psychometrischen Messinstrument dieser Untersuchung, der Symptom-Check-Liste SCL90-R, deren detaillierte Beschreibung im empirischen Teil dieser Arbeit erfolgt (vgl. Kapitel 6.2.2.). Die Symptom-Check-Liste zeigt mit ihren erhobenen Konstrukten Ängstlichkeit, oder Depression direkten Bezug zu dem Konzept Lebensqualität. Ein Fragebeispiel der SCL-90-R soll dies veranschaulichen: „Wie oft litten Sie in den letzten sieben Tagen unter Übelkeit oder Magenverstimmung?“ Eine Rating - Skala von 0-4 gibt Aufschluss darüber, inwieweit sich der Interviewpartner durch Übelkeit oder Magenverstimmung beeinträchtigt fühlt und inwiefern diese Beschwerden zu einer Beeinträchtigung der subjektiven Lebensqualität führen. Eine direkte theoretische Einbettung der SCL-90-R gibt der Originalautor Derogatis nicht an und ist auch nicht in den herangezogenen Studien von Kepplinger (1996), Franke (1990) und Derogatis (1986) zu finden. Bei der Anwendung psychometrischer Verfahren darf nicht beim Zitieren des Skalennamens stehengeblieben werden (Franke, 1990). Beeinflussende soziale Faktoren können zu einer Verschlechterung des klinischen Zustandes führen und somit eine Abnahme der subjektiv empfundenen Lebensqualität bedingen (Kallert, 1993). Durch eine frühe Intervention kann es zu einer Verbesserung der Lebensqualität seitens Betroffener kommen (http://www.hivnet.de/iagrthe.htm). Demzufolge erscheint die vorgenommene theoretische Einbettung der Symptom-Check-Liste in dem Konzept „Lebensqualität“, im Rahmen der vorliegenden Arbeit, als sinnvoll. . Bullinger (1991) setzt die emotionale, verhaltensbezogene und kognitive Dimension in Beziehung zu der physischen, psychischen und sozialen Dimension und schafft so die Das Konzept Lebensqualität 74 Möglichkeit, jede Komponente aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus zu betrachten. Von der gegenwärtigen Stimmung lassen sich somit, aus der emotionalen Dimension blickend, Rückschlüsse auf das gegenwärtige Befinden ziehen. Bei der kognitiven Betrachtung geht es um die Einschätzung von Patienten hinsichtlich ihrer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit im Copingprozess unter Berücksichtigung einer angemessenen Einschätzung in Bezug auf die eigene körperliche Leistungsfähigkeit. Für AIDS-Patienten würde dies zum Beispiel heißen, inwieweit sie sich, je nach Krankheitsstadium, in der Lage sehen, eher eine Kraftsportart oder eine Konditionssportart auszuüben. So lassen sich analog alle anderen Komponenten in Beziehung setzen. Die mitmenschlichen Beziehungen werden im Rahmen des Kapitels „Sozialer Rückhalt“ berücksichtigt. Eine chronische Erkrankung, um so mehr eine bis heute noch tödlich verlaufende Infektionskrankheit, ist so zentraler Punkt im Leben der Betroffenen, dass die Lebensqualität nicht ausschließlich von einer subjektiven Einschätzung des gesundheitlichen Zustandes abhängt. Da bei AIDS kein relativ gleichbleibender Gesundheitsstatus auf Dauer möglich ist, wie z.B. bei der chronischen Polyarthritis oder anderen chronischen Erkrankung, sondern es sich um eine slow-virus-infection handelt, ist davon auszugehen, dass in den späteren Krankheitsstadien objektive medizinische Daten mit der körperlichen Selbsteinschätzung korrelieren und dass darüber hinaus mit den zunehmenden körperlichen Beschwerden die psychische Homöostase aus dem Gleichgewicht gerät und somit einen Copingprozess der AIDS-Erkrankung erschwert oder gar unmöglich macht. Hofmann (1981) weist darauf hin, „... dass eine Erkrankung im Gesamtzusammenhang des Lebensvollzuges eines Menschen steht“. Dieser Punkt sollte bei Untersuchungen zur Lebensqualität chronisch Kranker integriert sein. Das Konzept Lebensqualität 75 5.5. Lebensqualitätsforschung und resultierende Probleme Das psychische Befinden, die Rolle in der Familie, häusliche und außerhäusliche Pflichten und die körperliche Verfassung sind, unterscheidbar nach Häufigkeit und Intensität, Indikatoren von Lebensqualität, wobei die positiven Affekte der Lebensqualität innerhalb eines definierten Zeitraumes stärker ausgeprägt sein sollten als negative Affekte der Lebensqualität (Filipp & Ferring, 1992). Die Häufigkeit meint, wie oft ein Affekt im definierten Zeitraum aufgetreten ist, wohingegen die Intensität die Tatsache beschreibt, wie stark sich ein Affekt auf die Lebensqualität im definierten Zeitraum auswirkt. Laut Diener, Sandvik und Pavot (1991) ist die Häufigkeit bedeutsamer als die Intensität, was bedeutet, dass Personen positive Affekte eher in der Quantität als in der Qualität erleben. Ob es einen Rückschluss bezogen auf negative Affekte gibt lässt sich der Literatur nicht entnehmen. Eine problematische Diskrepanz in der Lebensqualitätsforschung sind die subjektiven Einschätzungen der Patienten auf der einen und die Fremdeinschätzung der Mediziner durch objektiv gewonnene Daten auf der anderen Seite. Ungeachtet der subjektiven Einschätzung der Patienten könnte die Fremdeinschätzung, basierend auf objektiven Daten (zum Beispiel die CD4-Helfer-Zellen bei HIV), eine zu dominierende Rolle bei therapeutischen Entscheidungskriterien einnehmen. Unter Berücksichtigung der subjektiven Einschätzung der Patienten könnte eine Fremdeinschätzung und demzufolge diagnostische und therapeutische Maßnahmen patientengerechter und patientenorientierter werden. Gerade in Entscheidungen über eine therapeutische und medikamentöse Behandlung bei HIV und AIDS ist die Berücksichtigung der Selbst- wie auch der Fremdeinschätzung insofern sehr bedeutend, als antiretrovirale Medikamente, wenn sie einmal appliziert wurden, ein Leben lang eingenommen werden müssen. Bullinger und Pöppel (1988) postulieren eine Sensibilisierung für die psychosoziale Dimension von Krankheit und die Berücksichtigung der daraus resultierenden Konsequenzen. Diagnose, Therapien, medikamentöse Invasivmassnahmen und auch Rehabilitationen sollten, psychosozialen Kenntnissen folgend, auf den jeweiligen Patienten, unter Berücksichtigung seiner Einschätzung, seines Befindens und der Einschätzung über die Erträglichkeit einer Behandlung (Chemotherapien bei Neoplasien), Eigene Untersuchung 76 zugeschnitten sein. In dem Punkt, dass subjektive Einschätzungen der Lebensqualität von Situationsbedingungen und Persönlichkeitsdispositionen abhängen, liegt die Verbindung der Konzepte Lebensqualität und Stress. 6. Empirische Untersuchung der aktuellen Befindlichkeit in Abhängigkeit des erhaltenen sozialen Rückhaltes bei HIV- und AIDS Patienten 6.1. Einführung Die vorliegende Arbeit ist von interdisziplinären Paradigmen geleitet. Wie bereits in den theoretischen Kapiteln erörtert wurde, werden den Kognitionen und dem derzeitigen psychosozialem Belastungsgrad besondere Bedeutung zugeschrieben. Dies bedeutet, dass die subjektive Einschätzung eine Situation als aversiv oder als herausfordernd einstuft. Die Beurteilungsmöglichkeiten werden in die Ereigniseinschätzung und die Ressourcenwahrnehmung unterteilt. Aus diesem Leitgedanken kann gefolgert werden, dass eine subjektive Wahrnehmung der Umwelt und ihre Deutung eine große Relevanz für die Ätiologie und Pathogenese bei chronischer Erkrankung haben kann. Die vorliegende Studie untersucht das aktuelle Befindlichkeitsprofil und den erhaltenen sozialen Rückhalt einschließlich der Zufriedenheit innerhalb der letzten vier Wochen. Diese Untersuchung stellt methodisch ein quasi-experimentelles Untersuchungsdesign mit den daran gebundenen statistischen Operationen dar (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 1996). Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse sind stichprobenspezifische Ergebnisse und dürfen nicht auf die Gesamtpopulation HIV- und AIDS Erkrankter übertragen werden. Eigene Untersuchung 77 6.1.1. Datenerhebung und Auswertungsmethode Im folgenden wird die der Auswertung zugrundeliegende Erhebung beschrieben. Freiwillige Patienten erreichte ich durch Aushänge und Faxe in HIV-Schwerpunktpraxen, Kliniken, HIV-Ambulanzen, AIDS-Hilfen und ambulanten Pflegestationen. Gesucht wurden Patientinnen und Patienten in allen Krankheitsstadien: HIV-positiv ohne Beschwerden, HIV-positiv mit gelegentlichen Beschwerden, HIV-positiv mit häufigen Beschwerden sowie Patienten und Patientinnen der AIDS-Stadien I-IV. Der so gemessene Erkrankungsquerschnitt sollte in seinem aktuellen Befindlichkeitsprofil mit dem derzeit erhaltenen Rückhalt in Verbindung gebracht werden. Positive Rückmeldungen erhielt ich aus folgenden Städten in Nordrhein Westfalen: Aachen, Bonn, Köln, Leverkusen, Krefeld, Düsseldorf, Neuss, Bochum, Duisburg, Essen, Dortmund, Wuppertal, Solingen und Münster. Die Untersuchung wurde im Zeitraum von September 1998 bis April 1999 durchgeführt. Da es nachteilig sein kann, Fragebögen auf postalischem Weg zu versenden, da sich solche Bögen einer situativen Überprüfung, unter denen der Bogen ausgefüllt wurde, entziehen, wurde in der vorliegenden Untersuchung eine geführte Befragung durchgeführt. Der Vorteil lag darin, dass so auch Patienten für die Studie erreichbar waren, die sich aufgrund ihres Erkrankungsstadiums einer stationären Behandlung unterziehen mussten. Diese Patientengruppe wäre auf postalischem Weg nicht erreichbar gewesen. Jeder Patient wurde um das Ausfüllen des Fragebogens gebeten, bei Schwerstkranken wurde, wenn es nötig erschien, Hilfestellung beim Ausfüllen gegeben. Jeder Fragebogen umfasst drei Teile, einen nicht-standardisierten demographischen Bogen, die psychometrische Symptom-Check-Liste und den Fragebogen über „erhaltenen sozialen Rückhalt“. Die Bearbeitung des gesamten Untersuchungsinstrumentariums beträgt etwa 40 Minuten. Die Fragebögen wurden codiert und die Namen der Patienten niemals, zur Wahrung der Anonymität, notiert. Durch die vorgenommene Codierung ist es möglich, die durchgeführte Einmalmessung in einer Re-Test-Methode zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchzuführen, um zu Längsschnittergebnissen zu kommen. Außer 10 Patienten willigten alle Untersuchten ein, an einer wiederholten Messung im Rahmen der geplanten Eigene Untersuchung 78 Dissertation, teilzunehmen. Diese Bögen wurden mit einem zusätzlichem Code versehen. Verweigerten Patienten diese Form der Befragung, wurde dies akzeptiert. Insgesamt konnte die Untersuchung von 150 HIV-Positiven und AIDS-Erkrankte in einem Querschnitt vorgenommen werden. Das erste HIV-seropositive Testergebnis: Da der genaue Infektionszeitpunkt retrospektiv nicht festzustellen ist, wurde nach dem Zeitpunkt des ersten seropositiven Ergebnisses gefragt, um zu einer zeitlichen Abschätzung der Infektionsdauer zu kommen. Auf die Einbeziehung weiterer objektiver Parameter wurde aufgrund der psychosozialen Fragestellung dieser Arbeit verzichtet. Zudem entstehen bei der Erhebung rein objektiver physiologischer Variablen methodische Probleme, wenn belastende und aufwendige Methoden, z.B. die Abnahme von Blutproben, zu zusätzlichen Stressoren werden. Beim Einsatz subjektiver Erhebungsmethoden, wie in der vorliegenden Studie, ist die Belastung der Probanden um ein vielfaches geringer. Ferner zeigen subjektiv skalierte Symptome eine engere Korrelation mit emotionalen Zuständen (Pennebaker ,1982). Die Auswertung erfolgte bei kleineren Rechnungen durch den Taschenrechner; die Reliabilitätsanalysen und Faktorenanalysen der eingesetzten Messinstrumente, die Korrelationsberechnungen, die Regressionsanalyse, die graphischen Darstellungen sowie weitere Berechnungen erfolgten durch das „Statistical Package for Social Sciences (SPSS für Windows 7.5)“. Die Textverarbeitung wurde mit „Microsoft-Word“ vorgenommen 6.1.2. Die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung Das Untersuchungsmodell der vorliegenden Arbeit (siehe Abb.6.15.) zeigt die Multidimensionalität und die Interdependenz sozialer, psychologischer und physischer Faktoren bei der HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung. Eigene Untersuchung 79 Abb.6.15.: Das Untersuchungsmodell. Hartkopf, D.(1999). Die psychische, physische und soziale Situation bei HIV und AIDS. HIV-Seropositivität bedingt zunehmende gesundheitliche Einschränkungen. Laut Jäger (1989) versagen bei AIDS klassische Unterstützungssysteme. Daher stehen HIV-bedingte Symptomauswirkungen in Wechselwirkung zu der Lebensqualität aufgrund einer zugrundeliegenden chronischen Krankheit ohne Heilungsaussichten und zu sozialem Rückhalt, da soziale Trennungen und soziale Desintegration zunehmen, wenn die Hoffnung auf eine vollständige Heilung aufgegeben werden muss (Jäger 1989). Es wird angenommen, dass diese soziale und physische Situation bestimmte Symptome bei den Betroffenen auslöst. Aus diesem Grunde setzte ich als psychometrisches Messinstrument die Symptom-Check-Liste nach Derogatis ein (Derogatis 1986). So erhielt ich, wie das Eigene Untersuchung Untersuchungsmodell 80 zeigt, das aktuelle Befindlichkeitsprofil mit den neun Symptomgruppen (vgl. Kapitel 6.2.2.). Das Konzept „Lebensqualität“ ist als solches nicht erhoben worden und wäre somit eine Fragestellung in weiterführenden Forschungen. Aufgrund ihrer gegenseitigen Bedingtheit wurde die SCL-90-R in das Konzept „Lebensqualität“ integriert. Da klassische Supportsysteme laut Jäger (1989) versagen, setzte ich, um dieser Aussage nachzugehen, als weiteres Messinstrument den Fragebogen über „erhaltene soziale Unterstützung“ nach Dunkel-Schetter ein. Patienten, die viel Unterstützung erfahren, müssen nicht zwangsläufig damit zufrieden sein (vgl. Kapitel 4). Zufrieden mit einer unterstützenden Handlung ist man nur dann, wenn die Bedürfnisse des Empfängers von der richtigen Quelle adäquat befriedigt werden. Die Untersuchung geht der Frage nach, von welcher Quelle die Stichprobe welche Form an Unterstützung erhielt und wie zufrieden die Stichprobe damit war. Ob ein Zusammenhang zwischen der erhaltenen Unterstützung und dem aktuellen psychosozialen Befindlichkeitsprofil besteht, ist die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit. 6.1.3. Ableitung der Hypothesen Eine Erkrankung steht im Gesamtzusammenhang des Lebensvollzuges eines Menschen (Hofmann, 1981). Laut Siegrist (1990) ist soziale Unterstützung von enormer Bedeutung als Coping-Ressource in Bezug auf chronische Erkrankungen. Die als gravierend erlebten sozialen Faktoren können zu einer Störung des psychobiologischen Gleichgewichts führen. Soziale Faktoren können eine Krankheitsmanifestation bewirken und zu einer Verschlechterung des klinischen Zustandes führen (Kallert,1993). Familiäre Unterstützung kann zu einer emotionalen Entlastung führen und einen Prädikator für die Verringerung eines Vermeidungs-Coping im zeitlichen Verlauf darstellen (Fondacaro & Holahan, 1987). Diesen Ausführungen folgend wird somit angenommen, dass die hohe subjektive Belastung der untersuchten Stichprobe eng mit fehlender sozialer Unterstützung korreliert. Eigene Untersuchung 81 Aus den zuvor dargestellten Theorien und der daraus resultierenden zentralen Fragestellung lassen sich folgende Hypothesen ableiten (vgl. Kapitel 6.5.4.2.): 1. Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen dem Grad der subjektiven Belastung und der tatsächlich erhaltener Unterstützung. 2. Es wird angenommen, dass dieser Zusammenhang hoch korreliert. 3. Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen Depression und emotionaler Unterstützung. 4. Es wird angenommen, dass zwischen Somatisierung und der Unterstützung durch die Lebenspartner ein negativer Zusammenhang besteht. 5. Es wird hypothetisiert, dass ein negativer Zusammenhang zwischen Somatisierung und der Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Lebenspartner besteht. 6. Hinsichtlich der psychosozialen Befindlichkeit zeigen heterosexuelle Probanden und homosexuelle Männer Unterschiede. 7. Es wird angenommen, dass homosexuelle Probanden höhere GSI Werte aufweisen als heterosexuelle Probanden. 8. Es wird hypothetisiert, dass Frauen mehr emotionale Unterstützung erhalten. 9. Es wird angenommen Frauen mit erhaltener emotionaler Unterstützung zufriedener sind als Männer. Eigene Untersuchung 82 6.2. Vorstellung der Messinstrumente Das Untersuchungsinstrumentarium der vorliegenden Studie stellt sich wie folgt zusammen: 1. Ein soziodemographischer Fragebogen. 2. Die Symptom-Check-Liste (SCL-90-R). 3. Der Fragebogen zur erhaltenen sozialen Unterstützung. 6.2.1. Der soziodemographische Fragebogen Dieser für die vorliegende Untersuchung entwickelte Fragebogen richtet sich neben allgemeinen Fragen nach Alter, Geschlecht, Nationalität, familiärer und privater Situation, Beruf, Einkommen etc. an spezielle Lebensumstände bei HIV und AIDS. Bedeutend erschienen mir hierbei Fragen nach dem Infektionsweg, dem ersten seropositiven Testergebnis, der Art der Sexualität und ob das Umfeld über die jeweilige Sexualität informiert ist (Coming-out), der Dauer der Erkrankung, der Arbeitsfähigkeit, der Zufriedenheit mit der ärztlichen Behandlung und weiterer Betreuung, Fragen nach aktuellen HIV-typischen Beschwerden, antiretroviralen Medikamenten und vorhandenen Nebenwirkungen sowie dem Sexualverhalten. Bei dem Sexualverhalten der untersuchten Stichprobe interessierten mich Fragen danach, ob die HIV Infektion die Einstellung zur Sexualität veränderte und ob die Patienten die notwendige Veränderung ihres praktizierten Sexualkontaktes, im Sinne von Safer-Sex, vornahmen. 6.2.2. Die Symptom-Check-Liste (SCL-90-R) 6.2.2.1. Die Entwicklung der SCL-90-R Die Discomfort Scale der Forscher Parloff, Kellmann und Frank (1954) der John Hopkins University gilt als der Vorläufer der Symptom-Checkliste. Um das Ausmaß an Unbehagen Eigene Untersuchung 83 (discomfort) und Belastung (distress) messen zu können, entwickelten die Forscher eine Check-Liste mit einunddreißig Fragen. Frank verbesserte 1957 die SCL-31 zur SCL-41-Liste, wobei jedes Item mit einer VierPunkt-Skala versehen wurde. Die Items fokussierten somatische und psychische Belastungen. Diese Liste wurde in psychopharmakologischen placebo-kontrollierten Doppelblindstudien eingesetzt. 1965 setzten Lipmann et al. eine modifizierte Version mit fünfundsechzig Items zur Angstmessung ein. Die Arbeit von Lipmann et al. wurde von Derogatis et al. 1971 zusammengefasst und weiterentwickelt. Derogatis legte als erster Vergleichsdaten für psychisch Belastete und Gesunde vor. 1977 publizierte Derogatis seine Forschungsergebnisse über die 90 Items umfassende Symptom-Check-Liste, änderte die Bezeichnung hin zu SCL-90-R (R für revised), (Franke, 1990). 6.2.2.2. Die Symptom-Check-Liste SCL-90-R nach Derogatis Die Symptom-Check-Liste von Derogatis wurde in der vorliegenden Studie als psychometrisches Untersuchungsinstrument eingesetzt. Durch 90 Fragen bietet die SCL die Möglichkeit, psychische Belastungen (distress) einzuschätzen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Der Patient hat die Möglichkeit auf die Frage „Wie sehr litten Sie in den letzten 7 Tagen unter Einsamkeitsgefühlen?“ mit „überhaupt nicht“, „ein wenig“, „ziemlich“, „stark“ oder „sehr stark“ zu antworten (Likert-Skalierung). Eigene Untersuchung 84 Die 90 Fragen werden in der Auswertung zu folgenden neun Symptomgruppen zusammengefasst: Somatization (Somatisierung) Obsessive compulsive (Konzentrations- und Arbeitsstörung) Interpersonal sensivity (Unsicherheit im Sozialkontakt) Depression (Depression) Anxiety (Ängstlichkeit) Anger-hostility (Aggressivität und Feindseligkeit) Phobic anxiety (phobische Angst) Paranoid ideation (Misstrauen und Minderwertigkeitsgefühle) Psychoticism (Psychotizismus) Drei globale Indizes lassen Rückschlüsse über das Antwortverhalten zu. Die SCL-90-R liefert ein subjektiv skaliertes Symptomenprofil. 1976 legte Derogatis die Prüfung des Untersuchungsinstrumentariums vor und belegte eine ausreichende Reliabilität, Konstruktvalidität und durch die MMPI eine Übereinstimmungsvalidität zwischen r = .40 und r = .75 (Derogatis, 1986). Derogatis et al. beschreiben 1976 die interne Konsistenz (Cronbachs alpha) mit r(min.) = 0,77 und r(max.) = 0,90 als gut. Die Skala zeigt die Auswirkungen psychischer Kräfte auf das physische Befinden und eignet sich zur Messwiederholung. Der GSI (Global Severity Index) gibt Auskunft über die grundsätzliche psychische Belastung. Der PSDI (Positive Symptom Distress Index) misst die Intensität der Antworten und der PST (Positive Symptom Total) gibt Auskunft über die Anzahl der Symptome, bei denen ein Leidensdruck vorliegt. Derogatis bezieht sich in allen Veröffentlichungen zur SCL-90-R auf eine amerikanische Eichstichprobe von 494 männlichen und 480 weiblichen gesunden Probanden (n = 974), (Derogatis, 1977a). Diese untersuchte Eichstichprobe wird in der deutschsprachigen Symptom-Check-Liste Ausgabe zugrunde gelegt. In der Untersuchung von Hirsch et. al. (1985) zeigten die Forscher bereits einen bei AIDS auftretenden höheren Leidensdruck als bei der gesunde Kontrollgruppe (Hirsch et.al., 1985a,b). Eigene Untersuchung 85 Die durch die SCL erreichte Symptomlage und derzeitige Befindlichkeit kann eine Entscheidungshilfe für angestrebte Behandlungs- und Beratungspläne darstellen. 6.2.2.3. Die Skalen der SCL-90-R Die SCL-90-R besteht aus 90 Fragen zur subjektiven Befindlichkeit. Laut Franke (1990) darf bei der Anwendung psychodiagnostischer Verfahren nicht beim Zitieren des Skalennamens stehengeblieben werden. Als Originalautor belegte Derogatis die einzelnen Skalen mit Namen. Skala 1: Somatisierung (somatization) Einfache körperliche Belastung bis hin zu funktionellen Störungen werden in 12 Items dieser Skala beschrieben. Distressempfindungen äußern sich als körperliche Dysfunktionen: kardiovasculäre, gastrointestinale, respiratorische und somatische Komponenten der Angst. Personen mit einer hohen Belastung leiden unter Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen, Übelkeit oder Atemschwierigkeiten, Muskelschmerzen, Magenverstimmung, Hitzewallungen oder Kälteschauern, Taubheit oder Kribbeln in einzelnen Körperteilen, Schwächegefühl in einzelnen Körperteilen sowie einem Schweregefühl in Armen und Beinen. Skala 2: Zwanghaftigkeit (obsessive-compulsive) Leichte Konzentrations- Zwanghaftigkeit werden und in Arbeitsstörungen 10 Items dieser bis Skala hin zur erfasst. Zwanghaftigkeit meint Gedanken, Handlungen und Impulse, welche vom Individuum als nicht änderbar, fremd-gewollt und „ich-fremd“ erlebt werden. Personen mit hoher Belastung leiden unter immer wieder auftretenden unangenehmen Gedanken und Vorstellungen, Gedächtnisschwierigkeiten, dem Gefühl, dass es schwerfällt, etwas anzufangen, Schwierigkeiten sich zu entscheiden, Leere im Kopf, dem Eigene Untersuchung 86 Zwang, immer nach zu kontrollieren was, man tut, und der zwanghaften Wiederholung derselben Tätigkeit. Skala 3: Unsicherheit im Sozialkontakt (interpersonal sensivity) Leichte soziale Unsicherheit bis hin zum Gefühl völliger sozialer Unzulänglichkeit werden durch 9 Items dieser Skala beschrieben. Diese Skala bezieht sich auf die subjektive persönliche Unzulänglichkeit und dem Gefühl der Minderwertigkeit in bezug auf andere Personen, wobei bei hoher Belastung folgende Symptome auftreten: Allzu kritische Einstellung gegenüber anderen, Verletzlichkeit in Gefühlsdingen, dass andere sie nicht verstehen oder teilnahmslos sind, Minderwertigkeitsgefühle gegenüber anderen, starke Befangenheit im Umgang mit anderen sowie Unbehagen beim Essen und Trinken in der Öffentlichkeit. Skala 4: Depressivität (depression) 13 Items beschreiben Symptome der Traurigkeit bis hin zur Depression. Hierbei stehen eine dysphorische Stimmung, verringertes Interesse am allgemeinen Leben und eine verringerte Motivation im Vordergrund. Personen mit einer hohen Belastung beschreiben Symptome wie Verminderung ihres Interesses an Sexualität, Energielosigkeit oder Verlangsamung im Denken oder in den Bewegungen, Neigung zum Weinen, Einsamkeitsgefühlen, Schwermut, dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der Zukunft, dem Gefühl, sich für nichts zu interessieren, dem Gefühl, wertlos zu sein und dem Gefühl, dass alles sehr anstrengend ist. Skala 5: Ängstlichkeit (anxiety) Diese Skala beschreibt in 10 Items eine spürbare körperliche Nervosität bis hin zu tiefer Angst. Die Items fokussieren Angst mit Nervosität, innerer Spannung und Zittern, Panikattacken sowie Schreckgefühlen. Personen mit einer hohen Belastung leiden unter innerem Zittern und einer Spannung, plötzlichem Erschrecken ohne Grund, Herzjagen, unter Eigene Untersuchung 87 dem Gefühl, gespannt oder aufgeregt zu sein, starker Ruhelosigkeit, Panikattacken und dem Gefühl, dass ihnen etwas Schlimmes passiert. Skala 6: Aggressivität/Feindseligkeit (anger-hostility) Starke Aggressivität mit feindseligen Aspekten, Reizbarkeit, den negativen Gefühlszustand von Ärger und Unausgeglichenheit werden in 6 Items dieser Skala beschrieben. Personen mit einer hohen Belastung berichten über das Gefühl, leicht verärgerbar und reizbar zu sein, den Drang, Dinge zu zerschmettern, und jemanden zu schlagen, zu verletzen oder ihm Schmerzen zuzufügen. Ferner leiden sie unter der Neigung, immer wieder in Erörterungen und Auseinandersetzungen zu geraten und unter dem Bedürfnis mit Gegenständen zu werfen und laut zu schreien. Skala 7: Phobische Angst (phobic anxiety) Bei den sieben Items mit den beschriebenen Gefühlen der Bedrohung bis hin zur massiven phobischen Angst bezieht sich Derogatis auf die Definition von Agoraphobie nach Marks (1969), welche auch „phobisch-ängstliches Depersonalitätssyndrom“ genannt wird. Personen mit einer hohen Belastung leiden unter der Furcht, alleine aus dem Haus zu gehen, unter Furcht auf der Straße und auf offenen Plätzen, unter der Notwendigkeit, bestimmte Dinge und Orte meiden zu müssen, weil sie durch diese erschreckt werden würden, unter Nervosität, wenn sie alleine gelassen werden, und unter der Abneigung gegen Menschenmengen, z.B. im Kino oder beim Einkaufen. Skala 8: Paranoides Denken (paranoid ideation) Misstrauen, Minderwertigkeitsgefühle sowie starkes paranoides Denken werden durch 6 Items dieser Skala erfasst. Paranoides Verhalten wird hierbei als Denkstörung verstanden, wobei wahnhafte Täuschungen, Einengungen, Argwohn, Gedankenprojektion, Grandiosität und Angst vor Autonomieverlust als primäre Aspekte skizziert werden. Personen mit einer hohen Belastung leiden unter dem Gefühl, dass man den Eigene Untersuchung 88 meisten Leuten nicht trauen kann, unter dem Gefühl, dass andere an ihren Schwierigkeiten schuld sind, unter dem Gefühl, dass andere sie beobachten oder über sie reden, unter mangelnder Anerkennung ihrer Leistung und unter dem Gefühl, von anderen ausgenutzt zu werden. Skala 9: Psychotizismus (psychoticism) Zwischenmenschliche Entfremdung bis hin zur dramatischen Evidenz psychotischer Episoden werden durch 10 Items erfasst. Die Items umfassen die kontinuierliche Dimension menschlichen Erlebens, das heißt, von verzerrtem, isoliertem und schizoidem Lebensstil bis hin zu Erstsymptomen der Schizophrenie wie z.B. Halluzination und Gedankenzerfall. Personen mit einer hohen Belastung leiden unter dem Auftauchen von Gedanken, die nicht ihre eigenen sind, unter unangenehmen sexuellen Vorstellungen, unter der Vorstellung, dass mit ihrem Körper etwas nicht in Ordnung ist, unter dem Gedanken, dass sie für ihre Sünden bestraft werden sollten und dass irgend etwas mit ihrem Verstand nicht in Ordnung ist (Franke, 1995). 6.2.2.4. Die Anwendung der SCL-90-R Die Symptom-Checkliste ist bei Jugendlichen ab 14 Jahren und bei Erwachsenen anwendbar. Sie kommt in den folgenden Bereichen zum Einsatz: ambulanten und stationären Bereichen der Psychiatrie, Not- und Versorgungsdiensten für akute Fälle, allgemeinmedizinischen, chirurgischen und internistischen Einrichtungen, als Evaluation stationärer und ambulanter Psychotherapie, psychosozialen Beratungszentren und bei Opfern von Katastrophen. Ferner zeigten psychopharmakologische Studien, dass sich die Symptom-Checkliste als Indikator der Wirksamkeit psychoaktiver Drogen erwies. Eigene Untersuchung 89 6.2.2.5. Die Auswertung der SCL-90-R Die Auswertung erfolgt anhand des „Auswertungsschemas“ der deutschen Version der Symptom-Checkliste. Zur Auswertung werden zunächst die 90 Items den Subskalen zugeordnet. Tab.6.7.: Zuordnung der Items (in Anlehnung an Franke, 1995). Skala Nummern der Items 1 1, 4, 12, 27 ,40 ,42 ,48, 49, 52, 53, 56, 58 2 3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 51, 55, 65 3 6, 21, 34, 36, 37, 41, 61, 69, 73 4 5, 14, 15, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 54, 71, 79 5 2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80, 86 6 11, 24, 63, 67, 74, 81 7 13, 25, 47, 50, 70, 75, 82 8 8, 18, 43, 68, 76, 83 9 7, 16, 35, 62, 77, 84, 85, 87, 88, 90 Zusatz 19, 44, 59, 60, 64, 66, 89 Für jede der neun Skalen n sind folgende drei Werte zu bestimmen: Der Summenwert je Skala Sn, der Skalenwert Gn und die Belastungstendenz je Skala Pn. Der Summenwert Sn je Skala wird durch Addition der zu der Skala gehörigen Items bestimmt. Sn = Summe der Itemwerte von Skala n. Teilt man den Summenwert Sn durch die Itemanzahl der entsprechenden Skala bestimmt man den Skalenwert Gn. G n = Sn / Anzahl der Items von Skala n. Eigene Untersuchung 90 Die Belastungstendenz je Skala Pn errechnet man durch Auszählen der Items von Skala n, bei der eine Belastung vorliegt. Pn = Anzahl Items von Skala n mit einem Itemwert größer Null. Für die Berechnung der drei globalen Kennwerte GSI, PST und PSDI bildet man zunächst die Summe der zehn Summenwerte S1-S10. GS = Summe der Summenwerte S1-S10 Der Kennwert GSI errechnet sich aus GS dividiert durch die Items des gesamten Tests. GSI = GS / (90 minus missing data). Den Kennwert PST berechnet man durch die Addition der zehn Belastungstendenzen je Skala P1-P10. PST = Summe der Belastungstendenzen P1-P10. Dividiert man die Summe GS durch den Kennwert PST erhält man den PSDI. PSDI = GS / PST. Für die Auswertung sind die Skalenwerte Gn, GSI, PST und PSDI relevant. Die Transformation der Einzelfall-Rohwerte zu T-Werten anhand der T-Werte-Tabellen ermöglicht die Einordnung in bezug auf „Normalität“ und „Abweichung“. T-Werte zwischen 60 und 70 zeigen eine erhöhte Belastung an (Franke, 1995). 6.2.3. Der Fragebogen über „erhaltene“ soziale Unterstützung (UNTERST) Der Fragebogen zur erhaltenen sozialen Unterstützung von Dunkel-Schetter (1986) wurde 1993 von Schwarzer,C. ins Deutsche übersetzt. Der Fragebogen erhebt die Form an Rückhalt, die eine Person tatsächlich erhalten hat, und wie zufrieden die Person damit war. Die Items umfassen informationelle, instrumentelle, Einschätzungs- und emotionale Unterstützung. Ferner bezieht sich ein Item auf die Reziprozität sozialer Unterstützung. Eigene Untersuchung 91 Es wird nach fünf verschiedenen Unterstützungsquellen gefragt, das heißt, wie häufig die Interviewpartner Unterstützung erhalten haben einschließlich ihrer Zufriedenheit damit. Ein Beispiel soll dies aufzeigen: Wie oft haben Ihnen diese Menschen Ratschläge oder Informationen übermittelt, egal ob Sie das wollten oder nicht? Niemals selten Freunde O O Verwandte O Partner manchmal oft sehr oft O O O O O O O O O O O O O O O O O Gruppen oder Organisat. Durch diese Itemformulierung wird es möglich für den eigenen Untersuchungskontext Modifikationen vorzunehmen. Die Items der eigenen Untersuchung lauteten wie folgt: Wie oft haben die folgenden Menschen Ihnen aufmerksam zugehört und Verständnis gezeigt? Niemals Selten Manchmal Oft Sehr Ihre Eltern______ O O O O O Ihre Geschwister_ O O O O O andere Verwandte O O O O O Partner/in_______ O O O O O Freunde/innen___ O O O O O Kollegen/innen__ O O O O O Nachbarn/innen__ O O O O O Mitpatienten/innen O O O O O andere__________ O O O O O oft um welche Personen handelt es sich hierbei ?.............................. Eigene Untersuchung 92 Diese Skala wurde erstmals durch Monville (1994) in der deutschsprachigen Version eingesetzt. Monville setzte diese Skala in einer Studie über Stress am Arbeitsplatz ein und erhielt mit Cronbach´s von 0.89 eine gute interne Konsistenz für die Skala zur erhaltenen Unterstützung. 6.3. Beschreibung der Stichprobe 6.3.1. Soziodemographische Daten An der Untersuchung nahmen zunächst 221 Personen teil, von denen 71 Probanden für die Auswertung ausgeschlossen werden mussten. Die Gründe dafür waren unterschiedlich: Für einige Patienten war der Fragebogen subjektiv emotional zu belastend, andere verhielten sich non-compliant, das heißt, sie gaben unvollständig ausgefüllte Bögen zurück, und weitere Probanden erkrankten kurz vor der Befragung so akut, dass eine medizinische Intervention im Vordergrund stand. Allen Versuchsteilnehmern war nur das HIV-seropositive Testergebnis gemein, bezüglich Geschlecht, Alter, Nationalität, Sexualität, Infektionsweg und Erkrankungsstadium unterschieden sich die Probanden. Die untersuchte Stichprobe stellt einen Querschnitt aller AIDS-Stadien aus verschiedenen Städten in Nordrhein Westfalen dar (vgl. Kapitel 6.1.1.). Das Geschlecht innerhalb der untersuchten Stichprobe ist ungleich verteilt, da sich 102 (68%) männliche und nur 48 (32%) weibliche Probanden zu einer Teilnahme bereit erklärten. Die Altersspanne der Probanden reicht von 19 Jahren (min., 2,7%) bis 62 Jahren (max., 0,7%). Mit 53,3% stellt die Gruppe der 25-35 Jährigen die weitaus größte Gruppe dar. Das durchschnittliche Alter der Gesamtstichprobe beträgt 31,6 Jahre mit einer empirischen Standardabweichung (s)2 von s = 9,01. 126 deutsche Patienten stellen mit 84%, davon 83 Männer und 43 Frauen, die größte Patientengruppe dar. Der Anteil türkischer (9 Männer, 3 Frauen) und italienischer Patienten (10 Männer, 2 Frauen) liegt bei je 8% ( = 1,24, s = .59, SD = .048). 2 Die Standardabweichung eines Wertes ist ein statistisches Maß für die Abweichung aller möglichen Stichprobenmittelwerte vom wahren Mittelwert. Eigene Untersuchung 93 50,7% der Untersuchten leben alleine, 25,3% leben mit ihrem Partner zusammen und 24,0% leben in einer Wohngemeinschaft, wobei 68,9% der Männer alleine lebt und Frauen nur zu 30,7% alleine wohnen. Drogenabhängige leben zu 94,5% in Wohngemeinschaften, ( = 1,73, s = .82, SD3 = .073). 43,3% der Patienten waren zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht arbeitsfähig, erhielten zu 20,7% Berufsunfähigkeitsrente oder Krankengeld. 56,7% der Patienten arbeiteten unabhängig von ihrem Erkrankungsstadium in ihrem Beruf ( = 1,43, s = .50, SD = .040). In der Auswertung ließen sich folgende Berufsgruppen klassifizieren: Tab.6.8.: Berufsklassen der Stichprobe. Berufsart Prozentuale Verteilung Technische Berufe 10,7% Handwerkliche Berufe 18,0% Akademische Berufe 22% Kaufmännische Berufe 18,0% Soziale Berufe 13,3% Sonstige Berufe 13,3% Keine Angabe 4,0% Mit 22,0% stellen die Akademiker die größte Gruppe in der Stichprobe dar ( = 2,29, s = 2,77, SD = .23).Das monatliche Einkommen verteilt sich folgendermaßen ( = 2,30, s = .79, SD = .065). Tab.6.9.: Monatliches Einkommen der Stichprobe. 3 Unter 1000 DM 20,7% 1000 – 1800 DM 28,7% Über 1800 DM 50,7% Der Standardfehler des Mittelwertes ist als die Standardabweichung der Mittelwerte von gleich großen Zufallsstichproben einer Population definiert (Bortz, 1993). Eigene Untersuchung 94 Die folgende Tabelle klassifiziert die Stichprobe nach der Art ihrer Sexualität ( = 3,17, s = 1,48, SD = .12). Tab.6.10.: Sexualität in der Stichprobe. Homo Homo sexuell sexuell (Frauen) (Männer) 7,3% 36,7% Bisexuell Hetero Homo Pädophil Keine Sexuell phil (F/M) (F/M) (F/M) (F/M) (F/M) 12,7% 28,7% 8% 0,7% 5,3% Angaben Mit 36,7% stellen die homosexuellen Männer die größte Gruppe in der Stichprobe dar. Mit 28,7% bilden die heterosexuellen Frauen (n = 33, 68,7%) und Männer (n = 10, 9,8%) die zweitgrößte Gruppe. Die Kategorie „Pädophil“ wird aufgrund von n = 1 in den Berechnungen und Diskussionen nicht weiter berücksichtigt, da die Daten kaum Aussagen zulassen. 72,7% der Probanden leben ihre Sexualität offen, das heißt geoutet. Das soziale Umfeld ist über die Sexualität informiert. Hierbei lassen sich keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern finden. Bei 26,7% der Probanden ist das Umfeld nicht über die Sexualität informiert. Homosexuelle Männer leben hingegen eher geoutet als homosexuelle Frauen, bisexuelle und homophile Frauen und Männer ( = 1,27, s = .44, SD = .04). Folgende Kategorien zeigen den Infektionsweg mit dem HI-Virus in der Stichprobe ( = 4,49, s = 3,23, SD = .26). Eigene Untersuchung 95 Tab.6.11.: Infektionsweg der Probanden. Infektionsweg Homosexueller Kontakt Homosexueller Kontakt mit heterosexuellen Anteilen Bisexueller Kontakt mit homosexueller Präferenz Bisexueller Kontakt Mit heterosexueller Präferenz Heterosexueller Kontakt Mit homosexuellen Anteilen Heterosexueller Kontakt BlutUnd Blutprodukte Intravenöse Drogen Infektion kann nicht zurückverfolgt werden Prozentgesamt ProzentFrauen ProzentMänner 39,3% 14,6% 51,0% 2,7% 2,1% 2,9% 4,7% 2,1% 5,9% 2,0% 2,1% 2,0% 4,0% 6,3% 2,9% 8,7% 16,7% 4,9% 12,7% 20,8% 8,8% 12,7% 14,6% 11,8% 13,3% 20,8% 9,8% Die Befragung umfasste detailliert alle möglichen sexuellen Übertragungswege wie auch iatrogen verursachte Infektionen (Blut- und Blutbestandteilübertragung) sowie die Infektionsmöglichkeit über infizierte sich über intravenöse Applikation von psychoaktiven Drogen. 13,3% der Probanden konnten die Infektionsquelle nicht mehr zurück verfolgen. Eigene Untersuchung 96 Da es retrospektiv nicht möglich ist, den genauen Zeitpunkt der Infektion zu bestimmen, wurde in der vorliegenden Studie nach dem Zeitpunkt des ersten seropositiven Testergebnisses gefragt. Die folgende Tabelle zeigt, wie lange die Probanden im Schnitt schon an HIV erkrankt sind. Die Kategorie „HIV+ seit 2-4 Jahren“ präsentiert mit einem n = 60 (40%) die größte Gruppe der Patienten. Die Gruppe der Langzeitüberlebenden ist mit n = 6 zu 4% vertreten ( = 3,23, s = 2,01, SD = .16). Tab.6.12.: Erkrankungsdauer der Stichprobe. Erkrankungsdauer N % Seit wenigen Monaten 22 14,7% 2 – 4 Jahre 60 40,0% 4 – 5 Jahre 17 11,3% 5 – 6 Jahre 13 8,7% 6 – 7 Jahre 10 6,7% 7 – 8 Jahre 13 8,7% 8 – 10 Jahre 9 6,0% Über 10 Jahre 6 4,0% Insgesamt nehmen 83,3% der Patienten täglich antiretrovirale Medikamente ein. 16,7% werden nicht mit diesen Medikamenten behandelt oder lehnen selber eine lebenslange Medikation ab ( = 2,30, s = .79, SD = .065). 40% der Patienten, die Medikamente gegen die Infektion einnehmen, leiden unter Nebenwirkungen. 1.6% leiden unter ständigen Kopfschmerzen, 16% unter Magen- und Darmbeschwerden, 15,2% unter starker Müdigkeit und 7,2% unter Veränderung des Blutbildes (Anämie),( = 2,13, s = 1,02, SD = .083). 48,9% aller Patienten sind hierbei mit der ärztlichen Behandlung immer unzufrieden ( = 1,69, s = 1,27, SD = .10). Eigene Untersuchung 97 Die Krankheitsstadien der untersuchten Stichprobe ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Tab.6.13.: Krankheitsstadien der Stichprobe. Krankheitsstadium n % HIV ohne Beschwerden 17 11,3% 33 22,0% HIV,oft Beschwerden 19 12,7% AIDS, Stadium I 19 12,7% AIDS, Stadium II 16 10,7% AIDS, Stadium III 22 14,7% AIDS, Stadium IV 24 16,0% HIV, gelegentlich Beschwerden Mit 22,0% repräsentieren die Patienten mit gelegentlichen Beschwerden die größte Gruppe in der Stichprobe. 16,0% aller Probanden befanden sich zum Zeitpunkt der Untersuchung im Endstadium der Infektionskrankheit. 33,3% der Patienten dieses Stadiums ist erst 21 Jahre alt. Die 28 – Jährigen im Endstadium bilden die größte Gruppe mit 42,9%. Ab 38 – 62 Jahren ist keiner der Untersuchten im Endstadium zu finden ( = 2,13, s = 1,02, SD = .083). 51,3% der Probanden aller Stadien leiden an HIV bedingten Erkrankungen, 12,0% an Erkrankungen des Magen- Darmtraktes, 13,3% an Allergien, Ekzemen, Hautveränderungen und dem Kaposi – Sarkom (vgl. Kapitel 3), 14,7% an Veränderungen des zentralen Nervensystems und 11,3% an Tumorerkrankungen des Darmes, des Blutes und des Gehirns ( = 3,27, s = 1,49, SD = .12). Innerhalb dieser Stichprobe informieren sich 29,3% der Patienten überhaupt nicht über den aktuellen Forschungstand ihrer eigenen Erkrankung und 20,7% informieren sich nur gelegentlich ( = 1,42, s = 1,19, SD = .097). Eigene Untersuchung 98 Die Frage nach dem Schutz ihrer Sexualpartner vor einer HIV-Infektion beantworteten die Probanden wie folgt: 44.6% schützen weder sich noch ihre Sexualpartner vor einer HIVInfektion noch informieren sie ihre Sexualpartner über die eigene bestehende HIVInfektion. 46,0% geben an Schutzmaßnahmen bei sexuellen Kontakten zu treffen. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über das Sexualverhalten der untersuchten Stichprobe. Tab.6.14.: Sexualverhalten der Stichprobe. „Schützen Sie Ihren Sexualpartner vor Infektion und sich vor einer Re-Infektion?“ Männer Frauen Prozent (Gesamt) Ja 32% 14% 46,0% Nein 31,3% 13,3% 44,6% Keine Antwort 4,6% 4,6% 9,3% Wie die Tabelle 6.14. deutlich zeigt, stellt die Tatsache, ob Männer und Frauen sich selbst und ihren Sexualpartner schützen oder nicht, ein durchschnittliches Verhältnis von 1 : 1 dar. Nur 9,3% der Probanden verweigerte diesbezüglich eine Aussage. 6.4. Analyse der Messinstrumente Zunächst erfolgt eine kurze Darstellung der benötigten und eingesetzten Verfahren. Faktorenanalyse Als datenreduzierendes Verfahren stellt die Faktorenanalyse eine Möglichkeit dar, aufgrund ihrer korrelativen Beziehungen, Variablen zu unabhängigen Gruppen zu klassifizieren. Als hypothetische Größen erklären Faktoren den Zusammenhang zwischen Variablen. Die daraus resultierenden Variablengruppen enthalten eine ähnliche Struktur. Hierdurch lassen sich die Dimensionalitäten der einzelnen Konstrukte überprüfen und Hypothesen generieren (Bortz, 1993). Eigene Untersuchung 99 Reliabilitätsprüfung Interne Konsistenz Die Reliabilität erfasst den Grad der Genauigkeit in der Messung eines Merkmals (Präzision). Die Reliabilität spiegelt den Grad wider, mit dem eine Messung frei von zufälligen Messfehlern ist. Allgemein ergibt sich die Reliabilität aus der Beziehung: Reliabilität = 1 – Fehlervarianz/Gesamtvarianz (Backhaus, 1996). Der Alpha-Koeffizient nach Cronbach ( wird als Maß für die interne Konsistenz der eigenen Untersuchung zugrunde gelegt, wobei Werte über > .70 eine ausreichende interne Konsistenz für explorative Verfahren darstellen. Die Reliabilitäten von > .80 sind als gut zu bezeichnen (Bortz, 1993). Trennschärfe Als statistischer Kennwert der Itemanalyse gibt die Trennschärfe Aufschluss darüber, wie groß der Beitrag des einzelnen Items zur Differenzierungsfähigkeit der gesamten Skala ist. Hierbei sind hohe Trennschärfen erstrebenswert (Bortz, 1993). Die Werte sollten allgemein mindestens rit = .30 betragen. 6.4.1. Die SCL-90-R Für die eigene Untersuchung wurde die SCL-90-R einer Reliabilitätsanalyse unterzogen und konnte mit der Trennschärfe von rit = 1,44 und einem .94 die von Derogatis (1986) vorgelegte gute Konsistenz bestätigen. 6.4.2. Der Fragebogen zur erhaltenen Unterstützung (UNTERST) Dieser Fragebogen besteht aus fünf verschiedenen Items. Vier Items decken die informationelle, instrumentelle, bewertende und emotionale Unterstützung ab, und das fünfte Item erfasst die Reziprozität der Unterstützung. Die erste Unterskala des Eigene Untersuchung 100 Fragebogens (UNTERST A) fragt nach den verschiedenen Formen der Unterstützung und nach den Support-Gebern. UNTERST B, als zweite Unterskala, fragt nach der Zufriedenheit mit der Unterstützung. Zur Überprüfung der inhaltlichen Struktur unterzog ich diesen Fragebogen einer Faktorenanalyse. Folgende Kriterien zur Annahme einer Faktorenanalyse wurden dabei zugrunde gelegt: 1. Jeder Faktor hat einen Eigenwert >1 und wird durch mindestens drei Variablen mit Faktorenladungen (a2) und Kommunalitäten (h2) > 5 definiert (Bortz, 1993). 2. Der Anteil der Gesamtvarianz, der von einem Faktor bestimmt wird, beträgt mindestens 5% (Clauß & Ebner, 1989) 3. Die Maße der internen Konsistenz und die Trennschärfen (rit) liegen in einem zufriedenstellenden Bereich (Lienert, 1989). Die Quellenspezifität (siehe Kapitel 4) sollte durch die faktorenanalytische Überprüfung belegt werden. Daher wurde der Fragebogen zur erhaltenen Unterstützung einer Faktorenanalyse nach der Hauptkomponentenmethode mit Kommunalitäteniterationen und einer orthogonalen Varimaxrotation unterzogen. Hierbei konnten 8 von 9 Faktoren der rotierten Komponentenmatrixa in die statistische Berechnung aufgenommen werden. Die Faktorenanalyse bestätigte die Quellenspezifität und somit wurde die Skala UNTERST A durch 8 Faktoren repräsentiert. Eigene Untersuchung 101 Tab.6.15.: Reliabilitäten und Varianzaufklärung der extrahierten Faktoren (UNTERST). Faktor Faktor Faktor Faktor I II III IV Geschwi Partner V Faktor Faktor Faktor VI VII VIII Mitpatie Kollegen Verwand Nachbar Freunde ster Faktor nten te Eltern n .95 .92 .91 .91 .82 .79 .89/.90 1.04/1.4 .25/.31 .27/.48 .19/.23 .13/.71 .87 .96 rit 1 Eigenwe 1.69/2.1 1.30/1.7 3 9,34 5,43 3,11 2,38 1,80 1,73 1,34 1,02 29,2 16,7 9,6 7,1 5,6 5,2 4,2 3,2 29,2 46,0 55,6 62,7 68,4 73,6 77,8 81,0 rt Anteil an Gesamtv arianz % Kumulie rte Varianz Insgesamt können die 8 Faktoren eine Varianz von 80,8 % aufklären. Der Faktor I stellt mit 29,2 % den größten Anteil an der Gesamtvarianz. Die Quelle die durch diesen Faktor repräsentiert wird (Geschwister) wird als besonders unterstützend erlebt. Die Faktoren sind inhaltlich so zu interpretieren, dass die Supportquelle deutlich dominiert. Dies besagt, dass offensichtlich die Quelle des Supports und nicht die Art der Unterstützung von Bedeutung ist (vgl. Kapitel 4). Die für die eigene Untersuchung durchgeführte Faktorenanalyse bestätigt hinsichtlich des Verlustes wichtiger Supportquellen die Studien der Forscher Franke (1990) und Jäger (1989). Eigene Untersuchung 102 6.5. Ergebnisse Nachdem die Reliabilitätsanalyse, Faktorenanalyse Regressionsanalyse und die Itembeschreibung für die Messinstrumente durchgeführt und beschrieben wurde, werden nun die folgenden Ergebnisse statistischer Operationen dokumentiert. 6.5.1. Ergebnisse der SCL-90-R Bei der Auswertung aller Fragebögen konnte in 150 Fällen (100%) der Global-SeverityIndex (GSI) ermittelt werden. Der GSI der untersuchten Stichprobe (n = 150) betrug = .34 (s = .25; SD = .00183) und ist somit um den Faktor .01 höher als der GSI der gesunden Eichstichprobe. 81 Patienten (54%) lagen hierbei unter dem GSI der Eichstichprobe von .33 . GSI 40 30 20 Hä ufi 10 gk eit Std.abw. = ,22 Mittel = ,34 N = 150,00 0 ,0 6 ,1 9 ,3 1 ,4 4 ,5 6 ,6 9 ,8 1 ,9 4 1, 06 1, 19 1, 31 GSI Abb. 6.16.: Der GSI der eigenen Untersuchung. Dies bedeutet, dass sich diese Gruppe als gar nicht oder gering belastet fühlt. 69 Patienten (46%) liegen in ihrer subjektiven Belastung über dem Normwert von .33. Die höchste Belastung GSImax liegt bei 1.31. Frauen und Männer zeigten ein unterschiedliches Belastungsprofil: Frauen fühlten sich stärker belastet. Eigene Untersuchung 103 1,6 1,4 150 1,2 149 1,0 148 147 146 145 144 ,8 143 140 ,6 ,4 ,2 GSI 0,0 -,2 N= 102 48 männlich w eiblich Geschlecht Abb. 6.17.: Der GSI bei Frauen und Männern in der Stichprobe. In der Untersuchung waren die türkischen Patienten stärker belastet als die italienischen. Deutsche Patienten waren insgesamt weniger belastet. Bei der Frage nach dem Lebenspartner als wichtige Unterstützungsquelle zeigten sich in bezug auf den GSI kaum Unterschiede. 1,6 1,4 150 1,2 149 148 1,0 146 147 145 144 ,8 143 140 ,6 ,4 ,2 GSI 0,0 -,2 N= 51 99 mit Partner ohne Partner Lebenspartner Abb. 6.18.: Partnerschaft und GSI. Eigene Untersuchung 104 Bei der Frage der psychosozialen Belastung im Hinblick auf die in dieser Stichprobe erhobenen Sexualitätsklassen ergab sich folgendes Bild: 1,6 1,4 150 1,2 149 1,0 148 147 146 144 ,8 143 141 142 140 138 137 135 ,6 ,4 GSI ,2 0,0 -,2 N= 1 11 Fehlend 55 sc hw ul homos exuell 19 43 12 heteros exuell bis exuell Art der Sexualität Abb. 6.19.:Der GSI und die Sexualität der Stichprobe. homophil 1 8 pädophil keine Angabe Eigene Untersuchung 105 Die Kategorie „homosexuell“ präsentiert den Anteil homosexueller Frauen, welche insgesamt stärker belastet sind als die homosexuellen Männer (Kategorie „schwul“).Der Anteil der hetero- und bisexuellen Probanden ist am stärksten belastet. Die Kategorie „Pädophil“ war in der Stichprobe durch n = 1 vertreten und wird somit in der weiteren Diskussion nicht berücksichtigt. Der Anteil der Probanden, die angaben, derzeit unter körperlichen Beschwerden zu leiden, zeigten deutlich höhere GSI Werte. 1,6 1,4 1,2 148 1,0 145 144 ,8 140 138 136 ,6 ,4 GSI ,2 3 0,0 -,2 N= 2 71 ja 18 20 gastrointestinale be nein hautprobleme 22 17 ZNS TU-Leiden Körperliche Beschwerden Abb. 6.20.: Der GSI und die körperlichen Beschwerden der Stichprobe. Wie die Abbildung 6.20. zeigt, haben die Patienten die zu ihrer HIV Infektion oder AIDS Erkrankung zusätzlich körperlich belastet sind, höhere GSI Werte als Patienten, die zwar HIV/AIDS erkrankt sind, aber derzeit nicht unter körperlichen Beschwerden leiden. Wie die Abb.6.20. zeigt, leiden die Patienten am häufigsten unter gastrointestinalen Beschwerden (12%), Hautproblemen (13,3%), Störungen des ZNS (14,7%) und Tumorerkrankungen (11,3 %). Insgesamt litten 51,3% aller Befragten unter Beschwerden, Frauen häufiger (56%) als Männer (49,1%). Eigene Untersuchung 106 Die 90 untersuchten Einzelsymptome lassen sich zu den im Kapitel 6.2.2. beschriebenen Subskalen zusammenfassen. 1. Subskala Somatisierung 12 Items repräsentieren diese Skala mit einem= .34, s = .40 und einem Standardfehler (SD) von .0033. Subskala Somatisierung Schwere in Arm/Bein 6,0% Schwäche 15,4% Kopfschmerzen 16,4% Schwindel 2,7% Herz- Brustschmerz Engegefühl 6,9% 4,4% Kreuzschmerzen 7,5% Muskelschmerzen Taubheit/Kribbeln 6,0% 15,8% Atemnot Hitzewallungen 11,0% 7,9% Abb. 6.21.: Subskala Somatisierung. Das Symptom „Kopfschmerz“ war mit 16,4% das häufigste Symptom der untersuchten Patienten in dieser Skala.15,8% der Patienten litten unter Taubheit und Kribbeln in Armen und Beinen. Dies lässt auf eine neurologische Ätiologie schließen (vgl. Kapitel 3). Der GSI dieser Skala ist mit = .34 um den Faktor .01 erhöht. Eigene Untersuchung 107 2. Subskala Zwanghaftigkeit Die Zwanghaftigkeit wird durch 10 Items gemessen, der Mittelwert lag bei = .25, s = .26 und der Standardfehler betrug SD = .0021. Mit einem Mittelwert von = .75 stellen Konzentrationsstörungen das häufigste Symptom dieser Skala dar. 3.Subskala Unsicherheit im Sozialkontakt Die durchschnittliche Unsicherheit im Sozialkontakt betrug = .27, Standardabweichung s = .25 und SD = .0020. Das Gefühl, andere würden sie nicht verstehen oder erscheinen teilnahmslos, stellte mit = .58 einen mittleren Wert dar. Das Item „Verletzlichkeit in Gefühlsdingen“ präsentierte mit = 1.12 einen hohen Wert. 4. Subskala Depression Der Mittelwert der 13 untersuchten Items lag bei = .64, s = .35 und SD = .0035. Mit diesem Wert liegt die untersuchte Stichprobe um den Faktor .31 über dem Gesamtwert der Eichstichprobe. Eigene Untersuchung 108 Subskala Depression Gefühl, (wertlos ) ,9% Kraftlos 14,3% Hoffnungslosigkeit 13,8% Keine Interessen 1,4% Gefühl, (Sorgen) 10,0% Schwermut 3,6% Vermind. Sex. 10,5% Energielosigkeit 7,5% Suizidgedanken 4,9% neigung zum Weinen 17,2% Befürchtungen ,5% Selbstvorwürfe 3,0% Einsamkeitsgefühl 12,4% Abb. 6.22.: Subskala Depression Das Symptom „Neigung zum Weinen“ wurde von 17,2% der Patienten angegeben. 14,3% fühlen sich kraftlos und 13,8% haben das Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der Zukunft. Eine Verminderung des Interesses und der Freude an Sexualität gaben 10,5% der Patienten an. 5. Subskala Ängstlichkeit Die durchschnittliche Ängstlichkeit der untersuchten Stichprobe lag bei = .03, s = .26, SD = .0026. Unter dem Gefühl, dass ihnen etwas Schlimmes passiert, litten mit einem hohen Wert durchschnittlich = 1.06 der Befragten. Eigene Untersuchung 109 6. Subskala Aggressivität und Feindseligkeit Durchschnittlich lag die Aggression und Feindseligkeit mit einem Mittelwert von = .42, s = .37, SD = .0037 über dem Wert der Eichstichprobe. Subskala Aggressivität reizbar Bedarf zu schreien 18,5% 25,6% Auseinandersetzung 3,0% Dinge zerstören 13,6% Gefühlsausbrüche 36,2% Schlagen wollen 3,0% Abb. 6.23.: Subskala Aggressivität Das Symptomenprofil der Aggression zeigt, dass 36,2% der Patienten unter Gefühlsausbrüchen litt, gegenüber denen sie machtlos waren, 25,6% litten unter dem Bedürfnis, laut zu schreien, und 18,5% gaben an leicht reizbar und verärgerbar zu sein. Insgesamt hatten 16,6% sowohl den Wunsch, Dinge, Gegenstände zu werfen oder zu zerstören, als auch Personen zu schlagen oder zu verletzen. 3% der Befragten leiden darunter, häufig in Auseinandersetzungen zu geraten. 7. Subskala Phobische Angst Die untersuchten 7 Items repräsentierten die Phobische Angst der Stichprobe mit einem Mittelwert von = .17, s = .30, SD = .0030. Das Symptom „starke Nervosität, wenn man Eigene Untersuchung 110 alleine gelassen wird“ war mit einem Mittelwert = .33 die häufigste Antwort dieser Skala. 8. Subskala Paranoides Denken Paranoides Denken lag mit 6 Items im Durchschnitt bei = .14, s = .24, SD = .0023. Keines dieser Items lag außerhalb der GSI Normbereiche. 9. Subskala Psychotizismus 10 Items repräsentieren diese Skala mit einem Mittelwert von = .25, s = .19, SD = .0019. Mit einem Mittelwert von = 1.38 war das Item 87, „dem Gedanken, daß etwas mit dem Körper ernstlich nicht in Ordnung ist“ am stärksten in dieser Skala vertreten. Dieses Item ist um den Faktor 1.0 höher gegenüber der Eichstichprobe. Diese Ergebnisse zeigen einen erhöhten GSI der untersuchten Stichprobe in den Subskalen „Depression (22,8%)“, Aggressivität (14,9%)“ und „Somatisierung (12,0%)“ (vgl. Abb. 6.24.). Eine detaillierte Befunderhebung und daraus resultierende Einzelbefunde sind den Einzelabbildungen zu entnehmen. Die Skalen „Zwanghaftigkeit“, „Unsicherheit im Sozialkontakt“, Ängstlichkeit“, „Phobische Angst“, „paranoides Denken“ und „Psychotizismus“ zeigten in der Auswertung keine erhöhten Werte. Aus den einzelnen Subskalen zusammengesetzt lässt sich der GSI wie folgt darstellen: Eigene Untersuchung 111 Die Subskalen der Stichprobe PSYCHOTI 8,7% PARANOID 5,0% PHOBANGS 6,2% AGGRESSI 14,9% AENGSTLI 11,8% SOMATISI 12,0% ZW ANGHAF 8,8% UNSICHER 9,8% DEPRESSI 22,8% Abb. 6.24.: Die Subskalen der Stichprobe (GSI). 6.5.2. Ergebnisse des Fragebogens zur „erhaltenen“ Unterstützung (UNTERST) Für diese Skala ist die Faktorenlösung akzeptiert worden, und es werden zunächst Ergebnisse vorgestellt, die die gesamte Skala betreffen. Anschließend werden die Ergebnisse der Subskalen besprochen. Die insgesamt erhaltene durchschnittliche Unterstützung (UNTERST A) liegt in einem sehr niedrigen Bereich ( = .80, s = .49, SD = .004). Die instrumentelle Unterstützung durch Freunde ( = 2.13, s = 1.02, SD = .008) und durch Geschwister ( = 1.89, s =1.12,SD = .009) stellen sowohl die häufigste Form des Supports, als auch die häufigste Support-Quelle, dar. Dies bedeutet, dass die HIV- und AIDS Patienten von ihren Freunden und von den Geschwistern die wichtigste Unterstützung in Form von „Hilfe durch Taten“ beziehen. 1. Subskala „Unterstützung durch die Eltern“ Durchschnittlich erhielten die Probanden von ihren Eltern wenig Unterstützung ( = 1.45, s = 1.21, SD = .008). Mit = 1.69, s = 1.27 und SD = .10 gibt der instrumentelle Support die Eigene Untersuchung 112 tatsächliche erhaltene Unterstützung am besten wieder. Am wenigsten Unterstützung erhalten die Patienten im Bereich des informationellen Supports ( = 1.29, s = 1.26, SD = .10). Insgesamt ist die emotionale Unterstützung sehr gering, wobei die Eltern eher „Verständnis“ zeigen als ihren erkrankten Kindern „Mut“ zuzusprechen ( = 1.33, s = 1.33, SD = .10). 2. Subskala „Unterstützung durch die Geschwister“ Die erhaltene Unterstützung durch die Geschwister ist gering und liegt im Durchschnitt bei = 1.85, s = 1.04, SD = .008. Trotz des geringen Durchschnittswertes stellt die Supportquelle „Geschwister“ die zweithäufigste Quelle der Untersuchten dar. Am häufigsten unterstützen die Geschwister durch „Taten“ ( = 1.89, s = 1.12, SD = .009) und weniger dadurch, Mut zuzusprechen oder ihren erkrankten Geschwistern zuzuhören ( = 1.34, s = 1.16, SD = .009). 3. Subskala „Unterstützung durch Verwandte“ Der Durchschnittswert der Unterstützung durch Verwandte liegt in einem niedrigen Bereich ( = .23, s = .58, SD = .004).Verwandte scheinen den Probanden am besten durch Zuhören und durch Taten ( = .27, s = .27, SD = .008) zu helfen. 4. Subskala „Unterstützung durch den Partner“ Die erhaltene Unterstützung durch den Partner liegt mit durchschnittlich = 1.23, SD = .008 und einer empirischen Standardabweichung von s = 1.04 in einem niedrigen Bereich. Partner unterstützen am häufigsten durch Taten ( = 1.42, s = 1.19, SD = .009) und weniger dadurch, ihren Lebenspartnern verständnisvoll zuzuhören ( = 1.35, s = 1.15, SD = .009). Die Probanden erhalten ebenfalls wenig Tips, Informationen oder Ratschläge ( = 1.03, s = 1.21, SD = .009) durch ihre Lebenspartner. Eigene Untersuchung 113 5. Subskala „Unterstützung durch Freunde“ Bei dieser Skala liegt der Wert der durchschnittlichen Unterstützung in einem niedrigen Bereich ( = 1.93, s = .88, SD = .007), stellt aber gleichzeitig den höchsten durchschnittlichen Wert der gesamten erhaltenen Unterstützung in der Stichprobe dar. Freunde scheinen den Probanden am häufigsten durch Taten, verständnisvolles Zuhören und Mut zusprechen zu helfen ( = 2.13, s = 1.02, SD = .008). 6. Subskala „Unterstützung durch Kollegen“ Die erhaltene Unterstützung durch Kollegen liegt mit = .35, SD = .005. und einer empirischen Standardabweichung von s = .66 in einem sehr niedrigen Bereich. Instrumentelle Hilfe bekamen die Probanden von den Kollegen am häufigsten ( = .48, s = .83, SD = .008). Informationelle Unterstützung erhielten sie durch die Kollegen mit einem Mittelwert von = .002 (s = .67, SD = .005) fast nie. Emotionale Unterstützung gaben die Kollegen mit den Mittelwerten = .31 (s = .005, SD = .69) durch „Zuhören und Verständnis zeigen“ und mit = .33 (s = .006, SD = .77) durch „Mut machen“ insgesamt auch weniger als die Kategorie „selten“. Kollegen scheinen die Patienten in jeder Hinsicht sehr wenig zu unterstützen. 7. Subskala „Unterstützung durch Nachbarn“ Durchschnittlich erhielten die Probanden von den Nachbarn noch weniger Unterstützung als von den Kollegen. Der Durchschnitt liegt bei einem Mittelwert von = .31 (s = .0032, SD = .18). Hierbei fand die Frage nach instrumenteller Unterstützung mit einem Mittelwert von = .48 (s = .36, SD = .001) die häufigste Zustimmung. Am wenigsten gaben die Probanden die informationelle Unterstützung an ( = .02, s = .12, SD = .009). Nachbarn scheinen den Patienten allgemein wenig zu helfen, doch am meisten erfolgt die Unterstützung durch Taten. Eigene Untersuchung 114 8. Subskala „Mitpatienten“ Der Durchschnittswert der Unterstützung durch Mitpatienten liegt in einem sehr niedrigen Bereich bei = .28 (s = .65, SD = .005). Sie unterstützten die Probanden am häufigsten durch emotionale Unterstützung und zwar durch Zuhören und Verständnis zeigen ( = .31, s = .82, SD = .006). Mut gemacht haben ihnen die Mitpatienten dagegen weniger. Mit einem Mittelwert von = .25 (s = .70, SD = .005) liegt das Item „Mut machen“ am niedrigsten. Mitpatienten scheinen durch Zuhören und Verständnis zeigen emotionell zu unterstützen, doch durch „Mut machen“ geschieht dies seltener. Die Skala der Reziprozität zeigte, dass die untersuchten Patienten durchschnittlich mehr Unterstützung gewähren als selbst Unterstützung bekommen ( = 1.2, s = .48, SD = .0093). Subskala „Zufriedenheit mit der tatsächlich erhaltenen Unterstützung“ (UNTERST B) Dieser Skala liegt ein bipolares 7-stufiges Rating zugrunde (1 = sehr unzufrieden bis 7 = sehr zufrieden). In dieser Untersuchung wird die Zufriedenheit in bezug auf die Supportdimension ebenfalls nach Supportquellen unterteilt. Die durchschnittliche Zufriedenheit mit der tatsächlich erhaltenen Unterstützung ist niedrig ( = 1.84, s = .745, SD = .0061).mit der Unterstützung durch Taten waren die Probanden am zufriedensten ( = .94, s = .40, SD = .0033), doch erhalten sie wenig emotionale Unterstützung und sind demzufolge damit sehr unzufrieden ( = .90, s = .38, SD = .0031). Mit der Unterstützung durch Geschwister ( = 1.00, s = .65, SD = .0054) und durch Freunde ( = 1.00, s = .819, SD = .0067) sind die Patienten am zufriedensten. Die stärkste Unzufriedenheit mit erhaltener emotionaler, instrumenteller und informationeller Unterstützung liegt bei der „Unterstützung durch den Lebenspartner“ ( = .64, s = .72, SD = .0059). Eigene Untersuchung 115 6.5.3. Offene Kategorien Durch die Einführung offener Kategorien wurde den Probanden ermöglicht, fehlende Unterstützungsquellen zu ergänzen. 17% der Befragten nannten die „Unterstützung durch Krankenschwestern“. Aufgrund des zu geringen Anteils an der Gesamtvarianz wurde dieser Faktor als einziger nach der Faktorenanalyse nicht mehr berücksichtigt. 6.5.4. Hypothesenrelevante Ergebnisse Zur Überprüfung der hypothetisierten Zusammenhänge wurde der Rang- Korrelationskoeffizient nach Spearman berechnet. Die Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson musste aufgrund der angestrebten methodischen Stringenz verworfen werden (Backhaus, 1996). Der Korrelationskoeffizient r beschreibt die Enge des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen anhand einer Zahl, welche zwischen –1 und +1 liegt (Backhaus, 1996; Bortz, 1993). Bei zweidimensionalen Tabellen kann die Schwierigkeit auftreten, den gefundenen Sachverhalt zu interpretieren. Durch das Einbeziehen einer dritten Variablen W (Vw) kann eine veränderte Interpretation Korrelationsproblematik wurden Zusammenhangshypothesen Scheinkorrelationen (spurious notwendig für die werden. Umgehung hypothesenrelevanten Partialkorrelationen correlation) Zur berechnet, auszuschließen. Ergebnisse um Die dieser der sogenannte ursprünglichen Beziehungen der Variablen der Zusammenhangshypothesen 1. – 5. konnten nach Punkt 5 der folgenden Tabelle 6.16. beibehalten werden. Eigene Untersuchung 116 Tab.6.16.: Klassifikation der Effekte einer dritten Variablen auf die Korrelation zweier Variablen. Friedrichs, J. (1980). Methoden empirischer Sozialforschung. Ursprüngliche Partialkorrelation Partialkorrelation Partialkorrelation Korrelation gleich gleich unterschiedlich 0 Nicht 0 Korrelation nicht Korrelation durch Begründung für durch dritte Variable dritte Variable fehlende Beziehung verdeckt (1) verdeckt (3) 0 (2) Scheinkorrelation Nicht 0 (4) Korrelation Spezifikation der bleibt erhalten Beziehung (5) (6) Es wurde angenommen, dass zwischen der psychosozialen Belastung und der tatsächlich erhaltenen Unterstützung ein negativer Zusammenhang besteht (Hypothese 1). Diese Annahme lässt sich auf dem 1% Niveau bestätigen. Dieser geprüfte Zusammenhang ist für beide Faktoren „GSI“ und „Unterstützunggesamt“ negativ und mittelhoch sowie sehr signifikant (r = .405). Zudem wurde angenommen, dass dieser negative Zusammenhang hoch korreliert (Hypothese 2). Wie die Berechnung zur Überprüfung der Hypothese 1 zeigt, ist der negative Zusammenhang mit r = .405 nur mittelhoch korreliert. Die Hypothese 2 wird an dieser Stelle mit einem Risiko von .01% verworfen. Es konnte nicht gezeigt werden, dass der Zusammenhang hoch korreliert. Eigene Untersuchung 117 Die Hypothese 3 postuliert einen negativen Zusammenhang zwischen einer depressiven Befindlichkeitsstörung betroffener Patienten und der emotionalen Unterstützung durch Familie, Partner, Freunde, Verwandte, Kollegen, Nachbarn und Mitpatienten. Diese Annahme lässt sich auf dem 1% Niveau bestätigen. Der geprüfte Zusammenhang ist für beide Faktoren „Depression“ und „Unterstützungemotional“ negativ und mittelhoch sowie sehr signifikant (r = .425). Dies bedeutet, je weniger emotionale Unterstützung die Patienten dieser Stichprobe erhielten, desto depressiver war ihre Symptomenlage. In der These 4 wurde angenommen , dass der Zusammenhang zwischen Somatisierung und der tatsächlichen erhaltenen Unterstützung durch die Lebenspartner ein negativer ist. Die Berechnungen repräsentieren mit r = .06 ein nicht zu interpretierendes Ergebnis. Somit steht dieses Ergebnis erwartungswidrig zu den theoretischen Überlegungen von Jäger (1989) und Franke (1990). Die These 4 wird an dieser Stelle mit einem Risiko von .01% verworfen. Die Hypothese 5 postuliert einen negativen Zusammenhang zwischen Somatisierung und der Zufriedenheit der Patienten mit der erhaltenen Unterstützung ihrer Lebenspartner. Diese Annahme lässt sich auf dem 1% Niveau bestätigen. Der geprüfte Zusammenhang ist für beide Faktoren „Somatisierung“ und „Zufriedenheit mit der erhaltenen Unterstützung durch die Lebenspartner“ negativ und mittelhoch sowie sehr signifikant (r = .34). Dies bedeutet, je unzufriedener die Patienten mit der Unterstützung ihrer Lebenspartner sind, desto stärker zeigen sich körperliche Symptome des vegetativen Formenkreises (Kopfschmerzen, Magen- Darmbeschwerden etc.). In diesem Fall erscheint die körperliche Belastung („discomfort“ und „distress“) als das Resultat subjektiv eingeschätzter Belastungsereignisse und der Ressourcenwahrnehmung in Abhängigkeit der Bedeutung postulierter Quellenspezifität von sozialer Unterstützung. 6.5.4.1. Interindividuelle Unterschiede Eigene Untersuchung 118 Um die Hypothesen 6 –9 zu überprüfen, wurde als Signifikanztest für intervallskalierte Daten der t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. Die Varianzhomogenität der beiden Stichproben ist die Voraussetzung für die Anwendung des t-Test und wurde anhand des F-Testes überprüft (Lienert & Raatz, 1994). In der Hypothese 6 wurde angenommen, dass heterosexuelle Probanden und homosexuelle Männer unterschiedliche Werte in ihrer psychosozialen Belastung aufzeigen. Zur rechnerischen und graphischen Darstellung der Mittelwertunterschiede dient der Boxplot. 1,6 1,4 150 1,2 149 1,0 148 147 146 144 ,8 143 142 141 140 138 137 135 ,6 ,4 GSI ,2 0,0 -,2 N= 1 11 Fehlend 55 sc hw ul homos exuell 19 43 12 heteros exuell bis exuell homophil 1 8 pädophil keine Angabe Art der Sexualität Abb.6.25.: Mittelwertsunterschiede homo- und heterosexueller Patienten. Die homosexuellen Männer sind in der Kategorie „schwul“ repräsentiert (vgl. Kapitel 6.5.1.). Vergleicht man in der Abbildung die Mittelwerte von homo- und heterosexuellen Patienten in bezug auf ihre psychosoziale Belastung, zeigt sich, dass die heterosexuellen Patienten eine um den Faktor .13 höhere psychische Belastung aufweisen. Die Hypothese 6 kann somit bestätigt werden. An dieser Stelle soll nun auf die Hypothese 7 eingegangen werden. Eigene Untersuchung 119 Es wurde angenommen, dass homosexuelle Probanden eine höhere psychische Belastung aufweisen als heterosexuelle Probanden. Zur Überprüfung dieser These wurde der t-Test für unabhängige Stichproben bei zweiseitiger Fragestellung durchgeführt. Dabei ergaben sich folgende Werte: Tab.6.17.: Der Belastungsunterschied zwischen homo- und heterosexuellen Probanden. Homosexuell Heterosexuell = .28 = .41 s = .21 s = .26 SD = .0028 SD = .0040 Dieses Ergebnis besagt, dass heterosexuelle Probanden psychisch stärker belastet sind als homosexuelle Probanden. Die Annahme der Hypothese konnte somit nicht bestätigt werden und wird an dieser Stelle mit einem Risiko von .01% verworfen. Bei einem Signifikanzniveau von .22 ist das Ergebnis nicht zu interpretieren sondern stellt eine Tendenz innerhalb der Stichprobe dar. In der Hypothese 8 wurde angenommen, dass Frauen mehr emotionale Unterstützung erhalten als Männer. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde als Signifikanztest der tTest für unabhängige Variablen eingesetzt. Im Durchschnitt erhalten Männer ( = .81, s = .52, SD = .0051) mehr emotionale Unterstützung als Frauen ( = .75, s = .51, SD = .0074). Das Signifikanzniveau von .05 wurde nicht erreicht. Somit lässt sich dieses Ergebnis nicht interpretieren, sondern stellt eine Tendenz innerhalb der untersuchten Stichprobe dar. Die Hypothese konnte nicht bestätigt werden und wird an dieser Stelle verworfen mit einem Risiko von höchstens Die Hypothese 9 postuliert, dass Frauen mit erhaltener Unterstützung zufriedener sind als Männer. Der Signifikanztest (t-Test) für unabhängige Variablen wurde zur Überprüfung dieser Hypothese eingesetzt. Im Durchschnitt sind Männer ( = 1.85, s = .77, SD = .0073) Eigene Untersuchung 120 mit ihrer erhaltenen emotionalen Unterstützung zufriedener als Frauen ( = 1.80, s = .68, SD = .99). Das Ergebnis lässt sich aufgrund des nicht erreichten Signifikanzniveau von .05 nicht interpretieren, sondern stellt eine Tendenz innerhalb der Stichprobe dar. Die Hypothese konnte nicht bestätigt werden und wird an dieser Stelle mit einem Risiko von höchstens verworfen. 6.5.4.2. Die Regressionsanalyse Mit der Regressionsanalyse lassen sich Zusammenhänge erkennen, erklären, schätzen und prognostizieren. Hierbei wird die Beziehung zwischen einer abhängigen Variablen und einer oder mehrerer unabhängiger Variablen untersucht. Die Regressionsanalyse kann im Rahmen der Pfadanalyse zur Untersuchung mehrstufiger Kausalstrukturen eingesetzt werden. Im Sinne eines sachlogischen „Vor-Urteils“ wird eine Einteilung der Variablen in abhängige und unabhängige Variable vorab getroffen (Backhaus, 1996). Nach den statistischen Operationen der Faktorenanalyse, Reliabilitätsanalyse, den Korrelationsberechnungen, Partialkorrelationsberechnungen und den t-Tests soll nun, die Statistik schließend, der zentralen Frage dieser Arbeit nachgegangen werden. Die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit postuliert einen negativen Zusammenhang zwischen der psychosozialen Befindlichkeit und der erhaltenen sozialen Unterstützung. Dieser negative Zusammenhang wurde durch mehrere statistische Operationen geprüft (vgl. Kapitel 6.5.4.). Um festzustellen wer der eigentliche Prädiktor in bezug auf die psychosoziale Befindlichkeit der untersuchten Stichprobe ist, wurde die Regressionsanalyse in die statistischen Methoden aufgenommen. Der gesamte Belastungsindex (GSI), die gesamte erhaltene Unterstützung und die gesamte Zufriedenheit mit der Unterstützung stellen die zu untersuchenden Variablen dar. Hierbei wurden die Variablen wie folgt festgelegt: Tab.6.18.: Variablen der Regressionsanalyse. Abhängige Variable Einflußvariablen Erhaltene Unterstützunggesamt GSI Zufriedenheit mit Unterstützunggesamt Eigene Untersuchung 121 Die Analyse ergab, dass die geleistete soziale Unterstützunggesamt den Prädiktor in bezug auf das Belastungsprofil der HIV- und AIDS-Patienten darstellt (r2 =.273, F = 27,19, = .257). Dies bedeutet, dass der Grad der geleisteten Unterstützung die psychosoziale Befindlichkeit maßgeblich determiniert. Die Zufriedenheit mit der Unterstützunggesamt (r2 =.243, F = 46.75) ist in bezug auf den GSI weniger beeinflussend. Daraus lässt sich folgern, dass ein hoher Grad geleisteter instrumenteller, emotionaler und informeller Unterstützung die Gesamtbelastung (GSI) senken kann. 6.6. Diskussion der Ergebnisse Zuerst soll an dieser Stelle noch einmal kurz darauf eingegangen werden, in welchem gesundheitswissenschaftlichen Kontext diese Studie steht. Anschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung diskutiert. Durch die „neue“ Infektionskrankheit AIDS zeichnete sich weltweit ein verändertes Krankheitsspektrum ab. Die einfachen Gesundheits- und Krankheitsmodelle können die aufgetretenen Entwicklungen nicht ausreichend erklären. Es ist ätiologisch und epidemiologisch gesichert, dass humangenetische und umweltbedingte Faktoren gleichermaßen beeinflussend wirken wie die Lebensweise von Menschen. Diese Veränderungen bedingen die Verantwortung für Forscher aller Disziplinen, die Ursachen, Bedingungen und Maßnahmen zu untersuchen, um das Auftreten von Erkrankungen zu verringern und bestehende Erkrankungen multiprofessionell zu therapieren, um die Lebensqualität chronisch Kranker optimieren zu können. Soziale Bedingungen spielen eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung chronischer Erkrankungen. Versagen bei einer chronischen Krankheit Formen sozialer Unterstützung (Jäger, 1989) kann das zu einer Störung des psychobiologischen Gleichgewichts führen und eine Krankheitsmanifestation bewirken. So ist es notwendig herauszufinden, in welcher Abhängigkeit soziale Faktoren zu der Befindlichkeit im Leben mit AIDS stehen. Gegenstand der vorliegenden Studie war es somit, das psychosoziale Belastungsprofil in Wechselwirkung des tatsächlich erhaltenen Rückhaltes zu untersuchen. Dazu wurde ein Diskussion 122 Fragebogen eingesetzt, der die derzeitige psychosoziale Befindlichkeit misst, und des weiteren ein Fragebogen zur Messung tatsächlich erhaltenen Unterstützung. Im folgenden werden die zentralen Befunde der unterschiedlichen Prüfverfahren diskutiert. Die Überprüfung theoriegeleiteter Zusammenhangshypothesen zeigte einen negativen Zusammenhang zwischen der psychosozialen Belastung und der tatsächlich erhaltenen Unterstützung. Insgesamt erhält die untersuchte Stichprobe sehr wenig emotionale, informationelle und informationale Unterstützung. Unterstützung durch „Taten“ ist die am häufigsten gewährte Form der Hilfeleistung, und die Kategorie „Freunde“ leistet den häufigsten Support. Die Tatsache, dass die meisten Probanden heute auf ein soziales Umfeld blicken können, das sie unterstützt, sollte eher als Ausnahme betrachtet werden. Selbst durch sehr nahe stehende Personen, wie z.B. die Lebenspartner, erhalten die Probanden keine emotionale Unterstützung. Die fehlende emotionale, instrumentelle und informationelle Unterstützung bedingt eine höhere Befindlichkeitsstörung der untersuchten Stichprobe. Somit konnten die Untersuchungen der Autoren Jäger (1989) und Franke (1990) bestätigt werden. Die fehlende emotionale Unterstützung durch Familie, Lebenspartner, Freunde, Verwandte, Kollegen, Nachbarn und Mitpatienten verursachte eine erhöhte depressive Symptomenlage. Gerade mit der nicht erhaltenen gesamten Unterstützung durch die Lebenspartner waren die Probanden sehr unzufrieden. Fast die Hälfte aller Befragten ist mit der ärztlichen Behandlung und Betreuung sehr unzufrieden, und leiden zudem an starken Nebenwirkungen der ihnen verordneten Medikamente. Objektive medizinische Daten der Ärzte und die subjektive Einschätzung der Patienten (vgl. Kapitel 5) müssen nicht konform gehen. Die subjektive Befindlichkeit, soziale Bedingungen und die Lebensumstände sollten ganzheitlich in der Betreuung und Behandlung integriert sein. Als eine der wichtigsten Unterstützungsquellen bedingt die fehlende emotionale Hilfe der Lebenspartner eine insgesamt erhöhte Somatisierung, was zu einer Störung des psychobiologischen Gleichgewichts führen und eine Krankheitsmanifestation bewirken kann. Je unzufriedener die Patienten mit der fehlenden Unterstützung durch die Diskussion Lebenspartner 123 waren, desto stärker zeigten sich körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Magen-Darmbeschwerden und Taubheit und Kribbeln in Armen und Beinen (vgl. Kapitel 3). Der Überprüfung der weiteren Zusammenhänge zwischen der aktuellen Befindlichkeit und der erhaltenen Unterstützung ging die Analyse der zentralen Hypothesen dieser Untersuchung voraus. Die weitere Untersuchung zeigte eine unterschiedliche psychosoziale Belastung homo- und heterosexueller Patienten. Heterosexuelle Patienten zeigen deutlich höhere GSI-Werte (vgl. Kapitel 6.6.1.) als homosexuelle Männer. Dieses Ergebnis entspricht den aktuellen Forschungen, die seit ungefähr zwei Jahren eine zunehmende Verlagerung unter den Betroffenengruppen verzeichnen (http://www.aids98.ch), darf aber in der vorliegenden Arbeit durch das errechnete Signifikanzniveau von .22 nicht weiter interpretiert werden da es sich statistisch um eine Tendenz innerhalb der Stichprobe zu handeln scheint. Die Arbeit der AIDS-Hilfen basiert auf der Innitiative homosexueller Männer und deren Angehörigen (Jäger, 1989) und schaffte es schon zu Beginn der HIV-Ära, durch die Gesundheitsselbsthilfe und die psychosoziale Beratung die psychischen und sozialen Folgen dieser Infektionskrankheit bei homosexuellen Männern zu minimieren. Unter der Berücksichtigung der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zeigte sich ein zunehmend modifiziertes Verständnis von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Die gebotene Form der Hilfestellung durch die AIDS-Hilfen wird von heterosexuellen Bertoffenen nicht in dem Maße genutzt wie von homosexuellen Probanden, und somit fehlen wichtige Laien- und Professionellenunterstützungssysteme (Jäger, 1989).Die homosexuelle Subkultur scheint ihre Angehörigen noch eher stützen zu können. In der Subkultur der Drogenabhängigen ist es kaum möglich, HIV-positiven Betroffenen zu helfen. Nur der Ausstieg aus der Drogensucht kann dem HIV-Positiven eine Perspektive bieten. Die weitere Untersuchung zeigte, dass Männer mehr emotionale Unterstützung erhalten als Frauen und Männer mit der Form der emotionalen Unterstützung zufriedener sind als Frauen. Obwohl sich dieses Ergebnis durch das nicht erreichte Signifikanzniveau nicht interpretieren lässt, bestätigen Studien diese Beobachtungen (Hall, 1990). Es zeigt sich, in Anlehnung an die Autorin Hall (1990), dass die fehlende emotionale Unterstützung der Diskussion 124 Frauen mit einer höheren gesamten psychosozialen Belastung einher geht (vgl. Kapitel 6.6.1.).56% der befragten Frauen leiden diesbezüglich unter Beschwerden. Ein großes Problem in bezug auf die HIV-Prävention ist, dass Erfolge der derzeitigen Kombinationstherapie (vgl. Kapitel 3.5.) als Heilung fehlinterpretiert werden. Dies führt zu einer Vernachlässigung des Schutzes vor der HIV-Infektion (http://www.hivnet.de/iaahaupt.htm). 44,6% aller Untersuchten schützen weder ihre Sexualpartner noch sich selbst vor der Infektion bzw. einer Reinfektion. So gewinnt im AIDS-Zeitalter seit wenigen Monaten die sogenannte „Bareback-Bewegung“ zunehmend Anhänger. „Bareback“ ist eigentlich ein Begriff, der beim amerikanischen Rodeo verwendet wird und übersetzt „Reiten ohne Sattel“ bedeutet. Für das Sexualverhalten ist damit „bewußter Anal- und Geschlechtsverkehr ohne Kondom“ gemeint. Seit wenigen Monaten werden in der Bundesrepublik „Bareback-Sex-Parties“ veranstaltet, bei denen die Verwendung von schützenden Kondomen tabu ist. Die Möglichkeit der Übertragung neuer oder resistenter HI-Virusstämme wird bewusst in Kauf genommen (http://www.medonline.de). HIV-negative Frauen und Männer lassen sich, obwohl sie gut informiert sind, auf ungeschützten Sex ein. Es stellt sich die Frage, ob sich die jahrelangen Bemühungen der Präventionsarbeit gelohnt haben. Eigenverantwortliches Risikomanagement, so wie es die pädagogischen Berater jahrelang vertraten, ließ jedoch nur immer eine richtige Entscheidung zu, nämlich die für „Safer Sex“. Wie kann aus der Perspektive der HIV-Prävention respektvoll mit solchen Entscheidungen umgegangen werden und wie können sie in die Präventionsarbeit mit einbezogen werden. In einer pluralistischen Gesellschaft ergibt sich aus soziologischer Sicht die Möglichkeit und die Herausforderung, Regeln zu brechen, um Neue zu erstellen. „Safer Sex“ birgt seit der Krankheit AIDS immer die Assoziation mit „Krankheit“ und „Bareback“ soll hier die vermeintliche Rückkehr in die Zeiten vor AIDS übernehmen. Ebenso spielen Verdrängungsmechanismen eine entscheidende Rolle. Unterstützt wird die „Bareback“Einstellung durch angebliche Presseberichte über die wie eben erwähnten Fortschritte in der medikamentösen Behandlung von HIV und AIDS (vgl. Kapitel 3.5.). Es stellt sich eine gewisse Sorglosigkeit ein, die zu risikoreichem Verhalten führt. Diese Tatsache macht eine vermehrte interdisziplinäre Einbindung medizinischer in soziale Kontexte, wie in der vorliegenden Arbeit, notwendig, und bietet eine Grundlage für weitere vertiefende psychosoziale Forschung. Diskussion 125 Leiden die Patienten zu der bestehenden HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung zusätzlich an weiteren Erkrankungen zeigt sich parallel eine insgesamt höhere psychosoziale Belastung. Insgesamt zeigten die untersuchten Patienten erhöhte Belastungswerte in den Subskalen „Depression“, „Somatisierung“ und „Aggressivität“. Symptome wie „Neigung zum Weinen“, „das Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der Zukunft“, „Gefühlsausbrüche“, „dem Bedürfnis laut zu schreien“ sowie häufige „Kopfschmerzen“ stellten die dominierenden Items dar. Die Skalen „Zwanghaftigkeit“, Unsicherheit im Sozialkontakt“, „Ängstlichkeit“, „Phobische Angst“, „paranoides Denken“ und „Psychotizismus“ zeigten in der Auswertung keine erhöhten Werte (vgl. Kapitel 6.6.1.). Gesellschaftliche Zuschreibungsprozesse im Hinblick auf die Immunschwächekrankheit AIDS bedingen eine Abnahme wichtiger Unterstützungsquellen und werden im vegetativen Formenkreis symptomatisch (Franke, 1990; Jäger, 1989; Hall, 1990). Traurige, pessimistische und „ohnmächtige“ Gefühlslagen bestimmen das Gesamtbild der Stichprobe. Die Statistik schließend wurde anhand der Regressionsanalyse der zentralen Frage nach einem negativen Zusammenhang zwischen der psychosozialen Befindlichkeit und der tatsächlich erhaltenen Unterstützung nachgegangen. Die Untersuchung ergab, dass der Grad der tatsächlich geleisteten Unterstützung die psychosoziale Befindlichkeit maßgeblich determiniert. Die Zufriedenheit mit der Unterstützung ist in bezug auf die psychosoziale Befindlichkeit weniger beeinflussend. Daraus lässt sich folgern, dass ein hoher Grad geleisteter instrumenteller, emotionaler und informeller Unterstützung die psychosoziale Gesamtbelastung senken kann. Als „neue“ Krankheit kann die HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung offensichtlich nur bewältigt werden, wenn die Betroffenen Unterstützung ihres sozialen Umfeldes bekommen. Gelingt es den Betroffenen nicht, sich ein neues soziales Umfeld zu suchen, wenn ihres sie nicht auffangen kann, kann die HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung zur Isolation, Krankheit und Vereinsamung führen. 6.7. Ausblick Es sollte das Anliegen zukünftiger interdisziplinärer Forschung zum Thema AIDS sein, Betroffene über einen längeren Zeitraum begleitend zu untersuchen. Durch solche Diskussion 126 Längsschnittstudien können breitere Grundlagen zur Erforschung der psychologischen und sozialen Implikation der Entwicklung der HIV-Infektion gelegt werden. Bisher ist es utopisch, Forschungsergebnisse zu erwarten, die psychosoziale Bedingungen dafür aufzeigen, wie der Verlauf der HIV-Infektion verzögert werden kann. In diesem Zusammenhang ist auf die Forschungsergebnisse der psychoneuroimmunologischen Forschung zu hoffen (vgl. Kapitel 3.7.3.). Es scheint auf methodischer Ebene angezeigt, verschiedene Untersuchungsverfahren anzuwenden, da es sein kann, dass es Verfahren gibt, die Veränderungen der HIVInfektion sensibler zu messen vermögen als die SCL-90-R. In der medizinischen, sozialen und psychologischen AIDS-Forschung sollte es grundsätzlich vermieden werden, etikettierend und stigmatisierend vorzugehen. HIVInfizierte und AIDS-Kranke benötigen unsere Hilfe, Verständnis und Solidarität. Danksagung 127 7. Danksagung Zuerst möchte ich allen Patientinnen und Patienten meiner Untersuchung für ihre Kooperation und Gesprächsbereitschaft danken. Trotz mancher ethischer Schwierigkeiten der Untersuchung hat das Engagement meiner Interviewpartner dazu geführt, dass diese schwierige Thematik gute und dichte Befunde erbrachte. Um eine solidarische Verfahrensweise bemüht, wäre es wünschenswert, wenn die Qualität der vorliegenden Arbeit auch von den Betroffenen selbst beurteilt werden würde. Einige Patienten und Patientinnen konnten die Fertigstellung der vorliegenden Arbeit nicht mehr mit verfolgen. Mein Dank und mein Mitgefühl gilt den Angehörigen, Freunden, Lebenspartnern, den Kliniken und den ambulanten Krankenschwestern, Betreuern und Beratern, die mich freundlicherweise vom Tod einiger Patienten und Patientinnen unterrichteten. So ist ein Anliegen der vorliegenden Arbeit durch erweiterte Transparenz im Umgang und Leben mit HIV und AIDS bestehender sozialer Kälte und Desintegration entgegenzuwirken. Besonderen Dank an meine Mutter und meine Schwester für jede Art sozialer und wissenschaftlicher Unterstützung. Vielen Dank meinen Freunden und Kollegen (alphabetisch): Bert Baltes Birgit Blachutzik Eva Maria Gölden Stephan Israel Annemarie Kentgens Manfredo Pitrasch Stefanie Schulz Marc Siegrist-Gillisen Sebastian Siegrist-Gillisen Sabine Stammer Danksagung 128 Vielen Dank an Frau Prof. Dr. Christine Schwarzer für die Überlassung des Themas dieser Arbeit, der Betreuung, ihrer Initiativen und für die wirklich schöne Zeit an ihrem Institut. Für die mannigfaltigen Tips und Ratschläge sage ich Dank an Frau. Dr. Petra Buchwald, Hr. Dipl. Päd. Dirk Weimar und Herrn Prof. Krauth. Während meiner empirischen Datenerhebung an Patienten der Universitätsklinik Essen suchten Wissenschaftler der erziehungswissenschaftlichen, psychologischen und medizinischen Fakultät den Weg zu mir, da eine ähnliche psychosoziale Studie zu HIV und AIDS in Essen in Angriff genommen werden sollte. Für den gegenseitigen Austausch, die befruchtenden Gespräche und für das Interesse an meiner Arbeit sage ich herzlichen Dank. In memoriam Dr. Uwe Kai Siegrist – Gillisen. Literatur 129 8. Literaturliste Abele, A., Brehm, W. (1990). Sportliche Aktivität als gesundheitsbezogenes Handeln. In: Schwarzer, R. (Hg.), Gesundheitspsychologie. Göttingen: Hogrefe. S. 131-150. Ader, R. (1976).Conditioned adrenocortical steroid elevation in the rat. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 90, pp. 1156-1163. An der Heiden, U., Roth, G., Schwegler, H. (1985). Die Organisation der Organismen: Selbstherstellung und Selbsterhaltung. Funkt. Biol. Med. In: Hesch, R. O. (1989) (Hrsg.). Endokrinologie. München, Wien, Baltimore. Urban Schwarzenberg. Anderson, R., Bury, M. (Hrsg.) (1988). Living with chronic illness: The experiences of patients and their families. London: Hyman Unwin. Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. & Weiber, R. (1996). Multivariate Analysemethoden. Berlin: Springer. Badura, B. (1994). Public Health: Aufgabenstellung, Paradigmen, Entwicklungsbedarf. In: Schaeffer, D., Moers, M., Rosenbrock, R. (Hrsg.): Public Health und Pflege: Zwei neue gesundheitswissenschaftliche Disziplinen. Edition Sigma, Berlin. Balck, F. et al. (1982). Anpassungsprozesse der Familie an die Dialysesituation. In: Angermeyer, M. C., Freyberger, H. (Hrsg.). Chronisch kranke Erwachsene in der Familie, Enke, Stuttgart, pp. 108-113. Bavelas, J. B., Segal, L. (1982). Family System Theory: background and implications. Journal of Communication, 32, pp. 99-107. Bélair, J., Glass, L., an der Heiden, U. et al. (1995). Dynamical disease – mathematical analysis of human illness. Woodbury: AIP-Press, Am. Inst. Physics. Bertalanffy, L. V. (1956). General System Theory. In: Bertalanffy, L. V., Rapaport, R. (Hrsg.). Bertalanffy, L. V. (1972). Zu einer allgemeinen Systemlehre. In: Bleicher, K. (Hrsg.). Besedovsky, H. O., del Rey, A. (1996). Immune-neuro-endocrine interactions: facts and hypotheses. Endocrine Reviews, 17, pp. 64-102. Besedovsky, H., Sorkin, G. Felix, D., Haas, H. (Eds.) (1977). Hypothalamic changes during the immune response. European Journal of Immunology, 7, pp. 323-325. Blalock, J. E. (1984). The immune system as sensony organ. Journal of Immunology, 132, pp. 1067-1070. Literatur 130 Bleibtreu-Ehrenberg, G. (1986). Fragen Viren nach Moral? Unsere Schwierigkeiten mit den Geschlechtskrankheiten. In: Dunde, S. R. (Hrsg.). AIDS – Was eine Krankheit verändert. Frankfurt a. M. Fischer Verlag. Bortz, J. (1984). Lehrbuch der empirischen Forschung für Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer. Bortz, J. (1993). Statistik. Berlin: Springer. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. New York: Basic Books. Brickmann, P., Coates, D., Janoff-Bulman, R. (1978). Lottery winners and accident victoms: Is happiness relativ? Journal of Personality and Social Psychology (36) 917-927. Brooks, W. H., Walmann, M. (1989). Adrenocorticotropin functions as a late acting B cell growth factor and synergizes with IL-5. Journal of Molecular and Cellular Immunology, 4, pp. 327-335. Brownell, A., Shuemaker, S. A. (1984). Social support: An introduction to a complex phenomenon. Journal of Social Issues, 40, 4, pp. 1-9. Bühl, A. Zöfel, P. (1998). SPSS & Windows 7.5. Bonn. Addison Wesley Longman. Bullinger, M. (1991). Erhebungsmethoden. In: Tüchler, H., Lutz, D. (Eds.), Lebensqualität und Krankheit. Auf dem Weg zu einem medizinischen Kriterium Lebensqualität. Köln: Deutscher Ärzteverlag. Bullinger, M., Hasford, J. (1992). Umweltbedingungen und menschliche Lebensqualität: Belastungsfaktoren, Wirkungen, Einflussmöglichkeiten. In: Seifert, G. (Ed), Lebensqualität in unserer Zeit – Modebegriff oder neues Denken? Göttingen. Vandenhoek & Rupprecht. Bullinger, M., Pöppel, E. (1988). Lebensqualität in der Medizin: Schlagwort oder Forschungsansatz. Deutsches Ärzteblatt (85). Bullinger, M., Pöppel, E. (1988). Lebensqualität in der Medizin: Schlagwort oder Forschungsansatz. Deutsches Ärzteblatt (85), 679-680. Bundesministerium für Gesundheit (1992): Statistisches Taschenbuch der Gesundheit. Bonn. Burmester, G. R., Pezzutto, A. (Hrsg.) (1998). Taschenatlas der Immunologie. Stuttgart, New York. Georg Thieme Verlag. Literatur 131 Buske-Kirschbaum, A., Kirschbaum, C., Hellhammer, D. (1990). Psychoneuroimmunologie. In: Schwarzer, R. (Hrsg.), Gesundheitspsychologie. Göttingen, Toronto, Zürich: Hogrefe. Carver, C. S., Pozo, C., Harris, S. D., Noriega, V., Scheier, M. F., Robinson, D. C., Ketcham, A. S., Moffat, F. L., Clark, K. C. (1993). How coping mediates the effect of optimism on distress. Journal of Personality and Social Psychology, 65, pp. 375-390. Cohen, S. (1985). Measuring the functional components of social support. In: Sarason, I. G., Sarason, B. R. (Hrsg.), social support: Theory, research and applications. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 73-94. Cohen, S. (1988). Psychosocial models in the role of social support in the etiology of physical disease. Health Psychology, 7, pp. 269-297. Cohen, S., Tyrell, D. A. J., Smith, A. (1991). Psychological stress and susceptibility to the common cold. New England Journal of Medicine, 325, pp. 606-612. Cutrona, C. E., Suhr, J. A., Mac Farlane, R. (1990). Interpersonal transactions and the psychological sense of support. In: Duck, S., Silver, R. (Hrsg.), Social support and personal relationships. London: Sage, pp. 30-45. De Haan, R., Aaronson, N., Limburg, M. et al. (1993).Measuring quality of life in stroke. Stroke, 24, pp. 320-327. De Pompei, R. (1978). A systems approach to understanding CHI family functioning. Cognitive Rehabilitation, March/April 1987, pp. 6-10. Derogatis, L. R. (1977a). Administration, Scoring & Procedures Manual –I for the Revised Version. John Hopkins University School of Medicine. Derogatis, L. R. (1986). Self-Report Symptom Inventory. In: Internationale Skalen für Psychiatrie. Weinheim. Beltz. Derogatis, L. R., Rickels, K. & Rock, A. F. (1976). The SCL-90 and the MMPI: a step in the validation of a new self-report scale. British Journal of Psychiatry, 128, pp. 280-289. Descartes, R. (Deutsche Übersetzung),(o.J.). Abhandlungen über die Methode des richtigen Vernunftgebrauches und der wissenschaftlichen Wahrheitsforschung. Stuttgart: Reclam, Bd. 3767. Literatur 132 Diener, E., Sandvik, E., Parot, W. (1991). Happiness is the frequency not the intensity of positive versus negative affect. Ub: Strack, F., Argyle, M., Schwarz, N. (Hrsg.). Subjective well-being. Oxford: Pergamon. Dilman, V. M. (1977). Metabolic immunodepression and carcinom Genesis-Mechanisms of Aging and Development, 8, pp. 153-173. Dilman, V. M. , Ostroumova, M. N. (1984). Hypothalamic, metabolic and immune mechanisms of the influence of stress. In: Fox, B. H., Newberry, B. H. (Eds.), Impact of psychoendocrine systems in cancer and immunity. New York: Hogrefe Inc. Dressler, S., Wienold, M. (Hrsg.) (1996). AIDS. Berlin, Heidelberg, New York. Springer Verlag. Dunde, S. R. (1986). Die Angst vor der Krankheit. In: Dunde, S. R. (Hrsg.) AIDS – Was eine Krankheit verändert, pp. 33-42. Dunkel-Schetter, C., Blasband, D. E., Feinstein, L. G., Bennett, T. L. (1991). Elements of supportive social interactions: When are support attemps effective? In: Spacapan, S., Oskamp, S. (Hrsg.). Helping and being helped in the real world. Newbury Park, California: Sage. Durgin, Ch. (1989). Techniques for families to increase their involvement in the rehabilitation process. Cognitive Rehabilitation, May/June 1989, pp. 22-25. Durkheim, E. (1973). Der Selbstmord. Neuwied: Luchterhand. Duvall, E. M. (1977). Marriage and family development. Lippincott, New York. Evans, R. L., Griffith, J., Haselkorn, J. K. et al. (1992). Poststroke Family Function: An Evaluation of the Family’s Role in Rehabilitation. Rehabilitation Nursing, Vol. 17, No. 3. May/June 1992, pp. 127-131. Eysenck, H. J. (1991a). Personality, stress and disease: An interactionist perspective. Psychological Inquiry, 2, pp. 221-232. Feifel, H., Strack, S. (1989). Coping with conflict situation. Psychology and Aging, 4 (1). Filipp, S. H., Aymanns, P. (1987). Die Bedeutung sozialer und personaler Ressourcen in der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen. Zeitschrift für klinische Psychologie (XVI). Filipp, S. H., Ferring, D. (1992). Lebensqualität und das Problem ihrer Messung. In: Seifert, G. (Ed.), Lebensqualität in unserer Zeit – Modebegriff oder neues Denken? Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht. Literatur 133 Fisher, J. D., Fisher, W. A. (1992). Changing AIDS – risk behavior. Psychological Bulletin, 111, pp. 455-474. Fondacaro, M. , Moos, R. (1987). Social support and Coping. A longitudinal analysis. Am. J. Community Psychol. 15, pp. 653-673. Franke, G. (1990). Die psychosoziale Situation von HIV-Positiven. Berlin. Rainer Bohn Verlag. Franke, G. (1995). SCL-90-R. Die Symptom-Checkliste. Göttingen. Beltz Test GmbH. Frick, H., Leonhardt, H., Starck, D. (1987). Allgemeine Anatomie und spezielle Anatomie I. Stuttgart, New York. Thieme Verlag. Friedrich, H. (1981). Familiensoziologische Aspekte von Copingstrategien bei chronischen Krankheiten. In: Angermeyer, M. C. , Döhner, O. (Hrsg.). Chronisch kranke Kinder und Jugendliche in der Familie. Enke, Stuttgart. Friedrichs, J. (1980). Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen.Westdeutscherverlag GmbH. Garner, D. M., Garfinkel, P. E., Schwartz, D., Thompson, M. (Eds.) (1980). Cultural expectations of thiness in woman. Psychological Reports, 47, pp. 483-491. Geesing, H. (1991). Gegen Viren wehren. München, Wien, Zürich. BLV Verlag. Gemsa, D., Kalden, J.A., Resch, K. (Hrsg.) (1997). Immunologie. Stuttgart, New York. Georg Thieme Verlag. Geuen, R., J., Folkman, S., Lazarus, R. S. (1988). Centrality and individual differences in the meaning of daily hassles. Journal of Personality, 56, pp. 743-762. Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J. K., Stout, J. C., Tarr, K. L., Speicher, C. E., Holliday, J. E. (1985). Stress-related impairments in cellular immunity. Psychiatry Research, 16, pp. 233-239. Görres, S. (1988a). Lebenssituation älterer Patienten unter besonderer Berücksichtigung der Rehabilitation und Nachsorge. In: Döhner, H., Freese, H., Schröder, U. (Hrsg.): Im Alter leben – Krisen, Ängste, Perspektiven. Hamburg, pp. 103-115. Görres, S. (1994). Psychosoziale Folgen des Schlaganfalls und deren Bewältigung. In: Schütz, R. M., Meier-Baumgartner, H. P.: Der Schlaganfallpatient. Verlag Hans Huber, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle, pp. 151-166. Görres, S., Meier-Baumgartner, H. P., Zamory, P. (1988). Zur Situation von Schlaganfallpatienten nach der Rehabilitation – Erste Ergebnisse einer retrospektiven Langzeitstudie. Rehabilitation, 27, pp. 63-70. Literatur 134 Graham, N. M., Douglas, R. M., Ryan, P. (1986). Stress and acute respiratory infection. American Journal of Epidemiology, 124, pp. 389-401. Gross, R. (1979). Zur Gewinnung von Erkenntnissen in der Medizin. Erfahrungen, Intuitionen, Modelle. Deutsches Ärzteblatt, 76, 2571. Groß, R. (1997). Prinzipien der Medizin. Berlin. Springer Verlag. Gürtler, L. (1996). Diagnostik der HIV-Infektion. In: Ruf, B., Pohle, H. D., Goebel, F. D., L’age, M. (Hrsg.). HIV-Infektion, Pathogenese, Diagnostik und Therapie. Erlangen. Pharmacia & UPJOHN GmbH. Gwalthney, J. M. (1990). The common cold. In: Mandell, G. L., Douglas, R. G., Bennett, J. E. (Eds.): Principles and Practice of Infections Diseases, 3rd Edition. New York, Churchill Livingstone. Hackethal, J. (1992). Der Meineid des Hippokrates. Von der Verschwörung der Ärzte zur Selbstbestimmung des Patienten. Bergisch Gladbach. Gustav Lübbe Verlag. Hall, M. E. (1990). An Inquiry into Health Effects of Invisible and Visible Labor. Diss. John Hopkins University, School of Hygiene and Public Health. Baltimore, Maryland, USA, Academytry ck AB, Edsbruck. Hamouda, B., Schwarzländer, B. (1996). Aktuelle Trends der HIV/AIDS-Epidemie in Deutschland. In: Ruf, B., Pohle, H., Goebel, F. D. & L’age (Hrsg.). HIV-Infektion. Pathogenese, Diagnostik und Therapie. Hasford, J. (1991). Kriterium Lebensqualität. In: H. Tüchler & D. Lutz (Eds.), Lebensqualität und Krankheit. Auf dem Weg zu einem medizinischen Kriterium Lebensqualität, Köln: Deutscher Ärzteverlag. Heckhausen, H. (1989). Motivation und Handeln, Berlin: Springer. Hehl, F. J. (1988). Psychodiagnostik II. Unveröffentlichtes Manuskript, Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Hempel, U., Hermes, G. (1989). Aktuelle Fragen zum Stand der neuropsychologischen Therapie bei der Rehabilitation Hirngeschädigter. In: Brähler, E., Dahme, B., Klapp, B. F. (Hrsg.). Jahrbuch der medizinischen Psychologie 2: Psychologie in der Neurologie (1989), Springer, pp. 67-85. Hennig, J. (1998). Psychoneuroimmunologie. Band 9. In: Krohne, W., Schmidt, L., Netter, P., Schwarzer, R. (Hrsg.). Reihe Gesundheitspsychologie. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle. Hogrefe Verlag. Literatur 135 Hennig, J., Netter, P. (1996). Local immunocompetence and salivary cortisol in confinement. Advancer in Space Biology and Medicine, 5, pp. 115-132. Hinkle, L. E. (1973). The concept of stress in the biological and the social sciences. Science, Medicine and Man. Pp. 31-48. Hirsch, D. A., Dworkin, R. H. (1985a). Psychological Distress and the Acquired Immune Defiency Syndrome (AIDS). Paper: Meeting of American Psychological Association. Los Angeles. Hirsch, D. A., Dworkin, R. H. (1985b). Strategies used to cope with AIDS. Paper: Meeting of American Psychological Association. Los Angeles. Hobfoll, S. E. (1985). Limitations of social support in the stress process. In: Sarason, I. G., Sarason, B. R. ( Eds.), Social support: Theory, research and application. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 391-414. Hobfoll, S. E. (1988). The ecology of stress. Washington, DC: Hemisphere. Hofmann, E. (1981). Zitiert nach Hempel, U., Hermes, G. (1989). Aktuelle Fragen zum Stand der neuro-psychologischen Therapie bei der Rehabilitation morphologisch Hirngeschädigter. In: Brähler, E., Dahme, B., Klapp, B. F. (Hrsg.). Jahrbuch der medizinischen Psychologie 2:Psychologie in der Neurologie (1989), Springer, pp. 67-85. Holahan, C. J., Moos, R. (1978). The personal and contextual determinants of coping strategies. H, Pers. Soc. Psychol. 52, pp. 946-955. Hurrelmann, K. , Laaser, U. (Eds.) (1993). Gesundheitswissenschaften. Handbuch für Lehre, Forschung und Praxis. Weinheim: Beltz. Jäger, H. (Hrsg.) (1989). AIDS. Stuttgart. New York. Thieme. Jasnoski, M., Kugler, J. (1987). Relaxation, imagery and neuroimmunomodulation. Annals of the New York Academy of Sciences, 496, pp. 722-730. Jemmott, J. B., Mc Clelland, D. C. (1989). Secretory IgA as a measure of resistance to infections desease: Comments on Stone, Cox, Valdimarsdottir and Neale. Behavioral Medicine, 15, pp. 63-71. Jones, N. L., Killian, K. J. (1990). Exercise in chronic airway obstruction. In: Bouchard, R. J., Shepard, T., Stephens, T., Sutton, J. R., Mc Pherson (Hrsg.), Exercise, fitness and health. Champaign, IL: Human Kinetics Book, pp. 547-560. Literatur 136 Kallert, Th. W. (1993). Ausgewählte Aspekte der Krankheitsverarbeitung und der psychotherapeutischen Behandlung von Schädel-Hirn-Trauma-Patienten. Rehabilitation 32, pp. 99-106. Kaplan, B. H., Cassel, J. C. & Gore, S. (1977). Social support and health. Medical care (25). Kaplan, St. (1991). Psychosocial adjustment three years after traumatic brain injury. The clinical Neuropsychologist, Vol. 5, No. 4, pp. 360-369. Kelly, J. A., Lawrence, J. S., Brasfield, T. L. (1991). Predictors of vulnerability to AIDS risk behavior relapse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, pp. 163166. Kepplinger, J. (1996). Partnerschaft und Krebserkrankung: Psychosoziale Belastungen, soziale Unterstützung und Bewältigung bei Paaren mit tumorkrankem Partner. In: Muthny $ Mann (Hrsg.), Medizinische Psychologie, Bd. 8. Münster: Lit., 1986. Kobasa, S. C. (1982). The hardy personality: Toward a social psychology of stress and health. In: Sanders, J. S., Suls, J. (Eds.), Social psychology of health and illness. Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 3-33. Koch, T. (1992). Lebensqualität und Ethik – am Beispiel der Medizin. In: Seifert, G. (Ed.). Lebensqualität in unserer Zeit – Modebegriff oder neues Denken? Göttingen. Vandenhoek & Rupprecht. Kölle, H. (1997). Aids. Viel Angst und Leid, Irrtümer und viel Geld; Eine Kritik an der AIDS-Theorie. Espacio time, 6/97. König, J. (o. J.). Bemerkungen zum Begriff der Ursache. In: Patzig, G. (Hrsg.). Josef König, Vorträge und Aufsätze. Freiburg-München: Alber-Verlag. Kotler, D. P., Tierney, A. R., Francisco, A. et al. (1989). The magnitude of body cell mass depletion determines the timing of death from wasting in AIDS. Am. Journal Clin. Nutr. 50, pp. 444-447. Kreutzig, T. (1992). Biochemie. Stuttgart. Jungjohann Verlag. Kübler-Ross, E. (1986). Reif werden zum Tode. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn. Küchler, T. et al. (1990). Verbesserte Lebensqualität nach Lebertransplantation. Meinungen aus der Universität Hamburg (21). Kugler, J. (1991). Mood and salivary immunoglobuline A: a review. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 41, pp. 232-242. Literatur 137 Kugler, J. (1994). Stress, salivary immunoglobuline A and susceptibility to repper respiratory tract infection: evidence for adaptative immunomodulation. Psychologische Beiträge, 36, pp. 175-182. Kugler, J., Breitfeld, J., Tewes, U., Schedlowski, M. (1996). Shortterm decrease of salivary immunoglobulin A concentration during caries treatment. European Journal of Oral Sciences, 104, pp. 17-20. Kugler, J., Hess, M., Haake, D. (1992). Secretion of salivary immunoglobuline A in relation to age, saliva, flow, mood, states, secretion of albumin, cortisol and catecholamines in saliva. Journal of Clinical Immunology, 12, pp. 45-49. L’age-Stehr, J., Koch, M. G. (1997). AIDS. In: Gemsa, D., Kalden, J. R., Resch, K. (Hrsg.), Immunologie. Stuttgart, New York. Georg Thieme Verlag, pp. 607-635. Lampl, L., Mayer, J., Osenbrügge, M., Hillemann, C. (1990). Biochemie. MediscriptVerlag. Lanier et al. (1998). Phenotypic resistance to ABC in the presence of multiple genotypic mutations: Correlation with viral load response. Abstr. 686; 5th Conf on Retroviruses. Chicago, USA. Laudenslager, M., Fleshner, M., Hofstädter, Pl, Held, P. E., Simons, L. (Eds.) (1988). Suppression of specific antibody production by inescapable shock: stability under varying conditions. Brain Behavior and Immunity, 2, pp. 92-101. Lauritsen, J. (1990). Poison by Prescription. The AZT Story. Asklepios. New York. Lazarus, R., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality (1). Lehr, U. (1990). Lebensqualität als Bewertungskriterium in der Medizin: Der Beitrag der Gerentologie als interdisziplinäre Wissenschaft. In: Schölmerich, P. & Thews, H. (Eds.). Lebensqualität als Bewertungskriterium in der Medizin. Stuttgart. Fischer Verlag. Leppin, A. (1994). Bedingungen des Gesundheitsverhaltens. Risikowahrnehmung und persönliche Ressourcen. München: Juventa. Levy, J. A. (1993). Pathogenesis of human immunodeficiency virus infection. Microbiol. Rev. 57, pp. 183-289. Levy, J. A. (1994). HIV and the pathogenesis of AIDS. ASM Press, Washington DC. Lienert, G., Raatz, U. (1994). Testaufbau und Testanalyse. Weinheim: Beltz Literatur 138 Lin, N. (1986). Conzeptualizing social support. In: Lin, N., Dean, A., Ensel, W. M. (Hrsg.), Social support life events and depression. New York: Academic Press., pp. 17-30. Litt, M. (1988). Cognitive mediators of stressfull experience: Self-efficacy and perceived control. Cognitive Therapy and Research. Locke, S. E., Kraus, L., Leserman, J., Hurst, M. W. (1984). Life change stress, psychiatric symptoms, and natural killer cell activity. Psychosomatic Medicine, 46, pp. 441-453. Löffler, G., Petrides, P. E. (1990). Biochemie und Pathobiochemie. Berlin, Heidelberg, New York. Springer Verlag. Löffler, M. (1998). Biometrische Grundlagen der Medizin. Med. Klein., 93, pp. 6-571. Loyd, R. (1984). Mechanisms of psychoneuroimmunological response. In: Fox, B. H., Newberry, B. H. (Eds.), Impact of psychoendocrine systems in cancer and immunity. New York: Hogrefe Inc. Marks, G. B., Mellis, C. M., Peat, J. K., Wodcock, A. J., Leeder, S. R. (1994). A profile of Hypoxia and ist management in a New South wales provincial centre. Medical Journal of Australia (160). Marks, I. (1969). Fears and phobia. New York: Academic press. Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper. Mertgen, C. P., Fleming, I. (1995). AIDS. Pathomechanismen und therapeutische Ansätze. Gräfelfing. UPJOHN. Mestecky, J. (1993). Saliva as a Manifestation of the Common Mucosal Immune System. Annals of the New York Academy of Sciences, 694, pp. 184-194. Mestecky, J., Russel, M. W., Jackson, S., Brown, T. A. (1986). The human IgA System: A Reassessment. Clinical Immunology and Immunopathology, 40, pp. 105-114. Michealis, W., Bauch, J. (Hrsg.) (1991). Mundgesundheitszustand – und Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland. Köln. Deutscher Ärzteverlag. Miller, J. G. (1978). Living Systems. New York, McGraw Hill. Minuchin, S. (1977). Families and family therapie. Harvard University Press. Cambridge, Massachussetts. Minuchin, S. et al. (1975). A conceptual model of psychosomatic illness in children. Arch. Gen. Psychiat., 32, pp. 1031-1035. Literatur 139 Monville, C. (1994). Streß am Arbeitsplatz. Die Bedeutung von sozialer Unterstützung für die Streßwahrnehmung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Diplomarbeit, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (unveröffentlichte Publikation). Moormann et al. (1998). Declining morbidity and mortality among patients with advanced HIV infection. N. Eng. J. Med. 1998. Münch, R. (1991). Klassische soziologische Theorie. Vorlesungsskript. Düsseldorf: Heinrich-Heine-Universität. Muthny, F. (1991). Erfassung von Lebensqualität – Fragestellungen und Methodik. In: Tüchler, H., Lutz, D. (Eds.). Lebensqualität und Krankheit. Auf dem Weg zu einem medizinischen Kriterium Lebensqualität. Köln: Deutscher Ärzteverlag. Niemi, M. L., Laaksonen, R., Kotila, M., Waltimo, O. (1988). Quality of life 4 years after stroke. Stroke, 19, pp. 1101-1107. Novack, Th. A., Bergquist, Th. F., Bennett, G., Gouvier, W. D. (1991). Primary caregiver distress following severe head injury. J. Head Trauma Rehabil. 1991, 6 (4), pp. 69-77. Nye, K. E., Parkin, J. M. (Hrsg.) (1994). HIV und AIDS. Heidelberg, Berlin, Oxford. Spektrum Akademischer Verlag GmbH. Patzig, G. (1992). Lebensqualität in der Geschichte der Philosophie. In: Seifert, G. (Ed). Lebensqualität in unserer Zeit – Modebegriff oder neues Denken? Göttingen. Vandenhoek & Ruprecht. Pearlin, L. J., Menaghan, E. G., Liebermann, M. A., Mullan, J. T. (1981). The stress process. Journal of Health and Social Behavior, 22, pp. 337-365. Pennebaker, J. W. (1982). The psychology of physical symptoms. New York. Springer. Peterson, I., Baatrup, G., Brandslund, I., Teisner, B., Rasmussen, G. G., Svehag, S. E. (1986). Circadian and diurnal variation of circulating immune complexes, complement – mediated solubilization, and the complement split product C3d in rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology, 15, pp. 113-118. Procidano, M., Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: Three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11, 4, pp. 1-24. Pschyrembel, W. (Hrsg.) (1990). Klinisches Wörterbuch. Mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica. Bearb. von der Wörterbuchred.. D. Verl.. Unter der Leitung von Christoph Zink, 256. Neu bearbeitete Auflage Berlin, New York: de Gruyter. Literatur 140 Raspe, H. H. (1990). Zur Theorie und Messung der Lebensqualität in der Medizin. In: Schölmerich, P., Thews, H. (Eds.).Lebensqualität als Bewertungskriterium in der Medizin. Stuttgart. Fischer Verlag. Ritschl, D. (1987). Die Familie: Risiken und Chancen. Birkhäuser, Basel. Roedel (1990/1994). Zitiert nach Müller, G. (1992). Der systemische Fragebogen zur Herkunftsfamilie, Her-Fam., Entwicklung, Anwendung und erste Validierungsstudie. Diplomarbeit, Düsseldorf, pp. 23-25. Rogers, R. W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of protection motivation. In: J. R. Cacioppo & R. E. Petty (Eds.). New York: Guilford. Rohen, J. (1984). Funktionelle Anatomie des Menschen. Stuttgart, New York. Schattauer Verlag. Roitt, I. M., Lehner, T. (1980). Immunology of Oral Deseases. Oxford, Blackwell Scientific Publishers. Röllinghoff, M., Wagner, H. (1997). Zelluläre Immunreaktion. In: Gemsa, D., Kalden, J. R., Resch, K. (Hrsg.), Immunologie. Stuttgart, New York. Georg Thieme Verlag, pp. 29-44. Rühmann, F. (1986). Moral und tödliche Krankheit – Reflexionen. In: Dunde, S. R. (Hrsg.). AIDS – Was eine Krankheit verändert. Frankfurt a. M. Fischer Verlag. Sarason, I. G., Sarason, B. R. (1985b). Social support – insights from assessment and experimentation. In: Sarason, I. G., Sarason, B. R. (Hrsg.), Social support: Theory, research and applications. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 39-50. Sarason, I. G., Sarason, B. R., Shearin, E. N. (1986). Social support as an inividual difference variable: Its stability, origins, and relational aspects. Journal of Personality and Social Psychology, 50, pp. 845-855. Säring, W. (1988). Aufmerksamkeit. In: V. Cramon, Zihl, J. (Hrsg.). Neuropsychologische Rehabilitation. Berlin, Springer, pp. 182-196. Schedel, J. (1996). Pathogenese der HIV-Infektion. In: Ruf, B., Pohle, D., Goebel, F. D., L’age, M. (Hrsg.), HIV-Infektion, Pathogenese, Diagnostik und Therapie. Erlangen. Pharmacia & UPJOHN GmbH, pp. 58-94. Schedlowski, M., Jacobs, R., Stratmann, G., Richter, S., Hädicke, A., Tewes, U., Wagner, T. O. F., Schmidt, R. E. (1993). Changes of natural killer cells during acute psychological stress. Journal of Clinical Immunology, 13, pp. 119-126. Literatur 141 Scheidegger, C. (1989). Angst im Umgang mit AIDS Patienten. In: Jäger, H. (Hrsg.). AIDS. Psychosoziale Betreuung von AIDS- und AIDS Vorfeldpatienten. Thieme. Schimpl, A. (1997). Antikörper und Antikörpersynthese. In: Gemsa, D., Kalden, J. R., Resch, K. (Hrsg.), Immunologie. Stuttgart, New York. Georg Thieme Verlag, pp. 15-28. Schlippe von, A. (1993). Familientherapie im Überblick. Basiskonzepte, Formen, Anwendungsmöglichkeiten. Paderborn, Junfermann-Verlag. Schmidt, L. R. (1990). Psychodiagnostik in der Gesundheitspsychologie. In: Schwarzer, R. (Ed.). Gesundheitspsychologie. Göttingen: Hogrefe. Schoeck, G. (1994). Seneca. Frankfurt a. M.. Insel Verlag. Schwartz, F. W., Badura, B., Leidl, R., Raspe, H., Siegrist, J. (Hrsg.) (1998). Das Public Health Buch. München, Wien, Baltimore. Urban & Schwarzenberg. Schwartz, F. W., Siegrist, J., Troschke, J. von (1997). Wer ist gesund? Wer ist krank? Wie gesund bzw. krank sind Bevölkerungen? In: Schwartz, F. W., Badura, B., Leidl, R., Raspe, H., Siegrist, J. (Hrsg.), Das Public Health Buch. München, Wien, Baltimore. Urban & Schwarzenberg, pp. 8-32. Schwarzer, C. (1979). Einführung in die pädagogische Diagnostik. München: Kösel Verlag. Schwarzer, C. (1986). Perspektiven der pädagogischen Beratungswissenschaft. 2. Auflage, Heft 2. Erziehungswissenschaftliches Institut. Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Schwarzer, C. (1992). Emotionen und Streßbewältigung bei älteren Menschen. Arbeitsberichte aus der Abteilung für Bildungsforschung und Pädagogischer Beratung. Düsseldorf: Heinrich Heine Universität. Schwarzer, R. (1989). Überlegungen zu einer sozial kognitiven Theorie des Gesundheitsverhaltens. In: Rüdiger, D., Nöldner, W., Haug, D., Kopp, E. (Hrsg.).Gesundheitspsychologie – Konzepte und empirische Beiträge. Regensburg: Roderer Verlag, pp. 21-30. Schwarzer, R. (1992c). Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Göttingen, Hogrefe. Schwarzer, R. (1993a). Streß, Angst und Handlungsregulation. Stuttgart: Kohlhammer. Schwarzer, R. (Eds.) (1990a). Gesundheitspsychologie. Göttingen: Hogrefe. Schwarzer, R. (Hrsg.) (1990a). Gesundheitspsychologie. Göttingen: Hogrefe. Literatur 142 Schwarzer, R., Dunkel-Schetter, C., Weiner, B., Woo, G. (1992). Expectancies as mediators between recipient characteristies and social support intentions. In: Schwarzer, R. (Hrsg.), Self-efficacy. Thought control of action. New York: Hemisphere, pp. 65-87. Schwarzer, R., Leppin, A. (1989a). Sozialer Rückhalt und Gesundheit. Eine MetaAnalyse. Göttingen: Hogrefe. Schwarzer, R., Leppin, A. (1989b). Sozialer Rückhalt und Gesundheit: Eine MetaAnalyse zum Stand der Forschung. In: Schönpflug, W. (Hrsg.). Bericht über den 36. Kongress der DGfP in Berlin 1988. Göttingen: Hogrefe, pp. 354-366. Schwarzer, R., Leppin, Gesundheitsverhalten. A. (1990). Sozialer In: Schwarzer, R. Rückhalt, (Hrsg.), Krankheit und Gesundheitspsychologie. Göttingen, Hogrefe, pp. 395-414. Schwarzer, R., Leppin, A. (1991a). Social support and health: A theoretical and empirical overview. Journal of Social and Personal Relationship, 8, pp. 99-127. Schwarzer, R., Leppin, A. (1991b). Soziale Unterstützung und Wohlbefinden. In: Abele, A., Becker, P. (Hrsg.), Wohlbefinden, Theorie – Empirie – Diagnostik. München: Juventa, pp. 175-189. Schwarzer, R., Schwarzer, C. (1996). The assessment of coping. In: Zeidner, M., Endler, N. (Hrsg.), Handbook of coping. New York, Wiley, pp. 107-132. Sebestyén, G. (1991). Gedanken zur Lebensqualität. In: Tüchler, H. & Lutz, D. (Eds.). Lebensqualität und Krankheit. Auf dem Weg zu einem medizinischen Kriterium Lebensqualität. Köln: Deutscher Ärzteverlag. Seidl, O., Ermann, M. (1989a). Psychosoziale AIDS-Forschung – Fragen, Probleme und Chancen. In: Jäger, H. (Hrsg.). Frauen und AIDS: Somatische und psychosoziale Aspekte. Berlin, Heidelberg, New York. Springer Verlag. Seifert, G. (Ed.) (1992a). Lebensqualität in unserer Zeit – Modebegriff oder neues Denken? Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht. Selvini-Palazzoli, M., Boscolo, L. et al. (1978). Paradoxon und Gegenparadoxon. KlettCotta, Stuttgart. Selye, H. (1975). The stress concept. Ist philosophical and psychosocial implications. Bioscences Communications, 1, pp. 131-145. Literatur 143 Siegrist, J. (1985). Koronargefährdendes Verhalten. In: Basler, H. D., Florin, I. (Hrsg.). Klinische Psychologie und körperliche Krankheiten. Stuttgart: Kohlhammer, pp. 79-89. Siegrist, J., Junge, A. (1990). Measuring the social dimension of subjective health in chronic illness. Psychotherapie und Psychosomatik, (54), pp. 90-98. Silbernagl, S., Despopoulos, A. (1983). Taschenatlas der Physiologie. Stuttgart, New York. Georg Thieme Verlag. Spanbock, P. (1987). Understanding Head Injury from the Familie’s Perspective. Cognitive Rehabilitation, March/April 1987, pp. 12-14. Spiess, S. (1989). Zur Entwicklung von Rückkopplungsmodellen in der psychologischen Streßforschung. Hochschulschriften zum Personalwesen. Bd. 11. München. Mering Hampp. Stein, M. (1989). Stress, depression and the immune system. Journal of Clinical Psychiatry, 50, pp. 35-40. Stierlin, H. et al. (1980). Das erste Familiengespräch. Klett, Stuttgart. Suls, J. (1982). Social support, interpersonal relations and health: Benefits and liabilities. In: Sanders, G. S., Suls, J.(Hrsg.), Social psychology of health and illness. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Association, pp. 255-277. Toshima, M., Kaplan, R., Ries, A. (1992). Self-efficacy expectancies in chronic obstructive pulmonary disease rehabilitation. In: Schwarzer, R. (Hrsg.). Selfefficacy: Thought control of action. Washington: Hemisphere Publishing Corporation, pp. 325-354. Tüchler, H., Lutz, D. (Eds.) (1991). Lebensqualität und Krankheit. Auf dem Weg zu einem medizinischen Kriterium Lebensqualität. Köln: Deutscher Ärzteverlag. Van Rood, Y. R., Bogaards, M., Goulwey, E., Houwelingen van HC. (1993). The effects of stress and relaxation on the in vitro immune response in man: a meta-analytic study. Journal of Behavioral Medicine, 16, pp. 163-181. Vester, F. (1985). Neuland des Denkens. DTV, München. Waldvogel, B., Seidl, O., Ermann, M. (1989). Probleme und Belastungen von Ärzten und Krankenschwestern bei der Betreuung von Patienten mit AIDS. Poster: II. Deutscher AIDS-Kongreß. Berlin, Nr. 131. Literatur 144 Wiesmann, E. (1982). Medizinische Mikrobiologie. Bakteriologie, Virologie, Parasitologie, Mykologie, Immunologie, Chemotherapie. Stuttgart, New York, Thieme Verlag. Williams, S. J. (1989). Chronic respiratory illness and disability: A critical review of the psychosocial literature. Social Science Medicine (28). Wöller, W., Kruse, J., Reister, G., Winter, P., Richter, B., Arnolds, S., Kraut, D. (1993). Kortisonbild und emotionale Unterstützung durch Schlüsselfiguren bei Patienten mit Asthma bronchiale. Medizinische Psychologie (43). Woodworth, R. S. (1919). Examination of Emotional Fitness for Warfare. Psychological Bulletin, 16, pp. 59-60. Zänker, K. (1996). Das Immunsystem des Menschen. Bindeglied zwischen Körper und Seele. München. Oscar Beck Verlag. Zenz, H. (1989). Sozialbeziehungen des HIV-Infizierten. In: Jäger, H. (Hrsg.), AIDS und HIV-Infektionen: Diagnostik, Klinik, Behandlung. Handbuch und Atlas für Klinik und Praxis. Landsberg, München, Zürich: ecomed, S. IX-1.3: 1-8. Abbildungsverzeichnis 8.1. Abbildungsverzeichnis Abb. 3.1.: Friedrich Miescher. Abb. 3.2.: Rückkopplungsfunktion- biologisch und technisch. Abb. 3.3.: Die Anordnung des Immunsystems. Abb. 3.4.: Die Einflüsse der Hormone auf die stressinduzierte Cortisolausschüttung. Abb. 4.5.: Emile Durkheim. Abb. 4.6.: Das Kompensationsmodell. Abb. 4.7. Das Präventionsmodell. Abb. 4.8.: Das weniger restriktive Modell. Abb. 4.9.: Vier Support – Mobilisierungsmodelle, 1. Abb. 4.10.: Vier Support – Mobilisierungsmodelle, 2. Abb. 4.11.: Vier Support – Mobilisierungsmodelle, 3. Abb. 4.12.: Vier Support – Mobilisierungsmodelle, 4. Abb. 4.13.: Das Support – Verringerungsmodell. Abb. 5.14.: René Descartes. Abb. 6.15.: Das Untersuchungsmodell. 145 Abbildungsverzeichnis Abb. 6.16.: Der GSI der eigenen Untersuchung. Abb. 6.17.: Der GSI bei Frauen und Männern in der Stichprobe. Abb. 6.18.: Partnerschaft und GSI. Abb. 6.19.: Der GSI und die Sexualität der Stichprobe. Abb. 6.20.: Der GSI und die körperlichen Beschwerden der Stichprobe. Abb. 6.21.: Subskala Somatisierung. Abb. 6.22.: Subskala Depression. Abb. 6.23.: Subskala Aggressivität. Abb. 6.24.: Die Subskalen der Stichprobe. Abb. 6.25.: Mittelwertsunterschiede homo- und heterosexueller Patienten. 146 Tabellenverzeichnis 8.2. Tabellenverzeichnis Tab. 3.1.: AIDS – Stadien. Tab. 3.2.: Psychologische Auswirkungen erworbener Hirnschäden. Tab. 3.3.: Grundeigenschaften der Viren. Tab. 3.4.: Charakteristika von Patienten mit Langzeitüberleben. Tab. 4.5.: Begriffliche Differenzierung von sozialem Rückhalt. Tab. 4.6.: Die Matrix der Identität. Tab. 6.7.: Zuordnung der Items. Tab. 6.8.: Berufsklassen der Stichprobe. Tab. 6.9.: Monatliches Einkommen der Stichprobe. Tab. 6.10.: Sexualität in der Stichprobe. Tab. 6.11.: Infektionsweg der Probanden. Tab. 6.12.: Erkrankungsdauer der Stichprobe. Tab. 6.13.: Krankheitsstadien der Stichprobe. Tab. 6.14.: Sexualverhalten in der Stichprobe. Tab. 6.15.: Reliabilitäten und Varianzaufklärung der extrahierten Faktoren. 147 Tabellenverzeichnis Tab. 6.16.: Klassifikation der Effekte einer dritten Variablen auf die Korrelation zweier Variablen. Tab. 6.17.: Der Belastungsunterschied homo- und heterosexueller Probanden. Tab. 6.18.: Variablen der Regressionsanalyse. 148 Internetadressen 8.3. Internetquellen 1. Einleitung (Kapitel 1) I. (http://www.hivnet.de/iagprot.htm) II. (http://www.medonline.de) 2. Einführung in das Krankheitsbild AIDS (Kapitel 3) I. (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/anfenge.htm) II. (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/immunschwaech.htm) III. (http://www.rki.de/INFEKT/AIDS_STAD/WAD/WAD.htm) IV. (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/statistik.htm) V. (http://pweb.uunet.de/pr-leitner.DO/giftrezept.htm) VI. (http://www.hivnet.de/iagausbli.htm) VII. (http://www.aids98.ch) VIII. (http://www.mpib-tuebingen.mpg.de/miescher.htm) IX. (http://www.hivnet.de/ipi1haupt.htm) 3. Das Konzept Sozialer Rückhalt (Kapitel 4) I. (http://www.venturetech.com/philo/phils/durkheim.html) 4. Das Konzept Lebensqualität (Kapitel 5) I. (http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uK/history) II. (http://www.hivnet.de/iagrthe.htm) 5. Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 6) I. (http://www.aids98.ch) II. (http://www.hivnet.de/iaahaupt.htm) III. (http://www.medonline.de) 149 Erklärung 150 Düsseldorf, 10. Januar 2000 8.4. Erklärung Hiermit erkläre ich, daß die vorliegende Arbeit selbständig verfaßt wurde, und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet wurden. Düsseldorf, Januar 2000 Dirk Hartkopf