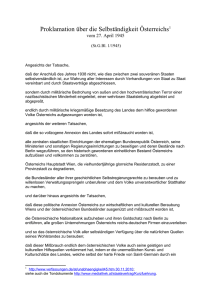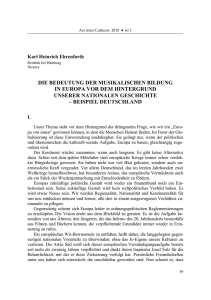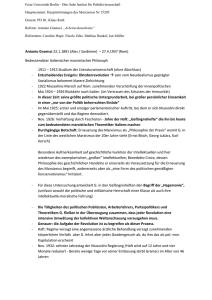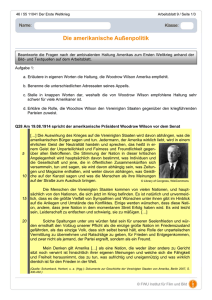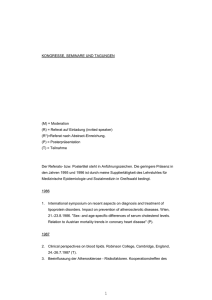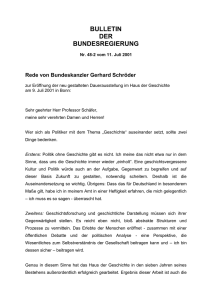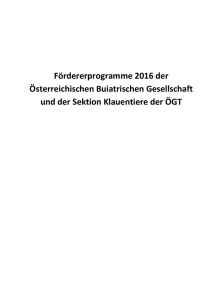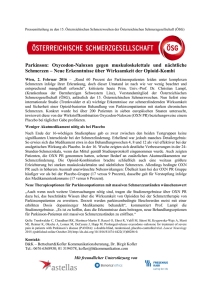Albert F. Reiterer - Universität Innsbruck
Werbung
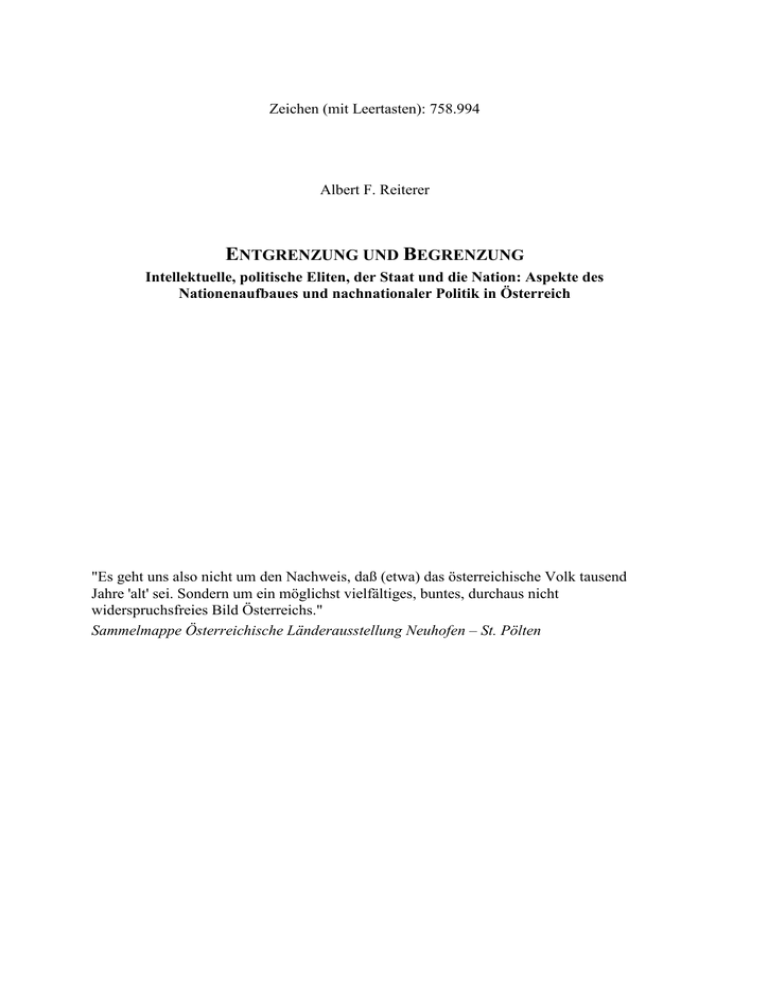
Zeichen (mit Leertasten): 758.994
Albert F. Reiterer
ENTGRENZUNG UND BEGRENZUNG
Intellektuelle, politische Eliten, der Staat und die Nation: Aspekte des
Nationenaufbaues und nachnationaler Politik in Österreich
"Es geht uns also nicht um den Nachweis, daß (etwa) das österreichische Volk tausend
Jahre 'alt' sei. Sondern um ein möglichst vielfältiges, buntes, durchaus nicht
widerspruchsfreies Bild Österreichs."
Sammelmappe Österreichische Länderausstellung Neuhofen – St. Pölten
Inhaltsverzeichnis
Vorwort ......................................................................................................................................... 4
0. Voraussetzungen .......................................................................................................................... 5
0.1 Perspektive.............................................................................................................................. 5
0.1.1 Arbeitsweise .................................................................................................................... 7
1 Nationenbau: Integration als politisches Projekt .................................................................... 10
1.0.1 Historiographie und nationale Orientierung .................................................................. 20
1.1 Intellektuelle – Begriffsklärung ............................................................................................ 33
1.1.1 Intellektuelle und 'Universalismus' ................................................................................ 39
1.1.2 Beamte und Bürokratie ................................................................................................. 40
2 Die österreichische Entwicklung ............................................................................................... 45
2.1. Methodische Überlegungen ................................................................................................. 45
2.2. Über den Zusammenhang politischer und wirtschaftlicher Entwicklung ............................ 48
2.3. Österreich im Rahmen einer Zentrum-Peripherie-Logik ..................................................... 52
2.3.1 Bernard Bolzano (1781 – 1848) – der traditionale Rebell des Vormärz ....................... 58
2.4. Das 19. Jahrhundert – Die Zeit bis zum ersten Weltkrieg ................................................... 59
2.4.1 “Biedermeier” – Malerei als verordnete Ideologie
61
2.4.2 Die Romantiker und ihre “Österreich”-Begeisterung
62
2.5 Das Jahr 1848 ...................................................................................................................... 63
2.5.1 Ein “48er” ..................................................................................................................... 64
2.5.2 Strukturelle Gegebenheiten ........................................................................................... 66
2.5.1 "Altösterreicher" und ihre Gegner................................................................................. 72
2.5.1.1 Adalbert Stifter
73
Peter Rosegger
74
Und die Stadt?
77
2.5.2 Lösungen? ..................................................................................................................... 78
2.6 'Ausgleich' ............................................................................................................................. 86
2.7 Fin de siècle .......................................................................................................................... 88
2.8 Zur Diskussion um die Nation .............................................................................................. 92
2.8.1 Ignaz Seipel................................................................................................................... 92
2.8.2 Karl Renner und Otto Bauer ......................................................................................... 93
2.8.3 Oszkar Jaszi .................................................................................................................. 97
2.8.4 Tomás G. Masaryk ........................................................................................................ 98
2.8.5 Theodor Herzl ............................................................................................................. 101
3 Das neue Österreich: 1918 und die Folgen ............................................................................. 103
3.1 Die Situation ....................................................................................................................... 103
3.1.1 Anomie ........................................................................................................................ 109
3.1.2 Siegmund Freud und seine Religion – die Psychoanalyse........................................... 110
3.2 Österreichs Staatsgründung ............................................................................................... 111
3.2.1 "Kulturnation" ............................................................................................................. 111
3.2.2 Die erste Nachkriegszeit und die Staatskonstruktion .................................................. 113
3.2.3 Die nationale Orientierung .......................................................................................... 115
3.2.3 Heimat Partei .............................................................................................................. 119
3.3 Die Zweite Republik ............................................................................................................ 122
3.3.1 Parteikulturen – die SPÖ ............................................................................................. 132
3.3.2 Einige Probleme der Nachkriegs-Rhetorik.................................................................. 133
3.3.2 Symbolik ..................................................................................................................... 135
3.3.3 Die nationale Selbstverständlichkeit: Kreisky ............................................................. 136
3.4 ÖVP, SPÖ, "Drittes Lager" - ein Rollentausch? ................................................................ 138
4 Nationale Identität? .................................................................................................................. 145
4.1 Intellektuelle "Vergangenheitsbewältigung" ...................................................................... 148
4.2 Provinzialismus versus Offenheit oder Zentrum gegen Peripherie? .................................. 155
4.2.1 Anschlußgelüste heute in der BRD und der Nachvollzug in Österreich ...................... 155
4.2.2 Die Frage der Sprache ................................................................................................. 156
4.2.3 Burgtheater – Großmythos und Kulturkampf .............................................................. 158
4.2.3 Personalisierung: Robert Menasse oder Erwin Ringel – eine Alternative? ................. 159
2
4.2.4 Die Gegenstimmen ..................................................................................................... 162
4.2.5 Reflexion und Konsequenzen ..................................................................................... 163
4.3 Großmachtträume versus Kleinstaatenrealität .................................................................. 163
4.3.1 Die ideologische Grundlage ....................................................................................... 165
4.3.2 Intellektuelle und Macht - ein eindeutiges oder ein dialektisches Verhältnis? ........... 165
4.3.3 Noch einmal ein Rückblick ......................................................................................... 167
4.3.3.1 Der ideologische Hintergrund - Hegels Staatsmythos
170
4.3.4 EG-Anschluß
173
4.3.5 Anton Pelinka 1990 oder Anton Pelinka 1994/1996?
176
4.4 Grenzenloses Österreich? Über die demokratiepolitische Unentbehrlichkeit nationaler und staatlicher
Grenzen .................................................................................................................................... 177
4.4.1 "Integrationsschock"? ................................................................................................. 180
4.4.2 Europäische Ideologie ................................................................................................ 181
4.5 Neuorientierung worauf? ............................................................................................... 183
4.5.1 Abfahrtslaufnationalismus? Nationalstolz? ................................................................ 186
4.5.2 Die Neutralität und der NATO-Anschluß ................................................................... 188
4.5.3 Personalisierung: Günther Nenning vs. Rudolf Burger? ............................................. 192
5 Nachnationale oder nationale Politik im übernationalen Sttaatenverband? Die Zeit seit 1995 193
6 Ausklang ............................................................................................................................... 194
Literatur ................................................................................................................................... 213
3
Vorwort
Diese Arbeit begann als eines jener "Millenniums"-Projekte, mit welchen die österreichische Bundesregierung der erstmaligen Dokumentation des Namens Österreich 996 gedenkt.
Dieser Anlass ist selbst bereits wieder Gegenstand dieser Arbeit, auf den wir im Verlauf
der Studie eingehen. Denn die Arbeit handelt in ihrer Weiterführung vom Aufbau des nationalen Systems in Österreich und ist in diesem Sinn auch Teil eines lang angelegten persönlichen Projekts: Ich versuche, in einem Neuzugang zu einer Theorie der Nation, deren
allgemeine Ansätze nicht in dieser Arbeit zu finden sind, möglichst viele konkrete Fälle
durch zu arbeiten. Das bedeutet, nach den Fragen von gesellschaftlicher und politischer
Entwicklung in konkreten Analysen und konkreten Situationen zu fragen. Es geht um die
Herstellung von Traditionen und Ideologien. Das ist ein dialektischer Prozess, und von
Dialektik wird in diesem Text viel die Rede sein: Die Widersprüche der österreichischen
Entwicklung als eines Beispiels sozialen Wandels sind aufzuzeigen. Zu den Tugenden liberaler Demokratie sollte es auch gehören, Widersprüche bestehen zu lassen und sie nicht unbedingt und um jeden Preis ausbügeln zu wollen. Zumindest ist dies eine der Lehren, die
uns das großartige Werk von John Rawls vermittelt.
Der Autor ist Sozialwissenschafter, folglich vor allem an jenen Prozessen interessiert, welche Österreich nicht zu einem Sonderfall, sondern zu einem Paradigma machen. Deutlicher: Die vorliegende Arbeit ist eine Studie zur Nationenwerdung, die – wie schon gesagt–
an einem Beitrag zu einer Theorie der Nation interessiert ist. Die manchmal stark erkennbare theoretische Stilisierung ist somit beabsichtigt. Wir betreiben hier Nationentheorie am
Fall Österreich.
Von dieser Arbeit wurden Teile bereits in einer ganzen Reihe meist längerer Aufsätze veröffentlicht (Reiterer 1996, 1999, 2001, 2003). Sie sind als integrale Teile der Arbeit zu
verstehen. Ihre Leitgedanken wurden meist in kurzer Form hier nochmals ausgeführt wenn
auch die Materialien schon aus Platzgründen nur in vereinzelten Fällen nochmals übernommen werden. Was aber noch fehlt, ist das mittlerweile zentrale Kapitel 5 über die Entwicklung seit 1995.
Wien, Anfang 2009
4
0. VORAUSSETZUNGEN
Kurz vor der österreichischen EG-Volksabstimmung 1994 hatte der Verfasser auf einer Tagung von Bibliothekaren der österreichischen Arbeiterkammern ein Referat zum Thema
Nation und Nationalismus zu halten. Es konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausbleiben, dass
auch über das Verhältnis von Europaorientierung und österreichischer Identität diskutiert
wurde. Dabei nahm ein westösterreichischer Teilnehmer sinngemäß etwa folgend Stellung:
"Mir geht es wirklich nicht um Österreich. Es reicht mir, wenn ich in einer Demokratie
lebe." Das klingt nüchtern und abgeklärt-rational. Doch lässt sich eine solche Haltung aufrecht erhalten? Hat ein abstraktes Bekenntnis zur Demokratie wirklich nichts mit nationaler
Zugehörigkeit im allgemeinen und mit der Frage der österreichischen Nation im besonderen zu tun? Sehen wir uns einmal das Umfeld an!
"Die österreichische Nation war eine ideologische Missgeburt, denn die Volkszugehörigkeit ist die eine Sache und die Staatszugehörigkeit die andere" (Jörg Haider im TV-Inlandsreport, laut Wiener Zeitung vom 19. August 1988). Dieser Satz eines Irrlichts der
österreichischen Politik der Gegenwart könnte jedoch genauso gut von sozialdemokratischen Emigranten in London 1945, nach der Befreiung und Wiederverselbständigung
Österreichs, stammen. Fritz Adler und Julius Braunthal waren konsequent genug, in dieses
ihnen verhasste Österreich erst gar nicht zurückzukehren. Karl Czernetz hingegen, aus dem
selben Umfeld, spielte in der Zweiten Republik eine gewisse Rolle. Er war zum "Chefideologen" der SPÖ geworden, dokumentiert durch eine enorme Anzahl von Artikeln in der
"Zukunft" von 1946 bis 1966 sowie anderswo. Wie konnte er das mit seiner früheren
Stellung zu Österreich vereinbaren? Die Lösung lautete, um eine Aussage aus der Zwischenkriegszeit zu paraphrasieren: Deutschland durfte er nicht sagen, Österreich wollte er
nicht. Also sagte er "Europa" und erklärte sich zum enthusiastischen "Europäer". Das war
eine Lösung dieser persönlichen Probleme, die gerade in der Sozialdemokratie häufig war.
In der deutschnationalen Tradition der österreichischen Sozialdemokratie von Viktor Adler
– im Grunde seit den Anfängen der mitteleuropäischen Arbeiterbewegung lange vor Adler
– bis Otto Bauer und seinen Adepten war alles, was österreichisch war, dunkel. Nur die
deutsche Orientierung verkörperte den Fortschritt. Einige wenige versuchten vorerst, diese
deutsche Linie auch nach dem Krieg beizubehalten. Das Ergebnis ist kennzeichnend: Ein
sich ursprünglich links einordnender sozialdemokratischer Spätnachkömmling dieser Haltung, der sie stets mit dem Hinweis auf Otto Bauer legitimierte, ist mittlerweile im rechtsextremen Umfeld gelandet.
Wie kam es, dass ausgerechnet jene, die sich als Linke in der Sozialdemokratie sahen, in
diesem Punkt so verwechselbar mit den übelsten Figuren des diskreditierten Deutschchauvinismus wurden? Hat das Bekenntnis zur Demokratie und die Zugehörigkeit zu Österreich
also wirklich nichts miteinander zu tun?
0.1 Perspektive
Es gibt eine Dialektik zwischen allgemeinen Strukturen der Realität und ihren besonderen
Erscheinungsformen. Jede soziale und politische Entwicklung kann man als Beispiel eines
allgemeinen Musters betrachten; und jede kann als einzigartiger Sonderfall beschrieben
werden: “No historical or political analysis can be written without the unse of general
concepts in which some notions of uniformity are necessarily implied” (Deutsch 1979, 14;
vgl. auch Seth 1999). Diese Studie wählt grundsätzlich die Perspektive des allgemeinen,
mit anderen geteilten Musters, nicht jene des "Sonderfalls Österreich". Hier wird somit
nicht etwa die "Abweichung" des Falles Österreich als typisch oder auch untypisch
5
beschrieben. Zumindest den Analytikern des Nationenbaues ist heute klar geworden: Es
gibt keine "nationalstaatliche Normalität", die z. B. in Westeuropa von Frankreich oder
England verkörpert würde, während Mittel- oder Osteuropa abweichende Fälle darstellten ein Bild, ein Gemeinplatz, der bei theoretisch ambitionierten Historikern noch immer eine
gewisse Beliebtheit hat.1 Wenn dies mehr als ein Gemeinplatz sein soll, muss es in seinen
Voraussetzungen sorgfältig analysiert werden. Wir können sagen: Vor allem Großbritannien war ein ökonomisch-industriell fortschrittliches Land. Es musste daher auch neue
politische Formen entwickeln. Die Nation mit ihrer vergleichsweisen Homogenität der
Oberklassen war ein solches. Wie sehr dabei allerdings andere Probleme ausgeblendet
werden, zeigt, dass das Problem Irland in Fragestellungen zum englisch-britischen
Nationenbau kaum zur Sprache kommt. Und doch war dies ein Musterfall einer alles
andere als mit der Gesamtnation “homogenen” Peripherie, mit enormen Rückwirkungen
auf das Zentralsystem. Ähnliches, und vielleicht stärker noch, gilt für Frankreich. Das
Problem des Südens (Okzitanien) und der Ränder gerät erst heute wieder langsam ins
Blickfeld. Wir können ohne Furcht vor Übertreibung sagen: Das Bild der “nationalen
Homogenität” in Westeuropa ist eine intellektuell-verzerrte Sicht der Dinge, die
unreflektiert den Blickwinkel der zentralen Eliten übernommen hat.
Gerade für den Nationenaufbau in Österreich überwiegt dagegen die Perspektive des
"Sonderfalles" in erdrückendem Ausmaß und gleichzeitig im gerade abgelehnten Sinn einer
"Anomalie". Vergleichende Ansätze gibt es nur in wenigen Studien, am ehesten bei Bluhm
(1973) und Katzenstein (1975). Deren Fragestellungen wirken mehr als zwei Jahrzehnte
nach ihrem Erscheinen nicht mehr immer völlig geglückt oder aktuell. Ein Sozialwissenschafter wird von seiner Wissenschaftskultur her dazu neigen, die strukturellen Linien
nachzuvollziehen. Damit kann er auch einen Beitrag zu einer allgemeinen Theorie sozialer
Entwicklung liefern, z. B. einer Theorie des Nationenbaues. Das bedeutet sicher nicht, dass
die Perspektive des konkreten Einzelfalles weniger legitim wäre, wenn sie selbst wiederum
als Perspektive eines allgemeineren Prozesses verstanden wird, und gewiss auch nicht, dass
sie weniger fruchtbar wäre. Es ist zu einem Gutteil eine persönliche Entscheidung des
einzelnen Wissenschaftlers, welchen Zugang er wählt. Allerdings möchte der vorliegende
Beitrag, als sozialwissenschaftliche Studie, die noch immer überwiegende Haltung in der
österreichischen Geschichtsschreibung vermeiden, die man in anderen Zusammenhängen
etwas abfällig "blank descriptivism" und "mindless empiricism" genannt hat. Damit ist
keine Historikerbeschimpfung beabsichtigt: Die Wissenschaftskultur dieses Faches ist
anders als jene der theoretischer gerichteten Sozialwissenschaften und oft von einer erfrischenden Konkretheit. Auch gibt es immer mehr Historiker, die theoretisches Interesse
zeigen: Im Zusammenhang der österreichischen Nationenbildung gehört dazu Ernst
Bruckmüller ().
Wir fragen mit Blick auf übernationale Integrationsvorgänge auch nach dem Verhältnis von
Demokratie, Nation und Nationalismus. Zu erinnern ist an das Motto der Vielfalt, unter
welcher diese Arbeit geschrieben wurde: Somit gilt das Interesse den widersprüchlichen
Entwicklungen der österreichischen Gesellschaft und Politik. Vergessen wir nicht: Häufig
1
Wenn man diese Art von Analysen liest, wird man unwillkürlich an die ironischen Sätze von Marx über die
naiv-spekulativen Philosophen erinnert, welche die “Frucht” als das wahre Wesen, die Substanz von Äpfel
und d Birne usw. erklären, dem das ganz unwesentliche wirkliche Dasein dieser Dinge gegenüber stehe
(MEW 2, 60 f.).
6
hat etwas, was gestern als demokratisch und progressiv galt, heute einen völlig anderen
Stellenwert. Wer sich im 19. Jahrhundert einen "48er" nannte, wollte seine radikal demokratische Haltung betonen. Wer diesen Begriff heute noch zur politischen Charakterisierung anwendet, ist regelmäßig ein reaktionärer Deutschnationaler. Diese Verschiebung ist
keine österreichische Eigenheit.
0.1.1 Arbeitsweise
Demokratiebewegungen wollen Mit- und Selbstbestimmung für möglichst viele Menschen
– für alle, die jenseits von Einschränkungen durch Alter (man denke an das Wahlalter) oder
vergleichbaren Tatbeständen überhaupt dazu in der Lage sind. Doch Demokratiebewegungen wurden in der Moderne stets von Intellektuellen geführt, von Menschen also, die
unmittelbar selbst weniger oder gar nicht vom gesellschaftlichen Ausschluss betroffen
waren. Insbesondere war und ist der Nationenaufbau eine Angelegenheit intellektueller
Eliten. Im Mittelpunkt des Interesses hier steht somit der Intellektuelle in einem Gramsci'
schen Sinn. Die Schlüsselrolle von Intellektuellen im Aufbau der Nation wird auch von
anderen Arbeiten mittlerweile gewürdigt: So fragt das umfangreiche "Projekt Norwegische
Identität" (Leiter: Øystein Sørensen) schon in seinem ersten Zugang ausdrücklich, "to what
extent, and in what way, the Norwegian national identity was created from above, by an
elite".
Nun könnte man meinen, dass in einer essentiell politischen Fragen die Aussagen von
aktiven Politikern die geeignetere Grundlage wären. Doch in modernen parlamentarischen
Systemen sind Politiker von ihren Stimmenmaximierungsinteressen ebenso wie von ihrer
politischen Sozialisierung her auf größtmöglichen Konsens gedrillt. Ihre Stellungnahmen
werden in heiklen Fragen dazu tendieren, weniger klärend als die Positionen verwischend
zu sein. Zum anderen sind sie auch Pragmatiker, sie sind auf die unmittelbare Tagespolitik
orientiert; oft genug interessiert sie der ideologische Aspekt ihrer Stellungnahmen nicht.
Damit unterscheiden sie sich deutlichst sowohl von den Politikern autoritärer Systeme,
aber auch noch von jenen der Frühzeit parlamentarischer Demokratie: Diese lebten und
argumentierten aus ihrer Ideologie heraus und waren meist selbst ausgewiesene Ideologen sie waren Intellektuelle, welche den Sprung in die Politik gemacht hatten. Daher waren sie
noch vom Habitus des Intellektuellen gekennzeichnet, und auch von ihrem charismatischen
Charakter im Gegensatz zum Bürokratismus der status quo-Politiker. Dies gilt insbesondere von den Vertretern aufsteigender Schichten, Bewegungen und Parteien. - Die
Stellungnahmen von Berufspolitiker sind daher in einer halbwegs gesicherten nationalen
Situation meist nicht von hohem Interesse. Dazu kommt, dass diese Fragen für die eigentlichen Wendezeiten der österreichischen Geschichte gut dokumentiert sind (Reiterer 1984,
1986 und 1988; Filla 1984). In noch stärkerem Maß gilt diese Aussage für offizielle Dokumente, wie sie Regierungserklärungen und andere bürokratische Schriftstücke sind. Hier
findet man zwar Grundlinien über die Handlungs-Absichten für die nächste Zeit. Kaum
einmal wird jedoch eine explizite Stellungnahme zu nationalen Fragen in umfassenden
Sinn abgegeben. Allerdings ist in diesem Zusammenhang auch eine selbstkritische Warnung angebracht: Intellektuelle tendieren häufig dazu, hämisch auf die nach ihrer Ansicht
plumpe und naive Sprache von Politikern hinzuweisen. Doch damit demonstrieren sie vor
allem Autozentriertheit. Im Grunde verlangen sie ja nichts anderes, als dass sich Politiker,
ihrer – der Intellektuellen – Sprache verwenden sollen. Über die Qualität von Gedanken
und Konzepten sagt die nichtintellektuelle Sprache der Politiker von vorneherein gar
nichts.
7
Politiker unterscheidet allerdings von Intellektuellen im Alltagssinn, und das gibt ihnen
ihre wesentlich über die Intellektuellen hinausreichende Bedeutung, daß sie professionelle,
"hauptamtliche Legitimatoren" (Berger/Luckmann 1969) für die Erhaltung bestehender
Sinnwelten sind. Sie sind dies in einer von der Bevölkerung formal legitimierten Weise,
welche jeder ihrer Wortmeldungen eine völlig andere, wesentlich verbindlichere Qualifikation gibt als jenen von jeweils nur einer abstrakten Öffentlichkeit - und das heißt: niemandem als ihrem eigenen Über-Ich – verpflichteten Intellektuellen. Während Lebenswelten
und ihr Aufbau eine stark spontane und selbstverständliche Komponente haben, arbeiten
die hauptamtlichen Legitimatoren in zielgerichteter und überlegter Weise an politischen
Entwürfen. Diese Elitenkonkurrenz wird ein ständiges implizites Thema dieser Arbeit sein.
Man könnte sagen: Im Unterschied zwischen der alltäglichen Bekräftigung der überkommenen und doch stets aufs Neue konstruierten Lebenswelten des Alltags einerseits und der
Legitimation einer bestimmten soziopolitischen Ordnung andererseits finden wir den
kennzeichnenden Unterschied zwischen Ethnizität und Nation.
Trotz der - für unsere Thematik – inhaltlichen Kargheit der Wortmeldungen von Politikern
liegt diesem Beitrag daher notwendigerweise eine systematische Sichtung von Aussagen
von Angehörigen der politischen Parteien in der Zweiten Republik zugrunde. Hier stellt
sich das Problem der Auswahl. Die Funktionärs-Zeitschriften z. B. sprechen den Kernbereich ihrer Basis an. Zum anderen aber haben sie bei aller tagespolitischen Gebundenheit
mehr Freiheit, als es die unmittelbar "zum Gebrauch" bestimmten Äußerungen der täglichen parteipolitischen Auseinandersetzung haben. Auch Parteiprogramme werden immer
stärker zu PR-Angelegenheiten in Wahlzeiten und enthalten daher wenig, was über den
Tag hinaus Gültigkeit hat. Darüber hinaus werden sie faktisch auch kaum von einer
nennenswerten Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wird.
Weiters wurden Publikationen von Politikern, insbesondere autobiographisches Material,
systematisch herangezogen. Solche Autobiographien sind gerade deswegen von Wert, weil
sie in ihrem Bestreben nach Konsistenz im Nachhinein mehr über die ideelle und
ideologische Zielrichtung aussagen als tagespolitische Dokumente: Als “Umwandlungen
polythetischer Konstitutionen in monothetische Gegenständlichkeit”, wie Schütz (1981, 93)
die Sinngebung von Handlungsabläufen beschreibt, sind sie das gerade Gegenteil von
Tagespolitik (“politics”), welche als Kampf unterschiedlicher Interessen nie “monothetisch”-einsinnig begriffen werden kann. Der gerade bei Politikererinnerungen so frappante
Eindruck nicht sosehr der Re-Konstruktion des Abgelaufenen, sondern der Konstruktion ist
nur ein spezifisches Beispiel für historiographisches Vorgehen überhaupt. Der Unterschied
liegt nur im Grad und in der Aktualität. Hier ist auf die Belege an den entsprechenden
Stellen zu verweisen. - Schließlich liegt es in der Natur sozialwissenschaftlichen Arbeitens,
daß der eigentliche Grundstock des Materials die bisherige Diskussion und Literatur ist,
wobei die Analyse und Interpretation den entscheidenden Punkt bildet.
Der "Kampf um die nationale Identität" findet in seinen strittigen Punkten viel heftiger
zwischen verschiedenen Intellektuellengruppen als zwischen Politikern statt. Darüber
hinaus hat deren jeweilige Rolle einen erheblich anderen Charakter: Wenn auch die österreichische Situation nicht so ist, dass eine besonders lebhafte nationale Auseinandersetzung
stattfand, so wäre doch das Thema potentiell uferlos. Wichtiges Material bilden somit die
auch Publikationen ausgewählter Personen aus dem österreichischen Geistesleben. Dabei
muss man sich vor einigen Fallen hüten: Intellektuelle kreieren Mythen. Nun sind diese
Mythen Teile der sozialen Wirklichkeit, sobald sie von einer relevanten Gruppe aufgegrif8
fen werden. Doch sie sind eine Wirklichkeit für sich, ein Symbolsystem, nicht unbedingt,
meist überhaupt nicht, verlässliche Beschreibung einer sozialen (strukturellen) Wirklichkeit.
Wenn man soziale und politische Entwicklungen von einem ideen- oder geistesgeschichtlichen
Blickpunkt verfolgt, muss man sich oft durch Elaborate philosophischen Charakters durchquälen,
wo sich unweigerlich die Frage stellt: Steht sich die Lektüre dieser oft bösartigen, oft auch nahezu
schwachsinnigen Auseinandersetzungen wirklich dafür? Doch wenn man Intellektuelle als soziale
Kategorie für bedeutsam hält, lässt sich dies nicht umgehen. Es zeugt auch dafür, wie sehr Begriffe
in ihrer Tradierung von einer Generation zur anderen eine Autonomie und Eigendynamik entwickeln. In diesem Sinn ist Philosophie oder vergleichbare Salon- oder Stammtischdebatten ebenso wichtiges Material für politische Untersuchungen wie historische Dokumente.
Bei einem so stark behandelten Gebiet wie es die österreichische Identität und ihre Entwicklung ist, wird die Darstellung zu einer zentralen methodischen Frage. Eine Fokussierung auf einzelne Bereiche ist notwendig. Es geht um die sozialwissenschaftliche Analyse
einzelner wichtiger Problematiken, nicht um die Dokumentation. Die Aufmerksamkeit
wird also einigen grundsätzlichen Themen gelten, die für das politische Projekt Österreich
den dimensionalen Rahmen vorgeben: die Kleinstaatlichkeit; die Frage der Zukunftsorientierung, abgehandelt nicht zuletzt am Vergleich mit der BRD; die internationale
Positionierung Österreichs; und schließlich den regionalen Unterschieden. Dabei stellt
sich auch die Frage, wie diese Problematiken am besten verständlich zu machen sind. Die
"Personalisierungen" in der folgenden Darstellung sind Versuche, in einem so stark
personenorientierten Feld, wie es die Frage von "Intellektuellen" darstellt, Konturen stärker
und prononcierter herauszuarbeiten, als es mit der reinen Strukturanalyse möglich wäre.
Der Stil bewegt sich daher zwischen der Fachsprache der Sozialwissenschaft und einem
manchmal auch politisch engagierten Essayismus, ohne dass damit weitreichende literarische Ambitionen verbunden wären.
9
1 NATIONENBAU: INTEGRATION ALS POLITISCHES PROJEKT
Nationalismus, das ist in Zentraleuropa ein anrüchiges Wort geworden. Doch Nation ist –
wie Nationalismus als verhaltensrelevante Mentalität der Moderne – ein wahrhaft dialektisches Phänomen. Ethnistische Politien ("Staaten") gab es im Verlauf der Geschichte ständig. Nationen als spezifische Ausdrucksformen des Verhältnisses Staat – zivile Gesellschaft als Legitimierung der staatlichen Machtausübung durch die Erklärung, einer
bestimmten Gesellschaft – der “Nation” – zuzugehören, bedurften aber mehrerer
Voraussetzungen und entstehen aus zwei konvergierenden Prozessen.
1) Den einen formt die Kraft des Faktischen infolge administrativer Integration. Das allerdings macht hauptsächlich den Aufbau des modernen Staates aus, d. h. eines politischen
Apparates, der Autonomie gegenüber den sozialen Strukturen und insbesondere auch die
stilbildende Herrschaftsschicht gewonnen hat. Mit dieser Autonomie konnte er eigene Ziele
setzen und zumindest den chancenreichen Versuch wagen, diese auch zu implementieren.
Im Feudalismus z. B. war dies noch nicht der Fall, weil soziale und politische Herrschaft
personalisiert war, für alle ununterscheidbar im Grundherrn zusammen fiel. Dieser Wandel
der politischen Macht zur autonomen Struktur ist unentbehrlich für die Nation, stellt aber
noch nicht den Nationenbau selbst dar. Missverständlicher Weise hat man dies für eine
spezifische Form der Nation gehalten und entsprechend klassifiziert: Es ist in der Essenz
das, was man das "westeuropäische Modell" genannt hat. Wir können dies auch als die top
down-Perspektive bezeichnen. Nationenaufbau beginnt somit als Staatsaufbau, als Prozess
von oben. Als frühen und erfolglosen Ideologen dieses Staatsaufbaus müssen wir etwa
Machiavelli betrachten. Erst wenn dieser Prozess in gewissem Ausmaß Erfolg zeitigte,
konnte er, paradox und dialektisch, zum Aufbau auch einer (Zivil-) Gesellschaft führen,
damit Aspekte eines Prozesses “von unten” annehmen. “Unten” aber war nicht “ganz
unten”. Es waren nicht etwa die grassroots. Es war eher das, was man heute noch völlig
mystifizierend die Basis nennt: Kleine militante Gruppen wurden zu Trägern einer
Anspruchsrevolution.
2) Die zweite Voraussetzung müssen wir als ein Legitimationsproblem bezeichnen. Denn
dieser neue staatliche Apparat mit seinen herrschaftlichen Strukturen musste gegenüber der
eigenen Bevölkerung Legitimität erhalten; dieser neue Staatsapparat musste sich den
eigenen Untertanen gegenüber in seiner Existenz rechtfertigen, weil er auf ihre Loyalität zu
setzen begann, zumindest auf die Loyalität von Teilen der Bevölkerung. Die Frage stellte
sich also: Wer ist der Souveränitätsträger? Die Aufklärer gaben zur Antwort: das Volk.
Wer oder was aber ist "das Volk"? Der Hinweis auf die Aufklärung zeigt schon, dass es die
neue ("bürgerliche") Intellektuellenschicht war, die sich ihrerseits durch diese Bezeichnung
rechtfertigte.
Es gilt, den Nationenbau als sozialen Prozess der Identitätsbildung und der gemeinschaftlichen Ausdrucksweise eines gesellschaftlichen Sachverhaltes sorgfältig vom Aufbau des
bürokratischen Apparates zu unterscheiden. Dieser stellt die spezifische Wirklichkeit des
Staates dar. Es geht somit um Herrschaft und ihre Rechtfertigung. Staaten bauen, in
Michael Walzers (1998) Worten, ein politisches Lokalmonopol auf. Nationen formen sich,
indem bestimmte Bevölkerungssegmente darum kämpfen, ein solches Lokalmonopol
begründen zu können. Nationen müssen einen Staat oder eine annähernd gleichwertige
politische Struktur erreichen, wenn sie Nationen werden (oder u. U. auch bleiben) wollen.
Dies scheint mir aus sowohl der funktionalen wie aus einer stärker ontologischen, die
Identität betonenden Auffassung der Nation her definitorisch gültig zu sein. Es ist die
10
Selbstbestimmung, die sich nach außen hin als Grenzziehung und nach innen als partizipatorische Demokratie ausprägt, welche den Staat erst vergesellschaftet. Dies kann nur
über den Aufbau des Bewusstseins gehen, eine gesellschaftliche Einheit darzustellen, über
den Aufbau einer sozialen Identität somit. Nationen treffen also auch eine Zugehörigkeitsaussage über jene, welche dieses Lokalmonopol aufbauen dürfen oder sogar sollten.
Ethnonationalismus formuliert diese Aussage askriptiv derart, dass als zugehörig nur jene
gelten sollen, welche - allen weiteren Beiwerkes entkleidet – eine bestimmte Gebürtigkeit
aufweisen. Als Indikator der richtigen Gebürtigkeit wurde im Europa der letzten zwei Jahrhunderte gewöhnlich die Muttersprache betrachtet. Das, was ich politischen Nationalismus
nannte (Reiterer 1988) und was heute meist “Bürgernationalismus” genannt wird, legt für
Beitrittswillige (nicht für Zugehörige schon durch Geburt in einem bestimmten Gebiet oder
von bestimmten Eltern) Beitrittskriterien fest. Diese können sehr unterschiedliche Merkmale beinhalten (z. B. auch Spracherlernung), werden aber i. a. ihren Schwerpunkt in
Wertorientierungen haben (vgl. den BRD-Ausdruck “Verfassungspatriotismus”). Zum
Staatsaufbau kommt somit im erfolgreichen Nationenaufbau die Formung eines gesamtgesellschaftlichen Identitätsbewusstseins, welches seinen Ausgang zuerst von “primordialen" Zugehörigkeiten ableitet, diese gemeinschaftlichen Elemente jedoch auf großgesellschaftliche Einheiten überträgt. Nation geht in diesem Aspekt hervor aus der politischen
Organisierung eines verallgemeinerten und vereinheitlichten ethnischen Bewusstseins. Der
Erfolg des Nationenaufbaues hängt davon ab, ob - bzw. wie - der politisch-administrative
Aspekt mit dem kommunitären und sozietären zur Deckung kommt. "Social boundaries are
given objectively and democracy normatively requires corresponding political ones"
(Bauböck 1994, 183). Nur das ist der theoretische Grund des sogenannten Nationalstaatsprinzips, welches eine Deckung zwischen Nation und Staat fordert. Es ist die ins Normative gekehrte Aussage, dass gesellschaftliche bzw. politische Einheiten eine gemeinschaftliche Struktur vonnöten haben, um legitim und stabil zu sein. In diesem Sinn gilt das
“Nationalstaatsprinzip” heute für alle demokratisch verfassten Staaten, mögen sie unter
einem anderen Gesichtspunkt, etwa der Sprache, auch als “Nationalitätenstaaten” zu
bezeichnen sein. Der Nationalstaat ist also das politische Paradigma der Gegenwart
schlechthin.
Das ist das Prinzip der Nation als Legitimierungsgröße für den modernen demokratischen
Staat; in fetischisierter Form wird es zum Prinzip des Nationalismus: Fetischisiert nenne
ich es deswegen, weil dieser gewöhnlich den Abgrenzungsindikator, am häufigsten die
Sprache, für das allumfassenden Merkmal selbst hält. Doch das Prinzip, die Übereinstimmung einer mit gemeinschaftlichen Zügen ausgestatteten Gesellschaft mit dem politischen
System, ist unter demokratisch-normativen Gesichtspunkten gültig. Nationenbau ist daher
grundlegend der gleichzeitig mit dem Aufbau des Staatsapparates einhergehende Aufbau
eines Demos, welcher durch die verallgemeinerte Partizipation von 'Demo'-kratisierungsprozessen ensteht; und eines über die bisherigen kleinräumigen ethnischen und regionalen
Einheiten hinausreichenden Ethnos, der nur ein anderer Aspekt des Demos ist. Eine solche
Grundwertegemeinschaft mit einer gemeinschaftlichen Komponente kann nur entstehen,
wenn freiwillige Partizipation2 die Erfahrung des Bürgers im Umgang mit politischen Insti-
2
Das Wort "freiwillig" mag auf dem ersten Anblick in dieser Kombination mit Partizipation seltsam wirken.
Doch es gibt auch genügend Formen der rituellen Partizipation, denen das Element der Freiwilligkeit
abgeht. Man denke hierbei an die Wahlrituale des seinerzeitigen "Realsozialismus", aber auch anderer
11
tutionen ebenso wie in der Gleichheit der Staatsbürgerrolle ermöglicht. Ist die staatliche
Einheit nicht von vorneherein schon gegeben, so handelt es sich um einen mehrstufigen
Prozess, wie er im deutschen und im italienischen Bereich zu beobachten war. Der
Unterschied zwischen dem "westeuropäischen" und dem "mittel- und osteuropäischen
Modell" ist übrigens im wesentlich größeren Ausmaß einer der offiziell gepflegten Ideologien als der sozialen Wirklichkeiten. Möglicherweise ist er einer der sozialen Phasenverschiebung. Kennbar gemacht wird dieser Prozess durch politische Symbole, die im übrigen
oft wandern und von einer Gesellschaft zur anderen oft angelernt werden. Eine Fahne, eine
Nationalhymne, oder auch eine Nationalsprache als Zeichen der Einheit ist schließlich
keine anthropologische Konstante: Hat sie aber einmal eine Gesellschaft eingesetzt,
insbesondere wenn es eine politisch dominierende ist, so übernimmt sie die nächste. Die
Sprache des Nationalismus besteht also aus zwei Grundkomponenten: aus der Sprache der
Vergangenheit (Mythen, etc.), welche die eigene Identität durch Rekurs auf eine lange
Kontinuität absichert; und aus der Sprache des nationalen (politischen) Konkurrenten,
welche die eigene Stellung im Gesamtsystem, im 'internationalen' System anzuzeigen hat.
Wir können diese Linie als die bottom up-Perspektive kennzeichnen. In diesem Beitrag
wird weniger der politisch-administrative Aspekt "top to bottom" (Nationenbildung als
Herrschaftsanspruch eines Hegemonialstaates nach preußischem Muster) betrachtet, sondern viel stärker der Prozess der Bildung einer nationalen Identität. Das ist eine reichlich
komplizierte Angelegenheit mit ihren Wechselwirkungen mit der Top down Wirkrichtung:
Ist doch Nationalismus nicht zuletzt die Ideologie einer Gegenelite. Dieser Aufbau geht
nun in mehreren Phasen vor sich. Wir sollten den Anspruch einer Sequenzanalyse ernst
nehmen: Gerade im politischen System sind gewöhnlich nicht Ereignisse an sich interessant, sondern die spezifischen (zeitlich gereihten) Folgen von Ereignissen bestimmen
das Ergebnis. Das gilt insbesondere für Konflikte, und Nationenbau ist ein konfliktualer
Prozess.
Die erste Stufe dieses Prozesses weist bürgerlichen Intellektuellen eine Schlüsselfunktion
zu. Die Qualifikation "bürgerlich" ist hier grosso modo für die soziale Herkunft, vor allem
aber für die soziopolitische Funktion ("civil") gebraucht. In einem Prozess der Elitenkonkurrenz mit und gegen Kräfte eines ancien régimes entdecken sie innerhalb ihres eigenen
Kreises Kultur- und Sprachähnlichkeiten. Das Bestehen auf einer partikulären nationalen
Kultur war überhaupt erst möglich, als sich eine Verallgemeinerung und damit Vereinheitlichung des Wertesystems sowohl im Inneren als auch im Äußeren durchsetzte. Dieses
einheitliche Wertesystem führte zu einem im wesentlichen festgeschriebenen und einheitlichen politischen Modell, dem Nationalstaat, idealtypischer Weise organisiert als parlamentarisch-demokratisches Regime über eine ethnisch homogene Bevölkerung. Nationenbau bedeutet also immer einen Appell an das “Volk”. Doch kann dies sehr Unterschiedliches bedeuten. Bei aller Unterschiedlichkeit des möglichen Konzeptes von “Volk” ist im
Begriff jedenfalls ein sozialer Universalismus eingebaut, welcher Eigendynamik entwickelt. Daraus leitete man das Postulat seitens der Intellektuellen ab, eine "Nation" als
politisches Projekt zu entwerfen, einen entsprechenden Staat zu bilden und selbst die
Führungskräfte dieser Nation und ihres Staates darzustellen. Eines der ideologischen Mittel
ist die Hypostasierung der präsumptiven Nation zu einer Art zivilen Religion. Die “(quasi-)
autoritärer politischer Systeme, in der durch verpflichtende Partizipation politische Identität gefördert
werden sollte - mit nicht übermäßigem Erfolg.
12
religiöse Struktur” des Nationalismus, so oft evoziert, besteht eigentlich aus einer recht
gewöhnlichen Fiktion. Die Systemeinheit, welche eine Gesellschaft (und ein Staat)
darstellt, wird externalisiert und mental fetischisiert: Ist es bei der Religion die Gottheit,
welche die Verkörperung der Gesellschaft darstellt, so ist es in der halbsäkularisierten Welt
mancher Nationalismen der “Volksgeist” oder der “Nationalcharakter”. Dazu kommt dann
eine Wertehierarchie, welche die so ontologisierte soziale Einheit über das Individuum
stellt. Es ist dies der Traditionalismus des Nationalismus, den er, d. h. seine Ideologen,
bewußt herzustellen sucht, weil er die Tradition sucht und nachahmt. Hier wiederum
sollten wir auf eine grundlegende Dialektik der Moderne nicht vergessen: Traditionalismus
ist ein moderner Zug - im Unterschied zur Tradition. Er versucht nämlich in reflektierende
Weise die Tradition zu konstruieren und zu rekonstruieren.
Ebenso wie der Gegensatz zwischen Person und Gesellschaftssystem ist jener zwischen
vergesellschaftetem Individuum und modernen Staat real, in einem gewissen Sinn sogar
unüberbrückbar. Pragmatisch wird er allerdings immer "aufgehoben", d. h. z. B.:
Momentaner Dissens hat keine Folgen; oder: er führt durch Transformation des Systems zu
einer neuen, konsensualen Integration; usw. Die Frage stellt sich also nicht, ob das
politische System die Oberhand behält – sonst würde es zerfallen – sondern mit welchen
Mitteln bzw. mit welcher Legitimität. Der ideologische Kniff der Intellektuellen in diesem
Stadium ist gewöhnlich, dass sie die Nation als eine personifizierte Entität (mit einem
"Nationalcharakter") darstellen. An sich ist gegen diesen Trick wenig einzuwenden. Auch
Juristen sprechen von juristischen "Personen", wenn sie Systeme meinen. Eine ganz andere
Frage ist allerdings jene nach der Qualität der Zugehörigkeit von Einzelmenschen oder
Gruppen zu solchen Systemen. Man könnte die Frage faktisch betrachten. In der Regel
wird sie allerdings normativ aufgefasst, und zwar i. S. einer Zuschreibung, der sich die
Einzelnen verpflichtend zu unterwerfen hätten. Damit beginnen die politischen Probleme,
auf die wir im konkreten später noch eingehen werden. Denn Intellektuelle nehmen sowohl
an den bottom up- wie auch an den top down-Prozessen teil. Überwiegt letzterer, weil sie
sich in einen administrativen Apparat inkorporieren, so hören sie damit allerdings auf,
"Intellektuelle" zu sein. Man kann es auch verdeutlichen und sagen: Intellektuelle
verkörpern "Gesellschaft", nicht "Staat", wollen aber den Staat nach ihren Vorstellungen
und Interessen gestalten. Insofern sind sie die Scharniere, die strategische Gruppe im
Nationenaufbau.
In dieser ersten Phase ist die Nations-Werdung noch ein ganz auf intellektuelle und und
einen Teil der elitären Kreise beschränkter Vorgang. Er berührt die übrige Bevölkerung
praktisch gar nicht. Schon Benedetto Croce hat darauf hingewiesen, dass die Träger der
neuen italienischen Idee nicht das Volk, sondern die Intellektuellen waren, während das
Volk eher die Rolle des Duldenden zugewiesen bekam. Im aktivsten Falle konnte man es
für kurze Rebellionen aktivieren, wenn die von den neuen Nationalisten so genannte
"Fremdherrschaft" ihre Schikanen überzog, wie in den habsburgischen Besitzungen Norditaliens (Candeloro 1984), oder aber in bestehende Verhältnisse zu brüsk eingriff, wie in
Tirol 1809. Doch was Croce für ein italienisches Spezifikum hielt, ist ein allgemeiner
Prozess der Nationenbildung. "Die aktiven Kräfte einer nationalen, wirtschaftlichen und
politischen Mobilisierung sind Eliten, die sich die Gunst erwerben, indem sie ihre Ansprüche auf wirtschaftliche Ressourcen mit den Appellen zur politischen Unterstützung verbinden. Die Appelle zur politischen Unterstützung erfordern die Ausformung entsprechender Symbole und Verhaltenscodes... Das wettbewerbsorientierte Zusammenspiel der Eliten
untereinander und mit den Gruppen der potentiellen Anhänger schafft jenes kulturelle
13
System, das wir Nation nennen" (Cole/Wolf 1995, 366). Der nationale Konflikt reduziert
sich somit keineswegs auf einen reinen Verteilungskonflikt um begrenzte Ressourcen.
Hervorgegangen aus einer Agglomeration ethnischer Strukturen, ist die Nation auch dem
Ethnozentrismus verhaftet, obwohl ein solcher in unterschiedlichen Sinnschichten auftreten
kann.
Im zweiten Schritt gelingt es diesem Kreis – im Falle einer erfolgreichen Weiterentwicklung – durch eine in langwierigen Kämpfen sich ständig erweiternde politische Partizipation immer mehr Menschen in die präsumptive Nation zu integrieren. Der Leitprozess
dafür ist die Wahlrechtserweiterung, ohne dass sich der nationalisierende Prozess darin
erschöpfen würde. "Penetration" besteht vielmehr auch im Anbot des Staates an die
Bevölkerung, eine gesellschaftliche Infrastruktur sicherzustellen. Entscheidend auf dieser
Stufe ist eine möglichst umfassende regionale Repräsentation, damit die regionalen Eliten
an der Formung und an der Nutzung der Ressource "Symbole der Macht" teilhaben
können. Dem wird in Einzelstudien der ganze zweite Teil dieser Arbeit gewidmet sein. Nur
durch diese umfassende regionale Repräsentation erwerben die auf zentraler Ebene aktiven
Intellektuellen und in der Folge die demokratischen Politiker die "Fähigkeit, Symbole der
lokalen Struktur in Symbole einer umfassenderen Struktur umzuwandeln" (Cole/Wolf
1995, 367). Bleibt ein Gebiet vollständig unvertreten, ist dies der erste Schritt zum
nationalen Dissens (vom Regionalismus bis zu Sezessionsbestrebungen). Im österreichischen Zusammenhang stellte sich dieses Problem auch noch in der Republik in der
regionalen Schwerpunktbildung der unterschiedlichen politischen Kräfte und damit deren
Nationenprojekte.
Der dritte und entscheidende Schritt ist die Ablösung des Identitätsbildungsprozesses von
der ursprünglichen Führungsgruppe. Nun wurde der Prozess umgedreht: Die gesamtstaatlichen Symbole der Macht und der Identität, die Symbole folglich einer umfassenderen
Struktur, müssen so beschaffen sein, dass sie sich in den Symbolen der lokalen und
regionalen Struktur wieder erkennen lassen, bzw., dass diese lokalen Symbole gleichzeitig
als die umfassenderen Symbole interpretiert werden können. Nationale Identität verselbständigt sich auf diese Weise und wird selbstverständlich i. S. jener "natürlichen Haltung",
wie sie z. B. Schütz unter dem Begriff der alltäglichen Lebenswelt beschrieben hat. Die in
den letzten Jahrzehnten in Österreichs populärhistorischer Literatur manchmal anzutreffende Umkehrung der Phrase vom "Staat, den keiner wollte" zum "Staat, den alle wollen"
kennzeichnet diesen Schritt nicht schlecht. Denn das signalisiert die Nations-Qualität auf
Massenbasis, dass eine grundsätzliche Übereinstimmung besteht, in einem politischen
System existieren zu wollen, Renans "désir de vivre ensemble".
Zu fragen bleibt, wie sehr nun 'Nation' von der politischen Klasse instrumentalisiert für ihre
eigenen Zwecke wird. Hier geht es nicht um die Herstellung von Konsens nach innen,
sondern um ein Thema, welches im Verlauf dieser Arbeit immer wieder aufgegriffen wird,
weil es in der Geschichte der österreichischen Nationenbildung eine wesentliche Rolle
spielt. Es geht um die Frage der internationalen Machtverhältnisse, die sich recht
unterschiedlich äußern kann. Wir werden auf die aktuellen Ausprägungen dieser Frage
noch zurückkommen. Doch sehen wir uns vorerst die historischen Umstände an! Es geht
um die Verbindung zwischen Nationalismus und Imperialismus.
Ende des 19. Jahrhunderts erschien in den Vereinigten Staaten das Buch eines Admirals, der sich
theoretisch mit einem Thema auseinander setzte, welches er "Seemacht" nannte (Mahan 1967).
Alfred Thayer Mahan ist zuerst und vor allem ein Theoretiker, vielmehr ein Ideologe des Imperi-
14
alismus. Man hat ihn manchmal mit Clausewitz verglichen. Dieser Vergleich ist völlig unberechtigt und in die Irre führend. Clausewitz ist ein sehr ernst zu nehmender politischer Theoretiker.
Mahans Buch hingegen ist eine Geschichte des Imperialismus, den er eben unter dem Blickwinkel
der militärischen Machtentfaltung zur See betrachtet. Was hat dies nun mit Nationalismus zu tun?
Die Verbindung liegt in der Großmachtauffassung von Nation, welche "weltumspannende" Aktionen verlangt, die wiederum entsprechende Machtentfaltung zur See voraussetzen. Mahan betrachtet zwar vor allem die Rolle Englands in den letzten 200 Jahren. Doch es ist sonnenklar, dass sein
Interesse seinem eigenen Land, den USA, gilt. Was aber auch klar wird, ist zugleich eine Kontinuität und ein Wechsel um Charakter des Imperialismus. Es scheint, als ob der alte Imperialismus vor
dem 19. Jahrhundert in einem bestimmten Sinne "rationaler" gewesen sei als der folgende, der viel
stärker an Prestigeüberlegungen orientiert war. Er war sehr viel stärker Kosten- / Nutzen-orientiert.
Dieser alte, interessensgeleitete Imperialismus, vertreten vor allem von England und bis nahe an
die Gegenwart von den Niederlanden, ging nun nahtlos in einen neuen, vorwiegend von der Idee
des nationalen Prestiges geleiteten Imperialismus über, für den sich z. B. die Jagd nach Kolonien,
welche die angestrebte Weltherrschaft fetischisiert darstellten, verselbständigte. Vertreten wurde
diese Politik nach 1870 von allen Mächten, paradigmatisch aber vom Wilhelminischen Deutschen
Reich. Für das Deutsche Reich selbst als Staat brachten die kolonialen Erwerbungen nicht nur
nichts, sondern waren eine finanzielle Last. Trotzdem war man immer wieder bereit, für irgendeine
osbkure Landbesitzung an den Rand des Krieges zu gehen. Die Träger dieses Imperialismus waren
eine seltsame Koalition der alten, sich an der Macht festklammernden Eliten mit neu in die
politische Arena eintretenden bürgerlichen, nicht zuletzt intellektuellen Schichten. Sozial sind
diese je nach Land höchst unterschiedlich zu charakterisieren. Waren es im Deutschen Reich eher
tatsächlich bürgerliche Kreise, so waren es in den USA eher proletarische Schichten, die
Arbeiteraristokratie. In dieser Phase des Imperialismus wird somit die nationale Integration nach
außen gekehrt. Mahans Buch ist kennzeichnend für diese Art des "weltumspannenden Denkens",
welche "Fragen der inneren Politik" nur als "unwichtige Parteiangelegenheiten" (S. 138) zu sehen
vermag, während sich der nationale Konsens am Außenfeind aufbauen soll. Damit wird das
Instrument als solches immer wichtiger: "Kriegsmarinen allein oder Handel allein haben sich als
nie ausreichend erwiesen. Erst in der Kombination beider liegt Stärke und Wirkung einer
Seemacht" (S. 92). Und die ist deswegen vorrangig, weil "das Meer in erster Linie eine große
Straße oder besser ein Feld (ist), über welches man nach allen Richtungen gehen kann", um seinen
Interessen nachzukommen (S. 21).
"Nationalismus" ist heute ein Begriff, der insbesondere bei liberalen Intellektuellen einen
schlechten Klang hat. Als politische Orientierung scheint er eine für viele verstörende und
lästige Eigenschaft zu besitzen – er ist nämlich überaus widersprüchlich. "National"
nannten sich gerade im Europa des 20. Jahrhundert Regime, die weit rechts standen.
Wollen wir einmal die im strengen Sinne faschistischen Regime beiseite lassen, so wurde
der Begriff national doch besetzt von Cliquen wie der Putsch-Obristen in Athen, der
Franco- und Salazar-Diktatur auf der iberischen Halbinsel oder – bis in die Gegenwart –
durch Parteien wie Alleanza nazionale in Italien. Und doch war Nationalismus zuerst
einmal eine Demokratiebewegung und ist dies in der Dritten Welt teilweise noch immer.
1834 gründete Mazzini in der Schweiz das “Junge Europa”. Es setzte sich aus einer Reihe
von nationalen Sektionen zusammen, “Junges Polen”, “Junges Italien”, usw. Es war nichts
anderes als eine radikaldemokratische Internationale der Nationalismen. Das ist ebenso
bedeutsam, als daß diese Internationale nur zwei Jahre lang hielt, und daß die einzig
bedeutsame Komponente, das Junge Italien, nur als nationalistische Bewegung ihr
geschichtliche Rolle spielte. Wie reimt sich das zusammen? Erinnern wir: Nation ist ein
politisches Projekt. Doch dieses Projekt gibt vor, auf eine kommunitäre Struktur aufzusetzen oder strebt jedenfalls die Schaffung einer solchen an. Das bedeutet aber, dass Nation
15
einen ethnischen Grundbau hat und in der Regel eine ethnische Vereinheitlichung anstrebt.
Wir wollen diesen, im übrigen in einer modernen Gesellschaft illusionären, Versuch einer
gemeinschaftlichen Organisierung analytisch nicht als Nationalismus, sondern als
Ethnizismus bezeichnen.3
Nationalismus in einem engeren, stärker auf das politische System ausgerichteten Sinn ist
dann die politische Selbstbestimmung und die Partizipation einer Bevölkerung am gemeinsamen Staat aufgrund gemeinsamer Grundwerte. Die oft unentwirrbare Verquickung dieser
beiden analytisch so leicht trennbaren Prozesse erzeugt das Janus-Gesicht des aus dem
politischen Alltag bekannten Phänomens Nationalismus mit seiner Doppeleigenschaft von
emanzipatorischer Selbstbestimmung und herrschaftlichen Ambitionen. Ethnizismus ist
also als rückwärtsgerichtetes politisches Projekt zu sehen, welches gewöhnlich Modernisierung überhaupt zu vermeiden strebt, oder aber sie selektiv einengen will auf den
technisch-organisatorischen Bereich. Die sozialen und politischen Beziehungen sollen
ausgespart werden. Dieser Ethnizismus hat sich bisher mit Vorliebe als "Nationalismus"
bezeichnet.
Das erklärt auch die kennzeichnende Doppeldeutigkeit, welche dem Begriff der Nation
auch gegenwärtig wieder, nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus mit seinem
zumindest ideologisch vertretenen internationalistischen oder überethnischen Integrationsparadigma, bestimmt: Wir sprechen von der slowakischen Nation und meinen damit alle
Bürger des slowakischen Staates. Doch gleichzeitig bezeichnet dieser Ausdruck auch nur
jenen Teil der Bevölkerung, welcher slowakisch als Muttersprache spricht und sich als
zugehörig zu den Slowaken identifiziert. Diese Doppeldeutigkeit ist in der Wirklichkeit
angelegt und nicht zu umgehen. Vor allem ist sie keineswegs nur eine Sprachenfrage. Es
mag sein, daß einzelne Sprachen, z. B. das Englische, das Französische und seit einiger
Zeit auch das Deutsche, die erste Bedeutung favorisieren; andere (“narod”, “nacija”) die
zweite. Doch wenn eine Nation ein Volk ist, welches die Kontrolle über die politischen
Mittel autoritativer Zielsetzung anstrebt oder schon erlangt hat, dann kann es im Rahmen
von durch Mehrheitsprinzip ausgeübter Volkssouveränität sehr wohl passieren, daß dieses
“Lokalmonopol” von einem Teil der Bevölkerung für sich allein angestrebt wird, wenn
dieser Teil zu einer dauernden politischen Mehrheit in der Lage ist. Dieser versucht dann,
sich selbst exklusiv als Anspruchsberechtigten auf die Volkssouveränität zu konstruieren.
Es ist damit auch kennzeichnend für die Nation als politisches Projekt, daß bei hartem
politischen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen politischen Konzepten immer wieder
Koalitionen einer Grundrichtung bereit sind, zur Durchsetzung ihres Konzepts auch die
politischen Vertreter der ethnonationalen Minderheit(en) an der Ausübung der Staatsmacht
zu beteiligen (Slowakei, Rumänien, Bulgarien, ...).
Österreich weist den Sonderzug auf, dass sich dieser Ethnizismus, der anderswo im nationalen Gewand auftrat, sich hier eher in regionalistischer Art kleidet. Die alten Konservativen rufen eher "Kärnten" oder "Vorarlberg" als Österreich. Selbst die ersten Bewegungsversuche des politischen Konservatismus auf dem Gebiet der nationalen Eigenständigkeit fielen erkennbar regionalistisch aus; und in der Gegenwart kehrt er wieder zu
3
Ohne näher auf das Problem der Terminologie in diesem minenreichen Feld der sozial- und politikwissenschaftlichen Forschung einzugehen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass ich als Stütze für diesen
Vorschlag einen verwandten Terminus aus dem Intercocta Glossary “Ethnicity” von Fred Riggs (1985)
anführen könnte.
16
diesen Ursprüngen zurück. Voraussetzung dafür war eine Dualisierung der Gesellschaft,
wie sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts grundgelegt wurde: Eine alte hegemoniale Schicht (Hof und Aristokratie) wehrte sich gegen die Ambitionen neu aufsteigender
Gruppen mit Konkurrenzprogrammen.4 In Österreich wollten diese alten Schichten daher
auch gar nicht national sein. Anderswo, in Preußen z. B., nahmen sie den attraktiven
Begriff für sich in Anspruch. Das Paradoxe daran ist, dass dieser Nationalismus analytisch
als vornational diagnostiziert werden muß, weil er auf den Idealtypus der sozialen
Zuschreibung, nicht auf das moderne Prinzip des Erwerbs (von Status ebenso wie von
ethnonationaler Zugehörigkeit) setzt. Diesem Nationalismus stellte sich ein "Internationalismus" gegenüber. Zuerst als Konkurrenzprojekt gegen das reaktionäre Prinzip der Festschreibung sozialer Strukturen unter der Maske der Gemeinschaftlichkeit gerichtet, wandelte sich der Begriff allerdings nach der stalinistischen Transformation der Lenin'schen
Revolution zu einem Code-Wort für die nichtpartizipative Politik einer Nomenklatura,
welche nicht an die eigene soziale sowie nationale Basis zurückgebunden sein wollte.
Es scheint, als ob sich gegenwärtig ein weiterer, vierter Schritt anbahnte. Die Auffassung
der Nation als ein politisches Projekt macht es zwar erforderlich, insbesondere auf den
großen Bruch der neueren österreichischen Geschichte einzugehen, auf die Gründerzeit der
Republik. Mit dem EG-Beitritt ist jedoch eine entscheidende Zäsur für alle diese Fragen
erreicht. Die nationale Debatte der Gegenwart geht kaum in die herkömmliche Begrifflichkeit des Nationalen, obwohl im Rahmen der EG / EU-Debatte sowohl von Pro als auch von
Contra von Zeit zu Zeit die Frage der "österreichischen Identität" angesprochen wurde. Sie
geht viel stärker um die politischen Teilprojekte, um die Politiken. Das ist durchaus ein
rationaler Zugang, denn nur darin konkretisiert sich das politische Projekt. Doch es entbehrt wiederum des integrierenden Konzeptes, welches mit dem Schlüsselwort der
nationalen Identität angesprochen wird. Es fehlt gewissermaßen der "Wegweiser".
Wenn es in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft überhaupt eine generelle Tendenz gibt, ist es jene zur Differenzierung der Institutionen und Komplexitätssteigerung.
Auch die Entwicklung der Nation muß somit einem Gesetz der Differenzierung gehorchen.
Die Systeme werden größer, die sozialen Beziehungen extensiver. Das ist nur möglich,
wenn sich Gesellschaft weiter differenziert. Das aber muss Folgen für die sozialen Identitäten in diesen Systemen haben. Wenn Rollen weiter ausdifferenzieren, müssen auch
Identitäten sich verändern. Welche unter diesen sozialen Identitäten nun die Leitidentität
ist, wird damit noch stärker als bisher zur Frage der Option. Damit muss sich der Charakter
der nationalen Identität als zugeschriebener Status noch mehr ausdünnen. Allerdings ist das
ein besonders stark schichtenspezifischer Prozess. Das lässt sich gegenwärtig u. a. im Verhältnis zwischen politischen Eliten in Westeuropa und ihrer jeweiligen Basis beobachten.
Für die politische Klasse wird die Loyalitätszumutung zu einer Nation brüchig. Wir können
von neuen Loyalitätsvermutungen ausgehen. Ihr Focus findet sich wahrscheinlich nicht
mehr in der Nation. Das wäre von enormer Bedeutung. Dass dies keine reine Spekulation
ist, zeigen die Argumentationen in Österreich rund um die EG / EU herum. Vor der
Volksabstimmung ging es noch darum, die Basis mit dem Versprechen billigerer Preise
4
Sehr viel klarer als für Österreich wurde dieser Sachverhalt im Rahmen der Habsburgermonarchie für die
ungarischen Verhältnisse der gleichen Zeit analysiert. Die Modernisierungsversuche wurden als "fremd"
und "nichtungarisch" denunziert. Auch war der ungarische Versuch einer Weiterführung dieser Politik
durch das Horthy-Regime der Zwischenkriegszeit viel unverschleierter als der gleichzeitige in Österreich.
17
und damit auch höherer Realeinkommen zu gewinnen. Ausdrücklich wies man jede Idee
einer Verschiebung nationaler Identität weit von sich. Das war der Sinn hinter dem berüchtigten Schlagwort von SP-Ederer: "1000 Schilling pro Monat". Man behauptete also, der
Interessensaspekt lege für jeden Einzelnen eine stärkere politische Integration nahe. Davon
würde im übrigen der Identitätsaspekt nicht berührt. Nach der Abstimmung, insbesondere
auch nach der Desillusionierung der Bevölkerung infolge der völlig anderen als versprochenen Entwicklung hinsichtlich des materiellen Wohlstandes, lautet die Argumentation
nun anders: "Europa besteht nicht in einigen hundert Schilling mehr in der Tasche" (der
damalige Abgeordnete des LIF, -Frischenschlager). Die unterschiedliche Parteizugehörigkeit ist natürlich keine Zufälligkeit, obwohl sich in diesen Fragen die Grenzen verwischen.
– Friedrich Heer, in dessen Gedankenwelt der pathetische, moralische und vielleicht auch
ein wenig altmodische Begriff des "Verrates" eine gewichtige Rolle spielte, hätte diese
Kategorie vermutlich zur Beschreibung dieser neuesten Phase ins Spiel gebracht, obwohl er
selbst gerne mit der Ideologie "Europa" spielte. Bei ihm hatte sie allerdings die Funktion
einer Weltöffnung, nicht jene, eine mangelnde demokratische Legitimation zu überspielen.
Was nun das eigentliche politische / ideologische Paradigma der EU ist, ist heute noch
keineswegs klar. Wie gerade angedeutet, gibt es einen verdeckten Paradigmenstreit. Für die
politische Klasse scheint das derzeit hegemoniale Paradigma die übernationale Ausweitung
des Nationalstaatsparadigmas zu sein (“USE”), am ehesten in der Form des britischen Paradigmas, wo England, Schottland, Wales und Nord-Irland nur vergleichsweise unbedeutende regionale Einheiten waren. Doch dieses Modell ist selbst in der Krise. Doch in der
gegenwärtigen Realität scheint dies bereits an seine Grenzen zu stoßen und kaum in einem
Bereich wirklich zu funktionieren. Volkssouveränität als nationale Souveränität ist
mittelfristig (1 - 2 Generationen) nicht beliebig manipulierbar. Das beweisen u. a. die
vielen gescheiterten nationalen Pan-Ideologien (Pangermanismus, Panslawismus, ...). Die
Pan-Europa-Ideologie (hier ist nicht etwa die monarchistische Sekte gemeint, die sich so
nennt, sondern der Hauptstrom) ist nur ein weiteres Beispiel. Im Unterschied zu den
früheren Pan-Ideologien ist sie allerdings noch stärker von oben her konzipiert, während
die Pannationalisten zumindest in ihrer Ideologie volkssouverän dachten - die Praxis mit
ihren gerade dort starken kemalistischen Tendenzen war freilich eine andere Frage.
Ein nationales – oder doch wohl viel eher ein postnationales Ideologem und Paradigma?
18
Der Aufbau einer Nation bedeutet so die Entwicklung eines umfassenden politischen
Projektes, welches die "Behausung" einer integrierten Gesellschaft darstellen will. Das
trifft zu, wenn er glückt. Glückt er nicht, so lässt sich dies vor allem daran ablesen, dass
sich keine eigenständige nationale Identität entwickelt hat. Auf dieser Ebene muss man das
Vorhandensein einer nationalen Ideologie als eines der wesentlichen Kriterien betrachten,
welches die Nation von einer traditionellen ethnischen Einheit unterscheidet. Die nationale
Ideologie, wie rudimentär und intellektuell unbefriedigend ausgeformt sie immer sein mag,
ist die symbolische Zusammenfassung einer politischen Zielvorstellung umfassender Art
mit sowohl kognitiven wie emotiven Komponenten und als solche Voraussetzung einer
nationalen Politik. Ausformuliert wird sie im wesentlichen von jener Personengruppe, die
wir als Intellektuelle kennzeichnen. Nationalismus ist ein Sorel’scher Mythos vor allem
kleinbürgerlicher Intellektueller, ein trvialisierter Mythos allerdings. Im Nationalismus
setzen sich die My(s)tiker gegen die Rationalisten durch, wenn man dies als zwei
intellektuelle Ideal- und Grundtypen sehen will. Die sogenannten nationalen “Ideen” – den
Ausdruck finden wir z. B. in der “megali idea” des griechischen Nationalismus – sind nicht
viel mehr als der in Hegel’scher Manier verallgemeinerte und idealisierte politische
Anspruch dieser Gruppe. Wenn man heute von “Europa” (gemeint ist fast immer einfach
die EU) oder gar der “Weltgesellschaft” nicht nur als einer in vielen Bereichen empirisch
feststellbaren Strukturtatsache spricht, sondern mit einem normativen Hintergrund, lauert
der “Weltgeist” kaum mehr verhüllt schon um die Ecke. Da dies eine zu spezifisch intellektuelle Angelegenheit war, konzentriert sich die nationale Ideologie im Begriff des
"Nationalcharakters". Der durchschlagende Erfolg dieses Konzeptes ist der Ausdruck
jenes grundlegenden menschlichen Bedürfnisses, sich eine Ordnung zu schaffen, um die
Dinge und Menschen klassifizieren zu können. Diesem Orientierungsbedürfnis steht ein
ästhetisches Bedürfnisses nach Ordnung um ihrer selbst willen an der Seite. Die
Grenzziehung wird bekanntlich von allen neueren Theoretikern der Ethnizität und somit
auch jenen, welche dem Ethnischen eine Rolle in der Konstitution von Nationen
beimessen, als grundlegende, oft sogar als einzige Funktion betrachtet. Sie bekommt im
"Nationalcharakter" die Trivialform gesicherten Alltagswissens, welches nicht mehr
nachgeprüft werden muss. Ist das Bedürfnis nach "Differenz" eine menschliche Universalie, so ist dann die ethnonationale Identität eine spezifische Ausdrucksform, und der
"Nationalcharakter" die ideologische Gestalt davon. Alle weiteren Kriterien – die Sprache,
die Religion, die Esskultur – gehorchen nur mehr dem Bedürfnis nach einer
Konkretisierung dieser "Differenz", die es geben muss.
Man kann die Frage auch analytisch angehen: Gibt es wirklich jeweils für bestimmte Nationen spezifische Charaktere? Norbert Elias (1989) hat zurecht darauf hingewiesen, dass dieser Begriff vorwissenschaftlich sei. Doch ist es mit einer reinen Umformulierung in "nationaler Habitus" oder
auch "nationale Mentalitäten" (Blomert u. a. 1993) nicht getan, wenn nicht die Begriffsstruktur
gründlich umformuliert wird. Schließlich ist der "Nationalcharakter" selbst nur eine durchsichtige
Umformulierung der "Volksseele". Alle diese Begriffe dienten zur Fetischisierung der Gesamtrolle, jenes Bündels von Erwartungen, welche jede Gesellschaft an ihre Mitglieder richtet. Sie sind
19
Nachfolgekonzepte früher religiöser Vorstellungen, welche die soziale Einheitlichkeit einer
bestimmten Gruppe verkörperten. Sie konnten mit anderen Merkmalen verknüpft sein, etwa der
Territorialität. Wenn wir eine Beschreibung des Erdgottes der Shang und Chou-Zeit lesen, so ist
dieser Repräsentationscharakter deutlich: "Seine Funktion im Götter-Pantheon Altchinas war der
Schutz eines umgrenzten Territoriums... Jede der Herrschaften, vom Gesamtreich über die großen
und kleinen Lehensterritorien bis zu den Landgemeinden, hatte einen eigenen Erdgottaltar"
(Franke / Trauzettel 1968, 49).
Einen frühen rationalen Zugang zu dieser Begrifflichkeit schaffte vor zweieinhalb Jahrhunderten
David Hume (Of National Charakters – Hume 1985, 198, 197): "A nation is nothing but a
collection of individuals... Some particular qualities are more frequently to be met with among one
people than among their neighbours." Und warum? Weil die Nation eine politische Einheit ist,
welche eine Kommunikationsgemeinschaft bilden. Damit hat der nüchterne Empirizist gleichzeitig
eine theoretische Erklärung gefunden, auf deren Wieder-Auftauchen man etwa zwei Jahrhunderte
warten wird müssen. Dementsprechend wird die Frage heute, wenn sie überhaupt noch ernsthaft
debattiert wird, meist nach dem “modalen Charakter” (Inkeles 1997, 3), der häufigsten Ausprägung, gestellt. Wenn dann allerdings im selben Satz auch die “Grundstruktur der Persönlichkeit”
genannt wird, sind wir bereits im Übergang zu einem neuen Ansatz.
Der Ausdruck "politisches Projekt" als Kennzeichnung für die nationale Ideologie könnte
das Missverständnis erzeugen, als handle es sich hierbei um einen rationalen, von Anfang
an im Detail ausgearbeiteten und nur mehr technokratisch zu implementierenden Plan, man
würde sich fragen: wessen? Doch Sinn dieses Ausdruckes ist es im Gegenteil, die
Ungerichtetheit und Unbestimmtheit, die Offenheit des politischen Prozesses zu betonen.
Es gibt keine von vorneherein feststehende nationale und auch keine solche ethnische
Einheit, die mit Naturnotwendigkeit zur Nation geworden ist. Der Entwurf eines politischen Projektes, genannt Nation, ist ein Prozess, in dem sich unterschiedlichste Interessen
gegeneinander stellen und ihre jeweilige Sicht der Dinge autoritativ, d. h. politisch und
sozial verpflichtend, zu machen versuchen. In nationaler Sicht gibt es immer einen Kampf
um eine zur Diskussion stehende nationale Identität, die zum Deckblatt des jeweiligen
Projektes wird oder werden soll. Träger dieses Kampfes sind gewöhnlich mittelständische
Intellektuelle, welche damit ihre Machtaspirationen verfolgen. Ist diese Schicht anders
orientiert oder möglicherweise gar nicht vorhanden, können andere funktionsgleiche
Schichten an ihre Stelle treten, wie man es besonders in Lateinamerika beobachtet hat. Der
"Kampf um die österreichische Identität" (Heer 1980) war ausgeprägt ein Kampf um die
politische Zukunft und ist als solcher zu decodieren. Doch die österreichischen Intellektuellen waren bis zur Zweiten Republik aus unterschiedlichen Gründen in ihrer Mehrzahl
nicht auf eine eigenständige Nation orientiert. Sie glaubten an eine größere, umfassendere
deutsche Nation. Die politische Klasse spielte hier eine größere Rolle als anderswo, wenn
auch diese nicht eindeutig war und sich eng an die politischen und sozialen Interessen der
unterschiedlichen Strömungen anlehnte.
Der Beginn der Auseinandersetzung um die nationale Zugehörigkeit der Österreicher und
zwar vor allem jener, die deutsch sprachen, lag vor 150 Jahren; ein vorläufiger Schlusspunkt deutet sich gerade an mit der Konversion der letzten bedeutsamen und in der FPÖ
politisch repräsentierten Schicht des organisierten Deutschnationalismus zum ÖsterreichPatriotismus und damit absehbar auch zur österreichischen Nation.
1.0.1 Historiographie und nationale Orientierung
Dieses Projekt über nationale Identität entstand in seinen Grundzügen aus Anlass des
"Millennium" 1996. Es ist angebracht, diesen Anlass zu reflektieren. Das Millennium, das
20
Tausend-Jahre-Jubiläum der erstmaligen Erwähnung des Namens Österreich in einer Urkunde, baut an einem speziellen Mythos. Zuerst einmal frappieren die 1000 Jahre. Die
Nation Österreich besteht seit 1945. Sie wäre erstmals möglich geworden durch den Zerfall
des Habsburgerreiches 1918. Ein nationales Jubiläum sollte also an diesen Jahren ansetzen.
Doch offenbar passt der Symbolwert dieser Jahre wesentlichen politischen Kräften nicht
ins Konzept. Darauf werden wir beim Nationalfeiertag und seiner Auswahl noch kommen.
Warum hat man weder 1918 noch 1945 als den eigentlichen nationalen Gedächtnistag gewählt? Beide Daten bedeuten den Abschied von einer Großmachtillusion – 1914/1918 erzwungen durch die historische Fehlkalkulation einer verantwortungslosen politischen Klasse zusammen mit der Dynastie; 1945 als gelungener Versuch, sich von einer moralischen
und politischen Katastrophe jener Deutschen abzukoppeln, von denen man eben noch als
zugehörig vereinnahmt gewesen war. Scheiterte die Erste Republik nicht zuletzt am Unvermögen der Elite, sich als selbständige kleine Nation zu begreifen (sie wollte nicht den
österreichischen, sondern den "zweiten deutschen Staat"), so wurde die Zweite Republik
ein unerwarteter Erfolg: Man begriff diesmal die eigene bescheidene Existenz als Chance
und akzeptierte sie. Damit stellt sich die Frage erst recht: Wozu einen nationalen Gedenktag, welcher sogar historisch umstritten ist?
Warum hat eigentlich Geschichte diese überragende Bedeutung im Diskurs des Nationalen? “Gedächtnis” und “Erinnerung” hat jeder Mensch und auch jede Gemeinschaft. Doch
Geschichte ist die sozial und politisch umkämpfte und staatlich beeinflusste bis gelenkte
Form der Rekonstruktion von Vergangenheit, welche eine der wichtigsten Formen ist, in
der sich intellektuelle Hegemonie darstellt. “Geschichte vereinigt in unserer Sprache die
objektive sowohl als subjektive Seite und bedeutet ebenso gut die historiam rerum gestarum als die res gestas selbst ... Geschichtserzählung [erscheint] mit eigentlich geschichtlichen Taten und Begebenheiten gleichzeitig... Der Staat erst führt seinen Inhalt herbei, der
für die Prosa der Geschichte nicht nur geeignet ist, sondern sie selbst mit erzeugt” (Hegel
1995, 83). Niemand hat wohl in affirmativer Weise stärker klar gemacht als Hegel: (Welt-)
Geschichte ist Herrschaftsgeschichte. Man nennt Herodot den Vater der Geschichtsschreibung. Doch das ist er nur als Berichterstatter über die Perserkriege. Die andere Seite seines
Werkes, die langen Berichte über die unterschiedlichsten Völkerschaften der damaligen
Welt, werden nicht umsonst als “Ethnographie” eingeordnet. Sie berichten “nur” von den
Alltagslebenswelten der Betroffenen. Als schließlich im europäischen Früh- und Hochmittelalter wieder Geschichtsschreibung in Form von Chroniken neu entstand, da waren es
Berichte über Dynastien und kirchlichen Bürokratien. Die erste Weltchronik in deutscher
Sprache, die Vorauer Kaiserchronik (1953), “chundet uns da von den bae[p]sten und von
den chunigen”. Und wenn die Geschichte nicht mit den Erwartungen an sie über einstimmte – umso schlimmer für die Geschichte: “Nicht immer konnten [die Präzedenzfälle
in der Vergangenheit] in den heiligen Schriften und den alten Chroniken gefunden werden.
Dann wurde die Vergangenheit geändert, durch Ergänzungen, Erklärungen und manchmal
auch durch direkte Fälschungen ...” (Schwarz 1991, 70, über die Legitimierung Moskaus
und seines Anspruchs auf Kontinuität zu Kiew im 15. Jahrhundert).
Geschichte, Historiographie, war im Europa der letzten zwei Jahrhunderte jene intellektuelle Disziplin, welche es unternahm – im eigenen Antrieb wie aus einem Bedürfnis seitens
der politischen Führung – für politischen Sinn zu sorgen. “Nur für den rückschauenden
Blick ... gibt es wohlunterschiedene Erlebnisse. Nur das Erlebte ist sinnvoll, nicht das Erleben” (Schütz 1981, 69). Obwohl es durchaus gefährlich ist, aus solchen Analyseansätzen,
welche sich auf den Einzelmenschen und seine Erlebnisweisen beziehen, auf ein soziales
21
System zu schließen oder überzugehen, liegt hier doch der Anfangsbestand einer Theorie
der Geschichte, die i. S. des methodologischen Individualismus schließlich doch im Verhalten des Einzelnen fundiert werden muss. Erst der Rückblick (die “Reproduktion” im
Gegensatz zur “Retention”) ermöglicht den Aufbau von Sinnzusammenhängen. Geschichte
wird so zur Konstruktion der Identität einer sozialen Einheit, mithin auch der eines “Volkes”. Mithin ist sie wesentlich mehr als Begriffs- und Alltags-Konstruktion. Sie wird als
Tätigkeit von Historiographen ebenso wie als autonomes Konstrukt anonym und verallgemeinert, mit der Autorität des Staates im Rücken weitergegeben in Bildungsinstitutionen
als Kern des ideologischen Curriculums und so selbst zum historisch-politischen Wirkstoff.
Allerdings unterscheidet sich moderne Gesellschaft in einem Punkt wesentlich von quasistatischer traditionaler Gesellschaft. Denn moderne Gesellschaft und ihre Geschichte bezieht sich nicht auf Selbsterlebtes. Geschichte unterscheidet sich fundamental dadurch von
Zeitgenössischen, dass sie intellektuelles Erleben von bloß symbolisch Repräsentiertem ist.
Das macht sie denn auch zum Spezialgebiet einer eigenen Gruppe von Intellektuellen,
nämlich der Historiker. Allerdings ist Geschichte für viele Historiker selbst zu einem fetischartigen Wesen geworden. Sie selbst „erklärt“ und wird zur wirkenden Ursache. „Hier
kann man die Eigenstaatlichkeit nur mit der Geschichte begründen“ (Ziegler 2002, 58 f.),
also nicht etwa mit gewissen politischen Strukturen oder mit Entscheidungen … Ähnlich
(a.a.O., 71): „Es liegt vor allem in der Geschichte begründet, …“.
Wir können die Historiker die Ideologen der Kontinuität nennen. "Indem der Historiker
Fragen aus den Tendenzen seiner Zeit aufgreift, indem er an Kausalzusammenhänge heranführt bis an den aktuellen Erlebnisbereich, nimmt er Einfluss auf den laufenden, auch Zukunftsfragen einbeziehenden Orientierungsprozess der Gegenwart" (Plaschka / Stourzh u.
a. 1995, 7f.). Doch den Kontinuitäten kann jeweils ein unterschiedlicher Sinn unterlegt
werden – je nach dem eigenen Standpunkt. Es gibt ja nicht nur eine einzige soziale Struktur. Aber man bedarf irgendeiner Struktur, um einen "Sinn", eine verstehbare Ordnung, zu
erkennen. Geschichte ist verwalteter Sinn. Der eine sieht die Geschichte als eine Geschichte von Klassenkämpfen. Doch Klasse ist vor allem synchrone Struktur innerhalb von Gesellschaft, und so kann es wenig verwundern, dass Weltgeschichte als Geschichte der Klassenkämpfe bislang noch nicht wirklich geschrieben wurde. Natürlich haben an einem solchen Blickwinkel auch die hegemonialen Klassen, welche Geschichte verwalten, nicht das
geringste Interesse.
Die moderne Geschichtswissenschaft und mit ihr die moderne Geschichte ist dagegen im
19. Jahrhundert als Nationalgeschichtsschreibung entstanden. Die Identifizierung von Historiographie und Geschichte ist hier weder zufällig noch fahrlässig. Denn Geschichte ist ein
Text, der sich allerdings in den Augen seiner Autoren von anderen Texten literarischer Art
als Wirklichkeitsbeschreibung in einer naiven Abbildtheorie empfiehlt. Nation bietet sich
für diesen Text besonders an. Ihr Anspruch ist gerade Kontinuität. Insofern ist es zumindest
politisch zweifelhaft (wenn auch für eine neue Geschichte in ihrem Willen zur Wissenschaft berechtigt), ob die Unterscheidung zwischen “Gedächtnis” (“memory”) und “Geschichte” (“history” – Pierre Nora) Gültigkeit hat. Denn auch die historischen Mythen und
die Volkserzählungen, die angeblich das “Gedächtnis” darstellen sollen, sind nahezu ausschließlich Produkte von identifizierbaren Einzelpersonen, und zwar oft eben von Historikern (vgl. später).
Man begann also, die Geschichte von "Nationen" ab ovo zu schreiben. Die Historiker
damals und nicht wenige auch in ihrer Tradition heute kamen gar nicht auf die Idee, zu
22
fragen, was sie da eigentlich beschreiben. Stellen wir zumindest das Problem, wenn es hier
auch noch nicht gelöst wird! Ich würde meinen, das bislang noch nicht völlig gelöste
Hauptproblem einer Theorie der Nation ist, die Nation weder als vom Himmel gefallen,
noch als ewig zu betrachten.
Kontinuität der Zusammengehörigkeiten über die Generationen hinweg kann nur ideell
hergestellt werden. Und doch gibt es auch dabei riesige Unterschiede zwischen verschieden
strukturierten Gesellschaften. Bis zu 10 oder sogar 12 Generationen, d. h. also: 200 bis 300
Jahre zurück müssen Nuer ihre genealogischen Verhältnisse kennen, denn diese haben
Einfluss auf ihren Alltag (Hutchinson 1996, 200 ff.): Sie bestimmen den Kreis der möglichen Gattinnen. Und doch gibt es bei ihnen keine “Geschichte”. Die für Gesellschaft und
für den Einzelmenschen und seine persönliche Sinngebung so wichtige Kontinuität wird also von ihnen erfahren, ohne dass sie sie als zeitliche Struktur substanzialisieren und reifizieren. Ich würde meinen, dass an diesem Beispiel einer der wichtigsten Unterschiede zwischen originärer Ethnizität als Erfahrung von Lebenswelten und ihrer Kontinuität auf der
einen Seite, nationaler Identität mit ihrer abstrakt gelernten Kontinuität aufeinander folgender Generationen, die jedoch über die Gesellschaft hin kaum miteinander verbunden sind,
besteht. Ethnizität wird also erfahren, Nation gelernt. Für moderne ethnische Identität
allerdings ist dieser Unterschied nicht mehr gültig. Hier ist sicher der Erfahrungszusammenhang von Nation wichtiger, weil praktisch bestimmend.5
Niemand hat eine Erfahrung, welche über zwei bis drei Generationen hinauswirkt. Das
sogenannte "kollektive Gedächtnis" ist meist nichts anderes, als was Kindern in der Schule
in ideologischer Absicht beigebracht wurde. Doch solche Indoktrinationen sind dann aber
u. U. enorm wirksam (Schumpeter 1975, 100: “Nothing is so retentive as a nations memory”). Nationalismen sind zuerst solche kontinuitätsorientierte Ideologien, bevor sie
Handlungssysteme werden. Die Berufung auf "serbische Gräber" und das "Land Abrahams" bekommt aber erst im davon mitmotivierten Handeln unmittelbare Realität. Der
Streit um die Vergangenheit wird so zum Kampf um die Zukunft. Hier geht es vorerst um
den strukturell-analytischen Gesichtspunkt, das politische Problem wird später noch angesprochen. Ganz deutlich werden diese Gegenüberstellung von realen und ideellen Kontinuitäten sowie ihr Auseinanderklaffen an der Entstehung, der Genese großethnischer Einheiten durch Fusion vieler kleiner, originärer Ethnien. Die weiterwirkende Tradition wird
in der Regel durch einen sozialen und politischen Traditionskern hergestellt, welcher die
Ethnogenese herrschaftlich gelenkt hat und die neue, größere Ethnie dominiert. Es werden
also Namen, gleich bleibende Worte und nicht sosehr Begriffe auf recht unterschiedliche
Strukturen angewandt. Die wissenschaftliche Disziplin, in welcher dies geschieht und unterschiedlich dargestellt wird, ist die Historiographie. Doch Geschichtsschreibung kann in
unterschiedlichster Weise vor sich gehen. Sie hat nach dem großangelegten Rationalisierungsprozess im Gefolge der Aufklärung heute eine andere Gestalt, als das, was man auch
Geschichtsschreibung in früheren Gesellschaften nennt. Da gibt es einige kennzeichnende
Züge, die eine kleine Abschweifung in einen ganz anderen Zusammenhang wert sind.
Die altchinesische Historiographie wurde bis ins 20. Jahrhundert herein ausschließlich in einer
Sprache festgehalten, welche allen außer sehr wenigen "Gebildeten" unverständlich war. Dies zeigt
geradezu grell, für wen sie bestimmt war. Sie sollte für die Dynastie(n) und die sie stützenden
5
Hier könnte eine Ursache des im Alltag unausrottbaren Missverständnisses sein (man kann es sogar bei
Sozialwissenschaftern u. U. noch antreffen), dass Ethnizität eine “Eigenschaft” von Minderheiten sei.
23
Oberschichten bzw. deren Apparat legitimierende Traditionen aufbauen. "Ihre konfuzianische
Indoktrinierung ließ die Historiker in jeder Hinsicht den Standpunkt der Oberschicht einnehmen"
(Franke / Trauzettel 1968, 15). Kennzeichnend waren die Stilmittel, die in solchen bürokratischen
und bürokratisierten Vorhaben eingesetzt wurden. Das vielleicht wichtigste davon war die
"angemessene Verschweigung", die in einer anderen Tradition, der römischen, damnatio memoriae
hieß. Das wesentlichste positive Stilmittel war eine entsprechende Topik bei wiederkehrenden
Anlässen. Der letzte Vertreter einer Dynastie, die von einer anderen abgelöst wurde, musste z. B.
verkommen und korrumpiert sein, sonst wäre ja die neue nicht legitim gewesen...
Ähnliches gilt für ziemlich alle vormodernen Historien, sobald sie von einem dem Mandarinat ähnlichen Personal (von Mönchen z. B.) verfasst wurden. Wenn man sich die altserbischen DaniloChronik mit ihren Herrscherbiographien ansieht (Hafner 1976), erhält man den überwältigenden
Eindruck einer vollständigen Abhängigkeit der Schreiber von der byzantinischen Kultur. Die Viten
der serbischen Könige sind reine Ikonen. Außer der Regierungszeit erscheint kaum etwas als individuell. Und doch sollten sie dazu dienen, die serbische Selbständigkeit gegenüber auch dem byzantinischen Kaiser zu rechtfertigen. Damit liegt der eigentlich historische Wert dieser Biographien in ihrer puren Existenz bzw. ihrem Stil, keineswegs in ihrem erzählerischen Inhalt. Der
Byzantinismus ist überwältigend und byzantinischer als in Byzanz selbst. Diese Hagiographie
wirkt heute grotesk, wenn man den gar nicht so frommen Inhalt mitberücksichtigt: In diese Sammlung von Bibelzitaten ist gelegentlich eine historische Bemerkung eingeblendet; gewöhnlich bringt
in diesem Fall ein Sohn seinen Vater um oder dieser lässt "betrübt" seinen Sohn blenden. Die
Identität zwischen Herrscher und Gottgesandten steht außer Zweifel. Es ist alles höchst archaisch;
im Vergleich dazu ist der etwas früher lebende byzantinische Geistliche Michael Psellos stark
säkularisiert.
Bürgerliche Geschichtsschreibung in Europa ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts, also
etwas vor der historischen Zäsur, in der bürgerliche Partizipation politisch wirksam wurde,
hat dagegen einen deutlich anderen Charakter. Sie ist individualistisch, verzichtet aber
deswegen keineswegs darauf, ideologisch zu sein. Sie legt zwar die Sicht eines Einzelnen
nieder, versucht dieser Sicht aber "Gültigkeit", Verbindlichkeit und Hegemonie zu verschaffen. Sie ist damit ein typisches Produkt und ein Werkzeug moderner Intellektueller.
Die Tradition wird in diesem Stadium nicht mehr – oder noch nicht – hierarchisch gelenkt
und verwaltet, wohl aber politisch genutzt. Dementsprechend ist das Hauptstilmittel die
Diskussion neuen Materials, die Interpretation von "Quellen". Es gibt einen (wissenschafts-) politischen Kampf um die Gestaltung bzw. um die Kreation einer Tradition, wobei
diese nationalen, religiösen, auch klassenspezifischen oder sonstigen Charakter haben
kann. Wenn man immer wieder Leopold Ranke als den "Vater" dieser Art von Geschichte
benennt, so ist dies zwar ein interessanter Hinweis, muss aber näher ausgeführt werden.
Ranke stand wie Hegel bewusst in Abhängigkeit und im Dienst des preußischen Absolutismus und Autoritarismus. Für ihn hatte er (in der "Preußischen Geschichte") die historische
Legitimierung zu liefern, wie Hegel die philosophische nach schob. Der Weltgeist wurde
zum berühmtesten Fetisch der Moderne, und hat auf eine fatale Weise auch die politischen
Gegner Hegels beeinflusst: Marx etwa sprach von der Philosophie und den Philosophen,
welche die Welt verändern sollten. Damit übernimmt er Hegel’sches Gedankengut, das er
nicht durchschaut und auch nicht durchschauen will, weil sie seine eigene Legitimation
gefährden könnte. Der gerade auch von Engels so reklamierte Fortschritt des Sozialismus
von der Utopie, d. h. dem deklarierten politischen Programm, zur “Wissenschaft”, d. h. der
behaupteten Notwendigkeit (das erinnert nicht umsonst an den “Sachzwang”) wurde so zu
einem Mittel im Kampf der Intellektuellen um die Hegemonie.
24
Auch wenn Ranke in technischer Hinsicht bereits als Innovator hervorsticht, ist der noch
nicht bürgerliche Intellektuelle hier ganz und gar Fürstendiener, also noch keineswegs
organischer Intellektueller seiner eigenen Schicht. Im Gegenteil – seine Aufgabe ist gerade
jene des Kampfes gegen das aufsteigende Bürgertum, welches eine Gefahr für die Dynastie
und den autoritären Militärstaat darstellte.
Inhaltlich war die bürgerlich-intellektuelle Geschichtsschreibung mit wenigen Ausnahmen
eindeutig Nationalgeschichte. Das Muster dazu lieferte im deutschen Sprachraum hauptsächlich der zum Preußen gewordene Badener Heinrich Treitschke mit seiner „Deutschen
Geschichte im 19. Jahrhundert“, der Historiograph des preußischen Staats in der Nachfolge
Rankes seit 1886.
Wenn je der Stil ein Werk bestimmte, dann hier. Man möchte sagen, Treitschke übertraf in seinem
– für heute nahezu unerträglichem – Pathos selbst Gustav Freytag und Genossen (s. u.). Sein
Lieblingswort ist „sittlich“, oder auch „Gesittung“, meist bezogen auf einen preußischen König
oder Politiker, „kerndeutsch“ kommt auch häufig vor. Überraschend leitet er seine Darstellung ein:
„Die deutsche Nation ist trotz ihrer alten Geschichte das jüngste unter den großen Völkern
Westeuropas“ ((o. J.; [seit 1879], 3). Aber das ist Stilistik, um seinen Organizismus einerseits, und
seine Preußenorientiertheit andererseits vorzubereiten. Mit einer analytischen Einsicht hat edies
nichts zu tun, wie die nächsten Worte beweisen: „Zweimal ward ihr ein Zeitalter der Jugend
beschieden, zweimal der Kampf um die Grundlagen staatlicher Macht und freier Gesittung. Sie
schuf sich vor einem Jahrtausend das stolzeste Königtum der Germanen und musste acht
Jahrhunderte nachher den Bau ihres Staates auf völlig verändertem Boden von neuem beginnen
…“ (a.a.O., 3). Gegen Treitschke ist Sybel wahrhaft ein nüchterner Schreiber – der aber auch in die
Treitschke’sche Sprache kommen konnte, wenn er wollte –, selten hat ein Historiker vor den Nazis
solche Tiefen der Ideologie erreicht.
Entstand die moderne Geschichtswissenschaft schon als Nationalgeschichtsschreibung, so
hat sie diese Ausrichtung bis in die Gegenwart fast ungebrochen durchgehalten. Und auch
die Alternativanbote entziehen sich dieser Logik nicht, sondern greifen nur auf andere
Inhalte zurück, die sie dann dementsprechend interpretieren. Dabei können durchaus
Inkonsistenzen auftreten. So ist in esoterischen Zirkeln und davon beeinflussten Kreisen
das Kelten-Paradigma beliebt. Es dient als Goldenes Zeitalter des neuen Irrationalismus
und seiner Fluchtphantasien. Doch interessanterweise wird dies teils universalistisch, teils
aber ganz entgegengesetzt, nämlich ethnistisch, aufgefasst. “Der moderne Nationalismus,
die Kleinstaaterei und der Dezentralismus sehen im Partikularismus der Kelten einen
Gegenentwurf zu zentralistischen und imperialistischen Machtblöcken. Wunschvorstellungen des politischen und gesellschaftlichen Alltags, wie die von der europäischen Einheit
und vom Matriarchat, werden auf die Kelten projiziert” (Birkhan 1997, 4). Die Ironie an
diesen durchaus richtigen Sätzen besteht darin, dass der Autor sein äußerst umfangreiches
Buch ohne vergleichbare Vorstellungen gar nicht hätte schreiben können, denn er selbst
geht von einer keltischen Einheit aus (“... eine relativ einheitliche materielle ... und
immaterielle Kultur...”), die ganz und gar nicht gesichert ist ...
Das geben mittlerweile – unter dem Eindruck neuer ideologischer Anforderungen – sogar
die zunftmäßigen Historiker zu: "Noch ist auch in Mitteleuropa die klassische Konzeption
des Historikers die der nationalen Vergangenheit, sein klassisches Objekt die Geschichte
der Nation... Waren die europäischen, nicht zuletzt die mitteleuropäischen, Nationen bis
vor kurzem noch in der Vorstellung verfangen, der wesentliche Sinn ihrer Geschichte liege
in der Hervorhebung ihres eigenen Weges und in der Kennzeichnung der damit verbundenen nationalen Eigenart, so setzt sich gerade auch in diesen Nationen nun zunehmend die
25
Erkenntnis durch, dass keiner ihrer Wege ein ganz getrennter, ein ganz isolierter gewesen
sei, sondern dass die Wege wie Eigenarten in überraschend hohem Maße übergreifende
und übereinstimmende Wege und Eigenarten sind" (Plaschka / Haselsteiner u. a. 1995,
XI). Nur einige wenige, die eher in die politische Theorie hinein gehören (z. B. Alexis de
Tocqueville), wurden nicht müde, auf die erstaunliche Gleichartigkeit der europäischen
Strukturen seit dem Hochmittelalter hinzuweisen. Trotzdem ist es kennzeichnend, daß
dieser Gedanke - die strukturelle Gleichartigkeit Europas vom Atlantik bis an die Grenze
des eigentlichen Osteuropas, für die man manchmal die Religionsgrenze katholisch - orthodox einsetzt – im 19. Jahrhundert wenig Chancen hatte. Er wird von der Geschichte erst
unter dem politischen Impetus der Gegenwart wieder auf gegriffen. Von außen war dies
offenbar leichter festzustellen: Rabindranath Tagore (1992 [1917], 88) vergleicht z. B. die
seiner Ansicht nach überwältigende Diversität Indiens mit der Einheitlichkeit Europas.
"India is too vast in its area and too diverse in its races. It is many countries packed into
one geographical receptacle. It is just the opposite of what Europe truly is: namly, one
country made into many."
Schließlich zeigt sich ein weiteres subtiles Problem: Durch die Art der Durchführung unterschiedlichster Veranstaltungen wird dieses Millennium schließlich zu einem sinnentleerten folkloristischen event. Damit geht auch seine potentielle politisch brisante Aussage verloren, nämlich jene der Eigenständigkeit Österreichs. Vom Wissensstand her wäre das also
vor 100 Jahren auch schon möglich gewesen: Man vgl. dazu die frühen Arbeiten von Otto
Hintze!6 Heute gibt es hier eine neuerlich Wende: "Europa" tritt ins Blickfeld der Öffentlichkeit und der Aufmerksamkeit auch der Historiker, weil Maastricht-Europa, sprich
die EG, ihr Bedürfnis nach einer historisch-ideologischen Fundierung entdeckt hat. "Faire
l'Europe", "Europa bauen", "The Making of Europe", heißt nun die Devise. Das schießt nun
oft genug auch wieder übers Ziel. "Europa" wird nun geradezu ein teleologischer Punkt.
Wie mittlerweile hinlänglich bekannt, gab es politische Einigungsideen in Westeuropa
schon seit langem (Neisser 1993). Doch von der mittelalterlichen Idee des Universum
catholicum über Kants "Ewigen Frieden" bis zur Gegenwart sind die Typen zu verschieden,
vor allem auch aufgrund der völlig unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen, als dass man
seriöser Weise eine einheitliche Tradition aufbauen könnte. Trotzdem versucht man gerade
das mit fast religiösem Eifer in einer Art Novalis’scher Tradition. Das wird von heutigen
Exponenten dieser Idee völlig übersehen. Und doch gibt es eine einheitliche Struktur im
Hintergrund. Man kann ihr mit den Begriffen des "Kulturbezirks" innerhalb von "Kulturkreisen" nahe kommen. Ein solcher Kulturkreis bzw. eine "Super-Ethnizität" bildet Europa,
und innerhalb Europas wiederum jeweils West- und Osteuropa. Das hat gerade für Intellektuelle eine spezifische Bedeutung.
Bürokratische Geschichte, geschrieben von Beamten, gibt es auch heute noch. Sie ist allerdings eher in den Vorbereich dessen abgedrängt, was allgemein als Geschichtsschreibung
verstanden wird. Doch auch in Österreich ist der "Staatsarchivar" oder auch der Landesarchivar eine strategische Stelle und Person, an der schon manche historiographische Pro6
Man vgl. auch folgende Bemerkung in der NZZ, 5. Oktober 1993: Symbiose von Kunst und Zweck – Henry
van de Velde im Museum für Gestaltung in Zürich: "Aktualität kann die Schau auch insofern beanspruchen, als sie – mit Blick auf die Vereinigungsbemühungen in der Alten Welt – versucht, über das
reine Werkmonographische hinaus van de Veldes Rolle als Integrationsfigur der damaligen europäischen
Kultur in den Blickpunkt zu rücken." Dazu fällt natürlich auch eine Ausstellung im Sommer 1993 im
Pariser Musée d'Orsay "Europe 1893 – 1993" mit exakt derselben Absicht ein.
26
jekte, in Kärnten z. B., gescheitert sind. Doch es ist der Anlass, aus dem diese Arbeit entstand, welcher einen kennzeichnenden Zug des Aufbaues und des Kampfes um die Formierung nationaler Identität zeigt: Das "Millennium", die erstmalige dokumentarische Nennung des Namens Österreich ("Ostarrichi") in einer Privaturkunde, wurde zum Anlass einer
umfassenden Positionsbestimmung. Die unterschiedlichsten Programme und Feierlichkeiten – vom wissenschaftlichen Projekt bis zur Festsitzung der Vertretungskörperschaften –
sollen unterschiedlichen Gruppen die Gelegenheit bieten, ihre Auffassung von "Österreich"
darzulegen. Insofern kann man dem Millennium einigen politischen Wert abgewinnen.
Hier haben viele unterschiedliche Gedanken Platz. Vom "Grenzenlosen Österreich" bis zur
"Bedrohten Vielfalt" reichen die Titel von Veranstaltungen, welche unter dem Mantel des
Millenniums Schutz suchen.
Hier spielt sich also auch jener Kampf um die Identität ab, der für die nationale Entwicklung kennzeichnend ist. Der Anlass des Jubiläums mag zufällig sein: Manche Mittelalter-Historiker können sich nicht genug alterieren über die angebliche Sinnlosigkeit des
gewählten Datums - die Erregung lässt schon wieder fragen, was sie eigentlich ausgelöst
hat. Denn sie übersehen damit unbewusst oder vielleicht auch bewusst den springenden
Punkt: Der Bezug auf die Vergangenheit dient in nationalen (oder auch nationalistischen)
Debatten immer dazu, gegenwärtige und zukunftsbezogene politische Entwürfe liturgisch
einzukleiden. Dazu gehören u. a. auch Reliquien: Der Erwerb eines außerordentlich teuren
Manuskriptes, in diesem Fall des Evangeliars Heinrich des Löwen um einen Kaufpreis von
DM 32 Mill. zu einer Zeit, wo anderswo im Staatshaushalt angeblich der Imperativ der
Sparsamkeit herrscht, wird so zum Erwerb eines nationalen Reliquiums. Der Festredner hat
Ironie (?) genug, diese Parallele selbst zu ziehen und noch darauf hinzuweisen, dass sich
manche mittelalterliche Herrscher an Reliquien arm gekauft haben (Fuhrmann / Mütherich
1986, 20 ff.).
Millennien und ähnliche Gedenktage sind so die Totemtage von nationalen Gesellschaften.
Diese Feste und Riten haben als Hauptfunktion die Verstärkung des Zusammenhaltes durch
Erinnerung an die gemeinsame mythische Abstammung. Sie dienen also der rituellen
Herstellung von Identität durch die Behauptung einer gemeinsamen langen Tradition. Sie
konstruieren so, nur ganz leicht verschleiert, eine politische Abstammung im mythischen
Gewand, das seine religiösen Ursprünge noch erkennen lässt.7 Nationale Mythen sind auch
nicht von vorneherein aggressiv, wie sich gerade an diesem Beispiel zeigt.
Wenn man also ironisch, ja ein bisschen abfällig von der "mangelnden Feierlust" (Brandstaller 1996, 122) anlässlich dieser historischen Festlegung spricht und meint, das Millennium sei eine "lustlose Pflichtübung" (Löffler 1996, 114), so mag schon sein, dass daran
etwas ist: "Als tiefere Ursache bietet sich Österreichs aktuelle Verunsicherung über den
Fortgang seiner inneren und äußeren Angelegenheiten an" (Brandstaller 1996, 122). Nur
sollten hier auch jene genannt werden, welche diese Unlust spüren oder zumindest äußern:
Es sind die Intellektuellen. Der Großteil der Bevölkerung dürfte trotz tatsächlicher Verunsicherung über die Zukunft, die eigene wie die der österreichischen Gesellschaft, in diesem
Punkt deutlich weniger defaitistisch sein und solche Anlässe weder überschätzen noch mit
7
"Toute fête, alors même qu'elle est purement laïque par ses origines. a ses charactères de cérémonie
religieuse, car, dans tous le cas, elle a pour effet de rapprocher les individus, de mettre en mouvement les
masses et de susciter ainsi un état d'effervescences, parfois même de délire, qui n'est pas sans parenté avec
l'état religieux" (Durkheim 1994, 547).
27
so besonderem Unbehagen betrachten. Möglicherweise nimmt sie das Millennium überhaupt nur am Rand zur Kenntnis. Denn wer sind die Akteure und gleichzeitig die Nutznießer? Die hauptsächlichen Konstrukteure mythisch-ideologischer Konstruktionen des
Nationalismus sind nationalistische Schriftsteller, und ihnen folgen die Historiker.
Es war im deutschen Sprachraum vor allem die romantische Literatur, welche den Aufbau
eines nationalen und bald nationalistischen Mythos begann. Kennzeichnend für die tatsächliche Rolle von Intellektuellen dabei war eines der meistzitierten und heute sicherlich
am wenigsten gelesenen Werke, eine Lyriksammlung, “Volkslieder”: “Des Knaben Wunderhorn”. Dieses Opus ist tatsächlich paradigmatisch für eine kulturnationalistische Interpretation der Tradition und die Funktion von Intellektuellen einer bestimmten Kategorie:
Zwar stammen tatsächlich fast alle Gedichte dieser Sammlung irgendwie aus einer mehr
oder minder fernen Vergangenheit. Doch kaum ein Stück blieb unbearbeitet. Wir haben
also die “alten deutschen Lieder” keineswegs in ihrer Originalfassung vor uns. Sie sind alle
von Achim vorn Arnim bzw. von Clemens Brentano in ihre aktuelle Fassung gebracht
worden. Diese Fassung unterscheidet sich oft drastisch vom Original. Manchmal werden
Gedichte miteinander verschmolzen, manchmal der ursprüngliche Sinn ins Gegenteil verkehrt. Es ist also nicht die authentische Tradition, die zählt. Es ist vielmehr ihre intellektuelle Interpretation. Dies gilt in mehreren Schichten:
(a) Zuerst interpretieren die Herausgeber und schreiben die gefundenen und ausgewählten
Stücke in dem Sinn um, der ihnen zusagt. (b) Dann interpretieren unmittelbar nach dem
Erscheinen einflussreiche Intellektuelle. Goethe etwa kommentiert praktisch jedes Gedicht
in einer Rezension 1806. (c) Schließlich machen sich die “Kärrner” an die Arbeit, die
fleißigen, aber durchschnittlichen Literaturhistoriker; die Lehrer in den Schulen; die Leser
und Distributoren. Was herauskommt, ist Literatur im Ricoeur’schen Sinn, eine Folge von
Texten, welche aufeinander bezogen sind und zusammen die neue Tradition ausmachen.
Gustav Freytag nannte sein literarisches Hauptwerk nach der Gründung des preußischdeutschen Reiches "Die Ahnen", und zur Verdeutlichung setzte er den Untertitel bei: "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" (1872 – 1880). Dort konstruiert er literarisch – im
Englischen wäre der Ausdruck "als fiction" weitaus aussagekräftiger – die Geschichte(n)
der "Deutschen" als Familiengeschichte seit der Römerzeit bis in seine Gegenwart. Wichtig
ist die "Familienstruktur" dieser umfangreichen Episodenfolge, denn diese Bilder-Serie aus
einer angeblichen "deutschen" Vergangenheit wurde nicht als fiction, sondern als authentische Darstellung von Vergangenheit und Gegenwart gelesen. Diese Wirkung, welche das
umfangreiche Werk zu einer Pflichtlektüre insbesondere für Bürgersöhne machte – und die
ganze Art der Darstellung ist durchaus von einem spezifisch bürgerlichen Habitus geprägt
– , machte die Konstruktion erst zum Erfolg. Interessant ist nun, dass das Schema der
Romanfolge in starkem Ausmaß Misserfolg und Opfer darstellt. Bereits im ersten Roman,
jenem aus der späten Römerzeit („Im Jahr 357“ steht über diesem Roman), geht Ingo
letztlich zugrunde, und nur sein kleiner Sohn überlebt. Ähnliches wiederholt sich fast 400
Jahre später, wobei diesmal der Tod des Helden, Ingraban, als christliches Martyrium zusammen mit Winfried / Bonifatius stilisiert wird. Die nächste Episode, 300 Jahre später, ist
ambivalenter, doch bereits die wieder in der nächsten kann sich der Held vor einer (historischen) Frühinquisition nur retten, in dem er sich dem Deutschen Orden zur Eroberung Ostpreußens anschließt. Der Protagonist der Episode aus dem Dreißigjährigen Krieg wird nach
dem Friedensschluss von einem persönlichen Feind samt seiner Frau erschossen, und nur
das Kind überlebt – ähnlich wie in der Ingo-Geschichte. Usw. Kennzeichnend ist schließ28
lich sein neurotischer Franzosenhass. Diese „verhasste Nation“, diese „fremde Nation und
ihr gottverfluchter Kaiser“ (VI, 1880, 210) wird in Ausdrücken benannt, die nur mehr aus
dem manichäisch-religiösen Denksystem abgeleitet werden kann, etwa auch, wenn die
Phrase: „Noch einmal drang der böse Kaiser ins Land … “ ganz offensichtlich in der
biblischen Sprache vom „bösen Feind“, also dem Teufel, ihr Vorbild hat. (Nebenbei: Das
erinnerte an die zeitgenössische politische Sprache jenseits des Atlantiks.) Ganz abgesehen
davon, dass unterschlagen wird, dass die Koalitionskriege fast immer durch Angriffe oder
Kriegserklärungen an Frankreich begannen, liegen hier die Wurzeln jener Haltung, die bereits im preußisch-französischen Krieg, dann aber in großem Maßstab im Ersten Weltkrieg
zu Kriegsverbrechen führten, welche man eher im Zweiten Weltkrieg vermuten würde.
Freytag war damit nicht der einzige Literat dieser Art. Auch Hermann Löns lässt 1910
seinen "Wehrwolf" – man beachte die Rechtschreibung: üblicherweise schreibt man dieses
Fabelwesen "Werwolf" – mit einem kurzen Rückgriff beginnen, welcher die Familie seines
Helden bis zur Schlacht im Teutoburger Wald zurückführt. Nicht umsonst wird Löns wenig
später von den Nazis als ihr Literat hochgejubelt werden.
Nationalistische Rhetorik: Streit um die Zukunft in den Mythen der Vergangenheit - nicht
nur in Österreich (Ausschnitt zu 1100 Jahre Ungarn)
29
Gegen diesen dumpfen Mystizismus sticht markant ein italienisches Gegenstück ab, Lampedusas "Gattopardo". In der Form ebenfalls ein Familienroman, lässt er die italienische
Nation nicht nur beginnen, als sie wirklich eben entstand, nämlich um 1860 herum. Er
führt auch die realen Motive und manche der gar nicht so heroischen Abläufe in einer
analytischen Weise vor, welche diesen Roman und einige seiner Kernstücke zu einem
Fundstück für den Theoretiker des Nationenbaus und für den Interessierten an italienischer
Politik überhaupt macht.
Aus Italien stammt auch ein Stück Literatur, welches über allen Zweifel beweist, dass im Grunde
alles zum nationalistischen Symbol werden kann. Man hat von Silvio Pellicos “Kerkern” (Le mie
prigioni) gesagt, es sei den Habsburgern teurer zu stehen gekommen als eine verlorene Schlacht.
Doch der Leser findet nur eine frömmelnde, oft peinliche Erzählung, deren Autor erklärt, er wolle
die Politik draußen lassen, und dies in aller Konsequenz tut. Das einzige, das man überhaupt
erfährt, ist, dass er wegen “Karbonarismus” verhaftet und verurteilt wurde.
Jede Gesellschaft ist darauf angewiesen, in irgendeiner Form Gemeinsamkeit herzustellen.
Der Symbolname Ostarrichi soll dazu dienen, die nationale Selbständigkeit abzubilden –
und wohl deshalb wenden sich Mediävisten aus der großdeutschen Schule der Zwischenkriegszeit auch gegen entsprechende Gedenktage. Das spricht ein spezifisch österreichisches Muster an: Die Historiker in Österreich verstanden sich bis ins dritte Viertel des 20.
Jahrhunderts überwiegend als Deutsche. Felix Kreissler hat am Beispiel Srbik auf die verhängnisvolle Rolle hingewiesen, welche solche Historiker durch ihre intellektuelle Hegemonie für die „Lebensunfähigkeits“-These gespielt haben. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite besteht darin, dass sie in ihren Konzepten völlig daneben griffen, dass sie, um es
ohne Umschweife auszudrücken, aus ihrem politischen – nationalen – Interesse heraus
schlechte Historiker waren. Ihre persönlichen Probleme waren irgendwo in der Mentalität
des integralen Nationalismus angesiedelt, sie haben diesen jedoch ins Katholische verbogen. Die Charakterisierung, die Srbik von seinem Großvater gibt (zit. bei Fellner 2002,
331), spricht Bände: „vom geborenen Tschechen zum Kulturdeutschen“.
Zum Jahrtausend des ersten Nachweises der Babenberger auf heutigem österreichischen Gebiet
erschien in einem nicht unumstrittenen, aber doch angesehenen Verlag eine Übersichtsdarstellung
(Lechner 1976). Es ist wert, hier in extenso aus der Edinleitung zu zitieren: Der Autor stellt „den
Aufstieg eines deutschen Fürstengeschlechts im Südosten des Reichs … als typisches Beispiel
eines deutschen Fürstentums [dar]. … Eines sei hier abschließend unmissverständlich ausgesprochen: Wir werden diese Mark, dieses Herzogtum, dieses Land nie allein, auf sich gestellt, betrachten dürfen, sondern immer hinein gestellt in ein größeres Ganzes, in die verfassungsmäßige Entwicklung des Römisch-Deutschen Reiches, in die Verbindung mit der deutschen Königs- und
römischen Kaiserpolitik und der Ostpolitik des Reiches, als sein bedeutsames, aber auch stets gefährdetes und umhegtes Grenzland, als seine Mark und späteres Reichsfürstentum sehen. … Mögen hier je nach politischer Einstellung im einzelnen auch Gegensätze gesehen worden sein, mag
die jeweilige Haltung ‚kleindeutsch’, ‚großdeutsch’ oder ‚gesamtdeutsch’ politische Parteiungen
hervorgerufen haben, der Historiker darf sich – abgesehen davon, dass diese Gegensätze heute als
überwunden erscheinen – dadurch nicht beeinflussen lassen. … Wir können auch das immer
stärkere Hineinwachsen dieses Geschlechts und seiner Glieder in die Reichspolitik verfolgen und
nicht – wie politische Tendenzen das manchmal wollten – das Herauswachsen aus dem Reich“ (13
30
und 15). Die teils nationalistischen, teils dynastischen Ideologien aus dem 19. Jahrhundert werden
somit evoziert, um gentil-feudale Geschichte des Hochmittelalters zu erläutern. Der damals weitgehend sinnlose Begriff „deutsch“ kommt in Fülle vor, und der ganze Ductus erinnert an die
Geschichtsschreibung in einem anderen Reich.
Das „Reich“ ist überhaupt ein Begriff, der eine unrühmliche Rolle gespielt hat, und heute, auf
andere Weise wieder spielt, diesmal im angelsächsischen Sprachbereich. In der Zwischenkriegszeit
proklamierte Srbik bereits 1927 ein Drittes Deutsches Reich. Dieses Dritte Reich war zwar nicht
so ganz das Hitler’sche, aber zufällig war die Wortwahl auch wieder nicht. Denn das „Reich“
wurde in der österreichischen Zwischenkriegszeit zu einer geradezu mystischen Kategorie, welche
in etwa der Nation bei integralen Nationalisten entspricht. Österreichische Historiker verstanden
unterschiedliches darunter, je nachdem sie – in ihrer übergroßen Mehrzahl – deutschnational und
„gesamtdeutsch“ orientiert waren, oder zur Außenseitergruppe der katholischen Monarchisten gehörten. Für die Ultramontanen war das „Reich“ eine politisch-religiöse Kategorie, an dem sie ihr
fundamentalistisches Konzept des politischen Katholizismus entwickeln konnten. Für die Deutschnationalen hingegen war es ein Vehikel der Versöhnung zwischen ihren Nostalgien nach einer
„besseren Vergangenheit“ und ihren nationalistischen Neigungen. Der Begriff stand auf halbem
Weg zur Säkularisierung, er sollte eine Sinngebung des langen historischen Ablaufs bieten.
Dass die nationalen Wurzeln in eine entfernte Vergangenheit verlegt werden, ist die Standardtechnik nationalistischer Ideologie, ein allgemein benutztes Verfahren, welches gar
nichts Österreichspezifisches hat. Jedoch, "the process of negotiating such symbols ... is
rarely discussed" (Bendix 1994). Und das ist auch ein Problem an diesem Millennium:
Jubiläen treffen eine Auswahl jener Traditionen, welche man als Symbol in den Blickpunkt
der Aufmerksamkeit stellen will. Vielleicht wird dies anderswo noch deutlicher als in
Österreich: Die Schweiz feiert 1998 150 Jahre Bundesstaat, weiters 200 Jahre Helvetik.
Doch ihre politische Klasse hat sich weitgehend erfolgreich geweigert, ein anderes Jubiläum auch nur anzusprechen, das mindestens ebenso wichtig für den Bestand der Schweiz
ist: 350 Jahre Exemptio ab imperio. Doch die politische Klasse empfindet die Erinnerung
an 1648 und die damalige Verselbständigung der Eidgenossenschaft als nicht opportun in
einer Zeit, wo sie gegen den Mehrheit des Volkswillens vor allem den Anschluss an die EU
anstrebt. So deutlich wird der aktuelle politische Gehalt und der Auswahlcharakter von
Jubiläen auch wieder nicht so oft.
Was bedeutet also das Millennium? Selbstkritisch gestehen die Autoren eines Begleittextes
zur "Österreichischen Länderausstellung" des Jubiläumsjahres ein: "Die Urkunde von 996
ist in der Tat wenig jubiläumsverdächtig. Sie bezeichnet ganz bestimmt kein Datum einer
Staatsgründung... 1996 ist auch nicht Jubiläum einer Landnahme." Was dann? Die Aussage
ist doch wohl: Österreich feiert 1996 tausend Jahre seines Bestehens. Seines Bestehens?
Seines Namens möglicherweise. Das Millennium ist so im besten Fall aus einem Kompromiss geboren, weil man die schärfer konturierten Daten mit ihrem Symbolwert einem Teil
der Bevölkerung nicht zumuten zu können glaubte. Es entstand aus dem Rückgriff auf ein
politisch wie theoretisch überholtes Verständnis von Nation, den Versuch der langen Tradition, der als Herstellung einer nationalen Tradition heute eigentlich nur mehr eine Erinnerung an ein vorwissenschaftliches Stadium sein sollte. Die Autoren des schon zitierten
Textes schreiben weiter: "Es war die junge Zweite Republik, die im Erinnern an 996 einen
historischen Anhaltspunkt für ihr neues Selbstbewusstsein finden wollte. Dieses Österreichbewusstsein setzt sich deutlich von den bis 1945 so überaus starken deutschnationalen
Mustern ab, die die Erste Republik geprägt hatten. Aber der Rückgriff auf 996 und damit
ein kleines Kernland um Neuhofen, aus dem erst später das Land Österreich werden sollte
und noch später ein Staat gleichen Namens, bedeutet auch Distanzierung von der habs31
burgischen Geschichte Österreichs. Er symbolisiert erstmals eine Bejahung der Kleinstaatlichkeit, unter Zurückdrängung aller Großstaat- und Großmachtphantasien, die noch das
Bewusstsein der Österreicher in der Ersten Republik und im autoritären Ständestaat mitgeprägt hatten." Dies ist trotz des Verweises auf die erstmaligen Feiern dieses Jahres zum
950-Jahre-Jubiläum nicht völlig aufrichtig. Zwar war die Möglichkeit gegeben, damals in
dieses neue Jubiläum unterschiedliche Inhalte hinein zu interpretieren – keine unnütze
Tugend vieler nationaler Jubiläen. Doch die Erörterungen sowohl zu den Staatssymbolen
(vgl. 3.2.3) wie auch zum Nationalfeiertag (vgl. 3.3.2) werden zeigen, dass diese
Akzeptanz bei maßgeblichen politischen Kräften eben nicht so eindeutig vorhanden war
und heute erst recht wiederum in Frage gestellt wird (vgl. 4.5.2).
"Welche Wesensdifferenz besteht zwischen einer Versammlung von Christen, welche die
Hauptereignisse im Leben Christi, oder Juden, welche den Auszug aus Ägypten oder die
Gesetzgebung feiern, und einer Zusammenkunft von Bürgern, welcher der Einsetzung einer
neuen moralischen Charta oder irgendeines großen Ereignisses des nationalen Lebens
gedenken?"
Durkheim 1994, 610.
Möglicherweise ist diese Auseinandersetzung um diese subtile Symbolik überflüssig. Es
scheint, als ob die Bevölkerung das Jubiläumsjahr stärker akzeptiert als die intellektuelle
Öffentlichkeit, welche sich vorwiegend äußert. In einer Boulevard-Zeitung – deren
Geheimnis darin besteht, der Stimmung ihrer zahlreichen Leserschaft nachzufühlen und ihr
gegebenenfalls ein wenig auf die Sprünge zu helfen – wird die Entdeckung einer Leserin
viel Platz gegeben, dass die Post schon einmal, 1976, mit einem Satz von Sondermarken
1000 Jahre Österreich gefeiert hat. Dieses Datum, dass jedenfalls historisch sehr viel mehr
Sinn machen würde, wird nun in dieser Ausgabe mit Datum des Nationalfeiertages als
"falsch" und das gerade gefeierte Jahr autoritativ als "richtig" erklärt – dann muss es wohl
so sein. ...
Das widerspricht allerdings einem anderen Eindruck: Nicht zuletzt, aber nicht nur durch
mehrfache Umfragen bei Anfänger-Studenten der Soziologie habe ich den Eindruck
gewonnen, dass die historische Begründung von und das historische Raisonnement um die
Nation zumindest in Österreich in der Tendenz jede Relevanz verliert. Wie jedoch eben
ausführlich dargelegt, hat (Ethno-) Nation seit ihrer Entstehung immer auch in hohem Maß
die „historische Tiefe“ gesucht. Nationalistische Intellektuelle haben behauptet, in Burke’
scher Manier eine Gemeinschaft der Lebenden, der schon Verstorbenen und der noch
Kommenden zu sein. Nation hat ihr Pathos nicht zuletzt aus der behaupteten langen Dauer
bezogen. Geht dieser ideologisch-historische Charakter verloren, so wandelt sich Nation.
Was tritt aber an ihre Stelle? Was bedeutet diese Verkürzung des nationalen Bewusstseins
für die soziale und politische Stabilität? Die Dimension der Gemeinschaftlichkeit für die
Legitimität des politischen Systems – wird sie wirklich überflüssig? Auf diese Punkte
werden wir noch mit Bezug auf die EU zurück kommen.
Möglicherweise bilden diese beiden Feststellungen – die Freude am historischen Jubiläum
in der Bevölkerung und die Skepsis gegenüber dem überkommenen Pathos an der Gemeinschaft bei Studenten – gar keinen Widerspruch. Die Leserschaft des Boulevards, wie er von
der „Krone“ repräsentiert wird, ist im Schnitt alt. Es könnte einfach ein Generationenunter32
schied sein. Dann stellt sich die Frage, ob dies nur einen Alters-Effekt oder aber einen
Kohorten-Effekt darstellt. Verständlicher: Ob die heute jungen Studenten beim ÄlterWerden schließlich wieder in ein „historisches Bewusstsein“ hinein wachsen. Aus ähnlichen Überlegungen und Untersuchungen würde ich vermuten, dass der Kohorten-Effekkt
ausgeprägt sein dürfte, dass sich also ein realer Wandel im Nations-Bewusstsein abzeichnet. Dann aber sind die Fragen des vorigen Absatzes wieder relevant.
1.1 Intellektuelle – Begriffsklärung
Gesellschaft ist ein Kommunikationsverbund. Geistesgeschichte ist daher immer Kommunikationsgeschichte. In lokal und regional beschränkten Kleingesellschaften sind die
Teilhaber dieses Kommunikationsprozesses tatsächlich alle Mitglieder der Gesellschaft.
(Hier gibt es allerdings sofort Probleme, wenn wir die Kategorie Geschlecht vernachlässigen, die in diesem Punkt einen Qualitätsunterschied zu markieren scheint.) Großgesellschaften hingegen – und Nation ist eine staatlich organisierte Großgesellschaft – können
nur entstehen und sich erhalten, wenn die sich differenzieren. Auch die Kommunikation
durchläuft einen solchen Differenzierungsprozess. Kommunikation wird also zur Aufgabe
bestimmter Personengruppen, wie auch spezifische Aufgaben der Kommunikation, die
Reflektion über Sinngebung etwa.
Damit ist aber auch die Problematik des Einzelnen angesprochen. Elie Kedourie (1986 [1960])
stellt uns in seinem bekannten Werk zum Nationalismus Kant als den Schöpfer einer Ideologie der
Selbstbestimmung vor. Der Intellektuelle hebt den Intellektuellen in den Rang des artifex. Es soll
keineswegs bestritten werden, dass die eigentliche Leidenschaft der Intellektuellen die Strukturgestaltung ist. Man kann aber mit gutem Recht die Betrachtungsweise umdrehen. Kant wie auch
andere seiner Zeitgenossen brachten eine Hauptströmung des allgemeinen intellektuellen Diskurses ihrer Zeit zum Ausdruck. Dem Mentalitätswandel der beginnenden Moderne entsprach der
Individualismus. Nun ist aber weiter dazu zu sagen: Die Sichtweise vom einzelnen Intellektuellen
her ist durchaus auch berechtigt. Es ist der Einzelmensch der denkt und raisonniert, nicht der
„Weltgeist“ oder der Nationalgeist. Allerdings muss man sich der strukturellen Bedingungen und
Voraussetzungen bewusst sein, und hier mangelt es meist bei denen, welche diese Art von
Ideengeschichte betreiben. Die strukturelle Voraussetzung aber war für Kant zum einen eine
Jahrhunderte, ja Jahrtausende alte Tradition der Weltbewältigung in einer ganz spezifischen
Begrifflichkeit; zum anderen aber auch die neue Interpretation dieser Begrifflichkeit im Rahmen
neuer gesellschaftlicher und politischer Anforderungen und Prozesse.
Kommunikation wird in arbeitsteiligen, machtstrukturierten Gesellschaften asymmetrisch,
weil sie entlang von Herrschaftsbeziehungen abläuft. Es wird also mehrere soziale Netze
mit unterschiedlichen kommunikativen Beziehungen geben. Die lokalen / regionalen Netze
bleiben bestehen. Über ihnen werden sich aber auch weitere, gesamtgesellschaftliche Netze
bilden. Eine moderne, nationale (d. h.: überregionale) Gesellschaft kennzeichnet sich u. a.
dadurch, dass die überregionalen Netze auf eine spezifische Weise mit den lokalen / regionalen verknüpft sind. Für den sogenannten Universalismus traditionaler Intellektuellen in z.
B. feudalen Gesellschaften hingegen ist kennzeichnend, dass ihre Verbindung mit den
lokalen Netzen gewissermaßen zufällig und nicht "organisch" (notwendig für die Systemerhaltung) waren. Dabei ergeben sich es Probleme, auf die wir im Einzelnen hier nicht
eingehen können (Geistliche und ihre Beziehung zur Kirchenhierarchie).
Antonio Gramsci verwendet dementsprechend den Begriff des "Intellektuellen" i. S. von
Personen mit maßgeblichem Einfluss auf die kulturelle und die politische Entwicklung. Sie
geben im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung die kulturellen Codes und damit
das entscheidende Symbolsystem der Gesellschaft vor. Ihre eigentliche Aufgabe ist der
33
Aufbau von Hegemonie. Intellektuelle sind also nicht sosehr durch eine spezifische Tätigkeit gekennzeichnet, als vielmehr durch eine Funktion (Gramsci 1975, 1516). Da Gesellschaft und Struktur sich im Bewusstsein der Menschen konstituieren, sind Intellektuelle als
die professionellen Entwickler und oft auch Verwalter (wörtlich stimmt letzteres für Lehrer) der maßgeblichen Begriffe, d. h. der “Wahrheit”, für die Frage mitentscheidend, wie
sich diese Struktur konkret darstellt. Hegemonie ist nichts anderes als der erfolgreiche Aufbau solcher struktureller “Wahrheiten”. Dass es immer einen oder vielmehr viele Konflikte
darum gibt, sollte selbstverständlich sein. Erstaunlicher ist schon eher das Gegenteil: Dass
nämlich Intellektuelle sich in der Regel sehr wohl auf hegemoniale Grundbegriffe und
mentale Grundstrukturen verständigen, innerhalb derer dann ihre Auseinandersetzung vor
sich geht.
Inhaltlich und hinsichtlich der von ihnen vertretenen Interessen werden sie durchaus auf
unterschiedlichen Standpunkten stehen. Sie können z. B. antikapitalistisch-revolutionär,
prokapitalistisch-apologetisch, oder aber reformistisch sein. Als Gruppe sind sie funktional
für die Systemerhaltung, da sich unter ihnen jene längerfristige Diskussion, jenes soziale
“Probehandeln” abspielt, welches über die unmittelbaren Interessen der gerade dominanten
Schichten hinausgeht. In diesem Sinn stellen sie einen braintrust der Gesellschaft dar, der
allerdings weniger technisch, als vielmehr ideell bzw. ideologisch orientiert ist. Es gibt
einen ständigen Kampf um die Hegemonie, bei denen die erfolgreichen Intellektuellen
immateriell, aber auch materiell viel gewinnen können. Intellektuelle sind eine Gruppe,
welche im Rahmen eines Standard-Curriculums ein ihnen gemeinsames Begriffs- und
Argumentationssystem, nämlich “Bildung” nach einem bestimmten Kanon,8 und damit
einen entsprechenden Kommunikationsstil erhielten. “Bildung” ist vor allem die Fähigkeit,
sich in den ideologischen Komplexen der eigenen Zeit geläufig und gewandt zu bewegen.
In diesen Zusammenhang gehört auch der Begriff des “Werkes”. Die Bedeutung eines
“Werkes” hängt nicht in erster Linie von seinem intrinsischen Wert ab. Der entscheidende,
und auch ästhetisch entscheidende Punkt ist, ob es angenommen wird und damit weiter
wirken kann – heißt doch aisthesis nichts anderes als Wahrnehmung. Das Argumentationssystem wiederum schlägt sich vor allem in einem bestimmten Jargon nieder, der
teilweise modeorientiert ist und am ehesten das wiedergibt, was man oft “Zeitgeist” nennt.
Dabei wird es je nach Subkultur natürlich unterschiedliche Ausdrucksweisen geben.
Ideologische Komplexe gibt es eine ganze Anzahl, und sie bzw. ihre Vertreter, konkurrieren um die Hegemonie. Das betrifft sowohl die Inhalte, als auch die ihnen assoziierte
Stile, Darstellungsweisen und Diskursformen. Im Übergang von der Klassik zur Romantik
etwa gab es die Konkurrenzsituation des biblisch-religiösen, des klassisch-antiken, und des
frühnational-historischen Komplexes. Der erste ist in Europa nahezu verschwunden, dafür
kam ein szientistisch-naturphilosophischer sowie ein individualistisch-psychoanalytischer
dazu. Jeder dieser Komplexe bedeutete den Hegemonieanspruch bestimmter Schichten,
8
“Zum sozialen Zusammenhang einer Gesellschaft gehört so etwas wie ein Bildungskanon. Sonst können wir
gar nicht miteinander kommunizieren”, meint der deutsche Bundestagspräsident Thierse (NZZ, 27./28.
Feber 1999: Ein Haribo von Goethe. Die Zukunft des Zitierens). Die Gestaltung dieses Kanons für alle
obliegt nun den Intellektuellen, und nicht zuletzt an diesem Kanon spielt sich der Kampf um die
Hegemonie ab. Gerade die erbitterte Auseinandersetzung in den USA um “European Studies” oder
“African Studies” zeigt dies besonders klar. Dazu kommt für Intellektuelle die Meta-Ebene ihres eigenen
schicht- und funktionenspezifischen Kanons.
34
wobei teils Überschneidungen stattfanden. Uns wird in Hinkunft vor allem der nationalhistorische sowie die letzteren zwei interessieren.
Dazu kommt, dass es bestimmte nahezu standardisierte Themen als Ausdrucksmittel gibt.
In der Zeit, von der wir eben sprachen, war etwa im deutschen Sprachraum der “Künstler”
das beliebte Selbstbild des Intellektuellen. Der nichtetablierte Kleinbürger mit seinem
gegenüber der bisherigen Gesellschaft devianten Lebensstil stilisierte sich als Künstler, d.
h. als ein besonders “Begabter” und wollte damit von vorneherein eine Legitimation für
seine Aspirationen besitzen. Er grenzte sich aufs heftigste gegen den „Philister“, den Kleinbürger, ab. Der gewöhnliche Mensch muss sich vor allem um seinen Lebensunterhalt
kümmern, und er tut dies nicht zuletzt, in dem er die Strukturen der Gesellschaft bejaht und
sich in ihren Werten einrichtet. Damit erscheint er dem Dichter als ein Mensch ohne
Transzendenz und ohne Vision, im besten Fall lächerlich, im schlimmeren der Feind. Die
sogenannten Entwicklungsromane dieser Zeit sind Künstlerromane, ob dies „Wilhelm
Meister“ (Goethe), „Heinrich von Ofterdingen“ (Novalis), oder aber „Der Goldene Topf“
(E. T. A. Hoffmann) ist. Gesellschaftskritik wurde hier zur Kunsttheorie. Es spielt eine
Portion Weltflucht mit, wie gerade aus diesen Romanen zu erkennen ist, aber es ist erstrangig ein platonischer Machtanspruch. In Frankreich und in England derselben Zeit war
dieses Bild kaum verbreitet, wiewohl der Machtanspruch dort nicht weniger gestellt wurde.
In Mitteleuropa hat es für Teile der Intellektuellen bis heute etwas von seiner ehemaligen
Faszination behalten.
Zu den Intellektuellen gehören Intellektuelle im Alltagssinn, d. h. eine sich durch hohe
formale Bildung legitimierende Gruppe mit der Absicht öffentlicher Intervention. Formale
Bildung grenzt sie von Autodidakten ab, die selten die Selbstverständlichkeit des intellektuellen Diskurses als Habitus erwerben, da dies ein langes Training in einem entsprechenden Alter erfordert. – Dazu gehören in einem weiteren Sinn auch Journalisten, auch
wenn hier aus pragmatischen Gründen der Großteil auszuklammern ist und lediglich einige
bekanntere Namen, die sich aus den einen oder anderen Gründen durchsetzten, zu nennen
sind. Damit sollte klar sein: Das Wort "Intellektuelle" ist kein Werturteil. Zu den Intellektuellen gehören auch politische Führungspersönlichkeiten, wenn sie das Kriterium der
Geschichtsmächtigkeit erfüllen. Das heißt andererseits aber auch: Dazu gehören keineswegs von vorneherein Spitzenpolitiker, die oft genug zwar große tagespolitische Ausstrahlung haben, jedoch historisch-praktisch spurenlos bleiben. Näher an den üblich verwendeten Begriff heran rückt die Bezeichnung "Sinnproduzenten".9 Allerdings kommt dies
analytisch in die Nähe des wesentlich weniger geschätzten Begriffes des "Ideologen". Der
weitere Begriff ist jenem der "Elite" sehr ähnlich; doch wollte Gramsci mit seiner
Konzeptualisierung gerade den elitistischen Charakter dieses Begriffes vermeiden.
Da Intellektuelle in einem ständigen Kampf um die Hegemonie begriffen sind, müssen sie
eine Schlüsselrolle im Aufbau von Nationen spielen, der doch vor allem ein Kampf um
eine spezifische Legitimierung des politischen Systems ist. Die Politik der Moderne, dass
ist das Drama der Intellektuellen, im übertragenen und oft auch im wörtlichen Sinn. Es war
9
Heinz Abosch, Zwischen Denken und Demagogie. Die schwierige Intelligenz. NZZ, 29. Mai 1995. Shils (zit.
bei Dahl 1989, 333) definiert Intellektuelle folgend: “Intellectuals are the aggregate of persons in any
society who employ in their communication and expression, with relatively higher frequency than most
other members of their society, symbols of general scope and abstract reference, concerning man, society,
nature, and the cosmos.”
35
vor allem das Drama von Nationalisten und Sozialisten. In wesentlich geringerem Maße
traf dies auf die Konservativen zu, auch auf die christlich-demokratische Schattierung.
Gerade diese pflegte oft einen ziemlich kruden Anti-Intellektualismus. Denn das eigentliche Drama der Intellektuellen besteht im Wandel, in seiner mentalen Erfassung und
Verarbeitung, im Versuch, ihn zu gestalten. Niemand hat dies deutlicher zum Ausdruck
gebracht als Karl Marx in seiner 11. These über Feuerbach: Es kommt darauf an, die Welt
zu verändern. Das aber war es gerade, was die Konservativen nicht wollten. Trotzdem:
Auch auf sie wirkte politische Macht wie ein Narkotikum.
Tatsächlich könnte man Nationalismus als eine Ideologie von Intellektuellen auf dem Weg
der Modernisierung bzw. beim Aufbau des modernen Staates kennzeichnen. „“In Europa,
wo die nationale Idee geboren wurde, waren die Intellektuellen, und insbesondere die
Historiker die Hohen Priester der nationalen Ideologien“ (Schnapper 2003, 35). Das gilt für
das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nationalismus ist heute – um dies vorweg
zu nehmen – nicht mehr die Ideologie modernisierter Menschen. Das intellektuelle Gepäck
dieser frühen Modernisierer bestand weitestgehend in politischem Klassizismus. Die Inhalte waren bestimmt durch einen halbierten, oft aber durch radikalisierten (Rousseau!)
Individualismus. Die Form war ebenso wichtig. Sie bekam ihre Gestalt durch den Bezug
auf antikes Schrifttum, auf griechische und vor allem lateinische Klassiker in Prosa und
Dichtung. Selbstverständlich ging dies nicht ohne Widersprüche. Langsam wechselte man
zudem in das Lager nicht nur der Privilegierten, sondern sogar der Herrschenden. Das ging
Hand in Hand mit der Stärkung askriptiver Züge in der Ideologie. Der Endpunkt war die
“Rasse”: Analytisch ist dies Askriptivität in Reinkultur, und zwar auf einer wertenden
Skala, die im Grunde auf eine Dimension nichtmenschlich – menschlich aufgespannt ist.
Doch schon in ethnischen Zusammenhängen spielen traditionale Intellektuelle des jeweiligen Kulturhorizontes eine bedeutende Rolle. Man bekommt tatsächlich den Eindruck, daß
soziale Identität als politische Kategorie vor allem ein intellektuelles Anliegen ist, wenn sie
über die selbstverständliche Alltagsidentität hinausgeht – letztere ist für alle Menschen
unabdingbar erforderlich, weil sie nichts als der Ausdruck intelligiblen Menschendaseins
ist. Als bewusstes Bedürfnis leitet sich diese Frage der Intellektuellen von der, schon bis
ins karikaturhafte ausgewalzten Fragestellung ab: “Wer sind wir? Woher kommen wir? ...“
In nationalen Kontext kommt dazu jedoch die Frage der Macht und ihre Legitimation.
Warum sollte es einem Einzelmenschen eigentlich ein Anliegen sein, dass “China stark ist”
(Sun Yatsen 1974, 73 ff.)? Warum sollte er “stolz” sein, ein Deutscher / Österreicher / usw.
... zu sein? Von einem individualistischen Standpunkt, jenem, den Intellektuelle sonst
bevorzugt einnehmen, wäre es wesentlich rationaler, selbst stark und reich sein zu wollen,
auf sich selbst und seine Errungenschaften stolz zu sein. Wenn ich mich allerdings sehr
stark mit einem Kollektiv identifiziere, bekommen diese Haltungen allerdings auch eine
gewisse Rationalität. Die Frage verschiebt sich dann: Warum identifiziere ich mich so stark
mit einer abstrakten Kategorie, sodass dies entscheidend für meine eigene Identität wird?
Lassen wir einmal die Diskriminierung, das Minderheitendasein beiseite, wo ich in eine
solche Identifizierung von außen hineingedrängt werde. Jenseits dieser aufgedrängten
Identität gibt es vor allem zwei Gründe für eine politische Identifizierung dieser Art: 1) Ich
will die Gruppierung “vertreten” in einem Weber’schen Sinn, d. h. sie führen. Damit wird
erhöhtes Prestige aus der sozialen Kategorie insgesamt auch unmittelbar mein eigenes
Ansehen erhöhen. 2) Als Intellektueller ist man gewöhnlich zu einer hohen Abstraktionsleistung befähigt. Dazu werden sie erzogen und sozialisiert. Das kann jenseits der reinen
Machtambitionen durchaus auch die Fähigkeit erhöhter Empathie bedeuten. Doch auch
36
diese Mitmenschlichkeit wird einen Gestaltungswillen umfassen. – Der Unterschied
zwischen diesen intellektuellen Identifizierungen und dem “Abfahrtslaufnationalismus”
vorzugsweise von Unterschichten besteht im wesentlichen in der politischen Dimension,
die beim Intellektuellen zum aktiven Machtanspruch führt, und der stärker sozial
charakterisierten Form der Alltagszugehörigkeit.
Intellektuelle versuchen ihre nationale Rolle als Träger einer "nationalen Kultur" zu legitimieren. Nun wissen wir mittlerweile: "Kultur" dient in aller Regel als ein Deckbegriff für
politische Verhältnisse, die nicht ausgesprochen werden wollen (vgl. Reiterer 1996). Wir
werden in der Folge sehen, dass die Berufung auf Kultur gerade auch im Aufbau der österreichischen Nation eine wesentliche Rolle spielte. Doch hat es überhaupt einmal eine nationale Kultur gegeben, dann war sie immer das ideologische Leitbild von Intellektuellen,
welche ihre eigene kulturellen Zielvorstellungen zu den hegemonialen machten und diese
"national" nannten. Das ist übrigens das Spiegelbild von Nation schlechthin in einem
bestimmten Stadium (vgl. unten), eine ziemlich allgemeine Erfahrung, und keineswegs,
wie es deutsche Nabelschau nach dem Zusammenbruch des Ostens und dem Anschluss der
DDR and die BRD gerne meint, eine deutsche Spezialität (Giesen 1993, 9: “... die Intellektuellen als Erfinder der deutschen Identität”). Als erfahrbare Realität war sie vor dem Zeitalter der Massenpartizipation auf die Intellektuellen und die ihnen angeschlossenen Gruppen beschränkt. Die Propagierung der Hochkultur – die ihn ihren Inhalten seit Jahrhunderten in Europa keineswegs regional, sondern kontinental war und heute international ist –
als Nationalkultur ist nur ein Ausdruck der bekannten nationalen Dialektik: National in der
Form, international im Inhalt.
In der Auseinandersetzung mit dem Phänomen Nation hat der Begriff der "geschichtslosen
Völker" eine unrühmliche Rolle gespielt. Geprägt von Hegel (1995), der als Ideologe der
Herrschaft darunter Völker ohne Staat verstand, wurde er durch Engels prominent, der
Hegel für einen “grundgelehrten Kopf” hielt. Interessanterweise scheint es übrigens keine
"geschichtslosen Ethnien" zu geben, wenn man die bezügliche Literatur ansieht. Im Grunde
geht es beim Begriff der "Geschichte" in diesem Zusammenhang um den bewussten Aufbau
einer Legitimationstradition. Nationen als politische Projekte brauchen diesen Aufbau,
nicht aber Ethnien als identitäre Einheiten. Damit löst sich dieser scheinbare Widerspruch denn gerade Ethnien leben aus der Kontinuität - auch schon auf. Es geht um unterschiedliche ideologische Prinzipien, welche von unterschiedlichen sozialen Gruppen verwirklicht werden. Nation braucht eine nationale Intelligenz als ausdifferenziertes Schichtsegment, als Teil eines nationalen Bürgertums. Großethnien, zu Großgesellschaften verschmolzene lokale ethnische Gruppierungen brauchen natürlich auch eine Elite. Aber das
können nach gesellschaftlicher Entwicklungsphase ganz unterschiedliche Personen oder
Gruppen sein. In vormodernen Phasen sind dies möglicherweise Chiefs, Geistliche, Kleinadelige (aber nie höfische Adelige – vgl. Raeff 1993). In der Moderne werden auch ethnische Einheiten gewöhnlich von einer bürgerlichen Intelligenzschicht dominiert. Der Prozeß
der Modernisierung ist geradezu gekennzeichnet vom Aufbau einer Konkurrenzelite, die
aus Intellektuellen besteht. Sie werden sich bewusst sehr stark von der traditionellen Elite
abzuheben versuchen. Das nimmt nicht selten sogar die Form eines Kampfes um das
Aussehen an: Im Südsudan verzichten die “schoolboys”, die “bull-boys”, bewusst auf die
Zeichnung mit den Narbenmustern im Prozess der Initiation, die sie als Angehörige ihres
spezifischen Volkes kennzeichnet. Mit diesem Verzicht auf die Initiation stellen sie die
37
bisherige Struktur ihrer Gesellschaft in Frage: Ihr Speer ist das “Papier” von Verwaltung
und formalisierter Bildung Sie setzen also Intellekt und politisches Geschick10 gegen die
körperzentrierten Tugenden der bisherigen Gesellschaft. – Freya Stark (1992) wiederum
beschreibt die “Effendies” der arabischen Welt als die Intellektuellenschicht, die nach Ablösung der alten Elite strebt. Sie konnten sich dort allerdings bisher nicht gegen eine andere
neue Konkurrenzelite durchsetzen, nämlich die Militärs.
Was unterscheidet die ethnische von der nationalen Elite? Es ist der bürgerlich-moderne
Staat, in dem sie situiert sind – in der Vormoderne existiert er nicht. In der Moderne ist er
nicht der zentrale Focus allen Bestrebens der ethnischen Elite, insofern diese im Unterschied zu nationalen Eliten nur beschränkte Ambitionen mit meist regionalem Bezug hat.
Um die Unterschiede in der Begriffsbildung und ihre Folgen zu erläutern, genügt eine Beobachtung in einem Einzelfall: Im Sommer 1972 starben annähernd zur selben Zeit der ehemalige
Bundeskanzler Gorbach und Ernst Fischer. Kennzeichnenderweise war etwa der NZZ damals der
Tod des österreichischen Alt-Bundeskanzlers nur eine kurze Notiz von ein paar Zeilen wert; Ernst
Fischer dagegen, der sich in seinen letzten Lebensjahren als KP-Dissident profiliert hatte, wurde
auf derselben Seite in einem langen Nachruf gewürdigt.
Zwischen Politikern und Intellektuellen gibt es jene "Expertenkonkurrenz", von denen
Berger / Luckmann (1969, 134 ff.) sprechen. Wir dürfen vielleicht die weiteren Ausführungen dieser Autoren nicht ganz zum Nennwert nehmen: Intellektuelle sind sicherlich aus
der Sicht der Politiker oft genug "unerwünschte Experten", weil sie Konkurrenten um die
Macht, potentielle Gegeneliten sind. Sie jedoch "gesellschaftliche Randexistenzen" zu
nennen, ist eher ein Ausfluss aus der Selbststilisierung, die viele Intellektuelle – nicht
zuletzt in Österreich (vgl. später) – für nötig halten: Sie wünschen, mit dem Pathos des
Tragischen und des Leidens ihre eigene Bedeutung zu steigern, indem sie sich bewusst
oder unbewusst in die christliche Tradition der Erlösung durch Leiden stellen. (In
moderneren, oft auch zynischen, entsäkularisierten Zusammenhängen tritt das Happening
an die Stelle des Erlöser-Leidens.) Die Konkurrenz zu den Politikern besteht allerdings
zumindest teilweise. Sie ist Ausdruck einer größeren Autonomie des Intellektuellen
gegenüber jener der Politiker, wobei diese Autonomie durchaus nicht immer genutzt wird.
Intellektuelle müssen sich dem "Sachzwang" in doppelter Hinsicht weniger strikt
unterwerfen als Politiker: Sie haben die Freiheit, über die gegenwärtigen strukturellen
Gegebenheiten (die jedoch auch sozial und politisch geschaffen sind, oft vor durchaus
kurzer Zeit) weiter hinaus zu denken und damit diese Strukturen selbst zu transzendieren.
Sie unterliegen weiters nicht denselben gruppenpsychologischen Zwängen, die Politiker
aufgrund ihrer Solidarität zur Gruppe, welche ihnen ihr Amt verschuf, empfinden.
Vielleicht noch wichtiger ist: Intellektuelle unterliegen nicht den politisch-administrativen
Rekrutierungsverfahren, sie bewegen sich außerhalb dessen. Genauer gesagt: Das
Rekrutierungsverfahren von Intellektuellen unterliegt anderen Kriterien, ist wenig
formalisiert und in seinem Ablauf auch oft genug schwer durchschaubar und schwer
nachvollziehbar. Bürokratien - und Politiker sind in Normalzeiten eine Unterklasse davon –
mit ihren extrem formalisierten Routinen können solche Vorgänge nur mit größtem
Misstrauen betrachten und sie als Bedrohung ihrer übersichtlichen Welt auffassen. Sie
denken dabei, wie es ein Intellektueller, der selbst einen Abstecher in die Politik machte
und dabei gründlich scheiterte, formuliert hat: Manche Intellektuelle entwickelten im
10
“The government is divinity” – Hutchinson 1996, 297.
38
Kapitalismus als mögliche Gegenelite “a vested interest in social unrest” (Schumpeter
1975, 146).11
Der Elitenpluralismus ist allerdings eine allgemeine Erscheinung des Nationenaufbaus,
keine österreichische Spezifität. Es geht eben immer um die Frage, was eben die legitimen
Grundlagen von Herrschaft sind. Unterschiedliche Programmentwürfe haben auch
unterschiedliche Gewinnsituationen für verschiedene Elite-Gruppen zur Folge. (Besonders
ausgeprägt ist dies sicherlich in den neuen Nationen der Dritten Welt, wo nicht zuletzt die
Frage der Einordnung in die Weltordnung zur Debatte steht, s. u.).
Wie nun methodisch "Intellektuelle" ausgewählt und von "Nicht-Intellektuellen" getrennt
werden, ist ein pragmatisches Problem. In dieser Arbeit wurde es einfach dahingehend
entschieden, dass jede kohärente öffentliche Wortmeldung in einer nicht spezifisch beruflichen Angelegenheit einen Intellektuellen definiert. Wenn der Bundeskanzler in einer
Regierungserklärung, einer Pressekonferenz oder in einem Interview eine Aussage macht,
so ist dies die Aussage des Regierungschefs. Schreibt Dr. Franz Vranitzky einen Artikel in
der "Zukunft" bzw. lässt er unter seinem Namen einen schreiben, so hat sich hier ein
"Intellektueller" geäußert.
1.1.1 Intellektuelle und 'Universalismus'
Überall in hochkulturellen Entwicklungen versuchte man, innerhalb eines gegebenen
Kulturkreises für Intellektuelle und Oberschichten einen "Universalismus", d. h. nichts
anderes als einen einheitlichen Bezugsrahmen auch in der Sprache durchzusetzen. Dieser
Universalismus war sehr relativ und beschränkt. Die Rolle des Lateins ist so bekannt, daß
es zum Topos dafür geworden ist. Doch die Sprache war nur der Ausdruck für ein
bestimmtes teleologisches, "ökumenisches" Geschichtsverständnis: Wie bei den antiken
Schriftstellern die ganze Geschichte auf das Imperium Romanum hingearbeitet war, so
dann im Mittelalter auf das, was man Christentum nannte und den westeuropäischen
Kulturkreis ausmachte. Dieser Art des Universalismus wurde in schon etwas säkularisierterer Form wenig später, allerdings in etwas anderen Schichten (Aristokratie, Diplomatie)
vom Französischen verkörpert. Die heutige Tendenz zur Mondialisierung, die nicht zuletzt
eine Durchsetzung des okzidentalen Modells ist, hat ihren sprachlichen Träger im Englischen gefunden. Die geistige Abstammung ist ein wenig kompliziert.
Humanismus und schon viel weniger Renaissance waren eine Übergangserscheinungen. Auf der
einen Seite polemisieren die neuen Intellektuellen schon gegen das korrupte und verdorbene
Mönchslatein, und damit im Grunde gegen eine ihnen nicht mehr adäquat erscheinende Lebensund Denkform. Sie streben danach, ein besonders gutes, "reines" Latein in Anlehnung an die
goldene und silberne Latinität wieder herzustellen. Sie sehen darin die wahre Kultur und die wahre
Universalität verkörpert. Nicht zuletzt dies eröffnete eine auf die Intellektuellen beschränkte
Epoche, die ein halbes Jahrtausend dauern sollte, und nicht nur ideologisch die Grundlagen
westeuropäischer Identität bildete. Die Kirchensprache war zur säkularen Intellektuellensprache
geworden. Die Auflösung dieser engen und konservativen westeuropäischen Identität spiegelt sich
wiederum in der weiteren Entwicklung beim Gebrauch des Lateins. Bis vor wenigen Jahrzehnten,
11
In ihrer Verallgemeinerung ist diese Schumpeter’sche Aussage so grob, dass sie falsch genannt werden
muss. Was ist z. B. mit ihm selbst? Derart plakative Behauptungen sind nicht hilfreich für eine Analyse.
Denn der größere Teil der Intellektuellen ist mit Sicherheit sehr systemkonform. Es ist kennzeichnend,
dass er in späteren Teilen dieses Buches immer wieder glaubt, qualifizieren zu müssen, indem er einen
Teil der Intellektuellen mit dem Wort “responsible” belohnt. Die Gramsci’schen Ansätze mit ihrer
Differenzierung sind mit Abstand fruchtbarer.
39
in einzelnen Gebieten bis vor wenigen Jahren wurde tatsächlich Latein noch als Sprache des
kirchlichen Apparates und auch als Erziehungssprache des priesterlichen Nachwuchs (in den
"Seminarien") eingesetzt. Und heute schließlich ist diese Sprache noch immer das (bildungs-)
stilbildende Merkmal einer konservativen Gruppe in vor allem zentral- und südeuropäischen
Mittelschichten. Die westeuropäische Super-Ethnizität bedarf dessen nicht mehr. Doch ist der
schichtenspezifische kulturelle Anspruch auf "den feinen Unterschied" (Bourdieu) noch immer
stark genug, um die "lateinische Kultur" z. B. für die Abgrenzung gegen Osteuropa einzusetzen.
Wir sprachen eben von der Rolle des Lateins für die Identität Westeuropas. Südost- und Osteuropa
hat ähnliche Traditionen. Das hellenistische Griechisch und das Kirchenslawische spielten dort
strukturell eine ähnliche Rolle. "Damit die Einheit der Sprachmittel (antike Zitate und
Neubildungen in einem einzigen Satz) erhalten blieb, wachte auch die Kirche über die Reinheit der
Hoch- und Kunstsprache, die letztlich noch das hellenistische Griechisch der Koiné war und
wiedersetzte sich dem Einfluss der Volks- und Umgangssprache" noch im 10. und 11. Jahrhundert
(Belting 1991, 298). Sie schuf eine gemeinsame Identität für außerordentlich dünne Schichten, die
sich selbst zu Recht als überlokal und -regional definierten. Dies ist die eigentliche Bedeutung der
"Universalität" des Lateins im westeuropäischen Mittelalter (von der – missverstanden –
Andersons 1983 ganze Argumentation der "nationalen Fragmentation" lebt).
Mit einem riesigen Schritt gehen wir jetzt ins 19. Jahrhundert. Der Universalismus der
Intellektuellen drückte sich jetzt nicht mehr in der gemeinsamen Bildungs-Sprache aus. Es war
eher ein gemeinsamer Rekurs auf einheitliche theoretische Vorstellungen, welche sich erheblichst
von den Alltagsorientierungen nichtintellektueller Volksschichten unterschieden. “Philosophie” als
damaliger Begriff für Theorie bildete die gemeinsame Grundlage für Intellektuelle
unterschiedlichsten Typus’, von jenen, die sich auf “Besitz und Bildung” beriefen bis zu den
Revolutionären, die im Namen eines bestimmten Zieles der Weltgeschichte auftraten. Unter diesen
Gruppierungen erlangten bald jene Hegemonie, die sich um den Begriff der Nation sammelten.
1.1.2 Beamte und Bürokratie
Es gibt eine Gruppe, deren Rolle gesondert betrachtet werden muss. Wenn man im 19.
Jahrhundert zu Beginn der parlamentarischen Vertretungen von "Besitz und Bildung" als
den Fakten sprach, welchen politische Partizipation gewährt werden sollte, da war "Besitz"
eindeutig als die klassische Bourgeoisie zu identifizieren. Ein bisschen unklarer ist für uns
heute die soziale Identifizierung der "Bildung". Für die Zeitgenossen dürfte es hingegen
ziemlich klar gewesen sein, dass der Hauptharst dieses Pfeilers die Beamtenschaft im weiteren Sinn darstellte. Und doch müssen wir mit einer gewissen Verwunderung feststellen,
dass wir die Beamten kaum in die aktiv nationalisierenden Schichten12 und nicht in den
Begriff des Intellektuellen aufnehmen können. Doch erschienen sie durch ihre soziale und
politische Funktion geradezu prädestiniert für eine solche Rolle. Wie erklärt sich dieser
Widerspruch?
Wir haben bereits dargelegt, wie Nation aus zwei antiparallelen Prozessen entsteht, aus
Staatsaufbau einerseits und ethno-nationaler Vereinheitlichung mit dem Ziel einer gemeinsamen nationalen Identität andererseits. Nationenbau ist eine revolutionäre Angelegenheit.
Doch diese revolutionäre Phase setzt auf der traditionalen Struktur der Ethnizität auf. Sie
ändert in der Folge die sozialen und politischen Verhältnisse der betroffenen Gesellschaft
12
Bismarck spricht allerdings in seinen Erinnerungen (1998, I, 62) von den „Sympathien der [preußischen]
der höheren Beamtenschichten theils für die liberale, theils für die nationale Seite der Bewegung“, fügt
allerdings hinzu: „ein Element, das ohne einen Impuls von oben wohl hemmend, aber nicht tatsächlich
entscheidend in’s Gewicht fallen konnte“ [nämlich für die aus seiner Sicht versäumte radikale
Niederschlagung der Revolution].
40
von Grund auf. In diesem Sinn kann Nationenbau als eine Facette der bürgerlichen Emanzipationsbewegung gesehen werden. Das hat zur Beachtung jener Akteure geführt, welche
die revolutionäre Seite verkörpern. So fiel der charismatische Führer ins Auge, denn
Charisma ist eine der wichtigen umstürzlerischen Faktoren in der Geschichte. Ein Akteur
geriet bisher kaum ins Blickfeld der Aufmerksamkeit. Doch wenn wir das politische
System in den Vordergrund stellen, kann man die Bürokratie kaum überschätzen. Die
Bürokratie ist die eigentliche und reale Verkörperung des Staates.
Es gibt einen mittelalterlichen Ablauf, der zeitweise in besonderem Maß in der deutschen Geschichtsschreibung nationalistisch umstritten war, der jedoch gerade unter dem Aspekt der Herausbildung der Intellektuellen von hohem Interesse wäre: der sogenannte Investiturstreit. Mitte des
11. Jahrhunderts kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Römischen Kirche und dem
okzidentalen Kaisertum, den mittelfristig die Kirche gewann. Die Kirche war bis damals ganz
selbstverständlich in die rudimentären politischen Strukturen einbezogen gewesen („Reichskirche“). Unter dem Stichwort des Kampfs gegen die Simonie (kirchlicher Ämterkauf) und auch dem
Impuls volksreligiöser Bewegung begann nunmehr eine intellektuell-bürokratische Bewegung um
die politische Macht. Humbert von Silva Candida weitete den Begriff der Simonie in seiner Schrift
„Contra simoniacos libri III“ um 1058 auf die sogenannte Laieninvestitur aus, die Einsetzung von
Bischöfen durch den König. Doch diese kirchliche Reformbewegung, dieser Kampf um die „Freiheit der Kirche von allem Laieneinfluss“ (Jordan, in: Gebhardt I 1954, 254) war nichts anderes als
der politische Wille der damaligen Intellektuellen zur Macht. Es war politischer Platonismus pur.
Es sollte „der freie Geist wirken“ (so die Formulierung bei Kempf, in Jedin III/1 1966, 407). Geist
kommt nur innerhalb der Intellektuellengruppe vor. Sie muss sich selbst autonom organisieren.
Das Ziel der Eigenverantwortlichkeit war in dieser Konstellation ein Herrschaftsanspruch ohne
jede Kontrolle. Der Anspruch und die Phantasie der klerikalen Intellektuellen – andere gab es damals nicht – war schlicht Allmacht. Besonders deutlich wird dies in der politisch entscheidenden
Figur, den römischen Bischof Gregor VII. Er muss wahrscheinlich, zusammen mit Leo IX., zum
ersten Mal im analytischen Sinn als Papst bezeichnet werden. Er war Ideologe und hochgradiger
Fanatiker. Das führte zu seinem persönlichen Scheitern (römischer Bischof 1073 – 1085), wogegen
politisch geschicktere Nachfolger den Kampf im wesentlichen für sich entschieden. Im „Dictatus
papae“ erhob Gregor politische Allmachtsansprüche. Doch was dort niedergeschrieben ist, wurde
bis zur Gegenwart innerhalb der Römischen Kirche selbstverständliche Wirklichkeit. Das intellektuelle Konzept wurde zur bürokratischen Wirklichkeit, allerdings nur in einem eingeschränktem
Bereich nichtstaatlicher Vereinsorganisation.
Die grobe Dichotomie zwischen "traditionalen" und "modernen" Gesellschaften wird hier
ungenügend. Das, was wir traditionale Gesellschaft nennen, ist immer eine Gesellschaft
vor unserer eigenen Moderne. Sie kann peripher-bürgerlich, feudal oder auch gentil sein.
Jeder dieser Gesellschaften entspricht eine andere Struktur der Politik. Mit Poulantzas
(1978) können wir etwas vergröbert sagen, dass erst bürgerliche Gesellschaften (eventuell
auch orientalisch-despotische) einen Staat entwickelten, denn erst diese brachten einen
autonomen Staatsapparat zuwege – die Bürokratie eben. Doch auch vorher hat es politische
Gemeinschaften gegeben. Die ersten Wurzeln der Bürokratie finden wir so in der
abendländischen Entwicklung auch schon im Feudalismus.
Das "falsche" und das "richtige" Jubiläum
41
Erst als langsam eine dünne bürgerliche Schicht entstand und gleichzeitig dieses seltsame
Gebilde des Heiligen Römischen Reiches zur formalen Hülse verkam, wurden auch die
Bürokratien etwas größer. Gleichzeitig wechselte auch der Personenkreis, der sie trug. Aus
den Klerikern wurden damit "clercs" – Beamte. Die Ausbildungsstätte war für sie von
Anfang an die Universität, welche ihnen auch ihre intellektuelle Identität lieferte. Damit
profilierte sich die Universität, die zuerst die Ausbildungsstätte der Kleriker gewesen war,
zur Wurzel der modernen Bürokratie. Nie aber war sie bisher Ort des Adels, gegen den sie
in bestimmten Ausmaß in ihrer mittelalterlichen wie in ihrer neuzeitlichen Form gerichtet
war. Sie war immer der Ort einer Gegenelite und ist dies – bis auf kurze Augenblicke (so in
Mitteleuropa etwa in der Zwischenkriegszeit) – auch bis in die Gegenwart geblieben. So
wird es denn auch nicht erstaunen, dass schließlich die Universität zu der Pflanzstätte des
Nationalismus wird.
42
Doch es gibt eine andere bürokratische Institution neben den Zivilbeamten. "Mächtiger als
die Bekehrungssucht christlicher Priester hat ein anderes Element zur Zerstörung der alten
Ideenwelt beigetragen: die Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht, die hier erst sehr
spät erfolgt ist. Denn während ehemals die kriegstüchtige Mannschaft vom Heeresdienst
durch Reklamation großteils befreit wurde, wird sie jetzt unweigerlich unserer Marine
einverleibt. Dadurch verändert sich mit einem Schlag der ganze Gesichtskreis des
eingestellten jungen Mannes. War bisher ein einziges Dorf der Nehrung seine Welt, so tut
sich ihm jetzt die Erde in ihrer ganzen Größe auf.. Er lernt Kameraden aus anderen
Gegenden seines Vaterlandes sowie Leute aus fremden Ländern und deren Anschauungen
kennen. Aufgeklärt kehrt er in den Kreis der Seinen zurück. Seine Interessen haben sich
erweitert." Der Freiherr Julius von Negelein spricht so 1902 über die Kuren und HaffLitauer in Ostpreußen (Rudolph 1989, 17). Knapp 30 Jahre vorher hat ein anderer
Beobachter dasselbe festgestellt: "Viele von den Söhnen gehen auf die Kriegsmarine,
kehren nach wenigen Jahren als vollkommene Deutsche zurück und führen diese Sprache
gar wohl in der Familie ein... Die Kuren haben kaum ein Bewusstsein ihrer Nationalität
und noch weniger das Verlangen, sie zu bewahren. Das Deutsche vertritt ihnen die Kultur,
die Vornehmheit, und so verschwinden die beiden Nationalitäten jährlich mehr und mehr"
(Passarge 1878, in: Rudolph 1989). Auch in nichtnationalen Zusammenhängen war völlig
plausibel in bürokratischen Apparatstaaten bereits das Militär ein mächtiges Instrument
ethnischer Vereinheitlichung.
Wir stellten schon fest, dass Nationen-Bildung auch ein Prozess von Oben nach Unten ist.
In diesem Prozess spielt das Militär als strukturierte Organisation eine wichtige Rolle. Wir
sehen nun, daß diese Institution einfach durch ihre Alltagswirkung auch erhebliche Effekte
ethnischer Vereinheitlichung haben kann, wobei ethnische Vereinheitlichung in wesentlich
stärkerem Ausmaß (aber keineswegs ausschließlich) auch von unten nach oben verläuft.
Hier ist nicht zu vergessen, dass gerade in dieser Zeit das Heer auch ein Kanal für einen bescheidenen Aufstieg ländlicher Unterschichten, in bescheidenerem Ausmaß auch des städtischen Proletariats war. Sie konnten bei entsprechenden Anstrengungen Unteroffiziere
werden. Das ist für die Habsburger-Monarchie und das Zarenreich einigermaßen bekannt.
An diesem Punkt hätte Anderson wesentlich fruchtbarere Überlegungen zur Nationalisierung ansetzen können, als an seinem Lieblingsbeispiel der mittelalterlichen Pilgerfahrten,
die damals angeblich Universalität hergestellt hätten.
Wir kommen hiermit auf eine interessante Spur: Bürokratie - Beamte und Militär - sind den
Strukturen des Staates, nicht jenen der Gesellschaft verpflichtet. Unter bestimmten Umständen können kurzfristig insbesondere Militärs Ersatzfunktionen im Nationenbau und der
Modernisierung übernehmen, wenn z. B. ein autoritäres Regime der Bevölkerung jeden
Zugang zur Staatsmacht versperrt. Sie haben ja die Macht zu intervenieren. Doch wenn sie
der Versuchung der Macht unterliegen und selbst die politische Klasse bilden wollen, zeigt
sich ihr Kastencharakter. Als die Verkörperungen des top down-Prozesses stehen sie politischen Partizipationsprozessen regelrecht entgegen. Wie sehr nun auch die institutionalen
Strukturen des Staatsaufbaues von Bedeutung für den Nationenbau sein mögen, setzt die
nationale Identität als das gesellschaftliche Scharnier zum Staat doch auf einer anderen
Ebene an. Das Bewusstsein von gleichen Einzelnen und von Gruppen ist hier von überragender Bedeutung. Um ein solches aufbauen zu können, ist die Möglichkeit positiver
Identifikation unabdingbar. Doch Bürokratie ist in der frühen Phase und bis zum Beginn
des Hoch-Nationalismus vor allem Instrument des Gewaltapparates Staat, fordert also nicht
zur Identifikation, sondern allenfalls zum Widerstand heraus. Das ist mit Blick auf ihre
43
Klientel, die Untertanen, gesagt. Doch auch die Beamten selbst hatten wenig Möglichkeit
zu einer positiven kollektiven Identifikation, welche über ihre engsten Standesinteressen
hinausging. Es war ihnen üblicherweise (im Habsburgerstaat formell) verboten, nicht nur
sich politisch zu organisieren, sondern auch nur politische Überzeugungen haben zu dürfen. Heindls (1990) Motto über ihre Arbeit zur Bürokratie bis 1848 aus einer Grillparzer'
schen Travestie der "Zauberflöte" markiert dies nicht schlecht: "Beschäftigt meine Beamten mehr, denn ich höre, ... sie lesen", sagt da die Königin der Nacht. Auch der manchmal
ins Vorbild stilisierte Josephinismus wurde bald zum Symbol dieser Art von Beamtenmentalität. Selbst wenn heute noch ab und zu ein Beamter sich selbst "Josephiner" nennt – und
diese Selbstetikettierung kommt einem erstaunlicherweise in der Gegenwart immer wieder
einmal unter – , dann ist dies gewöhnlich ein Hinweis auf einen sich aufklärerisch gerierenden Autoritarismus. Es ist einfach der Anspruch, etwas besser zu wissen als die von der
Amtshandlung betroffene Bevölkerung. Die Beamten als Schicht sind daher funktional
nichtintellektuell und als nationale Sprecher außerordentlich schlecht geeignet. Es war kein
Zufall, dass in der österreichischen Geschichte nur solche ehemalige Beamte eine
innovatorische Rolle spielten, welche diesem Stand schließlich den Rücken zudrehten. In
der Zeit der Monarchie, vor allem im Vormärz, gab es eine Reihe von Literaten oder auch
von Musikern, welche ihr Amt lediglich als Versorgungsstelle nutzten. Doch auch sie
waren entweder völlig monarchiefromm (Grillparzer) und a- bis antinational, oder aber sie
mussten ihre Stelle schließlich verlassen.
Da sich die Beamten, wenn überhaupt, mit den Strukturen des Staates und nicht der
Bevölkerung identifizierten, waren sie im Habsburgerstaat natürlich die letzten, von denen
man die Rolle nationaler Sprecher erwarten konnte. Sie dienten der Machterhaltung.
Intellektuelle als Gegenelite zielen gewöhnlich auf Veränderung. Hier sind allerdings
einige Unterschiede zu machen. Auch Lehrer oder Professoren sind ihrer arbeitsrechtlichen
Stellung nach Beamte. Sie aber wurden nach 1848 auf der regionalen und lokalen Ebene
häufig zu den Distributoren nationalen Gedankengutes. Doch dabei sind Einschränkungen
vorzunehmen. Dies gilt vorrangig für "deutsche" Lehrer, also Angehörige der dominanten
Nation Cisleithaniens. Sie und nur sie waren einigermaßen geschützt gegen Pressionen und
Sanktionen von oben, wenn sie ihren Nationalismus nicht übersteigerten.
44
2 DIE ÖSTERREICHISCHE ENTWICKLUNG
Die Nation ist eine spezifische Form des historischen Blocks. Sie stellt ein bestimmtes und
historisch lokalisiertes Verhältnis von ziviler Gesellschaft zum Staat dar. Folglich müssen
die sozialen Grundbeziehungen und insbesondere auch das wirtschaftliche System als
Einflussgrößen auf die politischen Institutionen die Nationen-Entwicklung in starkem
Maße gestalten. Wir müssen uns also um die wirtschaftlichen Grundlagen sowie um den
politisch-administrativen Staatsaufbau als Voraussetzungen des Aufbaues von Nation bzw.
des modernen Staates in Österreich kümmern. Man könnte sagen: Wir betreiben
Entwicklungstheorie am Beispiel Österreich. Der Kapitalismus, die Marktwirtschaft, sollte
der liberalen Theorie nach die räumlichen Strukturen vereinheitlichen. Doch das ist
keineswegs der Fall. Zumindest bisher hat er, im Weltmaßstab wie auch auf der nationalen
Ebene selbst, die regionalen Ungleichheiten eher verschärft. Gegenwärtig könnte sich in
hochentwickelten Ländern ein etwas anderer Prozess anbahnen. Doch aus dieser bisher i. a.
wachsenden Ungleichheit zwischen den Regionen als den räumlichen Abbildern regionaler
Gesellschaften erwuchsen Konflikte. Jede soziale und politische Mobilisierung von
Interessen braucht auch einen Identitätskern. Dieser mag sich ethnisch, kulturell, religiös
oder sprachlich kleiden. Welche Erscheinung immer er auch annimmt, er ist funktional als
Träger sozialer Ungleichheit einerseits, als Träger einer Gleichheitsbestrebung andererseits
zu sehen. Ökonomische Entwicklung muß also immer in irgendeiner Weise auch die
nationale Bewußtseinsbildung beeinflussen. Allerdings ist bisher keineswegs klar, wie und
in welcher Weise. Damit gilt es, wesentliche Grundsätze einer solchen auch ökonomisch
orientierten Analyse zu benennen. Es stellt sich die Frage: Können wir die Verbindung
dieser Basisstrukturen zur Entwicklung nationaler Identität nicht nur postulieren, sondern
analytisch und damit im nächsten Schritt auch empirisch modellieren und herstellen?
Welche Zwischenglieder, welche Rahmenbedingungen spielen eine Rolle?
2.1. Methodische Überlegungen
Es gibt keine "ehernen Naturnotwendigkeiten" der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung. Dieser Punkt ist in größtmöglicher Deutlichkeit herauszustellen. Ohne dies
wirklich zu begreifen, wird es nie eine wirkliche Entwicklungstheorie geben. Beachtet man
jedoch den probabilistischen Charakter von Entwicklung und Geschichte, so entgeht man
auch den vielen sterilen Auseinandersetzungen, wie sie gerade die Entwicklungspolitik
prägen. Diese ist geprägt – man ist versucht zu sagen: verunstaltet - von der Frage nach der
einzig richtigen Entwicklungsstrategie. Allerdings ist die absurde Art, wie man uns in
Schulen Geschichte beibringt, nicht dazu angetan, den differenzierten Blickwinkel auszubilden. Man könnte sogar sagen: Wir müssen vorerst einmal Deterministen werden, um
Abläufe verstehen zu lernen. Erst dann können wir uns wieder den Luxus gestatten, zu
einer befriedigerenden, nämlich probabilistischen, Sicht zurückzukehren.
Eine bestimmte Politik kann günstige oder ungünstige Voraussetzungen für den Entwicklungsprozess schaffen. Eine Garantie für das Gelingen wird sie aber nie bieten können. Zu
jedem gelungenen Prozess im Anschluss an eine bestimmte Politik werden sich Gegenbeispiele des Scheitern finden lassen. Die scholastischen Auseinandersetzungen, in der Gegenwart vor allem um die Frage liberal-freihändlerischer oder planend und oft protektionistischer Politik geführt, beachten den wichtigsten Punkt nicht: Gesellschaft ist eine multiple Struktur aus verschränkten Teilnetzen. Eine prinzipiell zielführende Wirtschaftspolitik
kann daher sehr wohl durch Wirkungen anderer Strukturen zu Fall gebracht werden. Umgekehrt kann auch eine wahrscheinlich wenig günstige Politik einmal Erfolg haben, wenn
45
glückliche äußere Zufälle mitwirken. So ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Schweizer
Industrieentwicklung ohne die Kontinentalsperre gescheitert oder zumindest verzögert worden wäre: Dabei war diese äußere Beschränkung von den Schweizern ganz sicher nicht
geplant und gewollt, ganz im Gegenteil (Menzel 1988). Ihr Glück – aus der Sicht im nachhinein – wurde ihnen von außen aufgezwungen.
Weiter geht es hier um die politischen Bedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung, und
nicht nur dieser. Es ist einer der gröbsten vulgärmarxistischen Fehler, die Analyse einfach
entlang von Wachstumsraten zu führen. Leider ist diese "ökonomistische Irrlehre" (Polanyi
1977) in der Entwicklungspolitik aller Schattierungen gang und gäbe, auch und heute
gerade in der liberalen. Nicht unschuldig sind an diesem Zustand die marxistischen
Klassiker. Kennzeichnend ist die Polemik Marx` gegen Friedrich List (Karl Marx über
Lists Buch "Das nationale System der politischen Ökonomie" in: List 1982, 439 ff.). Sie
wurde von seinen Nachfolgern, etwa auch Rosa Luxemburg, ziemlich gedankenlos nachgeplappert. Dabei war es Marx nicht gelungen, mental der logischen Eleganz einer "Wertökonomie" englischer, vor allem ricardianischer, Prägung zu entkommen. Dies ist umso
ironischer zu sehen, als etwa Marx selbst in der Rede über den Freihandel diese als
Betrügerei bezeichnet hatte, ohne allerdings eine politische Alternative (außer einer sehr
abstrakten Revolution) anzubieten. Diese Themen haben heute alle noch ihre Aktualität,
auch in Österreich.
List war keineswegs ein Nationalist im Sinne des 19. Jahrhunderts. In seiner berühmten Schrift
über das Eisenbahnwesen (o. J. [1833]) versuchte er allerdings implizit durchaus nationale Politik
zu betreiben, nämlich als Nationenbau im Bereich der Infrastruktur, insbesondere des Verkehrswesens. Das ist ein unentbehrlicher Aspekt eines nationalen Projektes, allerdings nur einer unter
mehreren, und ein eher technischer. Ein infrastrukturell integriertes System kann ohne weiteres
entstehen, ohne dass deswegen eine Nation entsteht. Das wird gerade im 19. Jahrhundert das
Problem “Österreichs”, nämlich Cisleithaniens sein. Umgekehrt ist es schwer vorstellbar, dass eine
Nation entstehen könnte, ohne dass sie auch ein Infrastruktursystem entwickelt.
Stilistisch und von der Anlage her ist Lists Schrift über das Eisenbahnwesen eine Feasibility-Studie; jedoch eine Feasibility-Studie mit weitreichendem Anspruch auf Entwicklung der Volkwirtschaft durch Verkehrsinfrastruktur. Dabei findet sich interessanter Weise in der ganzen Schrift
kaum ein politischer Hinweis, außer den obligaten und werbemäßigen eingesetzten Behauptung
über ein größeres “National”produkt.
Wie stark der politische Aspekt den ökonomischen tatsächlich überwog – man könnte eine
Parallele zu Identität und Interesse ziehen – , zeigt die Frage der Zentren beim Staatsaufbau. Entgegen Deutschs (1979, 19) Behauptung war eine politische Konkurrenz mehrerer Zentren (im deutschen Sprachgebiet z. B. zwischen Wien und Berlin bei Existenz kleinerer Zentren wie München) geradezu eine Garantie für das Scheitern eines Nationalstaatsaufbaus. Anders hingegen stellt sich die Lage bei einer Konkurrenz zwischen politischen
und wirtschaftlichen Zentren (Italien: Rom gegen Milano und Torino; Spanien: Madrid
gegen Barcelona und Bilbao; Vereinigtes Königreich: London gegen Glasgow und Birmingham/Liverpool; ...). Dies scheint zumindest in einer früheren Phase den nationalen
Aufbau nicht behindert zu haben. Möglicherweise steht dies mit den unterschiedlichen
Schichten als Träger von Politik (Adel und Bürokratie) und Wirtschaft (Bourgeoisie) in
Verbindung.
Abgrenzungen der sozialen Identitäten sind bekanntlich immer bezogen auf “Andere”.
Wenn sich also Nationalismus selbst durch Bezüge auf Außen definiert, muss die Stellung
einer bestimmten Nation in der politischen wie wirtschaftlichen Struktur des Weltsystems
46
mitgedacht und -analysiert werden. Insbesondere die Nation ist eine internationale Struktur,
welche aus dem Einzelfall heraus überhaupt nicht verstanden werden kann. Wie wirkte sich
nun die internationale Struktur auf die Entwicklung von Österreich-Bewusstsein aus, wie
reagierten die Intellektuellen darauf? Allein die Periodisierung lässt bereits erkennen, dass
sie eine überragende Rolle spielte. Wir können in etwa folgende Abschnitte erkennen:
1. Die Frühzeit im Aufbau eines nationalen, und zwar bei den Eliten klar deutsch gerichteten, Bewusstseins – bis 1848 bzw. noch einschließlich des Neoabsolutismus – war bestimmt von einer Reihe von sich überschneidenden Tendenzen, die jedoch insgesamt ein
gesamtdeutsches Bewusstsein der potentiellen Gegeneliten ergaben. Die Großmacht Habsburg stand am Beginn des 19. Jahrhunderts dem napoleonischen Frankreich gegenüber. Die
seit Friedrichs Eroberung Schlesiens akute Konkurrenz mit Preußen war kurzfristig etwas
in den Hintergrund gedrängt.
2. Die "deutsche Tendenz" in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergab sich nicht
zuletzt aus der preußischen Hegemonie seit 1866/1871, wobei die Nationalitätenkämpfe im
Inneren Cisleithaniens ein deutsches Bewusstsein fast zwingend nahe legten. Hier lässt sich
eine interessante Frage stellen: Könnte man die nationale Entwicklung der deutschsprechenden Österreicher im 19. Jahrhundert als eine politische Ambivalenz zwischen der
(deutsch-) nationalen Orientierung des Großteils der Intellektuellen einerseits und einer
ethnischen Strukturierung eines Großteils der Bevölkerung, welche auf die Länder oder
eventuelle auf eine Art deutschösterreichischer Identität bezogen war, sehen?
3. Die erste Republik sah einen Kleinstaat, dessen Bewohner großteils diesen Status nicht
akzeptieren wollten und daher, anfällig für Revanche, auf die wiederaufsteigende deutsche
Großmacht nebenan schielten. Erst in dieser Epoche wird eines ganz klar: Die NationenKonzeption des 19. Jahrhunderts war im wesentlichen eine Großmacht-Konzeption. Die
deutschsprechenden Österreicher hatten dies völlig verinnerlicht, als Teil der „führenden
Völker“13. Die neue und für das 20. Jahrhundert kennzeichnende Erscheinung der „kleinen
Nationen“ wurde von den nichtdeutschsprachigen Nachfolgestaaten voll und ganz akzeptiert, nicht aber von den Verlierern im nationalen Status.
4. Die Zeit von 1945 – 1991/94 lässt sich in zwei Unterabschnitte gliedern:
4.1 Die Vernichtung der deutschen Dominanz für gut ein Jahrzehnt und die Teilung der
Großmacht führte zu neuem, teils instrumentellen, teils echten, Selbstbewusstsein in Österreich.
4.2 In den 60er Jahren stellte sich auf gemäßigte Weise eine, vor allem kulturelle, Dominanz der BRD wieder her – man denke als Indikator nur an die Verhältnisse auf dem
Büchermarkt, wo 4/5 der Produkte aus dem “Reich” kommen. Trotzdem war bewusstseinsmäßig nicht der größere Nachbar nebenan politisch, kulturell und wirtschaftlich
entscheidend, sondern die Supermacht jenseits des Ozeans. So stellte sich zum ersten Mal
in der österreichischen Geschichte eine nationale “Normalität” her.
5. Die neue deutsche Großmacht seit 1991 und der Anschluss an die EU hat Konsequenzen, die im Augenblick noch gar nicht absehbar sind. Um die teils gegenläufigen Tenden-
13
1933 erschien im Deutschen Reich eine „Geschichte der führenden Völker“, hg. von Heinrich Finke, in
welchem Hugo Hantsch einen Beitrag über Österreich schrieb, dem einer über den Aufstieg Preußens
gegenüber gestellt wurde.
47
zen zu beobachten, wäre es etwa interessant, die Episode des Boykotts der informellen EUMinisterräte infolge der Sprachenfrage zu beobachten.
Diese Überlegungen haben Parallelen mit M. Hrochs (1985) Untersuchungen zur Rolle von
Intellektuellen Untersuchungen zur Nationenbildung. Hrochs Arbeit wiederum könnte als eine
sorgfältige (“europäische”) Ausarbeitung von Gedanken gesehen werden, welche Ende der 60er
Jahre schon S. Huntington (1967) geäußert hatte, leider in der bei ihm gewohnten Grobheit und
Undifferenziertheit. Nichtsdestoweniger lässt sich an beide anknüpfen und großer Nutzen aus ihren
Analysen ziehen.
Lassen sich diese entscheidende Prozesse der nationalen Entwicklung in Österreich mit
abgrenzbaren Etappen des sozialen Wandels parallelisieren? Ich denke hier insbesondere
an einen Vergleich von Kondratieff-Zyklen in Österreich und eventuellen Zyklen des politischen Prozesses. Dies wäre eine Fragestellung von höchster theoretischer Wichtigkeit. Es
geht um eine gegenseitige Bedingtheit von strukturellen und Bewusstseinsprozessen. Immerhin wird Nationen-Bildung als Modernisierungsprozess verstanden. Geht dieser
Prozess nicht nur von oben vor sich, sollte man gegenseitige Dependenzen erwarten
können. Man könnte immerhin mit einer gewissen Logik z. B. argumentieren: Je höher die
Wachstumsrate, umso höher ist die Beteiligung von Menschen mittelständischer Herkunft
an formaler Bildung. Diese Menschen sind aber in einer traditionalistischen Umgebung die
eigentlichen Träger der Nationalismus. Also müsste bei hohem Wirtschaftswachstum
nationalistische Bewegungen aufblühen. So konzipiert, wäre dies von einem flachen
Mechanismus und wohl kaum zu belegen. "Es scheint keinen Beweis zu geben, daß der
Nationalitätenkonflikt, der den gemeinsamen Markt im frühen 20. Jahrhundert zerstört hat,
auf wirtschaftlichen Hintergründen beruhte" (Komlos 1985, 24)14.
2.2. Über den Zusammenhang politischer und wirtschaftlicher Entwicklung
Nation bezieht sich immer auf den modernen Staat. Der moderne Staat entstand nie aus
einem einzigen Klasseninteresse heraus. Er entsprang stets einem (gewaltsamen) Ausgleich
deinem Interessen mehrerer Klassen durch einen jeder gegenüber autonomen, wenn auch
auf die wichtigsten herrschenden Interessen gestützten Apparat, verkörpert von einem
Herrscher oder einer Dynastie.
Dieser Punkt ist von überragender Wichtigkeit für jede Staatstheorie. Er zeigt überzeugend,
dass Staat, die moderne politische Struktur, nicht einfach nur ein Anhängsel "der" herrschenden Klasse ist, wie es der Vulgärmarxismus, aber auch Lenin will. "Daß der Staat das
Organ der Herrschaft einer bestimmten Klasse ist" (Lenin 1974, 399), ist schon recht vergröbernd. Doch Lenin beißt sich am Wort "Versöhnung" fest, wird vollkommen sophistisch
und macht damit eine weitere Argumentation beinahe unmöglich. Es geht – neben einer
immer wieder auch vorhandenen Befriedungsfunktion von Herrschaft in einem Hobbes’
schen Sinn - um die Autonomie der politischen Struktur, die den modernen Staat
auszeichnet. Er entstand aus einer multiplen Herrschaftsstruktur heraus. Der europäische
Absolutismus, den wir gewöhnlich als Klassengleichgewicht (nämlich zwischen Adel und
14
Es ist nicht unnötig, nach diesem zustimmenden Zitat zu erwähnen, dass gerade dieser Autor von
ausgeprägt ökonomistischer Grundhaltung ist: "Der politische und rechtliche Überbau wurde [in dieser
Studie] nur flüchtig erwähnt.... Ich kam zu der Überzeugung, dass politische Ereignisse letzten Endes das
langfristige Wachstum nicht beeinflussten... Meine Untersuchung hat dazu geführt, die wirtschaftlichen
Errungenschaften durch Mechanismen des anonymen Marktes begreifen zu können... Kurz: Ich suchte die
treibenden Kräfte der Wirtschaft nicht in der Regierungspolitik, sondern in der Wechselwirkung der
Marktkräfte" (Komlos 1985, 23 f.).
48
Bürgertum) interpretieren, verwirklicht in diesem Sinn auch eine schiedsrichterliche Idee,
zum Nutzen des absoluten Herrschers und seiner politischen Machtansprüche. Da er eine
gewisse Schwächung des Feudaladels bedeutete, muss er sich in irgendeiner Weise auch
für die Unterschichten ausgewirkt haben.
Noch anders verhält es sich mit traditionaler Politik. Auch hier müsste empirisch untersucht werden (mit welchen historischen Methoden?), ob diese Politik reine Ausbeutung
war, oder ob sie in irgendeiner Weise auch Steuerfunktionen hatte. Ein Hinweis könnte die
zwar sicherlich naive Hoffnung bäuerlicher Schichten darstellen, welche den "guten
König" (den kralj Matjaz der Slowenen, ...) zu einer ihrer Symbole erhoben haben. Es ist
die Personalisierung der Hoffnung auf eine schiedsrichterliches Wirken des "Staates", d. h.
jener Machtinstanzen, welche über der unmittelbaren lokalen oder regionalen Schicht der
Herrschaftsträger und Ausbeuter liegt. Das könnte man aber den Kernpunkt des modernen
Staates nennen. Aus diesem Punkt ist auch der emanzipative Aspekt des frühen Zentralismus zu verstehen, der immer dort auftritt, wo noch eine völlig undifferenzierte, Politik und
private Ausbeutungsbeziehungen nicht auseinanderhaltende Herrenschicht Gewalt ausübt.
Das Zentrum musste sich in seinem eigenen Interesse gegen die regionalen / lokalen
Herrschaftsträger stellen und damit offenbar i. S. einer gewissen Belastung der lokalen
Unterschichten einschalten. (Das war in China und in traditionalen Apparatstaaten des
Typus der Orientalischen Despotie meist anders, vgl. Franke / Trauzettel 1968, 95).
Die Entwicklung des Kapitalismus ging nicht stetig vor sich. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts fielen den Ökonomen die regelmäßigen und zeitlich umgrenzten Folgen von Krisen
und dazwischen liegenden Wachstumsperioden auf (Schumpeter 1961). In der typischen,
naturalistischen Denkweise des Jahrhunderts versuchte man zuerst, sie als Erscheinungen
der Natur zu deuten. Jevons entwickelte etwa eine "Sonnenfleckentheorie" (vgl. Schmölders 1967): Der Sonnenfleckenzyklus entscheide über die Ernteergebnisse der Landwirtschaft, und damit auch über die Performanz der Gesamtwirtschaft. Dabei konnte er sich auf
gewisse Daten des Astronomen Herschel über Getreidepreise stützen, die dieser 1801 zusammengestellt hatte, und die ihrerseits wieder über das Wetter mit den Sonnenfleckenzyklus zusammenzuhängen schienen. Nun ist Wetter in einer agrarischen Gesellschaft
sicherlich nichts, was man vernachlässigen kann. Ob man allerdings wetterbedingte Missernten überhaupt unter das Konzept des modernen Konjunkturzyklus subsumieren kann, ist
etwas ganz anderes. Jevons vor allem hatte schon mit einer industrialisierten Gesellschaft
zu tun. Die erwünschte Aussage war: Konjunkturen sind also nicht gesellschaftlich (wirtschaftlich) bedingt, sondern von unbeeinflussbaren Naturereignissen abhängig. Diese Ideen
entsprachen zwar ganz dem Zeitgeist im Wunsch, soziale und wirtschaftliche Abläufe als
ewige Kreisläufe zu diagnostizieren, widersprachen aber nicht nur dem zweiten Wunsch
nach einer dynamischen Wirtschaft, sondern zu offensichtlich auch dem langsam zunehmenden Wissen. Man ließ sie daher bald als absurd fallen. Dafür kam der Gedanke auf,
nach anderen und langfristigeren Wachstumsmustern zu suchen. Krisen besitzen für
Ökonomen sozialistischer Observanz eine besondere theoretische Bedeutung: Nicht zuletzt
durch sie setzt sich das "Wertgesetz" durch, werden also Ungleichgewichte korrigiert.
Anfang der 20er Jahre unseres Jahrhunderts wurde die Existenz "langer Wellen" (50 bis 70
Jahre) behauptet und plausibel, aber keineswegs über alle Zweifel erhaben, vorgerechnet
(Kondratieff 1926). Von einer Reihe von Wissenschafter (oft mit demographischen Einschlag) wurden - nicht immer mit besonderer Überzeugungskraft - noch bedeutend längere
Rhythmen behauptet, die "logistics" (Cameron 1992) etwa.
49
Die logistischen Kurven der Bevölkerungsentwicklung sind kaum zu bestreiten, und gerade die Bevölkerung auf dem Gebiet der heutigen Republik Österreich bietet ein gutes Beispiel dafür, wenn
man den Schätzungen glauben kann. Doch die Cameron'sche Behauptung geht weit darüber
hinaus. Sie behauptet einen zyklenhaften Ablauf der wirtschaftlichen und damit auch der Gesamtentwicklung der Menschheit. „Das Abendland breitete sich während jeder Phase beschleunigten
Bevölkerungswachstums kulturell, ökonomisch und auch geographisch weiter aus... Auffallend ist,
daß Europa in jeder Phase beschleunigten Bevölkerungswachstums zunächst von intellektueller
und künstlerischer Schöpfungskraft übersprudelte und anschließend allerorts monumentale Bauten
errichtet wurden" (Cameron 1991, 37f.). Interessanterweise kommt er damit einem ziemlich reduzierten historischem Materialismus näher als er vermutlich selbst dies wahrnehmen möchte, zumal
er sich noch davon als "simplifizierend" distanziert (a. a. O., 28f.). Diese Version sollte man allerdings eher "Technologismus" nennen, weil sie auf "epochale Innovationen" setzt, um die Zyklen
zu erklären. Damit sind in erster Linie technologische Innovationen gemeint, obwohl der Frage der
Institutionen in den einleitenden Sätzen immer auch einige Lippenbekenntnisse gewidmet werden.
Hier kommen wir in ein Problem hinein.
"Kliometrie" nennt sich eine neue historische Forschungsrichtung, welche allerdings zwei Anliegen mischt, die miteinander nicht notwendig etwas zu tun haben. Das eine Anliegen besteht in der
lang überfälligen Erkenntnis, dass quantitative Verhältnisse fundamentale Erkenntnisse der Geschichte allgemein und der Wirtschaftsgeschichte im besonderen vermitteln. Die zweite Annahme
besagt jedoch etwas ganz anderes: "Kliometrie ist die Anwendung moderner Wirtschaftstheorien
in der Geschichtsforschung" (Komlos 1985, 11). Unter "moderne Wirtschaftstheorien" werden die
neoklassischen Grunddogmen verstanden. Nun ist deren Brauchbarkeit schon für die aktuelle Wirtschaftsforschung von begrenztem Wert, und sie werden in der Ökonometrie nur selektiv benutzt.
Die Erfahrung des letzten Jahrzehnts in den Transformationsländern hat zudem sichtbar gezeigt,
dass sie eine Reihe kulturspezifischer Annahmen treffen, die bislang nur in Seitenströmen von
Minderheiten reflektiert wurden (z. B. der property rights-Ansatz, die Neue Politische Ökonomie,
u. a.). Was ist nun das Problem? Es besteht nicht zuletzt in der sauberen Trennung von ökonomischen und sogenannten außerökonomischem Verhalten. In vergleichsweise traditionalen Gesellschaften geht die soziale Differenzierung wesentlich weniger in die Tiefe als in stärker modernisierten. Anders ausgedrückt: Der Mensch ist in höherem Ausmaß totale soziale Realität, der seine
Handlungen nicht nach unterschiedlichen Handlungslogiken (das ist nur ein anderes Wort für:
soziale Institutionen) unterscheidet. Wenn man daher die Institutionen außer acht lässt und naiv
Theoreme aus der Gegenwart überträgt, wird die Erklärung problematisch werden. Dies ist für
unsere Thematik von überragender Bedeutung: Bedeutet doch Nation, wie weiter vorne besprochen, dass Gesellschaft eine ziemlich klaren Differenzierungsprozess durchlaufen hat – Nation ist
in diesem Sinne eine Integrations-Strategie, welche diese Differenzierung bewältigen muss.
50
Langfristige Bevölkerungsentwicklung auf dem Gebiet des heutigen
Österreich
9.000.000
8.000.000
7.000.000
5.000.000
4.000.000
Einwohner
6.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
900
1100
1300
1500
1700
1900
Quelle: ab 1869 Volkszählungen, ab 1526 Klein 1973, vorher Bruckmüller 1985, Sandgruber 1995
Was lag nun näher als der Versuch, ökonomische und politische Entwicklung synoptisch
zu sehen, zu koordinieren, und zwischen beiden eine Beziehung herzustellen? Der Grundgedanke heißt: Hegemoniezyklen, Zyklen des Auf- und Abstiegs von Großmächten, folgen
den langen Wellen und (was allerdings analytisch eine zweite Aussage ist) sind von ihnen
bedingt (Bousquet 1979). Ein wenig übersehen und manchmal explizit verneint wurde ein
Gedanke, der sich nahezu zwingend aus eben diesen Überlegungen ergibt: Wenn es eine
économie-monde (völlig unzulänglich mit “Weltwirtschaft” übersetzt – Braudel 1986) gibt,
muss es gerade nach marxistischen Gedankengängen auch ein politisches Weltsystem geben. Dass Nationalstaaten miteinander konkurrieren, ist kein Gegenargument, sondern eine
Bestätigung für die Handlungslogik. – Der Gedanke ist bestechend. Der Nachweis ist bisher allerdings nicht recht geglückt (Wallerstein 1979). Teils liegt dies an einer zu ökonomistischen Auffassung des Problems, also an einer zu einseitigen Konzeption der Wirkrichtung von der Wirtschaft zur Politik, wie sie oben gerade kritisiert wurde. Doch gelingt
es, sich davon frei zu halten, so ist der Gedanke, dass es erkennbare Zusammenhänge
zwischen ökonomischer und politischer Hegemonie (in beide Richtungen) ein wertvolles
Forschungsprogramm, welches wichtige Erkenntnisse verspricht. Allerdings ist dazu der
Gedanke zu modifizieren. Die Anziehungskraft von zyklischen Entwicklungsmodellen in
der neueren Geschichte ist darin begründet, dass solche Zyklen ein wesentlicher Ausdruck
eines sozialwissenschaftlich-nomologischen Denkens sind. Der Grundgedanke verliert allerdings deutlich von seiner Faszination, wenn man realisiert, auf was die meisten dieser
Modelle (neben Wallerstein z. B. Kindleberger 1996 oder Olson 1982) hinauslaufen: Die
Aussage besteht nämlich hauptsächlich darin, dass Hegemonien oder Dominanzen zwischen den Ländern oder politischen Mächten zirkulieren. Das ist aber wohl eher eine Trivialität als eine Erkenntnis. Man kann allerdings auch dieser Fragestellung einen Sinn abgewinnen: Aus welchen sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen werden
Gesellschaften hegemonial, oder umgekehrt: fallen in ihrer Bedeutung zurück, nachdem sie
einmal hegemonial gewesen waren?
51
Wir gehen hier davon aus, dass die Kondratieff-Zyklen Entwicklungsschübe in bzw. Phasen der kapitalistischen Entwicklung darstellen. Doch die Wirtschaftsentwicklung ist in politische Zusammenhänge eingebettet und von ihnen mitbestimmt. Die wichtigste soziopolitische Entwicklung der letzten zweihundert Jahre war der Aufbau von Nationalstaaten bzw.
des Nationalstaats-Modells selbst. Wenn man einen Zusammenhang zwischen Schüben
und Phasen der Entwicklung in den Strukturen des internationalen politischen Systems
feststellen kann, dann ist dies für Österreich von vorrangiger Bedeutung. War doch das Gebiet der heutigen Republik politisches und wirtschaftliches Zentrum der Habsburgermonarchie bis 1918. Diese wiederum war sicher als Großmacht Europas zu betrachten.
Warum hat sich dann die Bevölkerung dieses Gebietes so spät zur Nation entwickelt?
Allerdings lag die Hegemonialphase der Monarchie vor der eigentlichen kapitalistischen
Entwicklung Europas, die wir mit dem Beginn der Industriellen Revolution in England (der
Bequemlichkeit halber um 1775 zu datieren) beginnen lassen wollen.
2.3. Österreich im Rahmen einer Zentrum-Peripherie-Logik
Der Raum des späteren Österreich wurde im 1. Jahrhundert v. u. Z. zur wirtschaftlichen,
kulturellen und bald auch politischen Randzone des römisch beherrschten Mittelmeers. Es
fand eine bescheidene Urbanisierung statt. Damit bildeten sich lokale und kleinregionale
Zentren aus, die als Relais nach außen dienten und die Entwicklung des Gebiets gestalteten. In diesen Zentren kam es offenbar auch zur Alphabetisierung der Oberschichten. Wir
finden Ansätze einer ganz spezifischen Warenwirtschaft. Letztlich entstand eine spezifische römische Identität, welche sich ständig änderte. Diese peripher-römische Identität
war im 5. Jahrhundert zu einer christlichen geworden (Eugippius, etc). Das „römische
Österreich“ ist also ein legitimer Begriff, wenn man Österreich als Raum versteht.
Die norische Oberschicht hatte sich offenbar rasch assimiliert. „Einer ganzen Reihe von
keltischen nobiles wurde schon in augustäischer Zeit das römische Bürgerrecht verliehen“
(Gassner u. a. 2002, 77). Selbst die nördlich der Donau gelegenen Länder des heutigen
Österreich waren schließlich weitgehend romanisiert (siehe Ausgrabungen an den Leiser
Bergen). Was aber heißt „romanisiert“? Da waren einmal die kultischen Elemente aus Rom
und aus dem ganzen Imperium. Die provinzrömische Kultur war natürlich in Noricum eine
andere als in Syrien. Doch es gab einen administrativen und kommunikativen Verbund, der
eben Noricum ebenso einschloss wie das östliche Mediterraneum. Beide Peripherien
bezogen sich aber nicht aufeinander, sondern im wesentlichen auf das Zentrum, auf Rom.
Der Einfluss dürfte somit indirekt gewesen sein.
Somit war der spätere österreichische Raum Teil eines politisch organisierten großregionalen Systems. Der heutige Rückbezug darauf, der zumindest eine Zeit lang zur nationalen
österreichischen Identität der Mittelschichten gehörte, fiel allerdings der spätantiken-frühmittelalterlichen Zäsur zum Opfer. Das beste Symbol dafür ist nochmals Eugippius: Der
Leichnam des Heiligen Severin wurde beim Exodus der römischen Oberschichten mit nach
Süditalien transportiert.
Man muss nun fragen, was diese Zäsur tatsächlich bedeutete. Es war keineswegs eine Entvölkerung. Der größere Teil der Bauern, auch ein Teil der Städter, sind offenbar verblieben.
Wir wissen, dass es in Wien eine Siedlungs-Kontinuität gab. Was hat dies nun für Relevanz? Was es jedenfalls nicht gab, war eine Kontinuität der sozialen Identität.
Die Penetration der Welt durch die kapitalistische Warenwirtschaft vollzog sich in Entwicklungsschüben, in denen manche Gesellschaften zu Peripherien gemacht wurden, während es anderen gelang, den Status von Zentren oder zumindest von Subzentren zu errin52
gen. Die Industrielle Revolution hat in den westeuropäischen Ländern zu sehr verschiedenen Zeiten eingesetzt und ist mit höchst unterschiedlicher Geschwindigkeit verlaufen.
Insbesondere aber kann auch schon in dieser Frühphase die Entwicklung eines Landes keineswegs als unabhängig von jener der anderen betrachtet werden. Jede Wachstumstheorie,
welche dieses Entwicklungsmuster nicht beachtet, muss scheitern. Insbesondere lässt sich
die Entwicklung einer Wirtschaft nicht unabhängig von einem globalen System betrachten.
Aus diesem Grunde wirken auch die Versuche, der österreichischen Wirtschaftsentwicklung die Rostow`sche Etappenfolge (Rostow 1960, 1973 und 1976) aufzudrücken, im besten Fall aufgepfropft (Gross 1973). Im schlimmeren lenken sie von den wirklichen
Problemen ab. Das heißt nicht, dass diese Interpretationsversuche völlig nutzlos sind. Sie
können durch einen kritisch zu benutzenden "Take-Off"-Begriff auf wichtige Problemlagen
aufmerksam machen. Vor allem geht es dabei um den Punkt, wo nicht jede kleinste Erschütterung die Entwicklung aus dem Gleis wirft und zum Zusammenbruch führt. Doch
gerade die österreichische Entwicklung bietet sich für eine Untersuchung nach dependenzanalytischen Konzepten, nach einer Zentrum-Peripherie-Struktur, an.
Im politischen Bereich liegt es dann nahe, vor allem die Entwicklung der einzelnen
Nationen innerhalb des Habsburgerstaates mit dieser Struktur in Zusammenhang zu bringen: Das Konzept des inneren Kolonialismus hat dabei schön höchst wichtige Erkenntnisse
vermittelt und bleibt eine zentrale Interpretation (Hechter 1975). Nationalitätenkämpfe sind
für Auseinandersetzungen innerhalb dieser Struktur ein Ausdrucksmittel.
Gibt es ein österreichisches Ethnos? Damit wäre eine sich als ethnische Einheit verstehende Identität gemeint, welche quasi als Vorläuferin der österreichischen Nation betrachtet
werden könnte. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts verstand man unter „Österreicher“ –
wenn man von der Bevölkerung und nicht der Dynastie oder der Regierung sprach – ausschließlich die Nieder- und Oberösterreicher. Weiters gab es die Steirer, die Tiroler, die
Kärntner und die Salzburger, natürlich nicht die Burgenländer und auch nicht die Vorarlberger. Hier tritt in der herkömmlichen Historiographie nun ein Problem auf: Es wird
sehr wohl ständig von den „Deutschen“ gesprochen, und die deutschsprechenden Österreichern werden ihnen ohne weiteres zugezählt. Die Österreicher hätten sich von den
Deutschen „abgespalten“, lautet eine Formulierung.
Schon um 1000 u. Z. herum hatte in Europa die wichtigste politische Transformation endgültig stattgefunden, die von einer Stammespolitie zu Territorialherrschaften. Die Mittelaltergeschichte spricht davon unter dem Begriff des "Landesausbaus". Dies und auch die
folgenden Entwicklungen gingen mit einer starken Bevölkerungsentwicklung Hand in
Hand. Insbesondere bildete sich ein Netz von Städten, wobei quantitativ die Entwicklung
vor allem im 13. Jahrhundert einen Sprung machte. Diese Städte bildeten in Hinkunft
zuerst neben und dann vor den Klöstern die eigentlichen Standpunkte einer neuen Intellektuellenschicht. Die folgende Entwicklung erlebte einen sozialen und wirtschaftlichen
Rückschlag durch die große Krise Mitte des 14. Jahrhunderts, welche man gewöhnlich
durch die Pestepidemie in Europa 1347 und in den Folgejahren kennzeichnet. Sie dürfte
einen Bevölkerungsrückgang um ein Drittel zur Folge gehabt haben. Allerdings bedeutete
dieser in der Wirtschaftsgeschichte eher unter dem Stichwort der "Agrarkrise" abgehandelte Einschnitt keinen dauerhaften Rückschlag. Auch in unserer Region dürfte bereits
nach wenigen Jahrzehnten das frühere Niveau wieder erreicht worden sein. Nun begann
wiederum eine Kommunikationsverdichtung. Sie wird diesmal nicht mehr vorrangig durch
eine Gründungswelle von Städten signalisiert. "Während sich das Netz der Städte kaum
53
verdichtet hatte, sind im Spätmittelalter viele Marktorte und dörfliche Siedlungen durch
Ortserweiterungen angewachsen" (Klein 1980, 108). Dabei verschob sich der Siedlungsschwerpunkt im künftigen Österreich immer mehr in den Osten.
In der frühen Neuzeit begann sodann die Ausdifferenzierung der politischen Struktur zu
einem eigenem Apparat und damit potentiell die Ablöse der direkten Abhängigkeit der
Politik von den gesellschaftlichen (z. B. wirtschaftlichen) Herrschaftsverhältnissen. Dieser
Punkt ist der wichtigste Schritt in der politischen Entwicklung überhaupt, weil er den
Schritt zum modernen Staat bedeutet.
Götz von Berlichingen hat uns eine Biographie hinterlassen. Er schrieb sie in hohem Alter,
schon über der Mitte des 16. Jh. Diese Schrift besteht aus einer endlosen Aneinanderreihung von Geschichten und Erzählungen über Fehden und Streitereien, wo er sich jedenfalls
"im Recht" gegenüber seinen Gegnern sah. Aber dieses Recht wollte er immer höchstpersönlich durch Waffengewalt durchsetzen. Das war in der frühen Neuzeit jener "bellum
omnium contra omnes" in der Realität. Er machte das primitivste menschliche Anliegen,
die Selbsterhaltung, zum reinen Zufallsspiel. Es war ein allgemeines Anliegen, diesen
Zustand zu ändern.
Krisenhafte Situationen waren auch hier – wie schon bei den Usurpationen der Tyrannen –
Gelegenheiten für die Sieger, die Entwicklung weiter zu treiben. Die Reformation fand
zuerst gerade auch in Österreich einen fruchtbaren Boden, und es schien, als ob die habsburgischen Länder eine solide Stütze für die neue Konfession würden. Die Gegenreformation setzte dem ein Ende und damit dem ersten Ansatz einer unabhängigen intellektuellen
und politisch-bürgerlichen Entwicklung. Der vollständige Sieg dieses roll back wird die
Entwicklung Mitteleuropas noch auf mehrere Jahrhunderte hinaus bestimmen bzw. beeinträchtigen. Im heutigen Österreich wurde damit die beginnende Moderne coupiert und bis
nahezu an das Ende des 19. Jahrhunderts verschoben.
Als der 30jährige Krieg ausbrach, nutzen die Habsburger die Gelegenheit: "Der Kaiser war
entschlossen, seinen Sieg [in der Schlacht am Weißen Berg am 8. November 1620] bis zum
Äußersten zu nutzen... 30.000 Familien sollen in der Folge das Land verlassen haben...
Zwei Drittel allen Grundbesitzes wurde von der Konfiskation erfasst. In Mähren wechselte
fast die Hälfte aller Herrengüter den Besitz.... Der Grundbesitz der Herren, des Hochadels,
verdoppelte sich fast in der nächsten Generation, aber es war eine neue Herrenschicht: es
waren nicht mehr die Verfechter einer ständestaatlichen Oligarchie, sondern es waren
habsburgtreue Herren aus allen Landen, Spanier und Italiener, Flamen und Deutsche,
Kroaten und natürlich auch Tschechen, die die Gunst der Stunde zu nutzen wussten,
nachdem sie sich 16220 auf der habsburgischen Seite gehalten hatten." Die Verneuerte
Landesordnung von 1627 war die "Verfassung" dieser neuen Epoche: "Auf die ständische
Renaissance folgte das absolutistische Barock... Die böhmischen Länder [sanken] ...
endgültig in die Rolle von Nebenländern, von Provinzen herab" (Seibt 1993, 177 f.).
Später als in vergleichbaren Nationenbildungen in Westeuropa begann ein zentralisierender
Prozess in den deutschsprachigen habsburgischen Kernländern. Nach einer frühen Verselbständigung der österreichischen Kernländer (Privilegium Minus 1256 – Appelt 1983) stockte die politische Integration über ein halbes Jahrtausend lang. Der springende Punkt für die
Nationenbildung ist, dass diese Länder staatsrechtlich nie eine Einheit bildeten. Sie hatten
z. B. auch keine Generalstände, sondern waren in Personalunion unter den Habsburgern
versammelt. "Das Prinzip der Unteilbarkeit des ganzen Bestandes der Länder brach sich
nur langsam und unter wiederholten Rückfällen Bahn" (Bernatzik 1911, 3). Ein eher später
54
staatsrechtlicher Einigungsversuch, die sogenannte Pagmatische Sanktion 1703/ 1713
(Texte bei Bernatzik 1911, 1 – 48), mit der die Unteilbarkeit der Erblande bzw. des
gesamten Länderkomplexes statuiert wurde ("ohnzertheilt"), zeigte kaum Wirkung. Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass es daneben noch das "Heilige Römische Reich" gab,
über dessen Kaisertitel die Habsburgerherrscher ihr höchstes formales Prestige bezogen.
Mittlerweilen ist es bekannt genug, dass dieses "Reich" trotz seines Mangels an irgendwelchen positiven Impulsen, negativ noch immer eine Struktur war, welche zu allen
anderen Rückständigkeiten hinzu ein nicht unwichtiges Hindernis der Nationenbildung in
diesem Raum war.
Es ist insofern nicht uninteressant, wenn zu dieser Zeit ein junger schlesischer Dichter,
Johann Christian Günther nämlich, in einem 500 Zeilen langen Gedicht der Marke Lob und
Hudel (“Auf den zwischen Ihro kaiserl. Majestät und der Pforte An. 1718 geschlossenen
Frieden”), ausgerechnet auf den Prinzen Eugen bzw. teils auch auf Karl VI., plötzlich einen
frühen deutschen Nationalismus demonstriert: Das Wort deutsch kommt hier ein halbes
Dutzend Mal vor, und auch Hermann taucht plötzlich als “Ahnherr” auf (wessen? des
Prinzen Eugen? doch wohl eher Karl VI. oder vielleicht auch der Mannschaft).
Im übrigen darf man auch nicht vergessen, in welchem Zusammenhang die Pragmatische
Sanktion entstand: Es war der Spanische Erbfolgekrieg, welcher die Verwundbarkeit einer
rein dynastischen Konstruktion zeigte, zumal, wenn diese noch eingeengt durch Auffassungen war, wie sie etwa die eindeutige Priorität der männlichen Erbfolge war. Als dieses
dynastische Regelwerk 1713 in seinen wichtigsten Dispositionen verabschiedet wurde,
waren die Habsburger gerade im Begriff, trotz ursprünglicher massiver Überlegenheit ins
Lager der Verlierer dieses Krieges abgedrängt zu werden. Das war sicherlich zum einen
politische Unfähigkeit. Doch dazu kam ein Quentchen Pech: Der Tod des für die mitteleuropäischen habsburgischen Länder sowie für die Kaiserstellung vorgesehenen Prätendenten warf die bisherigen Interessen der Verbündeten über den Haufen. Sie hatten kein
Interesse an einer Personalunion zwischen Spanien und den habsburgischen Erblanden mit
Zubehör. Aus dieser Konstellation ergab sich übrigens noch etwas, was im Augenblick von
geringer Bedeutung war, langfristig sich jedoch als entscheidend erweisen würde: Aus dem
Erbfolgekrieg ging auch Preußen nicht nur gestärkt, sondern mit neuer Legitimität (Königstitel) hervor und wird nun eine europäische Macht, mit der man bald rechnen wird müssen.
Wenn man etwa bedenkt, dass die englisch-schottische Parlamentsunion etwa zur gleichen
Zeit (1707) durchgeführt wurde, zeigt sich grell der archaische Charakter des Versuches,
über eine rein dynastische Regelung die Einheit dieses Länderkonglomerates herzustellen.
Mindestens ebenso kennzeichnend ist, dass die späten Versuche einer Umstrukturierung
der Monarchie sich bis ins 20. Jahrhundert hinein noch immer ganz formal auf die Pragmatische Sanktion beriefen.
Doch die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert bedeutete für Österreich trotzdem den
Übergang von einem Staat auf mittelalterlich-feudaler Rechtsgrundlage mit teilweise noch
personalistischen Bindungen zu einem territorialen Flächenstaat mit autonomem Staatsapparat. Der Prozess verlief langsam und graduell. Wirtschaftspolitisch und fiskalisch
drückte er sich in einem ständigen und schließlich qualitativen Bedeutungsverlust der Regalien und Kronländer als Quelle der Staatsfinanzierung aus. "Die Auffassung, dass Staatseinkünfte das Privateinkommen des Herrschers waren, das er nach Gutdünken ausgeben
konnte, ließ sich nur sehr schwer ausrotten" (Miller 1983, 226). Privatvermögen des Kaisers und Staatsvermögen wurden schließlich getrennt. Zunehmend übernahmen Steuerein55
nahmen die Finanzierungsfunktion. Diese waren vom Rechtsstandpunkt dieser Zeit Eingriffe in das Privatvermögen. Die Stände, vor allem der Adel, mussten diese daher erst bewilligen. Dieser mühsame und oft wenig ergiebige Prozess war somit gleichzeitig ein Aufbau des (modernen) Staates auf Kosten bisheriger Rechtsträger – ich vermeide das Wort
"Souveränitätsträger", obwohl es berechtigt wäre, weil es heute so stark belastet ist. Die
Dynastie bemühte sich, ihre Finanzquellen auf andere soziale Schichten zu verlagern, vor
allem das Bürgertum. Dazu musste dieses aber erst einmal in der Lage sein. Die logische
Folge war eine gewisse Förderung des Bürgertums. Der Hof unterstützte Manufakturgründungen durch Privilegien, gründete solche teils auch selbst (Mikoletzky 1966). Dies ist der
konkrete Inhalt der abstrakten Formel, der Absolutismus ist die (frühbonapartistische)
Politik des Klassengleichgewichts.
In der Habsburgermonarchie ist diese Politik mit dem Namen des Hofkammerpräsidenten
Thomas Gundacker von Starhemberg verbunden (Holl 1976, Berenger 1984). Diese Förderung des Bürgertums war ein höchst widersprüchlicher Prozess. Er zeitigte auch nicht so
schnell Wirkung wie erwünscht. Daher gab es Tendenzen, der Staat möge die wirtschaftliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen, wie die schon erwähnten Manufakturgründungen. Damit traten mit dem Merkantilismus im mitteleuropäischen Raum zum
ersten Male Begriffe wie Volkswohlfahrt und Nationalkapital in Erscheinung (Kellenbenz).
Man könnte den Merkantilismus vielleicht überhaupt als Ausdruck einer protonationalen
Wirtschaftspolitik sehen. Allerdings ist damit nur eine Dimension des nationalen Phänomens erfasst, wenn man auf die Zentralisierung in administrativer Art abzielt. Diese und
die wirtschaftliche Penetration eines Gebietes geht im Hochabsolutismus natürlich noch
nicht Hand in Hand mit der Suche nach einer Legitimation der Herrschaft durch
Volkssouveränität – und damit dem Versuch, der Politie einen gemeinschaftlichen
Charakter wenn schon nicht zu geben, so doch zumindest vorzuspiegeln.
Insgesamt war diese Politik nicht allzu erfolgreich (Srbik 1907). Sie wurde zu wenig konsequent betrieben. Das lässt sich an einem Detail als Indikator anschaulich darstellen. Der
moderne Staat und konsequenterweise auch schon der sich modernisierende bedarf systematischer Information über seine Bewohner und deren Verhältnisse. In diesem Sinne ist die
amtliche Statistik richtigerweise als ein wesentliches Kenzeichen dieses Staates bezeichnet
worden (Giddens 1987, 179 ff.). Wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, dass eine der
Leitwissenschaften (oder Ideologien?) der Moderne, die Ökonomie, aus dem Bemühen
entstand, die Ressourcen von Staaten systematisch abzuschätzen, einerseits, um eine relativ
rationale Besteuerung durchführen zu können, andererseits um die Kräfteverhältnisse
zwischen frühmodernen Staaten (insbesondere Frankreich und Großbritannien) auf eine
reale Basis zu stellen. So entwickelte Sir William Petty (1986) Mitte des 17. Jahrhunderts
die Grundbegriffe der politischen Ökonomie. Wir sehen dabei, dass der Begriffsbestandteil
“politisch” alles andere als Zufall war. Das waren allerdings damals noch private Bemühungen, ebenso, wie Datensammlung und Datenaustausch der ersten demographisch interessierten Intellektuellen. Doch in dieser Zeit begannen auch schon die systematischen Versuche seitens der Staatsapparate, Daten insbesondere in Hinblick auf ihre “Peuplierungspolitik” zu sammeln, vor allem mittels Volkszählungen. Hier müssen wir nun feststellen,
dass die Maria-Theresianische Volkszählung von 1754 ähnlichen Unternehmungen in anderen Staaten in der Qualität in nichts nachstand. Bald aber kamen vergleichbare Bemühungen im Habsburgerstaat nahezu zu einem Stillstand. Erst für das Jahr 1828, um kurz
vorzugreifen, haben wir ein Statistisches “Handbuch” für den Habsburgerstaat – und zwar
in sechs handgeschriebenen (!) Exemplaren. (Es soll weitere 94 Kurzfassungen gegeben
56
gaben – Zeller 1979, 20.) Die gesammelten Daten etwa über Steuereinnahmen und
Staatsausgaben waren nur für die Staatsspitze, und in verringertem Umfang für die oberste
Gruppe der Bürokraten bestimmt; alle anderen sollten sie nichts angehen, wie es im
Vorwort dieser – man ist versucht zu sagen – Kuriosität ziemlich deutlich heißt.
Joseph II. schließlich versuchte sich im Staatsaufbau von oben herab – heute würden die
US-abhängigen Sozialwissenschafter wohl sagen; „nation-building“. Er wurde zum Idol
der Bürokraten schlechthin, weil er selbst als der oberste Bürokrat auftrat. Das unterschied
ihn auch von seiner Mutter, Maria Theresia, die viel stärker dem Typus der barocken
absoluten Herrscher entspricht. Der moderne Staat aber ist bürokratisch-einheitlich, und
das strebte Josef an. Aus verschiedenen Gründen scheiterte er.
Erst die napoleonischen Kriege bedeuteten einen wesentlichen Schritt zur vollen Durchsetzung ungeteilter staatlicher Souveränität, auch auf fiskalischem Gebiet. Überhaupt lässt
sich verallgemeinernd sagen, dass Kriege immer einen Quantensprung der "Staatsquote"
(um diesen heutigen Begriff zu benutzen). Sie geht nachher nie dauerhaft auf das alte
Niveau zurück. "Staatliche Ausgaben nach einem Krieg ... (pendeln) sich auf höherem
Niveau als in der Vorkriegszeit ein" (Schissler 1982, 377). Diese Staatsquote kann aber in
diesem Zeitraum und bis in die Gegenwart durchaus als Modernisierungsindikator
betrachtet werden: Nach Deutsch (1953) hat Nation als eine ihrer Hauptfunktionen bei der
nationalen Integration Umverteilung zu besorgen. Dafür muss sie über einen erhöhten Teil
des Nationalproduktes verfügen. Wie sie zu dieser Verfügungsmacht kommt, ist allerdings
eine andere Sache – es geht praktisch immer nur auf dem Weg des "Staatsnotstandes".
In den USA war der Krieg zumindest zweimal ein Wendepunkt im Aufbau eines zentralisierten
Staates. Weil als unabdingbare Notwendigkeit erschien, was vorher nur eine kleine Gruppe von
Politikern und Intellektuellen vertreten hatte, stärkte er entscheidend die Zentralgewalt gegen die
Einzelstaaten. Krieg macht eine in der Tendenz totalitäre Politik für die Bevölkerung plausibel.
Das beginnt bereits im Frieden mit der allgemeinen Wehrpflicht: Liturgische Leistungen sind mit
dem Zugriff auf die menschliche Person direkt verbunden und deswegen von ihrem Charakter her
bereits total. Von hier ist der Schritt zum Totalitären nicht nur sprachlich sehr kurz. - Schon der
Erste Weltkrieg war für die USA nicht von derselben Bedeutung wie für Europa. In Europa war er
für die kriegsführenden Staaten eine Angelegenheit auf Leben und Tod. Er hat schließlich
tatsächlich die Vorkriegsordnung zum Einsturz gebracht. Für die USA war er hingegen ein
klassischer Krieg, wenn auch in etwas größerem Maßstab. Doch er blieb ein wenn auch
kostspieligerer imperialistischer Krieg, in den die USA auch nur eher kurz verwickelt waren. So
waren denn auch die Rückwirkungen im Inneren nicht zu vergleichen mit denen, welcher dann der
Zweite Weltkrieg für die USA brachte. Typischerweise entstand der militärisch-industrielle
Komplex mit dem jetzt starkem staatlichen Interventionismus während des Zweiten Weltkrieges
und nicht schon ein Viertel Jahrhundert zuvor. In diesem Zusammenhang ist es sicher lehrreich,
das nachzulesen, was Lenin über die deutsche Kriegswirtschaft des Ersten Weltkrieges schrieb.
Überhaupt sind die Quantensprünge der Staatsquote in Kriegen zu beachten! Kriegswirtschaft ist
auf einem Gebiet das, was Staatsinterventionismus vorgibt, auf allen Gebieten zu wollen. Es war
jedenfalls eine starke Regierung des big business. Mit diesem Komplex – und nicht etwa schon
während des New Deal – entstand schließlich der starke Staat (dazu vgl. auch p. 68 der
"Federalists"). Letzteres gilt auch für die soziale Komponente, die man üblicherweise allein dem
New Deal zuschreibt (vgl. Adams 1976, 19 f.).
Übrigens realisierten die Behörden zur selben Zeit, welche sozialen und politischen Folgen
mit beschleunigter wirtschaftlicher Entwicklung gewöhnlich verbunden waren: Der Ruf
nach Partizipation und Selbstbestimmung wurde laut. Er wurde in den Jakobinerprozessen
blutig unterdrückt. So bahnte sich jene Politik an, die für den Vormärz kennzeichnend wer57
den sollte. 1802 wurde die Einstellung der Errichtung von Fabriken in Wien und in den
Vorstädten angeordnet. Nach dem Staatsbankrott 1811 wurde die Vorschrift gelockert. Sobald die Lage leidlich konsolidiert war, folgten 1822 neue Beschränkungen. Nach einem
kurzem liberalen Zwischenspiel (1827 f.) kam 1831 neuerlich eine Gewerbesperre. In der
Folge nahm die Staatsgewalt jede Gelegenheit wahr, dem "Liberalitätsprinzip" einen
Schlag zu versetzen. Dies alles brachte den bisher recht gut entwickelten österreichischen
Ländern den ersten schweren Rückschlag ihrer wirtschaftlichen (und sonstigen) Entwicklung. Erst nach dem Tode Franz I. (1835) begann sich die Situation etwas zu entspannen.
Die reaktionäre Wirtschaftspolitik dieses Monarchen hatte in der instinktiven Furcht vor
den geahnten gesellschaftsumgestaltenden Folgen einer raschen wirtschaftlichen Entwicklung gewurzelt. Franz hasste den "Industrialismus" als Nährboden des Liberalismus
(Zenker 1897, 309 f.): "Die Staaten, welche etwas von der Gefahr der vollendeten freien
Industrie, der vollendeten freien Moral und dem vollendeten menschenfreundlichen Handel
ahnen, suchen die Kapitalisierung des Eigentums – aber vergeblich – aufzuhalten" (Marx
1953, 309). Mit diesen Behinderungen und Schikanen orientierten sich die deutschsprachigen Bewohner der Monarchie allerdings erst recht nach außen. Der Vormärz wurde
auf diese Weise zur Geburtsstunde des Deutschnationalismus im Habsburgerstaat.
2.3.1 Bernard Bolzano (1781 – 1848) – der traditionale Rebell des Vormärz
Der Josephinismus hatte weitreichendere Folgen für die intellektuelle Entwicklung als für
die wirtschaftliche und politische. Allerdings erwies er sich in seiner Beschränkung als
Sackgasse. Die Tradition brach schließlich ab, ohne wirklich geschichtsmächtig zu werden.
Das ist mehr als nur für die österreichische Entwicklung interessant. Denn im Grunde
waren “die Josephiner” dieselben Typen, wie sie später Max Weber (1981) als kennzeichnend für den frühen Kapitalismus und geradezu schicksalhaft für seine Entwicklung
beschrieb. Im Habsburgerstaat wurden sie aber nicht unbedingt zu erfolgreichen Unternehmern, sondern zu Beamten und Privatgelehrten.
Die Lebensgeschichte Bernard Bolzanos, geboren in einer Kaufmannsfamilie, gleicht in
seinen fast karikaturhaft trocken-rationalistischen Charakterzügen, besonders der Kindheit
und Jugend, zum Verwechseln jenen des Benjamin Franklin, welche Weber als das Musterbild des puritanischen Menschen analysiert hat. Er war ein “pedantisch-puritanischer Geist,
... von ausschließlichem Interesse für Nützlichkeit und Allgemeinwohl, ... mit ethischem
Rigorismus”, der in seinen Tagebüchern “jede kleinste Ausgabe [verzeichnet] und über
jede Stunde des Tages Rechenschaft [ablegt]” (Winter u. a. 1967, 9 f.). Allerdings wird er
nach einigen Überlegungen katholischer Priester und Professor an der Prager Universität.
Als Rationalist wird er der katholisch-reaktionären Restauration des Kaisers Franz bald
verdächtig. Doch anfangs schützt ihn noch sein Beziehungsnetz, da selbst der hohe Klerus
teils noch aus Josephinern besteht. Wenn sich allerdings “Papst und Kaiser vereint um
[seine] völlige Vernichtung” bemühen (a. a. O., 16), hilft das letztlich auch nichts mehr. Er
wird relegiert, kann aber dank des noch immer vorhandenen Schutzes einflussreicher Kreise in bescheidenen Verhältnissen weiter seinen Interessen nachgehen, nämlich der Logik
und der Philosophie. Für die politischen Verhältnisse interessiert er sich nur ganz theoretisch. Der angeblich republikanisch und demokratisch Gesinnte ist völlig außerstande, die
Prozesse seiner Zeit zu verstehen. Kurz vor seinem Tod geht die revolutionäre Welle 1848
durch Europa – er steht ihr nicht nur verständnislos gegenüber, sondern lehnt sie sogar ab.
Ebenso verständnislos steht der Sohn eines zugewanderten italienischen Kunsthändlers, der
in Prag nahezu ausschließlich in deutschsprachigen Kreisen verkehrt, den nationalen
58
Bestrebungen überhaupt, nicht nur der Tschechen, gegenüber. Das ganze Leben Bolzanos
ist geradezu ein frappantes Gegenbeispiel zur Weber-These. Es zeigt, dass es mindestens
ebenso sehr die soziale und politische Struktur ist, welche über die Wirkung des
Rationalismus und der rechenhaften Lebensführung entscheidet, als umgekehrt.
An Bolzano lässt sich aber auch die Isolierung “österreichischer” Intellektueller von der
intellektuellen Entwicklung im deutschsprachigen Raum ebenso wie in Westeuropa erkennen. Hegel bestimmte das politisch-philosophische Denken im deutschen Sprachraum
außerhalb Österreichs – in Österreich war er weitgehend unbekannt. Der Habsburgerstaat
fürchtete ihn offenbar. Das ist geradezu lächerlich, denn Hegel wäre nicht zuletzt für die
Habsburger gut verwendbar gewesen. Doch da waren die Junghegelianer. Diese Revolutionäre bestimmten offenbar das Hegel-Bild, sodass ausgerechnet der Ideologe eines machtorientierten radikalen Konservatismus in "Österreich” unerwünscht war. Ganz zufällig war
dies natürlich nicht. Denn Hegel war in seiner Art – trotz seines Staatsmythos, ein
Rationalist. Deswegen konnten ihn die Junghegelianer denn auch so leicht “vom Kopf auf
die Füße” stellen. Der Habsburgerstaat aber war beherrscht von klerikaler Bigotterie und
von Willkür.
2.4. Das 19. Jahrhundert – Die Zeit bis zum ersten Weltkrieg
Der josephinische Wunsch, eine von Sprachkriterien unabhängiger habsburgischer Übernation aufzubauen, war gleichzeitig utopisch und reaktionär, weil er die sich an der Sprache entwickelnde Partizipation des Volkes, seine "Souveränität", nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Er blieb weitgehend folgenlos, hatte aber noch einmal ein Echo gegen Ende
der Metternich-Ära, als Alternativprogramm zum demokratisch orientierten Deutschnationalismus (vgl. Rumpler 1997, 271). Denn schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts begann
sich die dünne Intellektuellenschicht auf die deutsche Nation hin zu orientieren. Nach
gewissen Indizien dürfte das Volk diesen Nationalismus kaum geteilt haben. Doch diese
deutschnationalen Kräfte standen später am Ursprung aller österreichischen Parteien,
insbesondere auch der Sozialdemokratie. Es gelang ihnen daher, die Frage der österreichischen Identität und Nation offen zu halten.
Es ist durchaus interessant, wie in einem deutschen Reiseführer aus Leipzig die Wiener
Gesellschaft um 1840 herum charakterisiert wird. Zum einen wird eine gewisse Polyzentrizität bemerkt – nicht völlig überraschend in dieser Sammlung von Ständestaaten: "Es
ist kein Zweifel, dass Wien als der Brennpunkt des geistigen Lebens in den deutschen Bestandteilen der Monarchie betrachtet werden darf, wiewohl es nicht – wie Paris die bewegenden Kräfte ganz Frankreichs verschlingt und sozusagen alle Individualitäten in einen
einzigen lebendigen Organismus verwandelt – die Strebungen in den deutschen Provinzen
in gleicher Weise an sich zieht; die letzteren sowohl als die Hauptstädte der nicht deutschen des Kaiserstaats wirken wohltätig auf das geistige Leben in Wien zurück, und auf
solche Art erhält sich ein großartiger Wechselverkehr zwischen den Nationalitäten" (Duller
o. J., 109 f.). Der intellektuelle bürgerliche Reiseführer betont schließlich die intellektuelle
Hegemonie des Adels und der "Geldaristokratie". Das Bürgertum ist erst im Aufstieg begriffen, und die mittlere Bürokratie kommt schlecht weg, wird als beschränkt und dünkelhaft charakterisiert. Eine historische Arbeit der neuesten Zeit bekräftigt dies: "Das neue
Berufsethos des Beamtenstandes war ... spezifisch 'mittelständisch' (und mittelmäßig) und
unterschied sich wohl überall in Europa grundsätzlich von den aristokratischen Idealen"
(Heindl 1990, 236). Über Russland hat man Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt: “Jetzt ist
klar ersichtlich, dass der innere Prozess der bürgerlichen Entwicklung in Rußland nicht
59
früher als zu jenem Moment beginnt, da sich der russische Adel der Bourgeoisie zuwendet”
(Belinski an Annenkow, zit. bei Plechanow 1975 [19895], 405). Wortwörtlich dasselbe
hätte man auch über das vormärzliche Österreich sagen können – und über das habsburgische Österreich bis 1918 überhaupt. Auch die Frage, was eigentlich schlimmer sei:
der Kapitalismus oder das Fehlen, die mangelnde Entwicklung des Kapitalismus, hätte man
für Österreich stellen können, und tat dies später dann auch.
Von Interesse ist auch, wie etwa die Fronleichnamsprozession als der Höhepunkt aller
kirchlichen Feste als das religiös-politische Zeremoniell schlechthin beschrieben wird, an
dem alles, was in der Stadt irgend Rang und Namen hat, teilnimmt. Sie ist gewissermaßen
spätbarockes "Großes Welttheater". Doch die Beschreibung der kirchlichen Feste geht
völlig bruchlos und unvermittelt in jene sonstiger Faschings-Vergnügungen in Musikgärten
und Strauß'schen Konzerten über. Es ist diese Art von Wien- und Österreichbild, das
Phäaken-Stereotyp, welches bis in die Gegenwart nicht völlig verschwunden ist und noch
immer das österreichische Image bei Nichtösterreichern prägt.
Was der Reiseführer allerdings nicht erzählt, ist der Hass, den dieser Metternich'sche Staat
damals sowohl im Ausland als auch bei seinen eigenen Untertanen, sofern sie versuchten,
die Augen ein wenig offen zu halten erweckte. Damals wurde zum ersten Mal die Grundlage eines nationalen Selbstbewusstseins beinahe irreparabel beschädigt: Alle jene, welche
deutsch sprachen und die habsburgische Knute nicht als das höchste der Gefühle sehen
konnten, begannen sich zu diesem Zeitpunkt auf Deutschland zu orientieren. So glaubten
die Eliten des 19. Jh. fast durchwegs, sie seien Deutsche. Die demokratische Bewegung der
Monarchie wird sich über alle Gegensätze hinweg deutschnational ausrichten. Das war
umso leichter, als ein politisches Deutschland gar nicht existierte, man sich also sehr leicht
ein Traumland zurechtzimmern konnte. "Deutschland" wurde so für einen Teil des intellektuellen Bürgertums zur politischen Utopie.
Man könnte meinen, dies sei ideal für eine Projekt-Auffassung der Nation. Wie wenig dies
daraus folgt, zeigt die Stellung Franz Schuselkas. Schuselka (1843) kann als ein früher
integraler Nationalist beschrieben werden. Sein ganzes Selbstwertgefühl bezog er aus dem
erhebenden Gefühl, „Deutscher“ zu sein – obwohl sein Name auch nicht gerade „urdeutsch“ (mehrfach in seinen Schriften) klingt. Doch er steckt auch in einem gewissen
Dilemma. Denn, überzeugt davon, dass „alle kleinen und isolirten Staaten zur Ohnmacht,
zum langsamen Absterben verdammt sind“ (62), ist er staatsfromm und dynastietreu. Obwohl „Liberaler“, ordnet er doch sein politisches Programm dem ethno-natioalen Wunsch
unter, welchen er trotz aller auch nationaler Unterdrückung bei den Habsburgern aufgehoben sehen wollte. Dafür ist er bereit, seine Augen vor jeder Realität zu schließen bzw.
diese seinen Wünschen nach zurecht zu biegen und zu interpretieren. In einigen Zügen
kann er aber durchaus für den Typus des deutschen Nationalisten heran gezogen werden.
Seine Sprache ist religiös: „Aber Gott verlässt die Deutschen nicht, und wenn er sie
züchtigt, ist er ihnen am gnädigsten“ (3). Deutschland – was das ist, ist wieder nicht ganz
klar, gewöhnlich meint er bürokratisch damit den Deutschen Bund – , Deutschland ist also
Israel, das auserwählte Volk.
Der Gedanke einer österreichischen Eigenständigkeit wurde jedoch von den meisten mit
den verhassten Habsburgern verbunden. Das bis heute klassische literarische Zeugnis für
diesen Hass bildet eine Schrift. die einen ungeheuren Einfluss auf das Image des Habsburgerreiches gerade auch im übrigen Europa ausgeübt haben dürfte, geschrieben von
einem aus Brünn geflohenen Mönch, der als Schriftsteller bekannt wurde: Charles Seals60
field (1994). Karl Postl (1793 – 1864), wie er ursprünglich hieß (vgl. auch Grünzweig
1986), empfand jenen Hass, von dem er selbst schreibt, und der sich nicht zuletzt gegen die
Person des Kaisers Franz selbst richtet, der bei ihm in den schlimmsten Charakterzügen
erscheint. Er hat das Bild geprägt, das wir dann Jahrzehnte wiederfinden, das "deutsche
China" (MEW 9, 97), wie sich Marx verächtlich ausdrückte.
"Kaiser Franz ist eigentlich in allem und jedem das Vorbild der Österreicher. Sie
betrachten ihn wie einen Vater oder eigentlich wie einen Aufseher, dem sie sich jederzeit
nähern dürfen, und dem sie sich in allem unterwerfen. Ihre Gemütart entspricht sosehr der
des Kaisers, daß aus dieser Seelenverwandtschaft das beste Einverständnis zwischen dem
Österreicher und seinem Herrscher entstehen müßte.... Dieses Volk, trotz seines Hanges
zum Essen und Trinken, sicher eines der besten und gutherzigsten auf Erden, wird
merkwürdigerweise allgemein verachtet. Dafür gibt es zwei Gründe: Der eine ist der blinde
Gehorsam gegen den Herrscher, welcher die Österreicher dazu führt, im Augenblicke, wo
sie es mit der Regierung zu tun bekommen, aus Liebedienerei noch mehr zu leisten, als
ihnen befohlen wird... Der zweite Grund ist der Mangel an jeglichem nationalen Selbstgefühl oder an Tugenden, welche dieses erweckt... Der Kaiser kann nichts dafür, wenn die
Österreicher noch nicht das geworden sind, was sie sein werden, wenn sein System noch
zehn Jahre fortwirkt: die niedrigsten und treulosesten Menschen auf dem Erdenrund"
(Sealsfield 1994, 156, 158, 176).
Es war natürlich nicht die Person Franz I., die entscheidend war, obwohl in einem absolutistischen Regime selbstverständlich persönliche Defizienzen zu systematischen werden.
Es war das Regime. Es war sein Nachfolger, der schwachsinnige Ferdinand, der mitten im
19. Jahrhundert. tatkräftig vom Provinzadel unterstützt, nochmals eine Protestantenvertreibung inszenierte. Aus dem Tiroler Zillertal wurden 1837 ein knappes halbes Tausend von
Protestanten vertrieben, weil sie angeblich eine Gefahr für die Tiroler „Landeseinheit“
bildeten.
2.4.1 “Biedermeier” – Malerei als verordnete Ideologie
Bäuerliches Elend und Beschränktheit wird zur Idylle, zum bewusst ideologisierten
Leitbild vom "einfachen Leben" und der Bescheidung: Es sind die Städter welche dieses
Bild erträumen, welches Ferdinand Georg Waldmüller und etliche seiner Zeitgenossen in
die Malerei umsetzten. Biedermeier nennt man nicht nur die Periode, sondern seit etwa
einem Jahrhundert auch diese Malerei. Es hat keinen guten Ruf, trotz mancher Versuche
einer Wiederbelebung heute (vgl. Frodl / Schröder 1992). Verlogenheit und süßliche
Schilderungen bis zur unfreiwilligen Satire und Karikatur bei handwerklich oft
meisterlicher Durchführung ist ein Markenzeichen. Was sie weiters besonders charakterisiert, ist ihre eindeutige Verankerung in der Vormoderne. Während man in Paris bereits
die Autonomie der Kunst proklamierte und der Impressionismus entstand, bramarbisiert F.
G. Waldmüller in Wien noch von der “läuternden Moral” und der “echten Religiosität” als
den wahren Aufgaben der Kunst – und wird dafür ein halbes Jahrhundert später zum
“Rebellen” empor stilisiert (Frodl 1987, 1f.). Man kann daran den Abgrund ermessen,
welcher diese Personengruppe in seinem abgeschlossenen Reich von der neuen Zeit
trennte. Es kommt einem der Slogan der gleichzeitigen deutschen Religionskritik in den
Sinn: “Religion – hier müsste es sinngemäß heißen: “Kunst” – ist Opium für das Volk.”
Was so besonders auffällt, ist die Obrigkeitshörigkeit dieser Malergruppe, die nicht
umsonst vom Kaiserhaus enorm gefördert und geschätzt wurde: Ein erheblicher Anteil
unter ihnen malte nicht nur ständig die Angehörigen des Hofs, sondern war auch sehr
61
direkt vom Hof abhängig, als Beamte im Kunstbetrieb ihrer Zeit (Johann Peter Kraft, Peter
Fendi, Albert Schindler, usw.).
2.4.2 Die Romantiker und ihre “Österreich”-Begeisterung
“Natur / Landschaft” auf der einen Seite, “Geschichte” auf der anderen waren bei den Romantikern geradezu unlösbar assoziiert. Sie sahen beide als etwas ohne die Beeinflussung
durch den einzelnen Menschen Gewordenes, als Schicksal somit. Sie sind in diesem Sinn
beide “Struktur”, in welche sich erst episodenhaft aufgefasstes historisches Geschehen einschreibt, ob dies die dynastische Propaganda von der Frömmigkeit Rudolf von Habsburgs
ist, oder aber Alltags- und Volksfestgeschehen. Landschaften, das war in der vorher
gehenden Malerei nur Kulisse für den Auftritt der (dynastischen) Kulturheroen. Die
Historienbilder hatten die ideologisch hochstilisierten Topoi der Geschichte darzustellen.
Nun hat sich der Schwerpunkt verschoben. Die Landschaft wird nun selbst zur Trägerin der
Transzendenz, nicht mehr zur festgefrorenen Bühne für die Mythologie. Das alte Dorf und
die Burg, oft als Ruine, ist schließlich jener Topos, welches den Übergang von Natur und
Geschichte ebenso wie den Ablauf der Geschichte symbolisiert. Schließlich ist im
Vergleich zum vorhergehenden Klassizismus zu beachten: Die Vergangenheit heißt jetzt
nicht griechische oder römische Klassik, sondern “Mittelalter”, das Codewort für die
angeblich eigene Geschichte, die eigene Vergangenheit.
Sollte man die Romantiker, die einen Bezug zum Habsburgerstaat hatten, charakterisieren,
so fällt ihre enge Allianz mit den Herrschenden auf, die sich trotzdem stark von den Biedermeiern unterscheidet: Waren jene einfach brave Untertanen, so müssen die Romantiker
eher als religiöse Fundamentalisten gekennzeichnet werden, wenn man eine Parallele heute
sucht. Allerdings waren sie obrigkeitsfromme Fundamentalisten. Sie glaubten, in den
Habsburgern die Garanten ihrer Art des Katholizismus gefunden zu haben. Sie irrten sich
nicht im antimodernen Affekt der Dynastie, übersahen aber völlig, dass für diese die
Religion vor allem instrumentellen Wert besaß. Das hinderte viele unter ihnen nicht an
persönlicher Frömmelei. Den Anti-Rationalismus teilten sie mit diesen Alliierten allemal.
So waren habsburgischen Romantiker eine typische Intellektuellenbewegung. Doch im
Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen konnten sie kaum auf eine Mobilisierung im Volk
zählen.
Das also war der Ausgangspunkt für die Bildung der Moderne. Es gab in der neueren
Geschichte dieser Gesellschaft einige Paradigmenwechsel im Legitimationsschema. Das
kann nicht verwundern, wenn der Bruch in der politischen Geschichte in Rechnung gestellt
wird. Es konnte durchaus vorkommen, daß Autoren völlig konträr zu ihrer seinerzeitigen
Intention verwendet wurden.
Das passiert in allen nationalen Mythenbildungen. Als Albrecht von Haller 1729 die “Alpen”
schrieb, da betrieb er Rousseauismus avant la lettre: Es ging ihm um Kulturkritik und um ein
Gegenbild zu seiner städtischen Gesellschaft. Er selbst dürfte nicht im Traum auf die Idee
gekommen sein, hier ein Loblied auf eine “Schweizer Nation” zu schreiben. Wer dieses lange
Gedicht (490 Verse!) liest, ist eher erstaunt von der - wenn auch von Sympathie getragenen Distanz: Ohne nähere Informationen käme man kaum auf die Idee, daß hier ein Berner über einen
Teil des Kantons Bern schreibt. Man denkt . und das ist sicher beabsichtigt - eher an die edlen
Wilden eines fremden Erdteils. Nichtsdestoweniger wird er ein Jahrhundert später als Kronzeuge
des Schweizer Nationalcharakters angerufen werden (vgl. Zimmer 1998).
Versuchen wir eine Übersicht:
62
1) In der Monarchie lagen zwei Paradigmen, möglicherweise auch drei (was den rationalen
Untergrund zur sogenannten ”Lagertheorie” der neueren österreichischen Historiographie
bilden könnte), miteinander im Wettstreit, verkörpert von den entsprechenden Intellektuellengruppen:
a) Auf der obersten politischen Ebene und entsprechend der politischen Wirklichkeit
finden wir den a-nationalen Rechtfertigungsdiskurs der Konservativen, welcher den bestehenden Staat rechtfertigen sollte. Er war in der faktischen Kräfteverteilung dominant, weil er
die Grundlage des Staates und der Dynastie darstellte. Geistesgeschichtlich finden wir
unter ihnen allerdings wenig Profil.
b) Dazu in Konkurrenz stand bereits der großdeutsche und der deutschnationale Entwurf
der kommenden neuen Eliten, welche politische vor allem im Reichsrat vertreten waren.
Sie bildeten die eigentliche politische Konkurrenz der Konservativen, da sie auf ihre
Ablösung abzielten, und bestimmten weitgehend das Bild der Monarchie in der Endzeit.
“Besitz und Bildung” sollte die Voraussetzung für politische Partizipation sein. Die
politische Kultur, die tatsächlich “Bildung” in einem bestimmten Sinn voraussetzt, und
diese wiederum Ressourceneinsatz für eine bestimmte Elementarbildung, wurde in einen
Ausschließungsmechanismus verwandelt.
c) Ursprünglich ein Teil dieser Nationalliberalen, übernahmen später die Progressisten, und
unter ihnen vor allem die Sozialdemokraten die Hegemonie des nichtkonservativen Lagers.
Folge war allerdings, daß die Nationalliberalen sich weitgehend den Konservativen
anschlossen, sodass erst wieder nur zwei Hauptströmungen übrigblieben. Ausgehend vom
Linkshegelianertum - das, wie der Hegelianismus überhaupt, in Österreich nur in Spuren zu
finden war, waren doch Kant und Hegel auf den österreichischen Hochschulen verpönt übernahmen sie bald marxisierende Phrasen. Das wurde schließlich sogar zum eigentlichen
Identitätsmerkmal. Ihrer Ohnmacht im Realen entsprach die kompensatorische These vom
zwangsläufigen Ziel der Geschichte. Der intellektuellen Anmaßung entsprach die Vorgabe,
in einem angeblich “objektiven Interesse” der niedrigeren Klassen zu sprechen.
2) In der Ersten Republik verblich langsam der a-nationale Diskurs, obwohl er sich im
Ständestaat nach der Zerschlagung der Ersten Republik noch in der Gestalt der "österreichischen Mission" hielt. Doch dominant war vorerst eindeutig der deutschnationale
Diskurs, der im späteren Stadium sich mit dem Diskurs der österreichischen Mission
mischte und zu verbinden suchte: Die Österreicher seien die "besseren Deutschen", welche
die Aufgabe hätten, die Barbarei des Nazitums zu überdauern.
3) Zwischen 1945 und 1990 war nach gewissen Anfangsschwierigkeiten völlig und unbestritten der Diskurs der österreichischen Nation dominant. Die zahlenmäßig nicht unbeträchtlichen Teile der Bevölkerung, welche dem deutschen Diskurs noch nachhingen,
waren politisch an den Rand gedrängt und verstummt.
4) Nach dem Beitrittsgesuch der österreichischen Regierung zur EG gibt es Neuansätze zu
einem neuerlichen übernationalen Diskurs, der faktisch eine antinationale (anti-österreichnationale) Stoßrichtung hat. Dieser Diskurs kommt noch nicht so recht durch, obwohl ihn
insbesondere die konservativen politischen Kräfte und die mit ihnen verbundenen
Presseorgane nach Kräften fördern wollen.
2.5 Das Jahr 1848
Die Revolution von 1848 als nationale wie als demokratische Revolution scheiterte nicht
nur in den Ländern der Habsburgermonarchie, darunter im späteren Österreich, sondern
63
auch in Deutschland, Italien, und Frankreich. Das Scheitern der Revolution in Österreich
brachte auch die nationalen Emanzipationen der nichtdeutschen Bevölkerungsteile kurzfristig zum Scheitern. Hier zeigte sich in einzelnen Episoden, dass die nationalen Egoismen
bereits gemeinsame Interessen überspielen konnten. Die Koalitionen im konstituierenden
Reichtag verliefen oft bereits nach nationalen Grenzen. Als die Habsburger und ihre Büttel
schließlich siegreich waren, war dies für einige Gruppen auch aus der Bevölkerung Anlass
zu einer ganz spezifischen Freude: "Der [in Prag] siegreiche Feldmarschall Windischgrätz
bekam eine Dankadresse von den Deutschen aus den böhmischen Randgebieten, und fortan
brach sich unaufhaltsam die nationale Trennung im Lande Bahn, ... um die Jahrhundertwende mit einer uns heute verblüffenden Desintegration der beiden Nationen. Die
österreichische Nationalitätenpolitik war außer Stande, diesen Desintegrationsprozess
zugunsten einer höheren Staatsidee an sich zu ziehen" (Seibt 1993, 213).
Der erbitterte nationale Kampf im letzten halben Jahrhundert vor dem ersten Weltkrieg war
nur der Höhepunkt dieser zuerst von der Dynastie nicht ungern gesehenen Entwicklung.
Der Einsatz war die politische Dominanz in der Monarchie. Es war, wie Karl Rennner
1902 ein Buch betitelte, "der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat".
2.5.1 Ein “48er”
Hans Kudlich, der in manchen Schulbüchern als “Bauernbefreier” erscheint, war eine der
kennzeichnendsten Figuren des demokratischen Militanten dieser Jahre. Sohn eines vergleichsweise wohlhabenden, wenn auch robottpflichtigen Bauern aus Schlesien, erzählt er
aus seiner Kindheit, wie stolz nicht nur die Dorfkinder, sondern die Dörfler insgesamt
waren, “Österreicher” und nicht etwa “Preußen zu sein: “Slawisch und preußisch waren
uns idente Begriffe ... Merkwürdig, daß wir deutschen Buben, obwohl uns im strengen
nationalen Gegensatz zu den Slawen fühlend, nicht die mindeste Ahnung von einem
Deutschland besaßen” (Kudlich 1873, I, 5 und 7). Das passt bestens zu Roseggers Aussage
vier Jahrzehnte später, dass den Bauern die Frage der nationalen Zugehörigkeit höchst
gleichgültig sei (wofür er dann von der deutschnationalen Presse schwer geprügelt wurde).
Wir müssen uns überhaupt immer wieder mit der Stellung der Bauern im Nationenaufbau
auseinandersetzen – ein Thema, das trotz Moore noch immer ziemlich vernachlässigt ist.
Es wird uns im Verlaufe dieser Arbeit begleiten. Gerade in den (im Hroch’schen Sinn)
„kleinen Nationen“ war diese Klasse – vielmehr dieser Klassenverband – von erheblicher
Bedeutung, stellten die Bauern doch in all diesen Nationen die übergroße Mehrheit der
Bevölkerung. Allerdings waren die Sozialstrukturen in der Landwirtschaft zwischen den
unterschiedlichen Gesellschaften und Ländern deutlichst verschieden. Im heutigen Österreich fand die persönliche Befreiung der Bauern erst unter Joseph II. statt und war eine
stille Revolution von oben. Schließlich initiierte Kudlich die Grundablöse. Trotz der
Gegenrevolution wurde dieses Projekt im Neoabsolutismus weiter geführt und vollendet.
Nunmehr aber war die Absicht dahinter transformistisch. Die Krone und die alte Elite
suchte die Unterstützung einer kulturell-konservativen Kraft, die noch dazu, wie schon
erwähnt, die breite Mehrheit der Bevölkerung stellte. Man bedurfte ihrer als Verbündeter
gegen das liberale Bürgertum und die radikalen Intellektuellen. Die gegenrevolutionäre
Absicht tat sowohl kurz- wie auch langfristig ihre Wirkung. Die österreichischen Bauern
wurden auch politisch konservativ und bleiben es bis heute, wo die Klasse als solche
langsam verschwindet. Wir werden auf dieses Thema aus Anlass des Austrofaschismus
noch zurück kommen, der seine Hauptstütze ebenfalls in den Bauern fand.
64
Damit nahm die ursprüngliche Akkumulation in Österreich auch eine spezifische Form an.
Diese Reform war schließlich die einzige von Gewicht, welche der Neoabsolutismus nicht
rückgängig machte. Für die Grundbesitzer, zumindest den aufgeklärten Teil von ihnen, war
sie langfristig durchaus von Vorteil: Es half zumindest Teilen unter ihnen, das nötige
Kapital für den Übertritt in die Industrie aufzubringen.
Ein Vergleich – den wir hier nicht im Detail durchführen können – mit der Rolle der Bauernschaft z. B. in Norwegen und Dänemark ist äußerst aufschlussreich. Die dortige
Tradition der freien Bauern hat die dänischen und norwegischen Gesellschaften und politischen Systeme bis heute geprägt. In Dänemark fand der Prozess der Grundablöse bereits in
den dortigen Agrarreformen von 1784 – 1788 statt. Es war nicht nur ein Vorsprung von
über sechs Jahrzehnten. Die dortige Revolution von oben – denn auch dort lief die Entwicklung im Rahmen des allerdings viel liberaleren aufgeklärten Absolutismus ab – war
als Entwicklungsschub gedacht und wirkte auch so. Eine selbstbewusste Bauernschaft
entstand, welche in ihrem wohlhabenderen Teil zwar zahlenmäßig nicht besonders stark
war, jedoch für längere Zeit zum Rückgrat des dänischen Nationenbaus und nie faschisiert
wurde. Nicht unähnlich lief die Entwicklung in Norwegen ab. Es ist wohl kein Zufall, dass
beide Entwicklungen in Kleinstaaten stattfanden, auch wenn der eine, Dänemark, der Rest
eines Reichs, der andere, Norwegen, ein sich emanzipierender kleiner Nationalstaat war.
Der politische Unterschied zum archaisierenden Habsburgerstaat mit seinen Reichsphantasien auch im liberalen Bürgertum, wo sich das ancien regime nochmals durchsetzte, ist
deutlich. Allerdings sollte man auch die Unterschiede wieder nicht überbetonen.
Für Kudlich selbst wurde die nationale Frage bald von übergroßer Bedeutung. Bereits als
Gymnasiast in Troppau wurde er von seinem älteren Bruder, der schon die Rechte
studierte, deutschnational indoktriniert. In seinem überaus lesenswerten Erinnerungswerk
taucht dann das Vokabel “deutsch” an jeder möglichen und unmöglichen Stelle auf, sodass
der Text für einen heutigen Leser manchmal schwer erträglich ist. Was aber bei ihm
mustergültig herauskommt, ist eine nationale Interpretation der modernen Geschichte im
allgemeinen und der Revolution im besonderen. Er sieht die nationalen Zugehörigkeiten
durchaus explizit als politische Projekte, während im Text selbst vor allem der Kampf um
diese Projekte sehr deutlich wird: “Deutsch” ist für ihn nämlich das, was die “deutsche
Linke” im konstituierenden Reichtag vertrat, ein demokratisches Projekt, das nicht weit
vom Republikanismus entfernt war. Sein manchmal fast schon pathologischer Tschechenhass, der noch seinen Antiklerikalismus überstieg, verhinderte allerdings, dass er dieses
Projekt in den Zielsetzungen der damaligen Tschechen auch sah. So wird aus dem rationalradikalen Ansatz ziemlich unvermittelt und ganz unreflektiert ein Deutsch-Chauvinismus,
die es den Nazis später leicht machte, ihn ideologisch zu vereinnahmen. Denn er sieht im
damaligen Österreich nur eine einzige “Cultur-Nation”, die Deutschen nämlich. Es ist in
diesem Sinn kein Wunder, wenn in Österreich die Geschichtsschreibung über 1848 noch
heute im wesentlichen von der reaktionären Grundstimmung geprägt ist, wie sie Kudlich
selbst für das Ende des 19. Jahrhunderts diagnostiziert: Der Deutschnationalismus hat es
der Konservativen leicht gemacht, die damaligen progressiven Protagonisten zu übergehen.
Dass sich vereinzelt authentische Linke des Themas annahmen (Fischer 1948), hat dem
eher noch Vorschub geleistet.
Dabei kommt in Kudlichs Erinnerungswerk, in seiner ausführlichen Schilderung der
Agierenden und der Geschehnisse, nichts deutlicher heraus als der Kampf um die Hegemonie über die Deutschsprachigen, die sich eben keineswegs alle als Deutsche empfanden.
65
Gerade sein Kampf gegen den “Sumpf des Centrums” (II, 26), die er als die eigentlichen
Schwarzgelben bezeichnet, und welche die Linke zahlenmäßig übertrafen, macht dies klar.
Damit hat er zwar recht, wenn er den Misserfolg der Revolution mit auf den schon damals
entflammenden Nationalitätenkampf auch im Reichtag zurückführt, ist aber außerstande,
seinen eigenen Beitrag zu sehen: Dass er und seine Gesinnungsgenossen mit ihrer nationalistischen Rhetorik es verabsäumten, sich für die gemeinsamen politischen bzw. sozialen
Anliegen Bundesgenossen bei den Demokraten anderer Nationen zu suchen, die sich in
nationalen (d. h.: Selbstbestimmungs-) Anliegen schließlich in ihrer Kurzsichtigkeit bei
den “Schwarzgelben” besser aufgehoben glaubten – bis ihnen von diesen selbst die Augen
geöffnet wurden; doch dann war es zu spät.
2.5.2 Strukturelle Gegebenheiten
Doch "Österreich" damals, jetzt nämlich i. S. der Habsburgermonarchie, war in der
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung von seiner eigenen Dynastie in
jenem kritischen Zeitraum gebremst worden, als anderswo die Industrielle Revolution den
großen wirtschaftlichen und die nationalen Revolutionen den großen politischen Sprung
nach vorne einleiteten. Als daher der Neoabsolutismus mit aller Gewalt versuchte, die
Großmachtposition Österreichs in Mitteleuropa zu erhalten, war dies längst ein vergebliches Vorhaben. Es sollte nur die latente Finanzkrise verschärfen und die wirtschaftliche
Entwicklung weiter behindern. Zu dieser Zeit hatte Preußen die Hegemonierolle schon
längst übernommen und brauchte sie nur mehr zu konsolidieren und nach außen hin
darzustellen. Mit den industriellen Leitprodukten Chemie, Maschinenbau und (später)
Fahrzeuge war es wirtschaftlich bereits dem Habsburgerstaat weit überlegen. Mit der politischen Leitidee der Nation drängte es die eben noch dominante Monarchie in eine periphere
Stellung. Österreich als Gesamtstaat hinkte in allem nach. Wenn eine Entwicklung "im
Schatten" einem Land und seiner Bevölkerung die Chance gibt, vergleichsweise wenig
gestört ökonomische und politische Modelle auszuarbeiten - aber Österreich war nie im
Schatten gewesen – , so behindert eine periphere Entwicklung in der kapitalistischen
Weltwirtschaft wahrscheinlich immer den Nationenaufbau. Die Kommunikationsstruktur
der peripheren Entwicklung ist nicht in das integrierende Netz mit Zentralknoten, sondern
der außengleitende Stern. Es findet also nur eine Integration mit dem Subzentrum statt,
keine vollständige Integration und Penetration. Dies wäre sogar noch der positivere Fall.
Im schlimmeren werden aus einem politisch umschriebenen System (von Staatsgrenzen
umschlossenen Gebiet) Teilnetze herausdefiniert und direkt an andere, extranationale
Zentren angehängt. Die strukturelle Integration wird auf diese Weise vollends behindert,
und diese ist allemal die Grundlage von kulturell-bewusstseinsmäßiger Integration, der
Identitätsbildung, auch wenn diese einen hohen Grad an Autonomie besitzt: Wenn das
kulturelle System als Steuermechanismus für eine Gesellschaft aufgefasst wird, so muß
zumindest ein zu steuerndes System vorhanden sein. Die Voraussetzung für den Aufbau
einer Österreichischen Nation im 19. Jahrhundert waren also von der strukturellen Seite her
denkbar ungünstig.
Das habsburgische Österreich, das in der Frühneuzeit in Europa dominant gewesen war,
hatte mit dieser Dominanzposition seinen Länderkomplex von der Wirtschaftsentwicklung
teilweise abzukoppeln versucht. Es war aber nicht hegemonial, schon wegen des Verzichtes auf die Reformation: Diese bedeutete gleichzeitig einen Verzicht auf den Anspruch
auf Souveränität, das unverzichtbare Mittel des modernen Staatsaufbaues. Die Industrielle
Revolution setzte hier wesentlich später ein als in Westeuropa, aber auch in Preußen. Neue
66
Entwicklungen im wirtschaftlichen und politischen Gebiet werden eben nicht von jenen
Kräften gefunden und implementiert welche eine Epoche dominieren: Die würden dabei in
der Regel verlieren. Möglicherweise sind wichtige soziale und politische Neuerungen nur
von Gesellschaften durchführbar, die in ihrer Zeit und im Vergleich zur dominanten
Struktur eine periphere Situation, aber wiederum nicht eine allzu periphere Position,
einnehmen. Hier ist "Peripherie" als formales Kriterium aufgefasst. Außerdem ist diese
Stellung allein sicher keine hinreichende Bedingung. Als solche muss eine bestimmte
Beziehung zum Zentrum gelten, die etwa als "wohlwollende Nichtbeachtung" zu benennen
ist. Dies gilt auch für die Institution der Nation.
Bis 1850 war das habsburgische Österreich jedenfalls ein politisches Zentrum in Europa,
wenn auch eines, das schon im Abstieg war. Die sogenannte „Abspaltung“ vom Monstrum
des alten deutschen Reichs (Pufffendorf) war im Grunde der Ansatz einer eigenständigen
Staatsbildung. Für ein zentrales Gebiet wäre dies nur naheliegend gewesen. Dieser Ansatz
blieb allerdings bereits bei Joseph II. stecken oder jedenfalls im Vergleich zu West- unjd
Mitteleuropa deutlich zurück.
In Westeuropa, aber auch im Rheinland und in Preußen schuf ein vereinheitlichender
politischer Wille die strukturellen Grundlagen des Nationalstaates. Die Habsburgermonarchie hingegen blieb bis 1848 ein "europäisches China". Zwar hatte auch hier der
Absolutismus versucht, die administrative Vereinheitlichung voranzutreiben. In den
österreichischen Ländern wurde zur Zeit Maria Theresias das Maßwesen vereinheitlicht
und auf die Wiener und niederösterreichische Norm ausgerichtet. 1775 wurden diese
Länder schließlich ein einheitliches Zollgebiet. Doch diese Integrationsschritte waren meist
zu kurz und zu zögernd: Dem politischen Willen, sie durchzusetzen, fehlte die Kontinuität.
So wurden z. B. auch Tirol und Vorarlberg erst 1878, als das metrische System durchgesetzt wurde, in diese Vereinheitlichung einbezogen. Tirol (und mit ihm Vorarlberg) hatte
lange nicht einmal zum österreichischen Währungssystem gehört. Dort war bis 1858 die
"Reichswährung" im Umlauf. Nur Zahlungen an amtliche Stellen mussten in W.(iener)
W.(ährung) oder C. (onventions) M. (ünze) geleistet werden. “Gutes Geld” oder “schlechtes Geld” war auch im übrigen Gebiet eine ständige Frage, wenn eine Zahlung fällig war.
Wenn man bedenkt, welch hohen symbolischen Wert gerade das Geldsystem für die
territoriale Identität in der Moderne besitzt, braucht man sich für die geringe Identifizierung
mit einem bisher rechtlich gar nicht und wirtschaftlich nur diffus existierenden Österreich
nach dem Ersten Weltkrieg nicht zu wundern.
67
Wachstumsraten Cisleithaniens sowie des Gebietes der Republik
Österreich, 1830 - 1913
a) in Zehnjahresdurchschnitten
3,00
2,50
in %
2,00
1,50
1,00
0,50
1910 - 1913
1900 - 1910
1890 - 1900
1880 - 1890
1870 - 1880
1860 - 1870
1850 - 1860
1840 - 1850
1830 - 1840
0,00
Jahrzehnt
Gebiet der Republik
Cisleithanien
Quelle: errechnet aus den Datenreihen bei Kausel 1979
Die politisch-territoriale Entwicklung erfolgte damit stark verzögert. Die Integration ging
nicht von einem einheitlichen Kern, sondern von mehreren aus, die erst spät gekoppelt
wurden. Allerdings fand sie schließlich doch statt, und zwar in den letzten Jahrzehnten vor
der Jahrhundertwende. Doch das war zu spät. Mentale Änderungen sind nicht mechanisch
an eine äußere Entwicklung gekoppelt. Es braucht gewöhnlich eine Generation, bis sich
strukturelle Neuformierungen als Selbstverständlichkeiten im Verhalten des Menschen
wiederspiegeln. Vergleicht man diese Prozesse international, so findet sich die Monarchie
in Europa in den Indikatoren meist vor Rußland und gewöhnlich knapp nach Italien an
letzter Stelle.
Die Datenreihen zur Entwicklung der österreichischen Wirtschaft wurden bis 1830
zurückgerechnet. Die Wachstumsraten als wichtigsten Indikator wollen wir in Hinblick auf
unsere Zentrum-Peripherie-These kurz untersuchen.
Methodische Bemerkungen: Diese Daten sind nicht unbestritten, und es gibt konkurrierende Schätzungen, wie überhaupt seit einiger Zeit eine erstaunlich lebhafte Debatte um die Wirtschaftsgeschichte der Habsburgermonarchie geführt wird. Unglücklicherweise gibt der Autor nicht den
geringsten Hinweis auf das Verfahren, wie er zu seinen Daten kam. Eine persönliche Erkundung
ergab, daß er einfach mit geschätzten Zuwachsraten von 1913 nach hinten rechnete (die Basis 1913
ergibt sich aus Kausel / Nemeth / Seidel 1965). Dieses schon wieder geradezu unglaubliche
Vorgehen dürfte seinen Ursprung in seiner Berufskultur haben: Er war damals Vizepräsident im
ÖSTAT und vorher Abteilungsleiter im Bereich VGR. Trotz intensiver interner Diskussion jeder
technischen Einzelheit war es dort nicht üblich, methodische Überlegungen in Publikationen zu
reflektieren. Man steht also vor der Tatsache, nur sagen zu können: Ich glaube es oder ich glaube
es nicht. Da aber seine Ergebnisse meist von hoher Qualität waren, möchte man ihm Glauben
schenken.
68
b) Durchschnitte in den Kondratieff-Zyklen
3,00
2,50
in %
2,00
1,50
1,00
0,50
1896 1913
1874 1896
1850 1873
1830 1850
0,00
Zeiträume
Gebiet der Republik
Cisleithanien
Quelle: errechnet aus den Datenreihen bei Kausel 1979
Die Graphik (a) hält sich an die Daten und Zeiträume, in denen man in Weltmaßstab
Kondratieff-Zyklen festgestellt hat. Der erste Zyklus (B) beginnt nur aus Datengründen
1830. Die Graphik a) hingegen soll auch eine Überprüfung sozusagen ohne theoretische
Vorbelastung ermöglichen.
Der Theorie nach müsste sich die A- (= Aufschwung)phase vor allem im Zentrum
ausprägen, während die B-Phase (Abschwung oder Stagnation) für die Peripherie eine
Phase nachholender Entwicklung sein müsste, da aus Gründen der Stockung die wirtschaftlichen Aktivitäten sich in noch unerschlossenen Gebieten auszuweichen bemühen. In
gewisser Weise entspricht diese auch dem Luxemburg'schen Imperialismuskonzept,
allerdings ohne ihr konzeptuelles Mißverständnis einer mathematischen Logik aus den
Kreislaufschemata heraus.
Die Habsburgmonarchie war als Ganzes, Cisleithanien als Teil, aber auch die Alpenländer,
Peripherie für Westeuropa. Sie war somit ein vergleichsweise traditionales Gebiet, ein
Kontrapunkt zur Moderne. Damit ist sein verzögerter Nationenaufbau plausibel. Übrigens
befand sich Italien zu dieser Zeit in einer ähnlichen Position. Es war Peripherie, ähnelte in
der Struktur Cisleithanien (Analogien: Norditalienisches Industriedreieck - Alpenländer;
Mittelitalien und Mezzogiorno - habsburgische Ostprovinzen). Der Unterschied war, daß
sich das norditalienische Subzentrum gegenüber Italien nicht als Irredenta verhielt, die sich
an eine andere Nation anschließen wollte. Noch wesentlicher war allerdings, daß die
politische Führung ebenso wie die Intellektuellenschicht mit Entschlossenheit einen
Nationenaufbau in Angriff nahmen.
Im ersten Zeitraum (1830 – 50) war sowohl Österreich wie ganz Cisleithanien denkbar
niedrig entwickelt. Das ganze Gebiet war eindeutig Peripherie, obwohl schon damals die
beinahe noch unmerklichen Strukturvorteile der Altenländer die spätere schnelle Entwicklung vorbereiteten. Es paßt also ganz gut in das theoretische Schema, dass in diesem
Zeitraum die Wirtschaft der Alpenländer sogar geringfügig schneller wuchs als in der folgenden A-Phase (1850 - 1873). Dasselbe gilt für die B-Phase 1883 – 1896: Sie war die für
69
Österreich wesentlichste Zeit der verspäteten Industrialisierung. Die hohen Wachstumsraten in der nächsten A-Phase, wiewohl leicht niedriger als zuvor, scheinen anzudeuten,
dass die Alpenländer im Begriff waren, zu jenem echten Zentrum zu werden. Wir dürfen
nicht vergessen, dass jede kapitalistische Entwicklung als periphere Entwicklung beginnen
muss. Ob sie Peripherie bleibt, hängt dann für eine bestimmte Wirtschaft vor allem vom
politischen oder wirtschaftlichen Handeln ab. Die Peripherie des Reiches wuchs im gesamten Zeitraum, über den Daten vorliegen, wesentlich langsamer als das deutschsprachige
Österreich. Das ist nicht verwunderlich: Sie war bis 1884 praktisch noch nicht in den
Binnenmarkt der Monarchie eingebunden: Selbst gesetzlich gab es einen solchen noch gar
nicht, denn es bestanden noch die Zolllinien zwischen den österreichischen und
ungarischen Ländern. Sie bildeten somit weitgehend getrennte lokal-regionale Märkte. Die
Konjunkturen konnten also gar nicht im selben Maß durchschlagen. Anders freilich verhält
es sich mit den langen Wellen. Sie sind ja eine Form, in der sich die kapitalistische Entwicklung ("ursprüngliche Akkumulation") durchsetzt. Sie waren also durchaus feststellbar:
In der A-Phase bis 1873 blieb das Wachstum besonders stark zurück, verdoppelte sich in
der folgenden B-Phase – allerdings bei ebenfalls beinahe verdoppeltem Wachstum im
Zentrum - und stieg in der folgenden Phase (bis 1913) nochmals stark an und überholte
sogar im Jahrzehnt von 1900-1910 das Zentrum. Insbesondere verkleinern sich die
Quotienten zwischen den Raten ständig. Es hat sogar den Anschein, als ob die Peripherie in
der A-Phase, ab 1896, ein selbsttragendes Wachstum entwickelt hätte. Wahrscheinlich geht
dies allerdings auf das nordböhmische Zentrum zurück, das sich vom administrativen
Zentrum Wien / Niederösterreich löste. Nach Rückrechnungen des WIFO betrug 1911 1913 das Volkseinkommen p.c. auf dem Gebiet des heutigen Österreich 790 Kronen, in
Böhmen, Mähren und Schlesien immerhin noch 630, jedoch in Galizien nur 250, also nur
ein Drittel des zentralen Wertes, und auch in Slowenien und Dalmatien nur 300. Andere
Schätzungen sehen die Unterschiede geringer und insbesondere die böhmischen Länder nur
knapp hinter den Alpenländern (Butschek 1993). Der ständige Wachstumsvorsprung des
Zentrums war vor allem ein Strukturvorsprung, der schon am Beginn des 19. Jahrhunderts
bestanden hatte und im großen und ganzen erhalten geblieben war. Das aber bedeutet, daß
die Peripherie auch sozial und politisch hinter dem Zentrum herhinkte, wobei letzteres
durchaus geplant war.
Mit dem treffenden Ausdruck Otto Brunners war Österreich noch 1848 eine "monarchische
Union von Ständestaaten". Die Alpenländer, das spätere deutschsprachige Österreich, war
in Bezug auf Westeuropa Mitte des 19. Jahrhundert selbst noch Peripherie. Doch zum
einen war der Rückstand dieser Gebiete, im Unterschied zur Gesamtmonarchie, bald nicht
mehr groß. Zum anderen war dieses Gebiet (zusammen mit Teilen Böhmens) Zentrum
gegenüber allen anderen Gebieten der Monarchie. Seine Bevölkerung war bemüht, diese
Stellung auch politisch abzusichern und zu nützen. Dies ist die eigentliche Wurzel der
erbitterten nationalen Kämpfe sowie für das "deutsche Bewußtsein" vor allem seines
Bürgertums: Wesentliche Interessen werden in einer nationalstaatlich organisierten
Gesellschaft stets in nationale Identitäten umgedeutet.
Konzeptuell ist dies zu fassen als ungleiche Entwicklung, welche in der Regel als eine (notwendige? hinreichende?) Bedingung für die Entwicklung einer nationalen Frage bzw. von
Nationalitätenkämpfen aufgefasst wird. Ohne auf die Entwicklung näher eingehen zu
können, ist noch darauf zu verweisen, daß gerade in verspäteten und abhängigen Entwicklungsprozessen staatliche Eingriffe und eine bestimmte Form von Steuerung eine besondere Rolle spielt. Damit erhalten aber die ethnischen oder nationalen Träger der staatlichen
70
Verwaltung Möglichkeiten, der wirtschaftlichen Entwicklung ihre Zielsetzung bzw. ihre
Interessen vorzugeben. In Österreich (Cisleithanien) aber waren diese Träger Deutschsprachige, welche die anderen Völker des Reiches als minderwertig ansahen, die geringer
"gewogen" (Rauchberg) werden sollten als sie. Gleichzeitig sahen sie aber den durch den
Vormärz verursachten Wachstumsrückstand gegen den Westen und vor allem Deutschland.
Die Habsburgermonarchie, eine "monarchische Union von Ständestaaten" bis zum Ende:
"Wir Franz Josef I., von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, apostolischer König von
Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien, Rama, Serbien,
Kumanien und Bulgarien; König von Illyrien, Jerusalem usw., Erzherzog von Österreich,
Großherzog von Toskana und Krakau; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark,
Kärnten, Krain und Bukowina; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren,
Herzog von Ober- und Niederschlesien; Modena, Parma, Piacenza, Guastala, auschwitz,
Zator, Teschen, Friaul, Ragusa, Zara, etc.; Graf von Habsburg, Tirol, Kyburg, Görz und
Gradiska; Fürst von Trient und Brixen; Markgraf der Ober- und Niederlausitz und von
Istrien; Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg usw.; Herr von Triest,
Cattaro und auf der windischen Mark usw. ..."
Manchmal allerdings ging etwas verloren (6. Jänner 1867): "Seine k.k. Apostolische
Majestät haben laut ah. Handschreiben vom 3. Oktober 1866 infolge des am nämlichen
Tage zwischen Österreich und dem Königreiche Italien abgeschlossenen Friedenstraktates
allergnädigst zu beschließen geruht, den Titel 'König der Lombardei und Venedigs' hinfüro
abzulegen..." (zit. nach Bernatzik 1911, 320 und 52).
Eine deutsche Orientierung lag somit umso näher, als eine österreichische Option vom
Neoabsolutismus und auch später von den administrativen und militärischen Eliten der
Monarchie entwicklungshemmend definiert worden war. Sie hätte für sie zumindest
kurzfristig einen Verlust durch Verzicht auf ökonomischen Transfer aus der Peripherie und
auf eine gesicherte politisch dominante Stellung mit sich gebracht: Dies waren die Kosten
der Inklusion einiger nichtdeutscher Oberschichten in die Staatsführung. Eine österreichische Option (d.h. eine deutschsprachige österreichische Nation gleichberechtigt neben
anderen Nationen) wäre nur innerhalb eines (kon-) föderativen Systems möglich gewesen.
Diese Kosten liefen ja tatsächlich auf: Die Dynastie betrieb Ansätze einer staatlichen (nicht
nationalen) Integrationspolitik. Da sie es gegen die Absicht der "Deutschen" tat, trieb sie
diese erst recht in die Gegnerschaft gegen eine österreichische Lösung. Die Dynastie stützte
sich dabei auf konservative Kräfte, die ihrerseits wieder ein funktionierendes Bündnis mit
breiten traditionellen Schichten herstellte. Diese Schichten konnten von einem schnellen
sozialen Wandel nur Nachteile sehen (siehe Agrarkrise Ende des 19. Jahrhunderts).
Mit einer Politik verbreiterter Partizipation – man denke an die Wahlrechtsentwicklung,
welche als erste untere Schicht die zünftisch denkenden Handwerker erreichte – hatten die
Konservativen ein wunderbares Instrument zur Bremsung des sozialen Wandels in den
Händen, das sie gegen das deutschprachige Bürgertum anwandten. Dieses reagierte mit der
Defensivideologie des Deutschnationalismus; die Gleichberechtigungsansprüche der anderen Nationen wurden nicht zu Unrecht als Bedrohung der eigenen Position angesehen. Da
Intellektuelle die Hauptsprecher ihrer Interessen waren, verlagerten sich die Kämpfe vom
weniger gut begreifbaren oder, besser, vertretbaren ökonomischen Terrain auf das
kulturelle und kulturpolitische: Die Schulfrage und die Amtsprache waren dafür ideale
Gebiet, weil hier Symbolwerte zusammenflossen mit Berufs- und Statusinteressen. Es gab
allerdings auch Strömungen, welche direkt an den Interessen ansetzten, weil sie solchen
71
Ideen wie nationale Identität als zu leicht manipulierbar misstrauten. Dies gilt vor allem für
die Organisation des "Vierten Standes": Der Marxismus war das politische Programm der
von bürgerlichen Intellektuellen geführten Arbeiterbewegung. Diese Intellektuellen waren,
je nach den Umständen, auch selbst nationalistisch, doch machten sie dies nicht zum
Kernpunkt ihrer politischen Arbeit.
2.5.1 "Altösterreicher" und ihre Gegner
Otto Bauer hat bekanntlich, nicht zu Unrecht, die altösterreichische Linie später als die
retardierende Bewegung des alten Staates festmachen wollen. Eine Reihe von abschreckenden Beispielen aus jener Denkrichtung, die ich gerne “Vulgärmarxismus” nenne, hat uns
die Unzulässigkeit einer direkten Ableitung von Gedankengebäuden aus politischen oder
sozialen Verhältnissen drastisch vor Augen geführt. Andererseits können wir nicht gut
annehmen, dass die Verhältnisse einer Zeit ohne Einfluss auf wesentliche Denkansätze
bleiben. Wir müssen also zumindest die Zulässigkeit einer Parallelisierung behaupten. Die
methodischen Probleme dabei sind allerdings keineswegs gelöst; gewöhnlich bleiben wir
Spekulationen verhaftet. Die eigentliche Rechtfertigung liegt darin, daß jene, die in einer
bestimmten Zeit einflussreich an die Öffentlichkeit treten - die Intellektuellen also - , die
Probleme ihrer Zeit in irgendeiner Weise bewältigen müssen, auch wenn diese nicht in
einer bestimmten Fassung direkt ihr Thema sind.
Ferdinand Kürnberger (1821 – 1879) wäre der letzte gewesen, der sich als “Altösterreicher” hätte kategorisieren lassen. Er war vielmehr ein Prototyp derjenigen Intellektuellen
und Literaten, welche nicht nur alles Heil aus Deutschland erwarteten, sondern sogar ihren
persönlichen Habitus auf preußisch-deutsch stilisierten (vgl. Einleitung zu Kürnberger
1960). Als die Österreicher 1870 – nach 1866! – seine Kriegsbegeisterung nicht mitmachen, schimpft er los, und zwar nicht nur auf die Dynastie, sondern auch auf die Bevölkerung (a.a.O., Zitat auf 51): “Hof und Lazzaroni im Einklang, sonst nur eine Erscheinung
südlicherer Staaten, war diesmal die politische Physiognomie auch von Wien. Die höchste
Sphäre, antipreußisch aus Tradition, die unterste aus Instinkt, da ihr ‘preußisch’ ziemlich
richtig Arbeit und Bildung bedeutete, also das bitterste Widerspiel ihres eigenen Programms, Faulheit und Zote, beide Sphären aber von erdrückender Breite, und zwar die
Letztere, natürlicherweise, die Erste, künstlich durch nachäffende Affektion...”
Einer jener Literaten, welche dies nach 1848 - und das Jahr war für ihn persönlich eine
Zäsur - in ihrer Mentalität am besten belegen, war Ferdinand von Saar (1833 - 1906). Aus
kleinem neuen Beamtenadel stammend, schlug er vorerst die Offizierslaufbahn ein. Die
Armee wird in seinem erzählerischen Schaffen denn auch stets die Struktur des alten
Staates verkörpern. Er selbst hielt sie nicht lang aus, obwohl er eine kennzeichnende,
jedoch intelligente Ausprägung des "altösterreichischen Typus" dieser Zeit verkörperte wie
wenig andere. Pessimismus und Zukunftsangst dominieren. Über die Haltbarkeit oder gar
eine Zukunftsträchtigkeit dieses Staates und dieser Gesellschaft machte er sich keine
Illusionen. Doch er schafft weder eine Distanzierung von diesem System noch eine
Zukunftsorientierung. Saar ist ein vornationaler Mensch: Die nationale Frage kommt auch
nur ganz am Rande vor. Es ist aber nicht unbedingt ein vormoderner Mensch, obwohl er
die Moderne, seine Moderne, nicht liebt. An diesem Zwiespalt wird er schließlich selbst
zugrunde gehen - und darin ist er symbolisch sowohl für das System als auch für sein
Verhältnis zum sozialen Wandel. Der "Leutnant Burda" verliert in seinem Versuch, sich in
die große Welt dieses Staates weit oben einzudrängen, indem er gleichzeitig eine adelige
Abstammung konstruiert und eine dementsprechende "standesgemäße" Liebesverbindung
72
anstrebt, jede Realität unter seinen Füßen. Im Duell wird er schließlich von einem anderen
Bürgerlichen erschlagen, der zwar ein "Raufbold", aber ein glänzender Fechter und ihm
weit überlegen ist. Der General (aus "Vae victis") hat "keine Zukunft mehr". Folgerichtig
erschießt er sich selbst, und nicht, wie etwa im gleichzeitigen Roman "Effi Briest" von
Theodor Fontane der ehemalige preußische Offizier und Ministerialbeamte, seinen Konkurrenten und (Ex-) Liebhaber seiner Frau. Der Prototyp in "Schloß Kostenitz" scheitert
zuerst an seiner schwankenden Rolle im Jahr 1848 und flüchtet sich in eine neobiedermeierliche Idylle. Doch "den Wellenschlägen der Zeit kann sich auch der am fernsten
Stehende nicht entziehen". Die politische Struktur bricht, wieder in Gestalt der Armee und
eines hochadeligen Offiziers, in diesen (gerade nicht) geschützten Bezirk ein und verursacht die Katastrophe. Die zwei "Steinklopfer" überleben schließlich durch puren Zufall
und den menschlichen Augenblick eines höheren Offiziers - nicht eben ein zukunftsweisendes Anbot für die "soziale Frage".
2.5.1.1 Adalbert Stifter
Wesentlich bekannter und von der Fachdisziplin literarisch höher eingeschätzt als Saar ist
Adalbert Stifter (1805 - 1868). Doch in unserem Zusammenhang gehört er in eine ähnliche
Kategorie. Wo allerdings Saar resigniert, weicht Stifter in Eskapismus aus. Allerdings ist
dieser Eskapismus außerordentlich brüchig (vgl. Matz 1995). Ständig von der Angst
geprägt, dass er die "Gränzen eines heiter-ruhigen Lebens überschreiten und in Extreme
fallen könnte, welche die Harmonie in Wildheit und Sitte in Unordnung herabstürzen, und
indem sie die Wunde nur betäuben, diesselbe nicht nur nicht heilen, sondern vergrößern,
und aus einem Unglücklichen einen Sünder machen", passiert ihm am Ende seines Lebens
gerade dieses. Er fand seinen (Lebens-) “Stil” nicht, den er, nach dem Nietzsche’schen
Ausdruck, so verzweifelt suchte. Die heile Welt, die er ausschließlich in der Vergangenheit
sucht, besteht aus Regressionen eines Provinzschriftstellers und -funktionärs, welche die
Zerbrechlichkeit dieser Scheinwelt, die nach seinem Tode immerhin noch ein halbes
Jahrhundert überdauern wird, nur zu gründlich wiederspiegeln. Anstelle in eine Moderne
ging der Blick in eine konstruierte schöne alte Welt. Aus dem Böhmerwald stammend
nahm er doch die nationalen Spannungen nicht zur Kenntnis.
Zur selben Zeit, als Gustav Freytag den Schwulst seiner “Ahnen” herausbrachte, schrieb
Stifter einen historischen Roman: “Witiko”. Der “Deutsche” Stifter schreibt dabei Mitte
des 19. Jahrhunderts einen Roman über Böhmen, und noch spezifischer: über Südböhmen.
Es ist ein regelrechter Staatsdiskurs mit Hegel’schen Untertönen (“Die Geschichte [ist] die
Hauptsache und die einzelnen Menschen die Nebensache”, schreibt er 1861 an seinen
Verleger – laut Kindlers Literaturlexikon 23, 10258). “Da alle Völker zu Hause in kleinen
Stämmen ihres Lebens pflegten, konnten auch wir ohne Haupt in der Heimat unsere Dinge
tun,” lässt er bei einer umstrittenen Herzogswahl einen Adeligen sagen. ”Als aber die
Stämme um uns sich geeinigt hatten, brauchen wir einen Herzog, der uns gegen sie einigt
und der unser Land darstellt.” [S89] Eine beißende Kritik nannte den Roman daher ein
“Handbuch für Offiziersanwärter”, und, noch interessanter, “eine Austrittserklärung aus der
menschlichen Gesellschaft” (A. Schmidt). Tatsächlich macht seine staatsfromme Haltung
Unbehagen.
Der „Österreicher“ Stifter schreibt also seinen historischen Roman nicht etwa über ein
Thema und ein Gebiet des heutigen Österreich. Auch ein anderer dieser „Österreicher“,
Franz Grillparzer, hat sein Zivilisationsdrama „Libussa“ nicht über oder am Beispiel
Wiens, sondern an jenem Prags geschrieben. Die Modernisierung der „Deutschen“ gefällt
73
ihnen nicht. Grillparzer selbst geht zwar an der Modernisierung nicht zu Grunde. Er ist ja
Beamter mit einer Alibi-Stelle und ihren Privilegien; ihm kann nichts passieren, solange er
sich fügt. Aber seine Titelfigur Libussa lässt er an der Modernisierung sterben. Doch im
Gegensatz zu Goethe und seiner Klassik erklärt er sich immerhin prinzipiell für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit und ihr idyllisiertes Bild, weder im hellenischen Kleid
noch im mittelalterlichen.
Denn der Alte ist oft sehr hellsichtig:
„Die Liebe liebt den nahen Gegenstand,
und alle lieben ist nicht mehr Gefühl;
was Du Empfindung wähnst, ist nur Gedanke.
Es geht hier offenbar auch um Nationalismus und seine Behauptung der Liebe zum Volk,
eine richtige Diagnose, auch wenn der Ton kulturkritisch ist.
Eine bestimmte Ähnlichkeit zwischen Stifter und Gustav Freytag, zwischen “Witiko” und
den “Ahnen”, ist nicht in Abrede zu stellen: Es ist das “altdeutsche” Pathos. Während aber
“Die Ahnen” den ganz gewöhnlichen Schwulst des 19. Jahrhunderts bieten, findet sich bei
Stifter das Pathos in der bis zum geradezu absurden Manierismus getriebenen Simplizität.
Stellenweise macht dies heute – und nicht nur heute, wie die Zitate schon zeigten – die
Lektüre geradezu unerträglich. Ständig werden Sätze wortwörtlich wiederholt, werden
Tätigkeiten oder Haltungen in Vergangenheit und Zukunft aneinandergereiht, beginnen
Sätze und Absätze über Seiten hinweg mit dem Anfang “Dann...”, oder “Er sagte... “, “Sie
sagte...”. Der Roman beruht allein auf der Sprache. Sie sollte also wohl die gewünschte
Struktur der Welt wiederspiegeln. Jede Komplexität sollte also verbannt sein aus dieser
komplizierten und eben nicht einfachen Welt. Die Zukunft soll die Vergangenheit wiederholen. In diesem Punkt kommt der Konservativismus des Schulbeamten zur Gänze heraus,
im Wunsch nach einer Welt, wenn schon nicht des Unveränderlichen, so doch des Wenig
Veränderlichen. Man kann durchaus sagen: Hier fällt Stifter sogar hinter die Deutschnationalen zurück. Für diese ist die Vergangenheit alles Mögliche, nur nicht das Bild einer
ständig gleich bleibenden Welt mit dem “sanften Gesetz” des Seienden. Selbstverständlich
und für jeden denkenden Menschen auch damals haben sie damit recht. “Witiko” ist daher
literarisch ein Fehlschlag, und der Roman ist nicht zufällig heute auf dem Buchmarkt auch
nicht erhältlich. Der sprachliche Primitivismus mit seiner konstruierten Einfachheit wirkt
vor allem grotesk, zumal er dann wieder durch andere, archaisierende Manierismen unterbrochen wird: Man lebt im “Witiko” nie in einem Zelt, sondern immer im “Gezelt”, und
sitzt auf einem “Gesiedel”. Usf.
Damit trieb Stifter eine Haltung zum Extrem, welche auch sonst verbreitet war: Ein
tschechischer Feuilletonist beschreibt Ende des 19. Jahrhunderts anschaulich, wie gerade in
diesem abgelegenen Gebiet die Situation war. Allerdings beschreibt er schon ein "verlorenes Paradies" – die Nationalitätenkonflikte hatten auch dieses Gebiet schon erreicht, auch
wenn er sie draußen halten will (Klostermann 1987 [1890]: 154): "Da lebten wir früher so
ruhig beisammen, und niemandem fiel es ein, nach der Nationalität des anderen zu fragen;
es wurde kein Mensch tschechisiert noch germanisiert. Ist denn keine Möglichkeit da, daß
sie wiederkehre, die goldene alte Zeit, wo wir alle Brüder gewesen in guten und schlimmen
Tagen? ... Jetzt ist es anders geworden, jetzt glaubt jeder Wicht, der da kommet, daß die
Welt auf die blöden Ergüsse seines Hasses warte."
Peter Rosegger
74
Peter Rosegger (1843 – 1918) betrachtete Stifter als großes Vorbild, und tatsächlich liest
sich der “Waldschulmeister” streckenweise sehr nahe am “Nachsommer”. Rosegger verkörpert persönlich und in seinem literarischen Werk vielleicht am besten den Übergangscharakter der damaligen deutschösterreichischen Provinz aus der Traditionalität in nationale Strukturen. Seine politische Haltung kennzeichnet er in einer autobiographischen
Skizze ohne jede Ironie als kosmopolitisch; doch wenn es darauf ankäme, als “schwarzgelb” (I, XVIII). So beschreibt er denn auch affirmativ und mit viel Nostalgie eine
vornationale traditionale Gesellschaft mit engem und abgegrenzten Horizont. Das ist aber
nicht etwa Aufarbeitung seiner persönlichen Vergangenheit und Herkunft, wie im zeitgenössischen “neuen Heimatroman”. Dies ist nicht nur sein Gegenstand, dies ist auch sein
Ideal: Denn die “Absicht” seiner schriftstellerischen Tätigkeit sei, “Mitarbeiten an der sittlichen Klärung unserer Zeit” (I, XXXI). Er strebt “die Rückkehr zu jenen kleinen patriarchalischen Verhältnissen” an, “in welchen die Menschheit noch am natürlichsten gelebt
hat” (I, XVIII). Dass diese “natürlichen Verhältnisse” dann auch stockreaktionär und
schlichtweg anti-emanzipatorisch waren, fällt gelegentlich sogar ihm selbst auf, wenn er
über die Wirkung des 48er Jahres auf die Bauern schreibt: “Was die Befreiung von Zehent
und Abgaben, von Robot und Untertänigkeit bei meinen Landsleuten für einen Eindruck
gemacht hat, weiß ich nicht; wahrscheinlich nicht den besten, denn sie waren sehr vom
Althergebrachten befangen” (Lebensbeschreibung, in: I, IX). Wenn dies stimmt, und es
klingt nicht unplausibel: auch in seinen Erzählungen kommt diese Problematik schlichtweg
nicht vor, dann ist das eine Schlüsselstelle für die österreichische Entwicklung überhaupt.
Dazu gibt es allerdings einen frühen Roman, der ganz anders klingt, auch wenn er später
etwas umgearbeitet wurde. 1872, also noch am Anfang seiner Schriftstellerlaufbahn, erschien in Budapest bei Heckenast der Roman „In der Einöde“, der 10 Jahre später unter
dem Titel „Heidepeters Gabriel“ neu veröffentlicht wurde. Als Rosegger ihn 30 Jahre später (1913) in die „Gesammelten Werke“ aufnahm, hatte er das Bedürfnis, sich auf eine seltsame Weise davon zu distanzieren: „Es ist die Meinung aufgekommen, dass die Erzählung
‚Heidepeters Gabriel’ meine eigene Lebensgeschichte wäre. Diese Meinung ist unrichtig.
Eine solche Selbstbespiegelung wäre geschmacklos …“ (Vorbemerkung, GW IV, 4). Aber
die „Geschichten aus der Waldheimat“ sind dann keine „Selbstbespiegelung“? Übrigens ist
dieses Dementi selbst geschmacklos, denn nicht nur sind die Parallelen gar zu deutlich,
sondern auch die Ortsnamen sind manchmal auf eine amüsante Weise zu erkennen. Wenn
die Ruine Breitenwart, ganz klar im Mürztal, zu besichtigen wäre, kommt einem doch
Langenwang in den Sinn. Und dass man bei Karnstein an Hauenstein denkt, wird wohl
auch nicht der reine Zufall sein, obwohl der Ort nach der Beschreibung Krieglach sein
muss …
Dieser Roman klingt nun ganz und gar anders als die „Waldheimat“. Er schildert „die Einöde“ als nacktes Elend, auch gibt er sich streckenweise ganz bäuerlich-klassenkämpferisch,
auch wenn er dies als Handlungsoption seitens der Bauern verurteilt und scheitern lässt.
Die Bauern selbst sind ein recht heimtückisches und überhaupt nicht solidarisches Volk,
wo einer nur auf das Unglück des anderen wartet. Hier ist keine Idylle, selbst wenn Nostalgie aufgetragen wird, sogar dick. Wenige Jahre nachdem seine Familie abgehaust hatte und
unmittelbar nach dem Tod seiner Mutter in elenden Verhältnissen (1872) stand ihm nicht
der Sinn danach. – Wie auch in seinen anderen Romanen, „Jakob der Letzte“ etwa, klingt
die Konstruktion übrigens nicht besonders authentisch, sondern eben – konstruiert.
75
Doch dann kommt der vollständige Bruch. Der Roman ist nämlich eine „Erzählung in zwei
Büchern“. Das zweite Buch – offenbar ein Jahrzehnt später geschrieben – wird zum Gartenlauben-Roman in einer wirklich schon peinlichen Weise. Stilistisch ist es ein einziger
Schmachtfetzen. Man ist nahezu fassungslos, diese beiden Stücke in einzigen Roman
zusammen gespannt zu sehen. In diesem Roman kann man also den Wandel des Peter
Rosegger von einem realistischen Schriftsteller zum Kitsch-Produzenten miterleben.
Die sonstige Produktion muss man als einen ideologischen Überbau, zugegebener Weise
manchmal sogar von Bedeutung, bezeichnen: “Ich werde ihnen und mir eine neue Heimat
gründen”, lässt er seinen “Waldschulmeister” sagen (I, 143). Und doch will dieser Roman
und vermutlich Roseggers ganzes Werk Zivilisationsarbeit sein. Auf den folgenden Seiten
gibt es dann eine besonders interessante Beschreibung für Modernisierungstheoretiker: Zuerst muss zwar einmal eine Kirche gebaut werden, “daß die Gemeinde ein Herz hat; dann
machen wir uns an den Kopf und bauen das Schulhaus” (144). Und unmittelbar darauf
beschreibt er den Aufbau einer Personaldokumentation. “Das Wirrsal darf nicht so bleiben”
(145), also schreitet er zur (nach-) Namensgebung. So wird Zivilisation als administrative
Penetration aufgefasst, und das bei Rosegger, der eine fast rousseauistische Tendenz zur
“Natur”-Idyllisierung hat. Und was passiert dann? Es ist beinahe schon peinlich: “Mehrere
junge Winkelsteger wollten sich freiwillig anwerben lassen zu den Soldaten. Das ist ein
Anzeichen ihres erwachten Bewußtseins, daß sie ein Vaterland und eine Heimat haben...”
(231).
Ob dies jene irrlichternden Intellektuellen unserer Zeit gelesen haben, die auch immer wieder ihre sozialkonservative Ader demonstrativ pflegen und dabei Rosegger gleich zu ihrem
Ahnherrn ernennen möchten (vgl. Nennings Vorwort zu Farkas 1994)? Für jemand, der
Roseggers zeitweilige literarischen Qualitäten ebenso wie seine Bescheidenheit schätzt und
seiner nachdenklichen Rückbesinnung auf die kleinen Verhältnisse seines Ursprungs Sympathie entgegen bringt, ist gerade dieser Zug oft schwer verdaulich. Seine bäuerliche Sozialkritik hält sich in Grenzen. Man muss allerdings hinzufügen: Jene Erzählungen aus den
vier Bänden „Waldheimat“, welche auch Kritik enthalten – sie kommen vor allem im 4.
Band dieser Folge aus den „Gesammelten Werken“ (insgesamt 40 Bände) vor – sind in der
heutigen Auswahl desselben Verlags (Staakmann) einfach entfallen – das passt offenbar
nicht zum Rosegger-Bild. – Gebiete solcher Tradition müssen übrigens keineswegs dem
19. Jahrhundert angehören. Bis ins dritte Drittel des 20. Jahrhunderts konnte man in
Österreich noch Rückzugsgebiete solchen Charakters finden. In der Gegenwart allerdings
dürfte auch dies kaum mehr vorkommen.
Rosegger selbst verließ sein Dörfchen und den langsam zugrunde gehenden Hof seiner
Eltern und wurde erfolgreicher Schriftsteller. Gefördert wurde er dabei nicht sosehr von
den ihm geistig eher nahestehenden konservativen Kräften: Er beschreibt mehrmals mit
leichter Bitterkeit, wie wenig Interesse deren Exponenten an ihm hatten, da er doch gar
nichts besaß, ob Geistliche oder standesbewusste Gymnasiallehrer, deren einer sich nicht
entblödete, ihn einen “kulturfeindlichen Autodidakten” zu schimpfen (in einem Leserbrief
an den Heimgarten, zit. bei Schöpfer 1993, 8). Es waren denn auch Vertreter des nationalen
Bürgertum, die ihm den Schulbesuch und seinen Aufstieg ermöglichten. Er ließ sich so
auch in die nationalen Auseinandersetzungen seiner Zeit ein und wurde mit deutschnationalen und antislowenischen Äußerungen bekannt. Nichtsdestoweniger prügelten ihn die
Deutschnationalen, weil er einmal darauf hinwies, dass den Bauern der Nationalismus
gleichgültig sei. Auch um ein wenig Antisemitismus kam er nicht herum (vgl. dazu apolo76
getisch Farkas 1994). Schon gegen Ende seines Lebens (1909 nämlich) organisierte er eine
auf das Ziel von 2 Mill. Kronen angelegte Sammlung für die Erhaltung und Errichtung
deutscher Schulen an den Sprachgrenzen Österreichs. Es wird behauptet (Anderle 1986),
dass sich darauf die Tschechen gegen eine geplante Verleihung des Nobelpreises quer gelegt hätten. Sehr plausibel ist dies nicht. Doch selbst dieser Nationalismus zeigt noch seine
vornationale Beschränkungen. Denn es widmete sich einer der geringeren Konfliktzonen;
es war ein steirisches Problem, zu dem er sich dabei äußerte, das für den Rest der Monarchie mit Ausnahme Kärntens wenig Bedeutung hatte. Trotzdem wird eine seiner entfernten
Verwandten nachdenklich fragen, wieso denn seine Kinder gar so empfänglich für die
Hitler’schen Schalmeien waren.
Diese Frage ist mehrfach interessant, am wenigsten übrigens für Rosegger persönlich. Nach
der Lektüre vieler seiner Geschichten, die absolut drittrangige Kalender-Piècen sind (etwa:
“Adam das Dirndl”, II, 5 – 80), mit einem peinlichen Blut- und Bodenmief und Sprachelementen für “deutsche Leser” (Weinbrühe”), ist dies ziemlich klar. Wenn man schließlich
„Peter Mayr, Wirt an der Mahr“ (1893) gelesen hat, dann ist das Gerede, dass Rosegger im
Dritten Reich „missbraucht“ worden wäre, ein purer Zynismus. Dieser Roman ist blutig,
schrecklich und doch wieder auch gleichzeitig peinlich. Da war nichts zu missbrauchen,
das lag gebrauchfertig vor. Er passt prächtig zum „Steirischen Waffensegen“, den Rosegger
zusammen mit Ottokar Kernstock mitten im Ersten Weltkrieg heraus gab. „In Himmel
kembts, Tiroler!“ heißt ein Kapitel (110 ff.): „Aufg’schaut, Tiroler! In Himmel kembts! Für
Gott, Kaiser und Vaterland frisch voran! Der Heid ist’s, auf den es losgeht! Der Antichrist
ist’s auf den es losgeht! Wer in diesem heiligen Kampf fällt, dem wird zuteil die Märtyrerkrone im ewigen Leben! … Keiner von Euch hat eine Sünde in dieser Stund’, in solchem Streit sind alle vergeben. … Tiroler, denkt’s an Jesu Blut und Marter am hohen
Kreuzesstamm und fahrt’s drein! Usw.“ (112). Heute macht man sich in Europa über
solchen Wahnsinn bei islamistischen Fundamentalisten lustig: Dieser Rosegger’sche
Wahnsinn wurde vor nur wenig mehr als einem Jahrhundert geschrieben.
Wie passt jedoch eigentlich Großdeutschtum zu einem solchen generischen kleinräumigen
Traditionalismus? Aus der sozial-politischen Struktur des 19. Jahrhunderts kam offenbar
auch die Notwendigkeit und das Bedürfnis, sich mit einem größeren Kreis zu
identifizieren. War dies das Schicksal der Intellektuellen, auch der provinziellen? Es ist
eine Ironie. Das Geheimnis von Roseggers Erfolg ist ja, dass sein Provinzialismus mit all
seinen Beschränkungen, aber auch manchen Hellsichtigkeiten im Vergleich zur
widerlichen bürgerlichen Arroganz vieler seiner Zeitgenossen authentisch ist – und darüber
hinaus humanistisch: eine absolut seltene Kombination.
Und die Stadt?
Keineswegs ein “Altösterreicher” im inhaltlichen Sinn, vielmehr geradezu ein Antipode
insbesondere auch zur Idyllisierung Roseggers war Alfons Petzolt (1882 – 1923). Er soll
hier für ein wesentliches Segment nicht einmal sosehr der österreichischen Arbeiterbewegung, als vielmehr der österreichischen und speziell der Wiener Bevölkerung oder vielmehr
deren breite städtische Unterschichten stehen. „Arbeiterdichter“ wird er klassifiziert, doch
das ist ein Widerspruch in sich, besonders deutlich bei Petzold. Zum einen war er, als er
noch Hilfsarbeiter war, kein Dichter oder Schriftsteller. Als er dies war, war er längst kein
Arbeiter mehr. In diesem speziellen Fall ist übrigens die ganze Widersprüchlichkeit des
erfolgreichen Arbeiters vorhanden. Denn wenn er erfolgreich ist, als Politiker oder im
Beruf, ist er meist sehr schnell kein Arbeiter mehr. Zum anderen scheint er sich dann
77
tatsächlich mehr an einer allgemeinen Religiosität als am säkularen Emanzipationsstreben
der Klasse orientiert zu haben.
Sein naiver Ethnozentrismus ist im Grunde völlig unpolitisch. Dabei ordnet sich der spätere Paradeliterat der Sozialdemokratie selbst immer wieder in eine politische Kategorie ein.
Er nannte sich in später verächtlich früher Jugend “Antisemit”, wenig später war er “ein
ebenso dummer und blindwütiger Schreier gegen den Klerikalismus” (1920, 214), nachdem sein erstes Gedicht “eine Lobeshymne auf den großen Volksdemagogen Dr. Karl
Lueger” (1920, 116) gewesen war. Die nächste Stufe seiner Entwicklung war “ein deutschnationaler Maulheld, der in Bismarck den größten Helden des deutschen Volkes sah”
(293). Schließlich kam er mit der Sozialdemokratie in Berührung, von der er nun mit
Hochachtung spricht. Allerdings scheint er sie mehr als einen Bildungsverein als eine politische Partei betrachtet zu haben. Auch eine tolstoianische Phase fehlt nicht. Und schließlich gehörte er im Ersten Weltkrieg zu jenen schriftstellerischen Mitläufern, die glaubten,
sie könnten mit wüster “lyrischer” Kriegshetze ihren Erfolg sichern – dies wird ihm seinen
Förderer aus der intellektuell authentischen literarischen Szene der Arbeiterbewegung,
Josef Luitpold Stern, zutiefst entfremden (vgl. Slezak 1982).
Allein diese Aufzählung zeigt, dass sein politisches Engagement nicht besonders tief ging,
im Gegensatz zum menschlichen,. In seiner völligen Bezogenheit auf das eigene Elend erinnert seine Autobiographie, dieser “Roman eines Menschen”, bisweilen an den Solipsismus eines Knut Hamsun im “Hunger”. Er dürfte mit dieser Stimmung die Seelenlage eines
erheblichen Teils des verelendeten Proletariats getroffen haben. Die nationale Zugehörigkeit spielte da nur eine sehr untergeordnete Rolle.
2.5.2 Lösungen?
Die großdeutsch-großösterreichische Lösung – alle Habsburgerländer sollen in ein neues
Deutsches Reich incorporiert werden – war das Ziel der habsburgischen Außenpolitik von
1848 bis 1866. Sie war ihrem Konzept nach ein Produkt vergangener Zeiten und völlig
überholten Denkens, eine ständische Konstruktion in kaum gewandeltem Kleid, welche
den Aufbau von Nationen nicht zur Kenntnis nahm. Diese Diplomatie strebte somit nach
einer Totgeburt und musste erfolglos bleiben. Schließlich gelang es den Habsburgern nicht
einmal mehr, in den deutschen Zollverein aufgenommen zu werden.
Der Aufbau eines modernen Staates musste erst beginnen, die "integrative Revolution"
stand diesen zusammengewürfelten Ländern erst bevor. Um den Sprung in die Gegenwart
zu machen: Der Habsburgerstaat 1848 war etwa auf einem vergleichbaren Stand wie
Nigerien nach der Unabhängigkeit 1960. Gezwungen, wie dieser Vergleich prima vista
klingen mag, ist er strukturell zu einem nicht geringem Maß gerechtfertigt. Insbesondere
begann damals die "integrative Revolution", die Neudeutung primordialer Bindungen als
nationale Zugehörigkeit und damit die Übertragung entsprechender Loyalitäten auf
Sprachgemeinschaften. Der gemeinsame Staat dieser sich nunmehr langsam und erst auf
Elitenebene formierenden Nationen, vom ungarischen Aufstand und der kurzlebigen
Sezession damals schon grundsätzlich in Frage gestellt, wird dies nicht überstehen. Der
Versuch, der (Sprach-) Nation eine "Staatsnation", wobei darunter schlicht die Zusammenfassung der unterschiedlichsten Bevölkerungen unter der einheitlichen Dynastie verstanden
wurde, versuchte einen durchsichtigen Etikettenschwindel, der zu allem Überfluß nicht neu
war und schon in den napoleonischen Kriegen scheiterte. Dafür gibt es eine Reihe von
Gründen. Der wichtigste unter ihnen - aber keineswegs der einzige - war die politische
Modernisierung i. S. einer Demokratisierung, wie sie vor allem um die Jahrhundertwende
78
Auftrieb erhielt. Es ist somit keine Zufall, daß diesmal der Versuch aus zutiefst konservativen Intellektuellen-Kreisen kam und vom Kronprinzen Rudolph selbst aufs eifrigste
gefördert wurde.
"Nation" als zwanghaftes internationales Strukturprinzip – wozu?
"Das Land ist als Nationalstaat seit dem Sturz Siad Barres 1991 auseinandergebrochen, in
eine Vielzahl kleiner Räume, zwischen denen die Unterschiede enorm sein können... Die
Somalier scheinen mit diesem System, mit diesem Mosaik kleinerer Gebietseinheiten,
besser umgehen zu können als etwa ihre ausländischen Partner bei Rehabilitations- und
Nothilfeprogrammen... Oft bietet das System kleinräumiger "Selbstverwaltung" die einzige
Gewähr für ein mehr oder minder friedliches Zusammenleben verschiedener Stämme,
Clans oder Subclans. In der jüngeren somalischen Geschichte sind die akutesten und
gewalttätigsten Krisen immer dann ausgebrochen, wenn sich eine Faktion oder ClanGruppierung anmaßte, die Zentralgewalt zu übernehmen. Aus ihrem Selbstverständnis als
intergouvernementale Organisation und aus ihrer Geschichte heraus taten sich die UNO
besonders schwer mit der Vorstellung, ohne eine staatliche Autorität als Ansprechpartner
aktiv werden zu können... Sie vermittelten somalischen Faktions-, Miliz- und Clanchefs
den Eindruck, eine zentralstaatliche Autorität müsse um jeden Preis erzwungen werden.
notfalls auch mit Gewalt."
NZZ. 27. September 1996: Die Zersplitterung Somalias als Chance für die Zukunft
Das monumentale "Kronprinzenwerk" – "Die Habsburger-Monarchie in Wort und Bild" –
ist der halb literarische, halb propagandistische Ausdruck, welcher die Zeit überdauert hat.
Es war kein Zufall, dass ihm eine ganz spezifische "Ethnographie" ihren Stempel aufdrückte. Prachtvoll ausgestattet, stellt man bei der Lektüre bald erstaunt fest, daß man über
die tatsächlichen Lebensfragen des Alltags und der Politik überhaupt nichts erfährt. Dieses
Werk ist vielleicht das eindrücklichste PR-Unternehmen, das literarisch-wissenschaftlich in
der neueren Zeit in Angriff genommen wurde. Bewiesen sollte werden, daß die Monarchie
zwar historisch und kulturell durch alte "nationale" (nämlich ethnische) Eigentümlichkeiten
geprägt sei, strukturell aber vor allem durch gegenwärtige Gemeinsamkeiten aufgebaut
werde und damit notwendig wäre. Die Ironie an dieser Grundstimmung ist, daß sie sachlich
relativ richtig genannt werden muß. Sie sitzt jedoch der eigenen Kulturideologie auf und
geht damit am eigentlich entscheidenden Punkt vorbei: Dass nämlich Nation ein modernes
Konzept ist, welches zwar Verschiedenheit behauptet und sich damit zu begründen
versucht, das jedoch nur kann, weil sie grundsätzlich strukturelle Gleichheit voraussetzt.
"Tatsächlich gelang eine Durchsetzung dieser Konzeption nur in den staatstragenden Eliten
und in Ansätzen in der deutschsprachigen Bevölkerung" (Johler 1995, 86).
Bleiben wir noch einen Augenblick beim Vergleich des österreichischen Nationenaufbaues
mit jenen von Staaten der Dritten Welt der Gegenwart15, der auch von anderen schon
gezogen wurde (Bluhm 1973)! Die Unterschiede zu damals sind bei näherem Hinsehen
wesentlich weniger tief, als sie vorerst scheinen mögen. Was war das Hin- und
Herschieben von Gebieten in den Besitzständen der diversen Dynastien ohne Ansehen der
Bevölkerungen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts anders als die angeblich so "willkürliche
15
Wir könnten auch andere Vergleiche heranziehen. Wenn wir etwa die Diskussion um den Weg Rußlands
am Ende des 19. Jahrhunderts betrachten - Plechanow (1975 [1895] und ö. j. [1908]) könnte durchaus ein
Beispiel dafür sein, zumal er dies in der intellektualistischen Manier tat, wie wir sie von seinesgleichen im
nationalen Aufbau schon kennen - dann frappiert oft die Parallele qauch mit den heutigen Problemen.
79
Grenzziehung" durch die Kolonialmächte? Diese Dynastien standen nicht weniger
außerhalb der Gesellschaften wie fremde Mächte. Ob ein Nationenbau innerhalb gegebener
administrativer Grenzen erfolgreich war, war damals oft genug genauso eine Frage des
Zufalls, wie es auch heute der Fall ist. Das hing im wesentlichen von zwei Fragen ab: 1)
Reichte die numerische und politische Stärke des hegemonialen Zentrums aus, um die
Peripherien zu dominieren und zu integrieren? - 2) War die Distanz in der Selbst- und
Fremdwahrnehmung zwischen den konstituierenden Bestandteilen bzw. Bevölkerungsgruppen zu groß oder konnte sie überwunden werden? Diese Wahrnehmung lief in
den Augen der europäischen Intellektuellen vor allem als Funktion der (Hoch-) Sprache ab.
Österreich-Ungarn: Kommunikationsindikatoren
900
800
700
600
Eisenbahnkilometer pro Mill.
EW
500
400
Telegramme pro 100 EW
300
200
100
0
1860
1870
1880
1890
1900
1910
Jahr
Quelle: gerechnet aus Gross 1973 mit den Bevölkerungszahlen aus Helczmanowsky 1973
Kommunikationskennzahlen sind gute Indikatoren für die Integration. Es ist daher ein
aussagekräftiger Hinweis, dass das Niveau beförderter Briefe 1911 469,5 war, wenn man
den Durchschnitt 1882 – 1886 100 setzt. Andere vergleichbare Kennzahlen zeigen dieselbe
Entwicklung.
Der Aufbau eines modernen Staates war auch nach dem Scheitern des Neoabsolutismus
keineswegs erreicht, und er war auch nicht das Ziel der herrschenden Eliten. Für diese am
kennzeichnendsten war die Ära Taaffe (1879 - 1893), wobei Taaffe der mit weitem
Abstand längst amtierende Ministerpräsident der Doppelmonarchie war. Kinder- und
Jugendfreund des Kaisers, verstand er sich als "Kaiserminister", als "Minister der Krone",
als "nur ein Exekutivbeamter seiner Majestät" (Skedl 1921, 7). Der Herausgeber seines
politischen Nachlasses charakterisiert die Situation seiner Zeit so (Skedl 1921, 5 f.): "Da
der Kaiser die Richtung der Staatsverwaltung persönlich bestimmte, so sind seine Gehilfen,
die Personen seines Vertrauens, regelmäßig ein enggeschlossener aristokratischer Kreis,
wie dies die Schriftstücke zeigen. Die Mitglieder dieses Kreises verkehren untereinander
selbst in amtlichen Angelegenheiten, wie z. B. die Zuschriften des Ministerpräsidenten an
die Statthalter und umgekehrt beweisen, in freundschaftlichem, ja intimem Ton. (Die im
folgenden reproduzierten Privatbriefe sind eigentlich Dienstbriefe.) Es ist nicht das
verliehene Amt an und für sich, sondern das den Amtsträgern geschenkte kaiserliche
Vertrauen und seine Zugehörigkeit zur leitenden Oberschicht, welche den hohen Beamten
als solchen qualifizieren." Auf diese Verhältnisse hat man schon des öfteren hingewiesen
80
(Bruckmüller 1985, 1996). Es war der Hof, welcher für die gesamte "höhere", d. h.
hegemoniale, Gesellschaftsschicht den Ton, die obersten Werte, vorgab. Und das ging
keineswegs konfliktlos vor sich, was gerade auch auf die nationale Stimmung Auswirkungen gehabt haben dürfte. Was eine französische Reisende im ersten Viertel des Jahrhunderts schrieb, dürfte 50 Jahre später noch immer seine volle Gültigkeit gehabt haben:
"Es liegt ein Keim tiefen Hasses, vielleicht gar kommender Revolution in der arroganten
und verächtlichen Zurückhaltung in der hohen österreichischen Aristokratie und der von ihr
verletzten Eitelkeit der 'zweiten Gesellschaft'. Nicht führt von dieser hinüber zu jener,
weder Heiraten, die immer nur Mesalianzen sind, noch geleistete Dienste, weder Würde,
nicht Stellung, auch nicht die höchsten Orden. Wer sie trägt, genießt zwar für sich alle
Ehren und Vorteile, die damit verbunden sind, aber seine Familie bleibt immer fremd... Der
Dichter, der geniale Mensch, ist nicht imstande, die alberne Grenze zu überschreiten, die
ihn von den aristokratischen Salons trennt, wo er seinen Geschmack verfeinern und
zugleich den matten, abgestumpften Geist beleben könnte, der dort herrscht" (Baronin
Montet, zit. in: Heindl 1990, 244). Doch nicht diese Feindschaft ist das eigentliche
Problem, sondern vielmehr der doch nicht unterlassene Versuch, diese Schichten zu
imitieren. Hof und 'erste Gesellschaft' blieben stilbildend. Für den Sozialwissenschafter
stellt sich hier ein wesentliches Problem: Im 19. Jahrhundert stimmte in der Habsburger
Monarchie offenbar der Lebensstil und die sozioökonomische Funktion des Großbürgertums und vermutlich auch des Bildungsbürgertums überhaupt nicht überein. Aber auch
andere Schichten im Rahmen des gemeinsamen Staates lebten in diesem Zwiespalt. Der
mittlere ungarische Adel hatte dort jene Funktion, welche anderswo das Bürgertum zu
erfüllen hätte. Wenn man sich Max Webers Gedankengängen über die rationalisierende
Funktion des Bürgertums anschließt, die wir etwas verallgemeinert übrigens in Talcott
Parsons These vom Primat des Kultursystems gegenüber anderen analytischen Teilsystemen der Gesellschaft wiederfinden, müßte man sich eine Verzögerung oder eine
Umorientierung der Entwicklung erwarten. Sowohl für die österreichische, als auch für die
damit verbundene ungarische Entwicklung sollte dies manches erklären.
Was ist denn die Funktion des Bürgertums in sozialer und ökonomischer Sicht? Wir
wollen hier nicht die ohnehin schon bekannten Texte von Franklin bis Knigge wieder
zitieren, sondern uns auf die Ideologisierungen berufen, welche im 19. Jahrhundert
besonderes Gewicht bekamen, auf die Politische Ökonomie. Einer der Ideologen der
Akkumulation, welcher durch mehrfache Übersetzungen im deutschen Sprachraum
Gewicht erhielt und in seiner vulgarisierenden und popularisierenden Weise keine zu
hohen intellektuellen Ansprüche stellte - auf Jean-Baptiste Say.
J.-B. Say ist von Grund auf Technokrat und könnte imgrunde den ökonomischen Unterbau für
Saint-Simon liefern. Denn er exponiert sich ständig als Ideologe der Produktion: Konsum zerstört
Reichtümer und, implizit, senkt den Volkswohlstand. So ordnet er in der Tradition Adam Smith's
denn auch die Regierung tendentiell (und an vielen Stellen ganz explizit) in den parasitären
Konsum ein, der nur schadet. Überhaupt huldigt er einem geradezu anarchischen, viszeralen AntiEtatismus, der aber bei ihm schon zweischneidig wird: Auf der einen Seite richtet er sich gegen
das ancien régime. Auch der Kampf gegen die Steuer ist für ihn vorrangig ein Kampf gegen die
sinnlose Verschwendung des alten Staates. Auf der anderen Seite sind aber schon rudimentäre
Umverteilungsmaßnahmen das Ziel seiner Angriffe. Was er generell massiv unterschätzt, ist die
für eine Großgesellschaft gegebene Notwendigkeit eines politisch ordnenden Rahmens. Der Grund
für diese Überschätzung der selbstregulierenden Fähigkeiten der Gesellschaft ist ein gewisser
Naturalismus - die Neigung, die sozialen Institutionen seiner Zeit mit der "Natur des Menschen" zu
verwechseln. In der Folge dessen kommt er statt zu einer regulierten Gesellschaft (società
81
regolata) zu einem Nachtwächterstaat. Die falschen Töne dabei gehen bruchlos in eine
bedingungslose Eigentumsideologie über. Die hat kaum mehr etwas zu tun mit der größtmöglichen
Freiheit oder einem Zustand gleicher Chancen hinter einem "Schleier der Unwissenheit". Aus dem
um die persönliche Freiheit besorgten "Anarchisten", vielmehr Individualisten, wird der
bürgerliche Ideologe des schrankenlosen Eigentums. Dabei gelingen ihm sogar einige originelle
Gedanken. Es kommt z. B. bei ihm heraus, daß größere Ungleichheit den allgemeinen Wohlstand
vermindert, für den er als Indikator die verhältnismäßige Bevölkerungszahl bzw. -entwicklung
nimmt. Den Malthus'schen Naturalismus übernimmt er zwar abstrakt. Doch dann sind es die
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Institutionen, welche den "Nahrungsmittelspielraum",
nach Mackenroths Ausdruck, bestimmen.
Das Ziel des historischen Momentes, in dem er lebte, war Akkumulation. Und er war sich der
historischen Bedeutung dieses Augenblicks sehr bewußt. So gibt es denn kaum einen heftigeren
Gegner jener schmierigen Theorie von der Notwendigkeit einer parasitären Klasse wie eben ihn.
Parasitärer Verbrauch behindert die wirtschaftliche Entwicklung - da gibt es für ihn keine Frage.
Dies ist der Hintergrund und der Sinn seines berühmt-berüchtigten "Prinzipes", nach dem sich das
Angebot seine eigene Nachfrage schaffe. Es war ein Kampfinstrument für eine Reihe von
Zwecken. Die wichtige Auseinandersetzung dahinter ist eine erste intensive Unterkonsum-Debatte,
wie wir sie z. B. 100 Jahre später bei Rosa Luxemburg wieder erleben können. Daß Say dabei viele
reale Probleme übersieht, läßt sich aus dem Eifer des Gefechtes erklären (und verbindet ihn im
übrigen in diesem Punkt mit Ricardo). Eine andere Stoßrichtung geht gegen den Protektionismus
und für den Freihandel, der die "Reibungen", durch welche Absatzstockungen zustande kommen,
vermindern würde. Die Frage wäre: Hat uns diese Auseinandersetzung heute, in einer Zeit der
tendentiellen Nachfragelücke noch irgendetwas zu bieten? Say führt die Debatte nicht zuletzt ja als
Frage nach der Möglichkeit eines allgemeinen Gleichgewichtes. Allerdings zeigt er sich unfähig,
zwischen einem theoretischen und abstrakten Gleichgewichtszustand und einer realen, sich ständig
(zyklisch) entwickelnden Ungleichgewichtswirtschaft zu unterscheiden. In Wirklichkeit ist das nur
die praktische Seite seiner Unfähigkeit, zwischen Marktpreis und Wert zu Unterscheiden,
zumindest insoferne eine Dynamik einzuführen, als er eine ex-ante-Planung und eine ex-postWirklichkeit sehen würde.
Im übrigen kommen aus dieser technokratischen Haltung massive Fehlurteile, die aber einges über
den Gegenstand seiner Überlegungen aussagen: So sagt er etwa voraus, daß das Kolonialsystem im
19. Jh. zusammenbrechen würde, weil es zu aufwendig sei. Wichtig - und zwar für die
Sozialwissenschaft allgemein - ist die Rolle, welche die Quantifizierung der Verhältnisse spielt,
oder auch nicht spielt.
Die so oft beschriebene revolutionäre Funktion des Bürgertums ist gerade das Gegenteil
der Haltung, welche wir tatsächlich im 19. Jahrhundert in der österreichischen "zweiten
Gesellschaft" finden, die keinen brennenderen Ehrgeiz hatte, als zur ersten Gesellschaft zu
zählen. (Ähnliches gilt sicher auch für das Pariser Bürgertum des juste milieu.) Belegen
konnte sie dies am ehesten mit Prestige-Konsum, und das tat sie ausgiebig.
Als nach Taaffes Rücktritt die ersten Vorläufer eines allgemeinen Wahlrechtes - noch unter
seiner Ministerpräsidentschaft wurde, nicht zuletzt aus taktischen Gründen, die
gesetzlichen Grundlagen für eine fünfte, allgemeine Kurie geschaffen - ihre Wirkung
zeigten, begann auch dieses neofeudale System etwas von seiner Wirksamkeit zu verlieren.
Der Monarchie blieb infolge der Blindheit ihrer Führungsschichten allerdings nicht mehr
Zeit genug, den Umbau durchzuführen.
Im westlichen Teil des Habsburgerstaats (d. h. im wesentlichen außerhalb der Länder der
Stephanskrone) bestand ein entscheidendes Merkmal der aufsteigenden neuen
hegemonialen Eliten in der gemeinsamen Identifikation über die deutsche Sprache. Doch
diesen Eliten, wie übrigens auch Konkurrenzeliten, die sich noch langsamer bildeten als die
82
deutsche Hegemonialelite und über andere Sprachen identifizierten, waren vorerst, und in
vielen Fällen bis zum Ende der Monarchie, die Beteiligung an der Macht verwehrt. Da nun
eine Demokratisierung als Voraussetzung für "Partizipation" neben Integration und (Re-)
Distribution eine der Hauptfunktionen nationalen Lebens darstellt, orientierte sich vor
allem der Teil der Bevölkerung auf Deutschland, der am meisten auf eigene Mitsprache
drängte und dabei am meisten zu gewinnen dachte: die mittelständischen Intellektuellen
(Johnston 1983, Zöllner 1984). Aus ihnen kamen die Deutschnationalen. Ihnen stellten sich
die Konkurrenzeliten gegenüber, die nun ihrerseits aus dem Modernisierungsprozeß mit
eigenständigen nationalen Projekten auftauchten.
Eine ganz spezifische, verhängnisvolle und etwa mit der Funktion der Dynastie vergleichbare Rolle spielte in diesen Prozessen die römisch-katholische Kirche. Im Zeitraum des
Neoabsolutismus gelang es ihr mit dem Konkordat (1855), unbestritten die Rolle einer
Staatskirche zu erlangen, welche keine Abweichung von ihrer fundamentalistisch geprägten Lehre und Praxis duldete und alle anderen Konfessionen halb in die Illegalität drängte.
Die sogenannte liberale Ära ist nicht zuletzt gekennzeichnet durch den erfolgreichen
Kampf gegen das Konkordat und um einen moderat laizistischen Staat. Einzelne Bischöfe,
wie etwa der Linzer Bischof Rudigier, taten zwar alles, um einen Kulturkampf schroffster
Art zu entfachen. "Es ist vor allem der ausgleichenden Haltung des Kaisers zu verdanken,
daß das österreichische Kultuswesen vor ernsteren Zerwürfnissen verschont blieb und in
einem der Kirche keineswegs feindlichen Sinne erfolgte... Von einem 'Kulturkampf' in der
Art Preußens kann in Österreich kaum gesprochen werden" (Leisching 1985, 61f.). Was
hier so positiv formuliert wird, war nichts anderes als die Kollusion zwischen Kirche und
Dynastie - wobei Franz Joseph selbst in einem Brief an seine Mutter verärgert die Person
des Papstes, Pius IX., der auf kurzsichtigste Art ihn persönlich sogar mit "Kirchenstrafen"
bedrohte, als das eigentliche Hindernis für einen Ausgleich bezeichnete - , welche stark
dazu beitrug, auch die Nationen und Nationalitäten zu polarisieren und damit einen
modernen Staatsaufbau weiter verunmöglichte. Wie sehr dies der Fall war, läßt sich daran
ersehen, daß man die habsburgische Armee im Krieg gegen Preußen als
"Konkordatssoldaten" bezeichnete, über deren Niederlage niemand froher war als das
liberale Bürgertum der Monarchie. So war es denn auch in diesem Punkt, daß sich die
Blicke nach Preußen und ins Deutsche Reich richteten, wo Bismarck den römischen
Fehdehandschuh aufgenommen hatte. Man kann ohne weiteres sagen, daß sich hier auf
mitteleuropäischem Boden eine bestimmte Form von Kemalismus (Reiterer 1988)
abspielte, eine versuchte Kulturrevolution von oben. Wie der Ton der militanten
Gefolgschaft Bismarcks aus dem Bürgertum klang, läßt sich an einem Spätaufklärer
beispielhaft abnehmen:
"Am meisten zu beklagen ist es, daß der moderne Kulturstaat sich der kulturfeindlichen Kirche in die Arme wirft.... Unsere Staatsordnung kann nur dann besser
werden, wenn sie sich von den Fesseln der Kirche befreit und wenn sie durch
allgemeine naturwissenschaftliche Bildung die Welt- und Menschenkenntnis der
Staatsbürger auf eine höhere Stufe hebt. Dabei kommt es gar nicht auf die besondere
Staatsform an. Ob Monarchie oder Republik, ab aristokratische oder demokratische
Verfassung, das sind untergeordnete Fragen gegenüber der großen Hauptfrage: Soll
der moderne Kulturstaat geistlich oder weltlich sein? ... Als der deutsche Kulturkampf 1872 begann, wurde er mit vollem Recht von allen freidenkenden Männern als
eine politische Erneuerung der Reformation begrüßt, als ein energischer Versuch, die
moderne Kultur von dem Joche der papistischen Geistestyrannei zu befreien; die
83
gesamte liberale Presse feierte Fürst Bismarck als 'politischen Luther' ..." (Haeckel
1921 [1899], 6 und 208).
Und Haeckel beklagt den Gang nach Canossa, die Einstellung des Kulturkampfes. Wie
eigentlich alle seinesgleichen, hatte er nicht begriffen, daß Kemalismus in etwas fortgeschritteneren Gesellschaften kein längerfristig effizientes Mittel der Politik sein kann, weil
er anstelle Überzeugungen zu ändern nur aktiven Widerstand hervorruft. Diese Stimme
kam zwar aus dem Deutschen Reich, aber sein riesiger Erfolg unter liberalen Geistern
erreichte auch die Deutschsprachigen Österreichs.
Darüber hinaus hatte die Bismarck'sche Politik mit Aufklärung oder Liberalisierung
natürlich überhaupt nichts zu tun, wie sich u. a. an den Sozialistengesetzen zeigen wird. Es
war eine junkerlich autoritäre Politik, die hinter dem Fetisch des nationalen Interesses nur
die eigenen Klasseninteresse versteckte - was dem Bürgertum, auch dem liberalen, ja
durchaus zupaß kam. Der Appell zur nationalen Einheit war für dieses Bürgertum stets nur
der Appel, soziale Konflikte zu vermeiden und so seine Privilegien fraglos zu akzeptieren.
So ist es denn auch keineswegs verwunderlich. wenn eine neue Untersuchung zum Schluß
kommt, daß die Breite des nationalistischen Einflusses und seine Wirkung auf die
damaligen Entscheidungsträger durchaus begrenzt waren und keineswegs den heute
gängigen Vorstellungen entsprachen (Farrar u. a. 1989), ein Befund, der sich gerade auch
in Österreich in der Unterstützung explizit deutschnationaler Parteien im Vergleich zu den
Volksparteien damals nachvollziehen lässt (Reiterer 1993).
Was jedoch an diesem gebremsten Kulturkampf in Cisleithanien von größerer Bedeutung
war, ist, daß er national differentiell ablief. Die Römische Kirche konnte sich auf große
Teile der noch stark in traditionalen Verhältnissen lebenden nichtdeutschen Nationen und
Nationalitäten stützen. Zum einen führten die Deutschnationalen bereits den Kulturkampf
auch teilweise unter nationalem Vorzeichen. Zum anderen aber kam es dazu, weil sich die
Polen, Slowenen und Kroaten - bei den Tschechen war es komplizierter - vor den Karren
der kirchlichen Interessen spannen ließen und die Konservativen unterstützten. Damit
wurden manche der laizistischen Gesetze auch zu Symbolen im nationalen Streit. Noch
heute findet man bei den Slowenen z. B. gerne den Hinweis auf die Schulgesetze von 1869,
die als der eigentliche Wendepunkt zu einer germanisierenden Politik betrachtet werden.
Dies ist nicht unrichtig. Doch bleibt unerwähnt, dass dies nur geschehen konnte, weil sich
die klerikal-konservativen Sprecher, ob sie nun selbst Geistliche oder Bischöfe waren oder
Bürger, an die alte hinfällige Politik des Neoabsolutismus klammerte. Wie nicht selten,
wurden damit die Sprecher des status quo zu den Wegbereitern der Niederlage ihrer
eigenen Klientel. Der Deutschnationalismus nützte dies zu erfolgreichen Assimilationskampagnen.
Wir können am Charakter dieses zweischneidigen Deutschnationalismus nicht vorüber
gehen, weil er bis in die Gegenwart gründlichst missverstanden wird. Nationale Einigungsprozesse waren, wie schon oft genug betont, vor allem das Anliegen aufsteigender
bzw. auch am Aufstieg gehinderter bürgerlicher (Gegen-) Eliten. Die Frühformen des
Nationalismus traten dabei nicht selten als "Pan-Bewegungen" auf. Sie waren dabei
eigentlich Vorformen des modernen Nationalismus. In unserer Region die vielleicht
bekannteste ist der Panslawismus (vgl. Moritsch 1993). Das Interessante daran ist, dass ein
früher politischer Ausdruck dessen eigentlich dem späteren Panslawismus ganz entgegengerichtet war: Es war der "Austroslawismus" als intellektueller Versuch, der "russischen
Barbarei" eine (Kon-) Föderation unter habsburgischer Führung entgegenzusetzen. Heute
84
gibt es idyllisierende Tendenzen, ihn als weitblickenden Lösungsansatz hochzustilisieren
(vgl. Moritsch 1996). So mag es nicht uninteressant sein, wie er von zwei berühmten
Zeitgenossen betrachtet wurde, nämlich von Marx und Engels. Nach einem Überblick über
die Verhältnisse auf dem Balkan, der in seiner Verwendung von abgegriffenen Schlagworten von jedem anderen schlechtinformierten und oberflächlichen 19.-Jahrhundert-Journalisten stammen könnte,16 kommen sie jedoch zum wichtigen Schluss, dass die religiös
motivierte Orientierung auf Rußland als neues Rom jede anders gerichtete Überlegung
chancenlos mache: "Trotz allen panslawistischen Anstrengungen der Agramer oder Prager
Enthusiasten hat der Serbe, der Bulgare, der bosnische Rajah, der slawische Bauer aus
Makedonien und Thrazien mehr nationale Sympathie, mehr Berührungspunkte, mehr
Mittel des geistigen Verkehrs mit den Russen als mit den römisch-katholischen Südslawen,
der dieselbe Sprache spricht. Was immer geschehen mag, er erwartet von Petersburg seinen
Messias, der ihn von allem Übel erlöst" (MEW 9, 3 - 12 [11]).
Nicht minder interessant jedoch ist der Pangermanismus. Hier gilt es nun zu unterscheiden
zwischen einer frühen Form des deutschen Nationalismus und der wesentlich bekannteren
späteren, dem Pangermanismus im engeren Sinn. Die frühe Form des Deutschnationalismus ist eine typische Pan-"Bewegung", die man in eine Reihe mit Panslawismus, Panarabismus oder Panturkismus stellen muß, mit protonationalen Formen also, nicht aber mit
reifen nationalen Bewegungen. Intellektuelle griffen aus einer Gemengelage von unterschiedlichen politischen Bedürfnissen heraus die Sprachähnlichkeit vieler Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlichen Bewusstseins auf und erklärten sie zur "Nation". Es war
ein frühnationalistisches Konstrukt, welches mit der Erfahrung der betroffenen
Bevölkerung(en) wenig zu tun hatte und daher bei ihnen auch kaum auf Resonanz stieß.
Mobilisieren konnte man sie damit nicht. Ein Teil der politisch kurzfristig aktiven Massen
stand dem möglicherweise freundlich ohne großen Enthusiasmus gegenüber, der größere
Teil vermutlich nur gleichgültig.
Der eigentliche Pangermanismus, und dieser Ausdruck wurde nicht zufällig erst später
gemünzt, war etwas ganz anderes. Mittlerweile war eine deutsche Nation politische Wirklichkeit geworden, von oben herab geschaffen und unter der Hegemonie des preußischen
Kerns. Die sogenannte "kleindeutsche Lösung" war, als nationaler Entwurf, tatsächlich der
einzig gangbare. Damit ist weder gesagt, daß die Bismarck'sche Methode die einzig
mögliche war, noch dass die Grenzen genau dort gezogen werden mußten, wo sie eben
gezogen wurden. Letzteres ist bekanntlich in hohem Ausmaß eine Frage des Zufalls und
der momentanen Machtverhältnisse. Doch nunmehr stieg dieser neue deutsche Nationalstaat in den imperialistischen Wettbewerb ein. Eines der angewandten Mittel war ein
wilder Nationalismus, welcher die Höherrangigkeit des Kollektivs "Nation" gegenüber dem
Einzelmenschen behauptete. Das ist im Nationalismus recht gewöhnlich. Es ist faktisch
nichts anderes als der Machtanspruch von hegemonialen Schichten, vertreten durch soziale
und politische Eliten. Diese Eliten formulieren in nationalen Auseinandersetzungen einen
solchen Anspruch unter der "Kollektivideologie", weil mit einer Akzeptanz dieser Ideologie ihr Machtanspruch akzeptiert wird. Nach innen folgte aus dieser Ideologie übrigens ein
Homogenitätsanspruch und daraus eine Assimilationspolitik, womit sie ihren Machtan-
16
"Die europäische Türkei... ist so unglücklich, von einem Konglomerat der verschiedensten Rassen und
Nationalitäten bewohnt zu werden, von denen man schwer sagen kann, welche von ihnen die für
Zivilisation und Fortschritt am wenigsten befähigte ist" (MEW 9, 7).
85
spruch auf quantitativ immer größere Kreise ausweiten. Und nach außen entstand der
Pangermanismus als Eroberungsideologie dieses Imperialismus und seiner Alliierten bzw.
Fünften Kolonnen in anderen Staaten. Spezifisch deutsch daran war nicht etwa der
Imperialismus, der vom Ärmelkanal bis nach Bagdad herrschen wollte. Das wollten die
Briten ebenso und taten es auch. Spezifisch war eher, daß dies unter einem ethnonationalen
Anspruch geschah. Das war, bleibt man beim Vergleich mit den Briten, ungewöhnlich:
Diese wären nie auf die Idee gekommen, etwa die Iren als Briten zu sehen.
Theoretisch mag dies kompliziert klingen. "Der in der Habsburger-Monarchie im Zuge der
Industrialisierung mit der Ausbildung bürgerlich-industrieller Lebensformen und der damit
verbundenen höheren sozialen Flexibilität einhergehende Prozeß der nationalen
Bewußtseinsbildung hatte – zumal nach 1866/67 - die Relativierung der traditionellen
politischen und administrativen Hegemonie der Deutschen zur Folge. Der dem gegenüber
ins Treffen geführte nationale Besitzstand, die Überlegenheit der deutschen wirtschaftlichen und kulturellen Standards, scheint dabei gerade in ethnisch heterogenen Gebieten
gefährdet, in denen soziale Emanzipation und politische Partizipation Gleichberechtigung
unter den Volksgruppen implizierte" (Streibel 1994, 49 f.).
2.6 'Ausgleich'
Der Ausgleich war die Vollendung der bürgerlichen Revolution in Österreich und Ungarn
mit ihrem Kulminationspunkt 1848/1849. Er war es etwa in dem Sinne, wie auch Bismarck, mit einer gewaltigen Portion Zynismus, jedoch nicht ohne Realitätsgehalt, als der
Vollender der deutschen bürgerlichen 48er Bewegung bezeichnet wurde. Die historische
Dialektik hat aus beiden Vollendungen Vollstreckungen, d. h. Todesurteile für die
ursprünglich freiheitlichen Anliegen und Motive gemacht. Die 48er schrieben einen
sauberen Entwurf, die 60er (und in Deutschland: die 70er) machten daraus ihre schmutzige
Realität. Die "bürgerliche" Revolution zeigte in beiden Fällen ihr nicht allzu schönes
Gesicht – es erwies sich als die Fratze nationaler und sozialer Unterdrückung.
Historisch-konkret war Struktur und Geschehen sehr durchsichtig, auch von den
Beteiligten nicht verborgen und somit noch heute leicht erkennbar: Wenn Rauchenberg
1908 den Anspruch erhebt, die "Deutschen" der Monarchie dürften nicht gezählt, sondern
müssten gewogen werden (zit. in: Wandruszka/Urbanitsch 1978, 33), hat er damit den
Hegemonie und Machtanspruch seiner eigenen Schicht deutlich genug deklariert. Es hat
einige Zeit gedauert, bis diese Deutschen begriffen, daß sie innerhalb der Monarchie einen
wichtigen Verbündeten hatten: die Magyaren. Diese hatten in ähnlicher Weise um ihre
Dominanz in den Ländern der Stephanskrone zu kämpfen, wo auch sie eine Minderheit
darstellten. Nach dem Beinahe-Zusammenbruch der Monarchie im Krieg gegen Preußen
und Italien 1866 waren es die Magyaren, welche den Weg wiesen. Ihre Oberschichten
waren übrigens eher noch als das deutsche Bürgertum bereit gewesen, den Krieg gegen
Preußen zu unterstützen, im Gegensatz zu wenigen Jahren später. Nun waren sie auch zum
Kompromiss mit der Dynastie einerseits, mit den Hegemonen der westlichen Reichshälfte
andererseits bereit. Auch diese bzw. ihre dünne, sich parlamentarisierende bürgerliche
Oberschicht hatten endlich begriffen, dass dies in ihrem unmittelbaren Interesse lag: "Wir
wollen den Dualismus, da es keinen einzigen Staat von Bedeutung auf der Welt ohne eine
politisch führende Nation gibt; und diese führende Rolle, zumindest diesseits der Leitha,
uns gebührt..." (Kaiserfeld, Sprecher der Autonomisten, in: Galántai 1985, 27). Man
argumentierte aus einer Mischung von Nationalismus und altem Denken heraus. Ähnlich
war es bei den Magyaren, welche in ihren Wortmeldungen den Ausgleich vor allem
86
sicherheitspolitisch begründeten: "Die Niederlage bei Königgrätz hat Österreich in seinen
Grundfesten erschüttert, ohne dass Ungarn dabei jedoch einen positiven Vorteil erlangt
hätte. Die Lage hat sich für uns nur insoweit geändert, dass uns die Gefahr seitdem nicht
mehr sosehr von Seiten Österreichs, sondern von anderer Seite droht, und dass gegen den
neuen Feind gerade derjenige unser natürlichste Bündnisgenosse sein könnte, der bis dahin
unser größter Gegner war... Da die gleichen Elemente Österreich und Ungarn mit
Auflösung bedrohen, böte die Interessensgemeinschaft die Grundlage für das natürlichste
Bündnis" (Boldiszár Horváth, ein Sprecher der liberalen Deák-Partei; in: Galántai 1985,
29). Man skizzierte also eine amalgamierte Sicherheitsgemeinschaft mit der westlichen
Reichshälfte gegen Russland und Preußen. In der politischen Realität hatten die Magyaren
von Bismarck-Deutschland nichts zu fürchten: Der deutsche Kaiser wird sich mehrere
Male explizit weigern, die Deutschungarn gegen die dominanten Magyaren zu unterstützen. Bismarck, der Götze der Alldeutschen, war kein Nationalist in einem trivialen Sinn
– er war ein Staatsideologe nach der Art Seipels (s. später). Preußen wird denn auch bald
ausschließlich als Verbündeter wahrgenommen – mehr noch als die österreichischen
Deutschen jenseits der Leitha (vgl. Andrássy 1897). Der eigentliche Feind ist dagegen der
„Panslavismus“, d. h. im Inneren schlicht die nichtungarischen Nationalitäten. Gegen sie
und natürlich auch gegen ihre Verbündeten des „Orients“, d. h. des Balkans, gegen
Rumänien, Bulgarien und Serbien, muss Ungarn Großmachtstatus erlangen. Da es allein
dazu zu schwach ist, braucht man den Ausgleich, nämlich die Unterstützung des
cisleithanischen Reichsteils.
Doch nicht nur, nicht einmal hauptsächlich, außen standen die Gegner, wie gesagt: Der
Ausgleich war nötig "wegen der Nationalitätenbestrebungen der Slawen, die innerhalb der
Monarchie die ungarische wie die deutschösterreichische Hegemonie gleichermaßen
bedrohten" (Galántai 1985, 32f.).
Die Überlegungen der beiden Hauptkontrahenten des Ausgleichs verraten einigermaßen
viel über die Nations-Auffassung, wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs nur in
Mitteleuropa und keineswegs nur bei den Konservativen. Denn die sogenannten "Liberalen" unterschieden sich kaum von den deklarierten Konservativen, außer dass sie sich
manchmal "durch einiges Geflunker mit liberalen Phrasen"17 einen Vorteil erlangen wollten) gang und gebe war. Nation kann nur eine Bevölkerung sein, die eine Großmacht zu
bilden imstande ist. So schreibt Engels in einem privaten Brief am 23. Mai 1851 nach einer
Reihe von chauvinistischen Ausfällen gegen die Polen an Marx: "Eine Nation, die 20.000
bis 30.000 Mann [an Truppen] höchstens stellt, hat nicht mitzusprechen" (MEW 27, 268).
Diese Auffassung kam aber in Konflikt mit den sonstigen Bedingungen, insbesondere mit
der Überlegung, dass Nation eine Abstammungsgemeinschaft sein solle. Es gab eben nur
knapp 5 Millionen Ungarn in der Monarchie, und zum Zeitpunkt der Zählung waren sie
sogar nur die zahlenmäßig drittstärkste Sprachgruppe, nach den Deutschen und den Italienern (das wird sich 1866 ändern). Die eindeutige politische Schlussfolgerung war, dass
man Slowaken, Kroaten, Rumänen und Ungarndeutsche assimilieren müsse, und wenn sie
nicht wollten, eben unterdrücken. Nicht anders dachte die deutschsprechende Mehrheits-
17
Der Ausdruck stammt aus einem Bericht des damaligen Ministerpräsidenten-Stellvertreter Taaffe vom 29.
Oktober 1868 an den Kaiser, der sich über eine parlamentarische Wortmeldung des Justizministers Zerbst
bzw. des Innenministers Giskra erregt hatte; Taaffe beruhigte ihn, dass sei nötig gewesen, um sich
goodwill für die Abstimmung über das Wehrgesetz zu verschaffen (In: Skedl 1921, 46).
87
bevölkerung diesseits der Leitha (rund 40 % der Gesamtbevölkerung). Außenpolitisch
drückte sich die "Großmacht-Nation" zur selben Zeit in den sogenannten Rekompensationsverträgen und -klauseln aus: Wenn eine Macht irgend einen Vorteil in einem Gebiet
(z. B. am Balkan) erlangen sollte, wollte die andere dafür "entschädigt" werden. Dies zeigt,
dass man Nation oder Staat nach außen praktisch ausschließlich in Termen der militärischen Hegemonie verstand. Der Staat wird also von seinen Hauptnutznießern in dieser
Zeit also nur als Gewaltinstrument verstanden. Nur vor einem solchen geistigen Hintergrund konnte sich die Bismarck'sche Doktrin vom "Primat der Außenpolitik" entwickeln.
Nirgends wird dies deutlicher als im schon genannten geschwätzigen Diskussionsbeitrag
des jüngeren Andrássy. Es geht immer nur um das Heer. Er will seine „Ko-Nationalen“,
und das sind ausschließlich jene rund ein Viertel stellenden Ober- und oberen
Mittelschichten, welche im ungarischen Parlament vertreten waren, mit allen zu Gebote
stehenden rhetorischen Mitteln überzeugen, dass der Ausgleich vor allem „Ungarn“ dient,
dass die „Kenntnis der deutschen Sprache heute keine Gefahr mehr für uns“ ist (402): „Die
Gefahr unserer Nation liegt nur in der Erstarkung der Sonderstellungsgelüste der Slaven
und Walachen.“ In diesem Interesse werden auch die Politiker der westlichen Reichshälfte
aufgefordert, „der Ausbreitung der Slawisierung eine Grenze zu stecken“ (405).
Was aber noch bis heute komplett im Hintergrund ist, erstaunlich genug, ist: Die hegemoniale Stellung der "Deutschen" in Cisleithanien zusammen mit ihrer Konkurrenzhaltung
gegenüber den "Reichsdeutschen" zeigt im Grunde die objektive Nationenqualität jenes
Teiles der Bevölkerung, den wir besser bereits als Deutschösterreicher bezeichnen sollten.
Dieser Punkt ging aus zwei Gründen bisher völlig unter: Zum einen war jene stark minoritäre Strömung mit Abstand am lautstärksten, welche um Schönerer herum den alldeutschen
Kern darstellte. Zum anderen gab es keine Debatte, welche auch nur annähernd diese
objektive Nationenqualität thematisiert hätte, weil jene, die nicht die Zugehörigkeit zu den
Deutschen in den Mittelpunkt stellten, sich politisch nicht über die Nation, sondern über
den Staat definierten. Das lässt sich aus der unwidersprochenen Präponderanz des
Sprachnations-Konzeptes – von dem man eigentlich nur mit Blick auf die Juden abwich,
die man nicht als Deutsche akzeptieren mochte, trotz ihrer Sprache (Stourzh) – erklären.
Beide Voraussetzungen zusammen ergaben jene Auffassung, welche in der Zeit der Ersten
Republik und vor allem in der Nazi-Zeit zur unverrückbaren Wahrheit von der deutschen
Zugehörigkeit des cisleithanischen Staatsvolkes hochstilisiert wurde.
Damit war der Ausgleich eine Kompromiss- und Interessenskonstruktion zweier
dominanter Nationalismen, welche nicht bereit waren, die Gleichberechtigung der anderen
Nationen, welche zur gleichen Zeit in ihren Verfassungscharten festgeschrieben wurde,
auch tatsächlich anzuerkennen und zu verwirklichen. In diesem Sinne ist der Ausgleich nur
einer der wichtigsten Schritte zum endgültigen Zusammenbruch dieses archaischen Staates
mit aufgesetzten Hegemonialnationalismen.
2.7 Fin de siècle
Grundlagenarbeit ähnelt in vielem der Ideologie. Sie ist nicht zuletzt der Aufbau einer bestimmten Stilistik. Diese Stilistik ist einerseits Teil des gesellschaftlichen Umfelds, andererseits gestaltet es dieses. Gelingt die Durchsetzung eines hegemonialen Paradigmas, so wird
diese Stilistik Basis der neuen Wissenschaft, aber zumindest in Teilen auch Element des
Alltags. Während die Klassik die Stilistik der Arbeit pflegte, finden wir in der Neoklassik
wieder eine dick aufgetragene Stilistik der Natur. Das ist eigentlich erstaunlich, weil es im
Grunde ein aufklärerischer Zug ist. Andererseits passt es sehr gut in die Metaphysik der
88
Natur hinein, welche im späten 19. Jahrhundert die alte religiöse Transzendenz der Jenseitigkeit zumindest im hegemonialen intellektuellen Bereich ablöste.
In den 90er Jahren und bis zum Beginn des Weltkrieges glaubten die maßgeblichen
Politiker der Monarchie, die ungarischen wie die cisleithanischen, sie könnten noch immer
als Großmacht auftreten. Doch diesen Status hatte der Habsburgerstaat spätestens seit der
deutschen Reichsgründung verloren. Die politische Konjunktur der 80er Jahre, welche alle
europäischen Mächte fieberhaft Verbündete suchen ließ – das „europäische Konzert“ – ,
wobei das neue Deutsche Reich das Zentrum aller Bemühungen pro und contra war, spiegelte noch einmal einen gewissen Einfluss vor. Kennzeichnend für die Haltung wie auch
für die Folgen dieser Illusion war die vom Außenminister Aehrenthal 1908 vom Zaun gebrochene bosnische Annexionskrise, die den Weltkrieg beinahe schon hätte ausbrechen
lassen. Damit stieß er alle erdenklichen Interessenten vor den Kopf und erreichte in Bosnien selbst das genaue Gegenteil dessen, was er sich erwartet hatte, nämlich eine Beruhigung. Was er vor allem nicht begriffen hatte, war, dass Frankreich und England die
Monarchie realistisch nur mehr als untergeordneten Vasallen des Deutschen Reiches
betrachteten, eine Sichtweise, die von den Deutschen selbst ja geteilt wurde, wie sich aus
Naumanns Buch wenige Jahre später ohne jede Zweideutigkeit ergibt. Im Grunde war diese
Naumann'sche Sichtweise aber bereits das Konzept der Bismarck'schen Politik gewesen.
Sie nahm dem Habsburgerreich gegenüber eine halbkolonialistische Haltung ein. Der Staat
sollte womöglich bestehen bleiben, wenn und insofern er sich den preußisch-deutschen
Interessen unterordnete. Kennzeichnend dafür ist eine Schlüssel-Episode aus dem Krieg
von 1866, als Bismarcks Stellung noch nicht so eindeutig gefestigt war, dass er einfach
seine Vorstellungen unwidersprochen durch gesetzt hätte. Nach der unerwartet schnellen
Niederlage der habsburgischen Armee bei und nach Königgrätz bestand die militärische
Führung auf einen Marsch auf Wien, und der König neigte dieser Richtung zu. Bismarck
sah seine gesamte Konzeption in Frage gestellt, produzierte einen hysterischen Anfall und
forderte seinen Abschied (Jerussalimski 1983, 63). Angeblich soll er sich sogar mit
Selbstmordgedanken getragen haben Angeblich soll er sich sogar mit Selbstmordgedanken
getragen haben, „aus dem offenstehenden, vier Stock hohen Fenster zu fallen“, wie er sich
selbst in seinen Erinnerungen (1898, II, 47) ausdrückt (vgl. auch Gall 1980, 373 f.). Der
König gab nach, und das Bismarck'sche Konzept war gerettet.
Erst im Verlauf der Bosnien-Krise 1908, also sehr spät, ging dem damaligen Außenminister Einiges von der politischen Realität auf: "In Aehrenthal wuchs nach der Annexionskrise die Überzeugung, dass die Monarchie – wenigstens in der Periode der verschärften
englisch-deutschen Rivalität – um jeden Preis an der Bewahrung des Friedens interessiert
sein mußte" (Galántai 1985, 133). Doch Aehrenthal starb bald. Seine Nachfolger begriffen
diesen entscheidenden Punkt schon nicht mehr. Unter der Kriegshetze des Oberkommandos der Armee, welche hinsichtlich ihrer militärischen Möglichkeiten völlig verblendet und
wirklichkeitsfern war, arbeitete man ständig mit Ultimaten und Kriegsdrohungen. Im Jahr
1912 kam es zur Prochaska-Affäre, welche in ihrer ganzen Schäbigkeit einer Schmierenkomödie ein Schlaglicht auf die Verhältnisse warf, gleichzeitig aber auch die außenpolitischen Beziehungen des Habsburgerstaats schwer schädigte (Kann 1977). Ein ganz erheblicher Teil der politischen Klasse und der politischen Öffentlichkeit – die keineswegs die
Mehrheit der Bevölkerung abbildete – drängte ganz offen zum Krieg. Zugrunde lag dem
eine Mischung aus politischer Unfähigkeit, eklatant verkörpert im Ministerpräsident, den
Grafen Leopold Berchtold (1863 – 1942), Realitätsverweigerung, vor allem von Seiten des
Militärs, und einer intellektuellen Stimmung vor allem in Wien, die schwer zu kennzeich89
nen ist: „Götterdämmerung“, „Krisenatmosphäre“ (a.a.O., 38) ist eher schlechte Belletristik
als analytische Kennzeichnung. Offenbar wurde die politische Situation von diesen Gruppen als völlig blockiert betrachtet. In der gesellschaftlich-kulturellen Sphäre dominierten
ebenfalls Kräfte, welche eine Stimmung der Ausweglosigkeit kultivierten. Es war in mancher Weise das österreichische, das multikulturelle Äquivalent des integralen Nationalismus und seiner Neuralgien. So wurde denn der Krieg wird von jenem Staat ausgelöst, welcher das höchste Interesse am Frieden gehabt hätte. Das war in gewisser Weise auch nicht
verwunderlich. Eines Tages hätte sich auf alle Fälle eine solche Situation verselbständigt.
Die bürgerlichen Intellektuellen hatten mit der langsamen und stockenden Liberalisierung
der Monarchie zumindest im nun sich ihnen öffnenden politisch-parlamentarischen Bereich
Mitspracherechte erworben, weniger aber im entscheidenden Bereich der Administration,
praktisch gar nicht in den Streitkräften. Die unterschiedlichen deutschnationalen Gruppen,
von den Großdeutschen bis zu den Sozialdemokraten, wurden bei der langsamen Ausweitung des Wahlrechtes zuerst nicht nur zu Sprechern der politisch neu eintretenden Schichten, sondern vor allem jener Tendenz, die nach der erdrückenden Atmosphäre des habsburgischen Spätabsolutismus und seiner katholischen Umhüllung, die man zusammen nur all
zu oft "österreichisch" nannte, alle materiellen und politischen Hoffnungen auf BismarckDeutschland setzten und sich dementsprechend auch als Deutsche definieren mussten. Dem
Interessensaspekt folgte ihre Selbstidentifikation. Die Deutschnationalen waren im Reichsrat gegen das Jahrhundertende zu die einzige Strömung von Belang, welche die Demokratisierung zumindest i. S. einer Ausweitung des Wahlrechtes und der Parlamentarisierung
vorantrieben. Aus dem demokratischen Flügel dieses deutschnationalen Kreises wieder
ging (u. a.) die Führungsgruppe der österreichischen Sozialdemokratie hervor (Viktor
Adler, Engelbert Pernerstorfer, Friedrich Austerlitz, Karl Renner, ...). Die Sozialdemokratie
wurde am Anfang des 20. Jahrhundert zur eigentlichen Sprecherin des deutschen Nationalismus in Österreich (Springer [=Renner] 1902, Bauer 1907, Bluhm 1973, Panzenböck
1985, Reiterer 1984, 1986). Sie strebten eine Befriedung der nationalen Konflikte an,
wobei das ausdrückliche Ziel die Beibehaltung der deutschen Hegemonie war. Während
die deutschnationalen Klubs in der Regel habsburgfeindlich waren, konnten sich die
Sozialdemokraten die Erhaltung des Reiches vorstellen und strebten sie z. T. sogar offen
an. Während zwar Pernerstofer – kennzeichnenderweise ein deutscher Nationalist auch
nach seinem Eintritt bei der Sozialdemokratie – von Wilhem Ellenbogen (1981, 62) als
“antihabsburgisch” charakterisiert wird, kennzeichnet der Herausgeber seiner Erinnerungen
diesen selbst durch “Anhänglichkeit an das Kaiserhaus” (S. 19).
Dieser morbiden politischen Situation stand eine verwunderliche kurze kulturelle Blütezeit
gegenüber. Es ist allgemein bekannt, dass es um die Jahrhundertwende eine ausgesprochene Hochschwung der Wiener Kultur gab. Wien wurde für kurze Zeit zu einem Zentrum
der Moderne. Kennzeichnend für diese Zeit und für diese Blüte war ein ausgeprägter Multikulturalismus. Man kann ohne großes Risiko die These wagen, dass dieser Multikulturalismus auch eine Hauptursache für die Blüte war, da er eine solche Fülle von Impulsen
einbrachte, wie sie sonst nicht leicht zu finden sind. Hier sollen die Schwierigkeiten nicht
unterschätzt werden, welche daraus entstanden: Es gab nicht nur politische Konflikte, sondern auch solche persönlicher Art und sicherlich Probleme aus intrapersonellen Konflikten,
aus Identitätskonflikten, welche viele der Betroffenen in sich selbst austrugen und bewältigen mussten – und dies manchmal nicht schafften. Schließlich gab es ausgesprochene
Gegenbewegungen zur Moderne. Besonders klar lässt sich dies an der Entstehung neuerer
sozialwissenschaftlichen Disziplinen zu beleuchten, Unter ihnen finden wir eine, welche
90
sich damals ganz sicher nicht als sozialwissenschaftlich begriff und eine spezifische, wenn
auch nicht besonders hoch einzuschätzende Rolle spielte: die Volkskunde.
Volkskunde in Österreich – Reinhard Johler hat es mehrere Male dargestellt (1995a; 1995b
als Nachwort zu Cole/Wolf) – entstand um diese Zeit aus einer Gemengelage von Antimodernismus i. S. einer Anti-Stadt- und antinationaler Ideologie und dem Interesse an der
Sicherung der deutschen Hegemonie im Habsburgerstaat. Dabei war dieses Interesse
durchaus vormodern strukturiert. Und tatsächlich: Wenn man sich die ersten Jahrgänge der
Zeitschrift für Volkskunde ansieht, fällt es einem schwer, sich zu erinnern, daß sie in einer
Stadt erschien, welche damals ein blühendes Zentrum der Moderne war. Damit war aber
auch ihr ideologischer Ort von vorneherein festgelegt. Er wird sich allerdings später
deutlich verschieben und einem wiederum rückwärts gerichteten Nationalismus rassistischer und imperialistischer Prägung Platz machen (vgl. Bockhorn 1993 und 1994).
Wenn allerdings Volkskunde – in welcher paradoxen Art immer – eine Modernisierungsfolge ist, dann ist damit ein wesentlicher Berührungspunkt zu den Sozialwissenschaften gegeben. Soziologie und ihre umfassenderen Vorläufertheorien – vor allem die
Politische Ökonomie als Strukturanalyse des sozialen Grundsystems – entstanden schließlich aus den Problemen des europäischen Modernisierungsprozesses. Allerdings ist damit
fürs erste die Gemeinsamkeit auch schon erschöpft. Soziologie wollte – selbst in ihren
konservativen Versionen - die Modernisierung analysieren und transzendieren. Die neuere
Wirtschaftstheorie und ihre neueste Ausprägung in der Neoklassik war in Wien mitbegründet worden und versuchten eine Art technokratischer Modernisierung zu fördern, auch
wenn man gerade der Wiener Schule vorgeworfen hat, eine "Politische Ökonomie des
Rentners" (Bucharin 1925) darzustellen, also die parasitären und am wenigsten fortschrittliche Kapitalfraktion theoretisch zu vertreten. Volkskunde hingegen versuchte die Modernisierung rückgängig zu machen, und da dies nach ihrer eigenen Einsicht nicht ging,
zumindest zu konterkarieren. In diesem Sinn war die Gründung der Volkskunde als
Disziplin in Österreich gegen Ende des 19. Jahrhundert ein Projekt der Antimoderne. Das
Fach wurde einerseits von Angehörigen der Dynastie gefördert, konnte sich allerdings
vorerst wenig wissenschaftliches Renommé erringen und wurde auch erst spät mit den
Weihen einer akademischen Disziplin geehrt. Da hatte sie schon den Schwenker zum
retrospektiven Nationalismus hinter sich.
Ungefähr zur selben Zeit, als sich die Volkskunde in Österreich in Gestalt einer Zeitschrift
so halbwegs etablierte, erschienen in Westeuropa jene grundlegenden Werke, welche die
Soziologie als Spezialdisziplin begründeten: In Österreich wird es allerdings noch lange
dauern, bis sich etwas Ähnliches wie eine Soziologie als eigenständiges Fach durchsetzen
konnte – im Grunde bis nahe an die Gegenwart. Die ersten, die sich schon vor dem Ersten
Weltkrieg Soziologen nannten, waren Außenseiter ihrer jeweiligen Fächer.
Für den Theoretiker nicht nur der Nation, sondern auch des Nationalismus ist dies eine
hochinteressante Epoche. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein auffälliger Zug der meisten
Ethnonationalismen eine "Reinheits-Ideologie" ist: Die Nation und ihre Mitglieder sind
umso "wertvoller" und stehen desto höher, je "unvermischter" sie sind. In besonderem Ausmaß wurde diese Ideologie von Deutschnationalen unter preußischer Hegemonie gepflogen. Sie war in Österreich und im übrigen auch in Westeuropa äußerst wirksam. Der
Realitätsgehalt war nie gegeben, da alle modernen Nationen aus der Verschmelzung sehr
unterschiedlicher kultureller und ethnischer Komponenten entstanden, und je umfangreicher sie wurden, desto mehr. Hier aber wurde dies ad oculos demonstriert – jedoch die
91
Wahrnehmung wurde weitgehend verweigert. Die wenigen, welche vorurteilslos genug
waren, um dies auch zu sehen, waren unter der erdrückenden Dominanz des ideologischen
Konzepts der Nation als "Abstammungs- und Kulturgemeinschaft" nicht in der Lage, diese
Einsicht als nationales Projekt explizit zu formulieren. Sie flüchteten sich in einen
manchmal dynastischen und manchmal übernationalen Patriotismus und vergaben damit
die Chance, geschichtsmächtig und wirkkräftig zu werden. Überhaupt ist die Diskussion
um den Charakter der Nation als Phänomen, der vor allem in demokratischen Kreisen,
kaum in konservativen, geführt wurde, aufschlussreich, wie fetischisiert diese Diskussion
teilweise auch ablaufen mochte.
2.8 Zur Diskussion um die Nation
Die nationale Frage war das politische Problem der Monarchie. Die habsburgfrommen
Historiker suchten allerdings den Ausdruck auch zu vermeiden, und sprachen gerne von
den „ethnographischen Verhältnissen“ der Monarchie. So hat sich bereits in der Endphase
ihrer Existenz eine lebhafte Diskussion entwickelt, an der Persönlichkeiten
unterschiedlichster Provenienz teilnahmen. In der Folge werden einige Wortmeldungen
diskutiert, welche über den Zerfall des Habsburgerstaates hinaus Wirkung zeigten und ein
gewisses Minimal-Niveau aufweisen. Es geht hier also ausdrücklich nicht um politische
Propaganda oder journalistische Tagesprodukte.
2.8.1 Ignaz Seipel
Theologie denkt teleologisch, auf ein "Ziel der Geschichte" hin. Aus dieser Denkstruktur
heraus begründet (nicht: analysiert) Seipel (1916) – damals war er noch nicht unmittelbar
politisch tätig – sowohl Nation und Staat als "Gotteswerk", die durch jede Anwendung
säkularer Vertragsideen nur kompromittiert würden. Doch eindeutig wichtiger ist ihm der
Staat. Er schließt damit, ob er es selbst wusste oder nicht, klar an Hegel an. Bei keinem war
der konservative Charakter jedes Staatsmythos wohl klarer geworden. Die Verpflichtung
auf den Staat, ob als Ausdruck des “Weltgeistes” oder unmittelbar theologisch: als “Gotteswerk”, ist ja nur eine Verpflichtung auf die bestehende Macht. Das steht tatsächlich dem
Grundgedanken des Nationalismus gegenüber, damals und auch bis heute. Denn dieser
Grundgedanke ist die Volkssouveränität. Das ist ein revolutionäres Prinzip selbst dann
noch, wenn “Volk” in der Manier der Zuschreibung betrachte wird. Damals war es erst
recht revolutionär, denn jede Interpretation des Nationalismus musste sich gegen das
ancien régime richten. Doch selbst heute ist dies noch bedeutsam: In der BRD haben Liberalkonservative wie Habermas den Ausdruck vom “Verfassungspatriotismus” erfunden,
und in den USA ist dies seit langem ein tragendes Konzept, wie es auch immer ausgedrückt
werden mag. “Verfassungspatriotismus” lässt sich ebenso wie der geforderte “europäische
Geist” (dieser sogar wörtlich) auf die Wurzel des Hegel’schen Staatsmythos zurückführen.
Die Idee hat gegenwärtig wieder Konjunktur: Es geht um den Widerspruch von (Zivil-)
Gesellschaft gegen den Staat. Dazu gibt es in der österreichischen Tradition eine andere
Linie, die heute einigermaßen in den Hintergrund gerückt ist. Die österreichische Historiographie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte – soweit sie nicht klar deutschnationalistisch auftrat – dem Nationalbewusstsein ein „Staatsbewusstsein“ gegenüber, durchaus
auch im Auftrag der politischen Führung, jedoch nicht ohne theoretische Berechtigung.
„Staat versus Nation“ war also durchaus ein aktuelles Thema in der Zeit, in der Seipel
sozialisiert wurde (vgl. Fellner 2002).
So entspringt aus Seipels Nationentheorie denn auch eine eindeutige Staatsideologie. Denn
worum es ihm zu tun ist, das ist ein Kampf gegen jeden Säkularismus im Namen religiöser
92
Transzendenz. Das Ergebnis ist höchst dialektisch und in mancherlei Hinsicht erstaunlich.
Allerdings werden mancherlei schätzbare Einsichten durch seine politischen Absichten, die
allzu durchsichtig sind, entwertet: Überall kommt die Ideologie, das ganz bewusste Bemühen um die Rechtfertigung des augenblicklich Bestehenden, unverhüllt zum Vorschein
und entwertet dabei manche an sich bedenkenswerte Aussagen, weil dadurch Zweifel
aufkommen, ob es sich wirklich um Einsichten handelt.
Als zutiefst konservativer Mensch versucht er, das Gottesgnadentum im allgemeinen und
die Habsburger im besonderen gegen den demokratischen Anspruch auf Selbstbestimmung
zu retten. Nationalismus ist ein Ausdruck der Moderne. Daher muss er sich gegen ihn
wenden. Dabei gelingen ihm so erstaunliche Formulierungen, dass es absolut möglich sei,
"gute Österreicher und gleichzeitig national gesinnte Deutsche, Tschechen, Italiener, usw."
zu sein. Das klingt tatsächlich zum Verwechseln nach dem Konzept multipler Identitäten.
Doch das ist es nicht. An dieser Stelle ist gleich zu sagen, dass er von den bisher besprochenen Theoretikern jener ist, der am wenigsten mit Ethnizität zu tun hat. Das ist nicht
unbedingt Absicht, sondern gleichzeitig politisches Ziel und analytisches Unvermögen. Am
deutlichsten zeigt sich das in seiner Auseinandersetzung mit dem Rassenbegriff. Seine
Stellung dazu ist durchaus widersprüchlich. Einerseits steht er voll im Hauptstrom seiner
Zeit, wenn er schreibt: "Natürlich hängt die Kulturentwicklung mit den Rassenunterschieden unter den Menschen zusammen, weil sich die Kultur ja ganz und gar auf der
Natur aufbaut" (1916, 34). Aber wenige Seiten vorher lesen wir, er könne nicht einsehen,
"wieso Sprachen und Dialekte auf eine eigentümlich Zusammenstellung der Gene sollen
hinweisen können" (30). In ähnlicher Weise kommt ihm immer wieder seine Verankerung
im common sense seiner Zeit dem Wunsch, der Grundlage dieses common sense zu
entgehen, in die Quere: Diese Grundlage bestand im Aufbau einer innerweltlichen
Begründung auch für Politik, die man sich im Hauptstrom damals nur biologisch vorstellen
konnte. Das ist der eigentliche Grund, warum er sich gegen den "Naturalismus" seines
zeitgenössischen Nationalismus wandte. Man erinnere sich noch einmal an Haeckel! Diesem Naturalismus (eines Otto Bauer z. B.) musste er eine Transzendenz gegenüberstellen,
die rückwärts gewandt, aber deswegen auch nicht mehr zu retten war. Doch die
Gegnerschaft zu diesen groben biologischen Konzepten entlockt ihm eben dann solche
Formulierungen, die man heute bei oberflächlichen Hinsehen als moderne Einsichten
interpretieren könnte.
Die politischen Konsequenzen des realen Unvermögens werden sich dann im Nachkriegsösterreich zeigen. Dem robusten Deutschnationalismus der sozialdemokratischen
Führung sowie der Großdeutschen hatten die Konservativen theoretisch wenig entgegenzusetzen, was nicht in Sophisterei abgeglitten wäre. Den Aufbau einer neuen Nation
vermochten sie nicht zu begreifen, weil ihn selbst die Minderheitsgruppen im katholischen
Bereich, die dann einen solchen Aufbau tastend unternahmen, nicht als ethnonational, aber
auch nicht als supra-ethnisch zu begreifen vermochten.18 Oder, wie es für die Person hier
ein deutscher Historiker noch im Jahr 2000 unnachahmlich ausdrückt: Seipel konnte "sich
nie zu einem offenen Anschlussbekenntnis durchringen" (Pape 2000, 38 – meine Kursive
– AFR).
2.8.2 Karl Renner und Otto Bauer
18
Als neuen Begriff finde ich jüngst in einem auf die Weimarer Republik und ihr Verhältnis zur neuen
Bundesrepublik bezogen den Ausdruck "postklassisch national" (Winkler 1993).
93
Die Sozialdemokratie waren stets von einer Arbeiterschicht getragen gewesen, welche man
als Arbeiteraristokratie bezeichnen muss. Die Führungsgruppe aber war aus der deutschnationalen Bewegung heraus gewachsen und bestand aus nationalistischen Intellektuellen.
Insbesondere waren Intellektuelle jüdischer Herkunft stark vertreten, welche sich aber
keineswegs als Juden sahen: In ihrem Assimilationsprozess hatten manche unter ihnen jene
Janitscharen-Mentalität nie völlig hinter sich gelassen, welche für Assimilanten so häufig
kennzeichnend ist. Bernstein klagt einmal, dass im Ersten Weltkrieg gerade die Deutschen
jüdischer Herkunft die rabiatesten Nationalisten gewesen wären und sich geradezu zu
einem Rassismus verstiegen hätten (Fletcher 1984). Diese Bemerkung trifft auf die österreichischen Sozialdemokraten sicher weniger zu. Trotzdem denkt man hier unwillkürlich
an Friedrich Austerlitz und seine chauvinistischen Hetzartikel am Beginn des Weltkrieges.
Wichtiger aber war die Anschlussfixiertheit Otto Bauers. Dabei gab dieser schließlich 1923
selbst zu, dass die Parteimitglieder nicht mitzogen. "Sie hatten den deutschen Imperialismus während des Krieges allzutief gehasst, als dass sie sich hätten für den Anschluss an
dasselbe Deutschland begeistern können." Dogmatiker und gelernter Internationalist, versteckte er seine nationalistischen Neigungen hinter internationalistischer Rhetorik, die
deswegen aber nicht glaubwürdiger war.
Bleiben wir zuerst bei der Problematik, wie sie sich für die Beteiligten damals aktuell
stellte. Als 1907 in Cisleithanien das allgemeine Männerwahlrecht tatsächlich kam, da
waren insbesondere die Sozialdemokraten von den Auswirkungen enttäuscht. "Die großen
Erwartungen, die die Völker Österreichs auf das Parlament des gleichen Wahlrechtes
gesetzt hatten, waren abermals schmählich getäuscht worden," können wir in einem Bericht
des sozialdemokratischen Verbandes im Abgeordnetenhaus 1910 lesen (Renner 1970, 45).
Die Sozialdemokraten hatten sich besonders seit dem Brünner Parteitag 1898 mit diesem
Problem intensiv auseinandergesetzt. Der aus Mähren stammende Karl Renner hatte bereits 1902 einen großangelegten Lösungsvorschlag unter einem Pseudonym (Rudolf Springer) veröffentlicht. Dort betrachtete er in seiner Beamtenart "das nationale Problem als
Verfassungs- und Verwaltungsfrage" (Untertitel Renner 1902). Einige Jahre später nahm er
ein zweites Mal Stellung, diesmal noch stärker auf einen Lösungsvorschlag hin orientiert
(Renner = Springer 1906). Er schlug eine allgemeine Föderalisierung der Monarchie vor,
wobei er auch noch – Deutschnationalismus verpflichtet – den "deutschen Charakter"
dieses Bundesstaates gewahrt sah. Im Grunde interessieren ihn die scholastischen
Streitereien um den Begriff der Nation nicht sehr: "Uns interessiert nur das Verhältnis der
Nation zum Staat... Der Kampf der österreichischen Nationalitäten ist ein Kampf um die
Macht" (5 und 1). Sein eigentliches Anliegen kleidete er in die – wie es ihm damals vielleicht schien: rhetorische – Frage: "Wenn der deutsche Einheitsstaat denn dahinstirbt, ist es
nicht denkbar, dass auf der Grundlage nationaler Staatsgebilde sich ein Bundesstaat
Österreich erhebt, der wenigstens als Bund deutschen Charakter hat" (4)? Der Deutschnationale wollte also die deutsche Dominanz in der Habsburgermonarchie, zumindest
ihrem westlichen Teil, Cisleithanien, erhalten, jedoch gleichzeitig die anderen Nationen
einigermaßen zufrieden stellen. In seinem Entwurf zur "Reichsreform" einige Jahre später
schreibt er bereits im Vorwort in einer Mischung von Naivität und Sendungsbewusstsein:
"Ich wende mich an alle Nationen und Klassen und habe mir alle Mühe gegeben, das
Interesse meiner Nation und Klasse weder zu verleugnen noch zu überspannen" (Renner =
Springer 1906, IV). Der damalige Stabsoffizier Glaise von Horstenau (1980, 498 f.), der
am Ende des Weltkrieges die Stimmung der Sozialdemokraten erkunden sollte und daher
im Herbst 1918 Renner zum Abendessen einlud, charakterisierte Renner und den gemein94
samen Abend so: Er war "Großösterreicher im besten Sinn, der dem habsburgischen Völkerreiche eine große Mission zusprach... seine Ausführungen über territoriale und personelle Autonomie der Nationen bildeten ein Vademecum für jeden Nationalitätenpolitiker.
Seit der Rückkehr Otto Bauers aus der Kriegsgefangenschaft – ... – im Herbst 1917 sah
sich der Großösterreicher Renner durch das von Bauer verkündete Anschlussideal stark an
die Wand gedrückt... Auf Wunsch des Kaisers hatten wir Fühler auszustrecken nach der
Stimmung in diesen Kreisen. Der Zerfall Österreichs lag nicht im Kreise unserer Erwägungen. Im Gegenteil! Renner erörterte, daß er als Sozialdemokrat zwar grundsätzlich
Republikaner sei, sich aber einen Weiterbestand der Monarchie ohne die Dynastie
Habsburg nicht vorstellen könne. Meine Auseinandersetzungen, die sich möglichst offen
hielten, gipfelten darin, dass das bürgerliche Regime am Ende seiner Weisheit angelangt
sei und daß Umsturz und Anarchie samt allen Begleiterscheinungen unvermeidlich würden,
wenn sich nicht die Sozialdemokratie und hier besonders die Gewerkschaften der Dinge
annehmen. Die drei Gäste waren natürlich sehr erstaunt, aus meinem Munde solche
Äußerungen zu hören. Ich aber sagte Renner auf den Kopf hin, er müsse österreichischer
Ministerpräsident werden." Jenseits der verführerischen Aussicht für den persönlich sehr
ehrgeizigen Aufsteiger aus kleinsten Verhältnissen hat Glaise auch die politische Stellung
dieses Mannes sehr gut charakterisiert. Noch im allerletzten Augenblick wollte er diesen
verrotteten Staat samt seiner Dynastie retten, und warum? Staat konnte er sich immer nur
als Großstaat, als "Reich" eben, vorstellen, als Großmacht und als Großraum. Das wird
einer der Gründe sein, warum er wenige Wochen später die österreichische Republik gar
nicht akzeptieren konnte.
Renners Parteifreund vom linken Flügel, Otto Bauer (1907), ging die Sache von einer
anderen Seite her an. Otto Bauer (1907) entwarf eine Theorie der "Nation" auf sozialdarwinistischer Grundlage, die "Nation als Naturgemeinschaft" (8ff.). Tatsächlich spricht
er mehr von ethnischen Gruppierungen als von Nationen. Sein Zentralbegriff ist der
"Nationalcharakter": "Die Frage der Nation kann nur aufgerollt werden aus dem Begriff des
Nationalcharakters, ... dem Komplex der körperlichen und geistigen Merkmale, der eine
Nation von der anderen scheidet" (2). Auf dieser Grundlage war es gar nicht anders
möglich, als dass er in den Rassismus abglitt, den er allerdings für "Materialismus" hielt. In
diesem für die Sozialdemokraten wichtigen Werk verkannte er voll und ganz den
politischen Charakter der Nation und diskutiert z. B. auch nicht die internationalen
Beziehungen. Erst gegen Ende seines Lebens, im Exil und auf der Flucht sowohl vor
Austrofaschisten wie auch vor den Nazis, wird er diese wesentliche Dimension erkennen:
Eine Vereinigung Österreichs mit Deutschland würde alle Lebensinteressen der Nachbarn
Österreichs gefährden und nur zum schrecklichen Preis eines Krieges erhältlich sein (vgl.
Low 1995, 108). Hier hat er Renner deutlich hinter sich gelassen.
Im Vergleich zu Bauer ist Renner theoretisch jedoch durchaus weiter, weil er sich auf die
biologistisch-rassistischen Ausritte seines Parteigenossen nicht einläßt. Zwar meint auch er,
der Ethnologe untersuche die Naturgesetze der Zuchtwahl und der Vererbung; sein
Ergebnis seien Rassen und Stämme. Doch dann grenzt er sich theoretisch von diesem
Ansatzpunkt ab: "Das nationbildende Element ist und bleibt ein historisch-soziologisches,
kein ethnologisches... Das Massen-Wollen und die Massenthat ist Politik" (7).19
19
Wenn es darauf ankam, fiel er allerdings durchaus in die Bauer'sche Denkart zurück. So wird er als
Staatskanzler am 8. Mai 1919 vor der Fahrt nach Paris zu den Friedensverhandlungen erklären: "Es wird
95
"In den ererbten Charaktermerkmalen späterer Generationen spiegeln sich daher die
Produktionsbedingungen früherer Geschlechter wieder... Die Zugehörigen einer Nation
sind also klar körperlich und geistig einander ähnlich, weil sie von denselben Ahnen
abstammen und daher alle jene Eigenschaften ererbt haben, die den Ahnen durch den
Kampf ums Dasein im Wege der natürlichen und geschlechtlichen Zuchtwahl angezüchtet
.. worden sind."
Bauer, Nationalitätenfrage, 16 und 18
Auch Bauer, wenn auch verbrämter als Renner, wollte mit seinem Vorschlag der nationalkulturellen Autonomie das Kunststück zusammenbringen, nationale Selbstbestimmung und
deutsche Hegemonie zu vereinen. Besonders deutlich wird dies in einer anderen Publikation (Bauer 1912), wo er forderte, man dürfe Assimilation weder beschleunigen noch
bremsen. Doch er wusste wohl, dass dies unter den Bedingungen der Monarchie nur auf die
beschleunigte Assimilation der nichtdeutschen (und nichtungarischen) Nationen
hinauslaufen konnte. Etwas später gab er zu, daß für ihn der deutsche Nationalismus den
Fortschritt verkörperte, die "altösterreichische Tendenz" hingegen die Stagnation (Bauer
1924). Dieses implizite Zugeständnis, daß Nation also doch ein politisches Projekt sei und
nicht etwas Naturgegebenes, war wiederum Gemeingut unter den Sozialdemokraten, auch
wenn sie es nicht mit der Nation verknüpften. So sagte auch Renner (1970, 169) über das
neue Österreich, welches nach dem Friedensvertrag sich nicht an das Deutsche Reich
anschließen durfte: Dies ist ein "Staatswesen, das mit den sogenannten österreichischen
Traditionen nichts zu tun hat." Viel deutlich wird die Thematik, wenn man
sozialdemokratische Theoretiker berücksichtigt, die nicht unmittelbar in der politischen
Auseinandersetzung standen, sondern sich frei und ohne Rücksichten äußerten, wie etwa
Ludo Moritz Hartmann (Filla u. a. 1992).
Bauer wie Renner glaubten bis zum Ende der Monarchie, mehr Demokratie würde das
Heilmittel für die nationalen Zwistigkeiten sein. Sie strebten im Grunde einen habsburgischen Bundesstaat an. Ihr Lösungsvorschlag war die "national-kulturelle Autonomie".
Beide hatten nicht begriffen, dass die Nationen des Reiches kein gemeinsames
verhandelbares Objekt mehr sahen, dass mittlerweile "die entscheidende Voraussetzung der
Homogenität der Willensgemeinschaft" (Brandt 1985, 78) nicht mehr gegeben war. Sie
hätten nur ihre eigenen Beobachtungen über die Rolle des Parlamentes beachten müssen:
"Der Ruf nach gesetzlicher Regelung der Sprachenfrage zielt auf 'Unmögliches': Ein
national gruppirtes Parlament, wie das österreichische, vermag kein Sprachengesetz, das
dauernden Erfolg haben könnte, zu Stande zu bringen. Die wiederholten Versuche sind
darum auch immer gescheitert... In großen Staatskrisen bleibt immer nur der Absolutismus,
als Träger der bürgerlichen Freiheit, übrig, und glücklich sind dann noch solche Staaten zu
preisen, in denen, während solcher Zeiten, ein zielbewusstes, königliches Regiment die
weiteren Gefahren der inneren Zerrüttung abzuwenden vermag" (Offermann 1900, 6).
Die national-kulturelle Autonomie als Lösungsvorschlag für nationale Probleme scheint
uns heute umso plausibler, als in einigen zeitgenössischen Staaten viele der dort angetönten
Vorschläge realisiert sind und zumindest eine Zeitlang recht und schlecht funktionieren. So
gibt es in Südtirol einen nationalen Kataster, auf dessen Grundlage ein ethnischer Proporz
sich erweisen, früher oder später, daß das tausendjährige Band des Blutes stärker ist als der geschichtliche
Eintag" (Renner 1970, 159).
96
aufgebaut ist. Doch mit diesem Wort "ethnisch" ist auch schon die Frage angesprochen.
Der Unterschied zwischen ethnonationalen Regionalismen und nationalen (oder
nationalistischen Bewegungen) im vollen Wortsinn ist zu beachten. Das Habsburgerreich
war ein multinationaler, nicht einfach ein multiethnischer Staat. Das ist ein wesentlicher
politischer Unterschied. Es geht um das Verhältnis zum Staat. Die Nation ist ein
bestimmtes Verhältnis von Staat und Gesellschaft (Reiterer 1988a). Die Folge dieser
Bestimmung können wir sofort an der Kritik Stalins an den Austromarxisten erörtern: er
warf ihnen zurecht vor, die Selbstbestimmung mit der Autonomie zu verwechseln, oder
vielmehr, die Autonomie theoretisch unehrlich als "Selbstbestimmung" zu unterschieben.
2.8.3 Oszkar Jaszi
Wenn wir uns um Nationalitätenprobleme und Lösungsvorschläge in der Habsburgermonarchie kümmern, vergessen wir gewöhnlich eines: Wir unterhalten uns in der Regel
nur über Cisleithanien und sparen Ungarn aus. Diese Beschränkung galt fast für alle Werke
bis nahe an die Gegenwart. Doch in Ungarn gab es ebenso nationale Spannungen, wenn
auch infolge der noch illiberaleren Zustände diese weniger an die Öffentlichkeit kamen.
Überdies gibt es für Menschen aus Westeuropa eine triviale Hürde – ein Sprachproblem.
Dies alles trug dazu bei, dass Ungarn bisher völlig im Schatten der Aufmerksamkeit lag.20
Das geistige Klima war in Ungarn nicht dazu angetan, weittragende Entwürfe zu schaffen.
Es gab zwar einige frühe Problemwahrnehmungen. Beispielhaft steht der Name Eötvös mit
seiner Wortmeldung 1850. Die kamen aber über die Föderalisierung der historischen Länder nicht hinaus und standen damit eigentlich in der feudalen Tradition. Diese meist überaus reaktionären Vorschläge trugen den neuen Verhältnissen in keiner Weise Rechnung.
1918 zerfiel die Monarchie, und die Sieger ließen nicht zuletzt die Ungarn für den Krieg
büßen. Die Länder der Stephanskrone wurden auf Kernungarn reduziert. Im letzten
Moment, als Rettungsvorschlag 5 nach 12, tauchte von mehreren Seiten die Idee der
"Donaukonföderation" auf. Oskar Jaszi war in der Regierung Kiraly für Nationalitätenfragen zuständig. Er hatte sich schon im Ungarn der Vorkriegszeit einen gewissen Namen
als Experte für Nationalitätenprobleme gemacht. Damals waren seine Ideen sehr stark von
den Austromarxisten beeinflusst. Doch wie für diese, galt auch für Jaszi: zu wenig und zu
spät. 1912 noch glaubte er, die ungarischen Minderheiten mit einer dünnen
Kulturautonomie abspeisen zu können und machte sich schon damit Feinde bei der
Mehrheit. Eine territoriale Autonomie lag für ihn völlig jenseits der Vorstellungskraft. Erst
als die Sache lang gelaufen war, schlug er mit seiner Zustimmung zu einem Reorganisationsplan vom 25. November 1918 eine Kantonalisierung Ungarns entlang von
Sprachgrenzen vor. Doch diese "Schweiz Osteuropas" hatte nun keine Chance mehr.
"Erst später, im amerikanischen Exil, erkannte Jaszi die Mängel seiner früheren Vorstellung" (Dreisziger 1992, 26). Ende der 20er Jahre versuchte er, sich selbst und einem amerikanischen Publikum gegenüber über die Ursachen des Zerfallens der Monarchie klar zu
20
Als mit Hugelmann 1934 das erste Werk mit umfassenden Anspruch über das "Nationalitätenrecht des
alten Österreich" erschien, war Ungarn darin mit keinem Wort erwähnt. Auch Robert Kann (1964)
behandelt in seiner zweibändigen Arbeit Ungarn nur mit einem kurzen Kapitel (und die Kroaten in einem
weiteren) sowie mehreren Hinweisen, obwohl er schon im Titel von der Habsburgermonarchie spricht.
Die Gewichte sind also völlig unausgewogen. Erst 1980 erschien ein umfangreiches, völlig im
traditionalistischen Historikerstil gehaltenes Werk, welches tatsächlich umfassend ist (Wandruszka/
Urbanitsch III (1980)).
97
werden. Was dabei heraus kommt, ist weder für die Ungarn noch schon gar für die Dynastie schmeichelhaft. Er diagnostiziert jedenfalls den Zerfall als notwendig, weil Dynastie
und herrschende Gruppen die Notwendigkeit einer sozialen Modernisierung und insbesondere einer Demokratisierung nicht erkannt hatten. Die Monarchie ging also an ihrer fehlenden politischen Modernisierung zugrunde. Auch für ihn ist Nationalismus eine Demokratiebewegung. Trotzdem erkennt er sein Janus-Gesicht sehr gut und weist darauf hin,
dass nach der nationalen Emanzipation praktisch immer die vorher Unterdrückten selbst zu
Unterdrückern werden, wenn die Situation dies ermöglicht. Im Gegensatz zu Otto Bauer
und Karl Renner – allerdings, wie schon bemerkt, erst dann, als er keine politische Wirkmöglichkeit mehr hatte – begriff er nun, dass das nationale Problem nicht ein einheitlicher
Komplex gewesen war, und dass nationale Autonomie nur ein Minimalprogramm gewesen
war, viel zu wenig für die Aspirationen der entwickelten Nationen:
"Grob gesprochen, hatten wir zwei Typen nationaler Bewegungen in der Monarchie.
Der eine, wie er von den fortgeschritteneren Völkern der Monarchie mit einem klaren
und langen historischen Bewußtsein verfolgt wurde, war eine Bewegung für den
Aufbau eines vollständigen Nationalstaates. Das war der Ehrgeiz der Ungarn, der
Italiener, der Tschechen, der Polen und der Kroaten. Auf der anderen Seite waren die
kleineren oder weniger entwickelten nationalen Elemente, die kaum dem feudalen
Sumpf entronnen waren, weniger ehrgeizig und hätten sich für eine lange Zeit mit
einer Art nationaler oder Verwaltungsautonomie zufrieden gegeben. Das war fast bis
Kriegsbeginn die Haltung der Slowaken, der Ruthenen, der Slowenen, der Rumänen
und der deutschen Minderheiten in Ungarn. Doch wie verschieden auch die
konkreten Manifestationen der unterschiedlichen nationalen Programme gewesen
sein mag, sie hatten ein Element gemeinsam. Alle diese Völker strebten nach einem
nationalen Ausdruck ihrer selbst, nach der Möglichkeit, ihre eigene Kultur und
Sprache zu entwickeln, nach der Gelegenheit, ihr Idiom in den Schulen, der Kirche,
in Behörden und vor Gerichten zu benutzen. Das nenne ich das 'Minimalprogramm'
aller nationalen Kämpfe... Das nationale Problem ist in der Tat nur ein Aspekt der
sozialen Identität und der Emanzipation" (Jaszi 1929, 251).
Interessant mag es noch sein, dass Jaszi die einzige Möglichkeit eines Überdauerns der
Monarchie in einer toleranten staatsbürgerlichen Erziehung sehen wollte. Dabei ist nicht
ganz klar, ob das wirklich sein Blickwinkel war, oder mehr ein Lippenbekenntnis zum
Reihentitel, unter dem das Buch erschien: "Studies in the Making of Citizens", wobei es
um die Frage der Erziehung als politisches Mittel gehen sollte.
2.8.4 Tomás G. Masaryk
Otto Bauer und Karl Renner sahen als Vertreter der Arbeiterbewegung, des linken Flügels
der damaligen Demokratie-Bewegung der okzidentalen Demokratie, Nation und
Nationalismus im wesentlichen als Störfaktoren ihres politischen Projektes. Was Wunder,
wenn dieses doch unter dem Stichwort "Internationalismus" stand, wenn auch der deutsche
Nationalismus nur wenig verbrämt war. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums
stand bekanntlich der Antinationalismus Seipels (1916).
98
Österreichs Staatsgründung
(Staatsgesetzblatt Nr.1)
als
Selbstauflösungswunsch
99
der
politischen
Eliten
Wir müssen zurückgreifen auf einen Klassiker, wenn wir sowohl den theoretischen wie
auch den historisch-politischen Zusammenhang von Nationalismus und Demokratie richtig
verstehen wollen. Die volonté générale, der Allgemeinwille als Grundlage der Volksherrschaft, wie ihn Jean-Jacques Rousseau (1966 [1762]) konzipierte, ist keineswegs der
Mehrheitswillen, sondern eben der gemeinsame Willen aller. Was bedeutet dies nun, wenn
der Begriff mehr sein soll als ein philosophisches Schlagwort ohne eine Verankerung in der
Realität? Rousseau war sich dieser Problematik übrigens bewusst. Er warnt zuerst zwar,
daß auch die Herrschaft einer Mehrheit über eine dissidente Minderheit Herrschaft bleibe
und zu begründen ist: "La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement
de la convention, et suppose au moins une fois l'unanimité" (p. 50). Der Hinweis ist
wichtig. Dann erläutert er: "Pour qu'une volonté soit générale il n'est pas toujours nécessaire qu'il soit unanime, mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées; toute
exclusion formelle rompt la généralité" (64).
Dieses Thema, wie wenig es in der Regel politisch auch thematisiert werden mag, ist ein
Zentralthema jeder Theorie der Demokratie. Niklas Luhmann (1983) wird es mit der Frage
nach der Legitimität wieder aufnehmen. Er versucht dann, Legitimität als verallgemeinerte
Bereitschaft zu definieren, inhaltlich unbestimmte Entscheidungen innerhalb gewisser
Toleranzgrenzen hinzunehmen. Bei der Frage, worauf diese Bereitschaft beruhe, bleibt
seine Antwort unbefriedigend, weil er im Rahmen des Interesse-Begriffes verbleibt - wie
auch Rousseau und die Aufklärer allgemein.
Hat der Begriff des Allgemeinwillens einen praktischen Sinn, so ist der Zugang vom
Interesse her offenbar ungenügend, denn die Sonderinteressen werden im allerbesten Fall
einmal zufällig völlig übereinstimmen.21 Doch der Allgemeinwille ist offenbar eine ganz
grundlegende Übereinstimmung, Mitglieder eines bestimmten sozio-politischen Systems
zu sein. Die "volonté générale" wird damit zum rationalistischen Ausdruck dessen, was
Rénan 1882 emotioneller "le desir d'être ensemble" genannt hat. Der Allgemeinwille ist in
dieser Auffassung das Bewusstsein gemeinsamer und geteilter Identität. Da Rousseaus
Feststellung, dass auch die Herrschaft der Mehrheit Herrschaft ist, wohl kaum widersprochen werden kann, wird diese Frage nach der gemeinsamen Identität, nach der gemeinschaftlichen Struktur von Gesellschaft und Politik, zur Grundfrage der Demokratie.
Deswegen – und nur deswegen – konnte und musste die Volkssouveränität sich zur nationalen Souveränität umformen, die ihrerseits unter dem Stichwort "Nationalitäts-Prinzip"
die ethnische Einheit zum Träger dieses Prinzips erklärte.
In diesen Themenkreis tritt nun ein Politiker und Philosoph ein, der zwischen diesen Polen
steht, die wir vorhin eben besprachen. Er vertritt eine Position, die es wert ist, zur Kenntnis
genommen zu werden. Tomás G. Masaryk (1991 [1920]) griff die Traditionen Herders und
damit implizit Rousseaus mit großer Treue auf und bestand darüber hinaus resolut darauf:
Nation ist eine, nein, die Erscheinungsform der Demokratie. Nationalismus ist eine
Demokratie-Bewegung. Der tschechische Philosoph und Soziologe, der Liberaldemokrat,
der als Präsident eine der vielen unabhängigen "kleineren" Nationen der ersten Nachkriegszeit vertreten sollte, konnte auf die politische und historische Erfahrung seines
Lebens verweisen. Sie bestand aus der Beobachtung und der Teilnahme am zögernden und
ständig behinderten Demokratisierungsprozess der Habsburgermonarchie, die nicht zum
21
"En effet, chaque individu peut comme homme avoir une volonté particuliere contraire ou dissembleable a
la volonté générale qu'il a comme citoyen" (Rousseau 1966, 54).
100
Abschluss kam (vgl. auch Neudorfl 1993). Und sie bestand aus dem nationalen Emanzipationsprozess, man kann auch sagen, dem Nationenbildungsprozess, der Tschechen im
Rahmen dieser Monarchie und schließlich gegen sie. Dabei hatte er Erkenntnisse und
Erfahrungen verinnerlicht, die Otto Bauer nur zögernd und gewunden äußern konnte, weil
sie gegen die Grundsätze seiner Ideologie gingen, so wie er sie eben auffasste.
Doch Masaryks Problem war, daß er noch zu sehr in der Tradition Herders stand und daher
noch nicht fähig war, Ethnizität von Nation zu unterscheiden. Das führt im übrigen zu einer
Reihe theoretisch recht widersprüchlicher Äußerungen. Auf der einen Seite spricht er von
den vielen kleinen Nationen Russlands und meint damit die kleinen traditionalen Ethnien,
die man heute die "Völker des Nordens" nennt, sowie auch die kaukasischen Völker. Er
äußert auch die Meinung, die "Nationen" im Mittelalter in zahlreiche Staaten zerteilt
waren. Auf der anderen Seite erklärt er in aller Entschiedenheit: "Nationalität ist ein neues,
ein modernes Prinzip" (S. 47). Um diese unterschiedlichen Konzepte und Aussagen zu
vereinen, versucht er es nach einer längeren Erörterung der Begriffe so (in der Anm. S. 56):
"Nation wendet man mehr im politischen Sinn an - Volk bedeutet mehr die Masse der
Nation im demokratischen Sinn."
Mit diesem Unvermögen war ihm theoretisch, vor allem aber politisch der Weg zur
nationalen Problemlösung im Sinne des interethnischen Ausgleichs verbaut. Der Liberaldemokrat wurde zumindest zeitweise zum nationalen Unterdrücker, sobald er sein Ziel,
einen tschechischen Nationalstaat, einmal erreicht hatte. Kaum war der Staat errichtet,
erklärte er die Deutschen in Böhmen zu "Kolonisatoren". Die Slowaken wollte er in eine
"tschechoslowakische Nation" verschmelzen, doch es ist kennzeichnend, daß er praktisch
in einem Satz den Wortteil "-slowakisch" wieder fallen läßt und nur mehr von der
tschechischen Nation spricht. Von den nationalen Minderheiten anderer Zugehörigkeit
(Ungarn, Polen, Ruthenen, Juden, Roma [Zigeuner]) wollen wir hier gar nicht sprechen.
Die politische Praxis entsprach diesem theoretischen Unvermögen. Masaryk konnte sich
also die Nation nur als Ethnonation vorstellen, zumal die Idee eines multiethnischen oder nationalen Staates durch die Habsburg-Erfahrung noch allzu sehr diskreditiert war. Eine
korrekte Beziehung des tschechoslowakischen Staates bzw. ihres "sog. herrschenden
Volks" (S. 44) zu den anderen Nationen war auf dieser Grundlage nicht möglich.
Damit setzte er aber auch die Stabilität des neuen Staates aufs Spiel. Die Deutschen der Republik orientierten sich am benachbarten Deutschen Reich. Die Slowaken schienen anfangs
gewillt, auf die Fusionsidee einzusteigen. Doch tatsächlich verhielten sich die Tschechen
ihnen gegenüber selbst wie Kolonisatoren, die nur die ungarischen Kolonisatoren ablösten:
Anstatt ihnen zumindest im eigenen Land, der Slowakei, z. B. die Positionen des
Öffentlichen Dienstes zu überlassen, konnten sie nicht der Versuchung widerstehen, sich
die Beute anzueignen (vgl. auch Kirschbaum 1989).
2.8.5 Theodor Herzl
Der "Judenstaat" war eine Programmschrift, die direkt zu einem neuen Nationalstaat mit
einer neuen Nation führte. Sie ist aus diesem Grund von besonderem Interesse. Im übrigen
lassen sich hier eine Anzahl der wichtigsten Themen zwischen Ethnizität und Nation
finden. Daher können wir diesen kurzen Text auch als theoretische Schrift lesen.
Besonders deutlich erkennbar ist die Umwandlung von Ethnizität in Nation. Den Juden
wurde die Assimilation verweigert, da sie das Bild der "ganz Anderen" verkörpern mußten
und so nicht in die europäische Supra-Ethnizität einbegriffen wurden. In nationalen
Spannungen und Konflikten ist es das kennzeichnende Paradoxon, dass eine fundamentale
101
Gleichheit zwischen den Nationen vorausgesetzt ist. Fehlt diese Anerkennung als supraethnisch Gleiche, entwickelt sich Rassismus, wie wir es an der "Judenfrage" so deutlich
sehen können. Hier entstand schließlich durch den politischen Willen einer Basis-Bewegung – was selten genug vorkommt – eine Nation aus vielen einzelnen ethnischen
Minderheiten in anderen Nationen. "Wir erkennen unsere historische Zusammengehörigkeit nur am Glauben unserer Väter, weil wir ja längst die Sprachen verschiedener
Nationen unverlöschbar in uns aufgenommen haben" (Herzl 1988 [1896], 76). Damit gibt
Herzl, wie sehr er auch die nationale Terminologie pflegt ("Wir sind ein Volk, wir sind ein
Volk!"), selbst zu, dass von einer einzigen jüdischen Nation in seiner Zeit nicht die Rede
sein kann. Doch auf dieser von ihm evozierten Gemeinsamkeit der Religion, der ethnischen
Ausgrenzung aufgrund des religiösen Merkmals, will er nun weiterbauen. Das
gemeinschaftliche Element wird eingeplant: "Unsere Leute sollen in Gruppen miteinander
auswandern... Man nimmt die persönlichen Beziehungen sämtliche mit" (75).
Und was soll nun der Judenstaat bewirken? "Wir wollen den Juden eine Heimat geben"
(74). Doch Heimat ist nur dort, wo Sicherheit ist. Um Sicherheit zu finden, braucht es
politische Souveränität. Die politische Gemeinschaft, der Staat ist also vor allem eine
Sicherheitsgemeinschaft. Die Judennot mag ein soziales, ein religiöses, was auch immer für
ein Problem sein. Zuallererst kann man sie am Ende des 19. Jahrhunderts als nationale
Frage begreifen. Dieser Ausdruck enthält alle anderen Aspekte in sich, denn er stellt die
Frage als Problem der Selbstbestimmung.
Nation ist auch ein politisches Projekt. Ebenso wichtig wie die allgemeine Ableitung ist die
Gestaltung des künftigen Judenstaates. Herzl wehrt sich zwar gegen den Vorwurf, eine
Utopie zu verfassen. Doch mehrere Male ist ihm der künftige Staat das "Gelobte Land" und
ein "Musterstaat" (36), und so wird er auch skizziert. Der "Judenstaat" ist allerdings eine
reduzierte Utopie. Sein gesellschaftspolitisches Muster könnte als ein Kapitalismus mit
menschlichem Antlitz, eine verbesserte "soziale Marktwirtschaft", umschrieben werden.
Die Frage der nationalen Gleichheit in der nationalen Identität nimmt er so ernst, daß sie
ins Soziale hinüberschlägt. Im zeitgenössischen Nationalismus wird dieser "spill-over"
sonst strikt vermieden. Auch bei Herzl kommt es zu Widersprüchen. Er organisiert mit
dem Zionistischen Weltkongress eine Basisbewegung. Doch die Verfassung des künftigen
Staates stellt er sich als "aristokratische Republik" nach venetianischem Muster vor. Herzl
führt uns Ethnonationalismus mit all seinen Widersprüchen vor.
102
3 DAS NEUE ÖSTERREICH: 1918 UND DIE FOLGEN
3.1 Die Situation
Als die Monarchie mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zusammenbrach, verlor dieses
bisherige deutschsprachige Zentrum seine Peripherien. Dieser Verlust wurde von den
Österreichern zurecht als die eigentliche Niederlage und der schwerste Schlag des Krieges
empfunden. Die Nachfolgestaaten bemühten sich, ihre eigenen Wirtschaften beschleunigt
aufzubauen. Sie schotteten sich daher wohlweislich bis zu einem gewissen Grad vom
früheren Zentrum ab. Da sie außerdem von den Siegern begünstigt wurden, trat damit
beinahe eine Verkehrung der Lage von früher ein. Diesen Schock hat man in der Ersten
Republik nie überwunden. Dabei fand eine merkwürdige mentale Verschiebung statt.
Österreich war in wirtschaftlicher Hinsicht in den Friedensverträgen schonend behandelt
worden. Man sollte nicht vergessen: Immerhin war ein Drittel der Industrie im sehr viel
kleineren Anteil (ein Achtel der Bevölkerung) verblieben, welcher jetzt den (deutsch-)
österreichischen Staat bildete. Doch ist zu bedenken, daß der neue Staat auch seine
traditionellen
Absatzmärkte
verloren
hatte.
Die
Perspektive
war,
"ein
außenhandelsabhängiger Kleinstaat mit geringen Rohstoffreserven" (Grossendorfer 1979)
zu werden. Trotzdem hätte man erwarten müssen, daß die neuen führenden Kräfte, vor
allem die Sozialdemokraten, aber auch die Deutschnationalen, welche die Monarchie stets
als eine politisch unannehmbare Struktur kritisiert hatten, 1918 und den Neuaufbau als
Chance auffassten.
Interessant mag ein Blick auf die Verhältnisse in Deutschland sein. Versailles wurde dort zum
Codewort für alles, was man an der Nachkriegsordnung ablehnte. Dabei war der Friedensvertrag in
mancher Hinsicht, insbesondere in territorialer, für das Deutsche Reich nach seiner totalen
Niederlage außerordentlich schonend ausgefallen. Anders stand es freilich um die wirtschaftlichen
Bestimmungen. Die Entente war in Paris vor dem Problem gestanden, zwei Ziele zu vereinbaren.
Einerseits wollte sie sicherstellen, daß das Reich in Hinkunft nicht mehr die Wirtschaftskraft
haben sollte, wiederum einen Krieg zu beginnen. Aus diesem Grund wollte man Wert durch
schwer lastende Reparationen abschöpfen. Andererseits wollte man Deutschland in eine
konsolidierte bürgerliche Nachkriegsordnung in Europa einbauen, nicht zuletzt als Bollwerk gegen
den Bolschewismus. Also belastete man es wirtschaftlich und schonte es territorial. Doch das Ziel
wurde verfehlt. Die Deutschen waren zu lange der Propaganda eines "Siegfriedens" ausgesetzt
gewesen. Alles, was wesentlich darunter lag, wurde von ihnen nun als Schmach und Schande, als
massive Ungerechtigkeit empfunden. In diesem Punkt trafen sie sich mental mit dem zweiten
Verlierer, den bisherigen Hegemonen in Österreich und Ungarn.
Die Nachfolgestaaten verloren für Österreich nur langsam und ungleichmäßig an Bedeutung. Da die cisleithanische Vorkriegswirtschaft sehr viel weniger Industrieprodukte an das
damalige Deutsche Reich geliefert hatte als es bekam, war eine strukturelle Unterlegenheit
gegeben. Die Wirtschaft war noch stark in der Landwirtschaft verankert, und dies in einer
Phase der Entagrarisierung. Die Westorientierung wurde zwar gesucht, kam aber nur mühsam voran. Für die Nachfolgestaaten jedoch bedeutete die Unabhängigkeit tatsächlich eine
Verbesserung und die wirtschaftliche Chance ihres Aufbaues. Die Ironie ist natürlich, dass
auch für sie formal alles zutrifft, was der österreichischen Bevölkerung von Anschlussbefürwortern und Revanchisten über die "Lebensunfähigkeit" einhämmerten: die unvollständige Struktur, die neuen Zollgrenzen, die kleineren Märkte... Doch eine Peripherie mag
zwar kurzfristig Schwierigkeiten haben, wenn sie von ihrem Zentrum abgeschnitten ist.
Längerfristig muß sie vergleichsweise gewinnen. Das Zentrum ist schließlich immer
103
Nutznießer einer Ausbeutungssituation. Die abgeschöpften Werte werden also – ceteribus
paribus - in Hinkunft im Lande verbleiben.
Tab. 1: Anteil des Deutschen Reiches bzw. der BRD an den österreichischen Ein- und
Ausfuhren in %
Einfuhren
Ausfuhren
1877
2,0
65,0
1891
5,0
33,0
________________________________
1924
4,9
13,1
1929
6,1
14,8
________________________________
1950
6,6
15,3
1960
0,0
26,8
1970
1,2
23,4
1978
3,3
29,1
________________________________
1994
38,1
Quelle: Grossendorfer 1979, Stat. Übersichten 6/1996 (bis 1978 alte, 1994 neue BRD)
Tab. 2: Anteil verschiedener Staaten an den österreichischen Ausfuhren
1924
CSSR
1,0
Italien
0,1
Jugoslawien
10,3
Quelle: Grossendorfer 1979
1932
10,6
9,9
7,6
Doch Österreich hatte seine inneren Kolonien verloren. Es war zu einem Kleinstaat ohne
Macht nach außen geworden. Als es sich auf Reaktion darauf an das Deutsche Reich
anschließen wollte, verboten die Sieger dies. Auf diese völlig gewandelte Rolle antwortete
die gesamte politische Klasse und ein erheblicher Teil der Bevölkerung mit der Suche nach
einer neuen Identität. Sie wollten nach dem Verlust der eigenen Großmachtstellung
zumindest Teil einer anderen Großmacht werden. Es war Seipel, welcher diesen Tatbestand
besonders deutlich, und wie üblich bei ihm, mit Pathos, ausdrückte: ""Die Österreicher sind
ihrer ganzen Geschichte nach Großstaatmenschen, ... die Erben der Türkenbesieger:" Und
er weist eine Schweizer oder belgische Lösung von sich: "Ein eigenes Nationalbewusstsein
'künstlich' zu erzeugen, ist meines Erachtens ein Irrweg. Das ist keine gute deutsche und
keine österreichische Konzeption, sondern eine weltfremde französische oder tschechische
Vorstellung" (zit. nach Pape 2000, 38).
In dieser Orientierung auf die Großmacht-Stellung liegt auch die Auflösung für ein anderes
„Rätsel“ der österreichischen Geschichte, die Haltung gegenüber Italien. Der Habsburgerstaat war aus Deutschland „verdrängt“ worden, und er war auch aus Oberitalien „verdrängt“ worden – so die Diktion eines übrig gebliebenen Nationaldemokraten (Fellner
2002, z. B. 222 ff.). Doch während die politische Klasse gegenüber dem PreußischDeutschen Reich vor allem devot und unterwürfig war, war die Haltung gegenüber Italien
voller Ressentiments. In der abhängigen Haltung gegenüber Preußen-Deutschland erkannte
man eine Überlegenheit dort an. In den Ressentiments gegen Italien spiegelte sich hingegen
die Mentalität des Absteigers, dessen, der sich hoch überlegen fühlte und dann doch zur
Kenntnis nehmen muss, dass der Konkurrent erfolgreicher war bzw. ist. Dieses Gefühl
kennzeichnet die Stellung der österreichischen Intellektuellen in der Ersten Republik
insgesamt. Nicht zuletzt dies hat das österreichische Problem dieser Zeit ausgemacht.
104
Österreich wäre in vielerlei Weise strukturell als eine „kleine Nation“ im Hroch’schen Sinn
zu begreifen. Doch dieses Großmachtbewusstsein bzw. die Großmachtorientierung der
politischen und intellektuellen Eliten hat es zu einem Fall sui generis gemacht, welcher
nicht in diese Kategorie passt.
Den neuerlichen Großmachtambitionen wurde allerdings mit dem Friedensvertrag von
1919 ein Riegel vorgeschoben, denn ein Anschluss hätte eine Stärkung Deutschlands
bedeutet. Von Teilen der Bevölkerung wurde dies als hart, ungerecht und nicht den proklamierten Grundsätzen (US-Präsident Wilsons "14 Punkte") entsprechend empfunden. Sie
deuten die Mangelsituation einer Nachkriegszeit zur "Lebensunfähigkeit" Österreichs um.
Einzelne rationale Stimmen, die darauf hinweisen, dass Österreich seine Kohle so oder so
bezahlen müsse, ob es sie im eigenen Staatsgebiet fördere oder von der Tschechoslowakei
kaufe, fanden kein Gehör (Schumpeter 1992, 115): "Wir müssen Kohle haben. Aber auch
wenn sie in Deutschösterreich läge, müsste unsere Industrie sie ja kaufen, und mehr wie
kaufen braucht sie sie auch in Ostrau nicht. Da die Kohlenbergwerke in Ostrau und in
Oberschlesien nicht von der Erdoberfläche verschwunden sind, ist unser wirtschaftliches
Interesse lediglich darauf beschränkt, dass Ausfuhrzölle jener Staaten uns die Kohle nicht
verteuern. Wenn wir und die anderen nicht unvernünftig sind, ist es ganz gleichgültig, ob
die Produktionsbasis unserer Industrie innerhalb oder außerhalb unserer Staatsgrenzen
liegt," erklärte er in einer Rede vor dem Wiener Handels und Industrieverein am 30. Mai
1919. Trotzdem begann wirtschaftlich eine deutliche Umorientierung auf den Westen.
Diese Äußerung stammt zum einen kennzeichnenderweise von einem Ökonomen, der kurzfristig
als Finanzminister zum Praktiker geworden war, und sie war zum anderen auch im Kabinett durchaus eine Einzelerscheinung. Friedrich von Wieser wundert sich in seinem Tagebuch am 15. März
1919 (a. a. O., 10) über Schumpeters Eintritt in diese Regierung: "Schumpeter als 'bürgerlicher
Prügelknabe' in der neuen Regierung, er, der Monarchist, der Erzkonservative, der Englandfreund
und Deutschenhasser, der Feind der Sozialdemokratie." Wenn diese Charakterisierungen auch nur
teilweise stimmen – Schumpeter war z. B. den Sozialisierungen nicht abgeneigt, er war Pazifist
gewesen, er war allerdings nach heutiger Terminologie monetaristisch orientiert – , so war
Schumpeter tatsächlich klarer Anschlussgegner und sprach dies auch aus: "Das Deutsche Reich hat
ein großes Interesse daran, Österreich einzugliedern... Wir ziehen jedoch die Vor- und Nachteile
der Unabhängigkeit vor, wenn uns diese Unabhängigkeit am Leben läßt ... Die für den Weltfrieden
wünschenswerteste Vereinbarung ist nicht dieser Anschluß, sondern ein ökonomisches Abkommen
mit den anderen Nachfolgestaaten unter Bedingungen, welche die Wiederaufnahme von Arbeit und
Leben ermöglichen" (Interview in Le Temps vom 4. Juni 1919; a. a. O., 121). Von Renner – den er
einigermaßen verachtete ("Die einzige geistige Kapazität [in der Regierung] ist Otto Bauer...
Renner ... 'duckt' sich, wenn Otto Bauer nur das Wort erhebt um zu sprechen.") – bekam er dafür
wütende Telegramme aus Paris. So kann es nicht verwundern, dass Schumpeter als Finanzminister
scheiterte und gehen musste. Die "Arbeiterzeitung", über die Schumpeter ironisiert hatte, sie stelle
zwischen 11 und 23 Uhr die eigentliche Regierung dar, startete zum Abschied einen wütenden und
gehässigen Angriff ("Mangel an Charakter"). Er könnte von Otto Bauer stammen, da die
Formulierungen ähnlich denen sind, die Bauer vier Jahre später über Schumpeter verwenden wird.
Die Hyperinflation, die er unbedingt hatte vermeiden wollen, kam zwei Jahre später.
Das österreichische Problem der Nachkriegszeit kann man etwa so formulieren: Die
Auflösung des Habsburger-Staates und die dadurch beschleunigten Nationenbildungsprozesse waren die Form, welche das Problem der "verspäteteten Demokratie" (Kluge
1996) in allen Nachfolgestaaten annahm. Während jedoch in den anderen Staaten
zumindest der Nationenbildungsprozess entschlossen betrieben wurde, kam in Österreich
noch etwas Anderes dazu: Die präsumptiven Bürger der künftigen Republik konnten sich
105
aus unterschiedlichen Gründen nicht vorstellen, einen demos zu bilden. Sie sahen sich
vorrangig als ethnos, und zwar in eher kleinräumiger Weise, vor allem auf die Ebene der
historischen Länder bezogen. Das Tiroler Beispiel ist hier wesentlich: Man soll sondiert
haben, ob man insgesamt, als ungeteiltes Tirol, im italienischen Staatsverband Aufnahme
finden könne, weil man an aller erster Stelle Tiroler sei. Wenn aber Politiker und
Intellektuelle ein überdachendes Supra-Ethnos (eine größere Nation) wollten, dachte man
an die Deutschen. Die österreichische Ebene dazwischen fehlte als politisches Bedürfnis
und Ziel. Besonders kennzeichnend ist das bei den Sozialdemokraten zu sehen: Sie waren
die einzigen, welche tatsächlich an den demos dachten - jedoch sie hatten wieder kein
Sensorium für die Zugehörigkeit eines ethnos zu diesem Begriff. So ist es kennzeichnend,
dass bei ihnen eine intensive Verfassungsdebatte lief, aber eine nationale Debatte nach dem
Anschlussverbot vollständig fehlte.
Trotz Eigenstaatlichkeit war in Österreich der Aufbau einer eigenen Nation nicht geglückt.
Hauptgrund war die mangelnde Identifikationsmöglichkeit mit diesem Kleinstaat infolge
des Machtverlustes und der Nichtintegration einer Bevölkerungsmehrheit in den
politischen Prozess.
Die Situation ist deswegen so interessant, weil die Parallelen mit der Situation in den
Staaten des europäischen Ostens nach dem Zusammenbruch der Nomenklatur in der
„Wende“ exakt diesem Bild entspricht. Das Unvermögen, ethnische Gleichheit im Rahmen
einer (Staats-) Nation herzustellen, wird wieder mit ethnischer oder sprachlicher
Homogenisierung im Wege nationaler und ethnischer Unterdrückung verwechselt.
Die Zerstörungen und noch mehr die gesellschaftlich-wirtschaftliche Desorganisierung des
Weltkrieges hatten für Österreich einen besonders tiefen Rückfall gebracht. Das Wachstum
zwischen 1920 bis 1929 blieb dann ein wenig unter dem europäischen Durchschnitt. Damit
gelang es der Republik nicht, wieder aufzuholen. Daran war nicht zuletzt die "Lebensunfähigkeits"-These schuld – heute wissen wir, dass solche Stimmungslagen die Performanz einer Wirtschaft wesentlich beeinflussen. Anfangs waren es die Koalitionsregierung
und vor allem Bauer und Renner, die auf geradezu mutwillige Weise diese These stützten,
um den Anschluss zu erzwingen. Sie dachten gar nicht daran, die Entwicklung in die
eigenen Hände zu nehmen. Dann kamen die konservativen Regierungen. Die "Genfer
Sanierung" war für sie das gefundene Mittel, einen sozialen Einschnitt vorzunehmen,
welcher für die Erste Republik entscheidend werden sollte. Der Völkerbundkommisar A. R.
Zimmermann war von den Christlich-Sozialen durchaus gerne gesehen. Es ist also
sicherlich nicht richtig, daß diese Politik der Regierung von außen aufgezwungen war.
Immerhin wollte der Niederländer der Regierung "außerordentliche Vollmachte" bis zur
Ausschaltung des Parlamentes geben und wurde daher von Seipel durchaus wohlwollend
beurteilt (Burian 1992). Diese "Sanierung" schuf eine hohe Sockelarbeitslosigkeit. Ziel war
es, die Umverteilung und auch die politische Machtverschiebung der Umsturzzeit
rückgängig zu machen und eine soziale Containmentpolitik einzuleiten. Dieser CrashPolitik folgte zwar tatsächlich eine Stabilisierung. Doch sie wurde nicht dazu genutzt, in
der folgenden kurzen Hochkonjunktur eine Ausgleichpolitik einzuleiten. Vielmehr folgte
eine Politik der Gesellschaftsspaltung, die schließlich in den 30er Jahren vollendet wurde wieder mit Hilfe des Völkerbundes bzw. unter dem Vorwand seines wirtschaftspolitischen
Druckes, den er anlässlich der Lausanner Anleihe Juli 1932 ausübte. Die damals
eingeleitete forcierte Politik der Selbstversorgung wurde für die Bevölkerung plausibel mit
dem Trauma der Hungerzeit am Ende und nach dem Weltkrieg legitimiert, als die
106
Lebensmittelversorgung Wiens in der Luft hing, die Bundesländer mit ihrer Blockade sie
noch verschärften und die Sieger sie zu Erpressungsmanöver benutzten. Faktisch motiviert
war sie aber mit der Schaffung und Pflege einer bestimmten politischen Klientel. Dollfuß
wird die Bauernschaft auch dann weiter hofieren (Kluge 1978), als es längst
Lebensmittelüberschüsse auf dem Weltmarkt gibt, und die österreichischen Übermengen
nur durch eine Reihe von Marktordnungsinstrumenten zu bewältigen waren – während
gleichzeitig die Arbeitslosen hungerten. Die Industrie erreichte dagegen nie das Vorkriegsniveau. Die Erste Republik bildete in der wirtschaftlichen Entwicklung ein "Loch".
Das Vorkriegsniveau wurde erst 1928 und 1929 erreicht bzw. knapp übertroffen (und dann
erst wieder 1950).
Produktionsindizes der österreichischen Wirtschaft (1913 = 100)
300
250
200
150
100
50
0
1920
1925
1930
1935
1940
Jahr
BNP
Landwirt
schaft
Industrie
E, Gas,
Wasser
Handel
Öffentl.
Dienst
Quelle: Kausel / Nemeth / Seidel 1965
Als die Wirtschaftskrise Österreich erreichte, betrieb die Regierung eine Politik der
Verstärkung des Zyklus. Das geschah mit der Billigung der sozialdemokratischen Führung,
die immer noch um ihre Sparbücher fürchtete. Man weist zur Rechtfertigung heute auf die
"vorkeynesianische" Auffassung hin. Doch eine solche Politik war auch damals nicht
unvermeidlich. Die skandinavischen Länder begannen etwa zur gleichen Zeit und vor
Keynes eine recht erfolgreiche expansive Politik, die manche österreichische
Gewerkschaftsgruppen gern auch auf unser Land übertragen hätten. Doch sie stießen auf
den erbitterten Widerstand nicht nur der Regierung, sondern auch Renners und Bauers. So
begann ein immer größerer Teil der österreichischen Bevölkerung, wieder über die Grenze
107
nach Deutschland zu schauen. Der dort schon langsam anrollende Militärkeynesianismus
mit der forcierten Aufrüstungspolitik der Nazis führte immerhin praktisch zur
Vollbeschäftigung. In Österreich blieb dagegen die Arbeitslosigkeit bis 1937 über 20 %.
Die Wirtschaft erreichte nicht mehr das Niveau der Vorkriegszeit.
War es da verwunderlich, dass ein erheblicher Teil der Österreicher sich nicht für ihr Land
begeistern konnte? In den Zwanziger Jahren waren die Anschlussbefürworter nicht mehr so
lautstark gewesen, auch wenn sie ihre Tätigkeit keineswegs aufgegeben hatten. Jetzt
schwoll ihr Chor wiederum an. Wie die Erfolge der Nazis bei den Wiener
Gemeinderatswahlen, aber auch in Innsbruck, zeigten, konnten sie nun durchaus auch auf
erhebliche Unterstützung aus der Bevölkerung zählen. Es waren übrigens die
Christlichsozialen, die in diesen Wahlen regelrechte Zusammenbrüche erlitten. Die
Sozialdemokraten wurden vorerst davon kaum berührt. Außerdem waren die Arbeiterschaft
sowie die demokratische Bewegung sowieso bald nur mehr Zuschauer auf der politischen
Bühne. Der Bürgerkrieg drängte sie aus dem politischen Geschehen. Als es zu spät war,
wollte sie Schuschnigg mit seiner Volksabstimmung noch schnell miteinbeziehen. Die
Wahl für das Österreich dieser Machthaber, deren Politik ihnen jede Identifikation mit
diesem Staat und dieser Nation unmöglich gemacht hatte, blieb ihnen aber erspart - die
Nazis marschierten ein.
Der Projektcharakter der nationalen Frage wurde nach dem Zusammenbruch der
Habsburger-Monarchie besonders deutlich erkennbar. Wir müssen auf diesen Zeitpunkt
noch mehrmals zurückkommen, da er von den Deutschsprachigen des alten Reiches als
Katastrophe empfunden wurde und dementsprechend ihre weitere politische Haltung
prägte. Wie hätte es anders sein können? Mit der Monarchie brach nicht nur ein politisches
Gebilde, sondern ein kultureller Bezugsrahmen zusammen, das symbolische Bezugssystem
auch für jene, welche das politische System der Monarchie bekämpft und gehaßt hatten.
Für die Formung der gesamtgesellschaftlichen Tradition ist die Existenz und die
Funktionsweise des jeweiligen Staates von überragender Bedeutung, symbolisch wie in
seinen konkreten Funktionsweisen. In der Monarchie war es zudem der Staat, verkörpert
von Kaiser, Heer und Bürokratie, welcher infolge der Kraft des Faktischen dem Prinzip der
Nation bis nahe an das Ende erfolgreich Konkurrenz gemacht hatte. Noch mitten im Krieg
hat Seipel (1916) dies nicht nur festgestellt, sondern geradezu feierlich ideologisiert.
Zerbricht nun der Staat, und zwar im Ablauf einer historischen Katastrophe, so muss dies
auf alle Fälle auf der Ebene der Symbolik eine traumatische Erfahrung darstellen. Dazu
kam, dass diese Kräfte und insbesondere ihre intellektuellen Vertreter (man zögert hier
geradezu, von intellektuell zu sprechen, weil dies doch eine gewisse Urteilskraft bedeuten
sollte) zu den verblendetsten Ideologen des Weltkrieges gehört hatten. Sie hatten offenbar
jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren, bis an den Rande des Wahns. Noch im Sommer
1918, als der Zusammenbruch schon begann, schwadronierten diese angeblichen Gelehrten
von einem “bedingungslosen Siegfrieden”: ”Eingesponnen in den Nebel von politischem
Wunschdenken, Kriegsbegeisterung und patriotischen Elan, nahmen diese Vertreter der
Wissenschaft gar nicht wahr, dass sich die militärischen Kräfte der Mittelmächte dem Ende
zu neigten. Und als dann der Zusammenbruch tatsächlich Anfang August 1918 eintrat, lag
es auf der Hand, dass diesem euphorischen Siegestaumel ein bitteres und schmerzliches
Erwachen folgen musste” (Ramhardter 1973, 30). Die geistige Umorientierung folgte dann
ebenso schnell wie sie in ihrem Ergebnis kennzeichnend war: „Aus den Großösterreichern
sind Großdeutsche geworden“ (Fellner 2002, 333).
108
Als der Habsburger-Staat zusammenbrach, waren klarerweise jene am stärksten desorientiert, welchen dieses Symbolsystem am meisten gegolten hatte, die Katholisch-Konservativen. Österreichs politische Führung glaubte sich nicht anders retten zu können als
durch den Anschluss an das Deutsche Reich. Hier spielten zwar die Sozialdemokraten die
Einpeitscher. Doch auch die Christlich-Sozialen (Ignaz Seipel) wurden in etwas anderer
Form deutschnational. Die Erfahrung des Zusammenbruchs war nicht in wenigen Wochen
und auch nicht in wenigen Jahren zu bewältigen, zumal sie für diese Klientel, die
bürgerlichen Schichten auch noch Aspekte einer gesellschaftlichen Umwälzung trug. So
wurde für sie 1918 die eigentliche unbewältigte Vergangenheit für viele Jahrzehnte, der
Absturz aus der vermeintlich gesicherten Existenz der konservativen Macht. Das wird sich
noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen.
Für die Nationalen, ob Großdeutsche oder Sozialdemokraten, war zwar der Zerfall der Monarchie auch eine traumatische Erfahrung, aber doch in einer ganz anderen Qualität. Viele
unter ihnen hatten diesen Staat als Feindbild gepflegt. Sie vermochten sich daher eher zu
fangen. Die Sozialdemokraten waren überhaupt im Vorteil, weil sie über die deutschnationale Orientierung hinaus noch ein weiteres, ebenso wichtiges Identitäts-Anbot hatten, nämlich ein sozialpolitisch und kulturell innovatives Konzept einer "neuen Gesellschaft". So
konnten sie sehr kurzfristig sogar die soziopolitische Hegemonie erringen. Das sollte
wiederum Otto Bauer bald ideologisieren unter dem Schlagwort "Klassengleichgewicht der
Volksdemokratie". Ablesbar war dies an ihrer kurzfristigen Majorität im Wiener
Parlament.
3.1.1 Anomie
Felix Butschek hat, nicht völlig zu Unrecht, gemeint, aus dem Vergleich des Zusammenbruchs des Habsburgerstaates mit dem Zusammenbruch der Nomenklatura-Systeme des
Ostens Lehren für den wirtschaftlichen und politischen Aufbau dieser Gesellschaft ziehen
zu können. Hat der Vergleich irgendeine Berechtigung, dann gilt er natürlich auch anders
herum. Was aber das kennzeichnende Merkmal dieser Gesellschaften war bzw. noch
immer ist, ist eine verbreitete Anomie. Wie stand es um Österreich 1918?
Émile Durkheim (1990 [1897]) hat in seinem vielleicht berühmtesten Werk, jenem über
den Selbstmord22, das Grundkonzept der "Anomie" entwickelt. Seine Ausgangsbeobachtungen sind: "In normalen Zeiten wird die Kollektivordnung von der großen Mehrheit der
ihr Unterworfenen als gerecht angesehen" (287). Es geht hier also um die Legitimität einer
bestehenden Ordnung bzw. Gesellschaft und dem folgend um die grundsätzliche Loyalität
der großen Mehrheit zu ihr. "Wenn indessen in der Gesellschaft Störungen auftreten, sei es
infolge schmerzhafter Krisen oder auch infolge günstiger, aber allzuplötzlicher Wandlungen, ist sie zeitweilig unfähig, ... Autorität zu zeigen" (287). Die Regulierungsfähigkeit der
bestehenden Strukturen und Prozesse ist überfordert oder bricht überhaupt zusammen. "Der
Zustand der gestörten Ordnung oder Anomie ... gibt der öffentlichen Meinung keine
Orientierung mehr.... Zur gleichen Zeit wird der Kampf härter und opfervoller, einmal, weil
22
Gerade in unserem Zusammenhang mag Folgendes von mehr als nur anekdotischem Interesse sein: Der
wohl berühmteste Tscheche noch unseres Jahrhunderts hat sich 20 Jahre vor Durkheims epochemachendem Werk mit einer Arbeit über den Selbstmord an der philosophischen Fakultät der Universität
Wiens habilitiert. Thomas G. Masaryk stieß dabei allerdings auf völliges Unverständnis seiner
inkompetenten philosophischen Fachkollegen und mußte sein Werk unter ihrem Druck praktisch völlig
umschreiben.
109
die Kampfregeln wenig beachtet werden, und zum anderen, weil der Wettbewerb schärfer
wird" (289). Durkheim beschreibt in der Folge manches, was auch in unseren Quellen
ständig auftaucht. Man kann umgekehrt formulieren: Viele Sätze aus Zeitungsartikeln oder
sonstiger Literatur dieser Zeit könnten geradezu unverändert in Durkheims klassisches
Werk übernommen werden. Ein Systembruch, wie man ihn am Ende des Ersten Weltkrieges in Österreich (und wie man ihn wieder im heutigen Osten) erlebte, ist die Mustersituation, welche anomisches Verhalten und Reaktionen hervorruft. Dabei kann der Bruch
infolge seines auch kulturellen Charakters durchaus schärfer wahrgenommen werden, als er
sich im Nachhinein und in einer nüchternen Analyse herausstellt. Das war der Grund, warum die Lebensunfähigkeits-These mental so leicht vermittelt werden konnte. Dazu kam
eine gesteigerte reale Unsicherheit im Alltagsleben. Die anomische Situation zog anomische Persönlichkeiten an. Man denke an die Freischärler im Deutschen Reich, im deutsch
besiedelten Osten bzw. auch in den baltischen Gebieten! Auch an den Rändern Österreichs,
im späteren Burgenland, taucht dieses Problem in Gestalt ungarischer Banden auf. Im
Grunde sind die sogenannten Kärntner "Abwehrkämpfer" in dieselbe Kategorie einzureihen
– natürlich auch ihre südslawischen Gegner. Dass eine solche anomische Situation entstand, ist keineswegs überraschend. Alles andere wäre unerklärlich. Die Grunderfahrung
war eine existentielle Unsicherheit. Wenn nicht nur ein politisches und ein Gesellschaftssystem, sondern ein ganzes Wertsystem zusammenbricht, das immerhin Generationen
Gültigkeit hatte, käme jede andere Situation einer völligen Negation aller bisherigen
sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse gleich. Es ist kennzeichnend, dass die Sieger-Mächte zum erheblichen Teil nicht unähnliche Erfahrungen machten. Die forcierte Politik der
Konservativen, vor allem im Vereinigten Königreich, des Rückkehrs zum Goldstandard
war im Grunde eine völlig irrationale Wirtschaftspolitik, die überhaupt nur zu verstehen ist
als ein Verzweiflungsakt symbolischer Politik: Man wollte damit zu den gesicherten Verhältnissen der Vorkriegszeit zurückkehren, wo man praktisch keine Inflation und nur wenig
soziale Unruhe gekannt hatte.23
3.1.2 Siegmund Freud und seine Religion – die Psychoanalyse
Freuds Thema war der bürgerliche Mensch im fin de siècle, zuerst im Rahmen der Monarchie,
dann in der Ersten Republik. Sein Anbot war zuerst eine klinische Theorie, schließlich aber eine
vollständige Weltsicht mit quasi-religiösem Charakter, spätestens mit “Jenseits des Lustprinzips”
(1919/1920 - Freud 1989 III, 215 - 272). Die innere Auflösung der Monarchie, ihr Auseinanderfallen im und nach dem Weltkrieg, schließlich die ungesicherte Existenz der Ersten Republik ist
interessanterweise nirgends sein explizites Thema. Es scheint jedoch, als ob der Einfluß dieser
Prozesse auf die Formulierung seiner Gedanken überragend gewesen wäre. Allerdings läßt sich
dies nur in geradezu verschämten Beiläufigkeiten erkennen. So ist in der “Traumdeutung” (Freud
1989 II) der Antisemitismus als Barriere für seinen eigenen Ehrgeiz und jenen anderer Kollegen
jüdischer Herkunft allgegenwärtig; er wird jedoch immer verhüllend mit dem Vokabel der
Religionszugehörigkeit angesprochen. In der Republik ist es seine Religionskritik, welche zuerst,
als noch einigermaßen demokratische Verhältnisse herrschten, offen formuliert wird (“Zukunft
einer Illusion” 1927 – IX, 139 - 189). Im Austrofaschismus hält er dann jedoch den “Mann Moses”
(IX, 459 - 581) zurück und veröffentlicht den letzten Teil erst im Londoner Exil, mit mehreren
23
“We, in fact, were the predominant partner in the Gold Standard-Alliance. But those who think that a
return to the gold standard means a return to these conditions, are fools and blind” (Keynes 1963 [1931],
234). - Man denkt dabei unwillkürlich an die heutigen osteuropäischen Staaten, welche wider jede
wirtschaftliche und politische Vernunft unbedingt der EU und der NATO beitreten wollen, weil für sie
dies zum Symbol der Zugehörigkeit zu Westeuropa und zu seinem Wohlstand geworden ist.
110
Vorworten, auch mitten im Text, welche diese Schrift zu einem kennzeichnenden, auch
ergreifenden Zeugnis sowohl der politischen Umstände wie auch des Verfassers werden lassen.
Doch das eigentlich interessante ist die hochsublimierte Form, wie er auf dies alles reagiert.
Als bereits damals Mittelpunkt eines internationalen Netzes, wenn auch mit Schwerpunkt in Wien,
ist er offenbar nicht bereit, sich national zu identifizieren. Seine “Religionszugehörigkeit”
hingegen ist ein ständiges Thema, das immer wieder kollidiert mit dem reaktionären Katholizismus
seiner politischen Umgebung. Ergebnis ist eine Weltsicht, die sich auf die Biologie - offenbar die
einzige Transzendenz, die er noch erkennen kann - abstützt. Seine berufliche Laufbahn
prädestinierte ihn dazu. Doch er beschränkt sich nicht auf eine gewissermaßen positivistische
Wissenschaft. Es ist er die “Biologie als Schicksal”, welches ihn fasziniert. Das kennzeichnendste
Werk dazu ist die hochspekulative Schrift “Jenseits des Lustprinzips”, die dann zu so etwas wie
einem Treuetest für die orthodoxen Freudianer wurde.Tatsächlich scheint auch das der Punkt
gewesen zu sein, wo der Bruch mit einem seiner Getreuesten schließlich stattfand - mit Wilhelm
Reich (vgl. 1975, 213 ff.). Für Freud war das politische Engagement Reichs nicht akzeptabel,
sodas er schließlich leicht paranoid dessen Arbeiten als KP-gesteuert denunzierte - zu einer Zeit,
wo Reich schon auf seinen KP-Auschluß zuging.
Interessanterweise scheint Reich schließlich in weit radikalerer Form dort angekommen zu sein,
wo er Freud verließ – nämlich nach einem fast soziologischen Reduktionismus bei einem durchgehenden und ausschließlichen Biologismus, der ebenfalls religiöse Züge annahm. Während Freud
erst von den Nazis aus Österreich vertrieben wurde, verließ Reich Wien aus mehreren Gründen
bereits sechs Jahre zuvor, nicht zuletzt auch deswegen, weil er in der durch Freud beherrschten
Wiener Szene keine Möglichkeit mehr sah, beruflich und wissenschaftlich tätig zu sein.
Was aber die beiden schließlich einte, war die völlig anationale Haltung, welche den einzigen
archimedischen Punkt schließlich in der Biologie des Menschen erkennen konnte. Österreich
kommt bewusst in ihren Überlegungen nicht vor. Das scheint nun nicht zufällig für progressive
österreichische Intellektuelle. Während jedoch Freud zwar seine Spekulationen erstnahm, aber
doch mit ihnen spielte, behielt er sie im Griff - bei ihm siegte der Realismus über die intellektuelle
Konsequenz. Reich hingegen ging seinen intellektuellen Weg zu Ende bis zu seinem Tod in einem
US-amerikanischen Gefängnis.
3.2 Österreichs Staatsgründung
Die Entstehung der Ersten Republik und ihrer Verfassung ist für den Nationentheoretiker
ebenso wie für den Staatstheoretiker von großem Interesse. Sie zeigt den Aufbau eines
neuen Staates, nachdem der alte scheinbar vollständig zusammengebrochen war – scheinbar, weil die wichtigste Komponente des modernen Staates überdauerte: der bürokratische
Apparat. Kelsen (1923, 89) schon wies darauf hin, dass "der bürokratische Verwaltungsapparat des alten Österreich ohne Änderung übernommen" wurde. Aufrechterhalten wurde
er nicht zuletzt durch ein spezielles Arbeitsrecht, heute "Beamtendienstrecht" genannt.
Seine Hauptfunktion ist die Herrschaftssicherung. Dazu werden die Interessen der Betroffenen (der Beamten) durch Privilegierung mobilisiert. Allerdings war dieser Apparat "geköpft": Das Kommunikationszentrum, die politische Zentralgewalt, hatte kurzfristig zu
bestehen aufgehört. Es gab mehrere Machtkerne, die versuchten, möglichst viel Macht und
Kompetenz an sich zu ziehen. Der neue Staatsaufbau ist der Prozess, mittels welchem sich
binnen kurzem der wichtigste, weil repräsentativste, dieser Kerne durchsetzte. Darüber
hinaus war man auf der Suche nach einer neuen, möglichst allseits anerkannten Legitimität.
Das Symbolsystem Monarchie und Dynastie musste durch ein neues symbolisches System
ersetzt werden. Dafür bot sich die "Nation" an. Doch welche Nation?
3.2.1 "Kulturnation"
111
Seit 100 Jahren wird vor allem in der Historiographie die Frage der "Kulturnation"
debattiert. Wir wissen seit langem, dass dieser Begriff vorwiegend ein Deckbegriff für
nicht ausgesprochene Machtansprüche ist, oder für solche, welche sich nur verhüllt äußern
dürfen oder können. Es ist erstaunlich, wie wenig sich daran geändert hat. Es ist aber
durchaus kein Zufall, dass vor allem deutsche Historiker sich bis in die Gegenwart so
verbissen an diesen Terminus hängten. Während der Existenz der DDR war es das
Instrument, den staatsrechtlich formulierten Anspruch auf deren Territorium und
Bevölkerung "historisch" zu legitimieren. "Und nun ist während dieser zwei Jahrzehnte
auch Österreich manchmal in diesen Diskurs 'hineingerutscht'... 1978 hat Wolfgang
Mommsen in einem 1990 wiederabgedruckten Aufsatz davon gesprochen, 'daß es einen
deutschen Kernstaat gibt, die Bundesrepublik, und gleichsam zwei weitere deutsche
Staaten 'deutscher Nation', nämlich die DDR und Österreich'" (Stourzh 1993, 4). Nur am
Rande sei bemerkt, daß zur selben Zeit, als der von Stourzh zitierte deutschnationale
Historiker dies schrieb und damit gewissermaßen wieder einen Anschluß proklamierte, die
österreichische Ministerin für Wissenschaft und Forschung diesen selben Historiker mit
aller Macht auf den damals verwaisten sensiblen Zeitgeschichte-Lehrstuhl bringen wollte
und nur durch einige akademische Manöver regelrecht ausgetrickst wurde.
Doch darüber hinaus hat der Ausdruck einige Aspekte, die mit den Funktionen der Nation
ebenso zusammenhängen wie mit der Fähigkeit des Staates zur Autolegitimation. Es geht
um die Frage, wer vollwertiges Mitglied ist, um die Frage der Inklusion somit. Beginnen
wir mit zwei Feststellungen: "A symbolic status of membership such as citizenship rests on
general recognition rather than on the pysical location of bodies in space" (Bauböck 1994,
158). Folgerichtig lesen wir dann später: "In contrast with social membership, political
membership in democracy is a question of will more than of fact" (p. 174). Das aber
scheint massiv überzogen. Es würde das politische System, den Staat, auf ein symbolisches
System reduzieren, anstelle es / ihn als soziales Subsystem zu betrachten. Das politische
System wäre damit ein rein kulturelles Untersystem. Nun muss jedes Sozialsystem auch
über ein zugehöriges kulturelles System verfügen, also auch der Staat. Dies wurde von
Soziologen und Politikwissenschaftern bislang meist übersehen, ganz im Gegensatz zu
Juristen und Philosophen. Andererseits kommt zumindest das Wort "kulturell" in der
Nationentheorie ständig vor, insbesondere in der älteren, und vor allem im impliziten
Theoriezugang der Geschichtswissenschaften. Der Ausdruck "Kulturnation" sagt, wenn
auch fetischisiert, also ganz offensichtlich etwas über die Inklusion aus. Vielmehr soll er
nach Absicht seiner Propagandisten etwas aussagen. Doch da deren Ansicht von einem
erheblichen Teil wenn schon nicht der Wissenschaftler, so doch der Bevölkerung auf eine
diffuse Weise geteilt wird, wurde sie auch als Teil von sozialen Einstellungen zu einer
Realität. Diese Verschränkung von normativer und analytischer Ebene wird noch stärker
verkompliziert durch unterschiedliche Aspekte innerhalb der normativen Ebene. Auf der
einen Seite stellt er einen Machtanspruch sich sprachlich legitimierender Eliten (und
aspirierender Eliten) dar, heißt also: "Diese von uns definierte Gesellschaft ('Nation') hat
Anspruch auf einen eigenen Staat; und wir, die wir mit der Sprache arbeiten und sie
verwalten, wollen die Repräsentanten der so abgegrenzten Nation sein, die staatlichen
Herrschaftsträger." Die normative Inklusionsaussage hingegen ist: "Nur jene sollen
Mitglied [zuerst] der Nation sein, welche dieses bestimmte Kulturmerkmal, die Sprache,
tragen. Jedoch sollen andererseits alle jene Mitglieder werden." In Zusammenschau mit der
ersten Aussage ergibt dies die Folgerung: "Nur jene sind vollwertige Bürger unseres
Staates, welche unsere Sprache sprechen und daher zu unserer 'Kulturnation' gehören."
112
In völlig fetischisierter Form wird dies mit dem Term des "Nationalstolzes" ausgedrückt,
der von einem Großteil der Bevölkerung in irgendeiner diffusen Form geteilt wird. Er ist
der säkularisierte Ersatz für eine weitgehend abhanden gekommene religiöse Transzendenz. Besonders deutlich wird dies, wenn z. B. Tocqueville (1988) den Nationalstolz als
einzige über Spezialinteressen hinausgehende Gemeinsamkeit in modernen Gesellschaften
versteht. Wie gewöhnlich stehen in diesen Gemeinsamkeiten natürlich auch politische
Werte zur Debatte. Eine patriarchale Gesellschaftsstruktur glaubt diese verquere
Transzendenz zu brauchen, um ihre spezifischen Interessen, die Interessen einer kleinen
Schicht aus "Besitz und Bildung", als die Allgemeininteressen ausgeben zu können. Im
übrigen ist "Kultur" oder "Zivilisation" natürlich auch ein Codewort für eine ziemlich
grobe Ideologisierung bzw. Instrumentalisierung des "Nationalstolzes. Es diente bisher
einfach als Rechtfertigung für politische Intervention oder überhaupt für die Eroberung
(den Raub) eines Gebietes, auf das der "zivilisierende" Staat nicht den geringsten
Rechtsanspruch hat. Dies funktioniert deswegen so gut, weil die ethnozentrische
Auserwählungs-Überzeugung, in Wirklichkeit selbst die Einzigen zu sein, welche
vollmenschliche Züge haben, aufgrund des Auswahlcharakters sozialer Institutionen eine
so gute Stütze in der alltäglichen Lebenswelt aller Menschen hat: Jede Gesellschaft wählt
nur einen Bruchteil der möglichen Verhaltensweisen aus dem Fundus möglichen
menschlichen Verhaltens aus, die im Laufe der Zivilisation dann zum eigentlichen und
einzigen menschlichen Verhalten werden. Gesellschaften mit anderen Verhaltensmuster
sind somit nicht wirklich menschlich.
Der Kern ist also die individuelle und kollektive Mitgliedschaft, d. h. nicht zuletzt die
juridisch-politische und symbolische Figur der Bürgerschaft. Als symbolische
Mitgliedschaft juristischer Natur kann sie individuell verliehen werden. Kollektiv
entscheidet man durch das sogenannte "Selbstbestimmungsrecht" darüber. Als soziale
Mitgliedschaft ist ihr Erwerb ein ebenso stetiger Prozess der Integration wie andere
Integrationsprozesse auch. Einen völlig ungewohnten Aspekt allerdings erhält all dies,
wenn das bisherige System der (symbolischen und politischen) Mitgliedschaft verloren
ging und ein neues erst aufgebaut oder ausgewählt werden muss. Diese Situation war für
die späteren Österreicher 1918 gegeben und überforderte sie in ihrer Komplexität und
Dialektik massiv.
3.2.2 Die erste Nachkriegszeit und die Staatskonstruktion
Als seit Ende September 1918 die slawischen Nationen der Monarchie der Reihe nach
eigene Vertretungskörper konstituierten ("Nationalversammlungen"), brach das Reich nach
einem schwachen Versuch der Dynastie, die Einheit zu bewahren, endgültig auseinander.
Der Aufruf Kaiser Karls vom 16. Oktober 1918 zum Umbau des Staats blieb folgenlos.
Auch der Versuch der bisherigen politischen Macht, zumindest im deutschsprachigen Teil
die Kontinuität aufrechtzuerhalten, scheiterte: Die politischen Parteien in der jetzt (am 21.
Oktober 1918) konstituierten "Provisorischen Nationalversammlung" lehnten es dem
Noch-Kaiser gegenüber ab, die Konkursmasse des alten Staates zu übernehmen. Dazu
wurden sie dann durch den Friedensvertrag doch gezwungen. Damit stellte sich die Frage
nach der Zukunft. "Bürgerliche Demokraten, wie Zenker und Blasel, riefen als erste in
öffentlichen Versammlungen nach der Republik" (Goldinger 1962, 13). Hier fiel auch die
Entscheidung für eine parlamentarische Demokratie liberalen Musters. Das war nicht
selbstverständlich. Immerhin stand eine Rätedemokratie ernsthaft zur Debatte (Gerlich
1981). Schumpeter warnt z. B. immer wieder vor der bolschewistischen Gefahr. Die
113
politische Aufgabe, sie einzudämmen, übernahm die Sozialdemokratie. Sie trickste die
Arbeiterräte aus, indem sie sie sich in Tagesfragen erschöpfen ließ.
Der neue Staat musste nun formal gegründet werden. Interessant ist der bunte Ablauf der
Rechtssetzungsakte, wie er sich in der Staatsgesetzblättern spiegelt. Am 30. Oktober wurde
eine Art provisorischer Verfassung beschlossen (StGBl. 1/15. Nov. 1918). Ihr wichtigster
Zug ist, dass zum einen das bisherige Recht weitergilt (§ 16): "Das Recht des alten
Österreich ... bildet in seiner Hauptmasse auch heute noch den Grundstock der in der
Republik Österreich geltenden Rechtsordnung" (Ogris 1975, 546). Zum anderen bleibt
auch die oberste Behördenorganisation erhalten, nur heißen die Ministerien jetzt
"Staatsämter". Karl Kraus hatte wörtlich recht, wenn er der Sozialdemokratie vorwarf, die
österreichische Revolution auf einen Firmenwechsel reduziert zu haben.
Überhaupt erstaunt es, wie oft die Formulierungen der Verfassungsbestimmungen aus der
Monarchie, insbesondere der Dezembergesetze 1867 und der damit verbundenen früheren
Gesetze aus 1862, im republikanischen Verfassungstext wortwörtlich wiederkehren.
Gerade das zeigt besonders deutlich, wie sehr das B-VG noch aus dem altliberalen Geist
lebt, der schon 1920 Vergangenheit war. So ist es erklärlich, daß das heutige politische
Leben sehr oft im direkten Widerspruch zumindest zum Geist der Verfassung steht.
Da im Anschluss an den Krieg genügend Waffen im Umlauf waren und sich Kerne paramilitärischer Gruppen gebildet hatte, versuchte die Nationalversammlung, das entscheidende Kriterium des Staates, das Gewaltmonopol, wieder an sich zu ziehen
(Beschluss ... betreffend die National- und Bürgergarden, StGBl. 2).– Zwei Wochen später
kam der berühmte Beschluss: "Deutschösterreich ist eine demokratische Republik...
Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik." (StGBl. 5)
In diesem Staatsgründungsakt vom 12. November 1918 werden die Bundesländer nicht einmal erwähnt. Kelsen (1922, 53) wird ihn deshalb "verunglückt" nennen. Die Behauptung,
dass die Republik von den Bundesländern gegründet worden warf, ist also konservativ-föderalistische Ideologie. Politisch gesehen ist folgende Feststellung ganz aus dem Nationalismus und seiner ideologisierung im 19. Jahrhundert durch Mancini und Tschudi geschrieben, hat aber in dieser Ausnahmesituation ein richtiges Element: "Subjekte der
Staatsteilung und die Übernehmer dessen souveräner Rechte über einzelne Territorien
waren die Nationen und nicht etwa irgendwelche historische Länder" (Pleterski / Druškovic
1983, 15). Die Frage stellt sich allerdings: Wer ist diese Nation, wer handelt für sie? Das
wird erst etwas später mit der Kenntnisnahme der Beitrittserklärung der Länder (StGBl. 23)
sowie mit der – vom Zentrum aus angeordneten – "Übernahme der Staatsgewalt in den
Ländern" (StGBl. 24) geschehen. Zwischendurch fiel es offensichtlich einem Juristen auf,
dass das Staatsgesetzblatt rechtlich gar nicht existent war. Es wurde daher durch eine Verlautbarung im Staatsgesetzblatt geschaffen (StGBl. 7), ein hübsches Beispiel für die logische Selbstbezüglichkeit der Jurisprudenz. Weiters gab es einen pathetischen Aufruf ohne
jeden Rechtscharakter (StGBl. 6). Schließlich wurde eine Amnestie für alle im weiteren
Sinne politischen Delikte im alten Staat erlassen (Beschluss vom 14. Nov., StGBl. 25). U.
a. ging damals auch Friedrich Adler frei, der 1916 den Ministerpräsidenten Stürgh aus
Protest gegen dessen Kriegspolitik ebenso wie gegen die dabei mitspielende Politik seiner
eigenen Partei erschossen hatte. Schließlich fühlte man das Bedürfnis, das eigene Staatsgebiet auch einmal abzugrenzen (StGBl. 40 und 41). Dabei wurde u. a. das Sudetenland
und "Deutschböhmen" beansprucht, dagegen die "geschlossenen jugoslawischen Siedlungsgebiete" in Kärnten nicht ("Jugoslawien" gab es damals noch gar nicht). Schließlich
114
wird ein nicht näher bezeichnetes "Industriegebiet im äußersten Norden Ostmährens und
Ostschlesiens" als "zwischenstaatliches Verwaltungsgebiet" Polens, der Tschechoslowakei
und Deutschösterreichs deklariert; die deutschen Sprachinseln in den Nachfolgestaaten
zum "nationalen Interessensbereich"; und schließlich offene Handelswege entlang der
Donau und zur Adria zum "wirtschaftlichen und kulturellen Interessensbereich". Wie man
sieht, ist der Aufbau eines Staates recht verwirrend und läuft nicht ganz so glatt, wie sich es
die Juristen wünschen mögen. Es ist geradezu amüsant, wie Hans Kelsen als Jurist mit Leib
und Seele die rechtspolitische Entwicklung dieser Monate immer wieder mit den Worten
"seltsam", "geradezu sinnlos", "unhaltbar" und ähnlichen Ausdrücken kommentiert.
Umso interessanter ist es daher, die Situation in einer Region zu betrachten, wo die Katholisch-Konservativen völlig unbestritten eine überaus deutliche Mehrheit hatten. Wir werden
diesen Problemkreis im zweiten Teil dieser Arbeit noch ausführlich behandeln. Das eigentliche theoretische Interesse, welches die unterschiedlich gerichteten Anschlussbestrebungen der Vorarlberger Bevölkerung und ihrer politischen Klasse bieten, ist nicht das spezifisch Vorarlbergische in dieser Nachkriegssituation. Es ist die Frage, wie sie die politische
Orientierung unverhüllt zur nationalen Zuordnung wandelt. Ein Spezifikum könnte darin
bestehen, dass die Absichten dieser konservativen Mehrheit von ihrem autoritativsten
Sprecher nicht so in Wien vertreten wurde, wie sie möglicherweise in der Bevölkerung
vorhanden waren. Ein eigenes politisches Projekt traute man sich nicht zu, obwohl man für
Vorarlberg das "Selbstbestimmungsrecht" forderte (Wanner 1980). "Wien" hingegen lehnte
man ab, da dort die Sozialdemokratie zuviel zu sagen hatte. Der virulente Antisemitismus
dürfte in diesem Sinne vor allem ein Anti-Sozialismus gewesen sein. Im Zuge des Kampfes
um das eigene politische Projekt der Zukunft wurde dieser spezifische, religiös legitimierte
Fremdenhass – die Juden als die Verkörperung des "ganz Anderen" – mobilisiert, weil man
damit dem politischen Gegner die "Andersartigkeit" nachweisen konnte. In der zweiten
Nachkriegszeit wird aus dem Westen Österreichs nochmals Ähnliches zu vernehmen sein,
obwohl man diesmal den offenen Antisemitismus zumindest am Anfang vermied. Diese
Strömung hatte nur deswegen nicht mehr Folgerungen, weil sie diesmal nicht eine wirklich
ausgearbeitete Strategie verfolgten.
3.2.3 Die nationale Orientierung
Der Staatsaufbau ging in einer Situation ungeklärter nationaler Loyalitäten vor sich. Nun ist
Nation, nach einem Ausdruck von Max Weber, eine "Loyalitätszumutung. Die möglichen
und tendenziell konkurrierenden Loyalitäten waren daher gleichzeitig mit scharf konkurrierenden politischen Entwürfen verknüpft. Bekannt ist, dass und wie Otto Bauer den
Programmcharakter der nationalen Orientierung erfasste und deutete, da er dies selbst in
einer umfangreichen Publikation über die "österreichische Revolution" darlegte (vgl.
Reiterer 1994). Nicht uninteressant ist im Einzelfall, wie sehr sich die Unterschiedlichkeit
der Optionen in der neuen, erst zu erfindenden nationalen Symbolik verästelte. Die Repräsentanz politischer Existenz braucht ebenso ihre Ausdrucksformen wie jene der sozialer
Existenz. Diesen Ausdrucksformen (Wappen, Fahnen) versucht die politische Klasse und
ein erheblicher Teil der Bevölkerung tatsächlich eine gewisse Sakralität zu verleihen. Es
sind die öffentlichen Kultbilder und Reliquien des Staates. Dementsprechend werden hier
in einer ungeklärten nationalen Situation Konflikte aufbrechen.
Als zwischen den Christlichsozialen und den Sozialdemokraten 1918/1919 die Frage des
Staatswappens verhandelt wurde, einigte man sich einigermaßen bald auf den Adler mit
den drei Ständesymbolen (Mauerkrone, Hammer und Sichel). Doch an den Farben begann
115
es sich zu spießen. Karl Renner wollte die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold
durchsetzen. Dagegen stellten sich die Christlichsozialen, die schon von der AnschlussVerve der Sozialdemokraten überrumpelt worden waren. Hier setzten sie sich durch mit
ihrem Vorschlag Rot-Weiß-Rot. Es war eine Konfrontation zweier politischer Konzepte,
eine Konfrontation zwischen dem Wunsch nach Kontinuität und dem Willen zum Bruch
mit der Vergangenheit, der sich im Anschluss verwirklichen sollte.
Die Reichspost kommentierte dies sehr richtig (1. Nov. 1918; zit. nach Spann 1994, 41): "Rotweißrot [ist] das ehrwürdige Dreifarb der Babenberger und der Schleife, welche die österreichischen
Kaiser tragen... Die Wahl bekundet, dass man auf Geschichte und Tradition hält und an den Idealen der alten Ostmark anzuknüpfen wünscht, die nach der Lossagung der später hinzugekommenen
nichtdeutschen Länder vom schwarzgelben Österreich im neuen deutschösterreichischen Staat
wieder als Kern sichtbar geworden ist. Das gesamtösterreichische Schwarzgelb bleibt dem künftigen Bundesstaat, falls die Zusammenfassung der Nationalstaaten gelingt, überlassen, dem
schwarzrotgoldenen Bekenntnis zum Gesamtdeutschtum geschieht durch das eigene Dreifarb
Deutschösterreichs kein Abbruch."
In ähnlicher Weise stritt man sich um den "Staatsfeiertag" – also nicht um einen Nationalfeiertag. Den werden manche Professoren und Akademiker der Ersten Republik dann für
das Deutsche Reich feiern. Österreichischer Staatsfeiertag war der 12. November. Otto
Bauer wird bald bemerken, dass das österreichische Bürgertum diesen Tag nie wirklich
akzeptierte. Dieser Streit um den Staats-, dann Nationalfeiertag wird in der Zweiten
Republik eine Neuauflage erleben. "Für Österreich ist die Bezugnahme auf konsens- und
identitätsstiftende Ereignisse der jüngsten Vergangenheit als Anlass für nationales Feiern
schwierig. Lange Zeit fehlte in der Republikgeschichte das große, einigende historische
Erlebnis. Vielmehr überwogen die polarisierenden Erinnerungen... Im Streit um
Staatssymbole und Staatsfeiertag manifestierten sich die unüberbrückbaren Gegensätze um
das nationale Selbstverständnis und um die politischen und sozialen Grundorientierungen
der Ersten Republik Österreich" (Spann 1996, 27).
Am Anfang der neuen Republik schien das sozialdemokratische politische Projekt konkurrenzlos. Die Sozialdemokraten sahen sich national wie auch in sonstiger politischer
Hinsicht als die Nachfolger der alter 48er. Sie konnten sich kurzfristig durchsetzen, weil sie
auf eine solche Situation am besten geistig vorbereitet waren. Doch so stark war ihre
Machtstellung, die sich im wesentlichen im Osten Österreichs konzentrierte, nicht, daß sie
die weitere Entwicklung kontrollieren konnten. Die Vertreter der alten Interesse sahen
nicht lange zu. Mit bemerkenswerter Zähigkeit begannen die Christlich-Sozialen bereits
Anfang der 20er Jahre eine soziale roll-back-Politik, um den "Revolutionsschutt" (Seipel)
wegzuräumen. Die Erste österreichische Republik könnte geradezu als Bestätigung der
Lenin'schen These von der Notwendigkeit, "den unvermeidlichen, verzweifelten
Widerstand der Bourgeoisie" gegen die Demokratie niederzuhalten, gesehen werden (Lenin
25, 416). Das letztendliche Scheitern der Republik war nichts anderes als der Sieg dieser
Kräfte, die allerdings nicht einmal in erster Linie aus der in Österreich schmalbrüstigen
"Bourgeoisie" bestanden. Wichtiger war noch die Bürokratie, wobei diese Koalition von
der Römischen Kirche ideologisch und teils auch direkt organisatorisch geführt wurde und
sich deswegen immerhin auf die Massenbasis der Bauernschaft stützen konnte. Die
politische Kultur dieser Kreise ließ eine Anerkennung demokratischer Grundprinzipien,
und insbesondere des Prinzips der Toleranz für die Suche nach neuen Lebensformen nicht
zu. Die kurzfristige politische Hegemonie der Sozialdemokratie war für sie eine mentale
Katastrophe, die sich nicht wieder ereignen sollte.
116
Und natürlich wollte sie auch die Umverteilung am Beginne der Republik durch Zusammenbruch, Inflation und in geringem Grad auch durch Sozialisierung nicht zulassen. Dies
geschah zuerst durch die sogenannte Genfer "Sanierung", welche in ihrer spezifischen
Durchführung jede künftige Möglichkeit einer Wachstumspolitik und damit auch eines
sozialen Ausgleichs in der Ersten Republik unmöglich machten, mit wohlwollender
Komplizenschaft seiner Urheber. So war der Untergang Österreichs von seinen Führern
programmiert. Darum ging es aber gerade. Die folgenden österreichischen Regierungen
taten alles dazu, der Bevölkerung den Verlust spürbar zu machen. Die Bevölkerung erlebte
diese Politik als Bestätigung ihrer "Lebensunfähigkeits"-Ängste. Solange die
Sozialdemokraten in der Regierung saßen, war dies mehr eine ideologische Sache.
Abgesichert wurde dies durch jene Machtpolitik, welche etwa Theodor Körner für den ihn
interessierenden militärischen Bereich aus der Nähe beobachtet und so lebendig beschreibt
(Körner 1977). Die Verfassungsreform von 1929 war der Versuch, diese Verschiebung in
den sozialen und vor allem politischen Kräfteverhältnissen unter ständigen Putschdrohungen vonseiten der Heimwehren legalistisch festzuschreiben. Die Bauern als in Österreich
mächtige soziale Kraft waren bisher passiv geblieben. Mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise traten sie mit ihren Aspirationen auf den Plan. Sie wurden zur wesentlichen
Massenstütze des Austrofaschismus. Doch auch sie begannen nach Deutschland mit seiner
bauernfreundlichen Politik, welche die NS-Gleichschaltung schon im Jahr 1933. dort völlig
reibungslos ablaufen ließ, obwohl doch die Bauern vorher parteipolitisch eher anders
orientiert gewesen waren.
Doch die Konservativen versäumten es ebenfalls, eine nationale Identität aufzubauen. Der
"österreichische Mensch" ("im zweiten deutschen Staat") war kein Ersatz dafür. Das
Hauptanliegen der Konservativen war die Machterhaltung, und die war nur in Unabhängigkeit vom brutalen Macht- und Gestaltungswillen des NS-Staates möglich. Das sollten
nach dem Anschluss auch manche illegale Nazis erfahren, welche eine gewisse österreichische Eigenständigkeit erwartet hatten (Jedlicka 1975).
Heimito von Doderer (5. September 1896 – 23. Dezember 1966) ist vielleicht die kennzeichnendste literarische Verkörperung des österreichischen Konservativismus der Zwischenkriegszeit und
unmittelbar danach. Aus einem großbürgerlichen Elternhaus (Vater Architekt und Bauunternehmer) von habsburgisch-patriotischer Gesinnung stammend, hatte er die Annehmlichkeiten dieser
sozialen Schicht eindrücklich kennen gelernt, als man ihm – dem Sohn aus gutem Haus – trotz
völligen Versagens die Matura schenkte. Doch das väterliche Vermögen ging verloren wie die
Vermögen so vieler anderer, welche die Dummheit begingen, es in Kriegsanleihen anzulegen und
Gold für Eisen gaben. Seinem nach außen getragenen Selbstbewusstsein tat dies keinen Abbruch.
Doch das kam mit seiner realen Stellung in diesem Österreich und auch mit seinem vorerst äußerst
bescheidenem Erfolg in Widerspruch. Die Folge war, dass er sich bereits 1933 den Nazis
anschloss. Da er allerdings auch dort trotz Übersiedlung ins "Reich" keineswegs die gewünschte
Förderung erhielt, wird er in der Nachkriegszeit die erfolgreicheren Nazis als proletenhafte Typen
porträtieren. 1940 zum Katholizismus konvertiert, bedeutet dies keineswegs den Verzicht auf seine
sexuellen und sonstigen Perversionen, wie er sie in den "Dämonen" so liebevoll wie langatmig
beschreibt. Das Verständnis des Konservativen für die sozialen und politischen Probleme seiner
Zeit war begrenzt. Ein literarisch tatsächlich einsamer Höhepunkt findet sich in einer Passage im
Verlauf seiner Schilderung des Brandes des Justizpalastes: Ein Praterstrizi lebt seinen Hass auf die
Polizei dadurch aus, dass er bei ihrem Einsatz gegen die demonstrierenden Arbeiter mit einer
Drahtschlinge durch einen Kanaldeckel hindurch immer wieder einen Polizisten zum Straucheln
bringt, bis ihn schließlich ein Offizier erschießt: Der Widerstand gegen ein unmenschliches und
autoritäres Regime und seine Helfer in der Justiz wird also zur Verrücktheit eines
117
Kleinkriminellen. Wenn er allerdings die Emanzipation seines Muster-Arbeiters damit beginnen
lässt, dass dieser sich einen Liber Latinus aus zweiter Hand kauft und Latein lernt, könnte er sich
dabei auch mit gar nicht so wenigen Sozialdemokraten treffen, welche das "Bildung macht frei"
auf eine ähnlich verspießerte Weise verstanden.
Dies war der eine Zweig des Konservatismus. Der zweite manifestierte sich in einem unglaublichem Provinzialismus, der sich bald “nicht erst missbrauchen lassen [musste], um ins Bild der
politischen Entwicklung zu passen” (Paul Jandl), nach dem Anschluss nämlich.
Franz Karl Ginzkey (8. Sept. 1871 – 11. April 1963) kam im Gegensatz zu Doderer aus kleineren,
aber keineswegs armen Verhältnissen: In seinen durchaus etwas schwülstigen „Lebenserinnerungen – Reise nach Komakuku“ versucht er zwar, sich eher „von unten“ darzustellen. Doch sein
Vater – seine Mutter kommt nicht mit einem Wort vor – hatte immerhin studiert und war offenbar
als Angestellter der Marine in Pula auch materiell wohl versorgt. Durch das ganze Buch, in
Wirklichkeit keineswegs eine Autobiographie, sondern eine Anekdotensammlung aus seinem Leben – zieht sich gewissermaßen ein mythisches Raunen. Die „Pflicht des Bluts“ ist jedenfalls ein
„unerbittliches Naturgesetz“. Seine prägende Erfahrung schon als Kind war die Zugehörigkeit zu
einer herrschenden Nation, der „Stolz des mir (!) zugehörenden großen Reichs“. Als nicht sonderlich erfolgreicher aber recht submisser Angehöriger der Armee mit ihren oft grotesken Verhaltensmustern fand er dort doch eine Heimat. Dies kommt auch in seinem autobiographischen
Roman „Jakobus und die Frauen“ sehr klar heraus. In beiden Büchern erkennt man aber besonders
deutlich auch die habsburgische Armee als feudale Institution: Die jüngeren Offiziere konnten von
ihrem Beruf kaum leben, und doch erwartete man von ihnen ein herrschaftliches Auftreten mit
einem entsprechenden Lebensstil. Die literarische Qualität dieses Romans ist nur mit dem Ausdruck „schwülstiger Kitsch“ zu kategorisieren. ‚Wenn ein Autor bei fast keinem Substantiv ohne
epitheta ornantia auskommt, ist dies bereits ein Alarmzeichen. Wenn diese epitheta hauptsächlich
aus einem beschränkten Thesaurus wie „selig“, „still“, „zart“, „rein“, „berauschend“, „edel“, usf.
bestehen, dann erkennt man, dass sich ein Möchtegern-Literat sogenannte hohe Literatur angelesen
hat.
Bereits in der Zwischenkriegszeit war er Nazi. Denn er zählte sich ja doch zu den „feiner organisierten“ Menschen. Nach dem Krieg hat ihm dies nicht geschadet: Er erhielt das Große Österreichische Staatspreis und das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst (beides
1957). Als drei Jahrzehnte später seine Stellung und seine Ehrungen lokal thematisiert wurden – in
Seewalchen sollte eine Hauptschule nach ihm benannt werden, und dagegen gab es Widerstand,
jedoch kaum aus dem Ort – , waren es diejenigen, die sich dagegen aussprachen, welche gefährdet
waren.
Karl Heinrich Waggerl (1897 – 1975) hat sein Leben in Salzburg, fast zur Gänze in Wagrain,
heute ein Markt von deutlich über 3.000 Einwohnern, verbracht. Gehört ein Schriftsteller deswegen zur Provinz, weil er in einem Bundesland außerhalb Wiens lebt? – Was aber ist, wenn dieser
Schriftsteller selbst im deutlichen Anti-Wien-Ressentiment, bei allem Selbstgefühl ein gewisses
Bundesländer-Minderwertigkeitsgefühl erkennen lässt? Er lebte das Ressentiment gegen die intellektuelle Vernunft in den ihm so widernatürlich erscheinenden Ballungsräumen der Städte (vgl.
Müller 1997). In einem Brief an den „Kurier“ im Jahr 1962 erregt er sich, dass er „weit lieber
einen ganzen Gartenzwerg fräße“, als sich als „Heimatdichter“ katalogisieren zu lassen, und
schlägt vor, ihn einfach nicht zu beachten, wie es ja Wien auch sonst täte. – Aber hier haben wir
das Problem: Er hat wesentlich mehr Format als ein „Heimatdichter“ – aber er hat eine ganze
Menge geschrieben, das nur so einzuordnen ist, mehr jedenfalls als die literarisch qualitätsvollen
Texte ausmachen. Ähnliches könnte man nun von bald einem Schreiber sagen. Das Problem bei
Waggerl ist nur, dass er diese Texte offenbar mit derselben Überzeugungskraft schrieb und sodann
verteidigte. Er ist also ernstzunehmender Literat und anspruchsloser „Heimatdichter“. Auch in
seinen besseren Texten ist die Grundhaltung ziemlich klar. „Brot“ stellt dem modernen Kapitalismus eine kosmische Weltsicht gegenüber, wo aber das gute Leben aus dem Boden wächst,
118
„wie das Korn, wie alles was lebt auf Eben“ [dem Hof, wo der Roman spielt]. Und dagegen steht
„die weite Welt, … wie ein Abgrund, sie lacht und zieht“, und verschlingt denn auch den Halbbruder des jungen Helden, der eben nicht der Sohn des Alten ist, sondern nur ein lediges Kind
seiner Mutter. Es gleicht sehr der Blu-Bo-Literatur. Auch die bewusst naive Stilistik – „seht ihr“ –
tut das Ihre dazu. Diese zwei Naturen machen ihn in gewisser Weise zu einer Verlegenheit gerade
für jene, die ihn (auch) schätzen. In diesem Sinn ist er nicht sosehr verschieden von Rosegger.
Doch Waggerl ist in noch einer Beziehung eine Verlegenheit. Er war 1939 Landesobmann der
Schriftsteller im NS-Gau Salzburg und wurde von den Nazis 1940 zum Bürgermeister von Wagrain ernannt. Er selbst bestritt später, auch NSDAP-Mitglied gewesen zu sein, wies mehrfach
darauf hin, dass einige seiner Bücher im Reich verboten gewesen seien, scheute sich aber, sein
Verhältnis zu den Nazis klar zu stellen. In diesem Sinn – und das ist sicher nicht zufällig – erinnert
er an sein Vorbild Hamsun, dessen widerlich-eifernde Begeisterung ihm allerdings fremd gewesen
sein dürfte. Es war übrigens Ginzkey, der ihn am Anfang seiner Schriftsteller-Laufbahn unterstützte. Da war es ihm nicht so wichtig, welchen Antirationalismen er diente, einem austro- oder einem
nazifaschistischen. 1934 erhielt er den “Großen Österreichischen Staatspreis, nach dem Anschluss
aber war von den Nazis eingesetzter Bürgermeister von Wagrein. Doch schon 1947 ist er wieder
im österreichischen Heimatbuch vertreten. Wenn er aber sich in Briefen in die BR Deutschland mit
„Heiner“ unterschreibt, biedert er sich damit nicht wirklich an? Es war nicht so, dass die reaktionäre Seite im Nachkriegsösterreich nicht gewusst hätte, mit wem sie es da zu tun hatte. Ein Teil
davon kann offenbar bis heute nicht darauf verzichten (Pichler 1997).
Erst nach dem Machtantritt Hitlers setzten die beiden großen Lager auf Eigenstaatlichkeit.
Die Sozialdemokraten dachten weiter deutschnational. Manche katholische Kreise versuchten aber, die ethnische und nationale Identität der Österreicher und dem Etikett des "österreichischen Menschen" zu thematisieren. Doch im Rahmen der austrofaschistischen Diktatur musste dies ein durchsichtiger Legitimierungsversuch eines brüchigen Regimes bleiben.
Denn andere wiederum waren so großdeutsch – und zwar nicht aus emanzipativen Gründen
– wie auch die Sozialdemokraten. Als Kardinal Innitzer nach dem deutschen Einmarsch die
Entscheidung der österreichischen Bischöfe, für den Anschluss stimmen zu wollen,
mitteilte, da war sein handschriftliches "Heil Hitler!" möglicherweise eine opportunistische
Entgleisung. Doch die Entscheidung selbst stand durchaus in seiner auch persönlichen
Tradition: War er doch etliche Jahre früher als offizieller Festredner der Universität Wien
für den 18. Jänner, den Gedenktag der Gründung des Deutschen Reiches 1871 aufgetreten.
Und was den Nazismus betrifft: Der Bischof Hudal trat ganz offiziell als Propagandist für
eine Versöhnung zwischen Katholischer Kirche und Nationalsozialismus auf und versuchte, diese seine Gedanken und Argumente in Österreich unter ein aufnahmebereites Publikum zu bringen.24 "So kam es, dass gut zwei Drittel des Volkes Hitler vor Schuschnigg
den Vorzug gaben" (Renner 1946b, 24).
3.2.3 Heimat Partei
24
Hier fiel dem Verfasser vor Jahren ein Kuriosum in die Hände. Hudal wollte ein Buch mit seinen Ideen
("Katholische Kirche und Nationalsozialismus") in Wien beim Verlag Wilhelm Braumüller herausbringen.
Doch zum einen gab es wirtschaftliche Maßnahmen des Deutschen Reiches gegen Österreich, zum
anderen konnte der vom Verlag verlangte Druckkostenzuschuss nicht überwiesen werden. Somit entschied
sich der Verlag, das bereits in Satz vorliegende und vollständig umbrochene Buch nicht herauszubringen,
sodaß ein Exemplar als Unikat viele Jahre später erst bei der Liquidierung der Druckerei Jasper
auftauchte, die den Satz hergestellt hatte. Das Buch wurde übrigens dann in einem Verlag des Deutschen
Reiches doch noch veröffentlicht.
119
"Der Sozialismus war für mich und meine Generation nicht allein eine Idee, sondern vielmehr eine Lebensform, die ihre Erfüllung in der Tätigkeit innerhalb der Arbeiterbewegung
fand. Diese Wirksamkeit war mir eine Quelle höchster Beglückung... Die Intensität dieses
Gemeinschaftslebens erzeugte eine neue psychologische Haltung der Massen... Die Zahl
der Männer und Frauen, die im reichverzweigten Organismus der Arbeiterbewegung
verantwortliche Aufgaben erfüllten, ging in die Zehntausende. Ihre Stellung in der
Bewegung verlieh ihrem Dasein neue Bedeutung und erfüllte ihr Leben mit einem neuen
Inhalt. Ihre Aktivität war nun nicht mehr in die engen Schranken der Erwerbsarbeit und der
Familie gebannt; sie fanden ein weites Gebiet der Wirksamkeit in sozialen Organisationen.
Die Isolierung der Werkstätte und der Familie entbunden, fühlten sie sich als wirkende
Glieder einer Bewegung von Millionen gleichgesinnter aller Länder" (Braunthal 1964, 16f.
und 248).
In Worten wie diesen, welche religiöse Sentimente mit einer Beschreibung mischen, wie
sie häufig von Nationalisten für ihre Nation verwendet wurde (und wird), beschreibt nicht
nur der Funktionär und AZ-Redakteur Braunthal seine Gesinnungs- und Lebensgemeinschaft. Sehr ähnlich, allerdings bereits etwas ironisch und recht distanziert, lautet
die Beschreibung, die Josef Buttinger (1953) von manchen seiner Genossen liefert. Die
Partei und ihre Vorfeldorganisationen lieferte also für einen erheblichen Teil der
Österreicherinnen und Österreicher damals jene Geborgenheit und jenes soziale Netz,
welches sie sowohl von ihren materiellen Interessen wie auch von ihrer emotionalen Lage
her bedurften. Sie sollte damit jene umfassende Einheit sein, welche ihnen Österreich nicht
anbieten konnte - zum einen, weil eine Nation diese angestrebte Gemeinschaftlichkeit in
diesem Ausmaß nie aufbringen kann, obwohl man das damals illusorisch erwartete. Zum
anderen aber bot die Partei Partizipation und Identifizierung mit einem politischen Projekt,
dem man in weiten Kreisen tatsächlich millennarische Qualität zuschrieb - Braunthals
autobiographische Notizen tragen im Unterschied zu Buttingers Abrechnung mit seiner
Partei keinerlei ironischen Ton mit sich. Das politische Projekt Österreich hingegen war in
der Ersten Republik das gerade Gegenteil davon und schleppte zusätzlich durch seinen
Namen die Erinnerung an ein System mit sich, welches für die Sozialdemokraten gerade
auch im nachhinein das eigentliche Symbol von Reaktion geworden war. Die Partei trat
also sowohl als Ersatznation wie auch als Ersatzreligion auf und war damit
selbstverständlich überfordert.
Die Christlichsozialen hatten es in dieser Beziehung leichter. Zum einen waren sie an der
Macht und konnten ihre Vorstellungen durchsetzen. Zum anderen brauchten sie als Partei
zumindest nicht selbst jene umfassenden chiliastischen Ambitionen mit sich schleppen betrachteten sie sich doch selbst vielfach nur als politische Vorfeldorganisation der
Römischen Kirche. Gemeinsam war aber den Parteien, dass sie auf eine subnationale
Identität setzten, welche in ihrer eigenen Sicht im Verdrängungswettbewerb gegen die
beunruhigenden und auch unklaren nationalen Identitäten stand.
Möglicherweise ist dies ein für die Stufe bzw. den Aufbau der Massenpartei ein kaum zu vermeidendes Phänomen. Wenn in den letzten zwei Jahrzehnten Prozesse des De-Alignment stattgefunden haben, dann ist dies u. a. auch dem Verlust an Partei- oder Lagermentalität oder besser
-identität zuzuschreiben, der seinerseits eine Zunahme von Nationalisierung belegt. Die
Grundlagen dieser Identität, vor allem die bewusste ideologische Ausrichtung, sind weitgehend
geschwunden. Da dem pragmatisch auch die Politik folgte, muss die Parteiidentität zumindest bei
jenen schwächer werden, welche nicht mehr in die Heimat Partei hineinsozialisiert wurden. Wenn
120
Parteien nur mehr Dienstleistungsunternehmen sind, welche mehr oder weniger kompetent
dieselbe Politik verfolgen, gibt es auch keinen Grund für Parteiloyalität mehr.
121
3.3 Die Zweite Republik
Die Sozialdemokraten waren seit dem Ende Österreichs in der nationalen Frage gespalten.
Noch als Schuschnigg seine Volksabstimmung ankündigte, war die Zustimmung der Sozialdemokraten keineswegs klar, und sie versuchten noch in Verhandlungen ihre Anliegen
für eine Zustimmung einzusetzen. Über die Floridsdorfer Konferenz der Sozialdemokraten
unmittelbar vor dem Anschluss schreibt Olah (1995, 70), wie wenig bereit selbst in einer
solchen Situation direkt vor dem Abgrund ein erheblicher Teil der Arbeiter war, dem
Regime einen Vertrauens-Vorschuss zu geben: Nur "die Kommunisten gebärdeten sich als
die Oberpatrioten und waren für die bedingungslose Unterstützung der Regierung Schuschnigg", blieben aber in der Minderheit. Mag im Ton auch der neurotische Antikommunismus des späteren Prügelgardisten der Amerikaner mitspielen, so ist die Aussage
selbst keineswegs aus der Luft gegriffen. Auch Kreisky (1996, 230) wird noch wenige
Monate vor seinem Tod resummieren: "Das klägliche Zwischenspiel des Austrofaschismus
... (trieb) die Menschen nur noch stärker dem Nationalsozialismus zu. Der unmittelbare
Gegner, der auf die Sozialdemokraten schoss, der uns vernichtete, gegen den wir kämpften,
das waren die Kleriko-Faschisten. Das erklärt auch, warum die Österreicher eine so zwiespältige Haltung eingenommen haben, bis in unsere Zeit." Es wäre es wert, dem letzten
kleinen Zusatz weiter nachzugehen... Doch noch einmal Olah (1995, 33), der vermutlich
die Stimmung der Basis nicht schlecht wiedergibt: "Dieser österreichische 'Faschismus' war
zwar etwa schwächlich und nicht so grausam, dafür aber kleinkariert, schäbig und bösartig."25 Wenn man seit damals immer wieder anklägerisch und gleichzeitig entschuldigend
darauf hinwies, dass außer Mexiko und der UdSSR alle anderen Staaten der Welt den
Anschluss ohne Protest hingenommen hätten, so muss man doch wohl korrigieren: Die
österreichische Regierung hat dies durch ihre Politik der 30er Jahre – zwischen MussoliniAdoration und Hitler-Unterwürfigkeit – weitestgehend selbst verschuldet (Hagspiel 1995).
Im Grunde entlarvt dies alles jenen Blick auf den Austrofaschismus, der diesen als “Abwehrkampf” gegen Hitler sehen will, als pure und durchsichtige Rechtfertigungsideologie. Umso
erstaunlicher ist es, dass man diese abgedroschenen Phrasen plötzlich auch aus dem Ausland hören
kann. In einer Artikelserie in der NZZ hören wir plötzlich aus München dieses alte Lied. 26
Offenbar kam es einem Bedürfnis entgegen, denn es gab ein lebhaftes Echo. Es ist nicht leicht zu
durchschauen, was dahinter steht. Die Vermutung ist nicht weit hergeholt, daß das österreichische
Ständestaats-Regime in seinen Grundwerten tatsächlich von einigen Christlich-Konservativen, die
sich mit der modernen Demokratie nicht abfinden können, noch aufrecht verteidigt wird. Damit
wäre Geschichte wieder einmal auf ihre politische Grundfunktion gebracht: Streit um die
Gegenwart und die Zukunft in den Bildern der Vergangenheit.
25
Es ist nicht ohne Ironie, doch kennzeichnend für Olah und seine Stellung bis in die Gegenwart, dass der
Verlag, in dem seine Memoiren erschienen, im Anschluss an den Text ein Buch der Dollfuß-Tochter
Eva bewirbt, in dem sie nach der konservativen Sprachregelung ihren Vater wieder einmal nicht nur
als Hitlers erstes Opfer, sondern als den potentiellen Retter Österreichs darstellt...
26
Auf einen eher kritischen Artikel aus Zürich (Paul Schneeberger, 1938 bis 1945 – langes Nachwirken von
Österreichs ‘Opferstatus’. 7. 1. 1999) kam aus München die konservative Auffassung (Gottfried-Karl
Kindermann, Österreich, Hitler und die Pharisäer. 14. 1. 1999). Daran schloss sich ein weiterer
Schlagabtausch der beiden Autoren (19. 3. 1999) und in derselben Ausgabe eine Auswahl von
Zuschriften, u. a. von Heinz Kienzl. Ähnliches wiederholte sich im Jahr 2004, Gedenkjahr für 1934
und den 20. Juli 1944.
122
Gleichzeitig orientierte sich die kleine Kommunistische Partei, deren Einfluss aber in der
Illegalität wuchs, entschieden auf eine eigenständige österreichische Nation. Der einzige
nationale Entwurf, jener des Alfred Klahr und damit von Teilen der KPÖ, ging schon damals unter. In der Zweiten Republik wurde Klahr dann durch die zuerst Marginalisierung
und dann Ächtung der KPÖ endgültig zur Unperson, zumal er sich in seinen Überlegungen
auch noch auf Stalin stützt. Trotzdem waren seine Überlegungen den späteren Publikationen z. B. eines Ernst Fischer theoretisch weit voraus.
Eine der letzten Wortmeldungen Otto Bauers im Jahr 1938 scheint auf die Bejahung
zumindest einer Eigenstaatlichkeit für Österreich hinzudeuten. Die Sozialdemokraten im
Exil, vor allem das Londoner Exil, hatte keinen Kontakt mit der Bevölkerung und glaubten,
noch immer eine großdeutsche Lösung anstreben zu müssen. Anders war es in Österreich
selbst. Hier gibt es die mittlerweile vielzitierte Stelle bei Schärf (1955, 20), die allerdings
zehn Jahre nach dem Kriegsende erst geschrieben wurde. Als ihn ein deutsche
Sozialdemokrat, Wilhelm Leuschner, 1943 aufsuchte und Vorschläge für das künftige
Vorgehen zu machen begann, habe er, Schärf ihm plötzlich spontan widersprochen: "Ich
unterbrach meinen Besuch unvermittelt und sagte: 'Der Anschluß ist tot. Die Liebe zum
Deutschen Reich ist den Österreichern ausgetrieben worden. Ich kenne von meinem Beruf
her manche Frau und manchen Mann, die aus Deutschland nach Wien gekommen sind, und
die ich schätzen gelernt habe, ich sehe aber den Tag vor meinen Augen, an dem die
Reichsdeutschen aus Österreich vertrieben werden wie einst die Juden." Sein Besucher war
verstört. Doch Schärf berichtet weiter, dass auch manche konservative Gesprächspartner, er
nennt hier Hurdes, konsterniert waren, als er ihnen dieselbe Meinung sagte.
Alfred Klahr "wurde am 16. November 1904 geboren, wuchs in der Leopoldstadt unter wenig
begüterten, kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Vater, Angestellter der israelitischen
Kultusgemeinde, ermöglichte ihm den Besuch der Mittelschule, wo er bald mit sozialistischen
Ideen Bekanntschaft machte und der Vereinigung sozialistischer Mittelschüler beitrat. Von dort
fand er unter dem Einfluss seines älteren Freundes Franz Quittner gemeinsam mit anderen den
Weg zum kommunistischen Jugendverband. Ungeachtet seiner vielseitigen Interessen maturierte
Klahr 1923 mit Auszeichnung, inskribierte an der Wiener Universität Staatswissenschaften und
hörte Vorlesungen bei Karl Grünberg, Max Adler und Hans Kelsen, bei dem er 'über das
Verhältnis von Parlament und Regierung in parlamentarischen Republiken' dissertierte... Da Klahr
eine wissenschaftliche Laufbahn verwehrt war, wurde er kommunistischer Journalist... Nach einem
mehrmonatigen Zwischenspiel im Polizeigefängnis Rossauerlände ('Liesl') emigrierte Klahr [1934]
nach Prag... Belgien... Paris... Vichy-Frankreich... Schweiz... Die Schweizer übergaben ihn der
Vichy-Polizei.... Er wurde der GESTAPO übergeben und im August 1942 zur letzten Station
seines Lebens transportiert: nach Auschwitz." 1944 gelingt ihm die Flucht, doch er wird in
Warschau aufgegriffen und erschossen (Filla 1988).
Die Okkupation Österreichs seitens der Nazi-Truppen entschied vorerst die Frage. Der
deutsche Einmarsch hatte anfangs wirtschaftlich sehr positive Effekte und dürfte dem
entsprechend in der ersten Zeit weitgehend auf die Zustimmung der Bevölkerung gestoßen
sein, mit Ausnahme der direkten Opfer selbstverständlich. Innerhalb weniger Monate fiel
die Arbeitslosigkeit auf die Hälfte. Doch nicht nur die vorher Arbeitslosen, auch das Provinzbürgertum muss den Anschluss massiv optimistisch erlebt haben. Die Bauernschaft
wurde ebenfalls vorerst gehätschelt. Für viele Bauern rettete die "Entschuldung" wenige
Wochen nach dem deutschen Einmarsch sogar den Hof; ein von den neuen Machthabern
123
geförderter Technisierungsschub eröffnete neue Perspektiven, und ideologisch versuchte
man sie mit dem Blut-und-Boden-Mythos auch noch zu verwöhnen (Mooslechner/Stadler
1986; auch: Gies 1984). Bald allerdings begannen die "Reichsdeutschen" der Bevölkerung
vor Augen zu führen, was eine periphere Rolle wirklich bedeutet; daß man davor auch
nicht gefeit war, wenn man deutsch sprach. Als Österreich 1945 wieder entstand und nun
eine radikal andere Wirtschaftspolitik betrieben wurde, war damit die Voraussetzung für
einen eigenen Nationenaufbau gegeben. Die Bejahung einer eigenen nationalen Identität
folgte.
Nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft schienen allerdings die Nazis noch einmal
einen geistigen Sieg zu erringen: Das Zerbröseln ihres Systems und die letzten Kriegsbzw. die ersten Nachkriegswochen wurden von einem ganz erheblichen Teil der Bevölkerung mit Augen gesehen, wie sich die NS-Propaganda es nur wünschen konnte. Kennzeichnend dafür ist nochmals Schärf in seinem schon zitierten Erinnerungswerk (1955, 26
ff.): Über die Gräuel der Nazis geht er mit ganz wenigen Sätzen hinweg. Doch die Opfer
der Befreiung / Besetzung, insbesondere, soweit sie von der sowjetischen Armee verschuldet wurden, listet er minutiös auf. Dabei fällt ihm bei seiner Zahlenklauberei gar nicht auf,
dass diese Opfer in keiner Weise zu vergleichen waren mit den Hekatomben von Leichen,
welche die deutsche Besatzung verlassen hatten. Bei Schärf hatte dies natürlich einen präzisen parteipolitischen Sinn, denn er identifiziert indirekt die KPÖ mit “den Russen”. Doch
es stellt sich die Frage, warum dies die Bevölkerung so erlebte. Zum einen war dies
natürlich die traumatische Erfahrung, wie die Front, die bisher weit weg war, plötzlich über
Österreich darüber rollte. Gewalt und Tod wurden plötzlich sehr reale und alltägliche Erlebnisse. Zum anderen aber war es auch die von den Nazis erzeugte psychotische Stimmung gegen die “asiatischen Horden”.
In diesem Zusammenhang berichtet Schärf ein Detail (S. 40), das im Zusammenhang mit der
damaligen Stimmung viel sagt – und doch fast unfassbar ist. Abtreibung war bekanntlich ein TabuThema für Konservative. Nun gab es bekanntlich eine Reihe von Vergewaltigungen beim
Einmarsch der Siegermächte. Und hier erzählt nun der Vizekanzler über Die Lage in Niederösterreich: Es “tauchte immer wieder das Begehren auf, Ärzte zu beauftragen, an den von den
Russen vergewaltigten Frauen die Unterbrechung der Schwangerschaft durchzuführen - nicht
einmal streng katholisch gesinnte Ärzte haben sich damals diesem Wunsch widersetzt.” Man muss
dies im damaligen Zusammenhang einmal richtig nachfühlen. Es bedeutet nichts anderes, als dass
der Begriff der “Russen” als Untermenschen der Bevölkerung wirklich in Fleisch und Blut
übergegangen war. Denn es geht ja nicht um Vergewaltigungsopfer schlechthin – es geht nur um
von “Russen” vergewaltigte Frauen.
Doch die nationale Situation war komplett verschieden von jener in der ersten Nachkriegszeit. Die Österreicher hatten sieben Jahre lang erfahren, was Abhängigkeit bedeutete.
Außerdem schien es überlebensnotwendig, sich von der deutschen Katastrophe abzukoppeln. Als sich gegen das Ende des Krieges die Kampfhandlungen auf das österreichische
Gebiet hinzogen, war sich zumindest jene Personengruppe über die Notwendigkeit einer
österreichischen staatlichen, noch nicht unbedingt auch der nationalen, Selbständigkeit
einig, die bald die Führungsgruppe der Repulik stellen sollte. Die politische Führung, vor
allem die konservative ÖVP und die KPÖ, zog die Konsequenzen. Die SPÖ zögerte noch.
Nun drängte die politische Führung der überfahrenen Bevölkerung, die viele Jahre
deutschnationaler Indoktrination nicht leicht vergessen konnte, in einer völligen
Kehrtwendung eine eigene Nationalität auf. Es sollte etwa eine Generation dauern, bis
diese Operation glückte. 1957 war noch die Mehrheit der Österreicher davon überzeugt,
124
keine eigene Nation zu sein. 20 Jahre später hatte sich die Meinung massiv verkehrt. Die
Eigenstaatlichkeit ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für den Aufbau
einer eigenen Nation. Ebenso wichtig war die Möglichkeit, sich mit diesem Staat
identifizieren zu können, und dazu müssen die eigenen Interessen berücksichtigt wurden.
Tab. 3: Wachstumsraten in der Zweiten Republik (jährliche Durchschnitte)
Wachstumsraten
Wachstumsraten der österreichischen Wirtschaft
in %
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1946 bis
1950:
1950 bis
1962
1962 bis
1967
1967 bis
1984
1984 bis
1995
Quelle: 1946 bis 1984 nach Daten aus Butschek 1985, Stat. Übersichten 10/1996
Die wirtschaftlichen Probleme waren vorerst gigantisch. Das Land musste erst wieder als
eigener Wirtschafts- und Währungsraum konstituiert und von Deutschland abgekoppelt
werden. Da sich die Besatzungszonen wie selbständige Außenhandelsgebiete verhielten,
mussten sie erst neuerlich integriert werden. Durch eine strenge Bewirtschaftung der
lebensnotwendigen Güter konnte die Versorgung notdürftig sicher gestellt werden. Die
Inflation blieb einigermaßen unter Kontrolle. Der Wiederaufbau kam schnell in Gang, und
sein Tempo beschleunigte sich. Schon 1949 wurde gesamtwirtschaftlich praktisch das
Vorkriegsniveau erreicht. Damit begann auch ein von hoher Auslandshilfe (ERP-Mittel)
erfolgreich gestütztes stetiges Wachstum. Die Frage der Lebens(un)fähigkeit kam gar nicht
auf.
Allerdings ging dies zumindest anfangs auf Kosten vor allem der Arbeiter. Die Lohn-PreisAbkommen ab 1946 bewirkten eine Ruhigstellung an der sozialen Front. Im Nebeneffekt
dienten sie auch noch der Ausgrenzung der KPÖ. Sie hatte sich gegen diese Politik des
Verzichtes zugunsten der besser Gestellten sowie der Bauern gewandt. Insbesondere die
Oktoberstreiks des Jahres 1950 waren hier entscheidend. Der SP-Führung gelang es rasch,
die Proteste der Arbeiter – die übrigens von der sowjetischen Besatzungsmacht ebenso ungern gesehen und behindert wurden – als versuchten kommunistischen Putsch darzustellen.
Diese Version erlangte in den Massen Glaubwürdigkeit infolge der Geschehnisse in den
Nachbarländern und wurde seither zum Dogma. Nach dieser Niederlage war die KPÖ und
die Linke in Österreich überhaupt marginalisiert.
Trotzdem verfolgte die Führung in politischer Hinsicht nun eine völlig andere Politik: Man
band die Arbeiter bzw. Lohnabhängigen generell im Rahmen einer hochexpansiven Politik
in Gesellschaft und Staat ein. Damit wurde diese breite Schicht zum ersten Mal in
Österreich in ihrem eigenen Bewusstsein staatstragend. Zwei Unterschiede zur BRD waren
entscheidend. Zum einen war von Anfang an die Sozialdemokratie im Rahmen einer
großen Koalition Regierungspartner, wenn auch die Hegemonie der Konservativen außer
125
Zweifel stand. In der BRD gelang es den ersten Wahlsiegern, der CDU/CSU, die
Sozialdemokratie einige Male nahezu an den Rand der Legalität zu drängen und damit
auch die Ansprüche der Arbeiterschaft zu delegitimieren – das war die eigentliche Rolle
des KPD-Verbotes.
Österreichisches Nationalbewußtsein:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Die Österreicher
sind eine Nation
... beginnen sich
lansam als Nation zu
fühlen
sind keine Nation
1993
1990
1989
1987
1980
1979
1977
1972
1970
1964
1956
0%
keine Angabe
Quelle: Zusammenstellung Weninger 1991, Haller 1996
Weiters gab es in Österreich das Problem der Vertriebenen kaum. In der BRD hat diese
Gruppe wirtschaftlich und politisch eine wesentliche Rolle im Rahmen des neuen Staatsaufbau gespielt. Froh, überhaupt überlebt zu haben; nach dem Durchgang von Auffanglagern; folglich mit einem äußerst reduzierten Erwartungshorizont, waren sie bereit, unter
Bedingungen zu leben und zu arbeiten, welche den Arbeitgebern und der politischen
Führung ein restriktives und repressives Verhalten geradezu nahe legten. In diesem Sinn
war ihre Rolle nicht sosehr verschieden von jener der späteren "Gastarbeitern", die eine
vergleichbare, noch akzentuiertere Unterschichtung produzierten. Der wesentliche
Unterschied war ihre Integration als Staatsbürger. Diese machte sie zu jahrzehntelangen
Stützen einer extrem konservativen, ja reaktionären Politik. Österreich hatte aus
unterschiedlichen Motiven getrachtet, diese Schichten möglichst schnell und weitgehend
loszuwerden. Damit entfielen auch die damit verbundenen Probleme.
Schließlich begriffen in der zweiten Nachkriegszeit die Konservativen von Anfang an die
Notwendigkeit eines Nationenaufbaues sehr gut. Sie gingen von vorneherein in die
Offensive. Der Unterschied ist schlagend, wenn man die Funktionärsorgane der Regierungsparteien vergleicht, die "Österreichischen Monatshefte" (ÖVP) und die "Zukunft", die
sich im ersten Heft 1946 selbst als Nachfolgerin des "Kampfes" - und d. h. des linken
Flügels der Sozialdemokratie - definierte; schließlich auch noch "Weg und Ziel", da die
KPÖ noch nicht völlig marginalisiert war. Die ÖVP setzte voll auf die Eigennationalität.
Doch wir finden bei ihren Vertretern völlig ungebrochen die Seipel'sche Denkweise und
126
Sprache wieder, wie er sie 1916 verwendet hatte. Dabei setzten sie auch die klassischen
Versatzstücke des alten Nationalismus ein, deuteten sie aber leicht um. Die "Tausend
Jahre", die kurz vorher noch ein Zentralwort des Nationalsozialismus gewesen waren,
tauchen jetzt auf, um wieder die lange Tradition des alten, katholischen Österreichs zu
symbolisieren, also in einem latent antinationalen Sinn. Gerade die bei ChristlichKonservativen so oft verbreitete Haltung des Abstützens auf kleinräumige Identitäten
erleichterte ihr auch mental diesen politisch notwendigen Schwenk weg von der
Deutschtümelei. Die meisten wollten an ihre deutsche Jugend nicht erinnert werden.
Einige, die in ihrer Studentenzeit offenbar großdeutsch bewegt waren, bekannten sich
später im Alter mit dem Pathos der Anständigen wieder dazu: "Dieses Reich [von 1871]
haben in meiner Jugend nicht nur die Großdeutschen und wir bejaht" (Drimmel 1975, 176).
Doch wie es unnachahmlich bei Drimmel (1975, 12 f.) zu lesen ist, wenn er über seinen
Geburtsort spricht, dann klang das jetzt so:
"Soos ist mehr. Soos liegt nahe der uralten Grenze, die einmal die Staufenkaiser gegen den
Osten gewonnen haben. ... Für die Österreicher, die im Lande der Enns wohnen, für die
unterderennsischen Österreicher ist Österreich das Schicksal, dessen sie sich nicht
entledigen können. Dieses Schicksal liegt dem Bundesland der Republik Österreich ebenso
auf wie vordem dem Herzogtum, später Erzherzogtum Österreich und der ursprünglichen
Markgrafschaft. Die Prinzen des Hauses Habsburg heißen Österreich."
Manche der Jüngeren, wie etwa Karl Gruber, verwendeten dagegen die bisherige Sprache
in einer Unbekümmertheit, welche einen schon wieder erschauern lässt: Da wird "ausgerottet", "liquidiert" und "geistiger Imperialismus" beschworen. Man ist an die lingua Tertii
Imperii erinnert.27 Der „geistige Imperialismus“ ist allerdings noch älter. Bereits Hugo von
Hofmannsthal möchte ihn mitten im Ersten Weltkrieg propagieren, und zwar ausgerechnet
zur Abgrenzung gegen den deutschen Imperialismus. Dass sich eine neue politische Kultur
auch in einer neuen ausdrücken könnte, dürfte Gruber nicht einmal ansatzweise in den Sinn
gekommen sein. Die letzte Wendung vom "geistigen Imperialismus" ist übrigens nur die
vergröberte Version jener gerade im konservativen Bereich so oft beschworenen "Mission",
welche eine spezielle kulturelle Leistung für Österreich beanspruchte. Wieder einmal wurde "Kultur" zum Ersatz für "Politik", unter der man sich nur Großmachtpolitik vorstellen
konnte. Da man dies aber nunmehr als unmöglich und vielleicht auch gar nicht so
wünschenswert erkannte, musste man die eigene Größe in einer angeblich unvergleichlichen kulturellen Leistung suchen. Die Sehnsucht nach dem Besonderen als Kern
einer eigenen Identität hatte sich in den alten nationalistischen Mythen immer als
Machtentfaltung ausgedrückt. Nun setzten jene, welche einen neuen Mythos schaffen
wollten, an ihre Stelle eine behauptete kulturelle Hegemonie, etwa nach dem Motto: "Sind
wir schon keine politische Macht (mehr), so verkörpern wir zumindest die Macht des
Geistes". Dass es möglich wäre, einfach in Selbstbestimmung seine eigene Existenz zu
leben, ohne anderen über- oder untergeordnet zu sein, war offenbar ein Gedanke, der nach
dem Nazi-Wahnsinn besonders schwer zu fassen war (Den Topos der Kultur-Großmacht
finden wir übrigens selbst in Kreisky's posthumen Teil der Lebenserinnerungen wieder).
27
Irgendwie passt dazu ganz gut, dass man in der Todesursachenstatistik des Statistischen Zentralamts, wie
sie in den wieder erstandenen Statistischen Nachrichten der Nachkriegszeit veröffentlicht wurden, in
aller Nüchternheit ganz unten „gerichtlich angeordnete Hinrichtungen“ findet, und zwar 1945 119,
1946 37, 1947 33, 1948 15 und 1949 3.
127
Dieses quid-pro-quo von Kultur und Politik ist ein alter Trick des Nationalismus, der
gerade im deutschen Sprachraum eine lange Tradition hat (vgl. u. a. Reiterer 1994). Er
wird besonders gerne eingesetzt, wenn der Machtanspruch keine reale Grundlage hat. So
finden wir dies etwa ausgeprägt auch im Deutschen Reich der Ersten Nachkriegszeit: “Die
Demütigung, die das Deutsche Reich in Versailles hatte hinnehmen müssen, sollte durch
die Besinnung auf unvergängliche Werte, verkörpert in der Nation und in ihrer Geschichte
und Kultur, ausgeglichen werden” (Pape 1997, 54).
Darüber hinaus waren einzelne herausragende Führungsgestalten persönlich-biographisch
noch in der Monarchie und in ihrer katholischen Schulzeit verankert, in deren Zeit sie prägende sozialisierende Erfahrungen erhalten hatten. Das galt etwa für Julius Raab und dessen kurze, aber offenbar nachwirkende Offizierslaufbahn im Ersten Weltkrieg; in geringerem Ausmaß auch für Leopold Figl. Sie standen insbesondere den NS-Belasteten aus einem
konservativen Reflex heraus mit großem Misstrauen gegenüber: Der spätere ÖVPBundesobmann Karl Schleinzer wurde in Kärnten 1947 bei seinem ersten Aufnahmeantrag
an die ÖVP zurückgewiesen (Pisa, in: Dachs u. a. 1995, 513 ff.). Das geschah vermutlich
allerdings wohl noch me/hr wegen seines ungeklärten Verhältnisses zur Katholischen
Kirche als wegen seiner NS-Musterkarriere. Beinahe zur selben Zeit wurde immerhin
Joseph Klaus, der als Studentenfunktionär wüste antisemitische Hetze betrieb und dessen
Verhältnis zum Nationalsozialismus sicher nicht in Opposition bestanden hatte, der
vielmehr aktiv im katholischen Milieu und in Abstimmung mit dem Salzburger Erzbischof
die "Versöhnung" mit den Altnazis betrieb, beinahe aus dem Nichts Salzburger
Landeshauptmann: Als solcher betrieb er in den 50er Jahren stramm-konservative und
traditional-christliche Kulturpolitik (vgl. z. B. Klaus 1985). Noch im nachhinein werden
vereinzelte Exponenten diese strikte Antinazi-Politik der frühen Nachkriegszeit bedauern,
wie etwa Karl Gruber (Gruber 1988) und dessen damaliger Sekretär Fritz Molden. Dieser
konstatiert 1980 zwar den schlechten Eindruck, welche die mangelnde Entnazifizierung
nicht zuletzt auf das westliche Ausland machte, seufzt dann aber erleichtert: "Heute ist das
ja nun Gott sei Dank zum Großteil Geschichte und vorbei" (Molden 1980, 110). Er ahnte
damals noch nicht, daß dieses Geschwür wenige Jahre später noch einmal massiv
aufbrechen und die ganze österreichische Bevölkerung einer Zerreißprobe unterziehen
würde...
Die Gruppe, welche von diesen zwei Namen repräsentiert wird, ist nicht uninteressant.
Unter den späteren Politikern nannte man sie mit Abneigung und auch leicht verächtlich
die “45er”. Sogar in der späten Selbststilisierung hört man noch heraus, wie sehr ihnen ein
neues konservatives Projekt am Herzen lag, für welches sie grundsätzlich sogar unter
Umständen bereit gewesen wären, die Einheit Österreichs zu opfern. Vordergründig spielte
ein wilder Antikommunismus eine Rolle. Doch das war nur ein Deckblatt. Karl Gruber
gründete seine "Österreichische Staatspartei" (die bald in der Volkspartei aufging) als
Sammelbecken der "Liberalen, Monarchisten und aller, die von dem alten
christlichsozialen System nichts mehr wissen wollten" (Gruber 1988, 55 f.). Obwohl er
also die liberale Komponente betonte, war von einem zeitgemäßen Liberalismus gar nichts
zu merken. Nicht zufällig hatte Gruber eine auffällige Nähe zur Familie Habsburg. Es ging
eher tendenziell gegen die parlamentarische Demokratie: "Die Stimmung der Jugend war
gegen die Wiederbelebung der alten politischen Parteien" (a.a.O., 55). Gerechtfertigt wird
dies von seinem damaligen Mitarbeiter Molden (1980, 70 und 67) in kaum vorsichtigerer
Sprache mit dem Anspruch, als Widerstandskämpfer legitimere Ansprüche zu haben:
"Diese jungen Leute waren abseits politischer Ideologien mit viel Idealismus zum Kampf
128
gegen den übermächtigen Diktator und sein Regime angetreten, sie dachten dabei nicht an
politische Parteien, nicht an zukünftige Machtpositionen und auch nicht daran, nach
welchem Schlüssel die zurückzuerobernden Ämter aufzuteilen wären. Sie dachten im
Grunde nur an Österreich, das ihnen wie ein reichlich romantisches Traumbild à la
Wildgans vorschwebte... Auf breiter Front hievten die Politiker der alten Parteien sich
wieder in die Machtpositionen." Darauf folgt noch das Zugeständnis von der Naivität der
"Widerständler" und ihrer Verachtung für die "Systempolitiker und Parteisekretäre". Exakt
dieselbe Sprache findet sich schon 1964, als Molden glaubte, mit einem obskuren
Kandidaten für die Bundespräsidentschaft, einem ehemaligen Gendarmerie-General
namens Josef Kimmel, in die Innenpolitik eingreifen zu können: “ ... krebsartige
Krankheitszustände, ... ein spinnenwebartig das ganze Land überziehende System...” (aus
einem Wahlkampf-Blatt unter dem Titel “Neue Politik. Zeitschrift der Europäischen
Föderalistischen Partei Österreichs”).
Die Sprache, die wie direkt von den Nazis und ihren Verbündeten aus der Zwischenkriegszeit übernommen klingt und später von Kleinformat-Kolumnisten und Rechtspopulisten weiter entwickelt wurde, sagt viel über die politische Lokalisierung dieser
angeblich innovatorischen Jugend aus. Dass sie nicht allzu viel wirklichen Einfluss hatten,
hängt u. a. damit zusammen, dass ihre politischen Vorstellungen überhaupt nicht
konkretisiert waren und mehr in emotionalen Antipathien als in irgend welchen
erreichbaren Zielen bestand.
Die SPÖ dagegen war in der nationalen Frage gelähmt und gab von vorneherein die
Initiative ab. Die Sozialdemokraten versäumten damals schlicht das entscheidende
nationale Thema. Ihre eigentlichen Mythen hatten immer in ihrer Parteigeschichte, ihren
Erfolgen und ihren Niederlagen bestanden (Teibenbacher 1996). Das war aber kein
Identifikationsanbot für Menschen außerhalb der eigenen Kader. Der innerparteiliche Streit
um die Haltung zur nationalen Frage erlaubte zudem keine klare Stellungnahme. Auch hat
man den Eindruck, daß gerade die Linke der SPÖ gar nicht begriff, was sie versäumte. Sie
hielt die "österreichische Nation" wohl häufig für eine Parteimarotte der ÖVP, um die man
sich nicht zu kümmern brauchte. In den Jahren von 1946 bis 1948, in jenem Zeitraum also,
in dem die "Monatshefte" - wie übrigens auch "Weg und Ziel" - das nationale Thema zu
einem Schwerpunkt machten, sucht man in der "Zukunft" vergeblich auch nur nach einem
einzigen Artikel dazu. Dagegen war sie voll mit z. T. durchaus solide gearbeiteten
Beiträgen zu sicherlich wichtigen Einzelfragen, aber auch mit ideologischen, man kann nur
sagen: vulgärmarxistischen Artikeln von Karl Czernetz oder auch von Erwin Scharf und
Oskar Pollack. Die Integration in und die Identifikation mit dem neuen Staat stellte die
SPÖ auf andere Weise her. Da die Führungsgruppe noch in der alten Otto-Bauer'schern
Rhetorik verankert war, stellte etwa die Sozialisierung von Unternehmen für sie einen
wesentlichen politischen Symbolwert dar. Als daher mit Zustimmung der konservativen
Regierungspartei aus taktischen Überlegungen - man wollte die Betriebe des ehemaligen
"deutschen Eigentums" den sowjetischen Besatzern entziehen - ein ganz erheblicher Teil
der österreichischen Grundstoff- und Schwerindustrie verstaatlicht wurde, war dies für die
Sozialisten ein politisches Ereignis allerersten Ranges. Mit einem System dieser Art von
Mischwirtschaft konnte sie sich tatsächlich nicht nur abfinden, sondern identifizieren.
Darüber hinaus darf man nicht vergessen, daß die Verwaltung der öffentlichen Wirtschaft
natürlich auch eine Herrschaftsressource erheblichen Ranges darstellte. Die SPÖ war
entschlossen, sie zu nützen und tat dies dann auch in aller Konsequenz. Man erinnere sich
an den aussagekräftigen Slogan vom "Königreich Waldbrunner" – gewiss eine
129
konservative Polemik, doch mit viel Realitätsgehalt. Waldbrunner wird übrigens von
Kreisky (1988, 399), möglicherweise zu Recht, als die Verkörperung eines bestimmten
Modells langfristig angelegter Wirtschaftspolitik hochstilisiert, das auf Akkumulation
setzte – während Kamitz angeblich kurzfristige Konsum-Investitionen zum Eckpfeiler
seiner Politik habe machen wollen.
Kennzeichnend für die Haltung zur "Nation" und für die eigene nationale Option des
Großteils ihrer Führungs-Schicht war aber eine ganz bestimmte Haltung. Sie wird
verkörpert von einem Menschen, der sich vorwiegend als Politiker verstand, jedoch auch
einen intellektuellen Anspruch erhob. Karl Renner begann nach einigen tastenden
Versuchen (vgl. darüber Renner 1946) seine eigentliche schriftstellerische Tätigkeit - als
Parlamentsbeamter unter einem Pseudonym - mit einer Schrift über die nationale Frage. Er
wollte "das Reich" zugleich mit der Hegemonie der deutschen Führungsschicht erhalten.
Als Politiker nach dem Zusammenbruch der Monarchie am Ende des Ersten Weltkriegs
strebte er den Anschluss an das Deutsche Reich an, jedoch nicht so dogmatisch wie Otto
Bauer. Den Nazi-Anschluss begrüßte er freiwillig, ohne Druck, ohne dass ihn auch nur
jemand danach gefragt hätte. Ähnlich äußerte er sich wenig später überaus positiv zum
Überfall auf die Tschechoslowakei. Doch nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches
beeilte er sich, an den "lieben Genossen Stalin" zu schreiben und sich anzubieten. So
wurde er der erste Kanzler des neuen Österreich und dann der erste Bundespräsident. Noch
als Bundespräsident hatte er die größte Mühe, sich von seiner deutschnationalen
Vergangenheit zu lösen. Sein erster Versuch dazu lief schlicht darauf hinaus, daß Konzept
der Nation überhaupt fallen zu lassen. Das folgende lange Zitat (Zukunft, Sept. 1946, 1 - 3)
würde man kaum bei einem Menschen vermuten, welcher sich einmal theoretisch
klarsichtig mit dem Begriff der Nation auseinandergesetzt hatte:
"Wir stehen am Ende einer Kulturperiode, die aus dem Chaos der Rassen und Konfessionen feste und geschlossene Gebilde heraus gearbeitet hat in den geschichtlich gewordenen
nationalen Staaten, die mit dem rechtlichen Merkmal der Souveränität ausgerüstet sind.
Dies ist das Gestern. Das Morgen aber verlangt, diese gewordenen Staaten, so wie sie
geworden sind, zusammenzufassen zu einer höheren internationalen Friedensgemeinschaft.
Der Begriff der Staatsnation hat damit den ethnologischen Begriff endgültig abgelöst. Die
Belgier, die Schweizer, die Österreicher sind damit völkerrechtlich Nationen und so die
Bürger jedes Staates, der in die UNO eintritt. Die geschichtliche Periode der kriegerischen
Nationalstaatenbildung muß durch die beiden Weltkriege als abgeschlossen gelten... Die
Tendenzen zur völligen staatlichen Zusammenfassung der Sprachgemeinschaften, wie zur
Absonderung und Umschichtung von sprachlichen Minderheiten, sind wie die
Panbewegungen aller Art zum ersten moralischen Sprungbrett mißbraucht worden,
welches, obschon sie in ihrem Ursprung kultureller Natur und in diesem Rahmen berechtigt
sind, kriegslustigen Nationen die Rechtfertigung zur militärischen Aggression zu liefern
ausersehen wurde...."
Dieses unglaubliche Wirrwarr der "Gedanken zur Friedenskonferenz", in der er auf einmal
völkerrechtliche Entitäten und Allianzen zur Nation erklärt, verrät viel über die
Verwirrtheit des Verfassers zu diesem Zeitpunkt. Als Pragmatiker aber ließ er sich dadurch
nicht abhalten, weiterhin Politik zu betreiben. Erst ein Jahr später wird er seine Gedanken
wieder etwas geordnet haben. In einem langen Artikel in der Wiener Zeitung vom 19.
Jänner 1947 zieht er – noch immer mit deutlichem deutschnationalen Unterton - die
Parallele des österreichischen Nationenbildungsprozesses zur Schweiz.
130
Der weitere Ablauf dieses Prozess muss nicht wiederholt werden (vgl. Filla 1984). Es genügt der Hinweis, dass die meisten alten Genossen Renners wesentlich größere Umstellungsschwierigkeiten hatten als der Großmeister des Opportunismus. Sie schwiegen daher
über die nationale Frage lieber. Wenn sie sich äußern mussten, so griffen sie die von
Renner vorgegebene Linie auf, schwiegen über Österreich und orientierten sich lieber auf
"Europa". So überließen sie den Konservativen Begriff und Inhalt des Projektes "Österreich", die nicht zuletzt damit eine unbestrittene Hegemonie für mehr als zwei Jahrzehnte
begründeten. In manchen Regionen schwang auch noch der alte Deutschnationalismus mit
und ging manchmal eine seltsame Bindung mit parteitaktischen Reflexen ein. Als etwa zur
Zeit der Borodajkiewicz-Affaire ein Echo dieser Affaire auch in Graz gespielt wurde – ein
linkskatholischer Professor mobilisierte als Rektor ein kleines Publikum gegen eine bei
Licht besehen eindeutig neonazistische studentische Veranstaltung – , da ging die "Neue
Zeit" auf diese Demonstration los und beschimpfte die Teilnehmer als "prokommunistische" und "antideutsch" (Teibenbacher 1996; allgemein: Thaler 1999).
Mitbedingt war dies natürlich auch durch die so eindeutig konservative und nicht zuletzt katholische Besetzung des Österreich-Begriffes, dies in einer Zeit, als die Sozialdemokratie mit gutem
Grund teils noch ihrem alten Antiklerikalismus nachhing. Hier gab es eine Episode, die an sich
grotesk wäre, wäre sie nicht gar so kennzeichnend für die Vorgangsweise der Römischen Kirche.
Schärf (1955, 262ff.) – der "ein wütender Gegner des Konkordats war" (Olah 1995, 161) – berichtet, dass nach Renners Tod die Katholische Aktion eine Art Argumentationshilfe für Geistliche
herausgab, in der sie bedauerte, dass erstmals ein österreichischer Bundespräsident nicht kirchlich
begraben worden sei. Darüber hinaus behauptet dieses Elaborat noch, dass Renner sich die katholischen Sterbesakramente habe geben lassen; dass er überhaupt fromm geworden sei und sich gegen
Ende seines Lebens mit religiösem Schrifttum befasst habe; dass nur die SP-Parteispitzen und insbesondere Schärf ein kirchliches Begräbnis verhindert und auf eine Feuerbestattung bestanden
hätten; etc. – laut Schärf alles Behauptungen, die völlig aus der Luft gegriffen waren. Schärf setzt
sich gegen diese katholische Leichenfledderei – die übrigens inhaltlich nichts Neues darstellt,
sondern in ähnlicher Weise schon öfter gegenüber bekannten Agnostikern zum Einsatz kam – denn
auch in Ausdrücken zur Wehr, die heute zwischen SPÖ und Römischer Kirche undenkbar wären.
Nicht umsonst warf die KPÖ der SPÖ vor, in den wesentlichsten politischen Fragen vollständig ins Schlepptau der Konservativen geraten zu sein. In der nationalen Frage
allerdings stimmte sie selbst beinahe restlos mit der ÖVP überein. So verwundert auch
nicht eine überaus freundliche Besprechung einer kleinen Broschüre von Alfred Missong,
wo dieser seine Argumente zur österreichischen Nation zusammen fasste, in "Weg und
Ziel" (April 1947, 306 f.). Neben Ernst Fischer (1945) war es vor allem Otto Langbein,
welcher dieses Thema breit behandelte. Und auch er benützte neben validen politischen
Argumenten solche, die ganz in der Tradition des zweifelhaften biologistischen
"Volkscharakters" Otto Bauers standen. Auf der einen Seite unterstreicht er also die
politische Bedingtheit der Nationen-Werdung: "So wie die holländische und schweizerische Nation nur entstanden sind im Befreiungskampf, wie die amerikanische Nation
nur im Freiheitskampf gegen die englische entstehen konnte, so wird sich auch die
österreichische Nation nur konsolidieren gegen die sie bedrohende deutsche" (Weg und
Ziel, Jänner 1947, 14 – 28). Etwas vorher aber können wir lesen, "daß wir etwas anderes
sind als die Deutschen. Daß unsere Tradition und Wesensart, unsere Geisteshaltung, unsere
Kultur etwas deutlich anderes ist als die der Deutschen". Zum Vergleich Maleta (1968
[bzw. 1965], 141): "Die Erkenntnis der eigenen Wesensart der Österreicher, ... ihrer
ureigenen österreichischen Denkweise... daß wir Österreicher deutscher Zunge eine Naturund Wesensart besitzen, die sich in der Art unseres Menschseins, in unserer ganzen
131
Einstellung zu den Mitmenschen und zur Umwelt als etwas Eigenständiges
wiederspiegelt..."
3.3.1 Parteikulturen – die SPÖ
Die Probleme der SPÖ waren eigener Art und spiegelten sich in einer innerparteilichen
Auseinandersetzungen, auf denen vorerst der Deckel draufgehalten wurde. Sie brachen in
aller Schärfe erst Mitte der sechziger Jahre, nach dem Abschluß der Nachkriegskonsolidierung aus. Der Schlüsselname ist hier Franz Olah.
Die Sozialdemokratie war seit ihrer Gründung durch Viktor Adler eine Arbeiterpartei, die
von bürgerlichen Intellektuellen geführt wurde. Die mittleren Kader waren ins Funktionärskorps aufgestiegene Arbeiter, welche voll und ganz die Werte der bürgerlichintellektuellen Führungsschicht übernommen hatten. Das zeigt sich nicht zuletzt in ihren
kulturellen Leitvorstellungen. Gegen diese dominante Partei-Kultur hatte es am Anfang der
Parteigeschichte Widerstände gegeben. Die Schilderungen, welche die teils mit dem
Anarchismus sympathisierenden und am Parteitag von Hainburg endgültig ausgetricksten
Konkurrenten Adlers von diesem Parteitag und seinen Intrigen gaben, sind für Adler und
seine Gruppe nicht gerade schmeichelhaft. Doch nach Hainburg verschwand diese Gruppe
weitestgehend aus der Parteigeschichte. Ähnliche Tendenzen tauchten sehr kurzfristig nach
dem Ersten Weltkrieg auf, wurden aber größtenteils wieder in die Sozialdemokratie
integriert. Die kleinere Gruppe, welche sich zuerst in der neugegründeten KPÖ sammelte,
wurden dort ihrerseits mit dem schnell einsetzenden Prozeß der Stalinisierung an den Rand
gedrängt. Ihre Überreste gingen in den Stalin'schen Säuberungen der End-30er Jahre
zugrunde.
In diesen 30er Jahren allerdings konnten einzelne Vertreter im Untergrund wieder
reüssieren. Die Revolutionäre unter ihnen schlossen sich nach der jämmerlichen Haltung
der SPÖ im kurzen Bürgerkrieg großteils der KPÖ an, die schon damals
sozialkonservativen Abkömmlinge aus dem Facharbeiter-Proletariat eher den
Revolutionären Sozialisten. In der zweiten Nachkriegszeit gelang einzelnen unter ihnen der
Aufstieg in der SPÖ. Dabei sozialisierten sie sich gewöhnlich in die Parteikultur hinein.
Einer, der dies verweigerte und dabei einen brennenden Ehrgeiz und einen für die Führung
gefährlichen Machthunger entwickelte, war Franz Olah. Als er, wie er sich heute genüßlich
erinnert, 1950 seine Schlägergarden mit "unseren Holzprügeln" (1995, 138) auf die
streikenden und verzweifelten Arbeiter losließ und selbst, so berichtet er stolz, immer mit
einer geladenen Pistole in der Gegend herumfuhr und wohl auch einmal einen Schuß
abgab, da war er der SPÖ zwar willkommen. Doch nachdem die Arbeit getan war, wurde er
zunehmend ein Ärgernis: Er entwickelte über die Gewerkschaftsarbeit hinaus - wo diese
Art proletarischer Kultur durchaus ihren Platz behielt, bis zum Einsatz der Bauarbeiter
gegen Naturschützer in den Donauauen - auch politische Ambitionen im Staatsapparat. Das
aber paßte gar nicht ins Konzept seiner Partei bzw. ihrer Führung. Die Auseinandersetzung
zwischen Olah und der Mehrheit seiner Parteiführung ist tatsächlich ein Kampf zwischen
zwei Parteikulturen. Kennzeichnend ist etwa der abfällige Ton, in der sich Olah mehrmals
über den späteren Bundespräsidenten Franz Jonas äußert. Kreisky hingegen, der Olah
übrigens in seinen Memoiren mehrmals seinen engen Freund nennt, wird ihn anerkennend
folgend beschreiben: "Jonas war der Inbegriff des wißbegierigen und durch Bildung
gereiften Arbeiters. Der ehemalige Buchdrucker hatte die Bildungseinrichtungen der
Arbeiterbewegung bis zum äußersten ausgeschöpft. Er sprach ein wohlklingendes, für
österreichische Verhältnisse bemerkenswert gutes und kultiviertes Deutsch" [! - Anm.]
132
(Kreisky 1988, 365). Dieser Weg der Anpassung lag Olah völlig fern, und er hatte dafür vor
allem Spott übrig. Wenn er mit grimmigen Haß über Broda herzieht und ihn explizit aller
möglichen Untaten beschuldigt, so ist neben der politischen Gegnerschaft und der
persönlichen Feindschaft auch die Gegnerschaft des Typus beteiligt, denn Broda
verkörperte in vielem tatsächlich den linken Intellektuellen, den übrigens auch Kreisky (der
sich selbst als "bewußten Intellektuellen" bezeichnet - a. a. O., 363) nicht mochte. Die
intellektuelle Kultur der Partei-Elite, welche zu dieser Zeit gerade dran war, die SPÖ in
eine "Volkspartei", in eine "catch-all-party" zu transformieren, fühlte sich durch diese
ungefiltert proletarische Kultur bedroht. Olah schreibt später über seine
Auseinandersetzungen: "Meine Popularität bei den Arbeitern und bei der Exekutive war
unentschuldbar. Sie wirkte wie eine latente Bedrohung auf jene, die ihren Posten nur ihrem
Sitzfleich zu verdanken hatten" (S. 271). Das ist in vielerlei Hinsicht richtig gesehen. Diese
Sorte von etwas mafioser Arbeiterkultur, welche eher an die amerikanischen
Gewerkschaften erinnert, war in der SPÖ nicht erwünscht. Es ist daher auch kein Zufall
und sagt Einiges über die strukturelle Stellung Olahs in der österreichischen Politik aus,
wenn sich sein "Ausblick" am Ende seiner Erinnerungen (S. 320, 323 f.) liest wie eine
Kombination von "Staberl" und Jörg Haider:
"Österreich ist nun ein Teil der EU... Ein Europa der Nationen, uneingeschränkt ja. Ein
eurasisch-afrikanischer Schmelztiegel - nein. Respekt und Förderung auch fremder
Kulturen, aber keine Multikultur-Mischung. Wer bei uns leben will, muß unsere Sprache
erlernen, muß unsere Sitten und Gebräuche respektieren, und bereit sein, sich zu
integrieren... Wer wird schon Schulden zahlen? Das ist auch der Grundsatz vieler
österreichischer Bürger. Die Lösung ist der Privatkonkurs! ... Es gilt heute bei nicht
wenigen Österreichern als 'in', möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viele Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Der Staat soll zahlen. Manuelle Arbeit ist 'out'. Der
Facharbeiter wird immer unter seinem Wert entlohnt. Die verantwortungslose Schuldenpolitik des Staates färbt auf seine Bürger ab. Dies ist die moralische Bankrotterklärung der
staatlichen Gemeinschaft neben der finanziellen. Wir sehen aber auch die Auflösungstendenzen in der ganzen Gesellschaft, das Ende aller bisherigen Bindungen. Diese,
von der sogenannten progressiven Politik eingeleitete Entwicklung zerstört systematisch
alles, was bisher die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens war... Am Anfang
stand der Kampf der Vereinigten Feinde der Religion, des Glaubens jeder Richtung...",
usw.
3.3.2 Einige Probleme der Nachkriegs-Rhetorik
Eine Ironie dieses österreichischen Nationenbildungs-Prozesses der Zweiten Nachkriegszeit besteht darin, daß er zum nicht geringen Teil von den alten Eliten, die vor dem
Krieg "deutsch" gewesen waren, durchgezogen wurden. Eigentlich gegen ihre eigene
Sichtweise betrieben sie mit allen ihnen verfügbaren Mitteln von oben herab den Aufbau
einer eigenen nationalen Identität und waren dabei erfolgreich. Dabei konnten sie natürlich
nicht über ihren eigenen Schatten springen. Sie mußten die Bilder, über die sie verfügten,
in Einklang bringen mit den neuen politischen Bedingungen. Wir haben hier ein
hervorragendes Beispiel jenes Prozesses, den Lévi-Strauss (1962) "bricolage" (geistige
Bastelei) nennt und als Grundprozeß des "wilden Denkens" betrachtet: Es ist die
Verwendung von alten Bildern, welche frühere Bedeutungen aus Zusammenhängen, in
denen sie einmal eingesetzt waren, mit sich tragen, auch wenn sie nun in neue Zusammenhänge eingefügt werden. Dieses "wilde Denken" ist ja nichts anderes als das auf
133
Konkretes basierende Alltagsdenken, im Unterschied zum analytisch-abstrakten Denken
des (als paradigmatische Figur aufgefaßten) Wissenschaftlers. Es ist damit ganz selbstverständlich die eigentliche Vorgangsweise säkulärer Mythen, deren hervorragendste
Ausprägungen zum einen die ethnische Tradition, zum anderen der Nationalismus i. S.
eines Orientierungssystems, also die nationale Ideologie, sind.
Die unterschiedlichen "Missionen" des neuen Österreich sind also nur die Bruchstücke
jener Rechtfertigungsideologien aus der Monarchie, die in ihrer Endzeit - im übrigen ja
vergeblich - versucht hatte, sich auch noch einmal einen Mythos zu schaffen. Dies ist auch
die Erklärung für die seltsame und irreale Großmachtorientierung der Eliten des
Kleinstaates Österreich, welche diesen Kleinstaat diesmal aber akzeptierten. In diesem
Sinne sollte man die Großmachtstereotypen aber auch nicht überschätzen. Vor einem
halben Jahrhundert und nach der NS-Katastrophe waren sie offenbar das einzig verfügbare
Material, mit dem sich das politische Personal bemühte, einen neuen politischen Horizont
aufzubauen. Aus heutiger Sicht müssen sie somit natürlich unbeholfen, widersprüchlich
und oft leicht lächerlich wirken. Überhaupt besteht ein Großteil der Topoi, mit denen
damals die eigene Nation beschrieben wurde, aus sehr gewöhnlichen Bestandteilen
nationaler Hetero- und Autostereotypen aus dem Schatz des klassischen Nationalismus,
wie sie überall vorkommen. Die politischen Orientierungen dahinter sind oft nur sehr
mühsam erkennbar.
Diese Sprachspiele zogen sich bis Ende der 60er Jahre hin und hörten im wesentlichen mit
der Ära Kreisky auf, da sie ja vor allem von den Konservativen gepflegt wurden. Hören wir
uns zum besseren Verständnis an, was z. B. Alfred Maleta 1964 dem Bundesjugendring
sagen zu müssen glaubte (Maleta 1968, 111):
"Der Name Österreich bezeichnet nicht allein ein Staatsgebiet, sondern symbolisiert
darüberhinaus eine überstaatliche Ordnungsidee [M. spricht hier von der Republik!]... Sie
entspricht der übernationalen, zwischenstaatlichen Funktion Österreichs im europäischen
und mitteleuropäischen Kräftefeld, die überzeitlich gültig ist... Politische Ausstrahlungen
an einem solchen Ort bedürfen jedoch eines starken nationalen Sendungs- und
Selbstbewußtseins..."
Die eigentliche Frage wäre, wie sehr dieser politische Horizont beigetragen hat, am
Universalhorizont für weitere Kreise der Bevölkerung mitzubauen. Man kann sich des
Eindruckes nicht erwehren, daß es bei diesen Bemühungen viel stärker um Orientierung für
die politische Klasse selbst sowie für die intellektuelle Elite ging. Überhaupt wäre einmal
die Frage nach der nach Schicht differentiellen Betroffenheit der Bevölkerung von
nationalen Mythen zu stellen. Wenn Alexis de Tocqueville (1988) den "Nationalstolz" als
Ersatz für eine der Bevölkerung verlorengegangene Transzendenz einsetzen möchte (s. S.
20), so spricht er vermutlich sehr viel mehr seine eigenen Gefühle an als jene der
Bevölkerung.
Die Auseinandersetzung dieser Zeit folgte einem Muster, das Geertz (1973, 234 ff.)
antagonistisch unter die Stichworte "Essentialismus" vs. "Epochalismus" ordnete. Unter
Essentialismus versteht er den Bezug auf die eigenen Traditionen, lokalen und regionalen
Kulturen und den Willen, das eigene Projekt und den "eigenen Namen" (Mazzini) aus
diesen Elementen heraus aufzubauen. In der Zweiten Nachkriegszeit war dies in Österreich
die herrschende Strömung, zumal sie taktisch auch den Bedürfnissen nach Distanzierung
von der deutschen Option entgegenkam. Oberflächlich gesehen, liegt diese Wahl auch der
traditionalistischen Strömung (s. u.) näher - oberflächlich deshalb, weil der Bezug auf die
134
eigenen Traditionen natürlich eine Auswahl darstellt: Man kann sich auf die
Herrschaftstraditionen beziehen; man könnte sich aber sehr wohl auf auf die Traditionen
der Selbstbestimmung, der Rebellion gegen die Herrschaft, auf die Tradition der
Erniedrigten und Beleidigten besinnen. Die Festlegung der KPÖ auf die "essentialistische
Variante" war daher nicht von vorneherein abwegig. Sie schimmert auch etwas durch,
wenn Otto Langbein darauf verweist, daß die deutsche Arbeiterklasse in ihrer Mehrzahl
sich auf die Seite des Imperialismus geschlagen habe und schon daher keine Notwendigkeit
bestehe, sich mit ihr zu solidarisieren. Doch im großen und ganzen bietet auch der
Essentialismus der KPÖ das paradoxe Bild, daß er sich eher an den Herrschaftstraditionen
der Vergangenheit orientiert. Wahrscheinlich läßt sich dies darauf zurückführen, daß die
Kommunistischen Parteien grundsätzlich ihren Platz in der epochalistischen Variante sahen
("sozialistischer Internationalismus"). Diese geistige Übereinstimmung ging übrigens so
weit, daß in manchen nationalen Fragen von hohem Symbolwert die KPÖ gewissermaßen
versuchte, die ÖVP "rechts" zu überholen. Das war etwa der Fall beim Abschluß des
Gruber-De Gaspari-Abkommens, welches endgültig die österreichischen Aspirationen auf
Südtirol beendete. Die KPÖ warf Gruber nicht nur vor, das Parlament übergangen zu
haben, sondern kam mit ihrer Polemik einem Hochverrats-Vorwurf gegen den
Außenminister sehr nahe. Überhaupt ist der symbolische Gehalt der damaligen SüdtirolPolitik nicht ganz einfach zu deuten. Der Anspruch bedeutete nicht weniger als den
Wunsch nach einer Revision der Ergebnisse des Ersten Weltkrieges in einer für Österreich
und Italien besonders belasteten Frage. Die Frage erhebt sich: Wie konnte die
österreichische Politik überhaupt auf diese äußerst unrealistische Idee kommen?
Möglicherweise war dies auch ein Ausfluß jenes Opfer-Mythos ("Österreich ist das erste
Opfer des Nazi-Faschismus"), an den manche Politiker über seinen instrumentellen Wert
hinaus selbst zu glauben begannen. Darüberhinaus wird sich bald eine Schwierigkeit
ergeben, wie die Südtiroler eigentlich zu definieren seien. Als Österreicher? Als Deutsche?
Nicht einfacher wurde dies durch die vor allem in den Jahrzehnten '70 und '80 ziemlich
eindeutige Ausrichtung der dortigen politischen Führung auf Bayern, womit sie offenbar
ideologisch und politisch eher eine Verwandtschaft feststellten als mit Wien.
Doch kehren wir zurück zu den Geertz'schen Begriffen! Epochalismus ist die Orientierung
an einem behaupteten Hauptstrom der gesellschaftlichen Entwicklung zur Integration in
immer größere Einheiten. Es war in Österreich die Sozialdemokratie, welche unzweideutig
für diese Variante optiert hatte. Die deutlichsten Ausdrücke dafür hatte in Österreich Ludo
Moritz Hartmann gefunden. "Die Entwicklung der Nationen [muß] hineingestellt werden
in die Entwicklung der menschlichen Assoziations- und Organisationsformen überhaupt
oder in den Prozeß der fortschreitenden Vergesellschaftung, in welchem die Menschheit
ihre allmählich fortschreitende Anpassung an die Natur vollzieht" (in: Filla 1992, 135).
Doch auch die leninistische Strömung des Marxismus war völlig darauf festgelegt. Das ist
nicht verwunderlich: Sie hatte ihre theoretische Form nicht zuletzt in der
Auseinandersetzung (als "Westler") mit den "Narodniki" im zaristischen Rußland
gefunden, welche damals und dort die essentialistische Strömung repräsentierten.
Überhaupt dominierte diese Sicht nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie
fast unbestritten, zumindest für einige Jahre. Sie ist auch gegenwärtig wieder die
hegemoniale Strömung in Westeuropa. Dieses Gegensatzpaar geht weitgehend parallel mit
der Cleavage Traditionalismus - Moderne, deckt sich aber nicht völlig mit ihr.
3.3.2 Symbolik
135
Kommen wir noch einmal zu den Symbolen, die wir schon einmal, in der ersten
Nachkriegszeit, angesprochen haben! Als sich die Zweite Republik zwanzig Jahre nach der
Befreiung - wobei den Konservativen dieses Wort nicht über die Lippen ging: es war die
"sogenannte Befreiung" (Maleta 1968, 236) - endlich einen Nationalfeiertag gab, da
machte die Festlegung des Tages erhebliche Mühe. Die SPÖ schlug den 12. November vor.
Das war für die ÖVP völlig unakzeptabel. "Dieser 12. November bedeutet den Zerfall des
Reiches..., den Zerfall des Großraums, des Staatsgebildes, jener idealen wirtschaftlichen
Einheit und jenes politischen Gebildes, ... [dessen] Zerfall eine historische Tragödie war...
Die Freude über eine größere Freiheit in einer moderneren Staatsform ist also für weite
Teile der Bevölkerung verdunkelt durch dieses große historische Ereignis und seine
furchtbaren Folgen. Nicht Bosheit oder mangelnde republikanische Gesinnung veranlaßten
also die Volkspartei zu ihrer ablehnenden Haltung" schrieb der Erste Präsident des
Nationalrates, Maleta, am 27. Feber 1965 in der "Furche", deren damaliger Chefredakteur
sehr empfänglich für diese Art der Argumentation gewesen sein dürfte. Selbst heute sind
die keineswegs auf die Konservativen beschränkten Großmann-Sehnsüchte noch zu einem
erheblichen Teil aus dieser Wurzel gespeist (vgl. S. 145"Vergangenheitsbewältigung").
3.3.3 Die nationale Selbstverständlichkeit: Kreisky
Die Zeit von den End-60ern bis zu den Mitte-80ern, von der man gewöhnlich als der Ära
Kreisky spricht, war jene Periode der österreichischen Nationenbildung und -existenz, in
der die Nation am nächsten zu einer undramatischen nationalen wie staatlichen
"Normalität" - wie heute das Modevokabel lautet - kam. Voraussetzung war ein
unpathetisches und selbstverständliches Verhältnis zur eigenen Nation, welches sich in
einer nüchternen und bescheidenen Selbsteinschätzung darstellte, die trotzdem nicht zu
sozialem oder politischen Quietismus führte. Die Person Kreisky repräsentierte diese Zeit
tatsächlich in hohem Maß. Kreisky selbst hat sich als "Austromarxist" bezeichnet, er war in
seinem Denken aber einem Utilitarismus nahe, wie er von J. St. Mill getextet hätte sein
können.28
Er war alles andere als ein Nationalist, auch kein Österreich-Nationalist - im Gegenteil:
Hier wies er geradezu einen blinden Fleck auf, wie etwa seine verständnislose Haltung
gegenüber den Kärntner Slowenen und deren Anliegen zeigte. Er selbst betont zwar, daß er
im Gegensatz zu maßgeblichen anderen Persönlichkeiten seiner Partei bereits im Krieg
gegen die Idee der gesamtdeutschen Revolution, die vor allem von Friedrich Adler, "den
ich ungeheuer bewundert und geliebt habe" (Kreisky 1996, 21), vertreten wurde, war. Doch
die Begründungfür die Eigenstaatlichkeit Österreichs ist ausschließlich realpolitisch, i. S.:
die voraussichtlichen Sieger wollten dies. So spricht er denn in seinen Memoiren zwar von
einer "sozialdemokratischen Identität" (Kreisky 1996, 37). Den Begriff der österreichischen
Identität wird man aber vergeblich suchen, obwohl er sich "immer mit dem
österreichischen Volk identifiziert" hat (Kreisky 1988, 390). Dies steht im Zusammenhang
mit "antisemtischen Äußerungen in sehr ordinärer Form von maßgebenden
Persönlichkeiten der ÖVP" (Kreisky 1988, 396). Dabei nennt er als einen der
Verantworlichen "für die zweideutige Propaganda, die von dieser Partei bedenkenlos
eingesetzt wurde", explizit und "führend" den Außenminister zum Zeitpunkt der
Niederschrift seiner Erinnerungen, Alois Mock. Gedacht ist dabei in erster Linie wohl an
28
Man vgl. z. B.: "Jegliche Emanzipation nützt der Gesamtemanzipation, d. h., je mehr Frauenemanzipation
es gibt, desto mehr Emanzipation gibt es in der Summe der Gesellschaft" (Kreisky 1996, 25).
136
den Wahlkampf von 1970, als die ÖVP mit der Plakatierung von Kanzler Klaus als "echten
Österreicher" implizit gegen den "Juden Kreisky" suggerieren wollte.
Wenn er auch in seinen Erinnerungen plötzlich nostalgische Anwandlungen hinsichtlich
des Habsburgerstaates zeigt, dann ist dies eher der Versuch einer späten Selbststilisierung,
die nach einer passenden Epoche für "die eigene Größe" sucht. Das gehört nun einmal zu
den Charakteristiken politischer Memoirenschreiber. An einer Überidentifikation mit
Österreich wurde Kreisky allein durch seine tiefe Abneigung gegenüber dem
Austrofaschismus gehindert (siehe vorne), der sich ja auch mit dem Versuch, nicht zuletzt
im Rückgriff auf die Monarchie29 einen "österreichischen Menschen" zu postulieren, zu
legitimieren versucht hatte. Trotzdem wurde er zum "Österreicher" schlechthin. Sein Weg
in die Emigration hatte ihn bezeichnenderweise nicht in die Hauptstadt eines Imperiums
(London, Moskau) geführt, sondern nach Stokholm in eine kleine, selbstbewußte und sehr
eigenständige Nation, deren Erfolgsgeschichte nicht zuletzt durch Verzicht auf
Großmachtsambitionen seit 200 Jahren charakterisiert war. Der schwedische Historiker
Sten Carlson stellte 1969 fest: "Der Verlust Finnlands war der Preis einer langen und bis
heute ununterbrochenen Friedensperiode." Der schwedische Weg wurde prägend für ihn
und seine weitere politische Laufbahn. Kennzeichnend insgesamt ist, daß in Kreisky's
Regierungszeit keineswegs eine überzogene Identitätspolitik gemacht wurde, sondern
einfach erfolgreich sektorielle Politiken.
Bei der Erklärung seiner Erfolge wies er selbst dann ausdrücklich auf die Öffnung der
Partei insbesondere auch zu den Intellektuellen hin, auch wenn er als Politiker diese als
"letzlich entscheidende Wählergruppe" anspricht. Er verwechselt also deren Hegemonie
mit zahlenmäßiger Stärke, obwohl er gleich hinzufügt. "Der erklärte Nachholbedarf an
Liberalität hat uns in den von mir mit Erfolg geführten Wahlkämpfen von 1970 bis 1983
denn auch die Unterstützung der Intellektuellen gebracht" (Kreisky 1988, 361). Damit hat
er einen wichtigen Zug seiner Ära ausgesprochen, der sich übrigens weitgehend in die
Nach-Kreisky-Zeit hinübergerettet hat und erst gegenwärtig in Frage gestellt wird.
Sucht man nach den Merkmalen einer nationalen Politik dieser Zeit, so fallen ins Auge:
1) Das Pathos einer "Nation" wurde völlig in den Hintergrund geschoben. Entscheidend
war die wirtschaftliche und politische Performanz dieser Nation, die so als Gegebenheit
den selbstverständlichen Hintergrund bildete. Tatsächlich war es die Zeit, in der Österreich
nach den üblichen Indikatoren kulturell, wirtschaftlich, sozial und politisch in etwa an das
Niveau des übrigen Westeuropa anschloß, dabei aber in all diesen Bereichen ausgeprägt
seine Charakteristiken bewahrte. Es ging ganz klar um Nation als Projekt, während Nation
als Identität mittlerweilen einigermaßen selbstverständlich war: "Die Zukunft zu
bewältigen gilt es ... Ich mache deshalb einen konkreten Vorschlag: Laßt uns von heute an
einen Katalog der 100 nationalen Fragen erstellen" (Kreisky 1996, 239).
2) Die außenpolitische Absicherung dieser erfolgreichen Innenpolitik geschah durch eine
aktive Neutralitätspolitik. Sie erreichte nach außen ihre oft unrealistisch hoch gesteckten
Ziele nicht (Muster: Nahostvermittlung), trug aber erheblich zum Aufbau eines nationalen
Bewußtseins bei. Eine Ironie besteht darin, daß gerade Kreisky zum Zeitpunkt des
29
Ernst Karl Winter, der einzige konservative Intellektuelle der Zwischenkriegszeit, der einen
österreichischen Nationenbegriff entwickelte, war politisch ausgeprägt Monarchist und sah sein
Vorbild zuerst in einigen Mauras'schen Gruppen in Frankreich.
137
Staatsvertragsabschlusses der Neutralität höchst mißtrauisch gegenüberstand. Noch im
letzten Moment vor den entscheidenden Verhandlungen wehrte er sich dagegen (Stadler
1982): "Raab: 'Herr Staatssekretär, warum san Sie eigentlich so gegen das Wort
Neutralität? Dös spielt ja gar ka Rolle, wia ma dös nennen. Tan ma dös glei annehmen.' Kreisky: 'Ich denke hier vor allem an die Westmächte, die wir doch davon überzeugen
müssen, daß wir uns jedenfalls bemüht haben, eine derart weitgehende Festlegung nicht
von vorneherein anzunehmen:'"
3) Während die Rhetorik - oft mit einer gewissen Ironie (Insel der "Seligen") - den
Sondercharakter Österreichs hervorhob, bestand die Wirklichkeit vor allem in einer immer
stärkeren (wirtschafts-, sozial-) strukturellen Angleichung an die höchstentwickelten
Gesellschaften der westlichen Welt. Und genau das war beabsichtigt: "Ich behaupte nun,
daß wir in den Jahren 1970 bis 1983 und darnach die österreichische Gesellschaft
entscheidend verändert haben" und damit Europareife erlangten (Kreisky 1996, 37).
Theoretisch begründet er dies "austromarxistisch" mit der Hegel'schen Phrase vom
Umschlag der Quantität in Qualität.
3.4 ÖVP, SPÖ, "Drittes Lager" - ein Rollentausch?
Geschichtsbilder unterliegen einem besonders deutlichen Wechsel mit den Generationenwechseln von Eliten. Ein solcher hat Mitte der 80er Jahre an der Spitze der
Republik stattgefunden. Doch in den einzelnen Parteien ging das zu unterschiedlichen
Zeiten vor sich. In der unmittelbaren Tagespolitik der Gegenwart zeigt sich daher eine
weitere Facette des nationalen Kampfes um die politische Zukunft. Auch er nimmt langsam
die Züge einer Auseinandersetzung um Symbole und Identitäten an. Hatte die ÖVP schon
Anfang der 50er Jahre ihre prononciert österreichische Haltung aus wahltaktischen
Gründen - man suchte, ebenso wie die SPÖ, die Stimmen der ehemaligen Nazis - in den
Hintergrund gestellt, so begann nach der Verdrängung von der Regierung eine neue Phase,
die sich zuerst vor allem als Unsicherheit darstellte. Mitte der 80er Jahre wurde diese neue
Entwicklung Praxis, die sich in wenigen Jahren überstürzte. Sie ist war wesentlich mit dem
Namen Alois Mock verbunden. Doch vorerst mußte diese neue ÖVP erst wiederum
Teilhabe an der Regierungsmacht erlangen. Der "logische Nachfolger" (so ließ sich Mock
von einem Journalisten beschreiben) konnte aus der Opposition heraus nicht das bewirken
was er sich wünschte. Doch noch regierte die SPÖ, auch wenn nach leichten Verlusten in
der NR-Wahl 1983 die absolute Mehrheit verloren gegangen war und ein Juniorpartner in
der Regierung saß.
Fast unmittelbar nach dem Abtritt Kreiskys machte die SPÖ nach einem innerparteilichen
Putsch einen politischen Total-Schwenk. Sie warf die bisher gültigen Konzepte vor allem
in der Wirtschafts- und in der Außenpolitik über Bord. Nicht der letzte Anlaß dazu war ein
Schock infolge hoher Spekulationsverluste in schlecht kontrollierten Teilen der staatlichen
Industrie. Für die Konservativen war die Verstaatlichte spätestens seit dem Abzug der
Alliierten ein Dorn im Auge gewesen, den sie entfernen wollte: "Ein gestörtes Verhältnis
zur Verstaatlichung manifestierte sich in den hartnäckigen Versuchen, die verstaatlichten
Unternehmungen auf den Bereich der Grundstoffindustrie zu beschränken und eine
Diversifikation in Finalprodukte zu verhindern. Diese Bemühungen waren von der Sorge
um die Gewinne im privaten Sektor geprägt, die durch günstige Einstandspreise für
Vorprodukte und Grundstoffe und geringe Konkurrenz für die eigenen Produkte durch
verstaatlichte Unternehmungen sicher gefördert werden" (Abele 1989, 61). Das also stand
hinter der stets beschworenen Strukturkrise der Verstaatlichten, und nicht etwa die zu
138
hohen Sozialleistungen oder aber die Einflußnahme seitens Belegschaftsvertreter. Als nun
zu den durch jahrzehntelange Behinderung verursachten Problemen der alten
Schwerindustrie noch Spekulationsverluste kamen, war die gesuchte Gelegenheit
vorhanden. Die Sozialdemokratie selbst, deren Stolz diese Betriebe einmal gewesen waren,
machte sich, vor allem in Gestalt des Verstaatlichten- und Finanzminsters Lacina mit
diskreter Hintergrundunterstützung durch Vranitzky, daran, auch hier eine europäische
Normalisierung durchzuziehen. Damit kam insbesondere der Linken in ihrer eigenen Partei
ein Identifikationsobjekt abhanden, welche ihre ideologische Grundhaltung nachhaltig
infrage stellte. Es war der Auftakt zu einer Gesamtrevision sozialdemokratischer Politik.
Erstaunlicherweise ging die Partei ziemlich widerspruchslos mit. Obwohl der neue Bundeskanzler und Vorsitzende eine lange Serie von Niederlagen zu verantworten hat, war er
bisher weitgehend unangefochten. Erst die Niederlage bei den Wahlen zum EU-Parlament,
die auch mit dem symbolisch offenbar entscheidenden Verlust der ersten Stelle verbunden
war - dies nach einem unerwarteten Erfolg bei den NR-Wahlen 1995, die mittels einer
"linken" Kampagne, der Wahrung des sozialen Besitzstandes gewonnen wurde - brachte
eine innerparteiliche Diskussion und sodann seinen Rücktritt als Parteivorsitzenden.
Zehn Jahre nach diese Wende können wir eine erste Bilanz ziehen. Die Gegenwart zeigt
eine zunehmende Verflechtung und eine totale "Westintegration" der österreichischen
Wirtschaft und auch der Politik. Vor allem der technokratisch-konservative Teil der
politischen Führung will ihn auch durch eine militärische Westeinbindung irreversibel
machen. Auch in dieser Hinsicht weist der Trend über eine nationale Identität hinaus. Für
die bisher führende Regierungspartei stellt sich aber das Problem, daß ihre bedingungslose
Unterwerfung unter den EG / EU-Kurs trotz völliger Geschlossenheit der Führung nicht
nur von der Bevölkerung, sondern vor allem von der eigenen Klientel immer weniger
goutiert wird. "Wir haben einfach 50 % EU-Gegner in den eigenen Reihen" meint die
Generalsekretärin der SPÖ (Profil 42/ 15. Okt. 1996). Die SPÖ steht also derzeit wieder
einmal vor der Situation - wie schon am Beginn der Ersten Republik - , daß Führung und
Gefolgschaft nicht mehr dieselbe Sprache sprechen und in einer fundamentalen Frage
auseinanderklaffen. Und wiederum ist es die nationale Frage, wenn auch im neuen Gewand
der Diskussion über supranationale politische Integration.
Die ÖVP der 60er Jahre hatte sich ausschließlich als Partei der überkommenen Strukturen
und Denkweisen dargestellt. Sie war die Regierungspartei schlechthin, und damit basta.30
Das wurde ihr schließlich auf dem Gipfel ihres Erfolgs, in der Zeit der Alleinregierung,
zum Verhängnis, weil sie die in Österreich sehr leisen und wenig artikulierten
Veränderungen nicht zur Kenntnis nahm, teils aus der Arroganz der Macht heraus, teils
offenbar infolge eines fehlenden Sensoriums für sozialen Wandel. Kennzeichnend war
etwa, daß man damals als Justizminister einen erzkonservativen Rechtsprofessor bestellte,
der seine ganze Tätigkeit darauf ausrichtete, Dämme gegen den Modernismus zu bauen
(etwa im Eherecht usf.). Nach dem Verlust der Regierungsposition 1970 schien sie als
Partei plötzlich ohne eigentliche raison d'être dazustehen. Sie begann bald zwar mit einer
Art von Grundsatzdiskussion. Doch die sogenannten programmatischen oder ideologischen
Äußerungen sind meist von unüberbietbarer Banalität, wie sie sich etwa in der
30
"Vielfach hört man das Argument, daß ja die ÖVP schon 25 Jahre (!) allein regiert habe, und daß es nicht
schaden könne, wenn einmal ein anderer am Ruder sei." Motivstudie der ÖVP zur NR-Wahl 1970 in
Wien, zit. in: Kriechbaumer 1981, 76.
139
Zentralcharakterisierung der eigenen Partei als "progressive" oder "fortschrittliche Mitte"
äußert. Tatsächlich gab es zwei Grundströmungen, wenn man die zweite überhaupt als
Grundströmung bezeichnen kann.
Die eine, und in der Debatte vorerst dominierende wurde im wesentlichen von den alten
Konservativen vertreten, für die die Namen Maleta, Drimmel und auch Kohlmaier stehen
sollen. Sie versuchten den Rückgriff auf die alte, fundamentalistische katholische Lehre.
Imgrunde war diese Gruppe bereits Anfang der 60er Jahre gescheitert. Persönlich stellte
sich dies als Niederlage der Gruppe Drimmel am Klagenfurter Parteitag 1964 dar, obwohl
ihre Gegner (Klaus-Withalm) nicht weniger konservativ waren. Drimmel, der dieses frühe
Scheitern erst nach seinem Ausscheiden aus der Politik begriff, sah aufgrund dessen überall
nur mehr die Machtübernahme des Sozialismus, des Marxismus, des sinistrismo: in der
Kirche, in der Gesellschaft, in seiner eigenen Partei. Er selbst war in den 70er Jahren
endgültig von der Bühne abgetreten und meldete sich nur mehr mit immer neuen Büchern,
verlegt in einem extrem konservativen, ja weit rechts stehenden Verlag: "Indessen waren es
erst die Technokraten des Neo-Liberalismus und die Anhänger jener neuen Linken, die
während der Marx-Renaissance der 60er Jahre in Kirche, Partei und Staat auftauchten, die
mich in meine jetzige Eremitage vertrieben haben. Nachdem ich mich wehrte, bis ich allein
dastand" (Drimmel 1975, 10). Mit einem solchen Konservativismus war freilich kein Staat
mehr zu machen, und auch keine Partei - diese Gesinnung war bestenfalls gut für eine doch
sehr kleine Gruppe Ewig-Gestriger. Dazu kam daß ihm die großdeutsche Einstellung
offenbar auch als Unterrichtsminister noch nicht völlig abhanden gekommen war. Bei
einem Stiftungsfest einer Wiener Burschenschaft "bekannte" er sich mit Pathos zum
deutschnationalen Historiker Heinrich von Srbik, den z. B. Kreissler (1980, 18) als einen
der intellektuellen Totengräber des Ersten Österreich charakterisiert. Die - damals
eindeutig deutschnationalen - "Salzburger Nachrichten" (8. Juli 1961) zitieren ihn voll
Zustimmung ausführlich:
"Ich grüße am Ehrentag der Burschenschaft nicht nur den Amtsvorgänger
[Srbik war 1929/30 ein Jahr lang Unterrichtsminister gewesen - Anm.], dessen
Erinnerung im Bundesministerium für Unterricht unvergessen und dessen Bild
an hervorragender Stelle angebracht ist, sondern den Historiker, der sich dem
Gesetz der Wahrhaftigkeit verschrieben hat, ohne Rücksicht darauf, ob ihn die
Welle des Erfolges emporgetragen oder der Mahlstrom der Mißgunst zutiefst
verletzt hat ... Möge das Andenken an Heinrich von Srbik der Jugend ihrer
Burschenschaft so nahe bleiben, daß sich darnach das Lebensideal ritterlicher
Gesinnung und unbedingter Wahrhaftigkeit orientieren kann."
Der objektive Zynismus bei der Verwendung des Begriffes “Wahrhaftigkeit” dürfte ihm
nicht einmal bewußt gewesen sein. Wenn Drimmel dann jedoch von der
"Kriegsschuldlüge" spricht, sind wir ziemlich in der Nähe jener Achtung vor der
"Anständigkeit" der älteren Generation, welche manche Erfolgspolitiker bis heute den ganz
Unbelehrbaren noch attestieren wollen...
Ein anderer bewußt konservativer Strom, der sich wenig später als "neokonservativ"
darstellen wollte, beriefen sich auf konservative Ideologen, wie etwa Helmut Schelsky oder
auch den damals eine gewisse Prominenz genießenden, aus Österreich stammenden, aber in
der BRD lebenden Gerd Klaus Kaltenbrunner. Die Botschaft war eindeutig: Wir müssen
wieder bewußt konservativ werden, und das hieß anti-emanzipatorisch und gegen den
"Fetisch
von
Demokratisierung
und
Gleichheit":
Denn
"die
moderne
140
Emanzipationsbewegung [bedeutete] eine Herausforderung an alle politischen Gruppen,
welche sich mit der bestehenden liberal-demokratischen Ordnung und ihren Grundwerten
identifizierten" (Kriechbauer 1981, 111). Zur Begründung wurden alte Versatzstücke aus
früheren Diskussionen hervorgekramt; von Maleta (1968) etwa wieder der sogenannte
"Personalismus" als dem Liberalismus wie auch dem Sozialismus entgegengesetztes
Menschenbild; von Kohlmaier "die große Geschichte Österreichs". Tatsächlich ist in
diesem Kontext der Begriff der "Person" nichts als ein Code-Wort für den Versuch, eine
bestimmte Realität gesellschaftlicher Strukturen und ihre Wirksamkeit in Abrede zu
stellen, weil sie auch für Strukturkonservative nur schwer legitimierbar sind. Oder man
griff auf neo-Othmar-Spann'sche Vokabel zurück, die man semantisch leicht variierte, die
"partnerschaftliche Gesellschaft" etwa, die dann im sogenannten "Salzburger Programm"
wieder auftaucht. Und die große Geschichte Österreichs ist natürlich die Geschichte des
autoritären Habsburger-Staates.
Die zweite Strömung, der imgrunde die maßgeblichen Politiker der ÖVP angehörten, hielt
vermutlich die ganze Ideologie-Debatte für überflüssig. Es ging um die Staatsmacht und
sonst nichts. Dementsprechend dürftig ist denn auch ihr Beitrag. Tatsächlich setzte diese
Gruppierung darauf, Politikrezepte und Strategien, welche in anderen westlichen Ländern
im Laufe der 70er Jahre auftauchten und sich dort aus verschiedenen Gründen als
erfolgreich erwiesen, zu übernehmen. Man könnte dies unter dem Stichwort
"Neokonservatismus" zusammenfassen, wenn ein solcher neokonservativer Diskurs in
Österreich und speziell in der ÖVP tatsächlich eine Rolle gespielt hätte. Die ÖVP schaffte
allerdings bis in die 80er Jahre den Mix aus altkonservativen Inhalten mit militanter
Mobilisierung und moderner PR nicht, der das Wesen des Neokonservatismus sowohl in
den USA wie auch in Europa ausmacht. Ihre Werte, die sie als Regierungspartei noch mit
einem gewissen Erfolg aufrechterhalten hatte, brachen in den folgenden Jahren in der
österreichischen Öffentlichkeit regelrecht zusammen. Dies im Einzelnen nachzuzeichnen,
ist hier nicht der Platz. Als ein grober und vereinfachender Indikator dafür sei die
Kirchenbindung der Bevölkerung genannt (vgl. Zulehner 1981 und Zulehner u. a. 1991).
Die Folge war, daß die ÖVP sich von Österreich weg nach außen hin orientierte und
gewissermaßen eine internationale konservative Partei wurde. War die Nachkriegs-ÖVP
die eigentliche Erfinderung der "Österreich"-Ideologie gewesen, so sah sie sich nun vor der
Situation, daß die SPÖ den Ö-Begriff an sich gezogen hatte und ihn mit ihren Inhalten
(Stichwort "Modernisierung") und sogar dem Anspruch eines beispielgebenden Modells
auffüllte. Sie erreichte damit eine starke Identifizierung mit Österreich, und demoskopisch
meßbar war diese Identifizierung im SPÖ-Elektorat höher (vgl. Reiterer 1988). Unter den
Bedingungen der Tagespolitik bedeutete das geradezu einen strukturellen Zwang für die
ÖVP, dem Ö-Begriff etwas anderes gegenüberzusetzen. Es mußte ein neues politisches
Projekt entwickelt werden, dieses konnte aber nicht mehr unter der Bezeichnung
"Österreich" laufen. So mußte man schon vor der bedingungslosen Außenorientierung auch
von Seiten der ÖVP nahestehender Autoren konstatieren, "daß das Österreichbewußtsein
im Ausgang der Achtzigerjahre kritischer ist als zu Beginn des Jahrzehnts" (Stourzh 1990,
112).
Die Programmdiskussion der letzten Jahre und Monate zeigt einen vorläufigen Abschluß in
dieser Hinsicht, auch wenn das neue Programm formal noch nicht angenommen ist. Sehen
wir uns den Entwurf mit Stand Feber 1995 an, an dem sich kaum noch etwas ändern dürfte
(beigeheftet zu: Österreichische Monatshefte 8/1995):
141
"1.3.2 Wir treten für die Entwicklung und Förderung des kulturellen Erbes unserer
Heimat Österreich ein...
1.3. 5 Unsere reiche und vielschichtige kulturelle Identität stellt einen wichtigen
Beitrag für Europa dar. Österreich ist unverzichtbarer Bestandteil der europäischen
Identität...
9.1.10 Wir wollen eine Europäische Union, in welcher die Menschen in ihren lokalen
Gemeinschaften Heimat, Geborgenheit, geistige Orientierung und ihre moralische
Bindung begründen können, eine Union, in welcher sich die Menschen als Bürger
ihrer jeweiligen Heimatregion, ihres Vaterlandes und als Europäer verstehen."
Diese knappen Merksätze werden nur wenig variiert von Andreas Khol in einem langen
Artikel (Österreichische Monatshefte 1-2/1995, 35 - 44) erläutert. Khol hat sich in der
ÖVP stets, auch motiviert durch seine Funktion als Leiter der Parteiakademie, als
rechtskonservativer Ideologe profiliert, besetzt nun aber seit Ende 1994 eine strategische
politische Position seiner Partei und war imerhin nahe daran, ihr Obmann zu werden.
Khols "gesellschaftspolitische Visionen" (S. 44) in bezug auf den nationalen Aspekt lauten
folgendermaßen (43 f.):
"Die Volkspartei muß sich klar zum Begriff der Heimat Österreich bekennen.
Heimat, die in Familie, am Arbeitsplatz, in den Vereinen, in der Gemeinde, im
Bundesland, also in den überschaubaren und nahen Gemeinschaften erlebt wird. Die
Volkspartei als patriotische Partei bekennt sich damit besonders zur österreichischen
Identität und zu einem Patriotismus, der die Liebe zu Österreich meint, nicht aber den
Haß und die Abneigung anderen gegenüber...
Im Sinne dieses Heimatbegriffes soll Österreich endlich ein Österreich-Institut nach
dem Vorbild des Institut Français gründen, das die österreichische Identität im
kulturellen Bereich, seinen einzigartigen Beitrag zur europäischen Kultur weltweit
dokumentiert und verbreitet."
Wir konstatieren also zwei fundamentale Grundzüge der der neuen ÖVP-Position:
1) Semantisch wird der Begriff der österreichischen Nation strikt vermieden. Man spricht
ausschließlich von "Heimat", und diese siedelt man vorzugsweise im lokalen Bereich oder
sogar bei einzelnen unverpflichtenden Kollektiven an - Khol nennt die "Vereine" mehrmals
als die ihm zusagenden Verankerungen. Dieser Schützenverein- und FeuerwehrPatriotismus tritt jetzt an die Stelle einer nationalen Orientierung.
Das ist im übrigen keine Khol’sche Erfindung. Hier trifft er sich völlig nicht sosehr mit
seiner eigenen stark rechts orientierten Richtung, sondern vielmehr mit dem Hauptstrom
jener Intellektuellen, die sich selbst linksliberal definieren. In ganz Westeuropa ist eine
Tendenz beobachtbar, die man mit dem Konzept “Entnationalisierung der Politik”
umschreiben kann. Die Popularität des Ethnizitätsbegriffes ist denn auch nicht sosehr
einem gesteigerten Verständnis für Ethnizität zu verdanken, als vielmehr einem
schleichenden Versuch, ethnische, d. h. in diesem Zusammenhang entpolitisierte Konzepte
der sozialen Identität an die Stelle des radikal-demokratischen Begriffs der Nation mit
ihrem Selbstbestimmungs- und Unabhängigkeitspathos zu setzen. Die scheinbar so
progressive Bemühung um die Alltagskultur als der Lebenswelt der “kleinen Leute” und
die Polemik gegen die “politische Großsymbolik” wird zur Vermeidungsstrategie in einem
potentiellen Konflikt mit technokratischen Fremdbestimmungen. Dazu gehört weiters:
142
2) Die "österreichische Identität" wird ausschließlich kulturell definiert. Da mittlerweile
wohl bekannt ist, daß die kulturellen Unterschiede zwischen modernen Nationen zwar von
Nationalisten zu Legitimationszwecken gerne evoziert und aufgeblasen werden, in einem
kultursoziologischen Sinn aber - im Vergleich etwa mit den Unterschieden zwischen
sozialen Schichten - durchaus von untergeordneter Bedeutung sind, fragt man sich nach
dem Sinn dieser Definitionsstrategie. Sie ist durchsichtig, wenn man sich an den Zugang
dieses Beitrages erinnert: Nation als politisches Projekt. Gerade dies, eine politisch
eigenständige Definition von nationalen Präferenzen und Zielsetzungen soll unbedingt
vermieden werden. Analytisch hat damit die ÖVP die Orientierung auf eine Nation
Österreich aufgegeben. Was übrig bleibt, wäre allenfalls noch mit dem Begriff des
Regionalismus und eines schwachen Supra-Regionalismus (Österreich als Verein von
lokalen und regionalen Gesellschaften) zu fassen. Diese nur leicht verhüllte Festlegung auf
ideologischer Ebene entspricht allerdings (noch?) nicht der politischen Realität. Würde
also die politisch formulierte Programmatik auch bekannt und ernst genommen - was zu
bezweifeln ist; Parteiprogramme dieser Art scheint außer wenigen Politologen niemand zu
lesen - , ergäbe sich auch ein taktisch-politisches Problem, von dem sich tatsächlich Spuren
feststellen lassen: Ein konservatives österreichnationales Elektorat wird tendentiell
heimatlos. Hier setzt nun eine andere Entwicklung ein.
Wie allgemein bekannt, war das in der Republik sogenannte "Dritte Lager", im Klartext:
die seit spätestens 1930 weit rechts stehenden deklarierten Deutschnationalen, im Zweiten
Österreich parteimäßig in der FPÖ organisiert. Nach dem gescheiterten Versuch einer
liberalen Wende unter Norbert Steger und der Übernahme des Parteivorsitzes durch Jörg
Haider im Sommer 1986 nahm diese Partei einen phänomenalen Aufschwung. Sie wurde
zu einem Sammelbecken jener, die sich vom Hauptstrom der gegenwärtigen Politik nicht
vertreten fühlen, aber auch nicht ein progressives Gegenprojekt wünschen. Doch vorerst
hielt die ideologische Entwicklung nicht Schritt. Wir brauchen gar nicht von den
authentisch braunen Rändern in vielen Gruppen in und am Rande dieser Partei sprechen.
Es genügt ein Blick auf die Parteizeitungen.
Dem Stimmenumfang nach geht die Wählerschaft dieser Partei spätestens seit 1990 weit
über jenes Potential hinaus, welches man auch bei laxer Definition als deutschnational
kennzeichnen könnte. Da der Parteivorsitzende Haider sein Erfolgsrezept in einem
ziemlich genauen Hinhören auf Meinungsströmungen erkannte, die andere Politiker
einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen - aus honorigen oder weniger honorigen
Gründen - , konnte ihm diese Diskrepanz nicht verborgen bleiben. "Durch das neue
Wählerpotential ist das ursprüngliche, 220.000 Wähler ausmachende Potential der FPÖ zur
Minderheit geworden... Wir brauchen eine Zukunftsperspektive" (Haider im Interview in:
Wirtschaftswoche 34/17. Aug. 1995). Der eigentliche Wendepunkt war bereits die
Abstimmungskampagne zum EG-Beitritt. Die FPÖ führte ihn deutlich unter (deutsch-)
österreichischen Motiven. Nun wird auch die programmatische Grundlage nachgeliefert. In
einer Serie von Interviews hat Haider angekündigt, die deutschnationale Ausrichtung
aufzugeben und auf Österreich-Patriotismus zu setzen. Da er selbst aus deutschnationalem
Umfeld kommt und in seiner Sozialisation bis heute sichtlich bzw. hörbar davon und von
einer Affinität zur NS-Vergangenheit geprägt wurde, hat er auch selbst erhebliche
Schwierigkeiten bei der jehen Umstellung. In einem dieser Interviews (Profil, 21. August
1995, Nr. 34) bezeichnet er beispielsweise die Tätigkeit von Wehrmachtssoldaten als
"Widerstand" und spricht von "offizieller Geschichtsschreibung", wenn der Beginn des
Zweiten Weltkrieges (die deutsche "Kriegsschuld") angesprochen wird. Er reagiert
143
aggressiv, als dies selbst den Journalisten auffällt und sie ihn auf seine Fehlleistungen
aufmerksam machen. Doch dies sind vermutlich Umstellungsschwierigkeiten. Denn er
setzt auf den bewährten Mechanismus und hat in einem nationentheoretischen Sinn sogar
recht, wenn er sagt: "Ich will mich mit diesen Geschichten (!) nicht befassen, sondern ich
sage, wie immer die Geschichte im Laufe der Zeit noch facettenreicher wird, ist dies nicht
mein Problem..." Was er dabei bewußt übersieht, ist, daß die Definition von (nationalen,
regionalen, ...) Identitäten über den Bezug auf die Kontinuität der Geschichte läuft, und daß
gerade Nationalisten diesen Bezug immer bis zum Exzess ausreizten. Die plötzliche
Vermeidung von Geschichte ist eine durchsichtige Flucht aus seiner eigenen bisherigen
Vergangenheit, zumal dann - siehe unten - der Inhalt des Projektes in historisch recht
beladenen Vokabeln erfolgt. Allerdings steckt noch ein bißchen mehr dahinter: Haider ist
eigentlich der Mustertypus des "amerikanischen" Politikers, der zwar grundsätzlich
konservativ ist, sich aber ebenso grundsätzlich in seinem Handeln nach
Umfrageergebnissen richtet. Sein politische Projekt faßt er seit einiger Zeit unter dem
Vokabel "Dritte Republik" zusammen, welches allerdings kaum mit konkreten Inhalten
gefüllt ist. Der Untergrund ist "Antisozialismus", der sich als Antiliberalismus entpuppt:
"Die auf dem Boden der Aufklärung gewachsenen, für Europa prägenden Ideen und
Gesellschaftssysteme sind überholt, am Ende, oder überhaupt gescheitert... Es gilt auch,
Abschied zu nehmen von einem überkommenen Liberalismus, dessen einziger Sinn in der
verantwortungslosen Hingabe an eine individualistische Bedürfnisbefriedigung zu liegen
scheint... das Thema der Geschichte hat sich gründlich geändert, der Wind dreht sich"
(Haider 1994, 10, 12). Der stilistisch und inhaltlich vielleicht kennzeichnendste Satz dieser
pompösen Deklamation wurde von mir in Kursiv gesetzt.
Doch vorerst weiter: "Ich hatte mit der österreichischen Nation nie ein Problem." Wenige
Sätze später jedoch erklärt er, daß "die österreichische Nation in Wirklichkeit eine
Erfindung der Kommunisten gewesen ist", was in seinem Sinn ja wohl eine Verurteilung
bedeutet. Auch im nur vier Tage vorher datierten Interview mit der "Wirtschaftswoche"
macht er noch eine explizite Unterscheidung zwischen der "Mißgeburt" (der Ausdruck
wird ihm vom Journalisten entgegengehalten) der österreichischen Nation - "Das ist etwas
anderes als Österreich. Das war ja der Versuch, sich aus der Geschichte fortzustehlen" und der österreichischen Identität. (Man beachte übrigens, wie stark die Übereinstimmung
in der Formulierung vom "Fortstehlen aus der Geschichte" mit manchen Tendenzen zur
sogenannten Vergangenheitsbewältigung bei Linksliberalen ist - ein Thema, welches im
Verlauf dieser Studie noch anzusprechen sein wird.) Er läßt sich auch eine "theoretische"
Begründung durch einen emeritierten Soziologie-Professor31 geben. Dankenswerterweise
liefert dieser auch gleich eine Verurteilung des "kulturlosen multikulturellen Wirrwarrs"
mit und legitimiert sich damit als zugehörig zur Haider'schen Gesinnungsgemeinschaft.
Doch das alles zählt nicht wirklich. Er füllt das Projekt Ö-Nation heute mit zwei CodeWörtern: "Heimatbewußtsein" und "Vaterlandsliebe im klassischen Sinn". Damit ist der
konservative Charakter seines Projektes klargestellt. Auch wenn das erste Vokabel heute
nicht mehr ganz so eindeutig einem rückwärtsgewandten Wörterbuch angehört, so doch
zumindest das zweite, zumal es mit "im klassischen Sinn" präzisiert wird. Auch die
taktische Richtung wird erkennbar: Es geht um die noch verbliebenen Wähler der ÖVP, für
31
W. B. Simon im - lt. Blattlinie - "Diskussionsorgan" Freie Argumente 3/1995, 52 - 57, mit dem
Schwerpunkt-Thema "Österreich III".
144
welche der Deutschnationalismus in der F(PÖ), zumindest für einen beträchtlichen und
gerade auch den konservativsten Teil unter ihnen, ein beinahe unüberwindlicher
Hinderungsgrund für eine Stimmabgabe zugunsten dieser Partei ist. Taktiker, der er ist,
weiß Haider auch, daß die Widerstände aus der eigenen Partei kommen werden und droht
verhüllt in diese Richtung: "Wobei das für mich eine Frage über meinen persönlichen
weiteren Weg ist." Das heißt natürlich nicht, daß das einzelne Mitglied nicht weiter von
den "alten Rivalitäten des Blutes" und ähnlichen Formulierungen schwärmen darf. Dies ist
auch regional unterschieden. Neben Kärnten scheint nach dem Neuaufbau einer
burgenländischen Landesorganisation diese regelrecht altnazistische Kerne in der Partei zu
beheimaten.
In der nationalen Frage führt eher das LIF die Tradition eines Teils der alten FPÖ weiter.
Das LIF setzt nach außen hin klar auf eine übernationale Identität. Das hat mit seiner
Klientel, mit seiner neuen, altliberalen Ausrichtung zu tun, aber auch mit der persönlichen
Tradition seiner Protagonisten. Heide Schmidt wie z. B. auch F. Frischenschlager kommen
aus der alten, deutschnational bestimmten FPÖ: Für sie gilt erst recht das, was seinerzeit
und heute wieder für viele Sozialdemokraten galt und gilt: Da man Österreich nicht sagen
will, sagt man eben Europa.
Natürlich stellt sich spätestens hier die Frage, welchen nicht nur politischen, sondern nicht
zuletzt auf die Bedürfnisse des Einzelmenschen abstellenden Sinn diese doch recht
abgehobenen und fetischisierten Auseinandersetzungen um Nation oder Vaterland,
Identität oder Heimatbewußtsein, usw. eigentlich hat.
4 NATIONALE IDENTITÄT?
Nationalbewußtsein ist das hauptsächliche gemeinschaftliches Integrationsmittel nationaler
Gesellschaften neben dem gesellschaftlichen der "sozialen Arbeitsteilung". Es gibt viele
Möglichkeiten sozialer Identität. Doch gesamtgesellschaftliche Identitäten werden
regelmäßig, mit geringgewichtigen Ausnahmen, ethnische und / oder nationale Identitäten
sein. Damit wird die nationale Identität zu jener sozialen Identität, welcher in sozialen
Integrationszusammenhängen die größte Bedeutung zukommt. Die Frage nach der
Funktion der nationalen Identität, auch für die persönliche Identität des Einzelnen, ist somit
nicht trivial, wie schon die terminologische Anspielung auf Durkheim zeigt: Und doch ist
gerade im west- und mitteleuropäischen Bereich gegenwärtig eine Haltung unter
Intellektuellen zu finden, welche dieses Konzept mit einer gewissen Verächtlichkeit
betrachtet. Das widerspricht zwar diametral dem auch zu beobachtenden Zügen eines
wiederum von Intellektuellen getragenen ethnic revival, ist jedoch Faktum. Und insbesondere in Bezug auf Österreich wird es in diesen Kreisen manchmal offen als bedeutungslos und geradezu schädlich abgetan. Das ist verständlich, weil die Ausdrucksformen
des ethnic revival oft genug tatsächlich ideologisch sind: In einer Großgesellschaft - und
jede moderne Gesellschaft ist eine Großgesellschaft - ist der Rückgriff auf eine traditionell
oder traditionalistisch aufgefaßte Gemeinschaftlichkeit erst recht ein Ergebnis von
Entfremdung und Fetischisierung, also Ideologisierung. Allerdings ist dies allein zu
simplifizierend.
Anfang Oktober 1996 fand in Mürzzuschlag ein Symposion über mitteleuropäische Minderheiten statt. Es
stand unter dem Motto "Bedrohte Vielfalt". Doch dieses häufig benutzte Schlagwort führt in die Irre. Bedroht
ist in ethnischen und nationalen Konflikten nicht in erster Linie die Vielfalt im Sinne unterschiedlicher
Lebensformen der Menschen: Zumindest in entwickelten Ländern sind die Lebensformen auch bei
unterschiedlicher ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit zwar schichtspezifisch stark unterschiedlich; im
zwischenethnischen Vergleich unterscheiden sie sich jedoch kaum. Die "Vielfalt" wird somit zu einem Code-
145
Wort; sie wird zu einer Ideologie, wenn man darunter gar die "Andersartigkeit" verstehen will. Was ist in
ungleichgewichtigen ethnischen Beziehungen wirklich bedroht? Was steht für Minderheiten auf dem Spiel?
Es ist die Selbstbestimmung, die Selbstgestaltung der eigenen Zukunft, welche sich in interethnischen
Beziehungen als Möglichkeit der Wahl einer eigenen Zugehörigkeitswelt gegen den letztlich totalitären Druck
zur Assimilation, d. h. zur Selbstaufgabe, äußert. In der Kommunitarismusdebatte der letzten Jahre und
Jahrzehnte betonte man zu Recht, daß Gesellschaft immer auch Gemeinschaft sei, soll sie Kohäsion haben
und funktionieren. Weiters ist richtig, daß die Mensch meist in eine Gemeinschaft hineingeboren wird. Doch
da er ein , ein Gesellschaftswesen ist, ist seine Zugehörigkeit zu jeder dieser Gemeinschaften
grundlegend eine Frage der eigenen Wahl - jede Gemeinschaft ist letztlich eine community of choice. Doch es
muß in modernen demokratischen Zusammenhängen auch eine Frage der Wahl bleiben, ob der Mensch im
Rahmen eines Staates mit einer anders als er selbst markierten Mehrheit seine Zugehörigkeit zu einer
kleineren, also einer Minderheitsgruppierung beibehalten will. Diese normative Aussage wird zu einem
analytischen Merkmal des demokratischen Charakters. Damit ist es eine fundamentale, wenn auch schwierig
zu verwirklichende Bedingung von Zivilgesellschaft und Demokratie. Was besonders schwer zu begreifen und
offenbar auch zu ertragen ist: Eine Mehrheitsentscheidung kann Gültigkeit beanspruchen; und doch muß der
Minderheit zugestanden werden, ihre abweichende Position beizubehalten. Diese Toleranz, das
Bestehenlassen des Widerspruchs, ist in unserer Kultur mit ihrer herrschaftlichen Tradition der unbedingten
Herstellung von Einheitlichkeit ungewohnter als in anderen Gesellschaften, wie Lévi-Strauss so eindrücklich
gezeigt hat.
Jede persönliche Identität ist soziale Identität. Das hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen
ist die Identität sozial geformt. Zum anderen lokalisiert sich jeder Mensch durch Bezug auf
Kollektive, wenn nicht bewußt, so doch unbewußt. Diese Kollektive müssen nicht
notwendig Nationen oder Ethnien sein. Ethnic revival ist u. a. auch als Protest gegen
Entfremdung in modernen Gesellschaften durch eine allzu kurzsichtig und eindimensional
aufgefaßte Rationalität. Man setzt dem verabsolutierten homo oeconomicus den
Gegenentwurf einer umfassenderen menschlichen Existenz gegenüber, in dem das "Reich
der Freiheit" ebenso Berechtigung hat wie das "Reich der Notwendigkeit" behaupteter
Sachzwänge. Dieser umfassende Lebensanspruch wird auf die ethnische oder nationale
Identität hin projeziert. In einer national verfaßten Welt macht die politische Realität eine
Orientierung auch in Bezug auf Nationen unausweichlich. Wenn ein Mensch sich zu sehr
gegen diese triviale Notwendigkeit wehrt, ist dies ein Zeichen für ein psychosoziales
Problem. Das ist selbstverständlich nichts Ehrenrühriges, wohl aber etwas, was analytisch
festzustellen ist.
Die spezifisch österreichische Problemlage besteht nun in einer Verquickung zumindest
zweier historischer Voraussetzungen und deren Wirkung auf die Österreicher. In der neuen
österreichischen Geschichte hat es für die deutschsprechenden Bewohner dieses Landes
zwei nationale Angebote gegeben. Das eine war die Zugehörigkeit zu einer deutschen
Nation; das andere war der eigenständige Aufbau (nicht etwa: die "Abspaltung") einer
österreichischen Nation. An beiden hingen und hängen bis in die Gegenwart
unterschiedliche politische Programme, die sich ihrerseits im Laufe der Zeit änderten.
Damit stellt sich dies als Option zwischen komplexen und vielschichtigen Traditionen.
Nun scheint die Angelegenheit heute entschieden zu sein. Doch das Wichtige ist, daß sich
für einen Angehörigen der österreichischen Gesellschaft bzw. jemand mit einem realen
Bezug zu dieser Gesellschaft die Wahl nicht vermeiden läßt - was manche Menschen heute
immer noch möchten. Ein Vermeidungsversuch muß scheitern und gerät zu einem
psychischen Fluchtversuch auf der symbolischen Ebene. Er gibt sich derzeit meist als die
Behauptung einer übernationalen Identität. Ich möchte sagen, daß dies die narzistische
Variante des postnationalen Bewußtseins ist, der eine andere, eine melancholische Variante
gegenübersteht. Während die melancholische sich im gegenwärtigen Meinungsklima eher
146
selten äußert, wurde die narzistische zur wahren Yuppie-Mentalität, auch wenn viele, die
sie äußern, längst über das Yuppie-Alter hinaus sind.
Damit stellt sich natürlich die Frage: Wieso gibt es überhaupt diesen Fluchtversuch?
Einmal abgesehen von jenen wenigen, welche bis heute für die deutschnationale Variante
optieren und damit ein ganzes Programm einer düsteren Vergangenheit wählen, gibt es für
eine andere Gruppe ein anderes Motiv für Dissens, welches mit den Umständen zu tun hat,
unter welchen diese österreichische Nation, vor allem in der Zeit unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg, entstand. Doch von Anfang an muß gesagt werden, daß diese
Umstände nicht so verschieden von den Entstehungsprozessen anderer Nationen waren sie sind allerdings noch in der Erinnerungsreichweite der Lebenden und damit noch nicht
"reine Geschichte".
Man kann "das Bewußtsein definieren als die Beziehung psychischer Fakten zum Ich. Was
aber ist das Ich? Das Ich ist eine komplexe Gegebenheit, das vor allem aus der allgemeinen
Wahrnehmung des Körpers, des 'Daseins', besteht, und sodann aus den Gedächtnisinhalten;
man hat eine Vorstellung davon, gewesen zu sein und besitzt eine lange Reihe von
Erinnerungen. Diese zwei Faktoren sind die Hauptpfeiler von dem, was wir das Ich
nennen" (Jung 1975 [1935], 19). Verkürzt wie dieser Versuch einer Definition des Ichs
sein mag, ist sie nicht falsch und greift zumindest pragmatisch die uns leicht zugänglichen
Bereiche auf. Drücken wir dasselbe leicht variiert aus: Die persönliche Identität hat die
persönlichen Traditionen zum Inhalt, die sich allerdings nicht nur im Gedächtnis
niederschlagen. Sie setzt die Fähigkeit zur psychischen Integration dieser Inhalte voraus.
Doch diese persönlichen Traditionen kann ich mir zum größeren Teil nicht nach Belieben
aussuchen. Sie sind insoferne meiner Gestaltung entzogen, als sie Teile meiner durch die
Familie und der großteils in ihr ablaufenden Sozialisation überkommenen sozialen
Existenz sind. Daher rührt auch die ungeheure Macht der Zuschreibung insbesondere bei
der Bestimmung meiner sozialen Identität durch Bestimmung meiner Bezugsgruppe. Die
Betonung des Erwerbs in modernen Verhältnissen ist teils ein nützlicher und ethisch
wahrscheinlich sinnvoller Rationalismus, teils auch ein Ideologem. Im Nachhinein besteht
die Verarbeitung einer persönlichen Tradition vor allem in einer Bewertung der
Traditionselemente und dementsprechend in einem Betonen des einen Elements, im
Unterdrücken eines anderen Elementes; etc. Hier liegt die Crux dessen, was man
Vergangenheitsbewältigung nennt. Unter dem Anspruch, Verdrängungen an die Oberfläche
zu heben, verkennt sie nicht selten den psychischen Prozeß und leistet damit selbst anderen
Verdrängungen Vorschub. Man hat Renans Bemerkung über die Wichtigkeit nicht nur des
Erinnerns, sondern auch des Vergessens für die Formung nationaler Traditionen meist als
feuilletonistische Aperçue betrachtet. Tatsächlich dürfte Renan (1992 [1882], 41) selbst gar
nicht die analytische Tragweite seiner Sätze begriffen haben, als er schrieb: "L'oubli, et je
dirai même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la creation d'une nation." Denn
durch beide Verfahren - Erinnern und Vergessen - arbeitet man an jenem Super-Symbol der
mentalen Ordnung und damit der sozialen Sicherheit, ohne welche der Mensch nun
meinmal nicht zu leben vermag, welche jede Tradition darstellt. Die Bewertung einer
gegebenen Tradition ist logisch erst ein zweiter Schritt. Man kann eine bestimmte
Tradition verabscheuen, aber man braucht irgendeine Tradition. Das macht übrigens die
Bedeutung historiographischer Konstruktionen aus, ohne welche "Geschichte" überhaupt
nie entstanden wäre.
147
Im wesentlichen im Rahmen dieser Vergangenheitsverdrängung und -bewältigung fand der
Aufbau einer nationalen österreichischen Identität in der Zweiten Republik, seit dem
Zweiten Weltkrieg also, statt. Man kann dies in etwa drei diffuse Phasen einteilen: (1) Die
erste Phase war gekennzeichnet von mehreren widersprüchlichen Momenten und dauerte
etwa bis Mitte der 60er Jahre. Sie mischte eine starke Verdrängung der jüngsten
Vergangenheit mit einerseits einer resoluten Bejahung der Kleinstaatenidentität und
andererseits einer Suche nach historischen Wurzeln im habsburgischen Großstaat.
Vielleicht am kennzeichnendsten für diese Epoche ist ein vielbändiges Werk, daß ab 1956
in der Fortsetzung der Neuen Österreichischen Biographie 1815 - 1918 aus der Ersten
Republik erschien und sich als Reihe ab dem zweiten (d. h. nach offizieller Zählung der
Herausgeber: ab dem X.) Band "Große Österreicher" nannte. Die einzelnen biographischen
Artikel sind eine bunte Mischungs unterschiedlichster Persönlichkeiten und stellen reine
Hagiographie ohne einen Funken eines kritischen Ansatzes dar. (2) Die zweite Phase
dauerte bis etwa Mitte der 80er Jahre. Einem einigermaßen gesicherten österreichischen
Selbstbewußtsein, nicht zuletzt auch gestützt durch die Person Kreisky und dessen
außenpolitischen Aktivismus, ging ein Aufgreifen auch der Schattenseiten der eigenen
Vergangenheit parallel. Das betraf insbesondere eine zunehmend kritische Betrachtung der
Mitverantwortung von Österreichern im "Dritten Reich". Ziemlich kennzeichnend sind hier
die Bände der Serie Widerstand und Verfolgung: Die Vergangenheit wird nicht mehr
verschwiegen; doch der Akzent liegt auf dem Widerstand. (3) In der dritten Phase sind wir
mitten drinnen. Sie ist daher nur ansatzweise zu kennzeichnen. Die Affäre Waldheim
brachte einen immer überspitzteren Blick auf die dunkle Zeit. Es sind vor allem Literaten,
welche nunmehr dieses Thema in die Öffentlichkeit tragen.
Dies verschränkt sich mit den jüngeren politischen Weichenstellungen. Die rückhaltslosen
und mittlerweilen erfolgreichen Anschlußbestrebungen gegenüber der EG wurden aus einer
Reihe von Quellen gespeist, deren nicht geringste eine neue Großmachtsehnsucht war. Der
Zusammenbruch des alten Ostens machte Österreich plötzlich zur Außengrenze gegenüber
der Dritten Welt und weckte tiefe Ängste, die sich vor allem am Thema Immigration
konkretisierten. - Selbstverständlich sind die Abgrenzungen nicht scharf. Thomas
Bernhards' Schriften stammen zeitlich aus der zweiten Phase, gehören aber in ihrer
Wirkung und auch in ihrer Aussage eindeutig zur dritten. Der große Erfolg brachte andere
Literaten dazu, sich ans Thema anzuhängen...
4.1 Intellektuelle "Vergangenheitsbewältigung"
"Vergangenheitsbewältigung" ist der Kampf um die Gestalt sowohl jenes "logischen
Minimalkonformismus" wie auch jenes "moralischen Minimalkonformismus" (Durkheim
1994, 24), den jede Gesellschaft nötig hat, um Gesellschaft bleiben zu können. Wie in
Auseinandersetzungen mit nationalem Bezug immer, ist dies ein Kampf um die Zukunft in
der Sprache der Vergangenheit. Wenn man andere Formen dieses Kampfes betrachtet (die
Konstruktion von "Abstammung" z. B.), ist dies eine sehr rationale Form der
Auseinandersetzung. Die Grundsätze und Kategorien von Moral und Logik ("Geschichte")
werden direkt angesprochen und nicht nur in fetischisierter Gestalt. Das heißt nicht, daß
nicht die Auseinandersetzung selbst wieder meist sehr fetischisiert abläuft, wie wir gleich
sehen werden. Da die alten und bislang gültigen Grundlagen in Frage gestellt werden, muß
dieser Streit sehr bittere Formen annehmen. Es ist schließlich ein Kampf um die
Hegemonie im moralischen, und d. h. im sozialen und politischen Denken.
148
Übrigens ist dieser Kampf um die Vergangenheit keineswegs eine mitteleuropäische Erscheinung. Das wäre
angesichts der allgemeinen Struktur auch gar nicht denkbar. Anderswo zentriert sich allerdings die
Auseinandersetzung um andere Zeitpunkte und um andere Inhalte als hier. Immer aber sind es große
Wendepunkte der nationalen Entwicklung. Das können wir an einer ganzen Reihe von Beispielen belegen.
In den USA - um von Europa vorerst wegzugehen - ist es bis heute der Bürgerkrieg bzw. Sezessionskrieg.
Ging es dabei doch um die Weiterexistenz einer einheitlichen Nation. In der Sklavenfrage hatte sich ein
komplexes nationales Problem gebündelte. Als es sich nämlich zeigte, daß ein Großteil der Interessen stark
auseinandergingen, empfanden sich die zwei Großregionen der Union (der Norden und der Süden; der
Westen hatte noch kein großes Gewicht) bald nicht mehr als einheitliche Nation. Typischerweise äußerte sich
das darin, daß man völlig willkürlich getrennte Abstammungslinien konstruierte. Der Süden wollte nunmehr
von den königlichen "Kavalieren" der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts abstammen. Der Norden wiederum
berief sich verstärkt auf das puritanisch-republikanische Erbe der Mayflower-Tradition. Der Bürgerkrieg
klärte die Lage, machte aber den Süden für lange Zeit zur eroberten und gedemütigten Nation. Bis in die
Gegenwart blieb diese Linie der Tradition lebendig. Es sind nicht nur die südlichen Herrenhäuser, die man
mit Stolz den Fremden aus den USA und von anderswo zeigt, und wo man im "gift-shop" regelmäßig auch
revisionistische Bücher findet, welche die Position des Südens damals rechtfertigen. Im Augenblick (Juli
1997) gibt es einen Rechtsstreit, weil ein Oberstaatsanwalt in Atlanta/Ga. auf seinem Amtsgebäude die Flagge
der Konföderierten gehißt hat und sich weigert, sie ohne oberstgerichtliches Urteil zu entfernen. - Ein weiterer
Kampf um die Vergangenheit findet um "Vietnam" statt. Hier wird der aktuelle Inhalt besonders deutlich:
Imperialistischer Überfall auf ein Dritte Welt-Land oder Verteidigung der Demokratie? Es konnte so kein
Zufall sein, daß der republikanische Kandidat für die vergangenen Präsidentenwahlen am Beginn seiner
Kampagne auch diese Frage zum Thema zu machen versuchte. In einer Ansprache an die American Legion
griff er nicht nur den mehrsprachigen Unterricht für Einwanderer-Kinder an, sondern baute insbesondere auch
einen Popanz “unamerikanischer Geschichtsdarstellung” auf: Er warf “liberal academic elites”
“overemphasizing negative aspects of U.S. history such as the ‘scourge of MacCarthyism and the rise of the
KuKluxKlan” (The Washington Post, September 5, 1995) vor. Und es konnte natürlich auch nicht fehlen, daß
er eine Ausstellung über Hiroshima angriff, weil sie den Atombombenabwurf seiner Ansicht nach als
ungerechtfertigt darstelle. “We are proud of our country. And we won’t put up with our tax dollars being used
to drag it down or sow doubt about the nobility of America in the minds of our children.” Der Ton diesseits
und jenseits des Atlantiks ist zum Verwechseln.
Was eines der in Dole’s Rede angesprochenen Länder betrifft, Japan, hat eine Neubewertung der
Vergangenheit noch kaum begonnen. Die offizielle Haltung ist ein genaues Spiegelbild der Dole’schen Rede.
Ironischerweise dürfte dies eine der Folgen jener nach dem Zusammenbruch von den USA aufgerichteten
neuen Stabilität sein, welche dies verhindert - derselben Haltung, welche Dole für die USA vertritt. Sehr
langsam beginnt eine Diskussion, die zumindest von den Politikern überaus doppelzüngig geführt wird: Die
eine Äußerung gilt dem aisatischen Ausland, die andere dem chauvinistischen heimischen Publikum - eine
Diskussionsstrategie, die ja auch der neuesten Geschichte Österreichs bzw. manchen ihrer politischen
Exponenten nicht fremd ist. Es geht z. B. um die Darstellung in den Schulbüchern: “Daß Japans militärische
Präsenz in China eine Invasion war, widersprach dem bis dahin gültigen Regierungsstandpunkt, nach dem
Japan keinen Angriffkrieg zu verantworten hat. Die bevorzugte Sichtweise vieler war und ist noch immer, daß
Japan in den Krieg getrieben wurde, mehr Opfer als Täter.”32 Dementsprechend ist dann die vorgeschlagene
Sprachregelung fast wörtlich ident mit der des US-amerikanischen Konservativen: Die neuen Schulnbücher
dürften nicht die Kaiserlich-Japanische Armee in ein schlechtes Licht setzen.
Im Visier steht gegenwärtig vor allem das Problem des Verhaltens der Österreicher in der
Zeit der Nazi-Okkupation und die politische Stellung dazu nach der Befreiung / Besetzung.
Wenn auch unmittelbar nach dem Nazi-Zusammenbruch eine Entnazifizierung in Gang
kam, so verlief diese sich doch eher bald im Sand. Die Motivation dafür war sicherlich
vielschichtig und reichte von schäbigen parteipolitischen Stimmeninteressen bis zur
Hilfslosigkeit gegenüber dieser Vergangenheit. Ein, infolge seines Alters, damals gerade
schon oder noch Beteiligter sieht dies rückblickend so: "Als Österreicher hatten wir zwei
32
Florian Coulmas, Was Schulkinder nicht wissen sollen. Kein Ende der hitzigen Debatte um Japans
Geschichtsbild. NZZ, 3. März 1997.
149
Ziele vor Augen, die wir unbedingt erreichen wollten, nämlich die Besatzungsmächte
loszuwerden und die österreichische Wirtschaft wieder aufzubauen. Und mit einer
tiefgespaltenen Nation war das ja nicht zu machen. Die wichtigste Aufgabe war dabei die
geistige Entnazifizierung und der Umgang mit den 'bekehrten' Nazis" (Kienzl 1996, 118).
Man sollte diese Einstellung zumindest auch einmal vorläufig akzeptieren. Immerhin gab
es in Österreich die systematische Rehabilitation alter Nazi-Kader zum Zwecke des
Kampfes gegen "den Kommunismus", welche die BRD so kennzeichnete, nicht. Doch es
gab andere Probleme.
Insbesondere war es das Problem der alten "Seilschaften" und der Freundschaftsdienste an
Bekannte und Empfohlene, welche viele der Anstrengungen wieder zunichte machte.
Darüber findet man bis heute der Natur dieses Prozesses nach praktisch kein systematisches Material. Doch man stößt im Gespräch mit älteren Menschen immer wieder einmal
darauf. Er dürfte vor allem im universitären und verwandten Bereich eine quantitaiv nicht
zu unterschätzende Rolle gespielt haben. Gerechtfertigt wurde dies unterschiedlich, meist
mit irgendeinem Nestbeschmutzer-Argument: "Den Instituten [war] es wichtiger, den
eigenen Ruf hochzuhalten, als sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und sie
sich einzugestehen... Ganz allgemein bürgerte sich ein Sprachgebrauch ein, der Täter mit
Opfer verwechselte" (Schönafinger 1995, 174). Die Autorin schreibt über Graz weiter:
"Die Tatsache, daß Entscheidendes in Personalakten fehlt, und auch, daß von den
einschlägigen oben zitierten Schriften Weinhandels keine in irgendeiner Grazer Bibliothek
erhältlich ist, paßt sehr gut zur Praxis der Verdrängung und Verharmlosung der braunen
Vergangenheit von Personen wie den hier behandelten Naziphilosophen. Sie wurden
wieder eingestellt und in keiner Weise für ihre offenbar als 'Entgleisungen' oder
'Kavaliersdelikte' angesehenen nazistischen Aktivitäten zur Verantwortung gezogen." Das
könnte wortwörtlich auch über die Wiener Philosophie gesagt werden, die bis fast an die
Gegenwart heran von entsprechend belasteten Personen (Erich Heintel, Leo Gabriel)
maßgeblich bestimmt war. In diesem Fall, und das ist der Grund für das ausführliche Zitat,
kommt noch hinzu, daß in der europäischen Geistesgeschichte bis heute Philosophie nicht
eine Wissenschaft unter anderen war, sondern eine explizit weltanschauliche Funktion
zugewiesen bekam. Die jenseits der Anrüchigkeit dieser Partien dadurch mitverursachte
"Rückständigkeit der österreichischen Philosophie" (a. a. O., 175), die strukturell in
manchem an die Zeit des Vormärz erinnert, betrifft das Geistesleben der Gegenwart
insgesamt. Damit ist also eine der intellektuellen Schaltstellen betroffen. Dem kam das
Bedürfnis entgegen, einfach wegzuschauen. Der Schlußstrich wurde hier auf eine sehr
eigentümliche Weise gezogen, und nach wenigen Jahren waren auch diejenigen unter dem
universitären Personal, welche sich in oft sehr unzimperlicher Weise betätigt hatten und z.
B. 1938 in SA-Uniformen ihre politischen oder einfach auch persönlichen Gegner aus den
Universitäten hinausprügelten, wieder in Amt und Würden. Für mindestens zwei
Jahrzehnte senkte sich der Mantel des Schweigens über diese Geschehnisse.
Es bedurfte offenbar einer neuen Generation, um diese Fragen wieder anzugreifen. Die
Diskussion heute spielt sich hauptsächlich am Begriffszwilling "Opfer / Täter" ab. In der
unmittelbaren Nachkriegszeit versuchte man, den österreichischen Beitrag zum Nazismus
unter den Teppich zu kehren. Lepsius taufte diese Vorgangsweise "Externalisierung": Der
Nationalsozialismus wurde zu einem Ereignis außerhalb der eigentlichen österreichischen
Geschichte. Seit den 60er Jahren hat sich allerdings die Lage grundsätzlich geändert. Einen
Sprung bedeutete die politische Auseinandersetzung rund um Kurt Waldheims
Präsidentschaftskandidatur und die folgende Präsidentschaft. Ohne in die allzu komplexen
150
vielen Problematiken einzusteigen, welche diese Episode des österreichischen politischen
Lebens berührte, sollen nur zwei angesprochen werden. Das eigentliche
innerösterreichische nationale Problem war Waldheims Rechtfertigung seiner
Handlungsweise als "Pflichterfüllung" und damit die Desavouierung aller offiziellen
Stellungnahmen zur österreichischen Vergangenheit. Waldheim scheint dies auch dann
nicht begriffen zu haben, als sich die Auseinandersetzung entgegen seinen Erwartungen
nach seinem Amtsantritt nicht beruhigten.
Österreichs Bild in der Waldheim-Affäre in Frankreich, nicht zuletzt auch geprägt von der
selektiven Wahrnehmung der innerösterreichischen Diskussion. Die bösartige Karikatur
wurde von Le Monde gleich zweimal veröffentlicht, einmal nach dem ersten Wahlgang, ein
weiteres Mal nach dem endgültigen Wahlsieg Waldheims im zweiten Wahlgang
Überhaupt war seine Sensibilität für solche Fragen nicht vorhanden, womit er sich mit
einem erheblichen Teil der Österreicher und sicherlich einem Großteil seiner Wähler traf.
Kennzeichnend ist der Stil, in dem er später seine Aussagen zu erklären und auch zu
entschuldigen (im doppelten Sinn) versuchte - er ist rein bürokratisch-taktisch:
"Sicher habe ich anfangs unterschätzt, wie sehr die Beurteilung meines
persönlichen Schicksals zu einer großen Auseinandersetzung um den Weg
Österreichs in der Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg führen würde... Was ich
mit jener Pflichterfüllung ausdrücken wollte - es aber offenbar nur
unvollständig und ungenau tat - , war jenseits der kameradschaftlichen Hilfe
die Unfähigkeit meiner Generation zur freien Entscheidung. War die Ohnmacht
des Zwangs. Nur sehr wenige haben es damals geschafft, diese Fesseln des
Zwangs zu sprengen, unter dem Risiko, ihr eigenes Leben einzubüßen. Ich habe
151
nicht zu ihnen gehört" (Fernseh-Ansprache vom 19. Mai 1987, in: Waldheim
1992, 228).
In ähnlicher Weise war sein Verhalten gegenüber dem Problem des österreichischen
Antisemitismus bestimmt. Es war ein Taktieren zwischen den von ihm begriffenen
"außenpolitischen" Notwendigkeiten einer Distanzierung und dem augenzwinkernden
Haschen um die Stimmen und allgemein die Zustimmung jener in Österreich, welche sich
bis heute nicht von dieser Haltung lösen konnte. Tatsächlich hat die Wahlkampagne des
schließlich siegreichen Kandidaten eine bestimmte Form des Antisemitismus offenbar
wieder öffentlichkeitsfähig gemacht. Daß überzogene und teils absurde Vorwürfe von
außen dies förderten, ist unter das Stichwort "Rationalisierung" einzureihen.
Rationalisierung kennzeichnet sich immer dadurch, daß sie an einem grundsätzlich
berechtigten Punkt ganz andere Anliegen aufhängt.
Hier liegt der Parallelfall der Schweiz auf der Hand, wie er leicht verhüllend im Nachbarland unter dem Titel
“Schatten des Zweiten Weltkrieges” diskuttiert wird. Auch dort wurde die Debatte von außen (insbesondere
der selbst ethisch keineswegs über alle Zweifel erhabene und ständig unter Korruptionsvorwürfen stehende,
mittlerweile abgewählte republikanische Senator Alphonse D’Amato, N.Y.,33 aber auch ein britischer
Abgeordneter) eröffnet und kam dadurch erst in Gang. Doch auch dort wird die Aufarbeitung erschwert durch
Faktoren, die mit der Debatte selbst nichts zu tun haben. Man scheint in Westeuropa und den USA offenbar
gewillt, die Schweiz für ihre Eigenständigkeit zu ‘bestrafen’. “Was das Land lange als positiven Mythos
gepflegt hatte, der Alleingang und das Sich-Heraushalten aus ‘fremden Händeln’, wird ihm jetzt als
Zerrspiegel hingehalten.”34 Explizit wird dabei auch die “Europafrage” erwähnt. Auch dort gibt es eine
Intellektuellengruppe, die sich nur zu gerne an die internationale Kampagne anhängt. Und schließlich regt
sich auch dort ein verschämter Antisemitismus infolge der prominenten Rolle, die der Jüdische Weltkongreß
spielt. Das Kennzeichnende an dieser Beteiligten ist aber etwas, was man nicht eher erwartet: Während sich
Israel weitgehend zurückhält, spielt die Hauptrolle eine Person, bei der man keineswegs an antisemitische
Stereotypen denken wird, wenn man sie sich unvoreingenommen ansieht - wohl aber an andere: Bronfman
tritt in einer Art auf, wie man ihn viel eher im “ugly American” verkörpert sieht: Der arrogante Staatsbürger
einer Weltmacht und Präsident eines multinationalen Konzerns, der eben nicht dulden will, daß man seinen
Anweisungen nicht nachkommt, in seiner ganzen Handlungs- und Sprechweise außerordentlich “Yankee”. Im übrigen hat die Schweiz nicht unähnmlich reagiert wie Österreich: Sie hat eine Historikerkommission
eingesetzt, welche den Tatsachengehalt der Vorwürfe einmal klären soll. Darüberhinaus setzte sie aber einen
innenpolitisch umstrittenen Schritt: Sie kündigte eine Solidaritätsstiftung für politisch Unterdrückte überhaupt
ein, welche mit dem außerordentlich hohen Betrag von 7 Mrd. Sfr. geäufnet werden soll.
Mit dieser ganzen Auseinandersetzung kam aber ein weiterer Prozeß ins Laufen, der
seinerseits die Waldheim-Affäre in einem rationalisierenden Sinn für die eigenen Politund sonstigen Neurosen einsetzten. Diejenigen, die sich heute mit Österreich und seiner
Vergangenheit auseinandersetzen, tun dies in der Regel in einem höchst "selbstkritischen"
Sinn. Gleichzeitig behaupten sie aber, nur einem Ausnahmefall Österreich endlich auf die
Sprünge zu helfen, da dieses sich im Gegensatz zu anderen Gesellschaften so gar nicht der
Aufarbeitung seiner historischen Probleme widmen wolle. Gerade das Gegenteil ist seit
33
Das ist besonders verlogen, wenn man beachtet, wie sehr die USA in dieser Hinsicht selbst Schuld auf sich
geladen haben. “In 1939 ... the U.S.-Congress defeated a bill that would have rescued 20.000 children
from Nazi-Germany notwithstanding the willingness of American sponsors to provide for the children,
on the grounds that such a large immigration would exceed the quota allotted to German immigration”
(Piatt 1990, 18).
34
NZZ, 15./16. März 1997: Verunsicherte Schweiz. Suche nach einem neuen Selbstbild und nach innerer
Kohärenz. - Besonders deutlich wird dies in einem Artikel der New York Times vom 5. Feber 1997:
“The Neutrality Myth” (Thomas L. Friedman): “Too many Swiss still insist on being morally neutral,
on trying to live off the international system without being fully part of it.”
152
einem Jahrzehnt richtig. Wie sehr dies gilt, wird einem bewußt, wenn man sich historisch
vergleichbare andere Gesellschaften ansieht.
In der Festung Akershus im Hafen von Oslo wird den Besuchern auch ein Norwegisches Widerstandsmuseum
angeboten. In Norwegen hat es in der Zeit der deutschen Besatzung ja immerhin nicht nur eine beachtliche
Kollaboration gegeben, sondern auch eine norwegische Marionettenregierung. Doch man verzichtet in diesem
Museum sogar auf die naheliegende bewährte Technik, die Kollaboration einer winzigen Gruppe von
Gekauften anzulasten. Die Kollaboration kommt in dieser Ausstellung überhaupt nicht vor - es geht immer
nur gegen die deutschen Besatzer. Vidkun Quisling entdeckt man einmal auf einem nicht erläuterten Photo.
Andere Namen werden auch nicht genannt. Hamsun ist tabu. Eine Aufarbeitung dieser Epoche ist somit kein
Thema. Als Österreicher ist man an die Zeit in unserem Land bis etwa 1965 erinnert, welche die Jahre 1938
bis 1945 entweder ganz unterschlug, oder aber sie nur mit einigen wenigen, politisch opportun und daher von
ihrer realen Bedeutung her äußerst schief ausgewählten Widerstandsgruppen (das Hochjubeln von "O5" etwa)
besetzte. - Ein zweites Beispiel: Wenn Robert Menasse anklagend auf das "eigentümlich späte Zugeständnis"
einer österreichischen Mitschuld an den Nazi-Verbrechen hinweist, so ist dies und vergleichbare Situationen
keineswegs eine österreichische Spezialität - ganz im Gegenteil. "Der überwiegende Teil der
Kriegsgeneration ist in Österreich unfähig gehalten worden, auf seine eigene Vergangenheit einen kritischen
Blick zu werfen... Denn die österreichische Kriegsgeneration identifiziert sich in ihrer Mehrheit nach wie vor
mit ihrem damaligen Tun" (Haslinger 1987, 21). Dazu läßt sich - eher zufällig - eine Zeitungsmeldung aus
der Zeit der Niederschrift dieses Berichtes zitieren: "Die Niederländer, die sonst so gerne mit dem erhobenen
Zeigefinger durch die Welt laufen und im Verhalten anderer Länder eine scharfe Trennungslinie zwischen
'falsch' und 'richtig' zu ziehen pflegen, scheuen noch stets vor der Auseinandersetzung mit der eigenen
Kolonialgeschichte zurück... Unterschwellige Schuldgefühle über die eigene koloniale Vergangenheit
[führen] immer wieder zu emotionsgeladenen Auseinandersetzungen... "35
Der Einsatz von psychoanalytischen Konzepten in der Geschichte ist problematisch. Nicht deswegen gilt dies,
weil diese Konzepte dafür grundsätzlich nicht verwendbar wären. Ganz im Gegenteil: Wenn man mit Weber
davon ausgeht, daß Gesellschaft sich immer im Verhalten, im Bewußtsein wie im Unbewußten des
Einzelmenschen verwirklicht, wird der Einsatz psychoanalytischer Überlegungen bei sozialen Grundprozessen (Sozialisation, Auswahl des erwünschten wie des sanktionierten Verhaltens) für den Theoretiker
geradezu unvermeidlich. Doch üblicherweise werden diese Konzepte nicht analytisch eingesetzt. Es handelt
sich meist um Mode-Vokabeln, die nicht sosehr aufklären als vielmehr die Strukturen vernebeln. Die
Beschäftigung mit dem NS ist geradezu ein Musterbeispiel für diesen Vorwurf. Trotzdem wollen wir hier die
Vermutung äußern: Diese neue "Vergangenheitsbewältigung" entspricht vor allem einem Strafbedürfnis der
Beteiligten aus den heute lebenden Generationen gegen die Eltern / Älteren, welche die Ungeheuerlichkeiten
des 20. Jahrhunderts geschehen ließen und vielleicht sogar an ihnen mitwirkten. Hier stellt sich allerdings
eine Frage: Muß zum Bedürfnis, sich von diesen Verbrechen immer wieder zu distanzieren, nicht auch eine
gewisse psychische Kontinuität zu diesen Älteren / Eltern hinzukommen, um die Heftigkeit der
Auseinandersetzung nach einem halben Jahrhundert begreifbar zu machen?
Diese Vergleiche könnten mißverständlich sein. Selbstverständlich werden Schriftsteller,
die in Österreich leben und oft nicht glücklich über die österreichischen Verhältnisse sind,
sich kritisch mit diesen Verhältnissen auseinandersetzen. Der Hinweis soll im wesentlichen
besagen, daß Österreich auch im Umgang seiner Bevölkerung mit der eigenen
Vergangenheit ein außerordentlich typisches westeuropäisches Land ist, nicht
fortgeschrittener und aufgeklärter, aber sicher nicht stärker verzögert, wie so oft behauptet.
Es bedeutet eine völlig neurotische Fixierung auf dieses, das eigene Land, das Verhältnis
seiner Bevölkerung zu ihrer Vergangenheit als einzigartig österreichisch darzustellen, und
gemeint ist damit eine Abqualifizierung. Vielleicht deswegen kommen einem einige
möglicherweise nicht ganz dem mainstream entsprechende Gedanken in den Sinn. Ist, vom
Standpunkt eines nationalbewußten Österreichers, die Art der Aufarbeitung immer
35
NZZ, 22. August 1995: "Delikater Besuch Königin Beatrix in Indonesien. Holland zwischen kolonialem
Schuldgefühl und Veteranentrotz."
153
besonders glücklich? Es ist ja eine recht dialektische Angelegenheit. Für "Bilder der
Konstruktion einer österreichischen Identität" ist das "Konstruktionsprinzip nicht zuletzt
die Ausklammerung des Beschämenden" (Petschar/Schmid 1990, 13). Das allerdings ist
keine österreichische Spezialität. Schon Ernest Renan (1992 [1882]) - siehe oben - hat
darauf hingewiesen. Dieses von ihm angesprochene Vergessen und der "Irrtum", man kann
auch sagen: die konstruierte Geschichte, ist selbstverständlich in mehrerer Hinsicht
problematisch. Das Verschweigen und die Verfälschung der eigenen Geschichte ist ja keine
akademische Angelegenheit allein. Sie hat sich darüberhinaus - wie konsequente
Verdrängung immer - als nicht besonders zielführend erwiesen. Wenn man allerdings die
Verdrängung als individuellen tiefenpsychologischen Mechanismus nennt - und dies ist
berechtigt, weil es sich nicht nur um eine Analogie handelt, sondern weil sich die
"Vergangenheitsbewältigung", wie soziale Wahrnehmung und die Aufarbeitung dieser
Wahrnehmung immer, letztendlich auf der individuellen Ebene konkretisiert - , so muß
daran erinnert werden, daß sie ein fundamentaler Prozeß psychischer Integration ist. Jeder
Mensch verdrängt vieles aus seiner Vergangenheit. Nicht Verdrängung an sich, sondern
mißlungene Verdrängung führt zur Neurose. Eine andere Seite der Sache ist es somit, wenn
man bei nicht wenigen jener, die sich an der Aufarbeitung heute beteiligen, einen
regelrechten Österreich-Haß feststellen muß. Das erinnert an den Selbsthaß, wie er etwa
von Wilfried Daim paradigmatisch an Adolf Hitler diagnostiziert wurde, und wie er, in
weniger pathologischer Form, tatsächlich nicht selten bei "Deutschen" (Deutschnationalen)
in der Monarchie ebenso wie in der Ersten Republik, und manchmal auch noch in der
Zweiten, auftrat. Und die Diktion der hier gemeinten Gruppe - die noch besprochen wird erinnert in sehr unangenehmer Weise an die haßerfüllten Ergüsse französischer Faschisten
Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre gegen ihre eigene Nation, an Drieu la Rochelle,
Charles Mauras oder Robert Brasillac, die in ihrem Haß gegen die französische ohnehin
höchst unvollkommene Demokratie die Niederlage gegen Nazi-Deutschland feierten.
Schließlich sollte man nicht vergessen: In der so hart kritisierten Haltung des "Vergessens"
und "Verdrängens" manifestiert sich auch eine Distanzierung von der eigenen dunklen
Vergangenheit. Sie ist also nicht nur Scham, sondern auch der psychische Ausdruck für
eine andere politische Wahl, die tatsächlich zur Grundlage der österreichischen Nation bis
nahe an die Gegenwart wurde: Die (s. u.) auch schon auf eher dümmliche Weise kritisierte
Option "Kleinstaat Österreich" stand dem NS-Wahnsinn mit seinem Versuch einer
Weltherrschaft diametral gegenüber. Auch die Externalisierungs-These kann auf diese
Weise gesehen werden. Auch sie ist eine Facette der Annahme einer Kleinstaatenrolle.
Insoferne ist die langsame Akzeptanz der Täter-Rolle in der Gegewart sogar eine
zweischneidige Angelegenheit, denn sie drückt auch den rückwärtsprojezierten Wunsch,
vor allem der politischen Klasse, aber auch mancher Teile der Bevölkerung, aus, doch noch
einmal Teilhaber an der Großmacht zu sein, die damals aber eben vom Nazi-Reich und
seinen Monstrositäten verkörpert wurde.
In diesem ist Belang das vielleicht wichtigste Symbolereignis gegenwärtig die sogenannte
"Wehrmachtsausstellung" und die Diskussion darum, aus der sich die politische Klasse
vorerst sorgfältig heraushielt. Dieses neutrale Abseitsstehen wurde im Sommer 1996
allerdings in der Vorbereitung der Aufstellung nicht zufälligerweise in Kärnten gestört,
nachdem die Ausstellung vorher bereits in Wien und Innsbruck ohne größeren Eklat zu
sehen war. Dabei versuchten sich offenbar aus durchsichtigen Motiven einige Vertreter der
ÖVP, vor allem der glücklose Ex-Parteiobmann und -Landeshauptmannstellvertreter
Scheucher, durch besondere Ausfälligkeiten zu profilieren. Einen etwas anderen Charakter
154
trugen die Wortmeldungen einiger ehemaliger Spitzenleute der SPÖ Kärnten. Sie kommen
bekanntermaßen aus dem "nationalen" Eck, wie man noch immer verhüllend den
Deutschnationalismus und meist auch die nähere Umgebung des Nationalsozialismus in
Österreich mancherorts bezeichnet. Damit sind sie persönlich betroffen und ließen die
Gelegenheit, sich in Erinnerung zu rufen, auch nicht vorübergehen. Die jüngere Generation
der Partei ließ sich aber vorerst davon nicht sehr beeindrucken, zumal sie bei diesem
Thema die Bundespartei hinter sich wußte. Offensichtlich lassen sich allerdings mit
solchen Themen nicht nur ältere Segmente der Bevölkerung aus der Reserve locken. Auch
Teile der politischen Klasse, zumal, wenn sie selbst davon betroffen sind, verlieren die
Contenance. In dieser Hinsicht liegen die Parallelen zum Fall Waldheim auf der Hand. Wie sehr dies gilt, zeigt sich nicht nur an den österreichischen Ausstellungen, sondern noch
stärker in Bayern, wo dieselbe Ausstellung vonseiten insbesondere der CSU Reaktionen
hervorgerufen hat, wie sie in Österreich allenfalls am Biertisch, kaum aber in der
Öffentlichkeit geduldet werden. Die mitteleuropäische “Normalität” ist also für Österreich
nur zu deutlich.
Das Kennzeichnende an dieser Ausstellung ist imgrunde, daß sie nichts bringt, was in der
Fachwelt nicht seit zwei Jahrzehnten anerkannt ist. Doch durch den Schritt aus der
Fachwelt hinaus in eine Öffentlichkeit wurde eines der Schlüsselarrangements gestört.
"Saubere Wehrmacht - verbrecherische SS", und irgendwo dazwischen die Waffen-SS
funktioniert plötzlich nicht mehr zur Entlastung. Damit bricht der Schutzschild zusammen.
4.2 Provinzialismus versus Offenheit oder Zentrum gegen Peripherie?
4.2.1 Anschlußgelüste heute in der BRD und der Nachvollzug in Österreich
Die deutsche Haltung gegenüber Österreich ist offiziell die eines befreundeten
benachbarten Staates. Ganz so bruchlos lief dies aber nicht. Als sich schließlich Mitte der
'50er die Neutralisierung Österreichs abzeichnete, reagierte etwa der deutsche Bundeskanzler Adenauer ausgesprochen giftig auf diese Politik. Was Wunder: Hatte er selbst doch
eine Vereinigung Deutschlands, wie sie ihm in der Stalin-Note vom März 1953 angeboten
worden war, abgelehnt und der Westintegration geopfert. Mit dieser vertanen historischen
Chance war nicht nur die deutsche Geschichte der nächsten vier Jahrzehnte bestimmt.
Auch die europäische Entwicklung war damit für diesselbe Zeit festgelegt, und in
Wirklichkeit auch darüber hinaus. Interessant ist, daß dieses Adenauer'sche Bild des
treulosen Österreich selbst in der Gegenwart noch (oder z. T. wieder) bei deutschen
Historikern (Erdmann u. a.) auftaucht. Darüberhinaus gibt es in manchen journalistischen
Kreisen immer wieder Versuche, Österreich zumindest national, wenn schon nicht
staatlich, anzuschließen. Dies ist keineswegs ein Anliegen extremistischer Marginalkreise.
Vielmehr hat sich zum Sprecher dieser nationalistischen Personengruppen die FAZ
gemacht. In größeren Abständen bringt sie immer wieder ziemlich umfangreiche Artikel,
welche belegen sollen, daß die Österreicher eben doch Deutsche seien. Diese Ansprüche
basieren auf einem ziemlich altmodischen Sprachnationalismus. Und immer wieder spricht
sie damit einen neuralgischen Punkt ihrer Leserschaft an; denn deren Reaktion besteht
gewöhnlich in wochenlangen Stellungnahmen über Leserbriefe. Offenbar ist die nationale
Selbständigkeit Österreichs noch immer ein Stachel im Fleisch großdeutschen
Nationalismus'.
Das letzte Beispiel fand ich in dieser Zeitung in der Ausgabe vom 22. Juli 1995: Reinhald
Olt, Zumpf aus dem Latz. Sprechen Österreicher deutsch? In der Alpenrepublik feurige
Debatten über die Nation und ihre Sprache. Schludrig geschrieben wie der Artikel ist, läuft
155
er auf ein einziges Argument hinaus: Es gibt keine österreichische Hochsprache, also auch
keine österreichische Nation. Das Wort "national" in Bezug auf Österreich wird stets in
Anführungszeichen gesetzt.
4.2.2 Die Frage der Sprache
Dies bietet die Gelegenheit, auf die Mißverständnisse und oft genug auch die schlicht
nachhinkenden Konzepte in der politischen und meist auch in der historischen Debatte zu
nationalen Fragen hinzuweisen, wie sie zwar in der Sozialwissenschaft lang überwunden
sind, in der allgemeinen Öffentlichkeit und teilweise auch in der Geschichtswissenschaft
hingegen noch gang und gäbe sind. So findet sich in einem neu erschienenen Handbuch zur
deutschen Geschichte (Fried 1994, 63) die Formulierung: "... die Sprache, das heute allein
entscheidende Ordnungskriterium..." Ähnlich wird, ganz ähnlich, wie in diesem
Zeitungsartikel, selbst in Fachpublikationen über die Sprachgeschichte offenbar aus einem
nicht auszurottenden nationalen Egozentrismus die Entwicklung einiger westeuropäischen
Nationalsprachen, des Niederländischen etwa, als ihre "Absonderung" vom Deutschen
bezeichnet (Schildt 1976, 102). Doch aus der Analyse geht der Prozess ganz anders hervor:
Das Niederländische entstand als eigene Hoch- und dann Nationalsprache, weil sich in
diesem Gebiet aufgrund fortgeschrittener soziökonomischer Entwicklung früher als im
späteren deutschen Raum ein "Ausgleichungsprozess" abspielte, also ein Prozeß der
Vereinheitlichung und Standardisierung. Was sich also historisch "abgesondert" hat, war
das später erst vereinheitlichte Deutsch als Hochsprache, das sehr spät (nämlich im 19.
Jahrhundert) erst zur Nationalsprache wurde. Diese Korrekturen sind wesentlich, weil sie
unmittelbar auch für den Prozess des österreichischen und des deutschen Nationenaufbaues
gelten. Die österreichische Nation hat sich nicht "abgespalten", wenn man die große Masse
des Volkes betrachtet - sie hat sich in einem sehr späten Vereinheitlichungsprozess aus
vielen regionalen Komponenten neben einer deutschen (und italienischen, und
schweizerischen, und tschechischen, ...) Nation entwickelt.
Eine völlig andere Frage ist nun jene, welche die österreichische Variante der deutschen
Sprache im Bewusstsein der Bevölkerung und als Symbol wirklich spielt. Darüber gibt es
seit einiger Zeit eine zwar nicht reichliche, aber desto aufschlussreichere Literatur aus
literatur- und sprachwissenschaftlicher Sicht (Adel 1964, Muhr 1995). Sie versuchen, das
zu betonen, was insbesondere Literaten (und auch z. B. im zitierten Artikel der FAZ) nicht
einmal begriffen, geschweige denn thematisiert haben. Man hat oft über den Terminus der
„deutschen Unterrichtssprache“ in den Zeugnissen der Zweiten Nachkriegszeit gespöttelt.
In Wirklichkeit wäre dieser Ausdruck, was immer die Motivation der Schulbürokratie war,
eine analytisch sehr zutreffende Bezeichnung, ähnlich etwa dem „Rundfunk-Spanisch“ der
lateinamerikanischen Ländern oder Ähnlichem des arabischen Raums.
Deutsch ist eine plurizentrische Sprache, ähnlich wie Englisch, Spanisch, in deutlich
geringerem Ausmaß auch Französisch – eine Sprache, deren Weiterentwicklung nicht von
einem einzigen autoritativen Zentrum aus gesteuert wird, weil sie in mehreren Ländern
verbreitet ist und dort jeweils den Status einer National- oder Staatssprache hat. Das
Verhältnis zwischen diesen Zentren ist aber häufig unsymmetrisch. Man hat dabei DNationen (dominierende Nationen) und A-Nationen (andere) diagnostiziert. "D-Nationen
betrachten ihre Nationalvarietäten im allgemeinen als Standard und sich selbst als Träger
der Standardnormen.... Kultureliten der A-Nationen unterwerfen sich den Normen der DNationen... Die D-Nationen haben bessere Mittel als die A-Nationen, ihre Varietät durch
den Fremdsprachenunterricht zu 'exportieren'. Das liegt an den Forschungsinstituten, an der
156
Kultur- und Sprachpolitik und an den Sprachlehrinstituten, die sich dort befinden" (Muhr
1996a, 36). Diese Situation finden wir mustergültig im Verhältnis zwischen Österreich und
der BRD. Es gehört zu den Kennzeichen der Abhängigkeit, daß sie in der Regel nicht
reflektiert wird. Im Gegenteil: Wer sich nicht fraglos nach den Außennormen richtet, wird
ironischerweise als "nationalistisch" eingestuft, gegenwärtig schon ein fast bedrohliches
Ettikett. "Hier wurden die Purifizierungsmaßstäbe des 19. Jhdts. als Maßstab genommen,
die übrigens dazu geführt haben, daß das Deutsche auf sehr eindringliche Weise
vereinheitlicht wurde. Es ist jener Zustand, um dessen 'Aufweichung' man sich heute
Sorgen macht... Solche Skrupel kennen Sprecher dominierender Varianten kaum, ... Aber
offensichtlich gibt es 'mächtige' und 'nicht so mächtige' deutsche Dialekte" (Muhr 1996b,
17f.). Die Ironie dieser Umstände liegt nicht zuletzt darin, daß dieser Anwurf selbst auf
einer sprachnationalistischen Auffassung des 19. Jahrhunderts beruht, nämlich, es gäbe nur
eine einzige, naturgegebene Variante einer Sprache. Darüberhinaus erstaunt die Naivität,
wie hier ein Soziolekt, nämlich die präferierte Variante einer Intellektuellengruppe, zur
allgemein verbindlichen Sprache erklärt wird, und das nach einer jahrzehntelangen
Diskussion der Soziolinguistik, die sich hauptsächlich auf diesen Punkt konzentriert hat.
Das österreichische Deutsch wird aufgrund einer mehrdimensionalen Abhängigkeitsbeziehung nicht nur von Deutschen, sondern auch von den meisten Österreichern als
dialektal eingestuft - eine Frage kultureller Dependenz, die nicht zuletzt auf einer gerade im
Literaturbetrieb ausgeprägten wirtschaftlichen Abhängigkeit beruht. Wer literarisch Gehör
finden will, muß in einem deutschen Verlag publizieren. Die Folge ist: "Die derzeitige
Diskussion um die Merkmale der Varianten des Deutschen [dreht sich] gewissermaßen im
präskriptiven Korrekturkreis: Was kodifiziert wurde, erscheint in den Texten und was nicht
kodifiziert ist, wird aus diesen entfernt," von den deutschen Lektoren nämlich (Muhr 1995,
210). Soziale Orientierung wird auch durch die Sprache als Super-Symbol vermittelt.
Imgrunde verhalten sich nicht wenige der (zugegebenerweise nicht gar so bedeutenden)
österreichische Literaten wie die assimilationsorientierten Mitglieder ethnischer
Minderheiten, die nicht überangepaßt genug sich möglichst schnell ihrer eigenen
Muttersprache und oft damit verbunden auch ihrer offenbar irgendwie gefürchteten
Identität entledigen möchten.
Es gibt auch Versuche, aus dem Sprach- und Sprechverhalten typenbildende Dispositionen
und ihre Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland abzuleiten: "Für das Verhalten
in Kommunikationssituationen lassen sich bereits auf der Ebene der
Gesprächsvorannahmen Unterschiede feststellen. In Österreich sind die Fakten
Personalisierung, Hierarchisierung, Harmoniehaltung, Gesichtsbewahrung, Situationshandeln, Normenambivalenz, Wirklichkeitsmanipulation und Humor wichtige gesprächssteuernde Elemente. Dem stehen in Deutschland Sachbezogenheit, Konstanz, Wirklichkeitsüberhöhung und Ernsthaftigkeit als handlungsleitende Vorannahmen gegenüber. Auf
einer noch tieferliegenden Ebene Alterorientierung und Personenorientierung als zentrale
Handlungskategorien annehmen, d. h. daß Ausgehen von / Einbeziehen der Wünsche(n)
des anderen, bei gleichzeitiger Zurückhaltung mit eigenen Forderungen und Schützen des
Gesichts des anderen wichtige Kulturstandards darstellen. Bei (west-) deutschen Sprechern
kann demgegenüber archetypisch die Egoorientierung und Sachorientierung als zentrale
Handlungskategorie vermutet werden.... Auf österreichischer Seite ergibt sich daraus das
zentrale Ziel der Konfliktvermeidung, Harmonieerhaltung sowie nur verdecktes Äußern
von Kritik und indirektes (ironisches) Abwertungsverhalten. Besonders westdeutsche
Sprecher neigen dagegen viel eher zu offener Konfliktaustragung, Norm- und
157
Zielerhaltung, zu offen geäußerter, direkter Kritik und zu direktem Abwertungsverhalten"
(Muhr 1995, 230 f.).
Trotz einer vorwiegend nichtsprachlichen Definition der eigenen nationalen Identität, trotz
eines weitverbreiteten Unbehagens gegenüber sprachnationalistischen Einstellungen in
Österreich machen aber nicht wenige Österreicher auch an ihrer Sprache, am
österreichischen Deutsch, die Abgrenzung gegenüber den Deutschen fest. In einer
soziolinguistischen Untersuchung kommt dies sehr deutlich heraus: "Danach wird von der
Mehrheit der Interviewten eine eigene Hochsprache angenommen und häufig auch mit der
nationalen Eigenständigkeit Österreichs in Verbindung gebracht... Von der Mehrheit (ca.
90 %) der Befragten wird eine scharfe Trennung zur Bundesrepublik vollzogen, selbst was
die Sprache des Burgetheaters betrifft... Das Österreichische wird aber generell positiver
eingeschätzt als die Sprache in der BRD" (De Cillia 1995, 6). Wenn man in Betracht zieht,
daß eben das österreichische Deutsch als D-Sprache zu sehen ist, wäre dies selbst von der
Warte eines Nationen-Theoretikers, der analytisch stets gegen den Fetisch Sprache als
Kernbereich nationaler Existenz aufklärend wirken möchte, verständlich: Es ist eine
Stellungnahme gegenüber den Einvernahmungs- und Dominanzversuchen, die sich hier
ausdrückt.
Wie sehr Sprache in einer vom Sprachnationalismus bestimmten Debatte verknüpft sein
kann mit unterschiedlichen politischen Projekten und es oft auch ist, zeigt die Entwicklung
aus einer anderen kleinen europäischen Nation. In Norwegen gibt es heute noch zwei
unterschiedliche Schriftsprachen, die offiziell gleichberechtigt, jedoch äußerst
umgleichgewichtig verteilt sind: das Nynorsk und das Bokmål. Das Nynorsk entstand im
19. Jahrhundert im Zuge einer nationaldemokratischen Bewegung, die schließlich zur
norwegischen Unabhängigkeit führte. Das Bokmål als in Norwegen gesprochenes Dänisch
war die Sprache der Mittel- und Oberklassen in den Städten (Haugland 1980), man könnte
auch ohne weiteres sagen: der Kompradorenbourgeoisie. Das Landsmål als die Grundlage
der neuen Sprache, die auf westnorwegischen Dialekten aufbaute, war die Sprache der
weniger geschichteten Gesellschaft dieses Landesteiles und wurde auch zu einer
entscheidenden Cleavage im Parteiensystem, weil es von den politisch modernisierenden
Kräften gegen die Konservativen gestützt wurde. Tatsächlich bedeutet das Jahr 1885, als
die Nationalversammlung die Gleichberechtigung der neuen Schriftsprache beschloß, einen
Wendepunkt. Allerdings ist es kennzeichnend, daß heute von 4 Fünftel der Bevölkerung
die alte Schriftsprache benutzt wird: Zwar haben die Liberalen und die in dieser Frage nur
wenig engagierten Sozialisten politisch reüssiert. Die großbürgerliche und patrizische
Hegemonie in den alten Zentren, vor allem Christiania / Oslo blieb doch erhalten.
4.2.3 Burgtheater – Großmythos und Kulturkampf
In Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um das österreichische Deutsch und seinen
komplexen Symbolwert steht auch ein anderer kulturpolitischer Kampfkomplex, der allerdings insgesamt noch einmal wesentlich komplexer und vielschichtiger ist, nicht zuletzt,
weil sich dabei wiederum die unterschiedlichen Perspektiven eine Auseinandersetzung
liefern. Das Burgtheater, gegründet als Hoftheater, ist eine der Austragungsstätten eines
innerösterreichischen Kulturkampfes, in dem sich die unterschiedlichsten Motive mischen.
Da ist zum einen der Versuch, mit der Fortführung der Hoftheater-Tradition jene geistige
"Großmachtstellung" und jenen "geistigen Imperialismus" genüge zu tun, von dem weiter
vorne schon die Rede war, und der einen Ersatz für die politische Großmachstellung bilden
sollte. Doch da hinein spielen auch die Inhalte, die in einem Theater klarerweise nicht zu158
letzt in der Form bestehen. Die alte Form (manche sprechen von einem "SchauspielerTheater") symbolisiert die schon lange überwundenen Inhalte. Schließlich spielt auch das
Verhältnis Deutschland - Österreich hinein, und zwar gar nicht am Rande. Was allerdings
diese Auseinandersetzung transportiert, ist weniger offensichtlich. Hier muss man daran
erinnern, dass nicht wenige Auseinandersetzungen mit dem "Preußentum" nach dem Kriege einigen Modernisierungsmaßnahmen galt, welche die Nazis in Österreich implementiert
hatten. In der Abwehr des "Deutschen" finden wir also auch das Motiv eines Antimodernismus wieder. Nationale Identität wird in diesem Zusammenhang eingesetzt, um die
bedrohte Stellung einer bestimmten Personengruppe und damit jene der von ihr repräsentierten Schicht zu verteidigen - etwas, was ja gar nicht so selten vorkommt. Man könnte
dies im Grunde für eine groteske Überschätzung des Potentials eines mittelmäßigen Kulturbetriebs halten. Doch da nun einmal diese Arena als Schauplatz der Auseinandersetzungen
gewählt wurde und dient, ist es eine politische Symbolauseinandersetzung wie andere eben
auch, von nicht mehr, aber auch von nicht weniger Gewicht.
In diesen Auseinandersetzungen spielt sich zeitverschoben wieder und wieder das ab, was
bereits oben (3.3.2) für die Bewältigung der neuen Situation in der Nachkriegszeit gesagt
wurde, und was auch gerade im Abschnitt über die Sprache nochmals anklang: "Im
Zeichen des demokratischen Neubeginns sah sich 1918 die Erste und nach 1945 die Zweite
Republik gerade aus der Not der Kleinstaatlichkeit auf den überkommenen konservativen
Kulturbegriff verwiesen. Als Kulturgroßmacht, als 'Geisteskontinent' (Friedrich Heer), ja
als wahrer Erbe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ließ sich die politische
Zurücksetzung wenigstens halbwegs verschmerzen. Bis heute prägt denn eine Mischung
aus Unterlegenheitsgefühlen und Größenphantasien die kulturelle Identität Österreichs
insbesondere gegenüber Deutschland. Und generell hat, was 'das Ausland dazu sagen
[wird] (Egon Friedell), für die Seelenlage der Nation eine eminente Bedeutung... Die Gründung der Salzburger Festspiele 1920 ist ganz der Idee eines überzeitlichen österreichischen
Wesens und Menschentums in Musik, Theater und Literatur verpflichtet, und auch die
Bregenzer Festspiele knüpfen 1946 an die geistige Mission Österreichs an."
Der dies schreibt, ist der Kulturredakteur erst recht wieder einer einflussreichen ausländischen
Zeitung – diesmal allerdings einer, welche aus einer Nation kommt, die mit ihrer Kleinstaatenrealität bislang nicht die geringste Schwierigkeit hatte, ganz im Gegenteil, sie stets als Vorteil sah:
Es ist die Neue Zürcher Zeitung.36 Die Ironie mag darin liegen, dass gerade diese Zeitung – zusammen mit der von ihr sonst so bekämpften Schweizer Sozialdemokratie – zur Wortführerin einer
Strömung geworden ist, die im Gleichschritt mit dem Zeitgeist nun doch mit dem bisherigen nicht
nur bescheidenen, sondern auch komfortablen Status der Schweiz nicht mehr zufrieden ist und
unbedingt eine verstärkte Außenabhängigkeit will.
4.2.3 Personalisierung: Robert Menasse oder Erwin Ringel – eine Alternative?
Der Essayist und Romancier Robert Menasse steht hier eher zufällig, weil er einen
bestimmten Typus des österreichischen Literaten verkörpert. Es könnte genausogut
Gerhard Roth oder Nils Jensen oder André Heller sein. Schon differenzierter argumentiert
etwa Josef Haslinger. Menasse ist jene politische etwas unbedarfte Figur, nicht mehr ganz
36
Der zitierte Text findet sich in der Einführung zum Kulturteil einer umfangreichen und durchaus
qualitätsvoll gestalteten Beilage mit dem Datum des 30. Mai 1996. Die sonstigen Beiträge des
kulturell-feuilletonistischen Abschnitts sind zum erheblichen Teil von Österreichern geschrieben (u. a.
von: W. Müller-Funk, Rudolf Haller, R. Burger, B. Tschofen, u. a.).
159
jung, aber sicher noch nicht alt, der an den Verhältnissen leidet, oder dies zumindest
vorgibt. Ein Schriftsteller-Kollege, Antonio Fian, ironisiert (Standard, 20./21. Mai 1995):
"Möglich ist auch, daß Roth, Measse usw. etwas durcheinanderbringen, daß sie, deren
Karriere zeitlich zusammenfällt mit der Blüte der Sozialdemokratie in Österreich, deren
Krise, vielleicht Niedergang verwechseln mit dem Untergang der Republik." Diese Figur
des Literaten gibt es überall. Auch die Klage über die Verständnislosigkeit der "Masse" ist
überall zu hören - sie bedeutet übrigens etwas anderes, als oberflächlich gesagt wird: Diese
"Masse" ist gewöhnlich jener überwiegende Teil der Elite, zu der man selbst gehört, die
einem jedoch die Anerkennung versagt.37 Die österreichische Besonderheit besteht auch
nicht in der Illusion, daß es anderswo grundsätzlich besser sei. Auch diesen Topos finden
wir auf der ganzen Welt. Die Besonderheit besteht in der Aggressivität, mit der das eigene
Unbehagen und Ungenügen nicht sosehr anderen oder der Gesellschaft im allgemeinen
(wie z. B. in den 60er und 70er Jahren), sondern einer ganz bestimmten nationalen
Gesellschaft als solcher angelastet wird. Hören wir den Originalton:
"'Österreichische Identität' - dieser Begriff hat etwas von einem dunklen und muffigen
Zimmer, in dem man, wenn man aus irgend einem Grund eintritt, sofort die Vorhänge
beiseite schieben und das Fenster öffnen möchte... Wieder leben wir in einer Endzeit...
Kein Land der Welt hat sich selbst öffentlich so wenig problematisiert und grundsätzlich
reflektiert, wie die Zweite österreichische Republik... Meines Wissens ist die Zweite
Republik Österreich der einzige Nationalstaat, der sich zu seiner Nationswerdung
entschlossen hat, und, das ist gewiß einmalig, dessen Nationswerdung wesentlich außenpolitische Gründe hat..." Und natürlich darf auch der Angriff auf die "Kleinstaaterei" nicht
fehlen; usw. (Menasse 1992, 7, 8, 12, 18).
Hanisch (1996, 141 f., 143) nennt dies in ironischer Anlehnung an die seinerzeitigen
Fastenpredigten und "Volksmissionen" die "große Predigt über die Zweite Republik" von
Menasse, Haslinger, Roth, Fleck, Beckermann,...: Die Unfähigkeit, Handlungsspielräume,
strukturelle Zwänge und Motivation der Menschen in einer bestimmten historischen
Situation korrekt zu analysieren, dafür die selbstgerechte Rückprojektion der
gegenwärtigen Zeitstimmung, des aktuellen Diskurses, der eigenen individuellen
Befindlichkeit auf die Vergangenheit. Die Unfähigkeit, komplexe Gemengelage adäquat zu
begreifen, Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen genau aufzuschließen, eine
erschreckende historische Halbbildung, die sich der Mühe der Analyse entzieht und mit
einigen flotten Sätzen über die Probleme hinweg tänzelt... Der Selbsthaß heute erodiert die
demokratischen Grundlagen der Zweiten Republik." Karl-Markus Gauß drückt es im
selben Sinne, jedoch kürzer und prägnanter aus: “Was mich an den modischen Verächtern
Österreichs so stört, ist, daß sie im Grunde dasselbe Bild von Österreich haben, wie die
alten Verklärer Österreichs. Nur drehen sie die Wertung um. Ihr ganzes kritisches
Vermögen ist auf diese Fähigkeit geschrumpft, dasselbe zu sagen, aber es mit anderen
Vorzeichen zu versehen” (in: Salzburger Nachrichten, 22. November 1997). Das, was so
seltsam anmutet, ist, daß in diesen Ergüssen die konkreten Probleme kaum zur Sprache
kommen, sondern zum einen ein eher abstrakter Begriff - "österreichische Identität"
geprügelt wird, und zum anderen eine Fülle von Halbwahrheiten und tradierten
Gemeinplätzen angehäuft werden. Noch einmal Fian: "Sie sind Österreicher, wie von
37
Das hat man auch manchmal direkt ausgesprochen: "... die Masse, die nicht nur in den untersten Schichten
aufzusuchen ist...", wird Bruno Bauer in der "Heiligen Familie" zitiert, MEW 2, 142.
160
ihnen selbst beschrieben: in keiner Rolle sich wohler fühlend als der des Opfers, ...
opportunistisch, voll vorauseilendem Gehorsam" gegenüber dem anvisierten deutschen
Publikum. Was hier also stattfindet, ist keineswegs "Vergangenheitsbewältigung" - es ist
Fetischisierung nicht nur dieser Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart. Es ist die
Fortsetzung des "Schwarzen Mythos" Österreich, den es seit spätestens dem Vormärz gibt.
Das Ergebnis ist Gegenaufklärung und nicht Bewußtsein. Die Rationalität geht vollständig
verloren. Es bleibt einzig eine ziemlich dumpfe Emotion. Es gilt hier, was ein durchaus
wohlwollender Rezensent ziemlich ironisch über Gerhard Roth geschrieben hat: "Statt das
österreichische <Zwillingspaar 'Lüge und Wahrheit'> auseinanderzudividieren,
reproduzieren sie [Roths tagespolitische Stellungnahmen] es. So erscheint Roth als Teil des
Problems, das er mit beträchtlicher und dennoch unzureichender Tiefenschärfe analysiert...
Da ist, gemessen am aufklärerischen Anspruch, oft gar viel Rhetorik dabei, ... [eine]
eigentümliche Mischung aus Sensibilität und Borniertheit" (A. Breitenstein, in: NZZ, 17. 8.
1995). Das Erstaunliche daran ist, daß dies offenbar die Befindlichkeit einer gewissen
intellektuellen Öffentlichkeit trifft. Nun wäre dies prinzipiell das Problem dieser
Öffentlichkeit selbst. Nachdenklich macht allerdings, daß diese Strömung mit einer
benennbaren politischen Strömung zusammentrifft, die keineswegs vernachlässigbar ist,
und die gegenwärtig auf die Aufgabe österreichischer politischer Eigenständigkeit abzielt.
Der Aufruf zum neuerlichen "Anschluß", im Frühsommer 1995 von diesem selben
Menasse erhoben und vermutlich ursprünglich nicht mehr als eine billige Provokation,
bekommt im Lichte dessen eine neue Qualität.
Besser verständlich wird Menasses antiösterreichischer Affekt, wenn man ihn gegen die
Ausführungen einiger - nennen wir sie: apologetischer - "Österreich-Theoretiker" stellt, die
eine gar zu naive Version des "Goldenen Österreich-Mythos" pflegen, der seinerseits
bereits in die Endzeit der Monarchie zurückgeht - und zwar nicht zu den geistig
fruchtbarsten Intellektuellen damals. Meist schon älter und nicht selten hochdekoriert, läßt
sich ihre Haltung als "Österreich wie es ist über alles" zusammenfassen. Als Beispiel für
diese Gruppe kann Erwin Ringel stehen. Auch hier ist die Auswahl in dem Sinne zufällig,
daß durchaus andere Namen stehen könnten. In einer Mischung aus einigen popularisierten
Begriffen der Psychoanalyse, erhobenem Zeigefinger und Unterwürfigkeit gegenüber
Teilen der politischen Klasse geht jeder Ansatz zur Kritik unter. Auch hier wird der
Originalton besser als jede langatmige Ausführung die Sache erhellen. Die Passagen
stammen aus Ringels letzter Publikation, doch die Argumentation war zehn Jahre früher
(Ringel 1984), als die Formulierungen noch nicht im selben Maß durch das fortgeschrittene
Alter gekennzeichnet waren, nicht grundlegend anders:
"Es geht uns gut und wir können zufrieden sein... Politikverdrossenheit ist eine Art
Krankheit... [Nichtwähler] begehen ein extremes Unrecht." - Die "Kritiker und Verteufler
von Politik und Politikern [bringen] sicherlich keine Verbesserung". - In Österreich gibt es
die "grauenhafte Tendenz", von Politikern immer mehr zu verlangen, "auf der anderen
Seite aber ihre Gehälter immer mehr reduzieren zu wollen". - Politiker, "verhaltet euch so,
daß ihr liebenswert seid!... Man muß dem Kind und dem Bürger immer wieder von neuem
die Motive des eigenen Handelns erklären", usw. (1993, 23, 25 und 24, 32 und 31).
Dieses Sammelsurium von unbedingter und kindlicher Verteidigung einiger politischer
"Väter und Mütter", wie es derzeit sicherlich kein Partei-Funktionär mehr in der
Öffentlichkeit auszusprechen wagen würde, wird unter dem Stichwort der
"österreichischen Identität" ausgeboten. Es ist nicht so unähnlich wie in der Ersten
161
Republik: Wenn die jedes kritischen Blickes gegenüber der Macht entbehrenden Vertreter
des status quo ihre Haltung mit dem Vokabel "österreichisch" maskieren, kann dies nur zur
Ablehnung bei allen führen, die diesem status quo nicht völlig unkritisch gegenüberstehen.
Auch hier wird der Charakter der (nationalen) Identität als politisches Projekt wieder ganz
offensichtlich. Daß dieser Begriff damit diskreditiert und von jüngeren und weniger
saturierten Geistern als "muffig" empfunden wird, kann nicht verwundern.
4.2.4 Die Gegenstimmen
Eine Möglichkeit der Reaktion findet sich, wenn sich das Ringelspiel weiter dreht und auf
Grund solcher wenig qualifizierten Österreich-Beschimpfungen andere wiederum zu einem
eher unkritischen Österreich-Bild kommen, wo sie sich - nicht zuletzt im Hinblick auf das
"Ausland", vor allem "Amerika" – zur Apologie verpflichtet fühlen: "Die mangelnde
Aufarbeitung [der Nazi-Vergangenheit – Anm.]... ist nun buchstäblich aus den Fingern
gesogen. Alle Publikationen, Radiosendungen, Parlamentsdebatten und politischen
Diskussionen setzten sich nach dem Krieg intensivst mit dem Nationalsozialismus und
seinen Verbrechen auseinander" (Butschek 1996, 19). Das ist ein bißchen naiv, weil es
natürlich auf die Art der Auseinandersetzung ankommt. Es wird darüberhinaus schrecklich,
wenn die Anzahl der Todesurteile als Indikator für die gelungene Entnazifizierung
herangezogen wird.
Es gibt allerdings mittlerweile auch qualifizierte Wortmeldungen, und d. h., daß eine
Debatte in Gang kam, die nicht mehr nur auf der einen Seite völlig unkritische "Kritiker"
und auf der anderen Seite Apologeten à la Ringel sieht. Ein gewisses Aufsehen erregte
Holzer (1995), zumal ihr Buch in einem bekannten Publikumsverlag erschien, was auf eine
vergleichsweise hohe Auflage schließen läßt. Nach einer Auseinandersetzung mit
deutschen Anschlußgelüsten unterschiedlichster Provenienz, doch ziemlich gleichbleibenden Tones - "von deutschen Tönen hellhörig gemacht begann ich österreichische Töne
verstärkt wahrzunehmen" (S. 45) – , nimmt sie die Herausforderung jener ÖsterreichBeschimpfer auf, von denen vorhin die Rede war. Sie nimmt den Ausdruck Fians vom
"gnadenlos Guten" auf und weist dessen Anmaßungen zurück, insbesondere den Anspruch
auf das Monopol in "Vergangenheitsbewältigung" und die maßlose und damit schon
wieder nicht eben intelligente Überschätzung der österreichischen Rolle in der Genese von
Antisemitismus und Nazismus: "Solche österreichzentrierten Beobachtungen setzen die
Außerachtlassung der übrigen Welt sowie die Geschichte der Juden in (Alt-) Österreich
und insbesondere in Wien voraus... Die Entdeckung späterer Generationen, daß es viele
österreichische Täter gab, und ihre Schlußfolgerung, daß man ihnen dies bisher
verheimlicht habe, und alle Untaten angeblich ungesühnt blieben, beruht aber einzig und
allein auf Ignoranz, zumindest aber selektiver Wahrnehmung der Nachkriegsgeschichte"
(S. 79, 120). Und nach einer langen und gutdokumentierten Auseinandersetzung benennt
sie präzis Wirkung und Funktion:
"Das gnadenlos Gute beschreibt aber nicht die Krise; es ist selbst Teil davon. Es ist
Ausdruck und Motor eines Komplexes, der, gewiß unwillentlich und unwissentlich,
Widerstandskräfte schwächt. Wer Grundfesten österreichischer Existenz als Lügen und
Mythen in Frage stellt, bewirkt nicht Besinnung, sondern verstärkt Fluchttendenzen und
Orientierungslosigkeit... Ich halte es aber mit dem österreichischen, vor den Nazis
geflohenen und in der Fremde des amerikanischen Exils gestorbenen Schriftsteller Anton
Kuh, der österreichische und andere Gespenster bereits sah, als sie noch nicht in SS- und
Wehrmachtsuniformen auftraten... Zu ihnen zähltn die Geringschätzung, bestenfalls halb162
herzige Verteidigung des angeblich allzukleinen und provinziellen Österreich als lebensunwert, unrealistische Träume von kulturellen und anderen Missionen, Deutschnationalismus, Intoleranz, Autoritätsgläubigkeit, Duldung und Förderung einseitiger Abhängigkeit,
insbesondere von Deutschland, Mangel an politischem Grundkonsens und Demokratie,
österreichischer Minderwertigkeitskomplex und deutsche Maßlosigkeit" (137, 55f.).
Dies scheint einige der Beteiligten ins Weiche getroffen zu haben. Die Antwort ist völlig
unsachlich und besteht imgrund aus dem Schimpfwort "Hobbyzeithistoriker" (Rathkolb
1996, 128), das man dem nichtkonformen Kritiker, in diesem Fall Butschek, entgegenschleudert, und dem Vorwurf, sich inhaltlich mit Haider zu treffen. Auch Anton Pelinka
greift in einer Buchbesprechung zu Holzer (ÖZP 3/1995, 360f.) in dieselbe Schublade,
wenn er ihr entgegenhält: "Hat Holzer sich einmal gefragt, wie ein Herr Nimmerrichter
wohl über ihre Polemiken denkt, die sich ja mehr oder weniger gegen dieselben richten, die
regelmäßig in der Kronen-Zeitung fertiggemacht werden?" Der Hinweis, daß "keiner dieser
Bezüge mit einer Quellenangabe belegt" und daher "methodisch fragwürdig" sei, ist
entweder unrichtig - denn das Buch wimmelt von solchen Angaben - oder aber polemischunfair, weil er von einem auf ein großes Publikum gerichteten Sachbuch ja wohl nicht im
Ernst eine formale Zitierweise nach willkürlichen Regeln irgendeiner Fachwissenschaft
erwarten wird.38 Zu Recht meint Matzner (1996), daß man mit dieser Form der
Auseinandersetzung die Ebene der berechtigten Gegenkritik verläßt und in die
Pauschaldenunziation abgleitet (im Rahmen der Auseinandersetzung in der Europäischen
Rundschau vgl. auch Washietl 1996).
4.2.5 Reflexion und Konsequenzen
Nationale Identität ist nicht erst heute eine ambivalente Erfahrung. Sie wurde jedoch in der
Zwischenzeit zu einer Exhortation, der man mit Mißtrauen begegnet. Nationale Identität als
intellektuelle Phantomidentität muß sich die Frage gefallen lassen, ob sie die entsprechende
Antwort auf die Herausforderungen zeitgenössischer Gesellschaften ist. Beladen mit der
wahrhaft schwer zu (er)tragenden Tradition so vieler toter Geschlechter, von denen nicht
wenige getötet wurden, ist sie manchen zu belastet. Offen bleibt aber die Frage, was an ihre
Stelle treten könnte. Gibt es bereits eine neue Qualität jener Erfahrung des "Gleich-Seins",
die genügend Integrationskraft hat, um die Gesellschaften zusammen zu halten?
Supranationale Tendenzen in Westeuropa als Vorspuren einer nachnationalen Gesellschaft
sind erst recht wiederum intellektuelle Konstrukte, welche nicht die Erfahrungen und auch
nicht die Bedürfnisse eines Großteils der Bevölkerung wiedergeben. Die Bedürfnisse der
Intellektuellen sind zu respektieren. Eine andere Sache ist es, diese Bedürfnisse einer
widerstrebenden Bevölkerung aufzudrängen.
4.3 Großmachtträume versus Kleinstaatenrealität
Viele österreichische Politiker der Zweiten Republik haben die Eigenschaft des
wiederentstandenen Staates als "ein kleines Land" in den Vordergrund gestellt. Das war
nicht nur als faktische Aussage über die Bevölkerungsanzahl oder die militärische Macht
des Landes gemeint, sondern als ein politisches Programm. Österreicht hat "sich aus der
38
Daß natürlich auch einmal ein Fehler vorkommen kann - ich denke dabei an die Nennung Hermann
Langbeins unter den polemischen Österreichkritikern - , ist eine Selbstverständlichkeit und sollte
gerade von jemendem nicht überbewertet werden, der selbst viel publiziert und damit auch dem Risiko
von Fehlern ausgesetzt ist.
163
Geschichte herausgeschwindelt." Diese Aussage allerdings ist - jenseits ihrer pejorativen
Formulierung - nur für eine gewisse Zeit richtig, nämlich für die Ära Kreisky und hier
wieder insbesondere für das, was man "aktive Neutralitätspolitik" genannt hat. Das
eigentliche Problem war lange Zeit das Gegenteil.
Die Frage der Größe eines Staates ist tatsächlich ein erstrangiges demokratiepolitisches
Problem. Es geht um die Dialektik zwischen der Notwendigkeit von Größe und Macht als
wesentliches Element einer "Sicherheitsgemeinschaft" und der für effektive und
nichtentfremdete (bzw. entfremdende) Partizipation erforderlichen zahlenmäßigen
Beschränkung, deren kritischer Schwellenwert mit Sicherheit erheblich unter dem unteren
Schwellenwert für eine funktionierende Sicherheitsgemeinschaft liegt. Es geht also um die
Vereinbarkeit von innerer Selbstbestimmung, dem demokratischen Kernelement par
excellence, und äußerer Unabhängigkeit. Dieser Antagonismus ist keineswegs neu und
wurde viel diskutiert. Schon Hume (1985, 255)rühmt die Großmacht wegen ihres Beitrags
zur allgemeinen Sicherheit: "Private men receive greater security, in the possession of their
trade and riches, from the power of the public." Die beste Zusammenfassung aller
Argumente, welche für größere Ausdehnung und mehr Macht sprechen, finden wir in dem
gegenwärtig für Europa überaus aktuellen klassischen Text, der vor 200 Jahren als
"Federalist Papers" (Rossiter 1961) bekannt wurde. Die Gegenargumente finden wir nicht
nur in den Rousseau'schen Texten, sondern auch in jener breiten und diffusen
zeitgenössischen Strömung, welche wir ein wenig belächelnd unter dem Slogan "Small is
beautifull" zusammenfassen, und für welche der Name des Österreichers Leopold Kohr zu
einem Symbol wurde.
Den Verfassern der "Federalist Papers" ging es um den Aufbau eines souveränen Staates
aus 13 sehr viel kleineren Einheiten, mit Karl W. Deutsch' Worten, um eine "amalgamierte
Sicherheitsgemeinschaft". Ihre Argumente waren ziemlich einseitig militärischer Art, und
auch der Ausdruck "Sicherheitsgemeinschaft" verleitet zu einer solchen Verengung. Doch
in den Beziehungen zwischen modernen Gesellschaften und Staaten sind andere Aspekte
von mindestens ebensolcher, wenn nicht von größerer Bedeutung. Die Frage der (äußeren)
Abhängigkeit stellt sich heute zumindest im Westen vor allem als wirtschaftliches
Problem. Diese Frage allerdings hat viele Facetten, und nur eine unter ihnen ist die
Wirtschaftspolitik anderer Staaten. Wenn etwa das Unternehmen Mercedes Benz eine
Umsatzsumme (1994) von DM 60 Mrd., der österreichische Bundeshaushalt aber im selben
Jahr nur Ausgaben von etwas über öS 730 Mrd. hat, die weitgehend durch gesetzliche
Bestimmungen gebunden sind, so bezeichnet dies ein Kräfteverhältnis. Es geht um den
Spielraum von Politik überhaupt. Nicht umsonst heißt ein erfolgreiches Buch eines
bedeutenden Ökonomen der letzten Jahrzehnte "Sovereignty at Bay" (Vernon 1971), also
etwa: gefährdete Souveränität.
Neben dem Konzept der amalgamierten bietet uns Deutsch auch noch jenes der
"pluralistischen Sicherheitsgemeinschaft" an. Sie kennzeichnet sich dadurch, daß die
Souveränität grundsätzlich nicht an eine höhere Ebene übertragen wird. Sie könnte eine
Lösung für das Problem von Demokratie und Durchsetzungsfähigkeit anbieten. Da aber
hier "Souveränität" natürlich nicht im Sinne des fetischisierten Begriffes der Jurisprudenz
(oder einer konservativen Staatsphilosophie) verwendet wird, sondern einfach in jenem der
autonomen Entscheidungsmöglichkeit und -fähigkeit, stellt sich wiederum die Frage nach
der Gestaltung einer solchen pluralistischen Sicherheitsgemeinschaft. Auch sie kann bei
einer Fehlkonstruktion der demokratischen Kultur im Wege stehen. Es ist jedenfalls die
164
vielleicht wichtigste und weitreichendste nationale Frage der Gegenwart, und zwar nicht
nur in Westeuropa. Diese Frage wird in der Schweiz z. B. wesentlich gründlicher diskutiert
als in Österreich. Doch interessanterweise war die Schweiz in einer Zeit Vorbild für
Österreich, als sich diese Frage eher nicht in derselben Brisanz stellte wie heute.
Ständige Gewaltandrohung gegen jene, welche nicht so wollen wie die Großmacht, ist eine Versuchung, der
solche Mächte nie entgehen. In diesem Sinn sind sicherlich die USA heute weltweit die größte Gefährdung
von Demokratie. Doch dies wird auf Dauer auch für das innere System gelten. Ständiger Gewalteinsatz ohne
irgendeine (international) legale Rechtfertigung und die arrogante Verachtung von vertraglich vereinbarten
Umgangsformen (“Völkerrecht”) in Kombination mit einem hochtechnisierten militärisch-industriellen
Komplex können auf Dauer auch im Inneren nicht ohne Folgen bleiben.
4.3.1 Die ideologische Grundlage
Es ist unter dem Blickwinkel des ideologischen Charakters nationaler Orientierungen nicht
verwunderlich, wenn sich alle jene, welche einer österreichischen Identität nachgehen, auf
Intellektuelle, gewöhnlich auf Schriftsteller beziehen. Doch gerade in Österreich ist dies
nicht einfach. Hier kommt der Sonderfall dieses Landes zu tragen. Österreich und seine
Nation wurde ursprünglich nicht aus einem solchen Mythos, aus einer "nationalen Idee"
heraus konstruiert. Im Gegenteil: Jene, welche die Mythen produzieren, standen zum ganz
überwiegenden Teil auf jener Seite, welche eine Zugehörigkeit der Österreicher zu einer
"deutschen Nation" (die auch erst im Aufbau war) behaupteten. In diesem Sinn muß man
also höchst wählerisch vorgehen, wenn man Zeugnisse eines Österreich-Bewußtseins etwa
im 19. Jahrhundert finden will. Schließlich genügt es nicht, als Zeugnisse dafür eine
zurückgebliebene literarische oder politische Kultur anzuführen - denn das ist es oft, was
unter "österreichisch" verstanden wird.
In der Folge sollen einige fundamentale Züge und Bruchlinien dieses und eines potentiellen
alternativen Projektes dargestellt werden. Sie standen vom Anfang des österreichischen
Nationalprojektes an zur Debatte. Doch sie reichen bis in die Gegenwart weiter und sind
gegenwärtig sogar besonders aktuell geworden.
4.3.2 Intellektuelle und Macht - ein eindeutiges oder ein dialektisches Verhältnis?
Nationale Identität ist essentiell ein intellektueller Begriff. Er ist gleich in mehrerer Weise
ein Begriff von und für Intellektuelle. Wozu braucht "das Volk", d. h. jene, die nicht zur
engeren herrschenden Gruppe gehören, eine nationale Identität? Eine selbstverständliche
ethnische Alltagsidentität hat es ja. Diese gibt ihm jene soziale Identität, welche eine
Schütz'sche "natürliche" Einstellung ist, und welche alle Menschen zu ihrer Orientierung in
der Welt benötigen. Intellektuelle hingegen, und das gehört auch zur weiteren Semantik des
Begriffes, haben eine platonische Tendenz, einen Geschmack für die Macht. Dafür
benützen sie die Nationale Identität, geschrieben gewissermaßen mit Majuskeln, solange
diese ihnen sinnvoll erscheint. Wenn sie auf andere Weise Macht erlangen können, können
sie im Gegenteil auch andere Schlagwörter einsetzen - von der "internationalen" bis zur
"europäischen Solidarität" .
"Der nationale Streit zwischen Tschechen und Deutschen war mir bis dahin [1889] weder
in Süd- noch in Nordmähren als eine besondere Gefahr für das Reich erschienen, da weder
die Bauern noch die kleinstädtischen Bürger an ihm teilhatten, und was die studierten Leute
trieben, war doch wohl nicht so bedeutungsvoll, daß es den Staat als Ganzes, wie damals in
meiner Vorstellung lebte, berührt hätte."
Renner 1946, 194
165
Was Intellektuelle also unter einer solchen Identität verstehen, ist üblicherweise somit sehr
verschieden von dem ethnischen Selbstverständnis - man könnte auch formulieren: von der
Selbstverständlichkeit des Ethnischen - der Volksschichten. Für sie ist nationale Identität
eine Herrschaftsideologie und eine Herrschaftstechnik. Dementsprechend versuchen sie,
anstelle der Alltagsidentität einen manchmal kunstvoll aufgebauten nationalen Mythos
zustande zu bringen. Diese Mythen konkurrieren miteinander, oder es konkurrieren die
Interpretationen eines allgemein akzeptierten Mythos.
Hans Kelsen, Rechtspositivist und als jener, welcher den wichtigsten Entwurf der österreichischen
Bundesverfassung geschrieben hat, ein einflußreicher Rechtspolitiker, war ein brilianter Jurist. Er war
gleichzeitig allerdings ein Formalist mit wenig Verständnis für dialektische Entwicklungsprozesse. Ihm war
jedoch die repräsentative parlamentarische Demokratie ebenso ein Herzensanliegen wie eine strikte Legalität
als Sicherung der Freiheit. Und so raisoniert er über den Zusammenhang zwischen demokratischer
Willensbildung, Verwaltung ("Legalität") und Demokratisierung: "Die Idee der Legalität gerät auf einer
gewissen Stufe der staatlichen Willensbildung mit der der Demokratie in Konflikt" (1967, 22). Und: "Eine
radikale Demokratisierung der durch die Dezentralisation gebildeten Mittel- und Unterinstanzen bedeutet
geradezu die Gefahr einer Aufhebung der Demokratie der Gesetzgebung... Dem Willen der Glieder kann nur
auf Kosten des Willens des Ganzen Spielraum gewährt werden" (23 und 25). Der sozialdemokratische
Theoretiker hat hier die konservativen Eliten der österreichischen Bundesländer und Gemeinden vor Augen.
Trotzdem geht er, der als eines der Hauptziele seiner "Reinen Rechtslehre" (des Rechtspositivismus) die
Ideologiekritik bezeichnet (69), gleich in eine Reihe ideologischer Fallen:
Er setzt einen einheitlichen "Volkswillen", "Allgemeinwillen" und damit wohl auch ein einheitlichesVolk
voraus, anstelle zu erkennen, daß es durch institutionelle Zentralisierung erst konstituiert wird. Der
Parlamentarismus ist der wichtigste Ausdruck dieses Prozesses und dieser Institutionen. Was die Demokratie
betrifft, hat er wenige Seiten vorher das Geheimnis des Parlamentarismus ausgesprochen: Dieser soll "eine
exzessive Überspannung der demokratischen Idee in der politischen Wirklichkeit verhindern" (19). So
vermag Kelsen es nicht, die demokratische, d. h. herrschaftsmindernde, Funktion eines dezentralen
politischen Aufbaues zu erkennen. Überhaupt betrachtet er in einer Schumpeter vorwegnehmenden Weise
Demokratie ausschließlich als Mittel der Führungsauswahl und vermag nicht als wesentlichen Zug jenes
System der sich gegenseitig kontrollierenden Teilinstitutionen (der "checks and balances") der
Herrschaftsminimierung zu identifizieren. Dezentralisierung, etwa als Föderalisierung, ist eines der
effizientesten Mittel im Rahmen jener "checks and balances". Wir haben schon früher darauf hingewiesen,
daß lokale und regionale Eliten dies gleichzeitig oft als Instrument ihrer Machterhaltung zu benutzen
versuchen. Das gehört nun einmal zur politischen Dialektik. Trotzdem bleibt das demokratische Potential der
Dezentralisierung bestehen und wird mit erhöhter sozialer Partizipation auch in sich vergrößerndem Maßstab
aktualisiert.
Sein Zeitgenosse Carl Schmitt (1985 [1926]) war als beinharter Konservativer gleichzeitig realistischer und
dogmatischer. Sein Dogmatismus lebt sich aus in einer Mischung von auf die Spitze getriebenem juristischen
Formalismus mit einer hegelianisch-preußischen Geschichtsauffassung. Doch sein Realismus läßt ihn nach
den Voraussetzungen von Parlamentarismus und Demokratie - die er formalistisch ebenso streng scheidet wie
die "Diskussion" von der interessensgeleiteten "Verhandlung" - fragen. Und seine Antwort ist bei aller
Überspitzung von höchstem Interesse für den Demokratie- wie den Nationentheoretiker. Unter Berufung auf
Rousseau benennt er Homogenität der Staatsbürgerschaft als die erste Notwendigkeit. Doch die "Substanz der
Gleichheit", der "politischen Homogenität", kann für ihn nicht im "liberalen Gedanken" der
"Menschheitsdemokratie" bestehen: "In der Demokratie englischer Sektierer des 17. Jahrhunderts gründet sie
sich auf die Übereinstimmung religiöser Überzeugungen. Seit dem 19. Jahrhundert besteht sie vor allem in
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, in der nationalen Homogenität" (14). Hier zeigt sich der
Realismus des konservativen Fundamentalisten mit der Hochwertung des Bestehenden ("alles, was besteht,
istnützlich, nicht mehr und nicht weniger" - S. 7), dem er allerdings fundamentalistisch eine noch höhere
Bewertung der platonischen Eliten aufsetzt: "Ob das Parlament tatsächlich die Fähigkeit besitzt, eine
politische Elite zu bilden, ist sehr zweifelhaft geworden", polemisiert er gegen Max Weber (8). Doch
gleichzeitig zeigt sich auch die Verhaftetheit in ganz und gar zeitgenössischen Konzepten, denn die nationale
Homogenität ist ihm nicht etwa eine Homogenität der Grundwerte, wie sie auch Liberale wie Rawls nicht nur
akzeptieren, sondern sogar voraussetzen. Sie ist ihm eine substantivierte Homogenität des Willens, die er
auch und vielleicht noch mehr, formaljuristisch wahrscheinlich zu Recht, ausdrücklich auch Diktaturen
166
zubilligt, die damit in einer Verkehrung jeden Sinnes zu den besseren Demokratien werden: "In der
Geschichte der Demokratie gibt es manche Diktaturen, Cäsarismen und andere Beispiele auffälliger, für die
liberalen Traditionen des letzten Jahrhunderts ungewöhnliche Methoden, den Willen des Volkes zu bilden
und eine Homogenität zu schaffen... Die Krisis des heutigen Parlamentarismus ... ist der in seiner Tiefe
unüberwindliche Gegensatz von liberalem Einzelmensch-Bewußtsein und demokratischer Homogenität" (22
f.). Von hier zur Anerkennung der Notwendigkeit, den "Fremden" auszugrenze, "das Ungleiche, die
Homogenität Bedrohende zu beseitigen" , ist kaum noch ein kleiner Schritt, und Schmitt wird ihn auch in der
politischen Praxis gehen.
Was uns aber hier mehr interessiert, ist zweierlei: (1) Die Homogenität der Grundwerte ist tatsächlich die
Voraussetzung aller Prozeduren von Demokratie, wie wir sie bisher kennen. Nation als Projekt ist eine
Formulierung, welche einen solchen dynamischen Prozeß und seinen Output benennt. Diese Formulierung
weigert sich allerdings gleichzeitig, die Homogenität in irgendeiner zugeschriebenen Form, von der
"Abstammung" über die Sprache bis zu symbolträchtigen Zügen der angeblich verbindlichen Alltags-Kultur,
zu substantivieren. - (2) Doch die Realität dieser Notwendigkeit auch in ihrer zahlenmäßigen - aber nicht
willkürlichen bzw. aufgedrungenen Form durch irgendeinen der genannten Faktoren - Beschränkung zu
leugnen, ist Ausfluß von Wunschdenken. Wenn der Kreis der demokratisch Beteiligten den weitesten Kreis
der "Mitmenschen" (Schütz) überschreitet, also jenen weitesten Kreis der möglichen Angehörigen einer Sinnund Zugehörigkeitswelt, wandeln sich vorher demokratische Prozeduren in solche einer aufgepropften volonté
générale, wie sie Carl Schmitt so wohlwollend betrachtet. Ob die Agentur, welche diese Art von politischer
Gleichheit in der homogenen Substanz herstellt, dann eine aufgeklärte Bürokratie ist, oder sogar ein aus
allgemeinen Wahlen hervorgegangenes Parlament, ist dann nahezu gleichgültig. Beide werden nicht die
Zugehörigkeitswelten der Bürger repräsentieren, die dadurch wieder in den Untertanen-Status zurück sinken.
Die Völker (Bevölkerungsgruppen) des Habsburgerstaates realisierten dies, als man ihnen die Möglichkeit
der Repräsentation gab. In der Gegenwart stellt sich das Problem neu in der Weise, wie politische EliteGruppierungen als gelehrige Schüler von Carl Schmitt (von der politischen Klasse bis zu einem erheblichen
Teil der Intellektuellen) versuchen, ihre Zugehörigkeitswelten dem Rest der Bevölkerung aufzudrängen.
Deren Zugehörigkeitswelten sehen ganz anders aus. Die Folgen für die Zukunft drängen sich aus solchen
Reflexionen auf, wurden bisher aber weder konsequent durchgedacht noch auch in empirisch
nachzuvollziehender Weise untersucht.
4.3.3 Noch einmal ein Rückblick
Nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel das Habsburger-Reich und dem heutigen Österreich
wurde der Anschluß an das größere Deutschland verboten. Für die "Deutschen" der
Monarchie wurde dies zum Schlüsselerlebnis im Hinblick auf die neue Republik. Das gilt
keineswegs nur für die in der Monarchie politisch dominanten Konservativen. Auch die
Sozialdemokratie versuchte ihre Desorientierung mühsam zu überspielen, indem sie von
der "österreichischen Revolution" sprach und damit den Ereignissen in ihrer Rhetorik eine
positive Wendung zu geben versuchte. Für den größeren Teil der Parteiführung, die völlig
auf den Habsburgerstaat ausgerichtet gewesen waren, bedeutete dies aber nicht viel mehr
als einen schwachen Trost und auch eine Selbsttäuschung. Ihr Gefühlshaushalt war völlig
auf die Zugehörigkeit zur dominanten Nation des "Reiches" ausgerichtet gewesen.
Nationen sind großgesellschaftliche Sinneinheiten, oder müssen dies jedenfalls binnen
kurzem werden, wenn sie bestehen wollen. Das bedingt es, daß sie im Bewußtsein ihrer
Angehörigen soziale und politische Bezugsgrößen sind, die deutlich abgegrenzte Einheiten
darstellen. Für die politische Klasse und den Großteil der Intellektuellen des neuen
Österreichs nach 1918 waren diese Charakteristiken nicht gegeben. Die einen orientierten
sich auf die Großmacht nebenan, die anderen auf die moribunde Möchtegern-Großmacht
der Vergangenheit. Wie aber war es mit der Bevölkerung? Ein Zerfall nicht nur des Staates,
sondern einer ganzen damit verbundenen Ordnung mußte in ihr tiefe Spuren hinterlassen;
das ist plausibel und kaum zu bestreiten. Das ist jenes Thema, welches wir mit dem Begriff
der Anomie ansprachen. Trotzdem ist die Unterscheidung zwischen Bevölkerung und
politischer Elite hier von größter Bedeutung.
167
Der Großteil der Bevölkerung findet seine Bezugseinheit im Rahmen des in der Reichweite
begrenzten Alltags im lokalen und regionalen Bereich. Alltag, das ist "jener Bereich der
Wirklichkeit, in dem uns natürliche und gesellschaftliche Begebenheiten als die
Bedingungen unseres Lebens unmittelbar begegnen, als Vorgegebenheiten, mit denen wir
fertigzuwerden versuchen müssen" (Schütz/Luckmann 1990, II, 11). Nun sind aber
politische Klasse bzw. Elite, wenn sie diese Charakterisierung überhaupt verdient, nicht
nur juristisch-politisch Repräsentanten der Bevölkerung. Sie haben auf zumindest jenen
Teil der Lebenswelt, welche sich als "Politik" darstellt, gestaltenden Einfluß. Die
Orientierungslosigkeit der Elite und deren unterschiedliche Versuche einer Neuorientierung
mußten somit profund auf die Bevölkerung zurückwirken. Dies galt umso mehr, als die
autoritären Züge der verblichenen Monarchie ja keineswegs mit ihr verschwunden waren.
Man kann das Ergebnis dieser Konstellation vielleicht am besten so formulieren: Das
nationale Problem Österreichs der ersten Nachkriegszeit war ein Problem der
Intellektuellen und der politischen Klasse, welche diese zu einem Problem der
Bevölkerung machte. Die Orientierungslosigkeit der Elite wurde der Bevölkerung mitgeteilt und von ihr - allerdings in sicherlich weniger dramatischer Form - übernommen.
Eine nackte und unverhüllte und ungemischte Katastrophe war der Zerfall der Monarchie
für die Konservativen, vor allem die katholisch orientierten: "Reiche sind geborsten,
Zivilisationen zerstört, Kulturen erledigt, die Welt ist wie aufgelöst in ein Chaos von
Kämpfen und Sorgen" (Das Neue Reich, 1923, 858). Für sie war nicht nur der politische
und geistige Bezugsrahmen verschwunden. Sie waren zudem aus der Position der
unbestrittenen politischen Führungsgruppe und des geistigen Hegemons verdrängt worden.
Es war nicht nur der Zusammenbruch des Großstaates, sondern vor allem der Monarchie,
welche ihnen selbst die kulturelle Legitimierung nahm. Die Frage der "Lebensfähigkeit"
Österreichs war so in Wirklichkeit die soziale und politische Überlebensfrage dieser
Gruppen und Schichten. Die Katholiken waren mehr in der politischen Klasse selbst
vertreten, konnten aber nicht zuletzt den Großteil des flachen Landes hinter sich sammeln.
Es waren, neben der politischen Klasse, besonders bestimmte IntellektuellenGruppierungen, welche die "Lebensunfähigkeit" des neuen Staates zu ihrem
Lieblingsthema machten und damit - durchaus gewollt - zum späteren Untergang dieses
Staates beitrugen. Eine besondere Rolle spielten die akademischen Historiker, die mit ganz
vereinzelten Ausnahmen in der deutschnationalen Ecke standen. "Die an der Universität
lehrenden Historiker [übten] aufgrund ihres Sozialprestiges und der Tatsache, daß sie mehr als etwa heute - für die wissenschaftliche und politische Formung und Ausbildung
vieler Generationen von Geschichtslehrer verantwortlich waren, so eine schwer zu
unterschätzende Breitenwirkung aus" (Dachs 1974, III).
Hier hatte es, wie häufig auch im übrigen gesellschaftlichen Leben, nicht den geringsten
geistigen Bruch mit dem System der Monarchie gegeben. Insbesondere haben diese
Historiker das antidemokratische Sentiment nicht nur der Bürokratie, sondern auch eines
Großteils des Bürgertums weitergepflegt, das man bisweilen auch heute noch findet. Wenn
man sich ihre inhaltlichen Anbote ansieht, dann stellt man mit Erstaunen fest: Außer einem
gewissen Trivialnationalismus, der sich nicht genug tun konnte in Hinweisen auf die
"deutsche" Leistung beim Aufbau der alten Monarchie, hatten sie nichts zu bieten.
Während des Krieges waren sie Befürworter der autoritären Monarchie und Kriegstreiber
gewesen, nicht zuletzt, weil sie mit dem Krieg ihre chauvinistischen und autoritären
Neigungen ausleben konnten. Nach dem Zusammenbruch war es bei ihnen und in
vergleichbaren Gruppierungen, wo ein "eminent gesteigertes Orientierungsbedürfnis"
168
bestand, und nicht sosehr bei "breiten Bevölkerungsschichten" (beide Wendungen bei
Dachs 1974, II). Sie begannen, eine Dolchstoßlegende aufzubauen: Man sei nicht "im
Feld", sondern von subversiven Elementen an der "Heimatfront" besiegt worden. Der Krieg
wurde gewissermaßen argumentativ in den 20er Jahren weitergeführt, und zwar mit einem
beachtlichen Realitätsverlust. So bleiben sie auch vorwiegend Ideologen. Bei praktischen
Problemen, etwa technischen Fragen der Grenzziehung, äußerten sie sich auch meist gar
nicht - mit einigen kennzeichnenden Ausnahmen, wie etwa dem einflußreichen Kärntner
"Landeshistoriker" Martin Wutte.
Die Äußerungen selbst sind oft von einer schon wieder erstaunlichen Inhaltsleere. Sie
erschöpfen sich in Bildern, deren einzige Aussage immer wieder ist: Dieser Staat ist nicht
lebensfähig - ohne daß dies irgendwie begründet wurde. Eine erfrischende und
ernüchternde Feststellung kam von Josef A. Schumpeter, damals kurzfristig Finanzminister
der Republik.
Es ist nicht uninteressant, daß hier frühzeitig eine österreichische Version des ursprünglich deutschimperialistischen Mitteleuropa-Gedankens Naumanns (1916), ohne dessen imperialistischen Hintersinn, aus
einer nüchternen und rationalen Interessensabwägung heraus formuliert wird. In diesem Sinn stand
Schumpeter in der Tradition Eugen von Philippovichs (1915), auf den sich zu Unrecht auch Naumann beruft.
Philippovich wollte eine Zollunion zwischen der Habsburger-Monarchie und dem Deutschen Reich. Doch
während Naumann eine Hymne auf den Großstaat verfaßte, war der Ton bei Philippovich ganz anders. Im
ging es ausschließlich um mögliche gegenseitige Vorteile bei einem solchen Vertrag, und dafür wollte er sehr
vorsichtig und schrittweise ansetzen. Mitten im Ersten Weltkrieg wird man in seiner Broschüre auch nicht die
geringsten chauvinistischen Töne finden, was an sich bereits bemerkenswert ist.
Die letzten Ausläufer solcher Überlegungen finden wir immerhin noch Anfang der 90er Jahre, i. S. einer
ansatzweisen außenpolitischen Korrekturidee zur bedingungslosen West-Festlegung der offiziellen Politik.
Sie war allerdings damals wie heute ohne besonderen Realitätsbezug. Im übrigen hat der einzige Politiker von
einigem Gewicht, der dies vertrat (Erhard Busek), sehr bald einen totalen Schwenk gemacht und ist in der
Zwischenzeit insgesamt gescheitert. Es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, daß die geringe
Glaubwürdigkeit infolge der abstrakten Phrase dieses eine Zeitlang als Alternativ-Entwurf zur
ausschließlichen Westbindung alle anderen möglichen Alternativen dazu auch in ihrer Glaubwürdigkeit
beschädigte. Weiters wollte kaum jemand in Österreich in eine Kategorie mit dem neuen Osten gebracht
werden. Zwei Kartogramme bei Haller (1996, 318f.) sind dafür kennzeichnend: Wenn Österreicher und
Italiener "Mitteleuropa" abgrenzen, so gehört dazu bei einem Großteil das eigene Land sowie das jeweils
andere und auch noch die BRD, nicht aber das, was heute gerne auch Ostmitteleuropa genannt wird. Tun dies
Tschechen, so gehört ihr Land auch dazu, und nicht zu Osteuropa. Mitteleuropa wird also in diesen Ländern
als Kompromiß gesehen, um die eigenen Wünsche, auch zu Westeuropa zu gehören, mit der eigenen
Wirklichkeit, die Osteuropa heißt, zu versöhnen. Diese Bedeutung blieb zumindest einem Teil der
Österreicher nicht verborgen, und dafür empfanden sie wenig Sympathie. Somit blieb für einen erheblichen
Teil der Bevölkerung als einzige reale Option der EG-Anschluß übrig. Das könnte ein Mitgrund für den alle
überraschenden hohen Anteil der Pro-Stimmen in der EG / EU-Abstimmung vom Juni 1994 gewesen sein.
Was steht nun eigentlich hinter dieser "Lebensunfähigkeits"-Floskel? Das, was die
Konstante zwischen der Dynastie-Ergebenheit noch im Krieg und dem Deutschnationalismus und Anschlußgetöne in der Ersten Republik bildete, war die totale
Identifizierung mit der Großmacht im besonderen als Ausdruck der politischen Macht im
allgemeinen. Wenn auch der Großmachtstatus des Habsburgerstaats seit rund einem halben
Jahrhundert mehr Fiktion als Wirklichkeit gewesen war, so war der Gegensatz bei der
Wahrnehmung des besiegten Kleinstaats Österreich doch schlagend. Das hielten diese
Ideologen der Macht nicht aus. Also drängten sie zur Anschluß an die nächste größere
Macht, an das Deutsche Reich.
Gefragt wird allerdings nicht: Für wessen Entwicklung könnte eine starke Einbindung
Österreichs in den Westen und damit ein Souveränitätsverlust ein Gewinn sein? Die
169
gegenwärtige Struktur der Welt als Hegemonialordnung der westlichen Staaten wird
unbesehen als "Fortschritt" bezeichnet. Daß selbst für die wirtschaftlich davon Nutzen
ziehenden Gesellschaften auf mittlere und längere Frist ein demokratiepolitisch bedenklicher bürokratisch-autoritärer Trend daraus resultiert, wird mittlerweilen zwar von
Demokratietheoretikern diskutiert, nicht aber von Politikern. Sie gehören schließlich
kurzfristig zu den Nutznießern dieses Trend. Wenn daher in der Gegenwart Sozialdemokraten des mainstreams ihrer Parteien in der EG / EU ihre "wiederentdeckte
Internationale" (Standard, 1. Feber 1993, Interview mit dem Abgeordneten Ewald
Nowotny) finden, dann knüpfen sie völlig ungebrochen an diese Linie der GroßmachtBejahung an. Das vertraten in anderer Form auch z. B. Karl Renner und seine Gesinnungsgenossen (vgl. Pelinka 1988). "Gerade das ist ja unsere historische Erkenntnis
daraus... Aus sozialdemokratischer Sicht sehen wir deshalb die Währungs- und
Wirtschaftsunion durchaus positiv. Sie erweitert den gesamteuropäischen Handlungsspielraum der Politik" (Ewald Nowotny in derselben Ausgabe des Standard). Der unechte
Zungenschlag kommt im letzten Satz heraus: Das vorgesehene Europäische
Währungsinstitut als Vorläufer der Europäischen Zentralbank ist konstruiert, um eine
"internationale Re-Regulierung" als Ersatz einer De-Regulierung auf nationaler Ebene"
nicht zuzulassen. Hier taucht mit Macht das Problem der demokratischen Legitimation der
gesamten Währungspolitik auf, die schon innerstaatlich nicht gegeben ist.
Gerade der Wirtschaftsprofessor Nowotny sollte wissen, daß im Nationalbank-Gesetz (BGBl 50/31. Jänner
1984) die Zielvorgabe für die Nationalbank so diffus formuliert ist, daß man in jedem anderen Fall von einer
verfassungsrechtlich verpönten formalgesetzlichen Delegation sprechen würde. Weiters wird von allen EGBefürwortern gerade umgekehrt argumentiert. Die EG müsse innerstaatliche verkrustete Strukturen
aufbrechen, welche von den nationalen Politikern allein nicht durchsetzbar seien.
4.3.3.1 Der ideologische Hintergrund - Hegels Staatsmythos
Damit waren diese Ideologen in einem Staatsverständnis verwurzelt, das man nur als
bismarckianisch bezeichnen kann. Trotzdem war es keineswegs auf das Deutsche Reich
(oder Österreich) beschränkt - im Gegenteil: es war weltweit dominant. Es läßt sich am
besten mit einer allzu kennzeichnenden Aussage des jungen Engels in einem Brief an Marx
vom 23. Mai 1851 (MEW 27, 265 - 268 [268]) kennzeichnen: "Eine Nation, die 20.000 bis
30.000 Mann [an Truppen] höchstens stellt, hat nicht mitzusprechen." Hier kommt die
ideologische Grundlage von Engels und übrigens auch von Marx deutlich zum Vorschein:
Es ist Hegel mit seinem Staatsmythos. Es war wieder Engels, der davon offensichtlich mit
dem Einverständnis seines Partners sprach, daß Marx Hegel vom Kopf auf die Füße
gestellt habe (MEW 13, 473f., MEW 21, 277 ff., u.a.). Das aber scheint insbesondere als
Kritik des Staatsmythos denn doch zu wenig gewesen zu sein. Marx hat dies selbst
offenbar sehr wohl erkannt. In der Auseinandersetzung mit den Anarchisten entwickelte er
die hilflose Formel vom “Absterben” des Staates. Niemand konnte bisher klar legen, was
dies real bedeuten würde, nicht einmal Gramsci mit dem Begriff der geregelten
Gesellschaft (società regolata). Der rationale Hintergrund ist: Gesellschaft solle in
Hinkunft nicht mehr “bewußtlos” funktionieren und damit enorme Opfer unter der jeweil
betroffenen Bevölkerung verursachen. Sie sollte vielmehr bewußt, zielgerichtet und
selbstbestimmt agieren. Wie aber sollte das verwirklicht werden? Für Hegel war
sonnenklar: Der Staat ist die Verkörperung erst des “Volksgeistes”, dann des
“Weltgeistes”. Marx und in der Folge Lenin aber wollten den bürgerlichen Staat
zerschlagen, und den folgenden sozialistischen Staat schleißlcih absterben sehen. Die Folge
dieses theoretischen Versagens der Linken war die Entwicklung eines Staatsmonstrums im
170
Realsozialismus, das die konsequenteste Verwirklichung des Staatsmythos samt seiner,
wieder bei Hegel zu findenden (1995, 91) stalinistischen Moral war, daß der Endzweck der
Geschichte jedes Mittel und jedes Verbrechen heilige. Es ist übrigens die politische Moral
auf den Punkt gebracht, obwohl dies heute kaum noch jemand zu sagen wagen würde.39
Hegel ist seit Mitte der 70er Jahre ein toter Hund, und Marx (+Engels) seit einem
Jahrzehnt. Was aber keineswegs tot ist, ist gerade ihr Staatsverständnis. Man könnte mit
Fug und Recht sagen: Die eigentliche Staats-Ideologie der EU heute ist ein Rechtshegelianismus, der also wieder einmal Triumphe feiert. Es ist der Fortschritt vom volkssouveränen Nationalstaat über die Großregionalisierung zum globalisierten Weltstaat, die
ständig evoziert wird, und sehr genau dem Hegel’schen “Stufengang” der Vernunft vom
Familiengeist über den Volksgeist zum Weltgeist folgt. Dieses Gedankenschema hat denn
auch bereits Beinahe-Hegemonie errungen. Insbesondere der Großteil der Intellektuellen
folgt ihm.
Dieses Staatsverständnis erst Hegels und dann Engels’ war nicht zu trennen von einem
Nationenverständnis, welches in dieser Arbeit bereits angesprochen wurde (S. 16), der
Großnation. “Völker ohne Geschichte” sind “Völker ohne Staat” (siehe Hegel 1995, 82).
Diese Orientierung an der faktischen Herrschaftsbildung führte dazu, daß kleinere Ethnien
gar nicht die Chance zur Nationenbildung bekamen, wenn sie durch irgendeinen Zufall in
den Interessenbereich einer oder möglicherweise sogar zweier konkurrierender Nationen
hinein gezogen wurden - real sowieso nicht, aber nun auch geadelt durch
“geschichtsphilosophische” (theoretische) Rechtfertigung. So weckten Masuren oder
Kaschuben im 19. und in der 1. Hälfte des 20. Jahrhundert die Begehrlichkeit sowohl der
Deutschen (besser eigentlich: der Preußen) als auch der Polen und wurden in dieser Schere
schließlich aufgerieben, und zwar gar nicht friedlich (Belzyt 1996). Dieses
Staatsverständnis führte z. B. auch dazu, daß man 1920 dem Fürstentum Liechtenstein nach
seiner Lösung aus der engen Bindung mit der zerfallenen Monarchie die Aufnahme in den
Völkerbund verweigerte, mit der einzigen Begründung, daß es eben so klein sei. Auch in
der Gegenwart ist diese Haltung keineswegs verschwunden. Sie hat weitgehend die Politik
der Großmächte gegenüber dem Zerfall Jugoslawiens bestimmt - mit Ausnahme der BRD,
die dort eigene Interessen verfolgt und diese bei Kroatien besser aufgehoben sieht als im
alten Jugoslawien.
Hier drängt sich eine Parallele auf, welche auch eine Strukturverschiebung in der Funktion der
Ideologieproduktion belegt. Hatten bis in die 70er Jahre die Historiker hinsichtlich der Ideologieproduktion
bezüglich sozialer Sachverhalte ein Quasimonopol, das nur zeitweise von Philosophen angetastet wurde, so
änderte sich das mit dem kulturellen Modernisierungsschub der Kreisky-Ära. Auch in Österreich konnten sich
die Gesellschaftswissenschaften im engeren Sinn (Soziologie, Politikwissenschaft) universitär etablieren,
wenn auch in gewissen Fächern sehr spät. So wurde die erste Professur für Politikwissenschaft erst 1968
eingerichtet und mit einem katholischen Philosophen besetzt. 1969 begann faktisch erst der Vortrag. Schon
vorher hatte es von Juristen in Salzburg den Versuch gegeben, die Politische Wissenschaft einzuvernahmen.
Auch wurden die nächsten Lehrstühle systematisch mit Juristen besetzt. Auch heute versuchen immer wieder
einzelne Juristen, sich das Label "Politikwissenschaft" anzuheften, insbesondere, wenn es an ihrer Universität
kein solches Fach gibt. Es gab also einen Kampf um die Rolle des hegemonialen Ideologieproduzenten im
soziopolitischen Bereich. Den haben mittlerweise im obersten Segment die Gesellschaftswissenschaften für
39
Es ist aber noch nicht so lange her, daß dies einflußreiche Journalisten bejahend so auch aussprachen. In
einer Diskussion über Österreich Mitte der 60er Jahre im österreichischen TV nach einem
Schmutzkübel-Artikel des “Spiegels” konnte man vom Spiegel-Herausgeber Augstein durchaus hören,
daß Politiker eine andere Moral haben müßten, auch so richtig lügen sollten, wenn es nützlich sei, usw.
171
sich entschieden. Im mittleren stehen die Historiker noch immer konkurrenzlos da, weil es in den
weiterführenden Schulen faktisch keine Sozialwissenschaft gibt. Das "Unterrichtsprinzip Politische Bildung"
dient in erster Linie dazu, sie zu verhindern. Denn diese Fächer, und insbesondere die Politikwissenschaft
werden als "progressiv" verdächtigt: "Polito- und Soziologen haben viele schon betrogen..." reimte etwa der
deutschnational-reaktionäre KHD in den 80er Jahren.
Diese Sorge konservativer Kreise ist unbegründet. Insbesondere eine Reihe von Politikwissenschaftern haben
sich mittlerweile in einer Weise mit den Machtträgern arrangiert, welche viele Historiker - um beim Vergleich
zu bleiben - seinerzeit zu vermeiden trachteten. In dieser Hinsicht hat eine vollständige "Amerikanisierung"
stattgefunden, nachdem vorher europäische Emigranten eine vergleichbare Haltung in die USA getragen
hatten: "Die politikorientierten Intellektuellen haben die staatlichen Normen internalisiert" in einem Ausmaß,
daß man bereits von einer "Atrophie der Idee einer kritischen Universität" spricht (Lawrence 1996).
Tatsächlich ist die Identifikation mit der Macht bei vielen Politologen nicht nur fast vollständig, sondern auch
erstaunlich unreflektiert. Das dürfte vermutlich eine Mitursache des geringen theoretischen und methodischen
Niveaus nicht nur der österreichischen Politikwissenschaft sein. Auch hier zeigt eine Sichtung der
gegenwärtigen Produktion, wie schwer dieser Gruppe die Akzeptanz z. B. des Kleinstaaten-Status fällt, der
doch aus demokratietheoretischer Sicht eine enorme Chance darstellen könnte.
Es gibt allerdings am Rande von Politik und Sozialwissenschaft eine Gegenbewegung: In rousseauistischer
Manier werden plötzlich die Tugenden von Völkern ohne Staat entdeckt, und die sogenannten indigenen
Völker können daher auf erhebliche Sympathien in einer wenn auch beschränkten alternativen Öffentlichkeit
zählen. Dem Zivilisationsoptimismus, der sich zu unverhohlen mit der Staatsmacht liiert hat, folgt ein Schub
von Zivilisationspessimismus. Die “Vorgeschichte” - wie es bei Hegel heißt und später zum terminus
technicus wurde - wird so zum verloren gegangenen Paradies.
Diese Haltung wurde in die Zweite Republik trotz ihrer eindeutigen und bewußten Option
für den Kleinstaat herübergezogen. Anfang der 60er Jahre erschien im der Republik
gehörigen Österreichischen Bundesverlag ein Bildband, dessen Text Friedrich Heer
verfaßt hatte. Er war eine Zusammenfassung der damaligen Österreich-Ideologie und kann
infolge der Publizierung im damals rechtlich-wirtschaftlich nicht selbständigen
konservativen Staats-Verlag gewissermaßen als offiziöses Dokument gelten (Heer 1962).
Gedacht ist der Band offenbar in erster Linie für Schulbibliotheken und als Geschenkbuch.
Seine Aufgabe bestand darin, den "österreichischen Mythos" als angeblich notwendiges
Unterfutter für eine österreichische Nation zu liefern. Heer läßt kein Stereotyp aus, und sei
es noch so abgegriffen - der Unterschied zur intellektuellen Statur zwei Jahrzehnte später
ist schlagend. Der entscheidende inhaltliche Punkt ist, daß bewußt eine Kontinuität zum
ehemaligen Habsburgerstaat herzustellen versucht wird. Der österreichische
Habsburgermythos ist jedoch der nur leicht verschleierte Wunsch nach dem GroßmachtStatus. Das gilt zumindest für die Wiener Version; in manchen anderen Bundesländern
verhält sich dies ein wenig anders. Ganz in der Tradition noch der Ersten Republik wird
der Kleinstaaten-Status verweigert. Die Tradition, auf die man sich bezieht, ist der
Großstaat und seine Herrschaftsaspirationen, die kaschiert werden als "VölkerbundModell", etc. Es ist insoferne kein Zufall, daß ein möglicher Gegenmythos zu Habsburg,
nämlich die Babenberger, obwohl immer wieder einmal versuchsweise angerissen, erst in
der allerjüngsten Vergangenheit in einer Ausstellung ansatzweise aufgegriffen, aber nie
wirklich ausgearbeitet wurde. Erst im Verlauf der vielen Produktionen für das Millennium
wurde auch eine Babenberger-Serie für den ORF erstellt. Der sich daran knüpfende
politische Gedanke müßte für die Kleinheit stehen.
Mit diesem Repräsentationsbuch befand sich Heer in vollem Einvernehmen mit praktisch
allen politischen Kräften. Für sie lieferten eine Reihe von damals eher jüngeren Historikern
auch die gewünschte Geschichte nach. Auch aktive Politiker engagierten sich literarisch.
Neben den Konservativen steht hier ununterscheidbar der Kommunist Ernst Fischer. So
kann der Historiker Fellner mit seinem gebrochenen Verhältnis zur österreichischen Nation
172
am Ende der Zweiten Republik mit einer gewissen Süfisanz schreiben (1994, 220): "Ernst
Fischer - und darin ist er typisch für die Proponenten des Gedankens der besonderen
österreichischen Nation - versucht, daß kleine Österreich aus seiner großen Geschichte
heraus zu erklären, statt es aus dieser Vergangenheit zu lösen. Statt Regionalgeschichte als
Vorstufe der Staatsgeschichte zur Basis eines österreichischen Nationalgedankens zu
erheben, betrieb er weiterhin Herrschaftsgeschichte und reklamierte für die Österreicher der
Gegenwart alles, was im Bereich der habsburgischen Herrschaft einst geleistet worden
war" (zu den geteilten Ideologemen vgl. Reiterer 1986a). Hanns Haas hat durchaus recht,
wenn er im selben Sammelband feststellt (1994, 207 ff.), daß bis heute das
vordemokratische Erbe der Österreichidentität aus diesem seltsamen Bezug der Republik
auf den Kaiserstaat dieses politische Projekt belastet. Tatsächlich war und ist es auch der
entscheidende Angriffspunkt der alten und neuen Anschlußbefürworter vor allem aus der
Sozialdemokratie und ihrer Nähe. Möglicherweise war allerdings der Bezug auf das alte
"Österreich", nämlich den Habsburgerstaat, die einzige Tradition, welche eine von den
ständig wechselnden nationalen Indoktrinierungen überhaupt noch verstand (Man
vergleiche dazu auch die Ausführungen über die Konservativen in der Zweiten
Nachkriegszeit, 3.3.2). Natürlich wurde dies politisch instrumentalisiert - wie nicht, wenn
Nation ein politischer Entwurf ist? "Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war es
zunächst das österreichische kulturelle Erbe, das die staattliche Eigenständigkeit
Österreichs unterstreichen und die nationale Bewußtseinsbildung ermöglichen und die
Bevölkerung zur Mitarbeit am Aufbau einer demokratischen Ordnung motivieren sollte...
Indem man die nationale Identität nach 1945 auf traditionelle kulturelle Ausdrucksformen
festzulegen versuchte, bahnte man - nach siebenjähriger Verbannung aus dem politischen
Bereich - zugleich auch der genuinen österreichischen katholisch-konservativen
Weltanschauung den Weg zurück in die Herzen der Bevölkerung" (Streibel 1995, 55).
Diese restaurative Tendenz wurde möglich durch die vollständige Absenz der
Sozialdemokratie aus der nationalen Debatte. Die Kommunisten waren viel zu
marginalisiert, als daß sie ein bedeutsames Gegengewicht gewesen wären, ganz einmal
abgesehen von Fischers nostalgischen Naivitäten.
Doch auch hier ist Differenzierung vonnöten. In einer Darstellung des Österreich-Bildes,
wie es die Austria-Wochenschau im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens vermittelte, heben die
Autoren im Vergleich zwischen den berühmten Bildern vom Heldenplatz 1938 und
andererseits dem Bild vom Unterschrift unter den Staatsvertrag am 15. Mai 1955 den
grundlegend verschiedenen Zugang hervor. Der "Heldenplatz" zeigt den Blickwinkel des
"Führers" und die von ihm gewünschte Einheitlichkeit. Für das Belvedere wählten die
Filmer den Blick von unten. "Auf der Ebene der Darstellung finden wir eine Situation
wieder, der jedes militärische und totalitäre Element fremd ist" (Petschar/Schmid 1990,
48).
4.3.4 EG-Anschluß
Mit dem Beitritt zur EG / EU endete 1994/95 die Zweite Republik mit ihren
Grundelementen, über die bisher unter den wesentlichen politischen Gruppierungen ein
Basiskonsens bestand. Die Dritte Republik war ursprünglich ein Schlagwort aus ÖVPKreisen, um ihren Wunsch nach Überwindung der Kreisky-Ära auszudrücken. Noch
Anfang der 90erJahre verwendete man den Begriff auch in der Tagespublizistik ganz
unbefangen. Da ihn auch Jörg Haider aufgriff, wurde er dann als Nichtswürdigkeit und
politische Gefahr mit einem Tabu belegt: Doch schon die Schöpfer dieses Begriffes
173
wollten exakt die gleiche Programmatik damit bezeichnen wie Haider (siehe Kasten).
Heute ist dieser Begriff kein Projekt mehr, die Dritte Republik ist die Realität nach der
Aufkündigung dieses Grundkonsenses durch den überwiegenden Teil der politischen
Klasse - ob offen oder derzeit noch hinter einem Rauchvorhang von nebulösen Begriffen.
Der politische Streit geht also nicht mehr um eine Dritte Republik als Tatsbestand, er geht
nur mehr um ihre künftige Form.
"Man spricht vom Ende der Zweiten Republik und sucht nach den Gründungsinsignien der
noch imaginären Dritten... Mitte der 70er Jahre hatte der konservative Publizist Alexander
Vodopivec den dritten Wahlsieg Bruno Kreiskys zum Anlaß genommen, um wegen des
überproportionalen Gewerkschaftseinflusses die 'Dritte Republik' ... auszurufen. Zehn Jahre
später war es der steirische VP-Politiker Bernd Schilcher, der offenbar aus Sorge vor
immerwährendem Oppositionsdasein seiner Partei einer Verfassungsänderung in Richtung
Präsidialdemokratie und Konzentrationsregierung das Wort redete... Die Säulen der
Zweiten Republik [sind tönern] geworden."
Profil, 13. Jänner 1992: Die Republik frißt ihre Kinder
Diese Dritte Republik entsteht aus einem neuerlichen Versuch der politischen Klasse - die
Bevölkerung stellt sich mittlerweile mehrheitlich dagegen - , über den Anschluß an ein
ambitiöses politisches, militärisches und wirtschaftliches Mega-Bündnis die konsensuellen
Strukturen im Innern zu verändern und wieder den Anschluß an den Großmachtstatus zu
finden. Eine eigene selbstbestimmte Identität ist dabei hinderlich. Der politische Inhalt des
EG / EU-Beitrittes heißt Verzicht auf Eigenständigkeit. Das sozialpolitische System konnte
erst fundamental verändert werden, als die politische Klasse dies aus den eben
geschaffenen "Sachzwang" der Maastricht-Kriterien begründete. Aus diesem Grund - und
nicht etwa aus folkloristischen Kinkerlitzchen ("Paradeiser bleiben Paradeiser") - steht die
nationale Identität, und das heißt: die österreichische Demokratie, zur Debatte. Die
österreichische politische Klasse reagiert auf diese Sachlage recht einheitlich.
Globalisierung ist das Reizwort, welches die Antwort auf alle Einwände dieser Art bilden
soll. Kein Zeitungsartikel und kaum eine Politkerrede klommt heute ohne diesen Slogan
aus. Doch niemand ist wirklich imstande, es konzis und nachvollziehbar zu definieren.
Nicht zufällig tauchte dieses Schlagwort nach der großen Wende in Europa auf. Es ist der
Code für die westlich-kapitalistische Dominanz, welche sich im Innern der westlichen
Systeme als nunmehr fast unbestrittene Hegemonie (technokratisch-) konservativen
Denkens und der dem entsprechenden Politik äußert. "Globalisierung" als die Politik der
Einbindung in großregionale und mondiale Zusammenhänge versucht, durch bewußtes
Anstreben eines nationalen Autonomie-Verlustes das konservative Setting irreversibel zu
machen. Auf der mentalen (ideologischen) Ebene aber wandelt sich dieses Vokabel zum
"Sachzwang der Modernisierung".
Der "Realsozialismus"stellte erstaunlicherweise bis zu seinem unrühmlichen Ende eine
reale Alternative zu unserem System dar. Warum eigentlich? Der politische Einfluß der
Befürworter des sowjetischen Modells war westlich des Eisernen Vorhanges in allen
europäischen Gesellschaften minimal. 'Die Lebensverhältnisse im Osten wurden von einer
übergroßen Mehrheit der Bevölkerung keineswegs als attraktiv empfunden - selbst wenn
die eigenen auch bescheiden waren. Doch allein das Bestehen dieses Systems und seine
militärische Stärke, die auf grotteske 'Weise überschätzt wurde, mußte von den westlichen
Eliten als massive Bedrohung empfunden werden. In viel stärkerem Ausmaß galt dies für
die Dritte Welt. Möglicherweise war es gerade diese recht brüchige Allianz, manchmal mit
174
Regierungen, manchmal mit kontestatären Bewegungen, welche für den Westen zur
Hauptbedrohung wurde. Diese Allianz stellte eine Alternative zum Westen und seiner
Dominanz dar. Das belegt nicht zuletzt die stereotype Formel, wie sie geradezu mit
neurotischem Wiederholungszwang z. B. von der "Krone" ("die Kommunisten und die
Unterentwickelten"), aber auch in der ebenso dummen wie zynischen Angst vor dem
"Verlust" von (z. B.)-Südafrika auftaucht, von Habsburg bis Otto Molden. - Dagegen also
mußte man in den eigenen Reihen Verbündete suchen. Dies tat man am besten durch ein
Modell der Teilbefriedigung materieller Bedürfnisse politisch potentiell aktiver Schichten.
Das war die Begründung für den "Sozialstaat". In unterschiedlichen Ausmaß baute man in
allen entwickelten Wirtschaften solche Strukturen auf. Die Unterschiede sind vor allem
bedingt durch die Überlegung, wie man am besten den größtmöglichen Konsens zu nicht
überbordenden Kosten erzielte. Diiese Notwendigkeit scheint aber nunmehr entfallen zu
sein. Man muß daher den bisherigen Nutznießern des Sozialstaates dessen Abbau
beibringen. Der Begriff der Globalisierung dient dazu, die Unvermeidlichkeit dieses
Prozesses zu signalisieren. In dasselbe System fügen sich u. a. auch die "Lohnnebenkosten"
ein.
Die Frage "Großmacht versus Kleinstaat" ist eines der politischen Themen der Gegenwart
schlechthin. Deutlich wurde es insbesondere in der Diskussion über den EG-Anschluß
Österreichs vor der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994. Diese Diskussion ging an den
Intellektuellen weitgehend vorbei und wurde größtenteils von Politikern auf dem Niveau
von kommerziellen Werbeslogans geführt. Wenn man sich systematisch die
"theoretischen" Zeitschriften der politischen Parteien zu dieser Thematik ansieht, ist man
erstaunt, ja geradezu fassungslos, wie wenig Inhalt hier diskutiert, vermittelt und an die
eigenen Funktionäre weitergegeben wird: Das gilt durchaus auch in einem quantitativen
Sinn. Allerdings kam eine Aussage durch, endlos wiederholt, von Politikern wie von
Journalisten: Bundeskanzler Vranitzky faßte sie in seiner Pressekonferenz vom 13. Juni
1994 zum Ausgang der Volksabstimmung über den EG-Beitritt noch einmal zusammen:
"Heute haben wir zum ersten Mal über ein Strukturkonzept, über ein strukturpolitisches,
strukturelles, zukunftsbestimmendes Projekt im Interesse unseres Landes und unserer
Bevölkerung frei abgestimmt." Es war tatsächlich eine Weichenstellung, wobei allerdings
kaum jemals gesagt wurde, worum es eigentlich ging. In der Regierungserklärung vom 13.
März 1996 wird Vranitzky zwar nicht viel klarer, sagt aber doch ein wenig mehr, wenn er
betont, "daß wir nicht wegen einiger Preisvorteile beigetreten sind" (wie es ein
Hauptargumentationsstrang seiner Staatssekretärin Ederer mit ihrem Tausender pro Monat
gewesen war). Dann kommt wieder verhüllt das Großmachtmotiv: "Ganz besonders geht es
uns um die Schaffung einer Außen- und Sicherheitspolitik, die tatsächlich gemeinsam
genannt werden kann... Österreich wird danach trachten, bei den ersten Ländern zu sein,
die der Währungsunion angehören" (zit. nach Originalton der Radio-Übertragung). Eine
Begründung, wieso beides im österreichischen Interesse liegen soll, fehlt.
In einigen wenigen Stellungnahmen wurden jedoch relevante Bruchlinien auch offen
ausgesprochen: Die einzige intellektuelle Gruppierung, die eindeutig für die EG optierte,
war ein von einem langjährigen Beamten des BMWF und seit 1991 Professor an der
Hochschule für angewandte Kunst, Rudolf Burger, gegründeter Verein. Die lautstärksten
Wortmeldungen kamen von Burger selbst. Paradigmatisch für die von ihm angesprochenen
Themen war eine Diskussion zwischen Befürwortern und Skeptikern (IKUS-Lectures
3/1994). Es waren vor allem folgende Aussagen:
175
1) Österreichische Politiker haben immer die Eigenschaft "ein kleines Land" in den
Vordergrund gestellt. "Das war keine trockene Aussage über die geographische oder
demographische Größe des Landes, sondern eine qualitative Botschaft." Österreicht hat
"sich aus der Geschichte herausgeschwindelt." Ein anderer Autor macht es pathetischer. Er
spricht von der "Idee Europa", die für ihn vor allem - man beachte die Gleichsetzung "eine Ordnung ohne Rassenhaß und Klassenkampf; eine Ordnung, die uns Europäer in die
Lage versetzt, unserer weltweiten Verantwortung gerecht zu werden" bedeutet (Rinsche
1994). Diese Phrase mit der "Idee" wird von einer Sprecherin der Grünen beinahe wörtlich
wiederholt, wobei sie ein bißchen deutlicher wird: Monika Langthaler (Conturen 2/1994)
möchte mit "Minister Genscher" "Europa" (welches?) als "Machtfaktor in dieser Welt"
neben "Amerika" (offenbar die USA) und dem"asiatischen Raum" (?). Es geht also aufs
Neue um die Teilhabe am Großmachtstatus. Auf einen erheblichen Teil der Bevölkerung
wirkt dies offenbar attraktiv.
2) "Ein EU-Beitritt [würde] für Österreich so etwas wie westeuropäische Normalität
herstellen... Das bedeutet die Abkehr von einem mitteleuropäischen Sonderweg." Auch
hier dürfte eines der Motive liegen, weshalb die Bevölkerung mehrheitlich seinerzeit
zustimmte. Der EG-Beitritt war in vielerlei Hinsicht tatsächlich ein "Ruck nach Westen"
und hat insoferne einen gewissen österreichischen Komplex angesprochen: "Österreich,
einst weit außen am Ostrand der westlichen Welt, ist durch die junge Zugehörigkeit zur
Europäischen Union Brüssel wieder näher und findet dort einen direkten Zugang, den die
Schweiz nicht mehr hat", heißt es in einer dem "Vielgestaltigen Österreich" gewidmeten
Beitrag der EG-orientierten NZZ (30. Mai 1996).
In diesem Zusammenhang der Normalisierungsbehauptung zitiert Burger weiters den
berühmten Satz aus Lampedusas "Gattopardo". Allerdings dürfte er den Roman nicht
gelesen haben. Denn dieser Satz, daß man alles verändern müsse, wenn man wolle, daß
alles gleich bleibe, wurde zur Definition des "trasformismo" - jener Technik der
Machterhaltung mittels Strukturkosmetik, welche kennzeichnend für die aufgeklärteren
Fraktionen der jeweiligen ancien régimes ist. Somit sollte er sich wohl nicht darauf
berufen, wenn er als Ziel eine Demokratisierung angibt. Ebensowenig stimmt der Verweis
auf Max Weber und seine Bürokratie-These (in Burgers Form: Demokratisierung ist
Bürokratisierung): Denn Weber behauptet die Gefährdung liberaler Errungenschaften
durch die zunehmende Bürokratisierung.
Die Gegenposition wurde fast ebenso einsam, jedoch mit einem gewissen Eklat
ausformuliert. Der Wirtschaftswissenschafter und frühere Angestellte der AK Wien, Erwin
Weissel, trat aus der SPÖ aus. Nach seinen Motiven gefragt, sagte er folgendes (Die
Alternative 5/1994): "Der springende Punkt ist für mich die Art und Weise, wie versucht
wird, aus der Bevölkerung ein Ja herauszuholen. Das geschieht in einer Art und Weise, die
mit meinen Vorstellungen von Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich bin es
gewohnt, daß in der Politik manipuliert wird, aber das hat eine Grenze. Diese Grenze ist
von der SPÖ jetzt überschritten worden" (vgl., wesentlich weniger klar und prononciert:
Jagschitz 1994). Oder kürzer: Das politische Projekt des neuen Österreich ist
Entdemokratisierung.
4.3.5 Anton Pelinka 1990 oder Anton Pelinka 1994/1996?
Die Frage des Kleinstaatenstatus einerseits wie auch jene der (west-) europäischen
"Normalität" sind zwei Zentralthemen nicht nur der gegenwärtigen österreichischen Politik,
welche die Frage der politischen Identität direkt ansprechen. Sie sind tatsächlich
176
Diagnosen, die als analytische Aussagen kaum zu bestreiten sind. Die Differenzen treten
erst in der politischen Haltung, in der Bewertung also, auf. Die aber kann sich im Laufe der
Zeit offenbar ändern.
1990 erschien im Publikumsverlag Ueberreuter/Wien ein kurzes Buch des Innsbrucker
Politikwissenschafters Anton Pelinka. Es war gedacht als politische Stellungnahme des
mittlerweile zum bekanntesten Sozialwissenschafter Österreichs avancierten
Universitätslehrers zu einigen entscheidenden Fragen der österreichischen Zukunft. Damals
war der Streit um den - wie damals in der Journalistik hieß - "Brief nach Brüssel" gerade in
vollem Gang, da die SPÖ vor dem Anschluß zurückscheute. Kernsätze der angebotenen
Schlußfolgerungen lauteten:
"Den traditionellen Eliten fehlt die Kraft zur Bestimmung der österreichischen
Identität... Dieses Vakuum ist die Stunde der österreichischen Demokratie... –
Die EG ist ... Fluchtziel österreichischer Ängste... [Man erwartet sich] Stärke
durch Anbindung, Abhängigkeit. Dieses Motiv verbindet die österreichische
EG-Politik mit der (historischen) Anschlußpolitik... Österreich kann sich aus
der vermeintlichen Schwäche des Kleinstaates in die (ebenso vermeintliche)
Stärke eines großen Bruders flüchten... - Österreich als Vorreiter - auf dem
Weg des sich Aufgebens in einem großen Bruder? ... - Verschweizerung als
Angebot... - Kleinheit macht sich bezahlt" (Pelinka 1990, 151, 143, 145, 149,
146).
1994 bildete derselbe Autor mit dem schon sattsam zitierten Rudolf Burger einen Verein
für die Propagierung eben dieses hier als historische Fehlentscheidung abgelehnten EGAnschlusses, und ab 1995 ist er aktiv an der Einbindung Österreichs in die politische
Struktur des sich nun EU nennenden Staatenbundes beteiligt, wobei er diesen Beitritt
hauptsächlich als "Normalisierung" Österreichs diagnostiziert (vgl. auch Pelinka 1994a und
leicht variiert 1994b) - nicht zu Unrecht. Was war in der Zwischenzeit geschehen?
In der Hauptsache haben sich die Regierungsparteien in einer Kampagne, welche in der
gesamten österreichischen Geschichte keinen Vergleich kennt, zur unbedingten Übernahme
der Brüsseler Politik, d. h. also zum österreichischen Souveränitäts- und damit
Demokratieabbau, verpflichtet. Die machtmäßig geringgewichtigen Kräfte, die sich dieser
Ausrichtung entgegenstellten, wurden und werden marginalisiert, ob es sich um politisch
organisierte Kräfte handelt oder auch nur um skeptische Stimmen aus der Bürokratie oder
dem akademischen Leben. Es scheint, als ob die politischen Kräfte nicht zuletzt gegenüber
der Bevölkerung Irreversibilität hergestellt hätten.
4.4 Grenzenloses Österreich? Über die demokratiepolitische Unentbehrlichkeit
nationaler und staatlicher Grenzen
Grenzen, insbesondere ethnische und nationale, aber auch staatliche Grenzen, sind heute
laut einer merkwürdigen Übereinstimmung großer Teile der politischen Klasse mit großen
Teilen literarisch tätiger Intellektuellen, vom Bösen. Die Ideologie stimmt hier oft
allerdings nicht mit der Praxis überein. Denn gewisse Grenzen scheinen zumindest vielen
Politikern wiederum unentbehrlich - nämlich jene zur alten und neuen Dritten Welt. Nur
wenige kommen auf die Idee, die Funktion dieser Grenzen nicht nur in gesellschaftlichpolitischen Prozessen von Integration und Segmentierung zu untersuchen, sondern auch in
Hinblick auf die sonstigen leitenden Normvorstellungen unseres politischen Systems,
insbesondere der Partizipation, der Demokratie. Dabei müsste die neuere Diskussion um
"citizenship" eine solche Fragestellung geradezu erzwingen (Bauböck 1994a und 1994b).
177
Denn im Grunde sind hier Grenzen als Unabdingbarkeiten für den demokratischen Prozeß
vorausgesetzt. In einem wissenschaftspolitischen Zusammenhang, der durch den Übertitel
"Grenzenloses Österreich" gegeben ist, erweist sich also eine kurze Diskussion dieses
Topos als nötig.
Die Notwendigkeit der Grenziehung, zuerst der sozialen, dann der politischen und in der
Folge dessen der administrativen, ergibt sich aus der Fundierung des sozialen Systems auf
zumindest zwei Dimensionen, nämlich der gemeinschaftlichen und der gesellschaftlichen.
In Problemen der Integration ist fast stets nur von der letzteren die Rede. Hier soll jedoch
das erste im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. Die integrativen sozialen Teilsysteme,
deren wichtigstes eines die Politik als Steuersystem der Gesellschaft ist, beruhen auf den
Lebenswelten der Einzelmenschen, der Personen. Für ihre Akzeptanz und damit Stabilität
erfordern sie somit eine gemeinschaftliche Grundlage. Die Alltagsfolge geteilter
Lebenswelten ist die ständig neue Integrierung von "Zeitgenossen" als "Mitmenschen"
(Schütz) in die eigene "natürliche" Welt. "Die alltägliche Lebenswelt ist die
Wirklichkeitsregion, in die der Mensch eingreifen und die er verändern kann, indem er in
ihr durch die Vermittlung seines Leibes wirkt.... Ferner kann sich der Mensch nur innerhalb
dieses Bereiches mit seinen Mitmenschen verständigen, und nur in ihm kann er mit ihnen
zusammenwirken. Nur in der alltäglichen Lebenswelt kann sich eine gemeinsame
kommunikative Umwelt konstituieren... In der natürlichen Einstellung finde ich mich
immer in einer Welt, die für mich fraglos und selbstverständlich 'wirklich' ist. Ich wurde in
sie hineingeboren und nehme es als gegeben an, daß sie vor mir bestand. Sie ist der
unbefragte Boden aller Gegebenheiten sowie der fraglose Rahmen, in dem sich mir die
Probleme stellen, die ich bewältigen muß. Sie erscheint mir in zusammenhängenden
Gliederungen wohlumschriebener Objekte mit bestimmten Eigenschaften... Ferner nehme
ich als schlicht gegeben an, daß in dieser meiner Welt auch andere Menschen existieren,
und zwar nicht nur leiblich wie andere Gegenstände und unter anderen Gegenständen, sondern mit einem Bewußtsein begabt, das im wesentlichen dem meinen gleich ist. So ist
meine Lebenswelt von Anfang an nicht meine Privatwelt, sondern intersubjektiv; die
Grundstruktur ihrer Wirklichkeit ist uns gemeinsam... Ferner nehme ich es als
selbstverständlich hin, daß die Bedeutung dieser 'Naturwelt' - die schon von unseren
Vorfahren erfahren, bewältigt, benannt wurde - für meinen Mitmenschen grundsätzlich die
gleiche ist wie für mich, da sie eben auf einen gemeinsamen Interpretationsrahmen bezogen
ist" (Schütz/Luckmann 1973, 3 - 4). In diesem Sozialisations- als Integrationsprozeß muß
der zahlenmäßige Mitgliederstand meiner Mitmenschen rapid an eine Grenze stoßen. Diese
Grenze der alltäglichen Lebenswelt und der mit oder in ihr Lebenden ist ohne Zweifel je
nach sozialer Position deutlich verschieden. Sie ist auch keineswegs als räumlich
konzentriert aufzufassen: Man denke an die weltumspannenden Beziehungsnetze vieler
Wissenschafter! Trotzdem ist sie durch die Kommunikationskapazität des Menschen
zahlenmäßig äußerst beschränkt, wenn man sie als realisiert denkt. Großgesellschaften was anderes ist mit gewaltgestützten Großstaaten) können überhaupt nur infolge eines
Kniffs der abstraktionsfähigen Erkenntnis-, Orientierungs- und Deutungspotenz des
Menschen bestehen: Mittels Symbolen kann er identitär die potentiellen Mitmenschen
abgrenzen und sie von den reinen Zeitgenossen unterscheiden. Nun gilt eine abstrakt
gewordene Loyalitätszumutung (Weber) auch ihnen gegenüber. Allerdings ist dies eine
gewaltige Leistung des menschlichen Abstraktionsvermögens, welche langes Training und
langes Gewöhnen voraussetzt. Dementsprechend unterscheidet sich dieser Kreis quantitativ
in einem sehr viel größeren Maßstab nach Schichtzugehörigkeit.
178
Es ist nun eine empirische Tatsache, daß für eine große Mehrzahl der Menschen ihre
potentiellen Mitmenschen auf jenen Kreis beschränkt sind, welchen wir mittels nationaler
Identität abgrenzen, kurz: auf die Nation. Nur für diesen Kreis der potentiellen
Mitmenschen ist die Solidaritätszumutung, der faktische Anspruch auf "Teilen" soziale
Wirklichkeit - theoretisch i. S. einer verallgemeinerten sozialen Reziprozität, praktisch i. S.
des modernen Sozialstaates mit seinen unübersichtlichen Zahlungsströmen und
Umverteilungssalden. Die nationale Identität gibt also nicht zuletzt diesen Kreis an.
Folgerichtig bezeichnet sich trotz intensiver propagandistischer Bemühungen nur ein
verschwindender Bruchteil (5 %) der Österreicher als "vorrangig Europäer", wenn man sie
demoskopisch danach fragt (Plasser / Ulram 1996). Dementsprechend steht auch ein ganz
beträchtlicher Teil der als demokratisch ausgegebenen Idee, die Befugnisse des
Europäischen Parlamentes auszuweiten, mit Mißtrauen gegenüber. Länder, in denen die
Bereitschaft zu einer solchen Souveränitätsabtretung sehr hoch ist (Italien: 72 %), müssen
tatsächlich als nationale Krisenfälle bezeichnet werden: Das Mißtrauen der italienischen
Bürger in ihre politische Klasse ist bekanntlich übergroß - und trotzdem geht nach neueren
Daten auch in Italien der Prozentsatz der EU-Enthusiasten zurück.
Demokratische Partizipation ist jedoch nichts anderes, als ein Aspekt, eine Seite dieser
Bereitschaft zum "Teilen". Sie bedarf daher jener gemeinschaftlichen Basis, welche
wiederum die Solidarität (die Reziprozität) auf kleine Segmente der Menschheit
beschränkt. Nur so kann sie demokratische Stabilität gewährleisten, im Unterschied zur
ausschließlich autoritär gestützten, ausschließlich staatsorientierten. Selbst diese
demokratische Solidarität enthält ein gewichtiges Maß autoritärer Beimischung, welche
sich in der Zwangszugehörigkeit zum Staat äußert. Grenzen, zuerst sozialer, dann
politischer Art, sind somit unumgänglich, um eine allgemeine Akzeptanz solcher
demokratischer Entscheidungsprozesse überhaupt aufrecht erhalten zu können (vgl. auch
Reiterer 1996 über den "Allgemeinwillen"). Jener schleichende Legitimitätsverlust der
westeuropäischen politischen Systeme, der unter verschiedenen Bezeichnungen
gegenwärtig generell diagnostiziert wird, dürfte mit auf die triviale Tatsache
zurückzuführen sein, daß sich in dieser Hinsicht eine Kluft zwischen der politischen Klasse
und einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung aufgetan hat: Aus ihren eigenen Interessen,
sicherlich auch aus ihren weiterreichenden Lebenswelten heraus versucht ein Großteil der
politischen Klasse40 und der sozialen Elite, die bisher nationale Solidaritätszumutung zu
überdehnen auf großregionale politische Gebilde. Ein immer größerer Teil der
Bevölkerung, in nicht wenigen Staaten schon mehr als die Hälfte, hat damit grundsätzliche
Probleme, zumal die materiellen Folgen dieser Solidaritätszumutung häufig überhaupt
nicht mit den Vorstellung der Basis von "Gerechtigkeit" übereinstimmt. Die Folge könnte
ein Zusammenbruch der mentalen und affektiven Grundlagen der Demokratie sein:
Demokratie ist schließlich sehr viel mehr als eine Abstimmungsmaschinerie mit einem
Mehrheitsprinzip, ob direkt oder in einem Parlament. Demokratie ist eine Kultur des
begrenzten Konfliktes auf der Basis geteilter Identität, die dann auch ein Verfahren für
politische Elitenrekrutierung möglich macht. Dieser düsteren Perspektive steht allerdings
40
Es ist zumindest in der Schweiz mittlerweile ziemlich allgemein anerkannt, daß dieser Zwiespalt und damit
das darausfolgende Mißtrauen gegenüber der politischen Klasse in diesem Bereich dazu geführt hat,
daß die Schweizer Außenpolitik kaum noch handlungsfähig ist, weil sie stets Ziele anstrebt, welche
dann von einer Mehrheit der Bevölkerung im Referendum verworfen werden.
179
jene Tendenz gegenüber, welche in der Transformation dieser demokratischen Kultur
immer mehr Menschengruppen immer selbstverständlicher in den politischen und sozialen
Prozeß intervenieren läßt: Sie sind nicht mehr bereit fraglos Entscheidungen hinzunehmen,
welche über ihre Köpfe hinweg getroffen sind.
4.4.1 "Integrationsschock"?
Da in anderen Ländern - und vorwegnehmend auch schon in EG-Beitrittskandidaten des
Ostens - vom "Integrationsschock" gesprochen und man darunter die Wirkung des
westeuropäischen Integration auf nationale Integration und nationale Identität versteht, ist
nach einem vergleichbaren Phänomen in Österreich zu fragen. Dabei ist ganz klar zu sagen:
Einen Integrationsschock im Sinne einer merkbaren Einwirkung von außen hat es seit dem
EG-Beitritt Österreichs nicht gegeben. Was es aber sehr wohl gegeben hat und gibt, und
was direkt mit dem Anschluß zusammenhängt, ist ein Politik-Schock. Praktisch unmittelbar
nach dem formellen Inkraft-Treten des Beitritts am 1. Jänner 1995 begann in Österreich
eine Diskussion um die künftige Politikgestaltung, welche sich faktisch um die Grundlagen
der bisherigen österreichischen Politik überhaupt drehte. Zuerst vernebelt und überformt
durch die sich über Monate hinziehende Führungskrise der ÖVP, wurde der Einsatz
schlagartig klargestellt, als die neue Führung sich etabliert hatte. Das kann überhaupt nicht
verwundern, war doch gerade die von der ÖVP nunmehr offen betriebene Wende das
eigentliche Motiv für den Anschluß. Nun hatte man zwei Vehikel für die Wende selbst
vorzuweisen, zwei "Sachzwänge", die man sich durch den "Anschluß" soeben geschaffen
hatte:
(1) Infolge des hohen Netto-Abflusses von Bundesgeldern infolge der Beitragszahlungen
an die EG / EU wurde sowohl das Problem der Staatsverschuldung als auch jenes des
österreichischen Zahlungsbilanzdefizites akut. Der erste Problemkreis resultierte direkt aus
der Verhandlungsstrategie, welche - man ist versucht zu sagen: auf eine typisch
österreichische Art - die höchsten Prokopf-Beiträge innerhalb der EG im Tausch für mehr
oder weniger nebulöse Rückfluß- und Subventionsversprechen in Kauf genommen hatte.
Wie sehr diese Strategie aus Unfähigkeit erwuchs, oder wie sehr sie aus verschiedenen
Überlegungen über Machtmotive - bürokratische Kontrolle über Zahlungsströme bedeuten
selbstverständlich immer verstärkte Kontrolle über die Nutznießer - resultierte, ist aus den
derzeit verfügbaren Materialien nicht eindeutig erkennbar. Vermutlich handelte es sich um
eine Mischung beider Ursachen. Denn es war ziemlich eindeutig Unfähigkeit, welche für
die Verhandelnden den Blick auf die Folgen für die Zahlungsbilanz verdeckte. Wie die
NZZ in einem Artikel (17./18. Juni 1995) über die ersten Folgen der EG-Mitgliedschaft für
Österreich verwundert feststellte, wurde den Verantwortlichen dieses Problem erst bewußt,
als es bereits auftrat: “Diverse, ‘in der Regel gut informierte’ Gesprächspartner [bringen]
zum Ausdruck, man sei sich doch nicht so ganz bewußt gewesen, daß Österreich 30 Mrd.
Schilling nach Brüssel zahlen müsse und nur 15 Mrd. wieder zurückbekome, daß mit
anderen Worten der Staatshaushalt mit 30 Mrd. S und die Leistungsbilanz mit 15 Mrd. S
belastet werde.” Und daran angeschlossen wird noch “hinter vorgehaltener Hand” gefragt,
ob der Schilling nicht überbewertet sei und man sich zum eigenen Schaden “reich
gerechnet” habe. Und in dieser Weise gibt der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitutes
zu, daß es “blinde Flecken” in der Kampagne gegeben habe. (Das läßt schließlich Prof.
Matzner mit einer gewissen Bitterkeit die Forderung nach einer Ethik-Kommission für
Wirtschaftswissenschaftler stellen.)
180
(2) Verstärkend trat zu dieser jetzt objektiven Problematik die Fetischisierung der
"Maastricht-Kriterien" hinzu, deren hauptsächliche Stoßrichtung ja nicht wirtschaftliche
Konvergenz ist, wie man vorgibt und wie von der Art der Kriterien selbst dementiert wird,
sondern zuerst eine bestimmte Form von Austeritätspolitik mit ihren sozialen Folgen, und
in der Tendenz das, was ich eine "Abschaffung der Wirtschaftspolitik" nennen möchte.
Insbesondere die Haushaltskriterien dienten jetzt als Hebel, die bisherige Politik über Bord
zu werfen. Die ÖVP breschte vor, die SPÖ bremste taktisch geschickt und gewann mit für
sie selbst erstaunlichem Vorsprung die von den Konservativen vom Zaun gebrochenen
Neuwahlen. In der Folge gab es die bekannte "schwedische" Entwicklung: Die SPÖ warf
schon am Tag nach den Neuwahlen ihre Versprechungen über Bord und schwenkte voll auf
den konservativen Kurs ein.
Die unmittelbare Folge ist eine Verunsicherung in der Bevölkerung, wie es sie vermutlich
seit Ende der Besatzungszeit nicht mehr gegeben hat. Dieser Politik-Schock, den man
natürlich auch als Integrations-Schock bezeichnen könnte, ist zu kurzfristig wirksam, um
die Folgen abschätzen zu können. Daß er aber Folgen für die nationale Integration und für
die nationale Identität haben muß, steht nach allen bisherigen Überlegungen außer Zweifel.
4.4.2 Europäische Ideologie
Die deutlichste Ausformung dessen, was ich die europäische Ideologie nennen möchte,
findet sich bei jenen Intellektuellen, welche einem angeblichen Universalismus
vergangener Zeiten nachtrauern und diesem die Fragmentierung des Europas der jüngeren
Vergangenheit gegenüberstellen. Lange Zeit das Reservat eindeutig rückwärts gewandter
Kräfte, fanden sie ihren kennzeichnendsten Ausdruck im Neo-Rationalisten Julien Benda
(1993 [1933]). In seiner "Rede an die Europäische Nation", die sich formal und inhaltlich
an den gar nicht rationalistischen Fichte, den Mystiker des deutschen Nationalismus
anlehnt, finden sich alle Motive, die bisher "Europa" als Organisation zum Vorbild gedient
haben, als Idee aber eher in Verruf brachten. Von ihm gingen die Einflüsse auf die
Romantiker über, etwa auf die Brüder Schlegel, welche sich an Antike, Mittelalter und
Klassik orientierten und dies nur unter der allerdings von Novalis als Buchtitel
stammenden Bezeichnung "Die Christenheit oder Europa" einzuordnen wußten (vgl.
Behler 1994). Es war eine bewußt und geradezu fanatisch antiaufklärerisches Programm,
welches unter diesem Titel firmierte und die Tradition für Benda bildet.
Benda beginnt mit einer Anrufung an die europäischen Intellektuellen, wieder den Altären
Platons zu opfern. Das läßt aufmerken. Spätestens seit Popper wissen wir, daß Platon der
eigentliche Vater der Nomenklatura, jener totalitären neuen Klasse des Ostens und nicht
nur dort war.41 Benda kommt sehr schnell zu den wesentlichen Punkten: "Platon würde
sagen, Europa ist keineswegs, wie es viele wollen, der Respekt vor dem Anderen. Es wird
diese Kategorie überlagern mit dem Gleichen; jene der Vielheit mit der des Einen" (S. 54).
"Wenn Europa wirklich entstehen soll, erfordert dies das Aufblühen einer europäischen
Seele, welche die nationalen Seelen dominiert - und zu einem großen Teil vernichtet - , auf
dieselbe Art, wie Frankreich das Erscheinen einer französischen Seele verlangt hat, welche
die bretonische und provençalische Seele dominierte und vernichtete" (S. 117). Und als
guter Platoniker ist es nur logisch, daß er die Künstler als die ärgsten Feinde Europas
zeichnet, denn "von Natur aus sind sie nur dem Bestimmten, dem Besonderen, dem
41
So ist es kein Zufall, wenn der liberal-konservative Benda 1949 Stalins Prozesse rechtfertigen wird.
181
Unterschiedlichen zugetan... Alle diese Sektierer des Pittoresken sind gegen Euch... Europa
wird ernsthaft sein oder wird gar nicht sein" (100f. und 51).
Julien Benda stellt das Problem, löst es aber keineswegs. Wir finden hier eine für die
überhitzte Zeit des Nationalismus kennzeichnende Verwechslung der Frage einer
europäischen Identität - die neben oder über nationalen Identitäten bestehen kann - und
einer nicht gegebenen Notwendigkeit, diese Identität staatlich organisatorisch, auf
Verordnungswege gewissermaßen, abzusichern. Eine europäische Identität ist in einer sich
sozial integrierenden Welt unabdingbar, weil sie die Grundlage des Systems der politischen
Grundwerte bildet, für die die Staatenorganisation des Europarates steht. In diesem Sinn
kann man der Rhetorik in der "Charta von Paris für ein Neues Europa" (19. - 21. November
1990) zustimmen: "Wir erkennen den wesentlichen Beitrag unserer gemeinsamen
europäischen Kultur und unserer gemeinsamen Werte zur Überwindung der Teilung des
Kontinentes an... Die Teilnahme nordamerikanischer wie europäischer Staaten ist ein
bestimmendes Merkmal der KSZE... Das unerschütterliche Festhalten an gemeinsamen
Werten und an unserem gemeinsamen Erbe bindet uns aneinander." In welchem Ausmaß
die Rhetorik allerdings Rhetorik bleibt, haben die Staaten des Ostens mittlerweile erfahren
müssen als sie meinten, auf eine selbstlose Öffnung der Märkte des Westens für ihre
Sozialdumping-Produkte zählen zu können.
Der Vollständigkeit halber muß hier ein weiterer Strang angeführt werden, welcher vom
Inhalt her oft geradezu grotesk wirkt. Da jedoch der Hauptvertreter der Richtung im
Europäischen Parlament sitzt und dorthin immerhin von der mächtigsten deutschen
Rechtspartei entsandt wurde, weil sie mit ihm offenbar ihren am stärksten
traditionalistisch-autoritären Flügel abdecken möchte, kommt ihr eine gewisse politische
Bedeutung zu. Es ist die sogenannte "Pan-Europa"-Bewegung und Otto Habsburg. Sein
Sohn, der die Positionen seines Vaters vollumfänglich wiederholt (vgl. etwa Salzburger
Nachrichten 17./18. August 1996), hat gegen heftigen Widerstand der eigenen Partei auf
Wunsch des derzeit amtierenden Parteiobmannes der ÖVP ebenfalls ein Mandat im
Europa-Parlament wahrzunehmen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung ist kaum möglich,
weil sich die gar nicht wenigen politischen Schriften des Vaters - meist irgendwelche
Zeitungsartikel, die im nachhinein gesammelt und in Broschüren veröffentlicht wurden wie eine Mischung aus den politischen Analysen in den Geschichten des Jaroslaw Schwejk
und den Stilübungen des Leitartiklers in Kraus' "Letzten Tagen der Menschheit" lesen.
Hören wir also zumindest einige Stilproben:
"Unser Reich ist in diesem Fall die Ideologie des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation... Das Reich war kein engnationaler, sondern ein übernationaler Begriff... Das Reich
und die multinationalen Staatswesen, die nach seinem Verfall seine Aufgaben übernommen
hatten, waren ihrem Wesen nach auf die Verbindung gleichberechtigter Völker
ausgerichtet... Ziel war eine wahrhaft freiheitliche Integration, wie man sie noch, auch
unter Einbeziehung aller Schwächen, während des vergangenen Jahrhunderts im alten
Österreich [der Habsburger-Monarchie] finden konnte...
Wie vor 1000 Jahren erleben wir heute europäische Einigungsbestrebungen, die von der
westlichen Achse ausgehen. Sie erinnern an den Traum Karls des Großen... Wie einstmals
in den Zeiten vor der Jahrtausendwende wird Bayern wieder zur Ostmark des sich einigenden Europas... Von der historischen Pflichterfüllung Bayerns hängt viel für die Zukunft
Europas ab, ... denn unser wertvollstes Erbe, die christliche Zivilisation, steht auf dem
Spiel. die Lage ist kritisch" (Habsburg 1980, 44, 57, 61), vor allem wegen der
182
Weltverschwörung der Sozialistischen Internationale mit Willy Brandt an der Spitze, usw.
... .
4.5 Neuorientierung worauf?
Pelinka (1994a, 1994b) hat mehrmals darauf hingewiesen, daß die ideologischen "Lager"
in der Zwischenkriegszeit die eigentlichen Integrationskräfte in der österreichischen
Gesellschaft bildeten, und so die nationale Identität als Integrationsfaktor ersetzt hätten.
Allerdings ist dies keineswegs eine österreichische Besonderheit. Es ist nicht vorranging
bedingt durch das Fehlen, die Widersprüchlichkeit oder die Schwäche nationaler
Identifikation. Vielmehr ist dies eine der Formen, welche die Transformation traditionaler
Gesellschaften in durchmonetarisierte, industrielle oder auch kommerzielle nationale
Gesellschaften annahm und annimmt. Den Übergang selbst könnte man - vereinfachend
zugegebenermaßen - charakterisieren als: den Übergang von einer traditionalen Integration
auf Basis lokaler und eventuell regionaler Territorialität und deren gemeinschaftlicher Bindewirkung über eine beginnend moderne Integration auf Basis von schichtgestützten
Weltanschauungsgruppierungen zu einer neuerlichen, diesmal reifer modernen Integration
auf territorialer Basis, jetzt jedoch in gesellschaftlicher Form und zumindest auf regionaler,
meist jedoch auf kombiniert regionaler-nationaler Basis. Dies können wir in der
europäischen Geschichte beobachten. Wir können es aber auch in der Dritten Welt wieder
sehen. Dem politischen Katholizismus bis zur Hälfte dieses Jahrhunderts - in manchen
nicht nur südeuropäischen Gesellschaften auch durchaus länger bzw. von neuem entspricht der politische Islamismus (und seit kurzem auch der politische Hinduismus) in
vielen der dortigen Länder. Das ist somit ein traditionalistisches und nicht mehr ein
traditionales Phänomen: Ein Phänomen somit, das sich als reflektierte Bezugnahme auf
eine angebliche bessere Vergangenheit der Gottesfurcht und der lebendigen
Gemeinschaften präsentiert.42
Schon Geertz (1973, 148 ff.) weist auf die wesentliche Rolle der Weltanschauungsgemeinschaften
unterschiedlichster Art - er nennt den traditionalistischen Islamismus, den modernisierten, universalistischen
Islam, den Nationalismus und den Marxismus - im sozialen Wandel Javas hin. Die folgenden Sätze über
Zentraljava in den 50er Jahren klingen überhaupt, als ob sie über Österreich in den 20er und 30ern
geschrieben wären (167): "Because the same symbols are used in both political and religious contexts, people
often regard party struggle as involving not merely the usual ebb and flow of parlamentary manoeuver, the
necessary factional give-and-take of democratic government, but involving as well decisions on basic values
and ultimates... The normal conflict involved in electoral striving for office is heightened by the idea that
literally everything is at stake: the 'If we win it's our country' idea that the group which gains power has a
right, as one man said, 'to put his own foundation under the state'. Politics takes on a kind of sacralized
bitterness."
Die eigentliche Scheidelinie in einem bestimmten Stadium des Modernisierungsprozesses
ist somit die Cleavage Traditionalismus - Modernismus. Dies ähnelt der Konfliktlinie
Liberalismus - Konfessionalismus, welche aus der herkömmlichen Parteientheorie bekannt
ist. Sie sollte aber eher als eine Grunddimension, als ein "Faktor" i. S. der multivariaten
Statistik, gesehen werden. Denn dieser Faktor findet sich mit Sicherheit auch in anderen
42
Man vgl. dazu die Aussagen auf der Konferenz "Europa der Religionen" am Institut für die Wissenschaften
vom Menschen" im Dezember 1994, vor allem das Papier (im Erscheinen): Fouad Zakaria: The
Dilemma of Pluralism in Contemporary Islam. - Im übrigen bringt Karl Renner in seinen
Jugenderinnerungen, die er außerordentlich passend "An der Wende zweier Zeiten" nennt, eine höchst
bildhafte und dementsprechend eindrückliche Beschreibung jener Prozesse, die damals abliefen und
seinen eigenen Lebensweg bestimmten.
183
Konfliktlinien, wie etwa jener zwischen Stadt und Land oder zwischen Zentrum und
Peripherie. Diese Cleavage nahm in Österreich bis in die 60er Jahre hinein den hier so
genannten "Lager"-Charakter an. Die Nachwirkungen reichen durchaus bis in die
Gegenwart. Die unklare nationale Lage der Zwischenkriegszeit hat die Situation gegenüber
anderen Fällen lediglich auf spezifische Weise ein wenig verkompliziert. Das aber war
wiederum ein vorwiegend intellektuelles Phänomen. Man behauptet oft, daß das österreichische Wirtschafts- und Sozialsystem am Beginn des 20. Jahrhunderts sich durch
besondere Traditionalität ausgezeichnet hätte. Diese Zurückgebliebenheit wird mit
Sicherheit überschätzt. Wenn wir einige Indikatoren dafür, wie etwa das BIP p. c. oder die
Analphabetenrate als Bildungsindikator oder auch Geburtenziffern zwischen den Gebieten,
welche zehn Jahre später die Republik Österreich bilden sollten, mit jenen aus anderen
Staaten Westeuropas vergleichen (Kausel 1984), ist der Unterschied nicht von einer
Größenordnung, welche eine Qualitätsdifferenz begründen könnte. Daß die
innerösterreichischen regionalen Unterschiede groß waren, ist richtig, gilt aber für alle
anderen Länder auch. Die eigentliche Bedeutung bekamen diese Unterschiede erst durch
die auseinanderklaffenden Sinn- und Bezugswelten von Intellektuellen und Volk und durch
deren (der Intellektuellen) Sinndeutung der Unterschiede.
Bereits die literarische Romantik war ein bewußter Versuch, die Vergangenheit zu
ideologisieren und aus ihr Modelle für ein neues Zusammenleben zu entwickeln. In
Österreich fand sie ihren ideellen Bezug beinahe ausschließlich im Katholizismus, so sehr,
daß Österreich und vor allem Wien eine Zeitlang zur Walfahrtsstätte der reaktionären
deutschen Romantik wurde. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die langsam erkämpfte
Ausweitung der politischen Partizipation (abzulesen am Wahlrecht) demokratische Clubs
und schließlich Parteien sah, schien es auch diesen Kreisen dringlich, sich zu organisieren.
Die Bedrohung durch den Laizismus des Gegenlagers förderte schnell einen politischen
Schulterschluß fast des gesamten Konservatismus unter dem Sigel der "Christlichen
Sozialismus" (damals noch ganz offen ergänzt durch den Namenszusatz "und
Antisemiten").
Verkompliziert wurde, wie schon gesagt, die Situation durch die für die Eliten ungeklärte
nationale Lage, da sich auch die konservativen Intellektuellen mehrheitlich als "deutsch"
definierten, sich somit auf die Bevölkerung eines anderen Staates als ihre Nation bezogen,
obwohl sie die dortigen Verhältnisse zumindest vorerst (sozialdemokratische deutsche
Republik!) eher ablehnten. Als nach dem Zusammenbruch der Monarchie ein selbständiger
Kleinstaat entstand, nahm daher der eine Teil der konservativen Intelligenz Zuflucht zu
diffusen Ideologemen.
So hieß eine einflußreiche Zeitschrift des politischen Katholizismus der Ersten Republik "Das Neue Reich",
wobei man sich keineswegs etwa auf das Deutsche Reich bezog. Kennzeichnenderweise ist der Gründer,
Herausgeber und Chefredakteur der ersten Jahre (Joseph Eberle) ein zugewanderter Deutscher, der seine
geistige Heimat im katholischen Österreich zu finden hoffte - ebenso wie dann eine der wichtigsten Figuren
des "Christlichen Ständestaates", der österreichprogrammatischen Zeitschrift der 30er Jahre, ein Deutscher
dieses Typus war (Dietrich von Hildebrand). Neben einem ausgeprägten Antidemokratismus und einem heute
oft grotesk anmutenden Monarchismus durfte der Bestandteil Antisemitismus natürlich nicht fehlen. Es war
das Sprachrohr eines geradezu rabiaten katholischen Fundamentalismus, das bei anderen katholischen
Strömungen keineswegs ungeteilte Zustimmung fand. Allerdings dürfte einer der geistigen Väter im
Hintergrund Ignaz Seipel gewesen sein (Werner 1938 verneint dies ohne große Überzeugungskraft). Wenn
diese Zeitschrift also Anfang der 20er Jahre bereits der Republik ebenso wie der Demokratie jede
"Legitimität" absprach, so hatte dies verschiedene Bedeutungen. Fürs erste war es ein eher geradezu
kindlicher Versuch, die neue Wirklichkeit einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, indem man ihr
philosophisch und juristisch die Daseinsberechtigung absprach. Doch hätte sich die Rolle dieser Gruppe darin
184
erschöpft, wäre das Blatt keiner Erwähnung wert. Allerdings sprach es bereits zu einer Zeit Gedanken aus,
welche die christlich-soziale Führungsgruppe noch deutlich ablehnte, die sie sich aber nicht einmal ein
Jahrzehnt später zu eigen machte (vgl. Berchtold 1979). Ganz offenbar mit der Unterstützung von
maßgeblichen Teilen des Klerus wurde systematisch die Zerstörung der österreichischen Demokratie
vorbereitet. Da man antidemokratisch war, war man auch antinational, fuhr also vorerst auch noch nicht auf
der österreichischen Schiene. Sobald man von "österreichisch" sprach, präzisierte man den Inhalt mit "alt"österreichisch. Das "österreichische Volk" kommt bisweilen als Gegentypus zum "deutschen Volk" vor,
schon in der Vorwegnahme des Gedanken von den besseren Deutschen. Doch die "österreichische Idee" ist
stets jene Politik, welche in der verblichenen Monarchie schon einmal gescheitert war.
Ein anderer Teil, der "deutsch-katholische", orientierte sich von vorneherein auf den
Anschluß. Damit finden wir auf dieser Seite der Linie recht unterschiedliche Menschen.
Dazu gehörten etwa der Kreis der jungen Ideologen mit Maurras'schen Tendenzen wie
Konrad Heilig, zu dem aber auch Ernst Karl Winter mit ganz anderer Ausrichtung gehörte,
aber auch der Ständestaatsideologe Othmar Spann (dessen Werke spät in der Zweiten
Republik wieder aufgelegt wurden!) und der Pragmatiker Heinrich von Srbik (der sich
selbst 1925 als "maßvollen politischen Konservativen" mit einem "Hang zum
Katholizismus" definierte - Moos 1967, 9).
Den Anschluß an diese Linien stellten in der Zweiten Republik auch wieder sehr
unterschiedliche Personen her, von Friedrich Funder über Willi Lorenz bis zu Friedrich
Heer und Erika Weinzirl. In der Gegenwart scheint diese Gruppe kaum mehr als eine
identifizierbare Strömung zu existieren. Eine "Österreichische Gemeinschaft", die ihre
Existenz auf das Jahr 1925 zurückverfolgt, ist ein Notabelnklub, der trotz einiger bekannter
Namen in seinem Kuratorium (hier scheinen Rudolf Kirchschläger und Kurt Skalnik auf,
daneben noch F. J. Federsel, Norbert Leser, Robert Prantner und W. Potacs), kaum
irgendeine Wirkung zeigen dürfte. Er bekennt sich zur "Belebung und Vertiefung der aus
katholischer Grundlage erwachsenen österreichischen Staatsidee", tritt für "unbedingte
Selbständigkeit Österreichs als Staat und Nation" ein und will das friedliche
Zusammenleben der Völker "besonders jener des Donau- und Alpenraumes", fördern.
Seine Zeitschrift, "Die österreichische Nation", war bis vor wenigen Jahren ein dünnes
Mitteilungsblättchen für Vereinsangelegenheiten, bemüht sich nun aber um
repräsentativeres Aussehen und inhaltliche Beiträge.
Demgegenüber gab es eine intellektuelle Strömung, welche als ihr Hauptziel die
Überwindung der Tradition und des Traditionalismus sah. Sie fand sich seinerzeit
vorwiegend in der Sozialdemokratie und in ihrer geistigen Nachbarschaft, teilweise auch in
den demokratischen Traditionen des österreichischen Deutschnationalismus, und teils
kamen sie sogar ursprünglich aus dem Liberal-Konservativismus. Doch deren
Deutschnationalismus - nicht alle waren deutschnational - hatte eine völlig andere
Bedeutungswelt als jene es war, welche auch den größten Teil der Bevölkerung sich
"deutsch" definieren ließ, wenn man sie nach ihrer nationalen Zugehörigkeit fragte. Otto
Bauers (1923) Hinweis, daß die Anschlußbegeisterung unter den Arbeitern gering war,
"weil sie den deutschen Imperialismus gehaßt hätten", ist eine Rationalisierung und
insoferne eine Mißdeutung der Situation. - Neben ausgewiesenen Sozialdemokraten (Max
Adler, Ludo Moritz Hartmann) gehören hierher auch Leute wie Hans Kelsen, Josef
Schumpeter, Anton Menger, aber auch Sigmund Freud. In der Gegenwart setzt sich diese
Tradition im kulturellen Linksliberalismus fort, der seinerseits noch immer der heutigen
SPÖ nahesteht.
In der politischen Umsetzung war es die Ära Kreisky, welche mit ihrem Schlagwort der
Modernisierung - die über den Charakter als politisches Schlagwort tatsächlich eine
185
geistige Verwandtschaft zur Modernisierung aufwies, wie sie die Nationentheorie versteht einen kulturellen Liberalismus kurzfristig zumindest hegemonial machte. Im Moment
wandelt sich die Szene wiederum. Zu den Protagonisten einer neuen, nun aber gründlich
anders verstandenen Modernisierung haben sich neue Kräfte gemacht.
Als nach der schweren Wahlniederlage der SPÖ im November 1986 - es gelang ihr gerade
noch, einen minimalen Vorsprung vor der ÖVP zu halten - neuerlich eine große Koalition
gebildet wurde, da stand die Regierungserklärung (vom 9. Feber 1987) unter dem Motto:
"Unser Land braucht einen neuen Modernisierungsschub." Dies war wohl ein dialektisches
Anknüpfen an die erste Regierungserklärung Kreiskys vom 27. April 1970: Dialektisch,
weil es einerseits Kontinuität signalisierte zum damaligen Modernisierungskonzept,
andererseits aber offenbar auch die nötige Revision der nahezu zwei Jahrzehnte verfolgeten
Politik andeutete. Sieht man sich diese wie auch andere Regierungserklärungen weiter an,
wird man außer Worthülsen wenig finden. Aus der Regierungserklärung ist jedenfalls nicht
erkennbar, daß nunmehr tatsächlich eine politische Wende eingeleitet wurde. Sie nahm im
Inneren den Kurs einer akzentuierten neokonservativen Wirtschaftspolitik, getragen vor
allem von der Politik des SP-Finanzministers, und - wesentlich weittragender - durch die
Festschreibung der neuen Außenpolitik, initiiert schon in der kleinen Koalition durch den
damaligen Außenminister Gratz, durchgeführt durch die neue EG-Politik der nunmehrigen
Regierung. "Erst als die SPÖ ihre wesentlichen Grundsätze aufgegeben hat, war es ihr
möglich, in die Europa-Idee einzusteigen", schätzt dies der politische Gegner Mock richtig
ein (Wachter 1994, 124). Nach dieser Wende allerdings war die Partei die entschlossenste
Vertreterin der neuen Politik. Sie mündete im EG-Aufnahmeantrag und wurde 1994/95
durch den Beitritt formell abgeschlossen.
Heute trägt auch der SP-Vorsitzende die weitergehende Politik mit, welche die Aufgabe
jeder Eigenständigkeit bedeutet. "Ich begrüße die zunehmende Integration und stehe daher
auch der Währungsunion positiv gegenüber" (Vranitzky 1996, 44). Weil er dies aber in der
"Zukunft", also für die eigenen Funktionäre schreibt, welche dies nicht ganz so eindeutig
sehen, fährt er scheinkritisch fort: "Nicht die grundsätzliche Zielsetzung, wohl aber die
gegenwärtige Konzeption der Währungsunion entspricht primär einer neoklassisch
dominierten Auffassung von Wirtschaftstheorie und -politik." Und weil die Aussage nichts
kostet, fügt er noch hinzu: "Um die Währungsunion wirklich sozial verträglich zu
gestalten, muß die Zielsetzung einer aktiven Beschäftigungspolitik stärker in den
Mittelpunkt unseres wirtschaftspolitischen Handelns rücken" (S. 45 und 48). Die schwerste
Wahlniederlage der SPÖ in der Republik hat dies freilich nicht mehr verhindert.
4.5.1 Abfahrtslaufnationalismus? Nationalstolz?
Sport als Ausdruck nationaler Leistung und nationalen Stolzes wird im Diskurs um
nationales Bewußtsein immer mit Mißtrauen und von oben herab betrachtet. Wollen wir
dies klar feststellen und ausargumentieren: Sport gehört zu den wesentlichen kulturellen
Ausdrücken einer Gesellschaft. Damit sollte auch schon klar werden, warum gerade
Massen- und Schausport eine erhebliche Rolle in der nationalen Identifikation breiter
Volksschichten spielt. War Sport früher und in anderen Gesellschaften vorwiegend von den
Oberschichten betrieben, ja monopolisiert, so wurde er mittlerweile zum kulturellen
Ausdruck eher der Unter- und unteren Mittelschichten. Intellektuelle haben ihn daher aus
ihrem Lebenstil und von ihren Werten aus gewöhnlich mit Mißtrauen betrachtet, zumindest
186
in Kontinentaleuropa.43 Das führt dazu, daß man wesentliche Prozesse in der Formierung
kollektiver Identitäten entweder übersieht oder nicht richtig begreift. In Großbritannien
oder auch in den USA war es nicht zuletzt der "sportsman", welcher den "gentleman"
mitdefinierte, der wiederum den Typus des nationalen Menschen darstellen sollte. Aus
dieser intellektuellen Arroganz mitteleuropäischer Meisterdenker ist auch die
Abqualifikation
mancher
Ausdrucksformen
nationaler
Identität
als
"Abfahrtslaufnationalismus" erklärbar.
Es ist übrigens nicht neu, daß man Sport weniger als nationale Leistung anerkennen will als andere kulturellen
Ausdrücke. Das Wettrennen zwischen Cook und Peary zum Nordpol war nach amerikanischer Art ziemlich
unverhüllt ein nationales Sportereignis. Anders stand es mit dem Wettrennen zwischen Roald Amundsen und
Robert Scott zum Südpol. Dieses mußte unter der weihevollen Bezeichnung "Forschungsexpedition" laufen,
damit sich die Sprecher der nationalen Publika damit auseinandersetzten. Man nahm alibihaft Messungen des
Erdmagnetismus und Aufnahmen der Aurora vor, die sich in ihrer Stümperhaftigkeit später als völlig
unbrauchbar erwiesen. Aber es war hier einfach nicht möglich, die beachtlichen organisatorischen und
körperlichen Leistungen als kompetitiven Selbstzweck darzulegen. Die Ironie dabei ist, daß die Vermarktung
ähnliche Formen annahm, wie wir sie heute z. B. auch bei Reinhold Messner beobachten können. Amundsen
war immer wieder viele Wochen lang rund um die Welt unterwegs, um seine Dias in Vorträgen zu zeigen.
Der Informationsgehalt dieser Dias ist nahezu Null (vgl. Huntington 1989); sie vermitteln bestenfalls
Stimmung. Mehr erwartete man auch gar nicht. Denn man wollte sich identifizieren können, nicht in erster
Linie neue Erkenntnisse gewinnen.
Immer wieder wird auf den Einsatz von Landschaftselementen zur Symbolisierung
österreichischer Identität hingewiesen. Dabei sind die beliebtesten Topoi die "Donau" und schon im Übergang zu einem anderen Identitätstopos (dem "Sport") die "Alpen". Das steht
allerdings in schlagendem Widerspruch zu einem allgemein bekannten und akzeptiertem
Fakt, die "Konzentration der identitätsstiftenden Einrichtungen, Symbole und Heil- und
Heiligtümer in Wien" (Petschar/ Schmid 1990, 34). Beide Lokalisierungen sind nämlich
auch politische Aussagen. Gerade wenn man die Stadtfeindlichkeit der Anti-Moderne
bedenkt, die nicht nur in den 20er und 30er Jahren sumpfige Blüten treibt, sondern sich
auch in den 50er und 60ern ausleben konnte und Ausläufer bis heute hat, erstaunt man über
den Symbolkreis "Großstadt Wien". Wie kommt es, daß ausgerechnet der Weg der Stadt
die Nation Österreich symbolisieren sollte, da doch die zwei Jahrzehnte dominanten
Konservativen mit Wien immer ihre großen Schwierigkeiten hatten? Tatsächlich ging dies
auch nicht so einfach. Weiters ist Wien ein ziemlich komplexes Symbol. Man kann
natürlich, wie es für den inneren Gebrauch seit einiger Zeit geschieht, die
städteplanerischen und -politischen Erfolge des "roten Wiens" in den Vordergrund stellen.
Man kann aber auch, und faktisch geschieht dies in massivem Umfang, sodaß der erste
Aspekt völlig in den Hintergrund gerückt wird, das habsburgische Wien, die
"Residenzstadt Wien" ideologisch modellieren. Damit spielt man auch über die
Ambivalenz der Leittypen Leopold I., Maria Theresia, Joseph II., Franz I. (II.) und
natürlich Franz Joseph hinweg. Ergänzt wird das habsburgische Wien durch die ProvinzHabsburger, von den Tirolern mit Herzog Friedrich IV., "Friedl mit der leeren Tasche" und
Maximilian, bis zum "Steirer" Erzherzog Johann, durch konservativem Regionalismus
somit. Einen Nachglanz dieses Provinzialismus, im analytischen wie durchaus auch in
einem Alltagssinn, finden wir, pathetischer formuliert, auch in der oben ausführlich
zitierten Programmatik der ÖVP und ihrer Interpretation. - Dabei wird dann bewußt oder
unbewußt völlig vergessen, daß Wien in seiner Blütezeit am Ende der Monarchie vor allem
43
Der Verfasser gesteht reumütig ein, daß er sich dessen auch bereits schuldig gemacht hat.
187
auch eine "Industriestadt Wien" (Lichtenberger-Fenz) war. Schließlich sollte man auch
nicht vergessen, daß Wien bis 1966 für das übrige Österreich nicht in erster Linie eine SPKommune war, sondern die Hauptstadt einer von den Konservativen bestimmten
Regierung. Gerade deswegen läßt sich zum einen in der Gegenüberstellung "östlichwienerische Urbanität" und "westlich-ländlicher Traditionalismus", zum anderen aber auch
in der Polarität "fortschrittliches Wien" gegen "höfisches Wien" eine Konfliktlinie
erkennen, welche für die Darstellung der österreichischen Identität und der mit ihr
verbundenen möglichen Programmatiken von erstrangiger Bedeutung ist.
4.5.2 Die Neutralität und der NATO-Anschluß
Die sogenannte "immerwährende" Neutralität bzw. in der Folge die Stellung Österreichs
zur NATO wurde zu einem der Kernpunkte der neueren politischen Auseinandersetzung.
Das war völlig unvermeidlich, weil sie zu einem der Kerne geworden ist, an denen sich
österreichische Identität realisierte. Darüberhinaus war sie als die Voraussetzung für die
Wiedergewinnung der vollen Souveränität für die österreichische Bundesregierung auch
die eigentliche völkerrechtliche und politische Grundlage der Zweiten Republik. Es war
auch kein Zufall, daß die stärksten Angriffe auf die Neutralität stets aus dem
deutschnationalen Flügel der FPÖ kamen. Mittlerweile wurde diese Position, wie die
grundlegenden Haltungen insgesamt, von einem Großteil der politischen Klasse
übernommen. Von intellektueller Seite haben sich außer weit rechtsstehenden Personen
bisher kaum Stimmen dazu vernehmen lassen. Der Versuch, Neutralität angesichts ihrer
fundamentalen Bedeutung zum "Verfassungsprinzip" machen zu wollen, war eher
taktischer Art und insofern verfehlt, als es eine politische Frage ist. Jenseits der
Fragwürdigkeit, politische Entscheidungen mit einem Rechtstabu umgeben zu wollen,
verkennt es natürlich auch den Charakter des Rechts, das schließlich nichts anderes als die
formalisierte
und
verfahrensorientierte
Nachvollziehung
von
politischen
Kräfteverhältnissen ist.
Die Neutralität wurde deshalb zum Hauptangriffspunkt, weil sie tatsächlich den
österreichischen Eigenweg der Selbstbestimmung symbolisiert, und dies, obwohl sie
ursprünglich durchaus eine völkerrechtliche Verpflichtung, auferlegt von außen war,
welcher insbesondere die Sozialdemokratie und ihr damaliger außenpolitischer Sprecher
Kreisky mit Mißtrauen gegenüberstanden. Sie wurde daher zum eigentlichen Kern
österreichischer Identität. In diesem Sinn verkörpert sie auch die österreichische
Demokratie der Zweiten Republik bzw. diese selbst. Das wurde im übrigen sogar offiziell
ausgedrückt, wenn im Gesetz über den österreichischen Nationalfeiertag (BGBl 263/1967)
die dauernde Neutralität als Ausdruck der Entschlossenheit Österreichs definiert wird, "für
alle Zukunft und unter allen Umständen seine Unabhängigkeit zu wahren." Unter dem
Sperrfeuer massiver Angriffe fast der gesamten Presse sowie der NATO-Parteien ÖVP,
FPÖ und LIF sowie eines Teiles der SPÖ bröckelt die Zustimming in den letzten fünf
Jahren etwas ab, ist aber angesichts der fast vollständigen Beherrschung der Presse durch
die Neutralitätsgegner immer noch erstaunlich hoch: Eine zufällige Zeitungsmeldung zum
Zeitpunkt der Endredaktion dieses Textes ergibt 71 % an Pro-Haltung innerhalb der
Bevölkerung (OGM zit in Standard 25./26./27. Okt. 1996). Daß dabei die Kohärenz nicht
groß ist und eine erhebliche Anzahl auch der Aussage zustimmt, daß Österreich allein seine
Sicherheit nicht mehr wird gewähleisten können, ist angesichts der hämmernden
Propaganda und der jahrelangen bewußten Verwischung der Linien nicht verwunderlich.
Vor einem halben Jahrzehnt beantworteten noch 96 % die Frage: "Soll die Neutralität
188
Österreichs so bleiben wie sie ist, oder abgeschafft werden?" mit Ja (zit. nach Profil 3/13.
1. 1992, 16). Die Angriffe auf sie laufen im Moment auf mehreren Linien.
Neutralität ist Bestandteil der österreichischen Staatsidee
weiß nicht
9%
nein
12 %
ja
79 %
Quelle: SWS-Umfrage März 1991
Tatsächlich laufen die Vorschläge der ÖVP, die zur Vorbereitung der Turiner
Regierungskonferenz eine parteieigene Kommission eingesetzt hat, auf eine vollständige
Aufgabe der nationalen Souveränität hinaus, und da Souveränität die Außenseite der
Demokratie ist, auf eine Delegierung der Demokratie. Ausgerechnet Vertreter des
Kleinstaats Österreich treten für Positionen ein, die allenfalls Sinn für Großmächte machen
würde: "Im Rat der Europäischen Union sollen vermehrt Mehrheitsentscheidungen
vorgesehen werden... Die Kommission soll als Motor des Integrationsprozesses gestärkt
werden, indem z. B. weitere Politikbereiche 'vergemeinschaftet' werden. In einer ersten
Phase könnten der Kommission auch Kompetenzen in den Bereichen 'Inneres und Justiz'
übertragen werden" (Wintoniak 1996). Und um dem Ganzen auch einen Schuß Komik zu
geben wird noch die "Direktwahl des Kommissionspräsidenten" vorgeschlagen, wobei die
interessante Erläuterung folgt: "Europa würde durch einen direkt gewählten
Kommissionspräsidenten zu einer Präsidialrepublik wie die USA oder die GUS" (so steht
es tatsächlich im Text!! - Leidwein 1996). In solchen Gedankenspielen hat die Neutralität
natürlich keinen Platz.
Die derzeit maßgebliche Gruppe in der ÖVP hat also die freiheitliche Argumentation
aufgegriffen. Auch hier hat sie ihre Linie völlig geändert. In den 70er Jahren hatte sie sich
gegen die Neutralitätspolitik Kreiskys gestellt, weil diese angeblich eine Gefährdung der
reinen Lehre darstellten. Noch 1984 mußte der eigene künftige Kandidat für die
Bundespräsidentschaft mahnen (Waldheim 1984, 10): "Es gibt Leute, die es eher vorziehen
würden, wenn sich Österreich von der internationalen Politik fernhalten würde... Sicherlich
ist es richtig, sich bei Vermittlungsaufgaben nicht vorzudrängen. Umgekehrt aber leben wir
nicht im luftleeren Raum." Erst wenige Jahre später erkannte sie das politische Potential
einer Westwendung für die eigenen Ziele, die sie intern damals noch nicht durchbringen
konnte. Nach der Wende ließ sie beispielsweise einen Spitzendiplomaten, der heute (1996)
UNO-Botschafter ist, argumentieren: "Mit dem Wegfall des Ost-West-Konflikts und der
Desintegration des Ostblocks wird die Funktion von Nato und Westeuropäischer Union
neu eingeschätzt. Vor allem der Nati wird eine sicherheitspolitische Bedeutung für ganz
Europa zugemessen" (E. Sucharipa in: Standard, 28. Feber 1992). Auch die Richtung, in
189
die es gehen soll, wird bereits vorsichtig angedeutet: "Wären jedoch die eutopäischen
Demokratien von einem äußeren Konflikt bedroht, hätte die Solidarität Vorrang." Es geht
also tendentiell gegen die Dritte Welt, wobei die Situation umgekehrt wird. Tatsächlich
war politisch wie staatsrechtlich die bisher massivste Verschiebung in der Neutralitätspolitik noch lange vor dem EG-Anschluß festzustellen. Es war der zweite Golfkrieg, also
die Auseinandersetzung zwischen zwei der schmutzigsten Dritte-Welt-Regimen, deren
eines jedoch aufgrund seiner reichen Ölvorräte die Unterstützung der USA genoß. Damals
wurde in einer Nacht- und Nebelaktion das Kriegmaterialgesetz und das Strafgesetz so
geändert, daß die agierenden Politiker dem Drängen der USA nachgeben konnten, ohne
eine Strafverfolgung fürchten zu müssen (vgl. Rotter 1992). Die Ironie bestand darin, daß
gleichzeitig eine Reihe von Politikern wegen vergleichsweise harmloser Vergehen wegen
Neutralitätsgefährdung eben vor Gericht standen.
Um die neuen politischen Vorgaben auch ins Volk zu bringen, wird in geradezu
schamloser Weise jener Begriff in Anspruch genommen, welcher bis vor wenigen Jahren
immer ein Anbot an die Schwächeren, eben auch die Dritte Welt, bedeutete: Man spricht
vom "Prinzip der Solidarität". Heute lautet dies so: Auf die Frage an den Parteiobmann
Schüssel, ob der NATO-Beitritt "unausweichlich" sei, antwortet er: "Ja, das ist meine
persönliche Position als Obmann der ÖVP" (Kurier, 25. Mai 1996). Ein halbes Jahr später
wählt er das NATO-Hauptquartier selbst, um das Miltärbündnis aufzufordern, Österreich
um Beitritt zu bitten...
Die NATO-Parteien operieren heute mit Sicherheitspolitik und mit (allerdings nicht
besonders ausgeprägten) außenpolitischen Ängsten in der Bevölkerung. Sie versucht also,
die Neutralität auf einen rein instrumentellen Charakter zurückzuführen. Doch die
Diskussion darüber und über einen kommenden NATO-Beitritt haben mit
Sicherheitspolitik nichts zu tun. Es ist eine bewußt verschleiernde Diskussion. Der Einsatz
ist, wie schon in der EG-Debatte, die Auseinandersetzung um die Ausrichtung der
österreichischen Politik. Sie betrifft somit das nationale Projekt Österreich und damit die
Existenz der österreichischen Nation, und zwar sowohl in seiner realen als auch noch viel
stärker in seiner symbolischen Dimension. Das Ziel ist die endgültige und unwiderrufliche
Liquidierung des eigenständigen Modells Österreich.
Dieser Debatte hinkt im wesentlichen, wie immer etwas zögernd, die SPÖ hinterdrein. Eine
Ausnahme bildete der unvermeidliche Rudolf Burger mit einem Aufruf zum NATOBeitritt im SPÖ-Organ (Burger 1994), in dem er ziemlich wörtlich etwa jene Argumente
verwendet, mit denen sich seinerzeit die FPÖ gegen die immerwährende Neutralität
ausgesprochen hatte. Doch die SPÖ stellt sich derzeit (1996) mehrheitlich noch gegen die
vollständige Aufgabe der Neutralität und hat die gegenwärtige Praxis der differentiellen
Neutralitätspolitik zum offiziellen Standpunkt erhoben. Ihr inoffizieller Standpunkt wird typischerweise von einem Diplomaten mit politikwissenschaftlichen Ambitionen - mit
"Anpassen" umschrieben (Novotny, in Zukunft 5, 92, 17 ff.). Offiziell lautet dies so: Die
Sozialdemokratische Partei Österreichs sieht die Lösung der sicherheitspolitischen
Probleme in der Schaffung eines gesamteuropäischen, kollektiven Sicherheitssystems.
Österreichs Neutralität ist ein durchaus sinnvoller Beitrag zur Errichtung eines solchen
Systems. Österreichs Neutralität ist mit einer Mitgliedschaft in einem Militärbündnis - sei
es die NATO oder die WEU - unvereinbar" (zit. bei: Katzenschläger 1996, 18). Daneben
gibt es aber bereits Kräfte - man denke an den sogenannten Spitzenkandidaten der SPÖ für
die Wahlen zum Europäischen Parlament - die offen den NATO-Beitritt ansteuern, auch
190
wenn sie dies auf mitunter groteske Weise noch verschleiern möchten, indem sie NATO
und Neutralität für miteinander vereinbar erklären. Widerspruch kommt vom schwachen
"linken Flügel", für den derzeit (Mitte 1997) Caspar Einem spricht. Er benennt in einem
Artikel im Standard vom 4./5. August 1996 (Die Zähmung des Wettbewerbs") einige der
wesentlichen Motive, welche hinter dem Drängen in die NATO stehen:
"Freilich ist es nicht ganz auszuschließen, daß es auch einigen österreichischen Politikern
schwerfällt, mit der Entscheidung von 1918/19, die Österreich die materiellen
Voraussetzungen zu Machtpolitik genommen hat, und mit der Entscheidung von 1955, die
in der Folge der Katastrophe 1938/45 und der damals nochmals ausgelebten
Großmannsgelüste die Konsequenzen gezogen hat, zu leben. Derartige Neigungen sollten
allerdings offen gelegt werden. Österreich hat genug Erfahrungen gemacht als Teil einer
Großmacht oder als Großmacht, um zu wissen, wissen zu können, daß dieser Politikansatz
zwar immer wieder auf "das Feld der Ehre" führt. Dort aber bleiben in der Regel Tausende,
wenn nicht Millionen Tote zurück."
Diese Sätze sind tatsächlich erstaunlich für einen amtierenden Innenminister einer heutigen
österreichischen Bundesregierung. Doch ebenso wesentlich ist, was im Artikel noch steht,
bzw. vor allem, was nicht drinnen steht, und was sich auch im nernebelnden Stil ausdrückt,
was also ein maßgeblicher Politiker nicht sagen darf oder zu sagen wagt: Die EG / EU
selbst ist das Ergebnis jenes Großmachts- und Einflußzonendenkens, das er hier kritisiert.
Schon in den Römer Verträgen haben die vertragschließenden Parteien ausdrücklich das
Ziel der politischen Union formuliert. Nun weiß natürlich jeder, daß ein Staat nicht zuletzt
eine "amalgamierte Sicherheitsgemeinschaft" (K. W. Deutsch) ist, m. a. W., eine
vereinheitlichte Militärorganisation. Insbesondere ist die GASP, deren "Vertiefung" er
befürwortet, das designierte Instrument dieser Politik. Eine politische Union wäre denn
auch ein Widerspruch in sich ohne einheitliche Außen- und Militärpolitik. Daß diese
bislang schlecht funktioniert, besagt einzig, daß sich die maßgeblichen Staaten bisher
weder auf die Ziele noch auf die Vorgangsweisen tatsächlich einigen konnten, weil
insbesondere die Achsenmächte BRD und Frankreich in vielen Bereichen unterschiedliche
Vorstellungen bei durchaus grundsätzlicher Übereinstimmung haben. Die verschiedenen
Traditionen unterschiedlicher Großmachtkonzepte wirken nach, ebenso die
unterschiedlichen regionalen Interessen. Es besagt, daß die politische Union vorderhand
noch Fiktion ist. Doch wohin die allgemein festgelegte Richtung gehen soll, zeigt die
Diskussion und der Ausgang der sogenannten "out-of-area-Einsätze" in der BRD. Es geht
um die Durchsetzung von Interessen des "Nordens" gegen den Rest der Welt mit
militärischen Mitteln. Konnte man der NATO im Kalten Krieg in ihrem Sinne nicht einen
gewissen Verteidigungscharakter absprechen, weil es immerhin das Gegenüber des
Warschauer Paktes gab, so ist dieser Verteidigungscharakter mit dem Zerfall von
Warschauer Pakt und Sowjetunion bis auf den letzten Rest geschwunden. Im übrigen
wurden auch seinerzeit aus innenpolitischen Interessen verschiedener NATO-Staaten die
Bedrohungsbilder nicht nur bis zur Karikatur verzerrt, sondern massiv überschätzt - von
der "Raketenlücke" Kennedys über die vor allem deutschen Interessen
entgegenkommenden SS20 bis zur Einschätzung der gescheiterten Invasion Afghanistans
durch die Sowjetunion.. In diese NATO, welche der militärische Arm der Nord-Süd-Politik
sein soll, und wovon die GASP nur die EU-Formulierung der zugrundeliegenden Politk
bildet, drängt also ein Großteil der österreichischen politischen Klasse, und der Sprecher
des "linken" SP-Flügels nickt beifällig zur politischen Seite. Er hat offenbar vergessen, sich
an Clausewitz zu erinnern: Militärische Politik ist nur untergeordneter Teil der
191
Außenpolitik und wird, außer in Ausnahmeperioden, von dieser gesteuert. Für eine
"Vertiefung" der GASP, aber gegen die NATO zu sein, ist ein politischer Widerspruch.
Und wie verträgt sich des damaligen Innenministers Abneigung gegen die
"Großmannsgelüste" und die Großmacht-Phantasien mit dem Wahlplakat der SPÖ im
September 1996: "In Europa zählt Stärke"?
Der augenblickliche parteioffizielle Standpunkt läßt sich auf solche Feinheiten gar nicht
ein, sondern erklärt in gewohnter Oberflächlichkeit: "Die NATO ist ein
gutfunktionierendes Militärbündnis, aber sie vertritt ein Konzept von gestern... Was wir
brauchen, ist eine größere Bereitschaft und Anstrengungen, um Konflikte nicht militärisch
zu lösen; um dazu beizutragen, daß militärische Konflikte erst gar nicht mehr entstehen"
(P. Kostelka, Das Anti-Neutralitäts-Paradoxon. Profil 32/5. 8. 1996). Damit erspart man
sich auch jene Diskussion über Großmachtsehnsüchte auch und nicht zuletzt innerhalb der
SPÖ, die Einem in Gang bringen wollte. Hier zeigt sich die Doppelzüngigkeit der SPÖ
wieder deutlich, wie sie selbst ein Parteimitglied moniert: "In den letzten Jahren hat die
Regierung den Begriff 'Neutralität' fast nur mehr für den Hausgebrauch verwendet, ihn
jedoch auf internationaler Ebene kaum noch ins Spiel gebracht. Dadurch hat Österreich
aber auch auf die Chance verzichtet, im Rahmen der europäischen Sicherheitsdiskussion
einen Akzent einzubringen, der möglicherweise auch die starren Fronten um die Frage der
NATO-Osterweiterung aufweichen könnte" (Krims 1996, 23).
Parallel und faktisch von dieser Politik von oben gesteuert versucht der weitestgehend
konservative Tagesjournalismus, diese Strategie der Instrumentalisierung zu
popularisieren, vorderhand trotz großem Einsatz noch mit bescheidenem Erfolg. Und
daneben gibt es, wie schon erwähnt, vereinzelt jene, welche sich, vermutlich aus
persönlichem Profilierungsbedürfnis, mit einer moralischen, "internationalistischen",
Argumentation versuchen: Neutralität "ist immer eine Politik des verhärteten Herzens,"
usw. (Burger 1994).
4.5.3 Personalisierung: Günther Nenning vs. Rudolf Burger?
"Österklein statt Österreich, Österarm statt Österreich" (Nenning 1988, 206), so faßt einer
der seinerzeit bekanntesten Intellektuellen, auch einer, der schon recht viele Schwenks
gemacht hat, einer, der manchmal im Zentrum von neuen Ideen, derzeit aber - trotz (oder
wegen?) regelmäßigen Beiträgen in der "Kronenzeitung" - eher am Rande des politischen
Denkens steht, sein politisches Projekt zusammen. "Die Vollendung der österreichischen
Nationalität liegt im Schutz der Natur und der Arbeit, das heißt: Schutz der Heimat...
Unsere Regierenden gehen über Leichen (von Natur und Demokratie)" (S. 200 und 232).
Nicht nur damit steht Nenning diametral gegen herrschende intellektuelle Strömungen, aber
auch den Trivialfolgerungen daraus, welche manche Politiker ziehen. Zur Affäre Waldheim
meint er etwa: "Was hingegen unser Image betrifft, sollen wir froh sein, daß wir es verloren
haben. Mozartkugeln, Lippizaner Pferterln, Sound of Music, und der ganze Scheiß - dieses
Heiratsschwindlerimage des Österreichers, Schnurrbärtchen, Hantibussi very charming dem sollen wir nachweinen (201)?" Und schließlich zum Thema EG: "EG ist eine neue
Abkürzung für 'Deutschland, Deutschland über alles'" (S. 13). "Schafft zwei, drei, viele
Europas, nur nicht eines (Nenning 1990, 84)!" Der Wiederspruch zum eilfertigen und
höchst aggressiven - sehr laut hörbar in einer ORF-Diskussion mit Nenning über dasselbe
Thema - Nachvollzug politischer Vorgaben der Regierung, für den paradigmatisch Rudolf
Burger steht, könnte nicht größer sein.
192
Nenning hat bei all seinen politischen und ideologischen Hackenschlägen, vom BrechtKanibalismus bis zu seiner Version des Katholizismus, den politischen Projektcharakter
der Nation nicht nur erfaßt, sondern auch mit Inhalten anfüllen wollen. Darüberhinaus stellt
er sich prononciert gegen die Selbsthaß-Übertragungen, die wir weiter oben unter dem
Stichwort "Vergangenheitsbewältigung" angesprochen haben. Er verzichtet auch nicht auf
die alten Klichees: "Ich fühle mich als Böhme, Ungar, Jude, Italiener, Kelte, Illyrer - wie
sich eben ein richtiger Österreicher fühlt... verkauzt, provinziell, eben österreichisch" usw.
(Nenning 1988, 12 f.). Das ist übrigens ein seit 1945 gängiger Ausdruck für den Versuch,
die nationale Zugehörigkeit auf eine neue Weise zu naturalisieren, indem man nicht mehr
die „ (Rassen-) Reinheit“ betont, sondern die Mischung. Übrigens zeigt sich hier besonders
deutlich, wie heute „Kultur“ den Begriff der „Natur“ und insbesondere den der „Rasse“
ablöst: Denn heute wird das selbe Anliegen unter dem Schlagwort „Multikulturalismus“
formuliert, den man der „Nationalkultur“ gegenüberstellt (statt seinerzeit der „reinen
Rasse“). Der Begriff der Nationalkultur ist ja nichts anderes als der Anspruch einer Nation,
organisiert als Staat, auf die unbefragte Loyalität seiner Bürger. Der Kulturbegriff wird
infolge seiner höheren Dignität gegenüber jenem der Politik eingesetzt. Das ist auch der
Grund, dass man auf verlorenen Boden gegen die Verwendung des in Fragen ethnischer
Beziehungen analytisch obsoleten Kulturbegriffs angeht.
Doch seine Stellung zur NS-Zeit formuliert er in einer Weise, die wahrscheinlich
wahrhaftiger ist als die Gegenposition, jedoch allen Abrechnungen mit dieser
Vergangenheit entgegensteht: "In Wahrheit lief mitten quer durch uns die Grenze zwischen
Anstand und Faschismus ... Verwerflich ist zweierlei: erstens Faschismus, zweitens
Antifaschismus, der nicht verzeihen kann" (80 und 71). Eine stärkere Gegenthese zu den
Jellineks etc. dürfte schwer zu finden sein. Ist es auch antibrechtisch (da hat Nenning ja
Tradition), so ist es doch gleichzeitig auch vielschichtig. Wenn er über den "Widerstand",
den viele österreichische Schriftsteller ständig zu leisten glauben, spöttelt, spricht er
darüber hinaus noch ein erstaunliches Faktum an: den Mißbrauch von Begriffen, die
seinerzeit eine Frage von Leben und Tod bedeuteten, und die heute zur Masche, zur
modischen Pose und Posse wurden - wobei der für den eigenen Erfolg einiges riskiert, der
sie nicht benutzt und sich damit einem bestimmten Konformitätsdruck verweigert.
Nenning ist in unserem Zusammenhang, des zeitgenössischen Projektes Österreich,
deswegen wichtig, weil er eine Zeitlang, in den 60er und 70er Jahren, zum Sammelpunkt
einer größere Anzahl junger Intellektueller wurde. Seine damaligen Ideen und sein
Formulierungs- wie sein Oragnisationstalent taten also Wirkung. Ob bzw. wie sehr dies
heute noch der Fall ist, dürfte eher zweifelhaft sein. Nichtsdestoweniger kommt man an
ihm nicht vorbei, wenn man das österreichische Geistesleben der Gegenwart beobachtet.
5 Nachnationale oder nationale Politik im übernationalen Sttaatenverband? Die Zeit
seit 1995
Der Aufbau der österreichischen Nation war in weitaus geringerem Maße wie jener anderer
und konkurrierenden Nationenprojekte ein intellektuelles Anliegen. In Österreich waren die
Intellektuellen und die politische Elite bis zum NS-Zusammenbruch fast durchgehend
Träger eines "deutschen" Nationalbewusstseins. "Nation Österreich" war insbesondere
nach 1945 ein von oben gesteuertes politisches Programm, welches trotz seiner
außenabhängigen Bedingtheit (Abkoppelung von der deutschen Katastrophe) einem
tiefgehenden Bedürfnis der Bevölkerung entgegenkam. Das wird deutlich, wenn man ein
Beispiel zum Vergleich heranzieht, welches etwa gleich viel Zeit verfügbar hatte, letztlich
193
aber scheiterte, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach endgültig: die DDR. Auch das
Projekt eines antifaschistischen deutschen Staates zuerst und seit Ende der 60er Jahre einer
eigenen Nation (Kosing 1976, Hexelschneider/John 1984) wurde von oben vorgegeben. Es
scheiterte im wesentlichen an seinen Trägern, deren Projekt durch den entscheidenden Teil
der Bevölkerung nicht akzeptiert wurde und sich daher ohne Stütze von außen nicht halten
konnten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben die Intellektuellen gegenüber der großteils aus dem
alten System wiederkommenden, aber gewandelten politischen Klasse bis auf wenige
Ausnahmen vorerst stumm. So wurde Österreich in einem Ausmaß eine "politische
Nation", wie es anderswo in Europa kaum noch zu finden ist. Der politische
Projektcharakter, der jedem Nationenaufbau zukommt, ist nur dünn durch die üblichen
nationalen und nationalistischen Mythen verhüllt, wie sie sonst so beliebt als Spielzeuge
nationaler Invention sind.
Die ÖVP war damals neben der KPÖ die eigentliche Erfinderin der österreichischen Nation. In ihrem Programmentwurf von Mitte der 1990er Jahre bietet sie statt dessen "Europa"; Heimat sucht sie "in der Familie, am Arbeitsplatz, in den Vereinen, in der Gemeinde,
im Bundesland, in der überschaubaren und nahen Gemeinschaft" (der ÖVP-Spitzenpolitiker und spätere Nationalratspräsident Andreas Khol). Die Nation Österreich kommt
nicht mehr vor. – Die SPÖ hatte mit der österreichischen Nation anfangs Schwierigkeiten.
In der Ära Kreisky wurde sie zur eigentlichen Trägerin dieses Nationalprojektes. Ein wesentlicher Zug war die aktive Neutralitätspolitik. Seit Franz Vranitzky besinnt sie sich auf
ihre alten Wurzeln: Österreich will sie nicht mehr sagen; also sagt sie Europa. – Die F(PÖ)
schließlich, lange Zeit ohne wenn und aber deutschnational und aus diesem Grund pro-EG,
entdeckte ebenfalls Mitte der 90er Jahre aus taktischen Gründen das von der ÖVP fallen
gelassene Österreich-Thema und Jörg Haider wollte es in einer Serie von Interviews im
Sommer 1995 mit ihren Inhalten neu füllen und instrumentalisieren. Die damaligen zwei
Kleinparteien hatten teils gar nicht begriffen, um was es geht (der Großteil der "Grünen");
teils stehen sie auch in diesem Punkt exakt auf dem Boden der SPÖ (LIF).
Die Intellektuellen sind gegenwärtig eher verwirrt. Die Debatte bewegt sich weniger
zwischen als an zwei Polen: Einige wenige beeilen sich, dominanten politischen Überlegungen zu Diensten zu sein. Erwin Ringel widmete sich der restlosen Bejahung des status
quo. Rudolf Burger ruft gegen die "Kleinstaaterei" zum NATO-Beitritt auf, nachdem er
vorher zusammen mit Anton Pelinka den EG-Beitritt propagiert hatte, und Robert Menasse
wollte im Mai 1995 gleich den Anschluss an Deutschland.
Nationale Souveränität ist die Außenseite demokratischer Selbstbestimmung. Die heutige
Debatte um die österreichische Identität geht daher um die Erhaltung und den Ausbau
demokratischer Qualität. Österreichische Intellektuelle, die sich an dieser Diskussion beteiligen, haben das bislang nur undeutlich klar gemacht. Sie überlassen die Auseinandersetzung Rechtspopulisten und einer Boulevardzeitung. Ihr Ausgang wird die Zukunft
Österreichs bestimmen.
…..
6 Ausklang
194
Literatur
Abkürzung der Zeitschriften:
CRSN – Canadian Review of Studies in Nationalism. Hg. von Th. Spira.
LPLP – Language Problems and Language Planning
ÖGL – Österreich in Geschichte und Literatur
Abele, Hanns (1989, Anmerkungen zu einer Wirtschaftsgeschichte der Gegenwart: Österreich seit
1945. In: Abele, Hanns, u. a. (1989), Hg., Handbuch der österreichischen Wirtschaftspolitik.
Wien: Manz. 57 – 74.
Adel, Kurt (1964), Ein Stilgesetz der österreichischen Dichtung. In: ÖGL 8, 136 – 146.
Adel, Kurt (1971), Sprache und Dichtersprache in Österreich in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts. In: ÖGL 15,147 – 162.
Adunka, Evelyn (1995), Friedrich Heer. Eine intellektuelle Biographie. Innsbruck: Tyrolia.
Alter, Peter (1985), Nationalismus. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Anderle, Charlotte (1986), Der andere Peter Rosegger. Polemik, Zeitkritik und Vision im Spiegel
des ‘Heimgarten’. 1876 – 1918. Wien: Österreichischer Agrarverlag.
Anderson, Benedikt (1983), Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London-New York: Verso.
Andrássy, Graf Julius (1897), Ungarns Ausgleich mit Österreich vom Jahr 1867. Leipzig: Duncker
& Humblot.
Appelt, Erna (1992), Ein, zwei, ..., viele Widersprüche. In: L'homme - Zeitschrift für feministische
Geschichtsforschung 3/2, 46 – 58.
Appelt, Heinrich (1976) , Hg., Privilegium minus. Das staufische Kaisertum und die Babenberger
in Österreich. Wien: Böhlau.
Appelt, Heinrich (1988), Das Herzogtum Kärnten und die territoriale Staatsbildung im Südosten.
In: ders., Kaisertum, Königtum, Landesherrschaft. Gesammelte Studien zur mittelalterlichen
Verfasungsgeschichte. Wien-Graz-Köln: Böhlau, 276 - 292.
Appelt, Heinrich (1991), Das Herzogtum Österreich. In: Drabek, Anna M. (1991), Red., Österreich
im Hochmittelalter 907 - 1246). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften.
Ardelt, Rudolf G. (1986), "Drei Staaten - Zwei Nationen - Ein Volk" oder die Frage: "Wie deutsch
ist Österreich?" In: Zeitgeschichte 13, 253 - 268.
Auckenthaler, Karlheinz F. (1994), 'Ich sah, daß die Österreicher eine ganz andere, fremde Nation
sind. Die gemeinsame Sprache täuscht... Sie sind viel älter, erfahrener, viel weiser im Umgang
mit anderen Völkern.' Überlegungen zum österreichischen Literaturbegriff. In: ÖGL 38, 147 169.
Bach, Maximilian (1898), Geschichte der Wiener Revolution. Wien.
Bailer-Galanda, Brigitte (1995), Haider wörtlich. Führer in die Dritte Republik. Wien: Löcker.
Bansleben, Manfred (1983), Die Frage der österreichischen Wiedergutmachungen auf der
Friedenskonferenz 1919. In: ÖGL 27, 75 – 83.
Barnay, Markus (1995), Historische Konstruktion von Ethnizität und die gegenwärtige
Entwicklung des Regionalbewußtseins. In: Montfort 47, 30 – 33.
Barth, Frederik (1969), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture
Differences. London: Alan & Unwin.
195
Bauböck, Rainer (1994a), Transnational Citizenship. Membership and Rights in International
Migration. Aldershot: Edward Elgar.
Bauböck, Rainer (1994b), ed., From Aliens to Citizens. Redefining the Status of Immigrants in
Europe. Aldershot: Avebury.
Bauer, Otto (1907), Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Wien: Verlag der Volksbchhandlung (auch in: Werke. Hg. von H. Pepper. Wien: Europa Verlag, 1976).
Bauer, Otto (1976 [1923]), Die österreichische Revolution. In: Werke, Bd. 2. Hg. von Hugo
Pepper. Wien: Europa Verlag.
Behler, Ernst (1994), La conception de l'Europe dans la théorie du premier romantisme et la
relation franco-allemande. In: Revue germanique internationale, Heft 1 (Europe centrale /
Mitteleuropa), 25 – 44.
Behrendt, Ivan T. / Ranki, György (1973), Ungarns wirtschaftliche Entwicklung. In: Wandruszka,
Adam/Urbanitsch, Peter, Hg., Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918. Band 1: Die wirtschaftliche Entwicklung. Hg. von A. Brusatti. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 462 – 527.
Belting, Hans (1990), Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst.
München: Beck.
Belzyt, Leszek (1996), Zur Frage des nationalen Bewußtseins der Masuren im 19. und 20.
Jahrhundert (auf der Basis statistischer Angaben). In: ZS für Ostmitteleuropaforschung 45, 35 –
56.
Benda, Julien (1993 [1933]), Discours à la nation européenne. Paris: Gallimard.
Bendix, John (1994), Switzerlands 700th Anniversary: The Politics of Negotiating a Cultural
Display. In: CRSN XXI, 33 - 44.
Benedikt, Heinrich (1954), Hg., Geschichte der Republik Österreich. Wien: Verlag für Geschichte
und Politik.
Berchtold, Klaus (1979), Hg., Die Verfassungsreform von 1929. Dokumente und Materialien zur
Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle von 1929. 2 Bde. Wien: Braumüller.
Berenger, Jean (1984), A propos d'un ouvrage recent: les finances d'Autriche a l'epoque baroque
(1650 - 1740). In: histoire, economie et societe, 3e année, 221 – 245.
Berger, Peter L. / Luckmann, Thomas (1969), Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit.
Frankfurt/M.: Fischer.
Bernatzik, Edmund (1911), Hg., Die österreichischen Verfassungsgesetze mit Erläuterungen.
Wien: Manz.
Bernstein, Eduard (1921), Die deutsche Revolution. Ihr Ursprung, ihr Verlauf und ihr Werk. 1.
Band: Geschichte der Entstehung und ersten Arbeitsperiode der deutschen Republik. BerlinFichtenau: Verlag für Gesellschaft und Erziehung (Anm.: ein 2. Band erschien nicht).
Birkhan, Helmut (1997), Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Bluhm, William T. (1973), Building an Austrian Nation. The Political Integration of a Western
State. New Haven: Yale Univ. Press.
Bockhorn, Olaf (1994), "Diese Bauten stellen ... die Urform des ostgermanischen Hauses dar." Zur
Tätigkeit der Arbeitsgruppe "Bauernhausaufnahme" in der Gottschee im Jahr 1941. In: Pöttler,
Burkhard, u. a., Hg., Innovation und Wandel. Festschrift für Oskar Moser zum 80. Geburtstag.
Graz: Österreichischer Fachverband für Volkskunde, 23 – 32.
Botz, Gerhard / Sprengnagel, Gerald (1994), Hg., Kontroversen um Österreichs Zeitgeschichte.
Verdrängte Vergangenheit, Österreich-Identität, Waldheim und die Historiker. Frankfurt/M.:
Campus.
196
Bousqet, Nicole (1979), Esquisse d'une théorie de l'alternance de periodes de concurrence et
d'hegemonie au centre de l'économie-monde capitaliste. In: Review II, 501 - 517.
Brandstaller, Trautl (1996), Das Ende von Postkakanien. Oder: Warum Österreich sein
Millennium nicht feiert. In: Europäische Rundschau 24 (Heft 3), 121 - 124.
Brandt, Harm-Hinrich (1985), Parlamentarismus als staatliches Integrationsproblem: Die Habsburgermonarchie. In: Birke, Adolf M. / Kluxen, Kurt, Hg., Deutscher und Britischer Parlamentarismus / British and German Parlamentarism. München: K. G. Saur, 69 – 105.
Brauneder, Wilhelm / Lachmayer, Friedrich (1983) Österreichische Verfassungsgeschichte. Wien:
Manz.
Braudel, Fernand (1986), Die Dynamik des Kapitalismus. Stuttgart: Klett-Cotta.
Braunthal, Julius (1964), Auf der Suche nach dem Millenium. Wien: Europa Verlag.
Bruckmüller, Ernst (1984), Nation Österreich. Sozialhistorische Aspekte ihrer Entwicklung. Wien:
Böhlau. (neue Bearbeitung 1996: Kulturelles Bewußtsein und gesellschaftlich-politische Prozesse).
Bruckmüller, Ernst (1985), Sozialgeschichte Österreichs. Wien: Herold.
Bruckmüller, Ernst (1994), Österreichbewußtsein im Wandel. Identität und Selbstverständnis in
den 90er Jahren. Wien: Signum Verlag (Schriftenreihe des Zentrums für angewandte Politikforschung, Band 4).
Brunner, Otto (939) Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte
Südostdeutschlands im Mittelalter. Baden bei Wien: Rohrer.
Brunner, Karl (1994), Herzogtümer und Marken. Vom Ungarnsturm bis ins 12. Jahrhundert.
Österreichische Geschichte 907 - 1156. Hg. von Herwig Wolfram. Wien: Ueberreuter.
Brunner, Karl Michael / Jost, Gerhard / Lueger, Manfred (1994), Zur Soziogenese von Akzeptanz
und Integration: eine Gemeindestudie zur Beziehung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. In: ÖZP 23, 315 – 329.
Burger, Rudolf (1994), Vae neutris! In: Zukunft, Heft 9, 6 – 13.
Burghardt, Anton / Mathis, Herbert, Hg., Die Nationwerdung Österreichs. Historische und soziologische Aspekte. Wien: Institut für allgemeine Soziologie an der Wirtschaftsuniversität, 1978.
Burian, Peter (1992), Österreich und der Völkerbund. In: Klueting, Harm, Hg., Nation, Nationalismus, Postnation. Beiträge zur Identitätsfindung der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert.
Köln: Böhlau, 107 – 122.
Butschek, Felix (1978), Die österreichische Wirtschaft 1938 - 1945. Wien/Stuttgart: WIFO/G.
Fischer.
Butschek, Felix (1985), Die österreichische Wirtschaft im 20. Jahrhundert. Wien/Stuttgart: WIFO /
G. Fischer.
Butschek, Felix (1993), Der Zerfall Österreich-Ungarns – ein Lehrstück für die GUS? In:
Monatsberichte, h. 4, 231 – 237.
Butschek, Felix (1996), Österreichische Lebenslügen - oder wie wissenschaftlich ist
Geschichtsschreibung? In: Europ. Rundschau 24, 17 - 26.
Buttinger, Josef (1953), Am Beispiel Österreich. Ein geschichtlicher Beitrag zur Krise der
sozialistischen Bewegung. Köln: .
Cameron, Rondo (1991), Geschichte der Weltwirtschaft. I: Vom Paläolithikum bis zur Industrialisierung. II: Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart. Aus dem Amerikanischen übersetzt
von R. und B. Fremdling. Stuttgart: Klett-Cotta.
Cole, John W. / Wolf, Eric R. (1996), Die unsichtbare Grenze. Ethnizität und Ökologie in einem
Alpental. Bozen - Wien: Folio Verlag.
197
Csaky, Eva Maria (1980), Der Weg zu Freiheit und Neutralität. Dokumentation der österreichischen Außenpolitik 1945 – 1955. Wien: Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik
und internationale Beziehungen.
Czeike, Felix (1964), Hg., Erinnerungen eines Wiener Bügermeisters. Cajetan Felder. Wien:
Forum Verlag.
Czoernig, Carl von (1857), Ethnographie der österreichischen Monarchie. Wien: Hof- und
Staatsdruckerei.
Dachs, Herbert (1974), Österreichische Geschichtswissenschaft und Anschluß 1918 - 1930. Wien:
Geyer Edition (Veröffentlichung des Historischen Instituts der Universität Salzburg).
Dachs, Herbert / Gerlich, Peter / Müller, W. C. (1995), Die Politiker. Karrieren und Wirken
bedeutender Repräsentanten der Zweiten Republik. Wien: Manz.
Dahl, Robert A. (1982), Dilemmas of Pluralist Democracy. Autonomy vs. Control. New Haven:
Yale Univ. Press.
De Cillia, Rudolf (1995), Deutsche Sprache und österreichische Identität. In: Medienimpulse.
Beiträge zur Medienpädagogik 14 (Dezember), 4 – 13.
De Swaan, Alexander (1995), Die soziologische Untersuchung der transnationalen Gesellschaft.
In: JfS 35, 107 - 120.
Deutsch, Karl W. (1953), Nationalism and Social Communication. New York: Wiley.
Deutsch, Karl W. (1969), Der Nationalismus und seine Alternativen. München: Piper.
Deutsch, Karl W. (1973), Nationalismus – Nationalstaat – Integration. Düsseldorf: Bertelsmann.
Deutsch, Karl W. (1979), Tides Among Nations. New York: The Free Press.
Dittrich, Eckhard J. / Radtke, Frank-Olaf (1990), Hg., Ethnizität. Wissenschaft und Minderheiten.
Opladen: Westdeutscher Verlag.
Dreier, Werner / Pichler, Meinrad (1989), Vergebliches Werben. Mißlungene Vorarlberger
Anschlußversuche an die Schweiz und and Schwaben (1918 - 1920). Bregenz: Vorarlberger
Autorengesellschaft.
Dreisziger, N. F. (1992), Between Nationalism and Internationalism: Oskar Jaszi's Path to
Danubian Federalism, 1905 - 1918. In: CRSN XIX, 19 – 30.
Drimmel, Heinrich (1975), Die Häuser meines Lebens. Erinnerungen eines Engagierten. Wien:
Amalthea.
Duller, Eduard (o. J. [ca. 1840]), Die Donau. München: Borowsky (Das malerische und
romantische Deutschland).
Dunajtschik, Harald (1995), Volksaufstand wegen Schiffstaufe. Die Fussach-Affäre 1964. In:
Gehler, Michael / Sickinger, Hubert, Hg., Politische Affären und Skandale in Österreich. Von
Mayerling bis Waldheim. Thaur: Kulturverlag, 455 – 485.
Durkheim, Emile (1990 [1897]), Der Selbstmord. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Eisenstadt, S. N. / Rokkan, Stein (1973), Hg., Building States and Nations. Models and Data
Ressources. 2 Vol. Beverly Hills/London: Sage.
Ellenbogen, Wilhelm (1981), Menschen und Prinzipien. Erinnerungen, Urteile und Reflexionen
eines kritischen Sozialdemokraten. Bearbeitet von F. Weissensteiner. Wien: Böhlau.
Erdmann, Karl Dietrich (1994), Die Spur Österreichs in der deutschen Geschichte. In: Botz /
Sprengnagel 1994, 241 – 265.
Ermacora, Felix / Wirth, Christiane (1982), Hg., Die österreichische Bundesverfassung und Hanz
Kelsen. Analysen und Materialien zum 100. Geburtstag von Hans Kelsen. Wien: Braumüller.
Ernst, August (1987), Geschichte des Burgenlandes. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
198
Farrar, L. L. / McGuire, Kiernan / Thompson, John E. (1998), Dog in the night: the limits of
European nationalism, 1789 - 1895. In: Nations and Nationalism 4, 547 – 568.
Farkas, Reinhard (1994), Hg., Peter Roseggers Heimgarten. Wege zum Leben. Wien:
Österreichischer Agrarverlag.
Fellner, Fritz (1994), Das Problem der österreichischen Nation nach 1945. In: Botz / Sprengnagel
1994, 216 – 240.
Fellner, Fritz (2002), Geschichtsschreibung und nationale Identität. Probleme und Leistungen der
österreichischen Geschichtswissenschaft. Wien: Böhlau.
Fellner, Fritz / Schmid, Georg E. (1978), Ende oder Epoche der deutschen Geschichte? Bemerkungen zum Abschlußband des Gebhardschen Handbuches. In: Zeitgeschichte 5, 158 – 171.
Fenz, Brigitte (1978), Zur Ideologie der 'Volksbürgerschaft'. Die Studentenordnung der Universität
Wien vom 8. April 1930 vor dem Verfassungsgerichtshof. In: Zeitgeschichte 5, 125 – 145.
Filla, Wilhelm / Flaschberger, Ludwig / Pachner, H. / Reiterer, Albert F. (1982), Am Rande
Österreichs. Zur Soziologie der österreichischen Volksgruppen. Wien: Braumüller.
Filla, Wilhelm / Judy, Michaela / Knittler-Lux, Ursula (1992), Aufklärer und Organisator. Der
Wissenschaftler, Volksbildner und Politiker Ludo Moritz Hartmann. Wien: Picus.
Filla, Willi (1984), Österreichbewußtsein in der Arbeiterbewegung: KPÖ und SPÖ. Wien: Manus
(Projektbericht des FWF).
Filla, Willi (1988), Kaum bekannt: Alfred Kahr. Theoretiker der österreichischen Nation. In:
Schulheft, H. 1, 26 - 35.
Fischer, Ernst (1945), Die Entstehung des österreichischen Volkscharakters. Wien: Österreichischer Verlag.
Fischer, Ernst (1948), 1848.
Fishman, Josuah (1972), Language and Nationalism. Two Integrative Essays. Rowley, Mass.:
Newbury House.
Flaschberger, Ludwig / Reiterer, Albert F. (1980), Der tägliche Abwehrkampf.
Erscheinungformen und Strategien der Assimilation bei den Kärntner Slowenen. Wien:
Braumüller.
Fletcher, Roger (1982), Karl Leuthners Greater Germany. The Pre-1914 Pangermanism of an
Austrian Socialist. In: CRSN IX, 57 – 79.
Flora, Peter (1974), Modernisierungsforschung. Zur empirischen Analyse der gesellschaftlichen
Entwicklung. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Francis, Emmerich (1965), Ethnos und Demos. Soziologische Beiträge zur Volkstheorie. Berlin:
Duncker & Humblot.
Franke, Herbert / Trauzettel, Rolf (1968), Das chinesische Kaiserreich. Frankfurt/M.: Fischer
(Fischer Weltgeschichte 19).
Freud, Sigmund (1989), Studienausgabe. 11 Bände + Ergänzungsband. Frankfurt/M.: Fischer.
Frodl, Gerbert / Schröder, Klaus Albrecht (1992), Hg., Wiener Biedermeier. Malerei zwischen
Wiener Kongreß und Revolution. Katalogbuch. München: Prestel.
Galántai, Jószef (1985), Der österreichisch ungarische Dualismus 1867 - 1918. Budapest/Wien:
Corvina/ ÖBV.
Gall, Lothar (1980), Bismarck. Der weiße Revolutionär. Frankfurt / M.: Propyläen.
Gärtner, Heinz (1979), Zwischen Moskau und Österreich. Geschichte einer sowjetabhängigen KP.
Wien: Braumüller.
Geertz, Clifford (1973), The Interpretation of Culture. Selected Essays. New York: Basic Books.
199
Gehler, Michael / Sickinger, Hubert (1995): Politische Affären und Skandale in Österreich. Von
Mayerling bis Waldheim, Thaur.
Gellner, Ernest (1983), Nations and Nationalism. London: Blackwell.
Gerlich, Rudolf (1981), Die gescheiterte Alternative. Wien: Braumüller.
Gies, Horst (1984), Landbevölkerung und Nationalsozialismus: Der Weg in den Reichsnährstand.
In: Zeitgeschichte 13 (Jännerheft).
Giesen, Bernhard (1993), Die Intellektuellen und die Nation. Eine deutsche Achsenzeit.
Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Glaise von Korstenau, Edmund (1980, 1983, 1988), Ein General im Zwielicht. Die Erinnerungen
Edmund Glaises von Horstenau. I: K. u. K. Generalstabsoffizier und Historiker. - II: Minister
im Ständestaat und General im OKW. - III: Deutscher Bevollmächtigter General in Kroatien
und Zeuge des Untergangs des 'Tausendjährigen Reiches'. - Eingeleitet und hg. von Peter
Broucek. Wien: Böhlau (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte
Österreichs, Bd. 67, 70, 76).
Glazer, Nathan / Moynihan, Daniel P. (1975), eds., Ethnicity. Theory and Experience. Cambridge,Mass.: Harvard University Press.
Goerlich, Joseph / Romanik, Felix (1977), Geschichte Österreichs. Innsbruck: Tyrolia.
Goldinger, Walter (1962), Geschichte der Republik Österreich. Wien: Verlag für Geschichte und
Politik.
Görlich, Ernst Joseph / Romanik, Felix (21977), Geschichte Österreichs. Innsbruck: Tyrolia.
Gramsci, Antonio (1975), Quaderni del carcere. Edizione critica del Istituto Gramsci. A cura di
Valentino Gerratana. Torino: Einaudi.
Greverus, Ina-Maria (1987), Kultur und Alltagswelt. Eine Einführung in Fagen der
Kulturanthropologie (= Notizen;...; Bd. 26). Frankfurt am Main.
Große Österreicher (1956 ff.).Neue österreichische Biographie ab 1815. Band X ff. Hg. von
Heinrich Studer u. a. Wien: Amalthea.
Gross, Nachum Th. (1973), Die Stellung der Habsburgermonarchie in der Weltwirtschaft. In:
Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter, Hg., Die Habsburgermonarchie 1848 - 1918. Band 1:
Die wirtschaftliche Entwicklung. Hg. von A. Brusatti. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1 - 28.
Grossendorfer, Enno (1979), Österreichs Außenhandel 1831 - 1978. In: Geschichte..., 627 - 648.
Gruber, Karl (1988), Meine Partei ist Österreich. Privates und Diplomatisches. Wien: Amalthea.
Grünzweig. Walter (1986), 'Niemals verging sein deutsches Herz.' Charles Sealsfield in der
Literaturkritik der NS-Zeit. In: ÖGL 30, 40 - 61.
Guglia, Otto (1961), Das Werden des Burgenlandes. Eisenstadt: Burgenländische
Landesregierung. (Burgenländische Forschungen 44).
Gutkas, Karl (1984), Geschichte Niederösterreichs. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
Haas, Hanns (1994), Österreich im 'gesamtdeutschen Schicksalszusammenhang'? In: Botz /
Sprengnagel 1994, 194 - 215.
Habsburg, Otto (1980), Europa Garant der Freiheit. Wien: Herold.
Haeckel, Ernst (1921 [1899]), Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische
Philosophie. Stuttgart: Kröner.
Hafner, Stefan (1976), Hg., Serbisches Mittelalter. Altserbische Herrscherbiographien. Bd. II:
Danilo II. und seine Schüler: Die Königsbiographien. Graz: Styria.
Hagspiel, Herrmann (1995), Die Ostmark. Österreich im Großdeutschen Reich 1938 bis 1945.
Wien: Braumüller.
200
Haider, Jörg (41994), Die Freiheit, die ich meine. Frankfurt/M. - Berlin: Ullstein.
Haller, Max (1996), Hg., Identität und Nationalstolz der Österreicher. Gesellschaftliche Ursachen
und Funktionen – Herausbildung und Vergleich seit 1945 – Internationaler Vergleich. Wien:
Böhlau.
Haller, Max (1997), Effizienter Staat – beschämte Nation, ineffizienter Staat – stolze Nation?
Befunde über nationale Identität und Nationalstolz der Deutschen und Italiener, 1981 bis 1990.
In: Annali di Sociologia / Soziologisches Jahrbuch 13305 – 366 (italienische Fassung: 345 –
384).
Hanisch, Ernst (1994), Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im
20. Jahrhundert. Österreichische Geschichte 1890 - 1990. Hg. von Herwig Wolfram. Wien:
Ueberreuter.
Hanisch, Ernst (1996), 'Selbsthaß' als Teil der österreichischen Identität. In: Zeitgeschichte 23, 136
- 145.
Hartmann, Ludo M. (1992 [1912], Die Nation als politischer Faktor. In: Filla, u. a., 1992, 135 151.
Haslinger, Josef (21995), Politik der Gefühle. Ein Essay über Österreich. Frankfurt/M.: Fischer.
Haugland, Kjell (1980), An Outline of Norwegian Cultural Nationalism in the Second Half of the
Nineteenth Century. In: Mitchison, Rosalind, ed., The Roots of Nationalism: Studies in
Northern Europe. Edinburgh.
Hechter, Michael (1975), Internal Colonialism. The Celtic Fringe in British National Development, 1536 - 1966: Berkeley: UCLA Press.
Heer, Friedrich (1962), Österreich ein Leben lang. Geschichtliches Essay. Wien-München:
Österreichischer Bundesverlag.
Heer, Friedrich (1981), Der Kampf um die österreichische Identität. Wien: Böhlau.
Heindl, Waltraud (1990), Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich 1780 bis
1848. Wien: Böhlau.
Heiß, Gernot / Mattl, Siegfried / Meissl, Sebastian / Saurer, Edith / Stuhlpfarrer, Karl (1989), Hg.,
Willfährige Wissenschaft. Die Universität Wien 1938 bis 1945. Wien: Verlag für
Gesellschaftskritik.
Helczmanovsky, Heimold (1973), Hg., Beiträge zur Bevölkerungs- und Sozialgeschichte
Österreichs. Nebst einem Überblick über die Entwicklung der Bevölkerungs- und
Sozialstatistik. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
Herder, Johann Gottfried (1982), Werke in fünf Bänden. Weimar: Aufbau-Verlag.
Herzog-Punzenberger, Barbara (1995), Ethnizität. Diskurse zwischen naivem Kosmopolitismus
und kommunitaristischer Wertschätzung. Beispiele aus Österreich. Wien: Manus Diplomarbeit.
Hexelschneider, Erhard / John, Erhard (1984), Kultur als einigendes Band? Eine
Auseinandersetzung mit der These von der 'einheitlichen deutschen Kulturnation'. Berlin: Dietz
Verlag.
Höbelt, Lothar (1993), Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien
Altösterreichs 1882 - 1918. Wien-München: Verlag für Geschichte und Politik-Oldenbourg.
Hobsbawm, Eric J. (1990), Nations and Nationalism since 1780. Programme, myth, reality.
Cambridge: University Press.
Hoesch, Edgar / Seewann, Gerhard (1991), Hg., Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse des
Forschungsprojektes "Deutsche und Magyaren als nationale Minderheiten im Donauraum".
München: Oldenbourg, 1991.
201
Holl, Brigitte (1976), Hofkammerpräsident Gundacker Thomas Graf Starhemberg und die
österreichische Finanzpolitik der Barockzeit (1703 - 1715). Archiv für österreichische
Geschichte, Band 132. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Höll, Othmar (1983) ed., Small States in Europe and Dependence. Wien: Braumüller.
Holzer, Gabriele (1995), Verfreundete Nachbarn. Österreich - Deutschland. Ein Verhältnis. Wien:
Kremayr & Scheriau.
Holzinger, Wolfgang (1994), Projektleiter, Ethnische Identitätsbildung in der slowenischen
Minderheit Kärntens. Projektbericht and den FWF. Mitarbeiter: Stefka Vavti, Wolfgang
Pöllauer und Helmut Guggenberger. Klagenfurt: Manus.
Hörnigk, Philipp Wilhelm von (1983), Österreich über alles, wann es nur will. Reprint. Wien:
Brandstätter.
Horvath, Traude und Eva Müllner (Hg.) (1992): Hart an der Grenze: Burgenland und Westungarn.
Verlag für Gesellschaftskritik. Wien.
Hugelmann, Gottfried (1934), Hg., Das Nationalitätenrecht des alten Österreich. Wien: Braumüller.
Hume, David (1985), Essays; moral, political, and literary. Ed. by E. F. Miller. Indianopolis:
Liberty Classics.
Hurdes, Felix (1946), Österreich als Realität und Idee. Wien: Österreichischer Verlag.
Husserl, Edmund (1984), Die Konstitution der geistigen Welt, Hamburg: Meiner.
Hutchinson, Sharon E. (1996), Nuer Dilemmas. Coping with Money, War, and the State. Berkeley:
University of Cal. Press.
IKUS-Lectures 3 (1994), EU – Ja oder Nein. Ein staatspolitisches Streitgespräch zum EU-Beitritt.
Moderiert von Traudl Brandstaller. Wien: IKUS.
Inglehart, Ronald (1989), Kultureller Umbruch. Wertwandel in der westlichen Welt. Frankfurt/M.:
Campus.
Inzko, Valentin (1988), Hg., Geschichte der Kärntner Slowenen von 1918 bis zur Gegenwart unter
besonderer
Berücksichtigung
der
gesamtslowenischen
Geschichte.
Klagenfurt:
Hermagoras/Mohorjeva.
Jagschitz, Gerhard (1982), Österreichplanung während des Zweiten Weltkrieges und die Wiederherstellung der Demokratie 1945. In: Rettinger, Leopold, u. a., Hg., Zeitgeschichte. Wien:
Österreichischer Bundesverlag, 287 - 310.
Jagschitz, Gerhard (1994), EG und Demokratie. In: Witzany, Günther, Hg., Verraten und
Verkauft. Das EG-Lesebuch. Salzburg: Unipress Verlag, 69 - 91.
Jarnut, Jörg (1996), Teotischis homines (a. 816). Studien und Reflexionen über den ältesten
(urkundlichen) Beleg des Begriffes ‘theodiscus’. In: MIÖG 104, 26 - 40.
Jaszi, Oskar (1929), The Dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago: The Univ. of Chicago
Press (Studies in the Making of Citizens).
Jedlicka, Ludwig (1971), Die Anfänge des Rechtsradikalismus in Österreich (1919 - 1925). In:
Wissenschaft und Weltbild 24, 96 - 110.
Jedlicka, Ludwig (1972), Aufteilungs- und Einmarschprobleme um Österreich, 1918 - 1934. In:
Sacerdos et pastor semper ubique. Festschrift Franz Loidl, 1. Band. Wien: Dom Verlag, 96 112.
Jedlicka, Ludwig (1975), Gauleiter Josef Leopold (1889 - 1941). In: Geschichte und Gesellschaft.
Festschrift für Karl R. Stadler. Wien: Europa Verlag, 143 – 161.
Jerussalimski, Arkadi (1983), Bismarck. Diplomatie und Militarismus. Berlin (Ost): Dietz.
202
Johler, Reinhard (1995a), Das Ethnische als Forschungskonzept: Die österreichische Volkskunde
im europäischen Vergleich. In: Beitl, Klaus / Bockhorn, Olaf, Hg., Ethnologia Europaea. 5.
Internationaler Kongreß der SIEF. Plenarvorträge. Wien: Veröffentlichungen des Instituts für
Volkskunde 16/II, 69 – 102.
Johler, Reinhard (1995b), Nachwort. In: Cole, John W. / Wolf, Eric R. (1995), Die unsichtbare
Grenze. Ethnizität und Ökologie in einem Alpental. Bozen-Wien: Folio. (Transfer Kulturgeschichte Bd. III, hg. von Hans Heiss und Reinhard Johler).
Johnston,William M. (1983), The Austrian Mind. An Intellectual and Social History 1848 - 1938.
Berkeley: Univ. of Cal. Press.
Jones, David Martin / Smith, Michael L. R. (1999), Advance Australia – Anywhere. In: Orbis, 443
ff.
Judson, Pieter M. (2007), Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers of
Imperial Austria. Cambridge: Harvard University Press 2006. xvii + 313 pp.
Jung, Carl Gustav (1975 [1935]), Über Grundlagen der analytischen Psychologie. Die Tavistock
Lectures 1935. Frankfurt/M.: Fischer.
Kaindl, Raimund Friedrich (1927): Der Völkerkampf und Sprachenstreit in Böhmen. Wien:
Braumüller.
Kann, Robert A. (1964), Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie. Geschichte und
Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des Reiches im
Jahr 1918. 2 Bde. Graz-Köln: Böhlau.
Kann, Robert A. (1977), Die Prochaska-Affäre vom Herbst 1912. Zwischen kaltem und heißem
Krieg. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Kann, Robert A. / Prinz, Friedrich E. (1980), Hg., Deutschland und Österreich. Ein bilaterales
Geschichtsbuch. Wien: Jugend & Volk.
Karner, Stefan (1988), Graz 1938. In: Brünner, Christian / Konrad, Helmut, Hg., Die Universität
und 1938. Wien: Böhlau.
Karner, Stefan (1985), Hg., Das Burgenland im Jahre 1945. Beiträge zur LandesSonderausstellung 1985. Eisenstadt: Burgenländische Landesregierung.
Katzenschläger, Markus (1996), Wer hat Angst vor der NATO? In: Zukunft, Heft 9, 16 - 18.
Katzenstein, Peter J. (1976a), Disjoined Partners. Austria and Germany since 1815. Berkeley:
University Press.
Katzenstein, Peter J. (1976b), Das österreichische Nationalbewußtsein. In: Journal für Sozialforschung Heft 3, 2 – 14.
Kausel, Anton (1979), Österreichs Volkseinkommen 1830 - 1913. Versuch einer Rückrechnung
des realen Brutto-Inlandsproduktes für die österreichische Reichshälfte und das Gebiet der
Republik Österreich. In: Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in
Österreich 1829 - 1979. Wien: ÖStZ, 689 – 710 (Beiträge zur österreichischen Statistik 550).
Kausel, Anton (1985), 150 Jahre Wirtschaftswachstum in Österreich und der westlichen Welt im
Spiegel der Statistik. Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei.
Kausel, Anton (1968), Österreichs Wirtschaft 1918 – 1968. Wien: Verlag für Geschichte und
Politik.
Kausel, Anton / Nemeth, Nandor / Seidel, Hans (1965), Österreichs Volkseinkommen 1913 – 1963.
Wien: WIFO.
Kellenbenz, Hermann (1966), Probleme der Merkantilismusforschung. In: Mikoletzky, Hg.,
Congres, a. a. O., 171 - 190.
Kelsen, Hans (1922), Hg., Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920. Wien-Leipzig: Deuticke.
203
Kelsen, Hans (1923), Österreichisches Staatsrecht. Ein Grundriß, entwicklungsgeschichtlich
dargestellt. Tübingen: Mohr.
Kelsen, Hans (1967) Demokratie und Sozialismus. Ausgewählte Aufsätze. Hg. von Norbert Leser.
Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung.
Kempf, Wilhelm (1994/2), Zerstörung von Bezugssystemen als Nährboden für
Ausländerfeindlichkeit. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik 19, 3 - 21.
Kerekes, Lajos (1978), Von Saint Germain nach Genf. Österreich und seine Nachbarn 1918 - 1922.
Wien: Böhlau.
Keyserlingk, Robert H. (1982), Austrian Restoration and Nationalism: A British Dilemma during
World War II. In: CRSN IX, 279 - 296.
Khol, Andreas (1988), Mitteleuropa - Gefahr eines politischen Begriffes. In: Khol,
Andreas/Stirnemann, Alfred, Hg., Österreichisches Jahrbuch für Politik 1987. Wien: Verlag für
Geschichte und Politik.
Kienzl, Heinz (1996) Lebens- und andere Lügen. Oder ein Streit der Fakultäten? In: Europäische
Rundschau 24 (Heft 3), 115 - 119.
Kindleberger, Charles P. (1996), World Economic Primacy: !500 to 1990. New York - Oxford:
Oxford University Press.
Klar, Alfred (1978 [1937]), Die Österreicher - eine Nation. - Gegen die These 'Österreich als
zweiter deutscher Staat'. - Der Marxismus und das Wesen der Nation. - Gegen die
'gesamtdeutsch' Geschichtsfälschung. In: Die KPÖ im Kampf für Unabhängigkeit, Demokratie
und sozialistische Perspektive. Sammelband. Wien: Globus, 42 - 66.
Klaus, Josef (1985), Führung und Auftrag. Ausgewählte Reden und Aufsätze. Hg. von Wendelin
Ettmayer und Eugen Thurnher. Graz: Styria.
Klein, Kurt (1980), Daten zur Siedlungsgeschichte der österreichischen Länder bis zum 16.
Jahrhundert. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
Klemperer, Klemens von (1976), Ignaz Seipel. Staatsmann einer Krisenzeit. Graz: Styria.
Klima, Arnold (1983), Österreich 1848 und ein einheitliches Deutschland aus böhmischer Sicht.
In: Österreichische Osthefte 25, 399 - 411.
Klöckler, Jürgen (1995), Föderalistische Neugliederungskonzepte nach 1945: Vorarlberg als Teil
der 'Donau-Alpen-Konföderation' oder 'Alemanniens'? In: Montfort. Vierteljahresschrift für
Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs 47, 249 - 281.
Klueting, Harm (1992), Hg., Nation – Nationalismus – Postnation. Beiträge zur Identitätsfindung
der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert. Köln-Weimar- Wien: Böhlau.
Kluge, Ulrich (1978), Agrarpolitik und Agrarkrise 1918 - 1933. Möglichkeiten und Grenzen
agrarhistorischer Forschung in Österreich und Deutschland. In: Botz, Gerhard, u. a., Hg.,
Bewegung und Klasse. Studien zur österreichischen Arbeitergeschichte. Wien: Europa Verlag,
629 - 646.
Kluge, Ulrich (1996), Österreich zwischen Revolution und 'Anschluß' (1918 - 1938). In: neue
politische literatur XLI, 43 - 60.
Kohn, Hans (1962), Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur Französischen
Revolution. Frankfurt/M.: Fischer.
Komlos, John (1986), Die Habsburgermonarchie als Zollunion. Die Wirtschaftsentwicklung
Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert. Wien: Bundesverlag.
Kondratieff, N. D. (1926), Die langen Wellen der Konjunktur. In: Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik, Band LVI, 573 - 609.
Konrad, Helmut (1977), Nationale Frage und Arbeiterbewegung in Österreich um die
Jahrhundertwende. In: ÖZP 6, 190 - 204.
204
Konrad, Helmut (1988), Hg., Sozialdemokratie und 'Anschluß'. Historische Wurzeln - Anschluß
1918 und 1938 - Nachwirkungen. Wien: Europa Verlag.
Körner, Theodor (1977), Auf Vorposten. Ausgewählte Schriften 1928 - 1938. Hg. und
kommentiert von Ilona Duczynska. Wien: Europa Verlag.
Kosing, Alfred (1976), Nation in Geschichte und Gegenwart. Studien zur historischmaterialistischen Theorie der Nation. Berlin: Akademie.
Kracher, Rudolf (980) Die Entwicklung der Landwirtschaft in Illmitz und die Auswirkungen auf
die soziale und politische Struktur der Gemeinde (1945 - 1980). Wien: Manus Diss.
Kratschmar, Andreas (1996), Hohes Interesse, geringe Zufriedenheit. In: Österreichische
Monatshefte (Heft 4), 4 - 8.
Kreile, Michael (1992), Hg., Die Integration Europas. Opladen: Westdeutscher Verag (PVSSonderheft 23).
Kreissler, Felix (1980), La prise de conscience de la nation Autrichienne. Paris: PUF.
Kreissler, Felix (1996), Kultur als subversiver Widerstand. Ein Essay zur österreichischen
Identität. Wien: Kappa.
Kreisky, Bruno (1986), Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten. Berlin: Severin
und Siedler.
Kreisky, Bruno (1988), Im Strom der Politik. Der Memoiren zweiter Teil. Wien: Kremayr und
Scheriau.
Kreisky, Bruno (1996), Der Mensch im Mittelpunkt. Der Memoiren dritter Teil. Hg. von Oliver
Rathkolb, Johannes Kunz und Margot Schmidt. Wien: Kremayr und Scheriau.
Kriechbaumer, Robert (1981), Österreichs Innenpolitik 1970 - 1975. Wien/München: Verlag für
Geschichte und Politik/Oldenbourg.
Kriechbaumer, Robert / Schausberger, Franz (1995), Hg., Volkspartei - Anspruch und Realität.
Die Geschichte der ÖVP seit 1945. Wien: Böhlau.
Krims, Adalbert (1996), Wozu Neutralität? In: Zukunft, heft 8, 20 - 23.
Kudlich, Hans (1873), Rückblicke und Erinnerungen. 3 Bde. Wien-Pest-Leipzig: Hartleben.
Kuhn, Elmar L. (1993), Der Bodenseeraum - Historiker-Mythos und Festredentraum? In:
Bodensee-Hefte 1-2
Kühnl, Reinhard (1969), Formen bürgerlicher Herrschaft. Nationalismus, Faschismus. Hamburg:
Rowohlt.
Kürnberger, Ferdinand (1960), Spiegelungen. Eingeleitet und ausgewählt von Rudolf Holzer.
Graz: Stiasny.
Lawrence, Philip K. (1996), Strategy, Hegemony and Ideology: The Role of Intellectuals. In:
Political Studies XLIV, 44 – 59.
Lechner, Karl (1976), Die Babenberger. Markgrafen und Herzöge von Österreich 976 – 1246.
Wien: Böhlau. 480 S.
Leidwein, Alois (1996), Europa braucht einen Präsidenten. In: Öst. Monatshefte 1 - 2 , 15 - 16.
Leiris, Michel (1979), Die eigene und die fremde Kultur. Ethnologische Schriften. Aus dem
Französischen von Rolf Wintermeyer. Hg. von H.-J. Heinrichs. Frankfurt/M.: Syndikat.
Leisching, Peter (1985), Die römisch-katholische Kirche in Cisleithanien. In: Wandruszka /
Urbanitsch IV, 1 - 247.
Lemberg, Eugen (1964), Nationalismus. 2 Bde. Reinbeck: Rowohlt.
Leser, Norbert / Wagner, Manfred (1994), Hg., Österreichs politische Symbole. Wien: Böhau.
205
List, Friedrich (o. J. [1833]), Über ein sächsisches Eisenbahn-System als Grundlage eines
allgemeinen deutschen Eisenbahn-Systems. Hg. und eingeleitet von L. O. Brandt. Leipzig:
Reclam.
List, Friedrich (1982), Das nationale System der politischen Ökonomie. Hg. von Günter Fabiunke.
Berlin: Akademie Verlag.
Löffler, Sigried (1996), Überdrüssig - überflüssig. Ein Disput und ein Millennium. In: Europäische
Rundschau 24 (Heft 3), 111 - 114.
Low, Alfred D. (1975), Die Anschlußbewegung in Österreich und Deutschland, 1918 - 1919, und
die Pariser Friedenskonferenz. Wien: Braumüller.
Low, Alfred D. (1995), Otto Bauer, Socialist Theorician of Nationalism, and His Critics. In: CRSN
XXII, 103 - 110.
Luza, Radomir (1977), Österreich und die großdeutsche Idee in der NS-Zeit. Wien: Böhlau.
Luxemburg, Rosa (1923), Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen
Erklärung des Imperialismus. Berlin: Vereinigung internationaler Verlagsanstalten.
Mac Laughlin, Jim (1993), Place, Politics and Culture in Nation-Building Ulster: Constructing
Nationalist Hegemony in Post-Famine Donegal. In: CRSN XX, 97 – 111.
Mahan, Alfred Thayer (1967 [1890]), Der Einfluß der Seemacht auf die Geschichte. Überarbeitet
und hg. von G.-A. Wolter. Herford: Koehler.
Maier, Robert (2002), Hg., Die Präsenz des Nationalen im (ost) mitteleuropäischen
Geschichtsdiskurs. Hannover: Hahn’sche Buchhandlung (Studien zur internationalen
Schulbuchforschung).
Maleta, Alfred (1968), Entscheidung für morgen. Christliche Demokratie im Herzen Europas.
Wien: Molden.
Marko, Joseph (1995), Autonomie und Integration. Rechtsinstitute des Nationalitätenrechts im
funktionalen Vergleich. Wien: Böhlau.
Marx, Karl (1953), Nationalökonomie und Philosophie. In: ders., Frühschriften. Hg. von S.
Landshut. Stuttgart: Kröner (bzw. MEW, Ergänzungsband 1, 462 - 588).
Marx, Karl / Engels, Friedrich (1978 ff.), Werke. 42 Bände. Berlin (Ost): Dietz Verlag.
März, Eduard (1981), Österreichische Bankpolitik in der Zeit der großen Wende 1913 - 1923. Am
Beispiel der Creditanstalt für Handel und Gewerbe. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
Masaryk, Tomás Garrigue (1991 [1929]), Der neue Europa. Der slawische Standpunkt. Berlin:
Volk und Welt.
Massiczeck, Albert (1967), Hg., Die österreichische Nation. Zwischen zwei Nationalismen. Wien:
Europa Verlag.
Matzner, Egon (1996), Kritische Geschichtsforschung ist berechtigt. Zu Gerhard Botz'
Selbstverteidigung. In: Europäische Rundschau 24 (Heft 2), 115 - 119.
Matz, Wolfgang (1995), Adalbert Stifter oder Diese fürchterliche Wendung der Dinge. München:
Hanser.
Mayer, F. M. / Kaindl, R. F. / Pirchegger, H. / Klein, A. A., (1965), Geschichte und Kulturleben
Österreichs von 1797 bis zum Staatsvertrag 1955. Wien-Stuttgart: Braumüller.
Meadwell, Hudson (1989), Cultural and Instrumental Approaches to Ethnic Nationalism. In:
Ethnic and Racial Studies 12, 309 - 328.
Meinecke, Friedrich (1908), Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Geschichte des
deutschen Nationalstaates. Berlin-München: Oldenburg.
Meinecke, Friedrich (1929), Die Idee der Staatsraison in der neueren Geschichte. München:
Oldenburg.
206
Menasse, Robert (1992), Das Land ohne Eigenschaften. Essay zur österreichischen Identität.
Wien: Sonderzahl.
Menzel, Ulrich (1988), Auswege aus der Abhängigkeit. Die entwicklungspolitische Aktualität
Europas. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Michaelis, Hans-Thorald (1996), Das III. Deutsche Bundesschießen 1868 in Wien als politischhistorisches Phänomen.In: MIÖG 104, 58 - 95
Mikoletzky, Hans Leo (1966a), Die Anfänge der Industrie und der Staatsfinanzen Österreichs im
16. Jahrhundert. In: Mikoletzky, Hans Leo, Hg., XIIe Congres international des sciences
historiques - Rapports. IV: Methodologie et histoire contemporaine. Horn/Wien: F. Berger, o.J.,
191 - 200.
Mikoletzky, Hans Leo (1966b), Österreichische Zeitgeschichte. Wien: Bundesverlag.
Miller, Edward (1983), Wirtschaftspolitik und öffentliche Finanzen 1000 - 1500. In: Cipolla,
Carlo M., Hg., Europäische Wirtschaftsgeschichte. Band 1: Mittelalter. Stuttgart: G. Fischer,
219 - 240.
Mock, Alois (1984), Außenpolitik aus der Sicht der Oppositionsparteien. In: Club NÖ 3/1984, 21 26.
Mock, Alois (1994), Heimat Europa. Der Countdown von Wien nach Brüssel. Redigiert von
Herbert Vytiska. Wien: Österreichische Staatsdruckerei.
Molden, Fritz (1980), Besetzer, Toren, Biedermänner. Ein Bericht aus Österreich 1945 bis 1962.
Molisch, Paul (1926), Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Österreich von ihren
Anfängen bis zum Zerfall der Monarchie. Mit einem Beitrage: Das Wesen der deutschnationalen Bewegung. Von Prof. Dr. Kurt Knoll. Jena: Gustav Fischer.
Moos, Ludwig (1967), Bildungsbürgertum, Nationalbewußtsein und demokratisches Zeitalter.
Studium zum Werk Heinrich Ritters von Srbik. Freiburg i. B.: Diss. phil. (Manus).
Mooslechner, Michael / Stadler, Robert (1986), Die nationalsozialistische 'Entschuldung' der
Landwirtschaft. Eine Analyse der Hofakten der Gemeinde St. Johann im Pomgau 1938 - 1945.
In: Zeitgeschichte 14 (Heft 2(, 55 - 67.
Moritsch, Andreas (1993), Hg., Die slawische Idee. Bratislava: Slovak Academic Press.
Moritsch, Andreas (1996), Hg., Der Austroslawismus. Ein verfrühtes Konzept zur politischen
Neugestaltung Mitteleuropas. Wien: Böhlau.
Muchitsch, Max (1966), Die Partisanengruppe Leoben-Donawitz. Wien: Europa Verlag.
Mühlmann, Wilhelm E. (1964), Rassen, Ethnien, Kulturen. Moderne Ethnologie. Neuwied:
Luchterhand.
Muhr, Rudolf (1995), Grammatische und pragmatische Merkmale des österreichischen Deutsch.
In: Muhr, Rudolf / Schrott, R. / Wiesinger, Peter, Hg., Österreichisches Deutsch. Linguistische,
sozialpsychologische und sprachpolitische Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen.
Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 208 - 234.
Muhr, Rudolf (1996a), Österreichisches Deutsch und interkulturelle Kommunikation im Kontext
des Faches Deutsch als Fremdsprache. In: ÖDaF Mitteilungen 1: Deutsch als plurizentrische
Sprache, 31 - 44.
Muhr, Rudolf (1996b), Österreichisches deutsch - nationalismus? Einige argumente wider den
zeitgeist - Eine klarstellung. In: tribüne. zeitschrift für sprache und schreibung, heft 1, 12 - 18.
Müller, Karl (1997), Karl Heinrich Waggerl. Eine Biographie mit Bildern, Texten und
Dokumenten. Salzburg: Otto Müller Verlag.
Naumann, Friedrich (1915), Mitteleuropa. Berlin: Reimer.
Neisser, Heinrich (1993), Das politische System der EG. Wien: Holzhausen.
207
Nemschak, Franz (1955), Zehn Jahre österreichische Wirtschaft. 1945 - 1955. Wien: WIFO.
Nenning, Günther (1988), Grenzenlos deutsch. Österreichs Heimkehr ins falsche Reich. München:
Knesebeck und Schuler.
Nenning, Günther (1990), Die Nation kommt wieder. Würde, Schrecken und Geltung eines
europäischen Begriffes. Zürich: Interfrom.
Nössing, Josef / Noflatscher, Heinz (1986), Bearbeiter, Geschichte Tirols. Zur Ausstellung auf
Schloss Tirol. Bozen: Autonome Provinz.
Niederstätter, Alois (1996), Das Jahrhundert der Mitte. An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit.
Österreichische Geschichte 1400 - 1522. Hg. von Herwig Wolfram. Wien: Ueberreuter.
Oberkofler, Gerhard (1975), Einige Dokumente über die Funktion der Beamtenschaft beim
Aufbau des Austrofaschismus. In: Zeitgeschichte 2, 216 - 239.
Offermann, Alfred Freiherr von (1900), Die Bedingungen des Constitutionellen Österreichs. Wien:
Braumüller.
Ogris, Werner (1975) Die Rechtsentwicklung in Cisleithanien 1848 - 1918. In: Wandruszka, Adam
/ Urbanitsch, Peter, Hg., Die Habsburgermonarchie 1948 - 1918. Band II: Verwaltung und
Rechtswesen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 538 - 662.
Olah, Franz (1995), Die Erinnerungen mit 110 Abbildungen und Dokumenten. Wien: Amalthea.
Österreichische National-Encyklopädie, oder alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten
Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes.... 6 Bände. [Hg. von J. J. H. Czikann
und F. Gräffer.] Wien: Eigenverlag, in Commission bei Beck'sche Universitätsbuchhandlung,
1835 – 1837.
Panzenböck, Ernst (1985), Ein deutscher Traum. Die Anschlußidee und Anschlußpolitik bei Karl
Renner und Otto Bauer. Wien: Europa Verlag.
Panzenböck, Ernst (1986), Die Weichenstellung in der österreichischen Sozialdemokratie für die
Republik und den Anschlußgedanken. In: ÖGL 30, 6 - 17.
Pape, Matthias (1998), Die völkerrechtlichen und historischen Argumente bei der Abgrenzung
Österreichs von Deutschland nach 1945. In: Der Staat37, 287 - 313.
Pape, Matthias (1997), Mozart – Deutscher? Österreicher? oder Europäer?. Das Mozart-Bild in
seinen Wandlungen vor und nach 1945. In: Acta Mozartiana 44, 53 - 84.
Pape, Matthias (2000), Ungleiche Brüder. Österreich und Deutschland 1945 – 65. Wien: Böhlau.
Pauley, Bruce F. (1972), Hahnenschwanz und Kakenkreuz. Der steirische Heimatschutz und der
österreichische Nationalsozialismus 1918 - 1943. Wien: Europa Verlag.
Pauley, Bruce F. (1981), Hitler and the Forgotten Nazis. A History of Austrian National Socialism.
Chapel Hill: The Mac Millan Press.
Pelinka, Anton (1988), Karl Renner. "Zur Einführung". Hamburg: Junius.
Pelinka, Anton (1990), Zur österreichischen Identität. Zwischen deutscher Vereinigung und
Mitteleuropa. Wien: Ueberreuter.
Pelinka, Anton (1994a), Gefährdet ein EU-Beitritt die Identität Österreichs? In:
Wirtschaftspolitische Blätter 2/1994, 146 - 151.
Pelinka, Anton (1994b), Europäische Integration und politische Kultur. In: Pelinka, Anton /
Schaller, Christian / Luif, Paul, Hg., Ausweg EG? Innenpolitische Motive einer
außenpolitischen Umorientierung. Wien: Böhlau, 11 - 26.
Pernthaler, Peter (1991), Hg., Außenpolitik der Gliedstaaten und Regionen. Wien: Braumüller
(Schriftenreihe des Instituts für Föderalismusforschung 50).
208
Petschar, Hans / Schmid, Georg (1990), Erinnerung & Vision. Die Legitimation Österreichs in
Bildern. Eine semiohistorische Analyse der Austria Wochenschau 1949 - 1960. Mit einem
Beitrag von Herbert Hayduck. Graz: ADEVA.
Petty, William (1986), Schriften zur Nationalökonomie und Statistik (Eine Abhandlung über
Steuern und Abgaben, 1662). Hg. von W. Görlich. Berlin: Akademie Verlag.
Pevetz, Werner (1973), Agrarsozialer Wandel im Burgenland: eine statistische Studie. Wien:
Institut für Agrarwirtschaft.
Philippovich, Eugen von (1915), Ein Wirtschafts- und Zollverband - zwischen Deutschland und
Österreich-Ungarn. Leipzig: S. Hirzel.
Pichler, Ernst (1997), Karl Heinrich Waggerl. Eine Biographie. Innsbruck: Haymon Verlag.
Pichler, M. / Dreier, W. (1989), Vergebliches Werben. Mißlungene Vorarlberger
Anschlußversuche an die Schweiz und an Schwaben (1918 - 1020). Bregenz:.
Piuk, Claudia (1991), Das Vorarlberger Landesbewußtsein. Entstehung und Entwicklung anhand
der Beispiele der Vorarlberger Anschlußbewegung an die Schweiz 1918 - 1920. Wien.
Plaschka, Richard G. / Haselsteiner, Horst / Suppan, Arnold / Drabek, Anna / Zaar, Birgitta
(1995), Hg., Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wien:
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Zentraleuropa-Studien, Bd. 1).
Plaschka, Richard G. / Stourzh, Gerald / Niederkorn, Jan Paul (1995), Was heißt Österreich?
Inhalt und Umfang des Österreich-Begriffs vom 10. Jahrhundert bis heute. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Archiv für österreichische Geschichte 136).
Plasser, Fritz / Ulram, Peter A. (1996), Einstellung der Österreicher zum Europäischen Parlament
im Vorfeld der Europa-Wahl 1996 im EU-Vergleich. Wien: Signum.
Pleterski, Janko / Druskovic, Drago (1983) Der ungleiche Grenzstreit. Zwei Essays. Klagenfurt:
Drava.
Polanyi, Karl (1/1977), The Economistic Fallacy. In: In: Review I, 9 - 18.
Raeff, Marc (1993), The People, the Intelligentsia and Russian Political Culture. In: Political
Studies XLI, 93 - 106.
Ramhardter, Günther (1973), Geschichtswissenschaft und Patriotismus. Österreichs Historiker im
Weltkrieg 1914 - 1918. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
Raphaël, Freddy (1995), Identität - ein tödlicher Mythos? / L'identité, un mythe meutrier. In: Beitl,
Klaus / Bockhorn, Olaf (Hg.), Ethnologia Europaea. 5. Internationaler Kongreß der Société
International d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), 12. - 16. 9. 1994. Wien: Institut für
Volkskunde, 31 - 68.
Rathkolb, Oliver (1996), Berufsverbot für Zeithistoriker? In: Europäische Rundschau 24 (Heft 2),
122 - 130.
Reich, Wilhelm (1975), Charakteranalyse. Frankfurt/M.: Fischer.
Reiterer, Albert F. (1984), Von der Schwierigkeit mit der eigenen Identität. Zur politischen
Situation deutschnationaler Österreicher im 19. Jahrhundert. - Eine Fallstudie an drei
politischen Zeitschriften. In: ÖGL 28, 345 - 362.
Reiterer, Albert F. (1986a), Vom Scheitern eines politischen Entwurfes. Der 'österreichische
Mensch' - ein konservatives Nationalprojekt der Zwischenkriegszeit. In: ÖGL 30, 19 - 36.
Reiterer, Albert F. (1986b), Österreichbewußtsein, österreichische Nation und nachnationale
Gesellschaft in Österreich. In: Mladje 61, 68 - 88.
Reiterer, Albert F. (1987), Die konservative Chance. Österreichbewußtsein im konservativen Lager nach 1945. In: Zeitgeschichte 14, 379 - 397.
209
Reiterer, Albert F. (1988a), Die unvermeidbare Nation. Ethnizität, Nation und nachnationale
Gesellschaft. Frankfurt/M.: Campus.
Reiterer, Albert F. (1988b), Hg., Nation und Nationalbewußtsein in Österreich. Ergebnisse einer
empirischen Untersuchung. Wien: VWGÖ.
Reiterer, Albert F. (1988c), Periphere Identität. In: Bauböck, Rainer/Baumgartner,
Gerhard/Perchinig, Bernhard/Pinter, Karin, Hg., ... und raus bist Du! Ethnische Minderheiten
in der Politik. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 168 - 176.
Reiterer, Albert F. (1991), Lokale Politik und Ethnische Identität: Minderheiten im
Modernisierungsprozeß. In: ÖZP 20. Jg. (Heft 4), 383 - 399.
Reiterer, Albert F. (1993), Minorities in Austria. In: Patterns of Prejudice 27, 49 - 62.
Reiterer, Albert F. (1993), Österreichische Identität - deutsche Kultur - europäische Integration?
In: Novotny, Helga / Taschwer, Klaus, Hg., Macht und Ohnmacht im neuen Europa. Zur
Aktualität der Soziologie von Norbert Elias. Wien: Wiener Universitätsverlag, 107 - 122.
Renan, Ernest (1992 [1882]), Qu'est-ce qu'une nation? et autres essais politiques. Textes choisis et
présentés par Joël Roman. Paris: Presses Pocket.
Renner, Karl ("Springer Rudolf") (1902), Der Kampf der Österreichischen Nationen um den Staat.
Erster Theil: Das nationale Problem als Verfassungs- und Verwaltungsfrage. Leipzig/Wien:
Deuticke.
Renner, Karl ("Springer Rudolf") (1906), Grundlagen und Entwicklungsziele der ÖsterreichischUngarischen Monarchie. Politische Studie über den Zusammenbruch der Privilegienparlamente
und die Wahlreform in beiden Staaten, über die Reichsidee und ihre Zukunft. Wien-Leipzig:
Deuticke.
Renner, Karl (1946a), An der Wende zweier Zeiten. Lebenserinnerungen. Wien: Danubia Verlag.
Renner, Karl (1946b), Denkschrift über die Geschichte der Unabhängigkeitserklärung Österreichs
und Bericht über drei Monate Aufbauarbeit. Zürich: Europa Verlag.
Renner, Karl (1970), Porträt einer Evolution. Hg. von H. Fischer. Wien: Europa Verlag.
Reschauer, Heinrich / Szmets, Moritz (1872) Das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. 2
Bde. Wien: Waldheim.
Research Working Group (1979), Cyclical Rhythms and Secular Trends of the Capitalist World
Economy: Some Premises, Hypotheses, and Questions. In: Review II, 483 - 500.
Reventlow, Rolf (1969), Zwischen Allierten und Bolschewiken. Arbeiterräte in Österreich 1918 bis
1923. Wien: Europa Verlag.
Ringel, Erwin (1984), Die österreichische Seele. Zehn Reden über Medizin, Politik, Kunst und
Religion. Wien: Böhlau.
Ringel, Erwin (1993), Hg., 'Ich bitt Euch höflich, seid's keine Trottel!' Politikverdrossenheit und
österreichische Identität. Wien: Donau Verlag.
Roseger, Peter (1912 ff.) Gesammelte Werke. 40 Bände. München: Staakmann.
Rossiter, Clinton (1961), ed., The Federalist Papers. Alexander Hamilton, James Madison, John
Jay. New York: Penguin/Mentor.
Rostow, Walter W. (1960), The Process of Economic Growth. Oxford: Clarendon Press.
Rostow, Walter W. (1973), ed., The Economics of Take-Off into Sustained Growth. London:
Macmillan.
Rostow, Walter W. (1976), Die Stadien des wirtschaftlichen Wachstums. Eine Alternative zur
marxistischen Entwicklungstheorie. Göttingen:.
210
Roth, Gerhard (1995), Das doppelköpfige Österreich. Essays, Polemiken, Interviews. Hg. von K.
Pfoser-Schewig. Mit einem Vorwort von Josef Haslinger und Kommentaren von Gerfried
Sperl. Frankfurt/M.: Fischer.
Rotter, Manfred (1991), Von der integralen zur differentiellen Neutralität. Eine diskrete
Metamorphose im Schatten des zweiten Golfkriegs. In: Europäische Rundschau 19, Heft 4, 23 35.
Rudolph, Wolfgang (1989), Volkskundegegenstände als Indikatoren des Kulturwandels bei
ethnischen Minderheiten im südlichen Ostseegebiet. In: Jahrbuch für Volkskunde und
Kulturgeschichte 32, 11 - 20.
Sandgruber, Roman (1995), Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom
Mittelalter bis zur Gegenwart (Österreichische Geschichte, hg. v. H. Wolfram). Wien:
Ueberreuter.
Schärf, Adolf (1955), Österreichs Erneuerung 1945 - 1955. Das erste Jahrzehnt der Zweiten
Republik. Wien: Verlag der Volksbuchhandlung.
Schausberger, Norbert (1978), Der Griff nach Österreich. Der Anschluß. Wien: Jugend und Volk.
Schildt, Joachim (1976), Abriß der Geschichte der deutschen Sprache. Zum Verhältnis von
Gesellschafts- und Sprachgeschichte. Berlin (Ost): Akademie Verlag.
Schissler, Hanna (1982), Preußische Finanzpolitik nach 1807. Die Bedeutung der
Staatsverschuldung als Faktor der Modernisierung des preußischen Finanzsystems. In:
Geschichte und Gesellschaft 8, 367 - 385.
Schmitt, Carl (1985 [1926]), Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus.
Berlin: Duncker und Humblot.
Schmölders, Günther (1967), Konjunkturen und Krisen. Hamburg: Rowohlt.
Schnee, Heinrich (1962), Bismark und der Nationalismus in Österreich. In: Historisches Jahrbuch
81, 123 - 151.
Schönafinger, Bärbel (1995), Naziphilosophie in Graz. In: Geschichte und Gegenwart 14, 161 177.
Schöpfer, Gerald, Hg. (1993), Petter Rosegger, 1843 - 1918 (Ausstellungskatalog). Graz:
Steiermärkische Landesregierung.
Schumpeter, Joseph A. (1961), Konjunkturzyklen. Eine theoretische, historische und statistische
Analyse des kapitalistischen Prozesses. Übersetzt von K. Dockhorn. Göttingen:.
Schumpeter, Josef A. (1975), Capitalism, Socialism and Democracy. With a new introduction by
Tom Bottomore. New York: Harper & Row.
Schumpeter, Josef A. (1992), Politische Reden. Hg. und kommentiert von Christian Seidl und
Wolfgang F. Stolper. Tübingen: Mohr.
Schulze, Hans Joachim (1989), Regionale Identität Erwachsener. Voraussetzungen und empirische
Befunde. In: Raumforschung und Raumordnung, 319 – 325.
Schuselka, Franz (Anonym – 1843), Ist Österreich deutsch? Eine statistische und glossierte
Betrachtung. Leipzig: .
Schütz, Alfred (1981), Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende
Soziologie, Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Schütz, Alfred / Luckmann, Thomas (1990), Strukturen der Lebenswelt. 2 Bde. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Schwarz, Iskra Ilieva (1991), Das Problem der Kontinuität von der Kiever Rus zum Moskauer
Staat in den Moskauer Chroniken des 14. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. In:
Mitteilungen des IfÖG 99 / 1-2, 69 - 81.
211
Sealsfield, Charles = Postl, Karl (1994), Austria as it is: or Sketches of continental courts, by an
eye-witness. London 1828. – Österreich, wie es ist, oder Skizzen von Fürstenhöfen des Kontinents. Wien 1919. Eine kommentierte Textausgabe, herausgegeben und mit einem Nachwort
versehen von Primus-Heinz Kucher. Wien: Böhlau.
Seewann, Gerhard (1993), Minderheitenfragen in Südosteuropa. Beiträge der internationalen
Konferrenz, 8. – 14. April 1991. München: Oldenbourg.
Seewann, Gerhard, Hg., Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa. Vorträge der Internationalen Konferenz der Südosteuropa-Gesellschaft (München), des Südost-Instituts (München) und des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung
(Stadtschlaining, Burgenland) auf Burg Schlaining, 19. – 22. Oktober 1993. München: R. Oldenbourg (Untersuchungen zur Gegenwartskunde Südosteuropas 31/Südosteuropa-Schriften
16).
Seidl, Johann Gabriel (o. J. [Erstauflage ca. 1840]), Tirol und Steiermark. Das malerische und
romantische Deutschland. München: Borowski (Reprint).
Seipel, Ignaz (1916), Nation und Staat. Wien: Braumüller.
Seipel, Ignaz (1930), Der Kampf um die österreichische Verfassung. Wien: Braumüller.
Seth, Sanjay (1999), Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of ‘Moderate Nationalism’
in India. In: The Am. Historical Review 104, 95 - 116.
Sieder, Reinhard / Steinert, Heinz / Talos, Emmerich (1995), Hg., Österreich 1945 - 1995.
Gesellschaft - Politik - Kultur. Wien. Verlag für Gesellschaftskritik.
Simmel, Georg (1986), Soziologie des Raumes. In: ders., Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl.
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 221 – 242.
Skedl, Arthur (1922), unter Mitwirkung von Egon Weiss, Hg., Der politische Nachlaß des Grafen
Eduard Taaffe. Wien: Rikola Verlag.
Slapnicka, Harry (1978), Oberösterreich als es "Oberdonau" hieß. 1938 – 1945. Linz: Oberösterreichischer Landesverlag.
Slezak, Friedrich (1982), Ottakringer Arbeiterkultur an zwei Beispielen. 1. Alfons Petzold und
Josef Slezak. – 2. Franz Schütze und sein Kinderfreunde-Orchester. Wien: J. O. Slezak.
Smahel, Frantisek (2002), Die nationes im Mittelalter. In: Ziegler, 35 – 44.
Smith, Anthony D. (1972), Theories of Nationalism. New York: Harper and Row.
Smith, Anthony D. (1976), ed., Nationalist Movements. London: Macmillan.
Smith, Anthony D. (1986), The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.
Spann, Gustav (1994), Zur Geschichte von Flagge und Wappen der Republik Österreich. In: Leser
/ Wagner 37 – 64.
Spann, Gustav (1996), Zur Geschichte des österreichischen Nationalfeiertages. In: Beiträge zur
historischen Sozialkunde 26, 27 - 34.
Srbik, Heinrich von (1907), Der staatliche Exporthandel Österreichs von Leopold I. bis Maria
Theresia. Untersuchungen zur Wirtschaftsgeschichte Österreichs im Zeitalter des
Merkantilismus. Wien-Leipzip: Braumüller, .
Stadler, Friedrich (1988), Hg., Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil österreichischer
Wissenschaft. Wien: Jugend & Volk.
Stadler, Karl R., (1976), Engelbert Pernerstorfer. Zur 'deutschnationalen' Tradition in der österreichischen Sozialdemokratie. In: Neck, Rudolf/Wandruszka, Adam, Hg., Beiträge zur Zeitgeschichte. Festschrift Ludwig Jedlicka zum 60. Geburtstag. St. Pölten: Niederösterreichisches
Pressehaus, 45 – 60.
212
Stadler, Karl R., (1982), Adolf Schärf. Mensch, Politiker, Staatsmann. Wien-München-Zürich:
Jugend & Volk.
Stalin, Josef W. (1955), Marxismus und nationale Frage. Berlin: Dietz.
Stark, Freya (1992), Der Osten und der Westen. Ansichten über Arabien. Aus dem Englischen von
Marianne Rubach. Dortmund: eFeF.
Stourzh, Gerald (1990), Vom Reich zur Republik. Studien zum Österreichbewußtsein im 20.
Jahrhundert. Wien: Edition Atelier.
Stourzh, Gerald (1993), "Kulturnation" - zur Problematik eines Begriffes. Vortrag auf dem
Symposion 'Nation – Sprache – Kultur' in Bonn, veranstaltet von der Kulturabteilung der
österreichischen Botschaft Bonn ind 'Internationes'. Manus.
Streibel, Andreas (1995), Überlegungen zur kulturellen Landesidentität des Burgenlandes nach
1945. In: Burgenländische Heimatblätter 57, 49 - 63.
Streibel, Andreas (1994), 'Von der Alm zur Puszta'. Zur Rolle völkischer Schutzvereine bei der
Angliederung des Burgenlands an Österreich. In: Burgenländische Heimatblätter 56, 49 – 77,
89 – 118.
Szücs, Jenö (1982), Nation und Geschichte. Wien: Böhlau.
Sørensen, Øystein (1994), ed., Nordic Paths to National Identity in the Ninteenth Century. KULTs
skriftserie No. 22. Oslo: The Research Council of Norway.
Sørensen, Øystein (1996), ed., Nationalism in Small European Nations. KULTs skriftserie No. 47.
Oslo: The Research Council of Norway.
Talos, Emmerich / Hanisch, Ernst / Neugebauer, Wolfgang (1988), NS-Herrschaft in Österreich
1938 - 1945. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik.
Terzuolo, Eric R. (1985), Nationalism and Communist Resistance: Italy and Yougoslavia, 1941 1945. In: CRSN XII, 25 – 45.
Thaler, Peter (1999), National History - National Imagery: The Role of History in Postwar
Austrian Nation-Building. In: Central European History 32, 277 – 309.
Tilly, Charles R. (1975), The Formation of National States in Western Europe. Princeton, N. J.,:
Princeton Univ. Press.
Tobler, Felix (1985), Die Verwaltung des Burgenlandes 1918 – 1946. In: Karner, Stefan, Hg., Das
Burgenland im Jahre 1945. Beiträge zur Landes-Sonderausstellung 1985. Eisenstadt: Burgenländische Landesregierung, 1985, 38 – 48.
Tocqueville, Alexis de (1988), De la colonie en Algérie. Présentation par Tzvetan Todorov.
Bruxelles: Editions Complexe.
Treitschke, Heinrich von (o. J. [um 1935]), Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Mit einer
Einführung von Alfred Rosenberg. Herausgegeben und bearbeitet von Klaus Gundelach. Berlin:
Safari Verlag.
Ucakar, Karl (1985), Demokratie und Wahlrecht in Österreich. Zur Entwicklung von politischer
Partizipation und staatlicher Legitimationspolitik. Wien: Verlag für Gesellschaftspolitik.
Vernon, Raymond (1971), Sovereignty at Bay. The Multinational Spread of U.S. Enterprises. New
York: Basic Books.
Vranitzky, Franz (1996), Die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion. In: Zukunft,
Heft 6, 44 – 49.
Vytiska, Herbert (1983), Der logische Nachfolger. Alois Mock – eine politische Biographie. Wien:
Multiplex Media Verlag.
Wachter, Hubert (1994), Alois Mock. Ein Leben für Österreich. St. Pölten: Niederösterreichisches
Pressehaus.
213
Wagner, Georg (1982), Hg., Österreich. Von der Staatsidee zum Nationalbewußtsein. Studien und
Ansprachen mit einem Bildteil zur Geschichte Österreichs. Wien: Österreichische Staatsdruckerei.
Wagner, Georg (1983), Hg., Österreich. Zweite Republik. Zeitgeschichte und Bundesstaatstradition. Eine Dokumentation. Wien-Thaur/Tirol: Österreichischer Kulturverlag.
Waldheim. Kurt (1984), Österreich im Spannungsfeld der Weltpolitik. In: Club Niederösterreich 3.
3 – 10.
Waldheim. Kurt (1992), Worauf es ankommt. Gedanken, Appelle, Stellungsnahmen des
Bundespräsidenten 1986 - 1992. Hg. von H. Sassmann. Graz: Styria.
Wallerstein, Immanuel (1979), Kondratieff Up or Kondratieff Down? In:Review II, 663 – 674.
Wandruszka, Adam / Urbanitsch, Peter (1980, 1985), Hg., Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918.
Band III: Die Völker des Reiches. IV: Die Konfessionen. Wien: Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften.
Wanner, Gerhard (1980a), Vorarlbergs Übergang von der Monarchie zur Republik (1918 – 1919).
Der Wunsch nach der "Demokratischen Monarchie". In: Montfort 32, 104 – 116.
Wanner, Gerhard (1980b), Schiffstaufe Fußach 1994. Bregenz: Eugen Ruß Verlag.
Wanner, Gerhard (1985), Die Kammer für Arbeiter und Angesellte für Vorarlberg 1945-1985,
Feldkirch, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg.
Washietl, Engelbert (1996), Historiker, Medien und Zeitgeschichte. In: Europäische Rundschau 24
(Heft 2), 121 – 125.
Weber, Max (1976), Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr.
Weber, Max (1981), Die Protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung. Gütersloh: Mohn.
Weber, Wilhelm, und Mitarbeiter (1972), Wirtschaft in Politik und Recht. Am österreichischen
Beispiel 1945 – 1970. Wien: Europa Verlag.
Weber-Kellermann, Ingeborg (1978), Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und
ihre Nachbarn. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Weichart, Peter (1990), Raumbezogene Identität. Bausteine zu einer Theorie räumlich-sozialer
Kognition und Identifikation. Stuttgart: Franz Steiner.
Weichart, Peter (1992), Heimatbindung und Weltverantwortung. Widersprüchliche oder komplementäre Motivkonstellationen menschlichen Handelns. In: Geographie heute 100, 30 - 44.
Weinzierl, Erika/ Skalnik, Kurt (1975), Das neue Österreich. Geschichte der Zweiten Republik.
Graz-Wien-Köln: Styria.
Weinzierl, Erika (1990), Österreichische Nation und österreichisches Nationalbewußtsein. In:
Zeitgeschichte 17, 44 – 62.
Weitensfelder, Hubert (2007), ‚Römlinge’ und ‚Preußenseuchler’. Konservativ-Christlichsoziale,
Liberal-Deutschnationale und der Kulturkampf in Vorarlberg, 1860 bis 1914. München:
Oldenbourg.
Weninger, Thomas (1991), Das österreichische Nationalbewußtsein am Vorabend eines EGBeitritts. Sekundäranalytische Ergebnisse in der Zweiten Republik. In: SWS-Rundschau 31,
479 – 496.
Werner, Ruth (1982), Die Wiener Wochenschrift "Das Neue Reich" (1918 - 1925). Ein Beitrag zur
Geschichte des politischen Katholizismus. Neudruck der Ausgabe Breslau 1938). aalen:
Scientia (Breslauer Historische Forschungen, Heft 9).
Wessels, Wolfgang (1992), Staat und (westeuropäische) Integration. Die Fusionsthese. In: Kreile
1992, 36 - 61.
214
Whiteside, Andrew G. (1981), Georg Ritter von Schönerer. Alldeutschland und sein Prophet. Graz:
Styria.
Wichtl, Thomas (1985), Zur Ökonomie des `Volksreichtums'. Bevölkerungspolitische Theorien im
Österreich des aufgeklärten Absolutismus. In: Demographische Informationen. Wien: Institut
für Demographie, 36 – 48.
Winkler, Heinrich August (1982), Hg., Nationalismus in der Welt von heute. Geschichte und
Gesellschaft, Sonderheft 8. Göttingen: Vandenhock & Rupprecht.
Winter, Eduard / Funk, Paul / Berg, Jan (1967), Bernard Bolzano. Ein Denker und Erzieher im
österreichischen Vormärz. Wien: Kommissionsverlag Böhlau (ÖAW-Sitzungsberichte 252/5).
Wintoniak, Alexis (1996), Realistische Schritte. In: Österr. Monatshefte 1-2, 8 – 12.
Withalm, Hermann (1977), Aus meinem Gästebuch. Graz: Styria.
Witzig, Daniel (1974), Die Vorarlberger Frage. Die Vorarlberger Anschlußbewegung an die
Schweiz, territorialer Verzicht und territoriale Ansprüche vor dem Hintergrund der Neugestaltung Europas 1918 – 19.
Zeller, Wilhelm (1079), Geschichte der zentralen amtlichen Statistik in Österreich. In: ÖStZ,
Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich 1829 – 1979. Wien:
ÖStZ, 689 – 710 (Beiträge zur österreichischen Statistik 550), 13 – 236.
Zenker, Ernst Viktor (1897), Die Wiener Revolution 1848 in ihren sozialen Voraussetzungen und
Beziehungen. Wien: Braumüller.
Ziegler, Meinrad / Kannonier-Finster, Waltraud (1993), unter Mitarbeit von Marlene
Weiterschan, Österreichisches Gedächtnis. Über Erinnern und Vergessen der NSVergangenheit. Mit einem Beitrag von Mario Erdheim. Wien: Böhlau.
Ziegler, Walter (2002), Warum wurde Bayern kein souveräner Naqtionalstaat? In: Maier, 57 – 72.
Zimmer, Oliver (1998), In Search of Natural Identity: Alpine Landscape and the Reconstruction of
the Swiss Nation. IN: CSSH 40, 637 - 665.
Zöllner, Erich (1978), Hg., Das babenbergische Österreich (976 – 1246). Wien: Österreichischer
Bundesverlag.
Zöllner, Erich (1984), Hg., Volk, Land und Staat. Landesbewußtsein, Staatsidee und nationale
Frage in der Geschichte Österreichs. Wien: Österreichischer Bundesverlag.
Zwitter, Fran (1962), Nacionalni problemi v Habsburki Monarhiji. Ljubljana: Slovenska Matica.
Zulehner, Paul M. / Denz, Herrmann / Beham, M. / Friesl, Chr. (1991), Vom Untertanen zum
Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose anhand der Untersuchungen 'Religion im Leben der
Österreicher 1970 bis 1990' - 'Europäische Wertestudie – Österreichteil 1990'. Wien: Herder.
Zulehner, Paul Michael (1981), Religion im Leben der Österreicher. Dokumentation einer Umfrage. Wien: Herder.
215