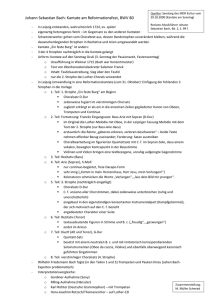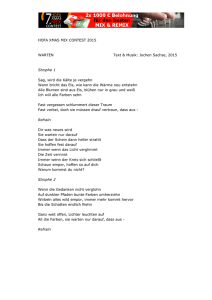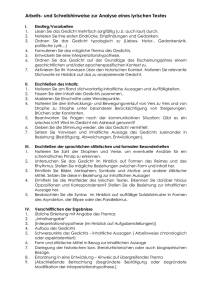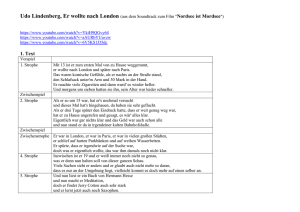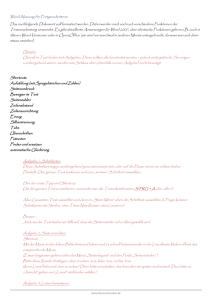Ebenbild unsres Lebens (Andreas Gryphius) - KGH auf lo-net
Werbung
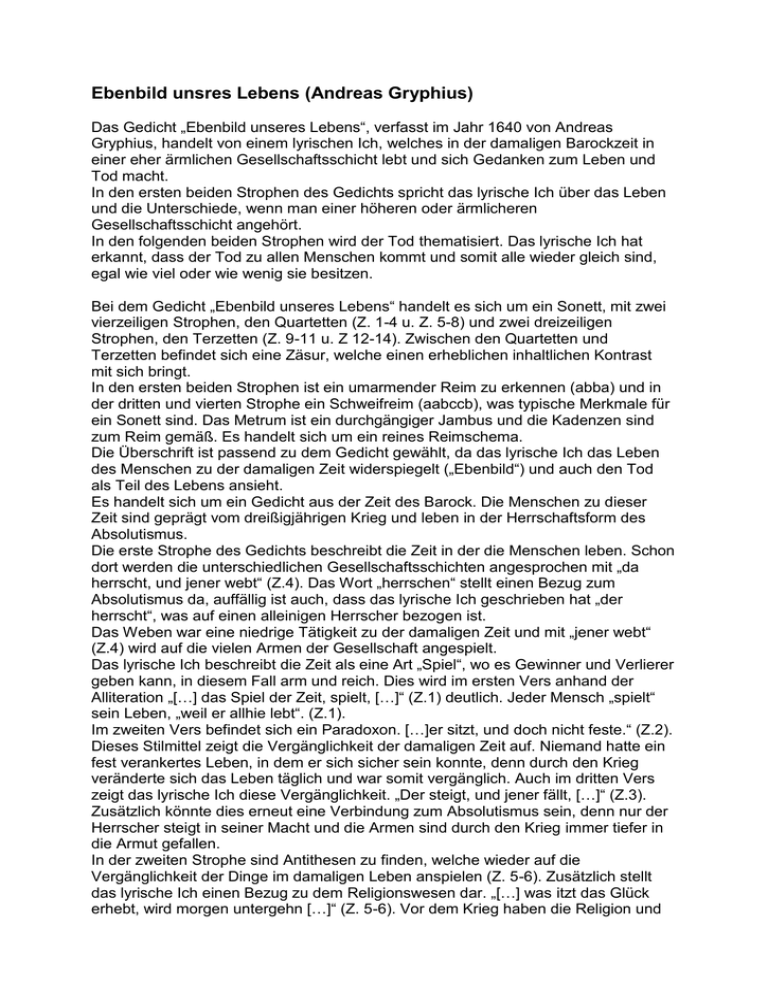
Ebenbild unsres Lebens (Andreas Gryphius) Das Gedicht „Ebenbild unseres Lebens“, verfasst im Jahr 1640 von Andreas Gryphius, handelt von einem lyrischen Ich, welches in der damaligen Barockzeit in einer eher ärmlichen Gesellschaftsschicht lebt und sich Gedanken zum Leben und Tod macht. In den ersten beiden Strophen des Gedichts spricht das lyrische Ich über das Leben und die Unterschiede, wenn man einer höheren oder ärmlicheren Gesellschaftsschicht angehört. In den folgenden beiden Strophen wird der Tod thematisiert. Das lyrische Ich hat erkannt, dass der Tod zu allen Menschen kommt und somit alle wieder gleich sind, egal wie viel oder wie wenig sie besitzen. Bei dem Gedicht „Ebenbild unseres Lebens“ handelt es sich um ein Sonett, mit zwei vierzeiligen Strophen, den Quartetten (Z. 1-4 u. Z. 5-8) und zwei dreizeiligen Strophen, den Terzetten (Z. 9-11 u. Z 12-14). Zwischen den Quartetten und Terzetten befindet sich eine Zäsur, welche einen erheblichen inhaltlichen Kontrast mit sich bringt. In den ersten beiden Strophen ist ein umarmender Reim zu erkennen (abba) und in der dritten und vierten Strophe ein Schweifreim (aabccb), was typische Merkmale für ein Sonett sind. Das Metrum ist ein durchgängiger Jambus und die Kadenzen sind zum Reim gemäß. Es handelt sich um ein reines Reimschema. Die Überschrift ist passend zu dem Gedicht gewählt, da das lyrische Ich das Leben des Menschen zu der damaligen Zeit widerspiegelt („Ebenbild“) und auch den Tod als Teil des Lebens ansieht. Es handelt sich um ein Gedicht aus der Zeit des Barock. Die Menschen zu dieser Zeit sind geprägt vom dreißigjährigen Krieg und leben in der Herrschaftsform des Absolutismus. Die erste Strophe des Gedichts beschreibt die Zeit in der die Menschen leben. Schon dort werden die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten angesprochen mit „da herrscht, und jener webt“ (Z.4). Das Wort „herrschen“ stellt einen Bezug zum Absolutismus da, auffällig ist auch, dass das lyrische Ich geschrieben hat „der herrscht“, was auf einen alleinigen Herrscher bezogen ist. Das Weben war eine niedrige Tätigkeit zu der damaligen Zeit und mit „jener webt“ (Z.4) wird auf die vielen Armen der Gesellschaft angespielt. Das lyrische Ich beschreibt die Zeit als eine Art „Spiel“, wo es Gewinner und Verlierer geben kann, in diesem Fall arm und reich. Dies wird im ersten Vers anhand der Alliteration „[…] das Spiel der Zeit, spielt, […]“ (Z.1) deutlich. Jeder Mensch „spielt“ sein Leben, „weil er allhie lebt“. (Z.1). Im zweiten Vers befindet sich ein Paradoxon. […]er sitzt, und doch nicht feste.“ (Z.2). Dieses Stilmittel zeigt die Vergänglichkeit der damaligen Zeit auf. Niemand hatte ein fest verankertes Leben, in dem er sich sicher sein konnte, denn durch den Krieg veränderte sich das Leben täglich und war somit vergänglich. Auch im dritten Vers zeigt das lyrische Ich diese Vergänglichkeit. „Der steigt, und jener fällt, […]“ (Z.3). Zusätzlich könnte dies erneut eine Verbindung zum Absolutismus sein, denn nur der Herrscher steigt in seiner Macht und die Armen sind durch den Krieg immer tiefer in die Armut gefallen. In der zweiten Strophe sind Antithesen zu finden, welche wieder auf die Vergänglichkeit der Dinge im damaligen Leben anspielen (Z. 5-6). Zusätzlich stellt das lyrische Ich einen Bezug zu dem Religionswesen dar. „[…] was itzt das Glück erhebt, wird morgen untergehn […]“ (Z. 5-6). Vor dem Krieg haben die Religion und der Glaube den Menschen Sicherheit und Glück gegeben, doch die Entwicklung des Absolutismus hat die Religion verdrängt und den Herrscher in den Mittelpunkt gestellt. Im dritten Vers der zweiten Strophe (Z. 7) bilden die Wörter „dürr und tot“ ein Hendiadyoin. Beide Wörter haben eine ähnliche Bedeutung, werden jedoch in verschiedenen Kontexten verwendet. Mit „dürr“ könnte das lyrische Ich die damalige Vergänglichkeit der Natur im oder nach dem Krieg thematisieren. Mit „tot“ hingegen wird auf die vielen Verstorbenen im Krieg angespielt. Ebenfalls deutlich wird, dass das lyrische Ich sich selbst zu der ärmeren Gesellschaftsschicht zählt, da es schreibt: „[…] wir Armen sind nur Gäste“ (Z. 7). Die dritte und die vierte Strophe beziehen sich auf den Tod der Menschen. Gleich im ersten Vers der dritten Strophe wird erneut auf die Ständegesellschaft hingewiesen. „Wir sind zwar gleich vom Fleisch, doch nicht vom gleichen Stande.“ (Z. 9) Doch nun stellt das lyrische Ich einen Bezug zum Tod her und stellt heraus, dass nach dem Ableben alle Menschen wieder gleich sind. „Bis nach entraubtem Schmuck der Tod uns gleiche macht.“ (Z. 11). Zusätzlich könnte dies eine Verbindung zum noch vorhandenen Glauben sein, dass alle Menschen mit ihren Sünden und Taten, egal ob reich oder arm gleich vor Gott stehen. Im folgenden Teil spricht es wieder von dem Leben in Form eines Spiels. „Spielt denn dies ernste Spiel, […]“ (Z. 12). Der letzte Vers des Gedichts schließt mit einer Akkumulation ab: „Kron, Weisheit, Stärk und Gut sei eine leere Pracht!“ (z. 14). Diese soll verdeutlichen, dass alles, was die reichen Personen zu Lebzeiten besitzen, ihnen im Tod keinen Nutzen mehr bringt und somit Reichtum ebenfalls vergänglich ist. Verfall (Georg Trakl) Das Gedicht „Verfall“, verfasst zwischen den Jahren 1910 und 1912 von Georg Trakl, handelt von einem lyrischen Ich, welches in einer Traumwelt wandelt und schließlich doch die angsteinflößende Wirklichkeit erfährt. In den ersten beiden Strophen des Gedichts träumt das lyrische Ich den Zugvögeln hinterher, welche sich zur Herbstzeit in Richtung Süden begeben und verliert dabei jegliches Zeitgefühl. In den folgenden Strophen drei und vier erwacht es aus der sicheren Traumwelt und nimmt die bedrohliche, angstvolle Realität wahr. Bei dem Gedicht „Verfall“ handelt es sich um ein Sonett, mit zwei vierzeiligen Strophen, den Quartetten (Z. 1-4 u. Z. 5-8) und zwei dreizeiligen Strophen, den Terzetten (Z. 9-11 u. Z. 12-14). Zwischen den Quartetten und den Terzetten befindet sich eine Zäsur, welche einen inhaltlichen Kontrast zwischen der ersten und zweiten und der dritten und vierten Strophe mit sich bringt. In den Strophen eins und zwei ist ein umarmender Reim zu erkennen (abba), wobei dieser in der ersten Strophe bei (a[...]a) und in der zweiten Strophe bei ([…]bb[…]) unrein gereimt ist. In der dritten und vierten Strophe ist ein Schweifreim zu erkennen (aabcbc). Dieses Reimschema ist ein typisches Merkmal für ein Sonett. Die Überschrift „Verfall“ könnte sich auf die Beendung des Traums am Ende der zweiten Strophe beziehen. Der Traum verfällt und die Wirklichkeit dahinter wird für das lyrische Ich sichtbar. Es handelt sich um ein Gedicht des frühern Expressionismus. Das Leben zu dieser Zeit war geprägt durch die sich immer weiter ausdehnende Industrialisierung und durch die Militarisierung. Viele Menschen hatten Probleme mit der „anonymen“ Großstadt und wurden begleitet von der Angst vor der Abhängigkeit von einer fremden, übermächtigen Welt. Die ersten beiden Strophen des Gedichts beschreiben die Traumwelt des lyrischen Ichs, wo „[…] die Glocken Frieden läuten,“ (Z. 1). Dies bedeutet, dass es in seinem Traum in einer friedlichen Welt, ohne Angst lebt. In Gedanken fliegt es mit den Vögeln durch die Wolken, ohne Zeitgefühl oder die Hektik der Wirklichkeit. „Und fühl der Stunden Weiser kaum mehr rücken. So flog ich über Wolken ihren Fahrten“ (Z. 78). Es erweckt den Eindruck, als hat das lyrische Ich Fernweh und möchte seiner Welt, wie die Zugvögel, entfliehen. Auch im vierten Vers: „Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten.“ (Z.4) ist eine Andeutung zu finden, dass es fliehen möchte, wenn die Angst zum ständigen Begleiter wird, wie bei den Vögeln die Kälte. Am Anfang der dritten Strophe erwacht das lyrische Ich schließlich aus seiner Traumwelt, was das Wort „da“ (Z. 9) betont. Im zweiten Vers der dritten Strophe ist eine Personifikation zu finden: „die Amsel klagt […]“ (Z. 10). Ab nun an vergleicht sich das lyrische Ich mit einer Amsel, die kein Zugvogel ist und somit auch im Winter der Kälte nicht entfliehen kann. Es ist ihm bewusst geworden, dass es selbst auch nicht vor dem Bösen und der Angst auf der Welt entfliehen kann. „Um dunkle Brunnenränder, die verwittern, im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen.“ (Z. 13-14). Mit den dunklen Brunnenrändern spielt das lyrische Ich auf die anonyme Gesellschaft an, von der man wie von einem Brunnen verschluckt werden kann. „Im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen.“ (Z. 14). Auch dies ist wieder mit einer Personifikation zu beschreiben. Doch es darf sich nicht verschlucken lassen von der Anonymität oder Angst vor der Industrialisierung haben, dann wird es das Leben überstehen, wie die Astern den Winter. Vergleich (Ebenbild unseres Lebens / Verfall) Gemeinsamkeiten: Sonette gleiches Reimschema Menschen haben Angst ( dreißigjähriger Krieg, Armut / Industrialisierung ) Unterschiede: unreiner Reim / reiner Reim Unterschiede der Gesellschaft werden angesprochen / Keine gesellschaftliche Trennung erkennbar 1640 / 1910- 1912 andere Wahrnehmungsweisen der Welt 1. + 2. Strophe: wahres Leben mit Guten und Schlechtem / Traumwelt