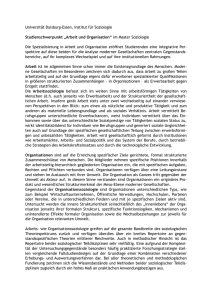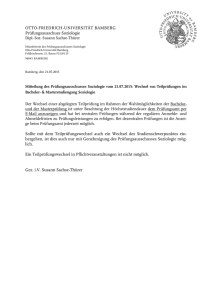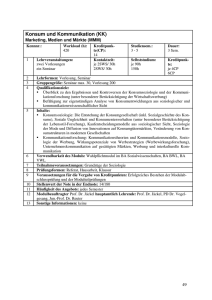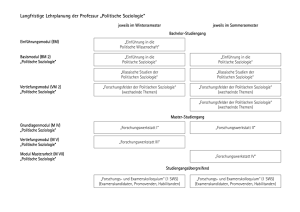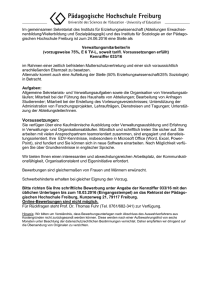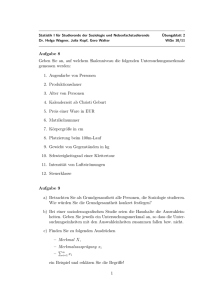Zwei zentrale Begriffe der Soziologie: Struktur und Funktion
Werbung
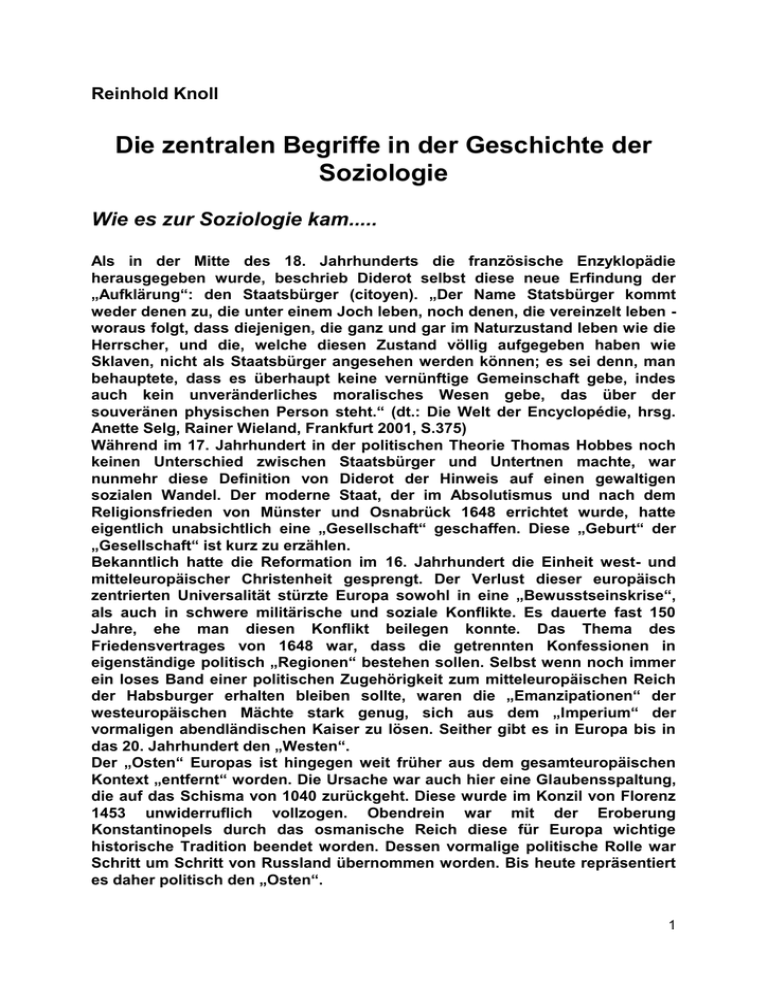
Reinhold Knoll Die zentralen Begriffe in der Geschichte der Soziologie Wie es zur Soziologie kam..... Als in der Mitte des 18. Jahrhunderts die französische Enzyklopädie herausgegeben wurde, beschrieb Diderot selbst diese neue Erfindung der „Aufklärung“: den Staatsbürger (citoyen). „Der Name Statsbürger kommt weder denen zu, die unter einem Joch leben, noch denen, die vereinzelt leben woraus folgt, dass diejenigen, die ganz und gar im Naturzustand leben wie die Herrscher, und die, welche diesen Zustand völlig aufgegeben haben wie Sklaven, nicht als Staatsbürger angesehen werden können; es sei denn, man behauptete, dass es überhaupt keine vernünftige Gemeinschaft gebe, indes auch kein unveränderliches moralisches Wesen gebe, das über der souveränen physischen Person steht.“ (dt.: Die Welt der Encyclopédie, hrsg. Anette Selg, Rainer Wieland, Frankfurt 2001, S.375) Während im 17. Jahrhundert in der politischen Theorie Thomas Hobbes noch keinen Unterschied zwischen Staatsbürger und Untertnen machte, war nunmehr diese Definition von Diderot der Hinweis auf einen gewaltigen sozialen Wandel. Der moderne Staat, der im Absolutismus und nach dem Religionsfrieden von Münster und Osnabrück 1648 errichtet wurde, hatte eigentlich unabsichtlich eine „Gesellschaft“ geschaffen. Diese „Geburt“ der „Gesellschaft“ ist kurz zu erzählen. Bekanntlich hatte die Reformation im 16. Jahrhundert die Einheit west- und mitteleuropäischer Christenheit gesprengt. Der Verlust dieser europäisch zentrierten Universalität stürzte Europa sowohl in eine „Bewusstseinskrise“, als auch in schwere militärische und soziale Konflikte. Es dauerte fast 150 Jahre, ehe man diesen Konflikt beilegen konnte. Das Thema des Friedensvertrages von 1648 war, dass die getrennten Konfessionen in eigenständige politisch „Regionen“ bestehen sollen. Selbst wenn noch immer ein loses Band einer politischen Zugehörigkeit zum mitteleuropäischen Reich der Habsburger erhalten bleiben sollte, waren die „Emanzipationen“ der westeuropäischen Mächte stark genug, sich aus dem „Imperium“ der vormaligen abendländischen Kaiser zu lösen. Seither gibt es in Europa bis in das 20. Jahrhundert den „Westen“. Der „Osten“ Europas ist hingegen weit früher aus dem gesamteuropäischen Kontext „entfernt“ worden. Die Ursache war auch hier eine Glaubensspaltung, die auf das Schisma von 1040 zurückgeht. Diese wurde im Konzil von Florenz 1453 unwiderruflich vollzogen. Obendrein war mit der Eroberung Konstantinopels durch das osmanische Reich diese für Europa wichtige historische Tradition beendet worden. Dessen vormalige politische Rolle war Schritt um Schritt von Russland übernommen worden. Bis heute repräsentiert es daher politisch den „Osten“. 1 Diese Vorbedingungen begünstigten den Entwurf des „Staates“ im französischen Absolutismus unter Ludwig XIV. Dieser war bald das Muster für alle anderen Regionen. Die etwas mildere Form nannte man schließlich einen „wohlfahrtsstaatlichen Absolutismus“, für den Josef II. oder Friedrich II. repräsentativ waren. Der Staat erhielt eine straffe Verwaltung und zugleich einen möglichen Zugriff auf die Lebensbereiche der Bewohner. Allerdings wurde damit gegenüber diesem neuen Staat „indirekt“ eine „Gesellschaft“ eingerichtet. Im Zuge der Aufklärung rückte diese immer mehr in den Mittelpunkt der politischen Interessen, wurde zum Gegenstand der Analyse und des Rechts. Es war somit nicht mehr zu verhindern, dass man auch über „Verbesserungen“ der Gesellschaft nachdachte, nachdem Vergleichbares in den Reformen für den Staat stattgefunden hatte. Es ist vermutlich diesem Umstand zu verdanken, dass Ideologien und Utopien in der Entwicklung der Soziologie eine so dominante Position einzunehmen begannen. In ihnen sind auch die Wurzeln für Liberalismus, Nationalismus und Sozialismus zu erblicken. Der absolutistische und „aufgeklärte“ Staat hatte deshalb eine so überragende Bedeutung gewonnen, da er sich gezwungen sah, seine Legitimation nicht mehr aus der alten Einheit christlichen Bekenntnisses abzuleiten. Er musste dafür neue Instanzen geltend machen. Somit waren Rechtswissenschaft, Verwaltungslehre, Naturwissenschaft und Ökonomie, Kunst und Philosophie gleichsam zu „geistig-politischen“ Mächten geworden, die die vormals religiös bestimmten Orientierungen und Legitimationen ersetzten. Es waren „Substitutionen“, die den Blick auf den Menschen, auf dessen Gemeinschaftsformen und auf den Staat veränderten. Die logische Konsequenz kann so beschrieben werden, dass sowohl die industrielle als auch die französische Revolution diese neue politische und gesellschaftliche Wirklichkeit zu formulieren und zu nutzen wussten. Keine Wissenschaft schien geeignet, eine adäquate Interpretation zu bieten, nicht die juristischen im weitesten Sinn und auch nicht die traditionelle Sozialphilosophie. Es war daher eine „Soziologie“ erforderlich, von der Auguste Comte wirklich behaupten konnte, sie sei die einzige Wissenschaft, die sich diesen neuen Verhältnissen zu stellen vermag und er sie deshalb als „positive“ Wissenschaft“ ausgab. Diese knappe Einleitung hat nicht den Sinn, etwa die Geschichte einer Wissenschaft möglichst schnell zusammenzufassen, deren Bedeutung zu mindern oder sie als Zeiterscheinung zu beschreiben, sondern bereits zu diesem Zeitpunkt ist zu erkennen, dass eine Soziologie sehr schnell eine eigenständige Terminologie zu entwickeln hatte, eine neue „Wissenschaftslehre“, die sich anfänglich noch der Geschichte als empirischer Grundlage bedienen musste und zugleich ihren Untersuchungsgegenstand gegenüber den traditionellen Disziplinen abgrenzen musste. Jedenfalls schien die alte Sozialphilosophie diese Fähigkeit nicht mehr besessen zu haben. Auch die Geschichtswissenschaft schien nicht wirklich in der Lage gewesen zu sein, die neuen Faktoren in Politik, Ökonomie, Wissenschaft und Industriesystem in ihrer Bedeutung einzuschätzen. So musste wirklich die Soziologie „erfunden“ werden, vor allem hofften die Pioniere, die gewaltige Destabilisierung von Gesellschaft und Staat nach den Revolutionen und nach dem Desaster der napoleonischen Kriege zu beenden 2 ein Motiv, das weit über Emile Durkheim hinaus als Begründung für die Wichtigkeit soziologischen Wissens angegeben wird. Wie die Soziologie begann.... Die Folgen der französischen Revolution waren in mehrfacher Hinsicht ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Im Rückblick kann man die Lehre ziehen, dass die politische Zuspitzung der Aufklärung zwar zu jenem sozialen „Prozess“ führte, der die Monarchie in Frankreich beendete, aber damit waren die Hoffnungen der Republik nicht erfüllt worden. Icht nur die politische „Normalisierung“ durch Napoleon hatte die kurze Zeit der „Volksherrschaft“ abgelöst, sondern für lange Zeit wurde das politische System Frankreichs destabilisiert. Revolutionen und Revolten brachten unruhige Zeiten und endeten vermutlich in der demütigen Niederlage 1871. In Versailles veranstaltete der deutsche Reichskanzler Bismarck die Ausrufung des preußischen Königs zum deutschen Kaiser. Schlimmer konnte eine Epoche nicht enden. Deshalb war der Frieden Frankreichs mit Deutschland nach dem 1. Weltkrieg ebenfalls in Versailles geschlossen worden, um sich für diese blamable Geschichte zu revanchieren. Nun war Auguste Comte ein sehr versierter Beobachter der politischen Wechselfälle in Frankreich. Er war ja im Revolutionsjahr 1789 geboren worden, konnte die Zeit Napoleons bereits miterleben und schließlich das „Bürgerkönigtum“ unter Louis Philippe. Vermutlich war er von dem großen System der Philosophie der Geschichte von Hegel beeinflusst, weshalb er ein vergleichbares System entwerfen wollte, natürlich mit den Vorbehalten gegenüber jeder Metaphysik, weshalb er sich für eine „positive Philosophie“ entschied. Er fühlte sich ja der französischen Tradition des „Szientismus“ verbunden und war der Überzeugung, dass Geschichte und Transzendenz, Rationalität und Metaphysik in jeder Form einer Verbindung in die falsche Richtung gehen. Eigentlich habe die Philosophie eine Wissenschaft zu sein. Nur so sei sie fähig, die entscheidenden Faktoren der gesellschaftlichen Entwicklung aufzudecken, deren Entwicklungen zu identifizieren und vielleicht auch künftig zu steuern. Für den Soziologen ist es ja wichtig, über eine Wissenschaft von der Gesellschaft zu verfügen, was nicht möglich wäre, würde man nicht die Faktoren gesellschaftlicher Entwicklung entdecken können und auf der anderen Seite Tendenzen in dieser Entwicklung rechtzeitig wahrzunehmen. Das Konzept von Comte schien beides anbieten zu können. Die Faktoren gesellschaftlicher Entwicklung lassen sich historisch-empirisch erheben, andererseits soll es einen regelmäßig wiederkehrenden Verlauf historischpolitischer Prozesse geben. So ungefähr hatte Comte sein Gebiet beschrieben. Die Voraussetzung dieser Interpretation war natürlich die „positivistische Methode“. Er behauptete, dass es eine solche Methode gebe, als Beweis nannte der den Fortschritt der Wissenschaften und beobachtete zugleich, wie die Naturwissenschaften die älteren „Geisteswissenschaften“ überrundeten. Die Naturwissenschaften hätten zuverlässige und konkrete Ergebnisse gebracht, das war insgesamt die Ansicht der meisten Intellektuellen und dahinter müsse wohl ein besonderes Merkmal von „Vernunft“ stecken. Darin liegt auch die Ursache für die Bezeichnung der Soziologie als „soziale Physik“, die Comte ebenfalls als Bezeichnung für sein Tun verwendete. Diese 3 Bezeichnung enthüllt eindeutig, dass Comte erhoffte, die Soziologie könne eine besondere Art von Naturwissenschaft sein, zumindest in ihrer Fähigkeit zur sozialwissenschaftlichen Erkenntnis eine ähnliche Qualität des Wissens erzeugen. Mit der Erfindung des Wortes „Soziologie“ hatte Comte angedeutet, ab nun werde es eine Wissenschaft geben, die eine treue Begleiterin der Gesellschaft sein werde, um sie vor Irrtum und Fehlentscheidung zu bewahren. Und es zählt zum Bekenntnis des Szientismus, dass man vor Irrtum bewahrt werden kann, sollte man eben nicht mehr spekulativ denken, sondern „positiv“. Da dürfe es keine Metaphysik geben, an deren Stelle würde man Gesetze sozialer Verläufe kennen, die die sozialen Veränderungen bestimmen und zugleich in der Ermittlung sozialer Tatsachen eine Interpretation der Gesellschaft erlauben natürlich unter Beiziehung historischen Wissens. Im Sinne dieser Konstruktion entwickelte Comte ein „System“, in dem dieses bekannte „Dreistadien-Gesetz“ als Erklärungsmodell dient, da es das Phänomen des Fortschritts als notwendige Abfolge erklärt, nämlich die Neigung der Menschen, stets höhere „Stadien“ ihres Lebens- und Daseinsvollzugs anzustreben. Die Weltgeschichte zeige eine stufenweise Entwicklung des Bewusstseins. Darin ist die Hypothese von Comte enthalten, dass er keine Weltgeschichte entschlüsseln wollte, auch „Menschheitsgeschichte“ zu schreiben beabsichtigte, sondern die stufenweise Entfaltung des Bewusstseins, das sich vor allem im Zustand der Wissenschaft nachweisen läßt. Also beginnt „Geschichte“ mit dem „theologischen“ Stadium, das vom „metaphysischen“ abgelöst wird und hierauf dem „positiven“ weichen muss. Und innerhalb dieser Stadien sind wiederum drei Stadien, also Entwicklungsschritte, die etwa im „theologischen Zeitalter“ den Verlauf vom Fetischismus über Polytheismus bis zum Monotheismus zeigen. In dieser Hypothese, in der die „Weltgeschichte“ eben einen ganz anderen Zuschnitt erfährt und zugleich „nur“ mehr der empirischen Vergewisserung dient und nicht der Spekulation über deren Sinn oder Zweck, stellt sich eine neue Einsicht ein: die Gesellschaft erfährt eine „Plastizität“, so dass sie als eigener „Gegenstand“ wie in der Physik untersucht werden kann. Im „theologischen“ Zeitalter habe sich ja schon gezeigt, dass die Menschen erkannten, dass die Phänomene nicht selbst „belebt“ sind oder ein Leben haben, sondern sie werden bewegt oder gehorchen einem höheren Willen. Damit sind Natur, Welt oder Geschichte „Objekte“ geworden, die Gottheiten sind nicht die Naturerscheinungen selbst, sondern sind Instrumente. Und in allen Stadien sind vergleichbare höhere Erkenntnisstufen eingetreten, so dass dann der Schritt zum „positiven“ Stadium gleichsam „automatisch“ sich einstellt. Er wurde in der Renaissance unternommen und ist bei Comte dadurch charakterisiert, dass Beobachtung und Untersuchung von einzelnen Phänomenen stattfanden und das Ergebnis zeigten, dass es „Gesetze“ gebe. Sie sind unveränderlich und werden Naturgesetze genannt. Und wie es Naturgesetze gibt, so werden auch soziale Erscheinungen eine Gesetzmäßigkeit enthalten. Diese Linienführung des Fortschritts sieht etwa so aus, dass Arithmetik die Lehre der Mechanik förderte und beide ermöglichten die Astronomie. Diese drei Wissenschaften waren die Grundlage für die Physik, an die sich die Chemie anschloss. Aus Chemie und Physik entwickelte sich die Biologie. 4 Daher ist es nicht verwunderlich, wenn am Ende als logische Folge eine „soziale Physik“ sein muss. Sie ist die Wissenschaft von dem komplexen Gebilde Gesellschaft, zugleich der Höhepunkt menschlicher Fähigkeit zur Erkenntnis und zeigt eine lineare Entwicklung der Wissenschaften. Wenn Comte diese „Physik“ als Soziologie bezeichnet, so half ihm dabei die erfolgreiche Statistik, weshalb diese Beziehung zwischen Soziologie und Statistik den Eindruck vermittelte, es gäbe in der Gesellschaft quantifizierbare Veränderungen, die sich wie Gesetze der Naturwissenschaften ermitteln lassen. Wissenschaftstheoretisch hatte damit Comte den ersten Schritt unternommen, eine Übereinstimmung von Geschichte und Wissenschaft anzunehmen, die für die weitere Entwicklung der Soziologie große Bedeutung gewann - etwa spägter bei Karl Marx. Comte nahm ebenfalls an, dass Verbrechen und Zahl der Delikte statitischen Kurven folgen. Darin vermutete er ein „Soziales Gesetz“. Auch wenn er diese überraschende Einsicht nicht weiter verfolgte, so knüpfte er daran die weitere Überlegung, dass eine „soziale Moral“, ei Wissen über das Gute nicht nur wünschenswert ist, sondern es wird die Aufgabe der Soziologie sein, die beste Bedingung für eine soziale Moral zu schaffen. Wenn er von „positiver Wissenschaft“ gesprochen hat, so meinte er damit, dass es einen seriösen Weg geben müsse, rational, empirisch und naturwissenschaftlich in der Methode, um das gesellschaftlich Gute zu fördern. Wissenschaft werde zuletzt die Instanz der Moral sein. Natürlich war die Idee, Moral sei über eine Wissenschaft zu ermitteln und rational zu konstruieren, nicht neu. Immerhin war dafür immer die Philosophie zuständig. Comte verließ aber bewusst dieses traditionelle Terrain der Philosophie und forderte für seine Soziologie eine Zuständigkeit ein, die sie allein schon wegen ihrer eigenen und genuinen Denkschritte und Methoden auch beanspruchen kann. Er verließ dort die Philosophie, wo Immanuel Kant die praktische von der theoretischen Vernunft trennte. Eine Vereinigung beider ist bei Kant nur durch die Erforschung einer Theorie durch denselben Willen zur Wahrheit möglich. Comte hingegen glaubte, es werde eine „Osmose“ eintreten: Aus dem Experiment würde eine Hypothgese möglich, deren Prüfung durch Erforschung der Tatsachen stattfindet und daraus würde sich ein Gesetz ergeben. Und der Charakter dieser Gesetze in der Gesellschaft erlaube nicht nur deren Kenntnis, sondern auch eine künftige vernünftige Lenkung der Gesellschaftspolitik durch Soziologie. Vielleicht ist der sympathische Teil dieses Entwurfs die Verbindung von Positivismus und Humanität. Fast kann man darin eine religiöse Bestimmung vermuten. Comte wurde von einem moralischen Idealismus angetrieben, der sich im 19. Jahrhundert bei Intellektuellen oft beobachten ließ. Schritt für Schritt bildete sich aus diesem Motiv die Soziologie aus, emanzipierte sich von dem quasi-religiösen Gründungsgedanken Comtes, um eine moderne Wissenschaft zu werden. Dazu benötigte sie aber ihre eigenständige Terminologie. Struktur, System und Funktion 5 In keinem Lehrbuch der Soziologie werden die drei Begriffe fehlen dürfen. Sie scheinen gut geeignet, Gesellschaft zu erklären. Im Wechselspiel zwischen Struktur, System und Funktion soll über gesellschaftliche Zusammenhänge Auskunft gegeben werden, allerdings scheinen die Begriffe „System“ und „Struktur“ miteinander zu konkurrieren. Es ist daher für viele Interessierte an der Soziologie verwirrend, die Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen zu erkennen. Historiker haben es hier etwas leichter, da sie beide ineinander fließen lassen und beschreiben, dass Hof und Verwaltung, Kirche, Parlament und ebenso Freie, Leibeigene und Handwerker miteinander verbunden sind und durch die daraus entstandenen Strukturen ein soziales Gefüge bilden. Dieses Gefüge gruppiert sich um Institutionen. Von außen betrachtet, kann man dieses Gefüge als System interpretieren. Dieses bestimmt das soziale Leben. Sehr bald haben aber die Historiker herausgefunden, dass diese Gesellschaften nicht nur ihren Rückhalt in den Institutionen haben, also über ein strukturelles Geflecht verfügen müssen, sondern dass die sichtbaren Funktionen darüber Auskunft geben. dass es Äquivalente in der Gesellschaft gibt, so etwa steht dem König der Adel gegenüber, oder aber Kaufleute benötigen natürlich die Konsumenten ihrer Handelsgüter. Es sind stets komplementär angeordnete soziale „Felder“, die eine Funktion erfüllen. Funktionen kann man als ein „Gleichungssystem“ bezeichnen - wie in der Mathematik. Die Störung in diesem Gleichgewicht fällt umgehend auf. Die Ausdehnung sozialer Funktionen und deren Vielfalt in der Gesellschaft, Soziologen stehen dann vor dem Problem erhöhter sozialer Komplexität, lassen sich dann über die Darstellung eines sozialen Systems veranschaulichen. Dazu zählen so bekannte Erscheinungen wie etwa Arbeitsteilung, Technisierung, Entwicklung des Rechts und politischer Partizipation. Diese Entwicklungen haben sogar eigene und neue Systeme gebildet. Damit Systeme Festigkeit gewinnen, benötigen sie Institutionen, die den Bestand sichern, oder man musste neue errichten. Das Kriterium ihrer Haltbarkeit ergab sich aus Rationalität, Regulierung der Handlungs- und Verhaltensweisen der Mitglieder von System und Institution und allgemeine Anerkennung. Dass damit nur eine begrenzte Dauer solcher Institutionen geschaffen werden kann, liegt auf der Hand. Es war ja die Soziologie, die darauf aufmerksam machte, dass die Veränderung sozialer Gefüge, die Veränderung der Institutionen auf den wichtigen Gegenstand sozialen Wandels verweisen. So beleuchten die Begriffe „Funktion“, „System“ und „Struktur“, dass es immer um die Auseinandersetzung zwischen sozialer Stabilität und sozialem Wandel geht, wobei diese beiden als soziologische Abstraktionen gelten. In beiden ist zugleich entweder 6 Kompetenz oder Kompetenzverlust gerade bei sozialen Institutionen zu beobachten, Funktionalität oder Dysfunktion, wobei wir nicht mehr ein „soziales System“ allein beschreiben, sondern schon „Strukturen“ als Bezeichnungen dieser Phänomene heranziehen müssen. Vielleicht ist es hilfreich, bei den Begriffen von „System“ und „Struktur“ an die Architektur zu denken. Beide Begriffe stammen ja aus der Gebäudelehre der Renaissance. Der sichtbare Aufriss der Gebäude, die Ordnung der Geschosse und Gebäudeachsen, die Anlage eigener Baukörper stellt ein System dar. Hingegen erhalten wir den Einblick in die Struktur eines Gebäudes, sollten wir den Grundriss betrachten. Das Bindeglied zwischen System und Struktur ist die Funktion - wenigstens in der Architektur. Wenn wir uns an diesen Hinweis halten, können diese Begriffe nicht mehr so leicht verwechselt werden. Natürlich ist der Begriff der „Funktion“ am leichtesten zu verstehen. Funktionen sorgen immer für soziales Gleichgewicht. Sie können sogar im Widerspruch zum sozialen System stehen und dennoch dieses stabilisieren. Denken wir hier an diverse Grauzonen in der Gesellschaft. Ein grauer Arbeitsmarkt lässt Arbeitslosigkeit nicht ganz so bitter erscheinen, oder fehlerhafte Funktionen bewegen zur Sanierung von Systemlücken. Immerhin verdanken wir diesen Einsichten, dass wir ein befriedigenderes System errichten müssen, das dann in der Form einer Verfassung Gesellschaft und Staat sinnvoll aneinander bindet. Sehr oft verursacht das Auftreten von fehlerhaften Funktionen im politischen System eine höchst paradoxe Wirkung. Gemeinhin wird geglaubt, dass Revolutionen oder Rebellionen einen tiefen Wandel der Gesellschaft und damit auch der politischen Ordnung bewirken. In der soziologischen Betrachtung kann man aber das Gegenteil feststellen: Letztlich war die Folge der französischen Revolution ein „aufgeklärter Absolutismus“ Napoleons und das Direktorium, das vormals revolutionäre Regierungsteam, wandelte sich zu einem bonapartistischen Kaiserreich. Die veränderten politischen Funktionen wirkten im Grunde „konservierend“ auf das System ein. Eine andere Antwort war von den anderen europäischen Staaten gegeben worden: Aus dem „aufgeklärten Absolutismus“ wurde eine politische Mischung zwischen Historismus und Romantik. Natürlich sprach man in der Zeit zwischen 1810 und 1830 von einer „Reaktion“, die sich in „Restaurationen“ äußerte. Eine ähnliche Paradoxie war auch die Folge der russischen Oktoberrevolution 1917. Nach dem Intermezzo einer Befreiung und politischen Liberalität siegte die Despotie Stalins. Im Rückblick fällt es relativ leicht, den einzelnen Phänomenen des sozialen und politischen Wandels spezielle Funktionen zuzuordnen. Der Soziologe hat es schwerer, da von ihm eine ähnliche Analyse für seine 7 Gegenwartsgesellschaft erwartet wird. Daher hat Robert Merton zwischen „manifesten“ und „latenten“ Funktionen unterschieden. Diese kann man gemäß der Wirkung und Konstruktion von Institutionen untersuchen. „Latente Funktionen“ äußern sich etwa als „Geist der Reform“, in der Bereitschaft der politischen Elite - oder „Klasse“, über Traditionen die soziale Ordnung zu erneuern. „Manifeste Funktionen“ hingegen stärken wegen ihrer Zuverlässigkeit und Dauer die sozialen Institutionen, so etwa das Rechtssystem in einer Gesellschaft oder die gesellschaftliche Position einer Kirche. Sie widerstehen dem Wandel der Zeit und scheinen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung „über der Zeit“ zu stehen. (Vgl. dazu Robert Merton, Manifest and latent functions; in: ders., Social Theory and Social Practice, New York 1968, S. 19-82) Wie hier zu sehen ist, haben die Analysen Mertons eine erhebliche politische Bedeutung. Aus seiner funktionalistischen Betrachtung kann man wesentliche soziologisch relevante Faktoren erkennen. Über diese können die gesellschaftlich relevanten Zustände beschrieben werden - so etwa „soziales Gleichgewicht, „Integration“, „Konsens“ oder „soziale Kohäsion“. Natürlich muss man sich stets vor Augen halten, dass es sich bei diesen Begriffen um „Abstraktionen“ handelt, die nicht nur eine soziale Realität zu definieren wünschen, sondern über die die Soziologie selbst ihre Reputation als Wissenschaft empfängt. Diese Abstraktionen sollen nicht die „Funktion“ erfüllen, auf die Menschen in der Gesellschaft zu vergessen. So angenehm es auch scheinen mag, „soziale Mechanismen“ darzustellen, so muss man dennoch berücksichtigen, dass die Menschen keineswegs „naiv“ oder gar „unbewusst“ ihre Ziele verfolgen. Sie können nicht nur ihre Situation und Lage beurteilen, sondern versuchen diese auch zu gestalten. Sie sind keine „Handlanger“ abstrakter sozialer Prozesse oder nur Teile von Funktionsabläufen. Diese Einsicht scheint die Wissenschaftlichkeit der Soziologie fast in Frage zu stellen. Die Menschen sind nicht Erfüllungsgehilfen theoretischer Konstruktionen der Soziologie. Sie können eben planen und steuern. Die Soziologie vermag diese Intentionen zwar dadurch beschreiben, dass sie die Abläufe, Bedingungen, Vollzüge und Ziele untersucht, aber muss sich nach einem streng theoretischen Konzept orientieren. Der Historiker beschreibt vorerst die Funktion „handelnder Personen“, fragt nach dem Grund von Überzeugungen und Zielvorstellungen und scheint daher weniger Probleme mit seiner Theorie der Geschichte zu haben. Der Soziologe muss seinen Gegenstand gleichsam über die Metaphorik seiner theoretischen Modelle bestimmen, um die Befindlichkeit, die Entwicklung oder den Wandel der Gesamtgesellschaft zu interpretieren. (Vgl. Peter Burke, Sociology and History, London 1980; in der dt. Fassung S. 60.) 8 Um nochmals Struktur und System zu unterscheiden, so war der Hinweis auf die Architektur sehr bildhaft. Im Anschluss daran kann man eine spezielle Ordnung darin erkennen, wenn System und Struktur einen eigenen Baustil bewirken. Die Struktur sorgt für die Organisation der Räume, während die Systeme in die Raumkonstruktion eingreifen und sogar die Stabilität der Räume garantieren. Die Struktur sieht für die Innenräume des Gebäudes manifeste Funktionen vor, während das System den latenten Funktionen einigen „Spielraum“ erlaubt. Überträgt man diese Interpretation auf eine politische Ordnung, so veranschaulicht die „Strukturanalyse“ der Soziologie, dass der Bauplan einer Gesellschaft nachhaltig von deren Kultur abgeleitet ist und kann in der Systemanalyse die sichtbaren Folgen struktureller Vorgaben untersuchen. Wenn also in der Geschichte der Baukunst erwähnt wird, dass große Gebäude einstürzten, so kann daraus der Schluss gezogen werden, dass die Struktur des Planes an das System Anforderungen stellte, die es offensichtlich nicht erfüllen konnte. Also können Gebäude schon während ihrer Errichtung Ruinen bleiben. Ähnliches kann auch Gesellschaften passieren. Geläufig ist ja, dass etwa „Modernisierungen“ von Strukturen nicht bewältigt werden, weshalb Systeme nicht haltbar sind. Die funktionalistische Theorie hat daher die Debatte über die Erfordernisse einer „stabilen“ Gesellschaft auf neuer Ebene fortgesetzt, die Auguste Comte mit seinen Überlegungen zu sozialer Statik und Dynamik eröffnet hatte. Dass in diesem theoretischen Konzept das Interesse an sozialem Gleichgewicht bevorzugt wird, darf nicht überraschen, da gerade angesichts der Prozesse sozialen Wandels ein instabiler Gegenstand hier Gesellschaft - nur schwer untersucht werden kann. Dieses Eigeninteresse einer soziologischen Theorie formuliert auf der anderen Seite die wichtige Einsicht, dass Gesellschaften sich nicht ausschließlich in Prozessen von Modernisierung, Wandel, Dynamik oder Fortschritt befinden können, sondern in gleichem Maß auch Stabilität, Homogenität und Dauerhaftigkeit sozialer Institutionen benötigen. Diese Darstellung ist unter anderem der Nachweis, dass diese Terminologien nicht nur der Soziologie wissenschaftliche Kompetenz verliehen, sondern auch den Zweck besaßen, Gesellschaften zu stabilisieren, wenn etwa die Funktionsäquivalente gestört erscheinen. Die Entwicklung der Soziologie begleitet daher speziell nach 1918, nach dem 1. Weltkrieg in Europa, den Gegensatz zwischen Reform und Revolution. Gemäß ihrer Begriffsinstrumentarien plädierte sie daher teils für sozialphilosophisch-ideologische Positionen, teils für einen sozialen Realismus, dessen Elan für Reformen sehr bald durch historischempirische Methoden unterstützt wurde. Es war die Voraussetzung für den Erfolg der Sozialwissenschaften in den USA ab 1930. Mit diesem Zuschnitt konnte die Soziologie eine „erkenntnisleitende“ und fundierende 9 Wissenschaft werden und war ein Teil der US-amerikanischen „Weltmission“ nach 1945, in der soziologisches Orientierungswissen ein neues Verständnis für Politik, Ökonomie und für Gesellschaft verbreitete. Soziologie wurde eine erfolgreiche Wissenschaft, wie es die Karriere der beiden Begriffe „Struktur und „System“ zeigen. Soziale Rolle Wenn von der Aussage ausgegangen wurde, Soziologie sei im 20. Jahrhundert die wichtigste Produzentin von Weltbildern gewesen, dann stellt sich sofort die Frage, über welche Sammelbegriffe soziale Phänomene bezeichnet wurden. Wenn diese Wissenschaft diese Bedeutung besaß, dann mussten rasch soziale „Spezialitäten“ erforscht werden, deren Ursachen und Wirkungen von den Soziologen zu erklären waren. Damit war das Versprechen verbunden, ein Wissen über diese speziellen Erscheinungen in der Gesellschaft könne das Fundament für Verbesserungen, Änderungen oder brauchbare Analysen sein. Die Umsetzung von „Gesellschaftswissen“ in praktische Handlungsanweisungen war seit dem 19. Jahrhundert eine deutliche Forderung an die Pioniere dieser Wissenschaft. Zu fragen war nach jenen Faktoren, die einerseits die „Vergesellschaftung“ der Individuen bewirken, andererseits zu untersuchen, ob es verbindliche Normen oder Regeln gibt, die die Individuen in ihre Gesellschaft integrieren. Diese Suche war sehr erfolgreich. Sie ging davon aus, dass Menschen nicht nur „soziale Lebewesen“ sind, sondern auch deren biologische „Ausstattung“ zwingt sie zur „Geselligkeit“. Wegen der engen Beziehungsformen, deren Ursprung in der Familie gesehen wurde, sah man in ihnen die Voraussetzung für die Aneignung sozialer Eigenschaften. In Sippenverbänden, Verwandtschaften und Familien finden also Sozialisationen statt, mit deren Hilfe der Mensch die ersten Schritte in seine soziale Umwelt unternimmt. Und das war gewiss schon vor der Antike der Fall. Es lag auf der Hand, dass hier Ethnologen den Soziologen wichtiges Beweismaterial lieferten. Und die Psychologie verstärkte diese Vermutungen. Diese schrittweise Integration in die soziale Umwelt ermuntern die Individuen zu „sozialem Handeln“. Dass diese Schritte besonders untersucht wurden, war für die Entwicklung der Soziologie wichtig. Das erste Ergebnis war, dass die soziale „Binnenstruktur“ die Familie ist, was weitere Schlüsse zuließ: Der eine mündete in die Hypothese, dass hier soziales Verhalten erlernt wird. Die andere Schlussfolgerung enthielt die Überzeugung, eine ideale Familie verbessert die „Soziabilität“ der künftigen Mitglieder der Gesellschaft. Nebenbei ist darin zu erkennen, dass die Soziologie immer mit dem 10 Problem behaftet ist, dass ihre Analysen oft von sozialphilosophischen, ideologischen und gesellschaftspolitischen Positionen begleitet wird. Seit der Romantik ist ja die Familie als „Sozialisationsagentur“ geläufig und wurde als Keimzelle von Gesellschaft und Staat ausgegeben. Die Familie schließt mit ihrer Exklusivität Intimität ein, Arbeitsteiligkeit gemäß der Geschlechtsrollen und dafür boten die Ethnologen reiches Anschauungsmaterial. Historiker beschrieben die Geschichte der Familie im Wandel und die Soziologen wurden darauf aufmerksam gemacht, dass Familien in den beiden Sphären von Öffentlichkeit und Privatheit gleichzeitig agieren. Es waren Einsichten, die Soziologen annehmen ließen, dass es nicht nur innerhalb der Familie soziale Rollen gibt. Mit Hilfe dieser Rollen konnten die komplexen Beziehungsformen dargestellt werden, die nun nicht auf die Familie beschränkt sind. Im Grunde hat man mit diesem theoretischen Zugang eine „soziale Grammatik“ anfertigen können. Rollen können also wie die Sprache zur Verständigung beitragen, gleichzeitig die täglichen Aufgaben verteilen und durch Routine die Organisation der Pflichten vereinfachen, ohne dass darunter die Qualität sozialer Beziehung leidet. Die Idee, soziale Rollen lassen die Gepflogenheiten in der Gesellschaft in realem Licht erscheinen, war natürlich dem Theater entnommen worden. Man war natürlich noch weit davon entfernt anzunehmen, dass das Leben ein ähnliches Rollenspiel fordert wie im Theater, aber man konnte erklären, wie soziale Situationen Personen vereinigen können, wenn sie diese „soziale Grammatik“ beherrschen, um sich in diesem „Zeit-Raum“ bewegen zu können. Über Rollen wurden die festen Regeln und verbindlichen Normen erkennbar. Sie scheinen insgesamt das Alltagsleben in der Gesellschaft regeln zu können. Ein Kind darf eben wie ein Kind sein, entspricht den Erwartungen, die Erwachsene gegenüber einem Kind haben; das Kind muss aber auch zu erkennen geben, von Jahr zu Jahr die Formen der Höflichkeit oder basale Kenntnisse aus der Schule immer besser zu beherrschen. (Vgl. dazu Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, New York 1958) Erving Goffman zeigte, dass nun ein Individuum über viele verschiedene Rollen verfügt, sei es als Mutter, im Berufsleben, als Tochter, Ehefrau, oder als Konsumentin im Warenhaus. Die Kenntnis dieser Rollen vereinfacht die Auswahl aus den Verhaltensvarianten. Diese werden durch die Art der sozialen Situation einerseits bestimmt, andererseits hat das Individuum eine gewisse Wahlfreiheit darin, wenn es mehr als nur die entsprechende Rolle gemäß der Situation zu „spielen“ beabsichtigt. Diese proportionalen Entsprechungen können wirklich einiges Licht in das „Funktionieren“ gesellschaftlichen Lebens bringen. Es ist auch möglich, damit angepasstes und unangepasstes Verhalten zu messen 11 und warum es vielleicht auch zum Bruch innerhalb erwarteten Verhaltens kommt. Es werden eben an Inhaber von Rollen Erwartungen gerichtet, die die Erfüllung erschweren. Sollte ein Arzt gegenüber einem Patienten zugeben, dessen Krankheit nicht angeben zu können, wird er zwar die Tugend der Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit verkörpern, aber beim Patienten Unverständnis ernten. Zur zugeschriebenen Rolle des Arztes gehört ja auch die allgemeine Kenntnis von Krankheitsursachen. Unter diesem Rollendruck könnte der Arzt vielleicht zur Lüge Zuflucht nehmen. Die Rollentheorie beschreibt, wie geschickt die Inhaber der Rollen agieren müssen, wollen sie ihre soziale Kompetenz behalten. Freilich können die sozialen Rollen nicht nur von den Individuen selbst bestimmt werden. Teilweise merken sie nicht, dass sie ihre Rollen „internalisiert“ haben gemäß traditioneller Regeln oder sozialer Normen. Diese wurden von der sozialen Umwelt definiert. Im Allgemeinen erfahren diese Normen ihre Verwirklichung im gelungenen „Rollenspiel“. Und zu diesem Spiel gehören Gesten und Posen, Haltungen und Fähigkeiten zur glaubwürdigen Selbstdarstellung, ja sogar spezielle Bekleidungen. Dennoch entscheiden über die angemessene Ausübung der Rolle soziale Normen, die zu genau bestimmten, sogar auch vorherbestimmten Zeitpunkten über Reife, Schuleintritt, Wahlalter entscheiden und weshalb man auch von den „Kandidaten“ ein angemessenes Rollenverhalten voraussetzt. Peter Lloyd beschrieb, wie schwierig es für den König der Yoruba in Nigeria war, sich einerseits gegenüber den anderen Häuptlingen durchzusetzen, andererseits gegenüber den hochgestellten Beratern die Rolle des kompromissbereiten „Kollegen“ zu spielen. (Peter Lloyd, Conflict Theory and Yoruba Kingdoms; in; I.M. Lewis, History and Social Anthropology, London 1968, S. 25-58) Die Vorteile der Rollentheorie liegen dort, wo die Reziprozität der Individuen eine Darstellung erfährt, unter welchen Bedingungen diese „Verknüpfungen“ möglich sind und haltbar. Ferner bietet sie einen guten Einblick in die herrschenden Normen und Regeln der Gesellschaft und inwieweit diese das „Rollenspiel“ direkt oder indirekt dirigieren. In weiterer Folge haben die Analysen gezeigt, dass Ämter und Würden ein adäquates Rollenverständnis voraussetzen. dass dann soziale Schichten, Ungleichheit, berufliche Dispositionen und soziale Ränge gut Die Strukturen des Alltags können entschlüsselt werden. Dennoch ist die Kritik an der Rollentheorie nicht verstummt. Sie wendet ein, aus der Mikroskopie zwischenmenschlichen Verhaltens und Handelns könne man nur sehr bedingte Schlüsse auf die Gesamtgesellschaft ziehen. Es sei nicht sicher, ob aus Alltags- und Gruppenverhalten in sozialen 12 Situationen Schlüsse in ausreichendem „Gesamtgesellschaft“ gezogen werden können. Maß auf die Sozialisation, soziale Kontrolle und abweichendes Verhalten Bereits in der Rollentheorie kommen Rezeptionen aus den Methoden der Psychologie und Sozialpsychologie zur Geltung. Anders hätte man Anpassungsleistung, soziale Reife, soziale Kompetenz nicht messen können. Wie bereits erwähnt, war die Soziologie - vor allem ihr konservativer Flügel im 19. Jahrhundert - davon ausgegangen, dass Gesellschaft von der Familie konstituiert wird und sie die erste „Sozialisationsagentur“ für die heranwachsenden Menschen ist. In ihr werden Verhaltensweisen erlernt, in ihr die sozialen Normen erfahren und sie ist eben der „soziale Mikrokosmos“, in dem das gesamte Repertoire des Sozialen enthalten ist. Ohne nun zu entscheiden, welcher Typus von Familie in der Geschichte der Zivilisation ausgebildet wurde, in ihr findet oder fand der Start der jeweils kommenden Generation in Gesellschaft, Beruf und Kultur statt. Natürlich gibt es nach der sogenannten industriellen Gesellschaft keine „Haushaltsfamilie“ mehr, die früher mehrere Generationen umfasste und vor allem im bäuerlichen Milieu lange erhalten blieb, aber auch die städtische „Kernfamilie“ sieht heute anders aus als noch vor 30 Jahren. Die Annahme wird richtig sein, dass kein soziales System existieren könnte, hätte keine Sozialisation stattgefunden. So sind sich die meisten Theorien darin einig, dass Familie, Erziehung und Schule die Weichen zum „geselligen“ Leben in der Gesellschaft stellen. Selbst die jeweils „andere“ Art von Jugend, über die die „Welt“ der Erwachsenen regelmäßig bestürzt ist, kann es nur geben, da die Übernahme von Normen, Werten und Rollen einerseits vollzogen wurde, andererseits eine aus der Pubertät bekannte Kritik, Ablehnung oder Alternative entwickelt wird, die vorwiegend in den Jugendgruppen eine eigene „Kultur“ bilden. So spricht man von der Ablöse der Sozialisationen, von der primären in der Familie, von der sekundären in der Schule etc.. (Vgl. dazu G. Schochet, Patriarchalism in Political Thought, Oxford 1975) Nun muss man einen Gedanken berücksichtigen, der viel zu wenig diskutiert wird. Sowohl die Rollen-, wie auch die Sozialisationstheorie sind sehr gute Ansätze, um die Formen des Sozialen darzustellen, zu analysieren und kritisch zu prüfen, ob sie auch in Zukunft die Ansprüche kommender Gesellschaft erfüllen können. Beide Theorien sind so gute Modelle, dass man dazu verführt werden kann, den gesamten Bereich einer Gesellschaft damit zu erklären. Es ist daher immer sinnvoll, sich zu 13 fragen, was spezielle Theorien nicht erklären. Es entspricht einer korrekten Anwendung einer Theorie, auch über ihre Grenzen nachzudenken. In unserem Fall erklärt etwa die Sozialisationstheorie nicht, wieso Normen oder soziale Werte in Teilen der Gesellschaft keine oder nur geringe Anerkennung finden, ohne dass damit aber die soziale Stabilität verloren geht. So kann man behaupten, dass viele soziologische Befunde ihre Haltbarkeit und ihre Glaubwürdigkeit dem Umstand verdanken, ihre Prognose bei gesellschaftlichem „Schönwetter“ erstellt zu haben. Das ist noch kein Mangel, wird aber keine Hilfe sein, will man eine Gesellschaft in der Krise beschreiben wollen. Nach Meinung von Pierre Bourdieu setzt man bei vielen soziologischen Analysen ein viel zu hohes Maß an gesellschaftlichem „Konsens“ voraus. Bourdieu behauptete hingegen, die Übertragung sozialer Normen durch Sozialisation zeige weit häufiger Konflikte. Die Geltung der Normen sei von der Klassenzugehörigkeit der Individuen abhängig und deren Anerkennung kann wegen einer hierarchisch geordneten Gesellschaft - Stichwort „soziale Ungleichheit“ - erzwungen werden. Das heißt, die Normen sind in der nächsten Generation keine traditionelle Gewohnheit, sind also bei weitem weniger „internalisiert“ als noch zuvor, sondern sind durch eine „kulturelle Reproduktion“ im Erziehungs- und Sozialisationsprozess vermittelt worden. Bourdieu ordnet dieses Ergebnis der Wirkung der Schule und des Militärdienstes zu. Dabei ist es gar nicht leicht, der nächsten Generation diese Werthaltungen „beizubringen“. Während dieser Vorgänge der sekundären oder tertiären Sozialisation geben Schule oder Militär vor, die Gesellschaft sei in einem dauerhaften Gleichgewicht und es soll auch nach Möglichkeit erhalten bleiben. So gehen etwa diese beiden Institutionen von dieser „Illusion“ aus, um die Bedeutung von Kontinuität, Tradition und Weltanschauung beizubehalten. Nebenbei erwähnt, bietet diese Einsicht von Bourdieu eine gute Erklärung dafür, warum jede politische Richtung, Partei oder sogar der Staat in erster Linie seine Aufmerksamkeit auf Schul- und Bildungsreformen lenkt. Bourdieu ist weiters der Auffassung, dass die Inhalte der „kulturellen Reproduktion“ so beschaffen sind, um der nächsten Generation ein Repertoire von Praktiken zu vermitteln, die in den vielen Situationen und Konstellationen der Gesellschaft eine nützliche Anwendung erfahren können. Weiters beschreibt er mit dem „Habitus“, also wie sich Menschen in sozialen Situation geben, verhalten und handeln, dass dieser durch „soziales Lernen“ erworben und aus den Durchmischungen von Kenntnissen aus Alltag, Wissenschaft, Berufserfahrung und Schichtzugehörigkeit gebildet wird. Alle diese Eigenschaften erwerben sich die Individuen unter „Zwang“, Druck und nötiger Anpassung. Und 14 wirklich scheint es eine realistische Annahme zu sein, denn keine Gesellschaft wird auf diese Sozialisationen verzichten können. Somit stehen wir vor zwei soziologischen Einsichten: Die erste lautet, dass Gesellschaft samt ihren Institutionen auf klar definierten „Feldern“, also innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche erfolgreich sein muss. Dieser Umstand erlaubt eine empirische Untersuchung. Für Bourdieu sind diese „Felder“ ein gut definierbarer Gegenstand. Die zweite Einsicht besagt, dass zur Gesellschaft auch „Nicht-Felder“, „Leerräume“ gehören, die je nach politischer, ökonomischer oder kultureller Lage eine überraschende Wirksamkeit gewinnen können. So können die „Felder“ unter dem Druck der Forderung nach Gleichheit - bislang ein politischer Leerraum - eine Veränderung erfahren. Es ist nicht sicher, dass mit der Erfüllung des Gleichheitsgrundsatzes die soziale Homogenität erhalten bleibt. So ist das soziale Gleichgewicht stets labil, denn nur der Kompromiss zwischen der Tradition dominanter „Felder“, den herrschenden Institutionen und den nachrückenden „Subkulturen“ stützt dieses „Gleichgewichtssystem“. Diese Überlegung bewog die Soziologie, sich auch den Randgruppen und „Subkulturen“ in einer Gesellschaft zu widmen. Hier sollten die „Binnenstrukturen“ analysiert werden, aus denen die schwerer zu erforschende „Gesamtgesellschaft“ zusammengesetzt ist und zugleich kann in diesem Verfahren auch der soziale Wandel sichtbar gemacht werden. In logischer Konsequenz kann man bei diesem Ansatz erkennen, dass sich die Soziologie zur Wissenschaft der Demokratie entwickelte, oder sogar von sich behauptete, eine demokratische Wissenschaft zu sein. Dieser Interpretation ist allerdings Bourdieu nicht gefolgt. Er konzentrierte sich auf die Analyse und Darstellung der „herrschenden Klasse“, die es weiterhin gibt, auch wenn sie nach dem Ende von Feudalismus andere Merkmale aufweist. Die in der Gegenwart herrschende Klasse zwinge durch „symbolische Gewalt“ ihre Kultur den Beherrschten auf, bestimme die Normen, Werte und den Habitus, die die Beherrschten anerkennen. So erscheint die „Kultur“ der herrschenden Klasse als legitim, während eine „Subkultur“ für illegitim gehalten wird. Dafür kann man ein simples Beispiel geben. Jeder hat schon die „unangenehme“ Situation erlebt, am ersten Morgen nach einer Nächtigung im Hotel nicht zu wissen, wie die Usancen des Frühstücks sind. Er weiß nicht, welcher Platz für ihn vorgesehen ist, wie die Praxis des Bestellens ist oder in welcher Reihenfolge er sich am Buffet anstellen soll. Er trifft auf andere Hotelgäste, die für den neuen Gast die „Hausordnung“ verkörpern, die ihn auch fühlen lassen, im Grunde fremd zu sein und die Schwierigkeit der Anpassung wird mit strafenden Blicken verfolgt. Sollte er am nächsten Tag sich wieder beim Frühstück einfinden, kann er bereits mit „seinem“ Platz rechnen, kennt die 15 Gebräuche und kann es sogar wagen, mit anderen, freundlicheren Hotelgästen ein Gespräch über das Wetter zu beginnen. In diesem Fall ist er integriert und es kann sein, dass er dem nächsten neuen Hotelgast mit dem ähnlich abweisenden Habitus begegnet, den er tags zuvor noch am eigenen Leib erfahren musste. Natürlich hinken Beispiele immer. Sie wollen aber das Problem veranschaulichen, dass in einer sozialen Situation unser Hotelgast sich eher anzupassen wünscht. Sollte er ein sehr bekannter Künstler sein, der selbstbewusst handelt und diese informellen Regeln beim Frühstück missachtet, kann es sein, dass eher die anderen Akteure dieses Verhalten zu akzeptieren haben. Sie tun es auch, denn unser Künstler wird eindeutig einer höheren Schichtzugehörigkeit zugeordnet. Nun ist die Soziologie bei der Beschreibung solcher Phänomene nicht stehen geblieben. Es ist ja auch die Sprache, die einen Beitrag zur Sozialisation leistet. Basil Bernstein meinte, dass durch „elaborierte“ und „restringierte“ Sprachcodes soziale Integration erzielt wird. (Basil Bernstein, Social Class, Language and Socialisation; in: Class, Codes and Control, Bd. I., London 1970, S. 170-178) Darunter ist zu verstehen, dass Sprache dann „elaboriert“ angewendet wird, um den Zweck eines sinnvollen Dialogs oder der Information zu erfüllen. Will ich meine Mitteilungen speziell an eine Person richten und beabsichtige, dass nur diese Person mich versteht, werde ich einen „restringierten“ Sprachcode verwenden. Bleiben wir beim Beispiel unseres Hotelgastes. Er wird, so er bereits mit anderen Hotelgästen ins Gespräch kam, Sätze mit allgemein verbindlichem Inhalt sprechen. Er wird mit der rhetorischen Frage beginnen, ob man auch hier auf Urlaub ist und gestern das gute Wetter ebenfalls nützte? Er wird das Gespräch nicht damit eröffnen, dass er sich als „Republikaner“ und Gegner der Abtreibung vorstellt. Politische Parteien haben zum Beispiel während des Wahlkampfes eine „elaborierte“ Sprache zu verwenden, da sie viele Menschen „ansprechen“ wollen - daher auch Interviews, Artikel und Reden. Kaum wieder in der Parteizentrale wird der „restringierte“ Code benutzt - im Sinne von „Parteilinie“. Ein besseres Beispiel für die soziologische Bedeutung der Sprache ist bereits in der Bibel zu lesen. Auf der einen Seite bot Moses eine „revolutionäre“ Glaubensüberzeugung, auf der anderen Seite musste er diese bei den Stämmen Israels durchsetzen. Die Codierung der neuen Normen im Dekalog, hier ein restringierter Code, bedurfte der „Elaboration“ durch weitere historisch-religiöse Entscheidungen. Dass dieses Anliegen zuerst fehlschlug, zeigt die Tatsache an, dass der Tanz ums goldene Kalb auf größere Zustimmung stieß. 16 Dieses Ereignis berührt ein weiteres Thema der Soziologie. Warum befolgten die Stämme Israels nicht das Glaubenszeugnis des Moses? Warum verletzten Menschen bereits akzeptierte soziale Normen und warum brechen sie dieses Vertrauensverhältnis zu Moses? Das ist immerhin für die Soziologie eine brisante Frage. Sie hat sie zunächst damit beantwortet, dass sie abweichendes Verhalten als ein Faktum sieht. Der Begriff „abweichendes Verhalten“ hilft der Soziologie, jenen Konflikt zu beschreiben, der eine Gruppe aus der Gesellschaft herauslöst. Abweichungen zu erforschen ist deshalb wichtig, weil in ihnen eine „Negation“ des sozialen Konsens vorliegt. Die Dramatik dieser soziologischen Erkenntnis ist dadurch begründet, dass eine Reziprozität zwischen Gesellschaft und dem abgelehnten kriminellen Verhalten konstatiert wird. Damit werden die geltenden sozialen „Werte“ sichtbar, andererseits zeigen die veränderten Sanktionen gegen Kriminalität den Bedeutungswandel dieser Werte an. So argumentiert der „Soziologe“, dass wegen der Bedeutung körperlicher Arbeit in der Phase der Industrialisierung die Körperstrafen abgeschafft wurden. Diese funktionalistische Interpretation wurde auch auf die Ablehnung oder Akzeptanz von Geisteskranken in der Gesellschaft angewendet. So kann man auch den paradoxen Umstand erklären, dass in der neu gebildeten „Öffentlichkeit“ in der Aufklärung im 18. Jahrhundert der Geisteskranke gleichzeitig interniert wurde und sein Dasein im neuen Irrenhaus fristen musste. So hat die Aufklärung den Geisteskranken nicht mehr als eine „Sonderform“ von „Geist“ angesehen, billigte ihm nicht mehr eine Qualität zu, die ihn einem Heiligen ähnlich erscheinen ließ, sondern nun war er abnorm, unangepasst und daher in eine Anstalt einzuweisen. Die Aufklärung produzierte eine sehr verbindliche Norm für Normalität. Und es war die Soziologie, die deutlich vor Augen führte, unter welchen Bedingungen ein soziales Gleichgewicht erkauft wird. (Vgl. Michel Foucault, folie et deraison, Paris 1961) In diesem Zusammenhang hat Michel Foucault eine spezielle Methode entwickelt, nämlich im „Diskurs“ diese merkwürdige Entsprechung zwischen Modernisierung und Inhumanität aufzudecken, die über Stigmatisierung, Institutionalisierung und Verdrängung erzielt wurde. Kehrt man zum abweichenden Verhalten zurück, so kann man eine Gegenfrage formulieren, ob nämlich zur Stabilität der Gesellschaft nicht jeweils ein Außenseiter, ein Fremder oder Behinderter, eben ein Sündenbock gesucht wird? So bei diesem Vorgang zugleich auch Regeln entwickelt werden, so vermögen sie relativ schnell Menschen zu Gesetzesbrecher zu machen. Dafür ist die fast willkürliche Eingrenzung des Weidegebietes in den USA ein gutes Beispiel. Mit dem Landerwerb durch europäische Zuwanderer, mit der Absperrung und Umzäunung 17 wurden die Ureinwohner der USA zu Gesetzesbrechern. Sie verstießen als Nomaden grundsätzlich gegen Besitzrechte, die aus Europa importiert wurden. (Vgl. Howard Becker, Outsiders, New York 1963) Die Konzentration auf dieses Thema verursachte in der Soziologie sehr schnell die rege Debatte über den Gegensatz zwischen Abweichung und Anpassung. Für das Fach selbst war es schwierig, eine Position zu beziehen. Man muss doch mit einiger Ironie festhalten, dass diese junge Wissenschaft, die sich geraume Zeit als nonkonformistisch einschätzte, von wissenschaftlichen Außenseitern oder Schriftstellern entworfen wurde, nun im 20. Jahrhundert als Lenkungswissenschaft galt und sehr eingehend das Dilemma zwischen Abweichung und Anpassung, sozialer Kontrolle und berechtigten Individualismus diskutierte. Da war natürlich die Erfindung des Begriffes „soziale Kontrolle“ das Pendant zum älteren Begriff der „öffentlichen Meinung“. Man fand heraus, dass es sogenannte „ungeschriebene Gesetze“ gibt, die in Gemeinschaften eingehalten werden. Und mit sozialer Kontrolle war gemeint, dass die Beachtung informeller Regeln durchgesetzt wird, und dies umso mehr, je deutlicher die Formen menschlichen Zusammenlebens gemeinschaftliche Merkmale besitzen. Auf diesen Unterschied zur Gesellschaft hat schon Ferdinand Toennies hingewiesen, der gerade für mitteleuropäische Bevölkerungen das Bestehen von Gemeinschaften diagnostizierte, obwohl diese gleichzeitig auch Gesellschaften waren. Es lag auf der Hand, dass Gemeinschaften eine stärkere soziale Kontrolle ausüben, das kennt man aus dem Leben am Dorf im Unterschied zum städtischen Leben. Das heißt, Nonkonformisten könnten in Gesellschaften ein „leichteres“ Leben führen. Natürlich trifft dies nur in Grenzen zu. Die Diskussion fortzusetzen, würde bedeuten, dass natürlich auch Gesellschaften mit „ihrer“ sozialen Kontrolle beginnen, sollte die Zahl von „Nonkonformisten“ steigen, freilich mit allen Varianten von Diskriminierung und Vorurteilen. Sollten die Nonkonformisten aber eine Künstlerkolonie sein wie am Pariser Montmartre, das Fernsehen häufig Berichte über deren Bedeutung senden, würden diese Nonkonformisten bald eine breite Akzeptanz erfahren. Stets ist aber die Akzeptanz von Außenseitern davon abhängig, zu welcher sozialen Schicht oder Gruppe sie hinzugezählt werden. Hier hat es eine Gemeinschaft mit deren Integration schwerer als eine Gesellschaft. Das hatte Toennies ausführlich behandelt. Am Begriff der sozialen Kontrolle kann man erkennen, dass er zwar sehr plausibel zu sein scheint, aber kaum innerhalb gesellschaftlicher Phänomene diskutiert, entpuppt er sich als außerordentlich schillernd. Vielleicht hilft hier ein Beispiel aus der Chemie. Wir wissen, dass Sauerstoff in hoher Konzentration giftig ist, sollte4 er fehlen, ist das 18 Leben gefährdet. Als Teil komplexer Gas-Verbindungen ist er unverzichtbar. So ähnlich haben auch Soziologen das Phänomen sozialer Kontrolle zu sehen, vor allem, wenn sie mit einem angeblich klaren Begriff ein höchst unklares Feld ihrer Wissenschaft zu definieren beginnen. An sich ist es kein Malheur, vor solchen Problemen zu stehen, unglücklich wird nur jener Soziologe sein, der einerseits meint, Erscheinungsbilder der Gesellschaft eindeutig identifizieren zu können, andererseits seine Ergebnisse mit Bewertung versieht, die eine sehr starke ideologische Bindung verraten. Da wird er häufig enttäuscht werden, dass sich die soziale Wirklichkeit nicht nach seinen „Vorstellungen“ richtet. Dennoch wollen wir die Geschichte positiv enden lassen. Vermutlich können wir abweichendes Verhalten oder soziale Kontrolle recht ordentlich erklären und die Bedingungen, die dazu führten, aufdecken. Das weit größere Problem für den Soziologen liegt dort, worüber er sich weit seltener den Kopf zerbricht: Warum gibt es in der bisherigen Geschichte eine offenbar nur schwer zu begründende Humanität? Soziale Klasse, Soziale Schichtung Seit der Antike waren Steuerleistung und Militärdienst die Merkmale sozialer Differenzierung. Daraus ergab sich eine Hierarchie, weit besser bekannt unter den Stichworten, dass es in der Gesellschaft eben ein „oben“ und „unten“ gibt. Eigentlich hätten die Soziologen für dieses Ergebnis der Geschichte dankbar zu sein, denn so besaßen sie in den sichtbaren Klassenstrukturen hervorragende Beispiele ihrer Analysen. Offensichtlich gibt es im Zusammenleben der Menschen einen „Automatismus“, der einerseits umgehend für eine Herrschaftsordnung sorgt, andererseits für unterscheidbare Zugehörigkeiten zu Klassen oder Schichten. Die Geschichte „lehrte“ aber auch, dass diese „Automatismen“ widerrufen werden können. Es scheint ein „Gesellschaftsspiel“ zu geben, in dem soziale Positionen von Klassen oder Schichten getauscht werden. In Revolutionen war das regelmäßig zu beobachten. Es war aber auch der Ansatz verschiedener Utopien, die einerseits vom Grundsatz der Gleichheit ausgehend, der herrschenden „vertikalen“ Sozialordnung eine „horizontale“ gegenüberstellten, andererseits wurden auch Visionen formuliert, die überhaupt Herrschaftsordnungen beseitigen wollten. Der Begriff „Klasse“ war für die Soziologen im 19. Jahrhundert unentbehrlich. Damit konnten sie die soziale Ungleichheit benennen und 19 wiesen dies in der Verteilung von Einkommen, sozialem Status der Individuen und Machtpositionen nach. Mit diesem Begriff war zwar noch nicht der Zusammenhalt einer Klasse zu erklären, aber mit der Politisierung dieses Begriffes hatte die bürgerliche Gesellschaft eine Chance erhalten, ihre Ziele gegenüber dem sogenannten „ancien regime“ durchzusetzen. Das war für die Soziologie deshalb von Bedeutung, da sie dadurch die Einsicht in den Bauplan sozialer Systeme erhielt. Bald sprach man von einer „Gesellschaftspyramide“, von Bedingungen sozialen Aufstiegs und von sozialer Mobilität. Die bürgerliche Revolution von1848 in Europa hatte diese Ansprüche auf eine neue Gesellschaftsordnung erhoben, schrittweise auch durchgesetzt. Auf der Strecke blieb aber jene „Klasse“, die am Beginn des 19. Jahrhunderts als Proletariat bezeichnet wurde. So musste man feststellen, dass der neue Typus in der bürgerlichen Gesellschaft der „Kapitalist“ war, dem Adel die alte Position in der Gesellschaft streitig machte, doch insgesamt war eine bisher unbekannte Mischung in der Gesellschaft eingetreten. Eine Reihe politischer und ökonomischer Entwicklungen, ebenso der 1. Weltkrieg bewogen einige Soziologen, den Begriff „Klasse“ fallen zu lassen. Sie meinten, Gesellschaft besser durch den Begriff der „sozialen Schichtung“ beschreiben zu können. Sie lösten mit diesem Begriff aus der Geologie einen gängigen Begriff heraus und meinten, eine bessere Möglichkeit der Beschreibung der Gesellschaft anfertigen zu können. Marxistische Soziologen teilten diese Meinung nicht und bestanden weiterhin auf den Begriff der sozialen Klassen. So war in der Bildung soziologischer Theorien Karl Marx mit seinem Begriff der sozialen Klassen und der Klassenherrschaft einflussreich geblieben. Natürlich hatte er neue Kriterien entwickelt und hatte das Modell aus der Antike nicht einfach neu belebt. Er ordnete die Klassen nach deren Funktion im Produktionsprozess und meinte, in ihnen gibt es strukturierende Merkmale, die das gesellschaftliche wie ökonomische Geschehen bestimmen: Land, Kapital und Arbeit. Als Faktoren bildeten sie trotz ihres Zusammenhanges entgegengesetzte Interessen und lösten die traditionellen sozialen Bindungen auf. Es ist dies auch die Ursache für die Klassenkämpfe in der Geschichte. (Vgl. Ralf Bendix, Seymore Martin Lipset, Karl Marx´ Theory of Social Classes; in: diess., Class, Status and Power, Glencoe 1953, S. 26-35) Das von Marx entwickelte Modell berücksichtigt sowohl die Folgen der industriellen Revolution, die ja die vornehmlich agrarischen Arbeitsverhältnisse ablöste, als er auch zeigen konnte, die oben genannten Faktoren gingen ein neues Verhältnis ein. Somit konnte er das ökonomische Ungleichgewicht in der Gesellschaft erklären, die Konfliktstoffe definieren und verknüpfte diese Analyse mit der Idee, 20 Gesellschaften könnten insgesamt gerechter sein, sozialer und humaner. Diese Faktoren als reale Gegenstände des Sozialen zu identifizieren, bedeutet, dass man Gesellschaften auch bewusst „entwerfen“ könne. Die meisten Vorwürfe gegen Marx richteten sich hauptsächlich gegen seine Neigung zu Verallgemeinerungen. Viele spätere Soziologen meinten, dass er einerseits spezielle historische Situationen für seine Zwecke interpretierte, daraus generelle Schlüsse zog und sowohl eine Geschichts- wie auch politökonomische Utopie folgen ließ. Das war keine haltbare Kritik. Innerhalb einer Wissenschaftstheorie dürfen Modelle auf Thesen aufbauen, die Generalisierungen entnommen wurden. Von historischen Ereignissen darf behauptet werden, dass sie mit anderen Ereignissen eine Verwandtschaft haben. Dass daraus Strukturen abgeleitet werden, ist im Analogieschluss möglich. Weit schwieriger ist die These von Marx über „soziale Klassen“ nachzuvollziehen. Es war einer seiner wichtigsten Begriffe. Da passte er diesen Begriff stets seinen Argumenten an und legte diesen quer über sehr unterschiedliche Gesellschaftsformen. Bald waren römische Sklaven und Plebejer eine Klasse, dann wieder Handwerker und Leibeigene im Mittelalter, bald war ein „Klassengegensatz“ diagnostiziert worden, der aber den geläufigen Konflikt zwischen Bedrückern und Unterdrückten meinte, oder jenen zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten. Eigentlich machte die Überzeugungskraft von Marx in der Interpretation von Geschichte am meisten stutzig. Und diese prägte viele Nachfolger seiner Überzeugung, die die Dimensionen von Geschichte und Gesellschaft, Ökonomie und Herrschaft noch mehr verkürzten als es Marx je getan hatte. Die Überlegungen von Marx lassen sofort an einen anderen Soziologen denken, der vergleichbare Bedeutung hat, aber den man selten mit Marx in Zusammenhang bringt. Max Weber bot in seiner Herrschaftssoziologie ein differenzierteres Modell an, wobei er in seinem methodischen Vorgehen mit Marx vergleichbar war. Er verwendete ebenfalls eine historisch-empirische Methode, definiert aber die „Klassen“ nur in ihrer Relation zum „Markt“. In dieser ist die Frage enthalten, inwieweit die Angehörigen verschiedener Klassen am Markt ihre Chancen verwirklichen können. Immerhin leiten die Mitglieder dieser Klassen vom „Marktgeschehen“ ihren sozialen Rang und Status ab. Max Weber schließt auch die Möglichkeit ein, dass die „sozialen Stände“ bis in die Industriegesellschaft ihre Bedeutung beibehalten können und nicht nur in vor-modernen Gesellschaften ihre politische und ökonomische Rolle besitzen. Damit erklärte Weber den Umstand, dass die „Stände“ selbst nach den Schritten der Modernisierung soziale Werte, Verhaltensweisen und Ehrbegriffe tradieren und für die Gesellschaft 21 konstitutiv bleiben. Sie nisten sich in die Gesellschaftsstruktur ein und überdauern sogar, wenn wir etwa an die gesellschaftliche Rolle von Offizieren um 1925 und später in Mitteleuropa denken, obwohl der 1. Weltkrieg in einer Katastrophe geendet hatte. Was Max Weber von Karl Marx deutlich unterscheidet, ist in der Beurteilung der Funktion von Produktion und Konsum zu erkennen. Was Thorsten Veblen schon 1899 extrem ironisch mit Luxus und Verschwendung „besserer Gesellschaft“ beschrieb, zeigte in gewisser Weise auch Max Weber, nämlich die differenzierten sozialen Positionen der „Stände“, Gruppen, Schichten. Er interpretiert diese Position über die Konsummuster, in denen er äußere Erscheinungsbilder von Privilegien sieht, Macht enthalten und damit auch die Fähigkeit, die Interessen am „Markt“ durchzusetzen. Das ist ein sehr spannendes Bild, wenn man nun den „Markt“ nicht nur als ökonomische Einrichtung ansieht, sondern als eine Institution, die in ähnlicher Weise alle anderen Bereiche des Sozialen dominiert. Dieser „Markt“ wird schließlich auch die Vorstellung von demokratischen Systemen beeinflussen und ein wesentliches politisches Kriterium sein. Das deutet schon darauf hin, dass Max Weber „soziologischer“ dachte als seine Zeitgenossen, allein schon bei diesem Aspekt des „Marktes“ die Ökonomisierung der Gesellschaft beobachtete und gemäß dieses Modells alle weiteren sozialen Bereiche interpretierte - bis hin zu den Phänomenen der Kultur. Nun darf es nicht verwundern, dass Max Weber viele Befunde seiner Analysen aus dem ökonomischen Geschehen ableitete. Er entstammte ja der deutschen Historischen Schule der Nationalökonomie, war mit dem Apparat der Begriffe vertraut und hatte dabei gleichsam ein Realitätsprinzip der Gesellschaft unmittelbar vor Augen: die Ökonomie. Sie schien ihm einen realistischen Zugang zu dem diffusen und schwer fassbaren Gebilde „Gesellschaft“ zu erlauben. Er teilte aber nicht die Behauptung früherer deutscher Sozialphilosophen, wegen der bürgerlichen Gesellschaft seien die ökonomischen Perspektiven die einzigen ernsthaften Bestimmungspunkte von gesellschaftlichem Bewusstsein, alles andere sei „Überbau“ oder gar Fiktion, sondern Max Weber sah im ökonomischen Geschehen die Auswirkung von „Kultur“, Geschichte und Lebensstilen in der Gesellschaft. Die verschiedenen Wirtschaftsstile, die man doch in Europa im 19. Jahrhundert sehen konnte, von der Industrielandschaft Englands bis zu den weiten Agrarflächen der Ukraine, die gleichsam von Leibeigenen noch immer bearbeitet werden mussten, sind Ausdruck von „Kultur“. Und das war die beeindruckende Sichtweise Max Webers, daraus Schritt für Schritt die sozialen Bestandteile abzuleiten, zu analysieren und deren konstitutive Bedeutung für die Ermittlung 22 des Gesellschaftlichen darzulegen. So erhielt er Konstruktionsmerkmale der Gesellschaft. Die erste Bestimmung legte er mit der Typenlehre sozialen Handels vor, die er in enge Beziehung zu den Typen von Herrschaft setzt. Während sich also Marx für die Konfliktstoffe der Gesellschaft interessierte und die künftigen Bruchstellen prophezeite, die sich in Revolutionen verwirklichen, konstatierte hier Max Weber die Phänomene sozialen Wandels, der vielfältige Reziprozitäten verursacht und die Gesellschaft verändert. Marx interessierte sich kaum für die Stabilität einer Gesellschaft, verschrieb sich seinen apokalyptischen Visionen, in denen er die Abschaffung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft als unvermeidbaren Prozess darstellte, hingegen Max Weber die Gesellschaft mit der Ruhe des Pathologen betrachtete. Er sah in der Gesellschaft die „Materialisierung“ von Kultur und deren Beständen, zu denen etwa Denken, Bewusstsein oder Weltanschauung zählen, beschrieb die verschiedenen sozialen Verknüpfungen, die jeweils vertikal und horizontal wirkende Solidaritäten ergeben können, oder aber wieder Gegensätze, die ebenfalls den Zustand der Gesellschaft bestimmen. Gesellschaft sah Max Weber stets in den Prozess der Geschichte verwickelt, daher befürchtete er die Destabilisierung von Gesellschaften und war daher ein entschiedener Befürworter jener Institutionen, die die sozialen Antagonismen mildern und auflösen helfen: Rechtsstaat und Bürokratie. In seiner Soziologie war zu erkennen, dass die Folgen der Modernisierung samt den Verunsicherungen der Menschen nur über diese beiden Institutionen transformiert und in einer Demokratie bewältigt werden können. Es war dies einer der Ansätze, weshalb Soziologie zu einer fundierenden Wissenschaft innerhalb der Sozialwissenschaften werden konnte. Soziale Mobilität Auf- und Abstieg von Kulturen und Imperien waren bei Historikern beliebte Bilder, um den Lauf der Geschichte zu charakterisieren. In der Renaissance hingegen schien man sich die historisch-kulturellen Muster ausgewählt zu haben und mischte sich aus Christentum und der Begeisterung für römische und griechische Antike ein neues Weltbild, das zugleich diese eindrucksvollen kulturellen Schöpfungen förderte. Neu war daran, dass Geschichte nicht Vergangenes blieb, sondern ein sehr wichtiger Steinbruch, aus dem die antiken Reste entnommen und zu neuen Formen entwickelt wurden. In dieser vereinfachten Darstellung soll nur die Sensibilität geweckt werden, dass man aus den Entnahmen aus der Geschichte und den Mischungen von Vergangenem und 23 Gegenwärtigem ein neues Zeitbewusstsein ablesen kann, woraus man eine Neubestimmung der Stellung des Menschen entwickelte. Neu war auch die Neubestimmung des Menschen in seinem Verhältnis zu Gott, wie es die Reformation deutlich machte. Das Ergebnis war die Glaubensspaltung, die West- und Mitteleuropa nachhaltig prägte, andererseits musste sie politisch überwunden werden. Damit begann der Siegeslauf des modernen Staates und seiner Institutionen. Dieser Hinweis auf die Geschichte wird in diesem Zusammenhang mit soziologischen Terminologien verblüffen. Allein dieser historische Umstand zeigt ja nicht nur eine neue Beweglichkeit des Denkens in den Wissenschaften, sondern drückt sich auch in einer steigenden sozialen Mobilität aus. Auf der einen Seite werden die intellektuellen Mönchskommunitäten von den Universitäten abgelöst, auf der anderen Seite wird dem Adel der „Geistesadel“ entgegengestellt. Schließlich benötigte der Staat, zuerst in den Stadtstaaten Oberitaliens, eine funktionstüchtig Bürokratie, ohne die die anstehenden Modernisierungen und verbesserte Administration nicht möglich gewesen wäre. Und die Beamten waren sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft. Die Mobilität war auch dadurch verursacht worden, dass mit der Reformation die Legitimationskriterien nicht mehr aus dem Glaubensbekenntnis gewonnen werden konnten, sondern diesen Verlust an Orientierung mussten Wissenschaft, Ökonomie und Administration ersetzen. Die Steigerung der Mobilität bis ins 21. Jahrhundert hat Joseph Schumpter einmal ironisch damit charakterisiert, dass „die oberen Schichten der Gesellschaft Hotels ähnlich sind, die immer voller Menschen, aber es sind immer wieder andere Menschen.“ Soziale Mobilität meint aber auch andere Phänomene. Es soll ja nicht nur das Auf und Ab auf der sozialen Leiter wiedergeben, sondern interessanter ist vielleicht die Mobilität innerhalb einer homogenen sozialen Schichte. Sie bestimmt die individuelle Lebensgestaltung. Dazu zählt auch die intergenerative Mobilität. Bekanntlich sind ja die lehrreichen Beispiele gelungener Biographien zugleich auch der Nachweis für Mobilität, also vom Tellerwäscher zum Millionär aufzusteigen. Und dies gilt noch weit mehr für das Wachstum der Produktion im Zeitalter der Industrialisierung. Da hatte der Großvater noch als Schmied gearbeitet, hingegen der Enkel verfügte dann über einen Konzern und beneidet den Großvater für dessen beschauliches Arbeitsleben. Mobilität will aber auch zum Ausdruck bringen, dass sie gerade für die Entwicklung zur gesellschaftlichen Gleichheit ein Merkmal dafür ist, ob Menschen zu ihrem Ziel kommen können oder wo es behindert wird. Gerechtigkeit in der Verteilung der Güter, gleicher Zugang zum Recht und Anrecht auf die meisten Positionen in der Gesellschaft zeigen das 24 Prinzip Gleichheit sehr erfolgreich, aber konnte nur über soziale Mobilitäten realisiert werden. Sie bewirkte die Steigerung der ökonomischen Produktivität, da arme Schichten der Landarbeiter in die Stadt wanderten, um in den Fabriken Arbeit zu finden. Sie weckte auch in den unteren Schichten den Optimismus, sozial aufsteigen zu können. Natürlich waren die Enttäuschungen ziemlich groß, als alle diese Ziele nicht so verwirklicht werden konnten, wie man es erhoffte. Gegenwärtig ist Mobilität im weitesten Sinn das bedeutendste Merkmal „sozialen“ Wandels. Wir leben ja nicht nur inmitten der größten Wanderungsbewegung der Geschichte, sondern mit der Forderung nach mehr „Flexibilität“ werden zahllose Menschen mit der Tatsache konfrontiert, in ihrer bisherigen Arbeitswelt nicht mehr bleiben zu können. Auch sie müssen sich mobil zeigen. Gleichzeitig war mit der steigenden Entwicklung der Kriminalität die Kehrseite von Mobilität erkennbar, denn auch diese verfolgt ja den Zweck sozialen Aufstiegs, wenn auch mit unlauteren Mitteln. Mobilität bedeutet hier, die Umwege zum Erfolg in der Gesellschaft zu kennen und zu nutzen. (Vgl. Daniel Bell, Crime as an American Way of Life; in: ders., The End of Ideology, New York, S. 127-150) Selbst diese dissonanten Merkmale förderten die Bedeutung der Soziologie. Hinter der Frage nach sozialer Mobilität stellte sich sofort die nächste, nämlich welche verwandten Wissenschaften der Soziologie bei den Ermittlungen helfen könnten? Bald rezipierte man in der Soziologie die Ergebnisse der Statistik, hierauf die der Sozialgeschichte und Sozialökonomie, die Ergebnisse aus der Tradition der Bevölkerungswissenschaft und der Sozialpolitik als einen Zweig der Volkswirtschaftslehre. Gerade diese Zusammensetzungen verrieten, dass es wirklich den großen Komplex einer Sozialwissenschaft gibt. Bürokratie Geht ein Besucher Roms vom Kolosseum zum Forum Romanum, so findet dieser Weg nicht nur vor einem Hügel ein Ende, sondern auch vor einem riesigen Gebäude: dem Tabularium. In ihr war der Sitz der berühmten römischen Reichsverwaltung. Die Reste dieses großen Gebäudes sind das interessanteste Vermächtnis des antiken Rom an den modernen Staat. Ohne Verwaltungsstäbe hätte das römische Reich nicht existieren können. Modernisierungen und daran anschließende Reformen hingen von Qualität und Güte der Bürokratie ab. Max Weber beschrieb die Bürokratie als einen unverzichtbaren Teil eines Typus von Herrschaft. Ihre Organisation, die Entwicklung von Regeln in Formen von Vorschriften, die Rekrutierung der Beamten bildeten ein völlig neues 25 politisches Instrument, in dem der Staat nicht nur besser überblickt werden konnte, zugleich dessen Bürger in der Bürokratie einen Bereich von Staatlichkeit und Politik realistisch „sehen“ und „fühlen“ konnten. Das war natürlich mit der Entwicklung des Territorialstaates ab dem 17. Jahrhundert in Frankreich eine notwendige Parallelentwicklung. Die Behörden wurden zur abgestuften Verwaltungshierarchie, die erstmals auch bis in die „Provinzen“ regierten und nun die Gesellschaft mit einem politischen System konfrontierte. In soziologischer Betrachtung wurden zwei Phänomene wichtig: Es wurde der schriftlich ausgefertigte Akt „erfunden“ und zugleich der Beruf des Verwaltungsjuristen. Standen einmal die „Griechen“ in der Antike vor der Alternative zwischen Tyrannis oder Demokratie als Herrschaftsformen, so war die bürokratische Herrschaft nach Max Weber ein politisches System, das sich gleichsam unabhängig von Personen konstituierte. Dafür benötigte man eigene Ausbildungen, Eignungsprüfungen und eine normierte Form einer Karriere für den Beamten. War im „patrimonialen“ System der veralteten Monarchie der Königshof „informell“ organisiert, bestenfalls nach Zeremoniell und tradierten Formalismen, genügte hier die „Mündlichkeit“ der Anweisungen, so waren nunmehr der Bürokratie die Befehle schriftlich zu geben, deren Befolgung wurde kontrolliert, in Akten vermerkt und archiviert. So entstand eine „rationale Ordnung“. Sie hatte sich in Westeuropa durchgesetzt und fand bis nach Russland eine Nachahmung. ( Vg. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1980) Der Erfolg der Bürokratie war auch mit dem Siegeszug des frühen Kapitalismus begleitet worden und förderten damit Rationalismus und Aufklärung. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft erhielten wirklich ein neues Gesicht. Daher meinte man zunehmend, politische, ökonomische und soziale Prozesse „durchschauen“ zu können. Daher ist es verständlich, dass die Bürokratieforschung in der Soziologie einen wichtigen Stellenwert erhielt. Im „liberalen“ Ansatz kritisierte man, dass Bürokratien auf Dauer die Menschen entmündigt, im „etatistischen“ Ansatz wurde betont, dass über die Bürokratie die Rechte der Staatsbürger gewahrt werden. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Bürokratie als wesentlichen Bestandteil staatlicher und politischer „Kultur“ betrachteten. Mentalität und Ideologie Im Anschluss an die Forschungen über Bürokratie war das Ergebnis zu verzeichnen, dass Beamte „andere“ Menschen seien. Er besitzt einen 26 bestimmten Ethos, den er seinem Beruf verdankt, empfängt von seiner Institution die Wertmaßstäbe, die er internalisiert. Diese Aufzählung umschreibt die „Tatsache“, dass es sich bei Beamten um Menschen mit spezifischen Denk- und Handlungsweisen handelt. Für die Soziologie ist der Begriff der „Mentalität“ von besonderer Bedeutung. „Mentalitäten“ zeigen ja nicht nur Beamte, sondern in allen Berufsgruppen scheint sie vorhanden zu sein. Unternehmer oder Sportler, Bauern oder Bauarbeiter lassen ihre spezifische Mentalität erkennen. Emile Durkheim hat darin das Ergebnis vorherrschender Ideen gesehen, selbst wenn er von einer „kollektiven Repräsentation“ von bestimmenden Ideen schrieb. Spezifische Denkweisen sind eben mit Tätigkeiten verbunden und führen zu „kognitiven Orientierungen“, die wieder gemeinsame Anschauungen prägen. Es „denken“ eben Bauern anders als Städter, Mechaniker anders als Piloten. In den Gesellschaften bilden sich unterscheidbare Denkweisen aus. Sie bestehen aus Kategorien, die einerseits über eigenständige Erfahrungen verfügen, andererseits eine spezielle Interpretation sozialer Wirklichkeit enthalten. Ein Berufschauffeur wird über den Straßenverkehr anders denken als ein geplagter Anrainer einer verkehrsreichen Straße. Soziologen interessieren hier nicht die Konfliktstoffe und Interessengegensätze, sondern wie bei diesen gegenteiligen Meinungen dennoch eine kollektive Mentalität erzielt wird. In der jüngeren Vergangenheit haben ja soziale Bewegungen gezeigt, eine sehr differente Repräsentation zu haben. Ökologische Bewegungen vereinen Mitglieder, die entweder grundsätzlich für den Naturschutz eintreten, Biologen aus rational-wissenschaftlichen Gründen oder auch Liebhaber der Schönheit der Natur. Die einen wollten die Natur zum Gegenstand des politischen Handelns machen, die anderen galten als Exponenten eines „Wertkonservatismus“. Daher mussten sich höchst unterschiedliche Haltungen zur Natur in einer gemeinsamen Mentalität. Da ist für den Soziologen interessant, wie lange diese Mischungen beibehalten werden, wie haltbar die gemeinsamen Positionen sind und ab wann die Wünsche in konkrete politische Aktionen verwandelt werden. Dabei ist die Feststellung wichtig, dass darin der Hinweis auf einen Wandel der Denkstrukturen vorliegt. Sollten sie eben über eine gewisse „Dauer“ verfügen, können wir von einer Mentalität sprechen, wenn diese nicht erreicht wird, so wird es wohl eine „Mode“ gewesen sein. Die Entschlüsselung von Mentalität war ein Untersuchungsgegenstand für die Schüler von Emile Durkheim. Sowohl bei Marc Bloch, als auch bei dem marxistisch orientierten Lucien Febvre wurden Mentalitätsstile über den Umweg von Ritualen, Wunderglauben, Einstellung zur 27 „Religion“ untersucht. (Marc Bloch, Le Rois thaumaturges, Paris 1923; Lucien Febvre, Le Probleme de l´incoyance an 16e siècle, Paris 1942) Mit diesem Ansatz waren sozialhistorische Themen plötzlich im Mittelpunkt soziologischer Interpretation: Zauberei, Hexerei oder Wunderglauben. So entdeckte man einerseits, dass ein spezielles „Wissen im Volk“ diskriminiert und wegen der Verwissenschaftlichung verdrängt wurde; andererseits fragte man sich, ob im Umfeld von Ritualen und Religionen auch Mentalitäten entstehen? Man musste zugestehen, dass Mentalitäten nicht allein aus herkunfts-, berufs- und gesellschaftsbezogenen Bindungen abgeleitet werden können, in denen Mentalität stets als eine Form der Rationalisierung erscheint. Die Analyse von Mentalität stellt natürlich die Soziologie selbst vor erhebliche Probleme. Kann sie nicht auch zur Mentalität eines Denkstiles werden? Widerspricht nicht die Dauerhaftigkeit einer Mentalität dem sozialen Wandel, der sie offensichtlich zu modifizieren scheint? Ist Mentalität in ihrer umfassenden Form mit gesellschaftlichem Bewusstsein gleichzusetzen? Wie auch immer die Antworten darauf erfolgten und von ernsthaften Bemühungen um eine Analyse begleitet waren, legte die Bestimmung von Mentalität nicht den Eindruck nahe, dass mit diesem Begriff zu großzügig umgegangen wurde? Man konnte bei aktuellen Forschungen einen weiten Bereich gesellschaftlichen Bewusstseins abdecken, ohne dass dessen Funktion zur Dechiffrierung eines Gesellschaftszustandes als ideologische Position des Forschers zur Debatte stand. So erkennt mn recht gut, dass mit Teminologien das Problemfeld offener Fragen eher verdeckt als aufgedeckt wurde. So bergen Begriffe häufig die Gefahr in sich, soziale Dimensionen zu verkürzen, in kausale Verbindungen zu bringen und daraus einen Erklärungszusammenhang zu konstruieren, der nicht eingehend gesellschaftliche Wirklichkeit trifft. Natürlich scheint alles in den Erfolg eines empirischen Zuschnittes zu passen und so kann es geschehen, dass die Vornahmen zugleich auch das Forschungsergebnis sind. Sollte man nun wirklich Mentalität bestimmen wollen, so wird wohl der Rat zu beherzigen sein, diese grundsätzlich zu einer genau erhobenen sozialen Wirklichkeit in Beziehung zu setzen, wie etwa den „Corpsgeist“ zur Befehlshierarchie militärischer Einheiten, oder die beschworene „corporated identity“ in Wirtschaftskonzernen. Einer gänzlich anderen Kategorie ist die „Ideologie“ zuzuordnen. Es ist ein geflügeltes Wort, das in der Soziologie eine breite Verwendung findet. Zumeist bezieht sich dieser Begriff auf die Aussagen der Analysen von Karl Marx, der zu je einer sozialen Klasse auch eine genuine Ideologie hinzuzählt. Gewiss ist bei bürgerlichen Unternehmern die Ideologie eines Wirtschaftsliberalismus anzutreffen, wie auch in der frühen Arbeiterbewegung ein revolutionärer Esprit verbreitet war. Hier 28 unterschied Karl Mannheim in seiner Wissenssoziologie zwischen „besonderer“ und „totaler“ Ideologie. (Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, (1936) Frankfurt 1985) In totalen Ideologien sollen Gesellschaftsordnungen legitimiert werden, die verbindliche politische Denkmuster einfordern und auch bei Intellektuellen durchsetzten. Sie akzeptieren keinen Unterschied zwischen gedachter, gewünschter und tatsächlicher sozialer Wirklichkeit. Politische Systeme bedienen sich oft dieser totalen Ideologien, so etwa in der Tabuisierung von „Markt“ und dessen ordnender Kraft, in der Tabuisierung politischer Positionen. Dahinter verbergen sich recht eigennützige Interessen. Der Markt etwa soll grundsätzlich Konkurrenz als „gesundes“ Prinzip zulassen, die Kompetenz individuellen Handelns garantieren. Bei politischen Bewegungen werden Ideologien als gelungene philosophische Systeme ausgegeben, die die Richtungen politischen Handelns vorgeben und eine kritische Prüfung verweigern. Sehr schnell ist ein Druck auf die Gesellschaft festzustellen, um Ideologien durchzusetzen, und sei es, dass „nur“ „symbolische Gewalt“ ausgeübt wird, wie diese Pierre Bourdieu beschrieb. (Pierre Bourdieu, Esquisse d´une theorie de la pratique, Paris 1972) Mit dem Begriff „Ideologie“ war es der Soziologie möglich, eine umfassende Weltanschauungskritik der Gesellschaft zu entwerfen, die immerhin zu einem wesentlichen Merkmal dieser Wissenschaft wurde. Somit nahm sie die Position für sich in Anspruch, die „Eliten“ in Politik, Wirtschaft, Kultur oder Wissenschaft untersuchen und auf deren Aporien verweisen zu können. Grundsätzlich wurde der Verdacht laut, hinter allen Denkweisen stecken Interessen, wie die Übernahme dieser Interessen in den „unteren“ sozialen Schichten als „Entfremdungen“ bezeichnet wurden. Durch Ideologien finden Instrumentalisierungen statt, weshalb die Ausgebeuteten und Entfremdeten ihren Zustand nicht durchschauen können. Der Begriff „Ideologie“, der immerhin die Errichtung der Position von „Ideologiekritik“ in den Sozialwissenschaften bewirkte, kann natürlich auch einen gegenteiligen Effekt hervorrufen: Sind generell die Bereiche von Recht oder Religion oder Kultur Funktionen für den Machterhalt? Sichern sie insgesamt und immer schon die Interessen der Mächtigen? Man wird nicht alle soziale Institutionen innerhalb dieser Absichten interpretieren können. Max Weber selbst erkannte, dass seine ausgefeilte Ideologiekritik mit der Einsicht in die „entzauberte“ soziale Welt verbunden ist, ja in der Objektivierung von Fortschritt und Modernisierung insgesamt eine „Entzauberung“ stattfindet, die die Gesellschaft mit völlig neuen Herausforderungen belastet. Die Antwort war dann wohl die Kreation perverser Mythen des Totalitarismus. 29 Die Ideologiekritik in der Tradition der Soziologie war immer von der Bemühung begleitet, nun könne der Aufbau sozialer Welt rationaler erfolgen und es sei möglich, Fortschritt in die Gesellschaft organisch zu integrieren. Rechtzeitig könne die Ideologiekritik das Aufkommen moderner Mythen und Idole verhindern. Dieser Optimismus hatte sich nicht bewahrheitet. Damit war soziologisches Wissens keineswegs außer Kraft gesetzt. Allerdings parierte die Soziologie die Befürchtungen vor dem Totalitarismus damit, dass sie selbst - wie erwähnt Produzentin einer „soziologischen Weltanschauung“ wurde, die alle Bereiche der Gesellschaft penetrierte. Sozialer Wandel Im Selbstverständnis des Faches stufte sich die Soziologie als die geeignetste Interpretin sozialen Wandels ein. Natürlich war „Wandel“ immer schon der Modus historischer Darstellungen, doch mit Auguste Comte war doch eine spezifische Änderung und Neuerung dieses Phänomens eingetreten. Seit der Aufklärung sah man sich in Wandlungsprozessen, nur hatte sich die Ansicht durchgesetzt, sozialen Wandel in die eigene Regie übernehmen zu können. Das war der Gegenstand politischer wie ökonomischer Reformprogramme im 18. Jahrhundert. Bereits im 17. Jahrhundert wusste man von der Veränderung der Bevölkerungszahlen, wie Gemeinwesen ökonomisch zu entwickeln seien oder warum sie geschwächt sind. Also waren Strukturveränderungen aufgefallen und wurden zum Gegenstand politischer Ökonomie und der Staatslehre. Welche Faktoren verursachen aber Veränderungen? Es war die zentrale Frage, die nicht erst Comte stellte. In den Untersuchungen zum Untergang des römischen Weltreiches war das Thema „Wandel“, „Veränderung“ oder „Untergang“ seit Montesquieue geläufig. Und bis zur Zäsur der russischen Revolution 1917 beschäftigten sich Soziologen mit diesem Thema. Dazu hatte Pitirim Sorokin ein eigenwilliges Modell skizziert, das wohl mit den Beschreibungen von „Fluktuation“ und „Zyklus“ neue Motive zur Erklärung beisteuerte. Selbst in diesen beeindruckenden Analysen stand die Geschichtsphilosophie Patin, denn hier erscheinen historisch-soziale Entwicklungen einem Kreislauf zu gehorchen. Andere Theoretiker wieder können zu einer christlich-jüdischen Tradition hinzugezählt werden, in der entweder linear verlaufende Prozesse grundsätzlich Wandlungen ergeben, oder der Geschichte eine theologisch argumentierte Eschatologie unterlegten. Unabhängig davon wurden auch Modelle aus der Biologie herangezogen, die in die Soziologie mit den Begriffen „Wachstum“, „Evolution“, „Dekadenz“ einwirkten. Ein 30 weiteres Modell entnahm man den Vorstellungen von „Organisation“, aus der man für den Wandlungsprozess die Begriffe „Penetration“, „Nachahmung“, „Diffusion“ oder „Derivation“ heranzog. So setzten in der Erklärung für Wandel Gabriele Tarde oder Thorsten Veblen auf des Modell der „Diffusion“, um in der Penetration verschiedener Bereiche der Gesellschaft durch zunehmende Vermischung von Nachahmungen oder gar Übertragungen von unterschiedlichen sozialen Dispositionen den sozialen Wandel zu markieren. (Gabriele Tarde, Les lois de l´imitation, 1890; Thorsten Veblen, Imperial Germany and the Industrial Revolution, 1915) Die Bereitschaft Neuerungen zu kopieren, ins eigene System zu integrieren und großteils damit überraschende Veränderungen hinzunehmen, war eine der Stärken des Diffusions-Modells. Es erklärte den Erfolg technischer Errungenschaften, den ökonomischen und materiellen Aufstieg, ohne dass damit ein Wandel des Bewusstseins Schritt gehalten hätte - am Beispiel Deutschlands und Japans um 1900. Nun war der Begriff des sozialen Wandels sehr schnell ein Merkmal für die Theorien der Modernisierung geworden. Diesem Thema widmete sich Herbert Spencer, der als Modell die aus der Naturwissenschaft entnommene Evolution zur Erklärung anbot. Da konnte sozialer Wandel sowohl in den Kriterien des „Wachstums“ und des „Fortschritts“ beschrieben werden, wie sich damit auch die Steigerung von sozialer Differenzierung und Komplexität einstellte. (Vgl. Herbert Spencer, Autobiography, London 1904; ders., Social Statics and Dynamics.....) Spencer meinte beobachten zu können, dass es eben eine direkte Linie vom Einfachen zum Komplexen gibt, vom Unspezialisierten zum Spezialisierten. Er stellte die Hypothese auf, dass der Weg von der „inkohärenten Homogenität zur „kohärenten Heterogenität“ führe. Dieser Überlegung hätten sowohl Emile Durkheim als auch Max Weber zustimmen können. Diese Hypothese Spencers enthielt aber ein Problem, das später in der Soziologie zu einem häufig auftretenden Irrtum verleitete. Er meinte, die Gesellschaft aus einer naturontologischen Bestimmung der Welt erklären zu können, die aber die Eigenart der Gesellschaftsontologie unterschlägt. Mit Hilfe der Evolution war er überzeugt, Natur und Gesellschaft sei vergleichbaren Regeln unterworfen, selbst wenn der Prozess der Zivilisation qualitativ andere Merkmale aufweisen sollte als die Naturordnung. Verführerisch war die Hypothese auch deshalb, da sie einerseits von einer hohen Plausibilität begleitet wurde, andererseits erlaubte sie endlich die Anwendung einer Empirie, die ihre Eignung in den Naturwissenschaften nachgewiesen hatte. Nun waren die Nachweise nicht mehr über eine geisteswissenschaftlich-historische Methode zu ermitteln, sondern naturwissenschaftlich-empirisch. 31 Emile Durkheim wählte eine völlig anderen Zugang. Er beschrieb den sozialen Wandel als ein Ergebnis von „Vergesellschaftungen“. Diese ergibt sich aus den Entwicklungen zur Solidarität innerhalb der Gesellschaft, wobei er zwischen „mechanischer“ und „organischer“ Solidarität unterschied. Wenn es eine soziale Evolution gibt, dann zeigt sie ihr Fortschreiten vom einfachen Muster mechanischer Solidarität in Familie, Sippenverband oder Stamm zur organischen Solidarität etwa am Beispiel der modernen vergesellschaftenden Kraft der Arbeitsteiligkeit. (Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris 1893) Diese neue Zuordnung der Individuen bei Durkheim kann freilich mit der Theorie der sozialen Institutionen bei Max Weber verglichen werden, weshalb sozialer Wandel sowohl durch die Veränderung der Organisation von Arbeit, als auch durch die Entwicklung von Bürokratie und Kapitalismus dargestellt werden kann. In der genauen Analyse von „Übergangsgesellschaften“, in der ja die genannten Faktoren vorhanden sein müssen, stellte Talcott Parsons fest, dass die Schritte der Modernisierung die Ablöse enger Gemeinschaft durch unpersönliche Gesellschaft bewirkt. Es kommt zu einer dramatischen Verknüpfung „endogen-binnengesellschaftlicher“ Faktoren mit „exogen-von außen nach innen gerichteten“ Einflussnahmen. (Talcott Parsons, Social Theory and Social Change,.....) Damit ist die Gegenüberstellung der beiden Formen von Vergesellschaftung nochmals aktualisiert, nämlich zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Da insgesamt das soziale Gefüge außerordentlich empfindlich ist, genügen schon geringfügige Umstellungen, kleine Änderungen, um einen Wandlungsprozess einzuleiten. Somit wurde den Soziologen ein höchst umfangreiches Feld der Forschung vorbereitet. Verstädterung, Industrialisierung, Technisierung, oder die Zunahme sozialer Komplexität und das weite Gebiet der Säkularisierungen drängen der Gesellschaft Veränderungen auf, denen sie sich nicht entziehen kann und deren Wandlungsprozess schlechthin das Thema der Soziologie ist. Und ein Widerstand gegen den Wandel ist nur um den hohen Preis von „Rückständigkeit“ möglich, wie Ogburn beredt argumentiert. Die Abkehr von Fortschritt führt zu sozialen Atavismen oder zu gewaltigen kulturellen Dissonanzen. Die Herausforderung an den Soziologen, eine umfassende und befriedigende Erklärung für sozialen Wandel zu bieten, kommt denkbaren Formen sozialen Wandels und diese zu ordnen, wird wohl wegen der gegensätzlichen Interpretationen kaum möglich sein. Daher mussten historische Phasen konstruiert werden, in denen die Stadien der Veränderungen eine adäquate Funktion besitzen. Offenbar müssen 32 wohl alle Gesellschaften die Phase einer „Entwicklungsgesellschaft“ durchlaufen, ob sie aber an das Ziel der Bewältigung ihrer Entwicklung kommen und wer ihnen dafür das Zeugnis ausstellt, trifft eher das „Verantwortungsbewusstsein“ der Soziologie als die Gesellschaft selbst. Sozialer Wandel in der Gestalt von Niedergang, Erschöpfung und ökonomischer Depression ist für die Historiker ein geläufiges Thema. Da die Soziologie in der Phase von Fortschritt und Revolutionen entstand, hat sie weit mehr die Frage interessiert, welche Voraussetzungen Fortschritt begünstigen und die Gefahr der Revolution vermindern. Eine „versöhnlichere“ Position bei der Erklärung sozialen Wandels wird in dem Modell veranschaulicht, in dem Wandel in der Gesellschaft durch gegenläufige Bewegungen verursacht wird. S. N. Eisenstadt wählte als Beispiel die Modernisierung, die einerseits einen Druck „von außen“ wie etwa den technologischen Fortschritt und die Bürokratisierung darstellt, andererseits ist eine „Regression“ zu beobachten, etwa Dezentralisierung oder der Anstieg der Wertschätzung privater Sphären. (S.N. Eisenstadt, Tradition, Change and Modernity, New York 1973) Ein ebenbürtiges Modell stellte Norbert Elias vor, der in der Modernisierung sowohl die Zunahme sozialer Differenzierung und der sozialen Integration beobachtet - und zugleich das Gegenteil, also Entdifferenzierung und Desintegration. Das heißt, dass die Gesellschaft verformt wird und der Gewinn neuer Eigenschaften, etwa sich in der industriellen Arbeitswelt zurecht zu finden, scheint gleichzeitig die Bedeutung der Intimsphären der Menschen zu heben. Vermutlich war das „Modell“ sozialen Wandels von Karl Marx bei weitem das einflussreichste. Mit seiner Konzentration auf Produktionsformen hatte er jederzeit eine empirisch erfassbare Tatsache vor sich und sah in deren Entwicklung zugleich auch den politischen Wandel. Ökonomie, Produktion und Gesellschaftsform besäßen immer eine widersprüchliche Struktur, begünstigen Konflikte, die aber dadurch lange Zeit kompensiert werden können, sollten die „einfachen“, wenig komplexen sozialen Einheiten zu immer komplizierteren sozialen Organisationen drängen. Es ist eine evolutionäre Entwicklung, die allerdings die Gefahr des plötzlichen Zusammenbruchs in sich birgt - die Revolution. Das Ende dieses Verlaufs sei die kommunistische Gesellschaft, die mit zwingender Notwendigkeit eintreten muss. Der Motor dieser historischen Bewegung ist die Steigerung der Produktionsweisen und die gleichzeitige Verelendung der „Massen“. Beide sind in der Lage, ihre Vergesellschaftungen zu leisten, in diesen ändern sich die Funktionen und Bedeutungen des Kapitals. Dieses führt den politischen Zustand bürgerlicher Gesellschaft letztlich ad absurdum. Bourgeoisie und Proletariat sind Endprodukte, die unversöhnlich gegeneinander stehen. 33 Marx räumt aber auch ein, dass das Gegenteil eintreten könne, also der Wandel kann in die Gegenrichtung stattfinden, weil er sich je nach ökonomischer Disposition einstellt. Und dieses „Modell“ entsprach auch einer paradoxen historischen Situation. Während Westeuropa im 16. Jahrhundert florierte, verloren die osteuropäischen Städte an Bedeutung und ökonomischer Kapazität. Oder: Während der Kapitalismus seinen Siegeszug am Westufer der Elbe feierte, wurde am Ostufer die „Feudalisierung“ in Grundbesitz und Landschloss gefestigt. Vermutlich erwecken diese Beispiele eher den Eindruck einer unbefriedigenden Beiläufigkeit und scheinen für Theorien nur sehr unspezifische „Instrumente“ zu sein. Auf der einen Seite verführen diese Beispiele zu einseitigen Interpretationen, auf der anderen bieten die Erkenntnisgewinne nur begrenzt zutreffende Einblicke. So konnte es zum Vorwurf kommen, soziologische Theorien seien in ideologischen Vorbestimmungen gefangen. Dennoch muss der aufmerksame Leser erkannt haben, dass etwa das „Realitätsprinzip“ für sozialwissenschaftliches Denken, Ökonomie, in den meisten Positionen innerhalb einer soziologischen Theorie eine dominante Stellung einnimmt - von Marx bis Weber. Erst über diese Brücke gibt es offensichtlich einen realen Bezug zur Wirklichkeit. Mit der Ökonomie hatte man also einen Ansatzpunkt zur Verfügung, der unter anderem die Arten des sozialen Wandels zu erklären vermag. Auf dieser Ebene bleibt die Diskussion streng auf das Thema ausgerichtet und öffnet zugleich das weite Feld soziologischer Spezialitäten. Allerdings zeigen sich innerhalb dieser Verknüpfungen zur Erklärung sozialer Wirklichkeit sehr anschaulich die Einwände gegen eine „naturwissenschaftliche“ Soziologie. So eben in der Soziologie eine Nachahmung von Naturwissenschaft angestrebt wurde, können zwar Teile einer Theorie an empirischer Gewissheit gewinnen, büßen ber gleichzeitig eine verallgemeinerbare Aussagekraft ein und erreichen damit nicht ihr Wunschziel, nämlich die Anwendbarkeit in der gesellschaftlichen Praxis. Dieses Dilemma begleitete die Soziologie über weite Strecken ihrer Entwicklung und begünstigte die Trennung zwischen empirischer Sozialwissenschaft und theoretischer Soziologie. Diese Trennung trat gerade in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ein. In beiden Ausprägungen von Soziologie besitzen die Begriffsbestimmungen eine wichtige Funktion. Sie war gerade in der Gegnerschaft zwischen diesen beiden Denkrichtungen ausschlaggebend. Die eine Seite beschuldigte die andere, soziale Phänomene nur eindimensional zu quantifizieren; die anderen entgegneten, die durch eine umfassende Theorie erwünschte „Mehrdimensionalität“ des Erklärungsmodells entgleitet ins Unbestimmte und ins „Atmosphärische“. 34 Soziologie als Krisenmanagement: Emile Durkheim Bis hierher war versucht worden, die Soziologie als Wissenschaft nach drei Gesichtspunkten zu ordnen. Es begann mit dem allgemeinen Einblick, warum aus der traditionellen Sozialmetaphysik eine „soziale Physik“ wurde und wie die Veränderung eines wissenschaftlichen Denkmusters in der Aufklärung die Gegenstände des „Sozialen“ anders bestimmen wollte als zuvor. Dieser neue Stil von Wissenschaft leistete der Soziologie die Geburtshilfe, obendrein nicht das Ergebnis innerhalb der Disziplinen der Universitäten, sondern von intellektuellen Außenseitern. Dafür war Auguste Comte das treffende Beispiel und während des 19. Jahrhunderts waren es großteils „Amateure“, die die Soziologie immer besser zu entwickeln hofften. Offenbar hatten viele „Schriftsteller“ den sozialen Wandel zu kommentieren versucht und waren unter dem „Zwang“ gestanden, für die veränderte Gesellschaft eine adäquate „neue“ Wissenschaft zu entwerfen. Und wirklich war ein „neues“ Vokabular geschaffen worden, das nicht nur die Begriffe für eine Gesellschaftstheorie bereit stellte, sondern auch umgekehrt definierte die Theorie die neuen „sozialen Felder“. Wie auch immer, diese drei Gesichtspunkte bildeten das Thema für die junge Soziologie und waren auch fast gleichzeitig präsent. Daher waren die Ausflüge in die Terminologie nötig gewesen und deren Aufzählung hatte den Zweck verfolgt, die Bestandteile der Soziologie zu sammeln. Außerdem ist diesen Perspektiven die Tendenz gemeinsam, die soziale Wirklichkeit findet im Prozess ihrer „Soziologisierung“ eine hinreichende Erklärung als auch den Schlüssel zum Selbstverständnis von „Gesellschaft“. Dass dies als die spezifische Aufgabe der Soziologie angesehen wurde, war das Ergebnis der Aufklärung, die hier als Proponentin für Skepsis, Empirie und Rationalität interpretiert wurde. Natürlich wird bisweilen übersehen, dass Soziologie die Faktoren für die „Vergesellschaftung“ der Individuen nicht allein aufzudecken wünschte, sondern von Beginn an auch die Aufgabe zu erfüllen trachtete, für die Gesellschaft eine soziale Ordnung zu errichten. Das war schon bei Auguste Comte zu sehen. Auch für Emile Durkheim war es das Motiv, nämlich für diesen Zweck eine Wissenschaft zu konstituieren, die einerseits ihren Gegenstand bestimmen kann - „Was ist Gesellschaft?, andererseits die dafür nötigen Methoden erarbeiten musste, die sie teils aus den Naturwissenschaften adoptierte, teils aus Geschichte und Philosophie. Wenn schon die politischen Wechselfälle in Europa im 19. Jahrhundert die Gesellschaften destabilisierten oder sogar zu ungeeigneten administrativen Maßnahmen verleiteten, womit ein dauerhafter „äußerer“ und „innerer“ Gleichgewichtszustand hätte erzielt 35 werden sollen, so hatte die Soziologie dieses Ziel mit anderen Mitteln zu erreichen versucht und war gewiss erfolgreicher in der Analyse der vielfältigen Spannungen. Fast hätte man von Erfolgen auf allen Ebenen sprechen können, denn die Jahre vor dem 1. Weltkrieg waren friedlich und beinahe hätte man meinen können, Konflikte, Spannungen oder gar Krieg gehören der Vergangenheit an. Allerdings war der Friede in Europa sehr teuer erkauft worden. Die Neigung zur Expansion und Aggression war in die außereuropäische Kolonialpolitik umgelenkt worden und England und Frankreich wurden „Weltmächte“. Emile Durkheim begann seine Überlegungen zur Soziologie noch während der „dunklen Stunden“ Frankreichs, also vor 1870/71. Grundsätzlich war er der Überzeugung, Gesellschaft sei keine Ausformung eines besonderen Naturprozesses, was etwa Herbert Spencer behauptet hatte, aber auch kein Ergebnis von „Geistesgeschichte“, was bei Auguste Comte der Fall zu sein schien, sondern „Gesellschaft“ werde durch Faktoren geschaffen, die es methodisch zu erschließen gilt. So etwa sah Durkheim eine Verbindung zwischen gesellschaftlicher Moral und Arbeitsteiligkeit. Beide würden einander durchdringen und bedingen und schaffen erst jenen Zustand, den wir zeitgemäß als „Gesellschaft“ bezeichnen können. Die dafür kompetente Methodenlehre ist die Soziologie. Sie kann aber diese Aufgabe nur dann befriedigend erfüllen, wenn die Gesellschaft eine „säkularisierte“ geworden ist, das heißt, ihre Durchschaubarkeit zuläßt, ihre Rationalität stärkt und Steuerbarkeit vorsieht. Es wird später zu erörtern sein, welche Rolle die These der Säkularisierung der Gesellschaft in der Soziologie einnimmt. Max Weber hat in diesem Zusammenhang von der fortschreitenden „Entzauberung“ gesprochen und bis in die Gegenwart wurde die Debatte über die Notwendigkeit „säkularistischer Gesellschaft“ fortgesetzt. Immerhin war es bei Durkheim die Voraussetzung, damit Wissenschaft als Praxis der Aufklärung Anwendung finden kann. Und diese Aufgabe ist erfüllbar. Durkheim sieht sie in seiner Fragestellung zuerst einmal recht einfach: Es gibt ja die Unterscheidung zwischen dem Gesunden und dem Kranken, dem Guten und Schlechten. Es besteht auch Konsens darüber, was gesund ist, wie es auch eine Übereinstimmung darüber gibt, was normal ist oder normativ zu gelten hat. Diese Analogieschlüsse sind bei Durkheim sehr ausgeprägt, wie sie auch recht plausibel soziale Konstellationen wiedergeben. Der Zweck ist, dass recht unterschiedliche Bereiche in der Gesellschaft eine „Kontingenz“ zeigen. Diese ist nicht willkürlich, sondern offensichtlich ebenso sind individuelle Einschätzungen wie etwa Gesundheit oder das 36 „Sittliche“ zugleich auch gemeinschaftliche und sind wie Gegenstände oder Objekte von fester Konsistenz. Wenn also eine Gesellschaft „weiß“, was krank oder gesund ist, so kann auch ein Gesundheitszustand der Gesellschaft bestimmt werden - so lautete die Hypothese Durkheims. Durkheim gibt hier nicht einen „objektiv“ vorgegebenen Standard an, sondern die Befindlichkeit der Gesellschaft ist die Eigenschaft ihrer „Gattung“. „....der Typus der Gesundheit (fällt) für jedermann mit dem der Gattung zusammen. Eine unheilbar krank wäre, ist ohne Widerspruch nicht denkbar. Die Gattung ist die Norm kat´exochen und kann daher nichts Anormales enthalten.“ Emile Durkheim, Regeln der soziologischen Methode, Neuwied ...., S.150) Diese Überlegungen verfolgen die Absicht, nicht nur Eigenschaften des Individuellen in ihrem sozialen Kontext zu bestimmen, sondern diese sind als Spiegelungen des Sozialen allgemeine „Existenzbedingungen des Kollektivs“. In dieser Engführung konstruiert Durkheim seinen Begriff der „sozialen Tatsachen“. Diese sind ihm deshalb wichtig, weil sie eine Vergegenständlichung sozialer Erscheinungsbilder sind und gemäß seiner Interpretation dann auch als „Dinge“ behandelt werden können. Es ist die Voraussetzung, um der Soziologie einen „festen“ Gegenstand zu bieten und sie als Wissenschaft konstituieren zu können. Und „Dinge“ sind dort anzutreffen, wo sie vom „Gemeinschaftshandeln“ erzeugt werden und in Ritualen, Symbolen oder Kulten zwar „abstrakt“ erscheinen, aber ihre Anerkennung oder Nachahmung durch ein Kollektiv erfahren. Damit ist auch das Interesse Durkheims für Religionen begründet. Methodisch näherte er sich den Gegenständen, also den „Dingen“ mittels Ethnologie, soweit es die Kulte und Religionen betraf, da diese Wissenschaft sich immer schon für ein Gemeinschaftshandeln interessiert hatte. Wegen seiner Rezeption von Psychologie nach der Schule von Wilhelm Wundt, hatte er für die damalige Gegenwartsgesellschaft die Zwischenbereiche des Individuellen und Sozialen zu untersuchen begonnen. Beide Entnahmen aus Nachbardisziplinen sollten nicht nur den Charakter sozialer Institutionen entschlüsseln, sondern auch die Frage beantworten, wie jenes „Gesellschaftswissen“ beschaffen ist, das offensichtlich das kollektive Bewusstsein kreierte, das Bindeglied zwischen dem Individuellen und der Integration in soziale Eiheiten. Da nun alles „Gesellschaftswissen“ aus der Konstellation der Existenzbedingungen des Kollektivs hervorgeht, also auch Sprache und Denken, so Durkheim, wird die soziale Wirklichkeit aus diesen kategorialen Bestimmungen gebildet. Sie übertrifft natürlich die individuell gewonnenen Erfahrungen und Sinneswahrnehmungen, schafft objektive Tatsachen, deren Konstruktion die Soziologie 37 aufzudecken vermag. Der bis Durkheim ungelöste Streit zwischen Empirismus und „Apriorismus“, also Gesellschaft durch Vorannahmen zu bestimmen, scheint beigelegt. In dieser Betrachtung erhält die Gesellschaft die Eigenschaft von Kretivität, den man bislang nur der göttlichen Schöpfungsmacht zugeschrieben hatte. Religion, Wissen, Vernunft und damit Zivilisation, Moral und Recht sind Schöpfungsakte der Gesellschaft. Wenn sie das sind, so können sie Gegenstand der Erkenntnistheorie werden, die sozialen Tatsachen lassen eine empirische Erhebung zu und daraus ist die Soziologie zu begründen. Die sozialen Tatsachen verfügen nunmehr über einen objektiven ontologischen Charakter. Daher veränderte sich die Soziologie nach Durkheim und erhielt fast einen Stellenwert, den die Kritiker als „säkularistische Offenbarung“ bezeichneten. Die Soziologie scheint eben in der Lage zu sein, nicht nur den Standard moderner Gesellschaft zu bestimmen - oder auch die Distanz zu diesen Standards, sondern kann auch den Menschen selbst zur Einsicht „bewegen“, jeweils und jederzeit ein Produkt seiner eigenen Vergesellschaftung zu sein. Damit ist die Soziologie eine rationale Form einer Weltanschauungsproduzentin geworden, wie es am Beginn schon zu lesen war. Aus ihr ist das sinnhafte Tun und Handeln der Individuen abzuleiten, daraus beziehen die Institutionen der Gesellschaft ihre Legitimation und die Soziologie kann die Nachfolge in jenen Funktionen antreten, die früher Religionen besaßen. Wenn die Krise der Gesellschaft in Europa im 19. Jahrhundert überwunden werden musste, so war die Ursache eine irrational vollzogene soziale Differenzierung, die nicht nur eine gemeinschftlich gebildete Moral aufgelöst hatte, sondern auch den „Sozialen Sinn“ fragwürdig erscheinen ließ. Dieses Argument Durkheims war die Schlussfolgerung aus seiner berühmten Studie über den „Selbstmord“. Nur die Soziologie könne den Menschen vor Augen führen, als Gesellschaft Träger innerweltlicher Transzendenz zu sein, Grundlage sozialer Sinnstiftungen und nur die Soziologie würde über die Kenntnis sozialer Tatsachen verfügen, den Bausteinen für „Solidaritäten“. Die anzupeilende Qualität des Sozialen solle in der „organischen Solidarität“ erreicht werden, die zugleich die Garantin des Fortschritts ist, die Bedingung eines ebenbürtigen gesellschaftlichen Bewusstseins. Das Mittel zur Erreichung dieser Ziele ist die Erziehung, also Schulpolitik und Bildungsreform. „Die Soziologie kann uns nicht fertige Verfahren reichen........Aber sie kann mehr und sie kann es besser: Sie kann uns das geben, was wir am dringendsten brauchen, d.h. ein Bündel richtungweisender Ideen, die die Seele unserer Praxis sind...., die unserem Tun einen Sinn geben und uns an sie binden.“ (Emile 38 Durkheim, Erziehung, Moral und Gesellschaft, Vorlesung an der Sorbonne 1902/03, Neuwied 1973, S.54f.) Vielleicht ist die Analyse des Sozialismus ein noch besseres Beispiel, um den Gedankengang Durkheims zu verstehen. Immerhin hatte er 1895/96 darüber eine Vorlesung gehalten. In ihr bot er eine Erklärung für eine Ideologie. Durkheim durchschaute sofort, dass Sozialismus eine auf die Zukunft gerichtete Idee ist. Ideologisch an ihr ist, dass der Sozialismus ein Modell der Anwendung einer soziologischen und historischen Methode ist, um zu einer Analyse der Ursachen der Ideen zu kommen. Durkheim billigt dem Sozialismus zu, Reflexionen anzustellen, um eine Bewusstseinserweiterung für „Dinge“, für die soziale Frage etwa zu erzeugen, die bislang unberücksichtigt waren. „Es ist unbestreitbar, dass er dadurch der Sozialwissenschaft mehr Dienste geleistet als er empfangen hat. Denn er hat das Bewusstsein erweckt, er hat die wissenschaftliche Aktivität stimuliert, er hat Forschungen provoziert, Probleme gestellt, so dass sich in mehr als einem Punkt seine Geschichte mit der der Soziologie vereint.“ (Emile Durkheim, Le socialisme, hrsg, Marcel Mauss, Paris 1971 (1927) S.4) Durkheim verneint aber entschieden, dass der Sozialismus irgend etwas mit einer Wissenschaft zu tun hat. „Der Sozialismus ist keine Wissenschaft, auch keine Miniaturausgabe der Soziologie; er ist ein Schrei des Schmerzes und manchmal auch der Wut, der von den Männern ausgestoßen wird, die am intensivsten unser Unbehagen spüren.“ (ebd.S.6) Für Durkheim war hingegen der Umstand am Sozialismus interessant, dass er ins Bewusstsein der Gesellschaft eindringen konnte und somit zur „sozialen Tatsache“ werden konnte. Und dafür besitzt die Soziologie die Kompetenz, nämlich die Ursachen für den Sozialismus zu ergründen. An diesem Beispiel wird vielleicht der Ansatz Durkheims für die Soziologie deutlich. Eine politisch-ideologische Richtung gewinnt an Bedeutung, enthält Reflexionen und Spekulationen, die einen vergleichbaren Stellenwert erlangen wie etwa Moral, Sitte, Weltanschauung es bisher besaßen. Es ist die Aufgabe der Soziologie, die Karriere einer politischen, weltanschaulichen oder ökonomischen Position zu durchleuchten, um von daher einen Weg zu ermitteln, der für die Gesellschaft eine „Heilung“ verspricht. Das ist die Fortsetzung eines Aspekts in der Wissenschaft, der strikt in der Tradition der Aufklärung bleibt und der Wissenschaft eine „gesellschaftspädagogische“ Rolle auferlegt. Also lag es auf der Hand, dass Durkheim der Schul- und Bildungsreform hohe Bedeutung zuerkennt, denn nur durch sie ist der Grad gesellschaftlicher Selbstbestimmung zu erreichen. Und dabei hat die Soziologie die Funktion eines gewaltigen gesellschaftspolitischen Pädagogiums. 39 Was die Soziologie will..... Die Entwicklung dieser Wissenschaft im 19. Jahrhundert war der Versuch, die drei bekannten Fragen von Immanuel Kant zu beantworten: „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?“. Auf die erste Frage gab die Soziologie überraschend neue Antworten. Die vielen Erscheinungsformen der Gesellschaft waren durch die Perspektiven soziologischen Wissens um mehrere Dimensionen bereichert worden. Allein die Erhebungen, die in der Arbeitsteiligkeit dank Industrialisierung ein zentrales Motiv der Gesellschaft erkannten, ferner die Analysen bürgerlicher Gesellschaft und deren Interpretation durch Theorien sozialer Evolution oder Revolution waren konkrete Schritte in Richtung Soziologie. Der spezialisierte Blick auf die soziale Wirklichkeit war ein Merkmal der Soziologie geworden, gleichzeitig belehrte er über die Mannigfaltigkeit der Gesellschaft, weshalb man motiviert wurde, das Rätsel „Gesellschaft“ zu dechiffrieren. Die neue Welt sozialer Objekte war ja bei erster Betrachtung unerschöpflich erschienen, weshalb die Soziologie von der Naturwissenschaft die Hypothese heranzog, dass es eine Systematisierung, Erklärbarkeit und Kategorisierung geben muss, sollte die Soziologie über eine Kompetenz verfügen wollen. Zu diesem Zeitpunkt war die Soziologie vornehmlich eine Erfahrungswissenschaft. Die zweite Frage wollte die Soziologie ebenfalls beantworten. Da war sie ja nicht nur zu einem „fundierenden Wissen“ für die praktische Sozialpolitik geworden, wodurch die „positivistische Orientierung“ zur Bestimmung sozialer Wirklichkeit ein hilfreiches Instrument wurde, sondern sie stellte sich auch bewusst auf die Seite einer Gesellschaftsreform. Da wollte sie „Wirklichkeitswissenschaft“ sein, selbst auf das Risiko hin, dass die Bestimmung sozialer Wirklichkeit mit Ideologie kontaminiert wurde. Stets war diese Entwicklung vom Anspruch begleitet, allgemeingültige Bedingungen gesellschaftlicher Moral zu erschließen - wie es ja bei Durkheim deutlich zu erkennen war, weshalb die Soziologie zunehmend für die Produktion von Weltanschauung in der Modernen werden konnte. Von dort her drang sie schrittweise in die anderen Wissenschaften ein, von der Ethnologie, Psychologie und Ökonomie bis zur - Theologie. Die dritte Frage zählte offiziell niemals zu einem soziologischen Thema. Dennoch war von der Hoffnung in der Soziologie zu lesen, als „Lenkungswissenschaft“ auf den Bau der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Also wollte sie sich auch dieser Frage ernsthaft stellen. In der 40 Analyse sozialer Werte wurde immerhin vorausgesetzt, jede Gesellschaft anerkenne a priori eine Bindung an soziale Werte, die selbst durch gegenteilige Erfahrungen nicht außer Kraft gesetzt würden. Hierzu hatte Max Weber die eindrucksvollsten Überlegungen angestellt, wenn er etwa für die Phase des Frühkapitalismus die Tugenden der Sparsamkeit, des Fleißes und des Pflichtgefühls entdeckte, die als „Säkularisate“ einer protestantischen Ethik erhalten blieben. Und seine Forschungen schienen ihm recht zu geben, dass diese Motive für die Konstruktion bürgerlicher Gesellschaft, die zugleich auch eine kapitalistische wurde, ausschlaggebend sind. Somit hatte er ein objektives Wissen über die Gesellschaft ermittelt, jedoch nicht zu erklären beabsichtigt, ob etwa diese „Werte“ die Merkmale individueller Vorstellungen von Freiheit verändern, beibehalten, stärken oder verringern. Er hatte nicht die Absicht, eine Erklärung dafür zu geben, warum Menschen diesem Tugendkatalog gehorchten, der doch dem vermutlich ebenso starken „Lustprinzip“ widersprach. Die individuelle Übernahme moralischer Kriterien zählen eben nicht zum Bereich gesellschaftlicher Phänomene, selbst wenn diese nur die Summe individueller Überzeugungen wären. Daher beschrieb Max Weber in seiner Theorie sozialen Handelns nicht deren moralische Qualität, sondern bindet es strikt an Zwecke und deren Konsequenzen. Wenn also Kant in der Norm moralischen „Sollens“ die Bereitschaft der Individuen zum „guten Willen“ sah, darin auch die Autonomie der Person begründet, so wird schließlich die Philosophie von den später folgenden Ansprüchen der Soziologie getrennt. Es zählt nicht zum Interesse des Soziologen, wie etwa die Autonomie der Person innerhalb von Vergesellschaftung oder Sozialisation erhalten bleiben soll. Würde nämlich die Soziologie diesen Kanon der Philosophie anerkannt haben, besonders jenen subjektiver Pflichten, der bei Kant die Voraussetzung für den Vollzug von Freiheit war, würde sie sich um die zahllosen Erfolge ihrer empirischen Forschungen gebracht gesehen haben. Sie hätte auch ihren Weg der Erforschung der Gesellschaft nicht unbehindert fortsetzen können. Natürlich spricht für die Soziologie der Umstand, dass etwa soziales Handeln dem verbreiteten „Mittel-zum-Zweck“-Modell entspricht, vor allem, wenn es über die veränderte Form der Arbeitsteilung einen hohen Grad der Gestaltung sozialer Wirklichkeit realistisch wiedergibt. Somit wandelte sich die Gesellschaft in ihrer Selbstbestimmung zu einer „innerweltlichen Transzendenz“, die sie grundsätzlich von ihren historischen Formen ihres „Bewusstseins“ unterscheidet. Die Gesellschaft wird eben jetzt zum Ausgangspunkt aller sozialen und individuellen Erscheinungsformen. Sie erreicht hier jenen Zustand, der 41 in der Aufklärung angekündigt und als Ziel angegeben wurde. Allerdings war der Preis dieser „Modernisierung“, dass die Menschen nunmehr „soziologisiert“ oder „soziologisierbar“ erscheinen. Soziologie als soziale Biologie: Herbert Spencer Der wohl bekannteste Entwurf für eine Soziologie war im 19. Jahrhundert von Herbert Spencer geschrieben worden. Wie gerade erwähnt, galten die Bemühungen um eine Soziologie bei weitem mehr als vermutet dem Ersatz verlorener „Weltanschauung“ - die bislang in Europa noch vom Christentum formuliert war. Ähnlich Durkheim war auch Spencer von der Überzeugung geleitet, dass dieser Verlust „traditioneller“ Weltanschauung durch eine Gesellschaftsethik auf wissenschaftlicher Grundlage wettgemacht werden muss. Sie habe aber nicht allein Ersatz zu leisten, sondern sollte für die künftigen „modernen“ Gesellschaften gleichsam die ethische Handlungsanweisung sein, die auch dem künftigen Fortschritt sozialer Komplexität entsprechen muss. Spencer war von der Idee besessen, dass in allen Erscheinungsformen, seien sie nun natürliche oder soziale, ein allgemeines Gesetz oder Bauprinzip sich finden lassen müsse, woraus auch eine „Naturgeschichte“ der Gesellschaft abgeleitet werden könne. Sowohl das Denken, nun Gegenstand der Psychologie, als auch die sozialen „Tatsachen“, Gegenstand der Soziologie, würden aus diesem Prinzip entstehen. Das begünstigt die Schlussfolgerung, Erkenntnisse können vereinheitlicht werden und führen zu einer - im Sinne Spencers „synthetischen Philosophie“. Diese ist eine Art „Wissenschaftslehre“ oder gar „Wissenschaftstheorie“, deren Methode bei Spencer nach strikten Regeln der Kausalschlüsse zu immer besseren Einsichten verhilft. Als ehemaliger Ingenieur neigte Spencer zu einem funktionalen Denkgebäude, das ebenso klar sein soll wie der Plan eines Konstrukteurs. Und er ließ sich nicht davon abbringen, dass sein „Naturalismus“ den grundsätzlichen Unterschied zwischen Natur- und Gesellschaftsontologie überwinden wird. Wenn er von dem physikalischen „Gesetz“ von der Erhaltung der Kraft ausging, so war er überzeugt, dass dieses nicht allein für die Natur gilt, sondern gleichzeitig auch für die Gesellschaft. Also wirken auf die Gesellschaft die Kräfte der Natur ein und deshalb ist die Gesellschaft auch naturwissenschaftlich zu behandeln. Und die Erkenntnisse aus der Physik und Mechanik werden nun der Schlüssel für die Lösung aller weiteren sozialen Fragen. Das 42 Gesetz von der Erhaltung der Kraft bewirkt, dass Prozesse stärkerer Differenzierung, zu mehr heterogenen Einheiten und zu höherer sozialer Komplexität eintreten. Dieser Ansatz verfolgte die Absicht, die offenkundig vorhandenen Entwicklungen der Gesellschaft in ein Modell zu bringen. Es solllte nämlich das Phänomen des Auf und Ab der Kulturen oder Fortschritts erklärt werden, die „Aggregatzustände“ des Sozialen. Und es lag auf der Hand, das Modell für diese historischen Abläufe aus der Biologie zu entnehmen. So war ist für Spencer auch die Gesellschaft ein „Organismus“, dessen „Leben“ oder „Tod“ nach den Regeln der Evolution eintritt. Damit war Herbert Spencer endgültig mit der wenig ehrenden Bezeichnung eines Sozialdarwinisten „ausgezeichnet“ worden. Was für Spencer spricht, war seine Anstrengung, den „Szientismus“ von Comte zu überwinden und eine Soziologie nicht mehr aus einer alternativen Interpretation der Geschichte abzuleiten, sondern auch die Gesellschaft sei von der Evolution abhängig, vom natürlichen Fortgang des Einfachen zum „Komplizierten“ und zuweilen auch umgekehrt. Soll es also eine Soziologie geben, so wird sie in ähnlicher Weise Gesetze formulieren müssen, wie dies zuvor den Naturwissenschaften gelang. Die Methode der Ermittlung dieser Gesetze ist der schon erwähnte Kausalschluss. Mit ihm wird die Steigerung sozialer Komplexität verständlich. Gleichzeitig kann man mit diesen Ergebnissen den Enticklungsstandard einer Gesellschaft messen. Die überindividuellen gesellschaftlichen Aggregatzustände sind die Merkmale organischer Beschaffenheit, die wie alle anderen Organe entweder pathogene Veränderungen zeigen, oder eben gesund sind. Spencer verwendet für die Gesellschaft explizit die Begriffe der Evolution, wobei er den Anregungen Darwins folgt und sie in die Soziologie überträgt. Die Glaubwürdigkeit dieser Interpretation, dass eben „Naturkräfte“ auf die Gesellschaft einwirken, war recht gut geeignet, den Unterschied gesellschaftlicher Entwicklung zu erklären. Klima, Rohstoffe, die geographische Lage, der Zugang zum Meer oder die Bedingungen eines Binnenlandes prägen sicherlich Gesellschaften und deren Kulturen. Diese „Kräfte“ steuern zum Teil die Geschichte, ohne dass sich die jeweilige Gesellschaft diesen Einflüssen entziehen kann. Spencer war der Meinung, der „soziale Organismus“ ist nicht so beschaffen, dass er für diese Einwirkungen ein „Sensorium“ besitzt. Und für die späteren Soziologen wird diese Einsicht wichtig sein, denn mit dem Verständnis für diese „Naturkräfte“, mit deren Begrenzung oder deren Nutzung beginnt die Phase der „Modernisierung“ der Gesellschaften. Spencer beschreibt aber noch jenen Zustand der Gesellschaft, in der diese 43 Eingriffe noch sehr beschränkt möglich waren. Und in dieser Kulturform der Gesellschaft ist das Gesetz der Kausalität voll wirksam und es war seine Überzeugung, dass keine Regierung der Welt diese Bedingung durchbrechen kann. Vermutlich hatte Spencer diese Einschätzung übertrieben, denn aus ihr leitete er den Ablauf der organischen Gesellschaftsstruktur ab. Nun muss man berücksichtigen, dass diese „Organismus-Theorie“ keineswegs die Kompetenz der Individuen einschränkt. Im Gegensatz zu späteren politisch-totalitären Ideologien, die den Biologismus zur Entmündigung des Menschen nutzten, wollte Spencer die speziellen Funktionen der Individuen und der Institutionen im „Bau des sozialen Körpers“ darlegen. Wenn dafür die Soziologie die kompetente Wissenschaft ist, dann in der Aufklärung über das Zusammenspiel der Individuen innerhalb dieses Organismus. Wie auch immer der Zweck des sozialen Organismus definiert wird, entweder militärisch oder industriell, so ist er eben „von sich aus“ bestrebt, die Summe der Interessen zu koordinieren. Hier bedeutet Evolution je ach Zielbestimmung einer Gesellschaft entweder Militärstaat oder Industriegesellschaft. Hier weisen sie entweder erstaunliche Erfolge auf, oder aber spezifische Formen „pathogener“ Veränderung. Beide „Typen“ werden ihre adäquaten Instanzen besitzen, spezifische Aufteilungen der Funktionen, die eine Verknüpfung zwischen sozialer Differenzierung und gleichzeitiger Integration zulassen. Die Soziologie kann darüber aufklären, welcher Gesellschaftszustand wünschenswert ist und welche Mittel dafür einzusetzen wären Bei Spencer ist Soziologie eine Wissenschaft, die wegen der Einsicht in den „sozialen Organismus“ aussagen kann, welches soziales Handeln funktional erscheint, wie die Kriterien der Sittlichkeit und Ethik beschaffen sein sollen. Und hier ist auch der wesentliche Unterschied zu Auguste Comte zu erkennen: Bei Comte ist der historische Verlauf der Gesellschaft in den drei Stadien vornehmlich von der Tatkraft menschlichen Geistes bestimmt. Bei Spencer ist die Gesellschaft das Ergebnis eines „Naturprozesses“. Mit Hilfe des „biologischen Paradigmas“ konnte Spencer eine völlig andere Perspektive in die Interpretation und Analyse der Gesellschaft aufbieten, so skurril sie auch erschien. Für Comte war die empirische Vergewisserung nur über die Interpretation der Geschichte möglich, mit deren Hilfe er seine Soziologie und positive Philosophie entwerfen konnte. Bei Spencer hingegen ist erstmals die Übertragung der Naturwissenschaft auf soziologisches Denken versucht worden, so dass die Geschichte nur innerhalb der sozialen Organismen stattfindet, aber die äußeren Bedingungen sind ihrer Entfaltungsmöglichkeit entzogen. Allerdings war in der Wirkungsgeschichte das Modell Spencers zum 44 „Sozialdarwinismus“ verkommen, einerseits ein Erfolgsrezept für die Soziologie - speziell in den USA knapp vor 1900, andererseits im Verlust des humanitären Anliegens die Grundlage für modernisierte totalitäre und elitäre „Rassen-, Staats- und Gesellschaftstheorien“. Soziologie als Wissenschaft von der Modernisierung Die Nachwirkung von Herbert Spencer ist bei weitem ernsthafter zu prüfen als es in der Geschichte der Soziologie der Fall war. Seine „Entdeckung“ struktureller Differenzierung, also die Veränderung vom Unspezialisierten zum Komplexen, von „inkohärenter Homogenität“ zu „kohärenter Heterogenität“ beschreibt den sozialen Wandel erstmals nicht als historischen Verlauf, sondern mit evolutionärer Begrifflichkeit aus der Biologie. Dieser Punkt, der oben gerade erwähnt wurde, ist in der Soziologie deshalb von Bedeutung, da für Wandlungsformen Merkmale in begrifflicher Eindeutigkeit bestimmt werden sollen. Emile Durkheim und Max Weber haben sich unter dem Aspekt der Modernisierung mit diesem Spezialfall sozialen Wandels auseinandergesetzt, wobei Durkheim das biologische Modell Spencers offenbar berücksichtigte. Durkheim behauptete ja, leider in etwas verwirrender Weise, dass in der Gesellschaft der „Aufstieg“ von „mechanischer“ zu „organischer Solidarität“ beobachtet werden kann. Merkmal dafür ist die gesteigerte und komplexere Arbeitsteiligkeit. Darunter verstand er eigentlich den Wandel von familiärer oder gar bäuerlicher Kooperation zur industriellen. In dieser entwickelte sich eine ganz andere Lebensform der einander ergänzenden Individuen, deren soziale Beziehungen die bisherigen familiären erweitern, ergänzen oder gar ersetzen. Durkheim sah eben in der neuen Industriegesellschaft eine besondere Schöpfung von sozialem Organismus. Max Weber sah sich angesichts der Modernisierungen in Europa vor ein ähnliches Problem gestellt. Er vermied es allerdings, hier gleich den Begriff „Entwicklung“ oder gar „Wandel“ einzusetzen. Dennoch sah er in der Weltgeschichte jene Tendenz, dass Gesellschaften komplexer wurden, rationaler, und deren gesellschaftliche Organisation Institutionen benötigten, die es in der Geschichte vorher nicht gab. Im Zusammenspiel von Kapitalismus und bürokratischer Organisation war nicht nur eine unpersönlichere Form des „Gesellschaftlichen“ eingetreten, Max Weber sprach in diesem Zusammenhang von der „Entzauberung der Welt“, sondern sie war auch unumkehrbar geworden. Alle diese Überlegungen haben schließlich einen eigenen Zweig in der Soziologie hervorgerufen, nämlich für das Phänomen der Modernisierung ein adäquates Modell anzubieten. Es war eben später 45 Talcott Parsons, der Modernisierung speziell untersuchte und für diesen spezifischen sozialen Wandel eine eigenständige Theorie anbot. Talcot Parsons bot für sein Modell der Modernisierung fünf verschiedene Typen von Gesellschaft an, die durch eine Entwicklungsgeschichte charakterisiert sind. Von der „primitiven“ über eine „archaische“ und „mäßig fortgeschrittenen“ bis zur „modernen“ Gesellschaft läuft die Linie, die wie eine ethnologische Studie anmutet. Entscheidend ist bei den modernen Soziologen, dass sie im Unterschied zu den älteren grundsätzlich eine „traditionale“ Gesellschaft der „modernen“ entgegensetzen. Natürlich gibt es dafür gute Argumente. „Traditionale Herrschaften“, wie es Max Weber bezeichnete, verfügen über Geburtsrechte und überkommene Privilegien, haben eine feste Hierarchie und geringe soziale Mobilität. Sowohl Max Weber als auch Durkheim greifen hier auf eine wesentliche Unterscheidung zurück, die erstmals Ferdinand Toennies thematisierte. In der Gegenüberstellung und Verzahnung von „Gesellschaft und Gemeinschaft“ vermochte Toennies gerade für den Entwicklngsstand der Gesellschaften in Mitteleuropa im ausgehenden 19. Jahrhundert diese merkwürdige „Symbiose“ analysieren, dass eben Modernisierungen, die doch zur „sozialen Kälte“ neigen, außerordentliche „gemeinschaftsbildende Faktoren“ benötigen. In einem lapidaren Beispiel läßt sich dies gut zeigen: Wenn etwa Tourismus eine modernisierende ökonomische Kraft ist, so begleitet diese eine überraschende Präsentation von Brauchtum, alten Traditionen und Wiederbelebung von Riten. So leben die Menschen gleichzeitig in zwei „Welten“. Modernisierung bedeutet nicht, dass auf Gemeinschaft verzichtet werden kann, auch wenn diese oft als „rückständig“ denunziert wird. Zurück: Modernisierung wird oft als ein linearer Prozess missverstanden. „Modern“ hingegen wird jener Zustand bezeichnet, in dem ein eklatanter Wandel erkennbar ist. Es waren Historiker, die diese Zäsuren zu bestimmen suchten. Die einen meinten, die Staatenbildung im heutigen Sinn sei im 15. Jahrhundert der Beginn der Modernisierung in Europa gewesen, andere wiederum meinen, dass es die „Entdeckung“ der Individualität in der Renaissance gewesen sei. Offenbar haben hier Leopold von Ranke, der Begründer des wissenschaftlichen „Historismus“, und Jakob Burckhardt, der Architekt der „Geistesgeschichte“, Zäsuren genannt, ohne damit die Innovationen der Industrialisierung berücksichtigt zu haben. Nun hat Herbert Spencer gemeint, dass sich Modernisierung sehr gut an der Geschichte der Familie zeigen läßt. Er meinte, dass generell eine „Schrumpfung“ stattfand, von der „Großfamilie“ im ausgehenden Mittelalter bis zur „Kernfamilie“ während der Industrialisierung. So 46 plausibel diese Position auch klang, so wurde sie von Soziologen und Historikern heftig bezweifelt. Peter Laslett wies nach, dass dieser Verlauf der „Schrumpfung“ der Familie in Europa nicht linear war, für Japan ebenfalls nicht. (Peter Laslett, Household and Family in Past Time, Cambridge 1972) War damit aber ein Merkmal der Modernisierung gegenstandslos geworden? Ein weiteres Problem berührt die Analyse des Vorgangs von Modernisierung. Findet sie linear und mit jeweils vergleichbarem Ablauf statt? Stimmen die Faktoren der Modernisierung in jedem Fall überein? Spencer erweckt den Eindruck, Modernisierung sei ein Mechanismus, der ziemlich unbemerkt und sanft eingreift. Ein Argument lautete, die Urbanisierung verändere Lebensform und Bildungsstand, mache die Bevölkerung bereit für Innovationen und insgesamt hebt eine verbesserte Kommunikation die ökonomische und politische Partizipation in der Gesellschaft. Wie immer klingen diese Darstellungen glaubwürdig, aber recht bald finden Historiker oder Soziologen heraus, dass es Modernisierungen gegeben hat, die alle diese Phänomene nicht aufweisen. Skandinavien ist fortgeschritten modernisiert, verfügt über einen hohen Bildungsstandard und eine effiziente Ökonomie, ohne dass die Ursache eine steigende Urbanisierung war. Die weitere Suche nach geeigneteren Modellen bewog S. N. Eisenstadt ein flexibleres „System“ zu entwerfen. Somit kann sowohl ein Druck von außen, als auch eine „Regression zur Dezentralisierung“ im Inneren einer Gesellschaft Modernisierung erzeugen. (S. N. Eisenstadt, The Political Systems of Empires, Glencoe 1963 und ders., Tradition, Change and Modernity, New York 1972) Eine Alternative zur Erklärung von Modernisierung hat weit früher schon Norbert Elias angeboten und in seinem Modell zwei Varianten angeboten. In der Soziogenese westlicher Zivilisation zeigte er „zwei Hauptrichtungen struktureller Veränderungen der Gesellschaft......jene, die zu wachsender Differenzierung und Integration führen, und jene, die zu abnehmender Differenzierung und Integration tendieren.“ (Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, 2 Bde., Basel 1939) Diese Überlegung läßt sich in den verschiedenen Phasen der Geschichte nachweisen, vor allem in der konfliktreichen Geschichte Europas, wo etwa die militärische „Konkurrenz“ zwischen Staaten oder Ländern die soziale Integration förderte und gleichzeitig die Differenzierung in der nötigen Durchorganisation der militarisierten Gesellschaft anstieg. Natürlich darf bei dem Begriff „Modernisierung“ Karl Marx nicht fehlen. Er war ja gleichsam der Spezialist für sozialen Wandel. Er wählte als Darstellungsmittel die Produktionsformen in der Gesellschaft. Wenn der gesellschaftliche Anteil an der Güterproduktion sinkt, innere Widersprüche in der Gesellschaft erzeugt, können Klassenkonflikte, 47 Revolutionen die Folge sein. Dieser Rückschlag wird durch die Veränderung der Produktionsverhältnisse nach dieser Zäsur aufgefangen und drängt die Entwicklung der Gesellschaft in Richtung auf Fortschritt und Modernisierung. Keine Gesellschaft mit Sklavenhaltung konnte bestehen bleiben, auch keine Feudalgesellschaft, sie alle müssen im Gleichschritt des Fortschritts den Weg über Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft zum Sozialismus und Kommunismus einschlagen. Wie Herbert Spencer erklärt auch Marx die Modernisierung durch das Einwirken endogener Faktoren auf die Gesellschaft - hier also die Produktionsverhältnisse, allerdings mit einem variantenreicheren „Modell“. Marx argumentiert vorerst aus einer „negativen“ Position: Es kann Gesellschaften geben, die rückständig sind und auch bleiben; eine „Entwicklung zur Unterentwicklung“, die südamerikanische Staaten im 20. Jahrhundert heimsuchte. Es kann wiederum Gesellschaften geben, die einen Rückschritt bewusst einleiten - etwa in einer Refeudalisierung, die nach französischer Revolution und Napoleon eingetreten war. Das Modell von Marx konzentrierte sich vorwiegend auf Modernisierung durch Industrialisierung und den daraus abzuleitenden Folgen ökonomischer Ungleichheit, währen Spencer eher Evolution und Anpassung als Antriebsmomente für Modernisierung anführte. Es lag auf der Hand, dass später sowohl in der Geschichtswissenschaft, als auch in der Soziologie Synthesen beider Modelle versucht wurden. (Einen Überblick bietet Peter Burke, Soziologie und Geschichte, (Sociology and History, London 1980) Hamburg 1989, S. 111ff.) Soziologie als „Naturwissenschaft“ Wenn die Soziologie Gesellschaft analysieren will, so kann damit auch der Eindruck entstehen, die Individuen gleichsam zu „instrumentalisieren“, also zu Spielfiguren in ihrer Gesellschaft zu machen. Nun lieferten die Entnahmen theoretischer Konzepte aus den Naturwissenschaften und die eigenständigen Entwicklungen von „Bevölkerungslehre“ und Statistik seit dem 18. Jahrhundert ideale Begründungen für eine Sozialwissenschaft, die die Gesellschaft als eine besondere „Spielart“ der Natur interpretierten. Natürlich muss man immer berücksichtigen, dass die labilen sozialen Verhältnisse im 19. Jahrhundert nicht nur nach Reform und Reorganisation verlangten, nach Erziehung und Bildung, sozialer Gleichberechtigung und Emanzipation, sondern die Soziologie hatte sich ja auch als Wissenschaft verstanden, eine geeignetere soziale Ordnung ermitteln zu können. Dieses, bereits erwähnte Motiv bewog etwa Adolphe Quételet, ein Zeitgenosse von Auguste Comte, zu der Hypothese, dass die Taten und Handlungen der 48 Individuen bei „massenhaftem“ Auftreten in der Gesellschaft eben Gesetzen folgen, die vermutlich nach ähnlichen Kriterien strukturiert sind wie sie unter anderen Bedingungen in der Natur schon beobachtet wurden. Unter dem Einfluss der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie konstruierte Adolphe Quételet „soziale Tatsachenreihen“, die er von Charles Fourier und Pierre Laplace ableitete. „Both of these men....had analysed statistical social data. This combination of abstract mathematics and social reality obviously provided the ideal convergence of the two lines along which Quételets mind had developped.“ Paul Lazarsfeld, Notes on the History of Qualification in Sociology; in: Isis, Vol.52 (1961) S. 277) Die Konsequenz für Quételet war, dass die Gesellschaft wie ein physikalischer Körper ist und daher Naturgesetzen unterworfen. Wenn diese Hypothese gilt, dann sind soziale Erscheinungen „physische“. Quételet nahm wirklich den Wunsch Comtes nach einer „sozialen Physik“ wörtlich und behauptete, dass ein „allgemeines Gesetz“ die moralischen und intellektuellen Eigenschaften der Völker ebenso beherrscht wie die physischen. Jeder Mensch ist von diesem „geheimnisvollen Band“ umgeben und es setzt sich auch in den Handlungen durch. Die Statistik lässt erkennen, dass selbst individuelle Verhaltensweisen wie Heirat, Verbrechen oder Selbstmord zum „Budget“ des „Gesellschafts-Organismus“ zählen. Die Gesellschaft „toleriert“ solche Entwicklungen, ist aber zugleich jene Instanz, die eine Besserung dieser Bedingungen anstrebt. Die statistische Bestimmung des „homme moyen“, des Durchschnittsmenschen, erlaubt die Beobachtung und Messung der Abweichungen. Es ist somit auch eine Prognose möglich, die Ermittlung eines „Mittelwerts“ sozialen Verhaltens. Diese Daten ergeben die Voraussetzung für eine befriedigendere soziale Ordnung. (Adolphe Quételet, Zur Naturgeschichte der Gesellschaft, dt. A. Runge, Stuttgart 1838; zit. nach Michael Bock, S.10) Diese versuchte Formalisierung sozialer Prozesse durch Quételet war eine unglaublich bedeutende Anregung in der Soziologie, nämlich aus ihr eine empirische Sozialwissenschaft zu machen. Bislang war sie ja eher im geisteswissenschaftlichen Bereich angesiedelt. Diese Methode von Beobachtung und Messung, was dem „gelernten“ Astronomen „Quételet nicht schwer fiel, fand zwar viel später Nachahmer, aber dafür sehr erfolgreiche. Ihnen gelang es speziell nach dem 2. Weltkrieg, die Methoden der Beobachtung und Messung so zu spezialisieren, weshalb die Rolle der Geschichtswissenschaft in der Soziologie eklatant an Bedeutung verlor. Der Anspruch von Quételet, der bis dahin fast als utopisch abgesehen werden konnte, wurde eingelöst und in den Meinungsforschungen und -analysen, in Erhebungen und Befragungen war man großteils überzeugt, wirklich ein reales Abbild der Gesellschaft 49 skizziert zu haben. Quételet schuf dafür die „wissenschaftstheoretische“ Voraussetzung: „Übrigens sind die Gesetze, nach welchen sich die Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft regulieren, nicht wesentlich unveränderlich; sie können sich zugleich mit der Natur der Ursachen, denen sie ihre Entstehung verdanken, ändern; so haben die Fortschritte der Civilisation eine Änderung der Gesetze der Sterblichkeit zur nothwendigen Folge gehabt, wie sie auch auf die physische und moralische Seite des Menschen von Einfluß sein müssen....gerade auf diese Modifikationen müssen die Freunde der Menschheit ihr Augenmerk lenken. ....“ (ebd. S. 11) Natürlich besaßen die empirischen Forschungstechniken noch keine Zuverlässigkeit, wie es später der Fall. Eine Alternative zur Statistik und Mathematik entwickelte Frederic Le Play, der seine Empirie als „teilnehmende Beobachtung“ verstanden hatte. Mit deren Hilfe beschrieb er die Lebensumstände der Menschen quer durch Europa, reiste von Frankreich bis Russland, um einerseits den sozialen Wandel aus der Tradition der Lebensform herauszulösen, andererseits damit die Vorteile traditionalistischer gegenüber moderner Lebensweise zu eine unterstreichen. Le Play unterstützte die konservative Position der Sozialreform und vermutlich erlaubte diese Reihe von Beobachtungen, die er in seiner Soziographie als „soziales Inventar“ bezeichnete. Darunter hatte er die Aufzählung aller Gebrauchsgegenstände im Alltag gemeint, die Arten traditionellen Wirtschaftens in der bäuerlichen Bevölkerung, die Familienstrukturen und Gewohnheiten. Nun zeigt dieses „Inventar“ natürlich den sozialen Wandel ebenso wie die regionalen Unterschiede, gar nicht zu reden von den kulturellen. Le Play geht davon aus, dass die Familie der Maßstab der Gesellschaft ist und nur in ihr findet die „soziale Evolution“ statt, die Veränderung von Bewusstsein und Lebenseinstellung. In der Sozialgeschichte war ja schon argumentiert worden, in der Familie werde Stabilität und Kontinuität vermittelt, Revolutionäres wird grundsätzlich als Irrtum qualifiziert und gleichzeitig erfolgt in der Sozialisation eine deutlich Prägung für eine künftige Lebensform. (Vgl. Frederic Le Play, Les ouvriers Europeéns, Tour 1877-1879) Nun waren die Monographien von Le Play auf sehr skeptische Leser gestoßen und die Anerkennung als Soziologe war ihm generell versagt geblieben. Dennoch war er der Pionier des soziologischen Empirismus, denn seit diesem verfolgte die Sozialforschung den Zweck, nur eine empirisch aufbereitete Grundlage könne die Gesellschaftsreform fördern und auf induktivem Weg Probleme der Gesellschaft lösen. Nach Quételet und Le Play wurden die sozialwissenschaftlichen Methoden weiter entwickelt. Ein weiterer Schritt war die „Survey-Studie“ von Charles Booth. Da hatte er erstmals konkrete Erhebungstechniken 50 bei befragten Personen angewendet, um die Kategorie „Armut“ in ihren Dimensionen darzustellen. Diese Analysen ließen die soziale Frage als Fundament ausstehender Gesellschaftspolitik erkennen und Booth fügte seinen Analysen noch eine protestantisch fundierte Sozialethik hinzu. Er stand auch der englischen Gewerkschaftsbewegung nahe, plädierte wie fast nahezu alle Soziologen des 19. Jahrhunderts für eine Erziehungsund Schulreform, trat für die Bildung der Arbeiter ein und zählte zu den ersten Mitgliedern der Labour Party. Interessant bei Charles Booth war nicht nur die Mischung aus Wissenschaft und sozialem Engagement, sondern mit der Erhebung von Armut disqualifizierte er die „Charity-Programme“ bürgerlicher Gesellschaft, da er ihnen nachweisen konnte, nichts für eine allgemeine Lage der Arbeiter zu bewirken, aber sehr viel für den heuchlerischen Selbstbetrug. Grundsätzlich ist Wissenschaft von Engagement nicht zu trennen. „Science must lay down afresh the laws of life....I feel assured that the principles of Positivism will lead us on till we find the true solution of the problem of government. We are on the right road, let us advanced with a good heart...“ (T.S. Simey, Charles Booth, Social Scientist, Oxford 1960. Dann: Charles Booth, Life and Labour of the People of London, London 1892-1902) Im 19. Jahrhundert schien sich die Sozialforschung noch innerhalb der geisteswissenschaftlichen Theorien zu bewegen, wie diese bei Auguste Comte geläufig waren. Soziale Ordnung, Fortschritt und Emanzipation waren die Ziele. Es waren heroische Versuche. Der Szientismus des 18. Jahrhunderts hatte sie angeregt. Damit wurde der Glaube an die Wissenschaft gestärkt und daraus die Hoffnung geschöpft, die Menschen aus ihrem sozialem Elend zu befreien. So unterschiedlich die einzelnen europäischen Staaten und die USA diese Frage auch beantworteten, gemeinsam war ihnen, dass Sozialpolitik vis a vis der herrschenden Ökonomie ein ebenbürtiges Thema ist. Das hatte nicht nur den „Charakter“ der Staaten geändert, wenn sie die Verpflichtung zur Intervention im ökonomischen Prozess offiziell in die Regierungspolitik übernahmen - oder nicht, sondern jetzt war wirklich ein deutlicher Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft eingetreten, deren Verbindungen bislang „fließend“ waren. Parallel zu den Ausformulierungen ökonomischer Theorien, die gerade am Ende des 19. Jahrhunderts eine hohe Bedeutung erlangten, hatte sich auch die Soziologie adäquat profiliert. Für die Sozialforschung war es die Grundlage für weitere Untersuchungen. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wollte George Lundberg eine Sozialwissenschaft wiederum wie eine Naturwissenschaft entwerfen, wofür er experimentelle Methoden der Psychologie nutzte. Durch diese Mischung, hier „soziale Naturwissenschaft“, dort die psychologische 51 Interpretation der handelnden Individuen, gelang ihm erstmals für die künftige empirische Sozialforschung eine entscheidende Reduktion: die Klassifizierung sozialen Handelns nach Kriterien des Verhaltens. An diesem Punkt muss es auffallen, dass über die empirische Wende der Soziologie das autonome Handeln der Individuen zu einem reaktiven Verhalten wurde. Es war eine gelungene Vereinfachung. Wenn nämlich gelten soll, dass soziale Phänomene natürlichen gleichen, so ist mit der Reduktion von Handeln auf Verhalten die Unsicherheit du Unmessbarkeit soziologischer Vorannahmen fast beseitigt. Also lassen sich soziale Verhaltensweisen systematisieren und nach Anpassungsleistungen ordnen. Gewiss waren die Untersuchungen der Anpassungsleistungen nicht deterministisch zu verstehen - wie etwa bei tierischem Verhalten, aber man war überzeugt, der Mensch begegnet den Herausforderungen seiner Umwelt mit der Tendenz zu Interessenausgleich und Anpassung, die er mit der Sozialisation in Familie, Schule und Arbeitswelt erlernte. Die sinnhafte Struktur individuellen Handelns, dessen Motive können deshalb vernachlässigt werden, das Wille, die Zwecke und Ziele, die Werte selbst letztlich nur Ergebnisse einer Anpassung zu sein scheinen. Dieser Schritt erleichterte der Sozialforschung den Zugang zu den Erscheinungsbildern der Gesellschaft. Daraus entstanden Theorien, die als realistische Darstellungen der Gesellschaft die Trennung zwischen Theorie und politischer Praxis aufheben. Diese empirischen Sozialwissenschaften schienen nicht im „elfenbeinernen Turm“ zu verharren, sondern zeigten sich eben anwendbar. War zuvor das „Kausalgesetz“ schon ein plausibles Modell für Erklärungen, so wurden nunmehr Hypothesen über soziale Funktionszuordnungen oder Systemnotwendigkeiten sehr anschauliche Modelle geworden, die den Weg von der „schlechten“ zur wünschbaren sozialen Wirklichkeit klar markieren wollten. Jetzt erhielten die bereits erwähnten Begriffe ihre Bedeutung, ihren Erklärungswert und jene Dimension, die die „Mehrdimensionalität“ des Sozialen zu ordnen vermochten. Soziale Rollen waren hier in die Theorien ebenso integrierbar wie Funktionen und Systeme, soziale Schichten und soziale Mobilität. So konnte man der festen Überzeugung sein, dass die Soziologie nunmehr wirklich eine Wissenschaft geworden ist. Gewiss waren die vielen Ergebnisse der Sozialforschung unentbehrlich für das gesellschaftliche Selbstverständnis oder für die politischen Zielvorstellungen. Die empirische Sozialforschung konnte zum „praktischen Gesellschaftswissen“ werden, deren Bedeutung weder von der Ökonomie noch von der Politik übersehen werden konnte. Ja, für die Sozialwissenschaften insgesamt war die Soziologie eine fundierende Wissenschaft geworden. Der Preis war, dass alle die ie Gesellschaft 52 betreffenden Fragen gleichsam in sachlich-technische Probleme verwandelt wurden und deren Lösung war zum Greifen nahe. Allerdings hatte man zu wenig berücksichtigt, dass durch die politische Entwicklung Europas im 20. Jahrhundert, die gewaltige Krise der beiden Weltkriege eine „Gesellschaft“ begünstigten, die in ihrem Zuschnitt außerordentlich homogen geworden war, wegen der Konflikte die sozialen Binnenstrukturen gestärkt wurden und die Abgrenzungen gegenüber den Nachbarn, „Anderen“ und „Fremden“ die Integration förderte, andererseits darüber willkürlich entscheiden wollte, wer nun für integriert gilt und wer nicht. Diese Ausführung mag angesichts der wachsenden Bedeutung empirischer Sozialforschung paradox erscheinen. Es scheint aber wirklich ein soziologisches Gesetz der Paradoxie gegeben zu haben, dass alle jene Motive, die die „Vergesellschaftung“ verstärkten, zugleich in der Gesellschaft den Effekt des Ab- und Ausstoßens förderten. So kann man fortsetzen, dass in dem Maß Gesellschaft über empirische Methoden beleuchtet werden kann, sie in jenem Umfang alle wünschenswerten Eigenschaften einbüßt, von denen man meinte, sie würden über sozialwissenschaftliche Steuerungen erreichbar sein. Die Alternativen in der Soziologie - Max Weber und Georg Simmel Soll wieder ein „roter“ Faden in der Darstellung aufgenommen werden, so wird das nur über eine Wiederholung der Perspektiven möglich sein, die am Anfang genannt wurden. Der ausschlaggebende Punkt für die Soziologie war ja die Bewertung der beiden Ereignisse: französische und industrielle Revolution. Sie waren sichtbare Merkmale eines tiefgreifenden Wandels in Europa gewesen. Die Interpretation verwendete dazu die Erkenntnisse aus Szientismus und späterem Positivismus. Daraus sah man sich in der Annahme bestärkt, die Gesellschaft ist zugleich Subjekt und Objekt der Veränderung. Man musste sich aber auch fragen, was denn Gesellschaft ist? Sollte eine Antwort weiterhin in die Kompetenz der Sozialphilosophie fallen, so würden wesentliche Faktoren nicht verstanden werden können. Allein die Form von Entwicklung oder Wandel, die ökonomischen Umstellungen eröffneten neue Dimensionen, die offenbar nach der Zuständigkeit einer neuen Wissenschaft verlangten. Für den „Wissenschaftssoziologen“ ist es ja interessant, dass diese neuen Fragestellungen nicht mehr innerhalb der Universitäten behandelt wurden, von diesen kaum wahrgenommen wurden, sondern „Privatgerlehrte“, Schriftsteller und journalistisch versierte Beobachter 53 wurden auf die neuen Probleme aufmerksam. So kam es zur Soziologie wie zu den meisten technischen Erfindungen im 19. Jahrhundert durch „Amateure“. Das hat die Soziologie die längste Zeit geprägt. Es war eigentlich erst Max Weber, der der Soziologie einen kompetenten universitären Rang verlieh. Und dennoch war man sehr optimistisch gewesen, dass diese junge Wissenschaft ihre Aufgaben lösen werde. Im Unterschied zum 19. Jahrhundert ist man heute weit skeptischer, ob die Soziologie ihrem Thema auch gerecht werden kann. Man sah sehr deutlich, dass zwar die Erfolgsgeschichte der Soziologie dadurch beschleunigt wurde, indem sie sich als Naturontologie der Gesellschaft positionierte. Hätte man sich von Anfang an aus der Gesellschaftsontologie abgeleitet, wäre natürlich die Schwierigkeit größer gewesen, sich von der traditionellen Sozialphilosophie zu emanzipieren und der Erfolg wäre auch geringer gewesen. Diese Verwicklung stellt sich heute als eine Belastung für die Soziologie dar. In der deutschen Tradition, jedenfalls bis zum Beginn des Nationalsozialismus, war Soziologie als „Geisteswissenschaft“ präsenter und wehrte sich entschieden gegen eine naturwissenschaftlich entworfene Soziologie. Der Einwand von Wihelm Dilthey, geisteswissenschaftliche Erkenntnis unterscheide sich grundsätzlich von naturwissenschaftlicher, war ein wichtiger Schritt für eine „andere Soziologie“. Noch auf Geschichts- und Kulturwissenschaften konzentriert, behauptete Dilthey, in diesen Wissenschaften könne es weder eine naturwissenschaftliche Systematik geben, noch das Ideal der positivistischen Hoffnung auf eine „Einheit aller Wissenschaften“. Comte, John Stuart Mill und Herbert Spencer hatten sich zwar diesem Ideal verschrieben, doch unterdrückten sie den Gedanken, der menschliche Geist sei fähig, die geschichtlich-gesellschaftliche Welt als Wirklichkeit zu erfahren. Die Übernahme von Methoden aus den Naturwissenschaften erlaube nur, so hatte Dilthey argumentiert, die äußere Erscheinungswelt der Gesellschaft zu beschreiben, über kausale Erklärungen zu zeichnen, hingegen bleibt der Erfahrungshorizont der Menschen unberücksichtigt. An diesem Punkt läge die Funktion der Geistes- und Sozialwissenschaften, nämlich eine realen Bezug zu ermitteln, der das individuelle Verstehen sozialer Umwelt wiedergibt und den Zugang zum „Sinnverstehen“ von Geschichte, Geist und Gegenwart erlaubt. (Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaft (1883), Band 1, Leipzig 1923, S. 9ff. und S. 36) Dilthey war klar geworden, dass es sicherlich eine Reziprozität zwischen den „Systemen der Kultur“ und der „Organisation der Gesellschaft“ gibt, aber erst die Unterscheidung belehrt über die unterschiedlichen Funktionen. Die „Systeme der Kultur“ beziehen sich auf 54 Zweckzusammenhänge, die die menschlichen Erwartungshaltungen gesellschaftlich vermitteln, die „soziale Organisation“ hingegen formt das soziale Leben durch Gemeinschaftsbeziehungen und Herrschaftsverhältnisse. Die Völker sind die Träger beider Elemente und sind das Subjekt sozialer Bewegung. Dieses Subjekt kann durchaus eine konkrete Eigenart besitzen, die über Herrschaftsverhältnisse geprägt werden kann, wie durch Sprache, Religion und Kunst, also durch kulturelle Bestände im Bewusstsein des Subjekts „Volk“. Die Geschichtsschreibung selbst konnte diese Beziehung zwischen Kultur und Organisation der Gesellschaft nicht befriedigend lösen, so Dilthey, weshalb sie auch die Wirklichkeitserfahrung nicht vergegenständlichen konnte. Es war dies der späteren Entwicklung der Sozialgeschichte zu verdanken, dieses Thema ernsthaft zu analysieren. Dieses Missverhältnis hatte man durch „Bewegungsgesetze“ auszugleichen versucht, eben durch naturwissenschaftliche Methoden eine Gesellschaftslehre zu entwerfen. Damit wurde die konkrete Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft in den Sozialwissenschaften getrennt. So konnte man sich auf das Phänomen bürgerlicher Gesellschaft konzentrieren, vernachlässigte aber alle weiteren Faktoren, die ebenfalls eine Gesellschaft formen und formten. Unter diesen Auspizien hatte die Soziologie begonnen, hatte aber zugleich auf eine hinreichende sozialphilosophische Grundlage fast verzichtet. Sie verschrieb sich einer „naturalistischen“ Metaphysik der Geschichte und näherte sich ihrem Untersuchungsgegenstand „Gesellschaft“ durch „soziale Physik“. Also konnte sie sich aus der wissenschaftstheoretischen Fundierung der Geschichtswissenschaft emanzipieren und orientierte sich „kausalistisch“, wenn sie die Beziehungsform des Individuellem zum Allgemeinen, des Speziellen mit generalisierten Begriffen zu erklären begann. Da ja auch die Geschichtswissenschaft eine empirische ist, der Erforschung der Gegenwart eine historische Dimension zu verleihen vermag, so hätte die Soziologie in der Geschichte eine Instanz besessen, um die Analyse der Gegenwart entschiedener aus der Spekulation oder Ideologieproduktion zu lösen. Diese gewaltige Kritik ist deshalb bedeutend, da sie Max weber und Georg Simmel nachhaltig beeindruckte. Wenn Gesellschaft eine höchst unspezifische Bedeutung hat, so begegnete Simmel diesem Mangel dadurch, dass er den organisch-historischen Begriff von der Gesellschaft durch eine Vielzahl sozialer Wechselbeziehungen ersetzte. Es mag schon sein, so dachte Simmel, dass unter speziellen Bedingungen historische Fakten, Inhalte, Zäsuren und Neuschöpfungen ihre Ursache in sozialen Verhältnissen haben, so habe man dies einer „Erkenntismethode“ zu verdanken, aber noch nicht einer selbständigen 55 Wissenschaft. Hier sei noch keine Soziologie nötig, denn die bisherigen Geisteswissenschaften bieten gleiche und vergleichbare Leistungen an. Simmel fügte hinzu, im Grunde enthalten bereits Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre und Religionsgeschichte genügend Soziologie. Aufgabe der Soziologie ist es, die Formen der Vergesellschaftung zu untersuchen. Diese „formale Soziologie“ analysiert die Interaktionen der Individuen, inwieweit sie zum Aspekt der Gesellschaft beitragen und daher diese begründen. Dabei sind die individuellen Handlungen nicht psychologisch zu deuten, nämlich Absichten und Motive zu entschlüsseln, sondern inwieweit sich diese Handlungen gesellschaftliche Geltung verschaffen und die längste Zeit ohne jede Absicht die Gesellschaft zu strukturieren beginnen. Will man dafür ein Beispiel wählen, so könnten wir an ein Gesellschaftsspiel denken. Bei Beginn des bekannten Spiels ist sich jeder Teilnehmer über die Regeln im Klaren. Dennoch verläuft jedes Spiel anders. Simmel hätte sich die Frage gestellt, auf Grund welcher Spielzüge und -handlungen so viele Varianten des Spiels möglich waren. In einem Spiel wurde auf einen Pechvogel mehr Rücksicht genommen, in einem anderen dominierten stille Absprachen oder es wurden sogar kleine Schwindeleien toleriert. Alle diese Interpretationen der Spielhandlung bewegen sich innerhalb des Regelwerks des Gesellschaftsspieles. Es erfährt seine Verwirklichung in höchst unterschiedlicher Weise. Simmel war offenkundig ein Pragmatiker. Gesellschaft lässt er als Sammelbegriff gelten, aber sie ist grundsätzlich erst dort real vorhanden, wo Menschen in Wechselbeziehung treten. So ist für Georg Simmel Gesellschaft immer im Werden. Deren Entwicklungsgrad ergibt sich aus der Qualität der Sozialisationen. Damit hält er die Optionen der „Spieler“ offen, nämlich mehr oder weniger an Vergesellschaftungen teilzunehmen. Es ist ja denkbar, dass ich morgen die Teilnahme am Spiel ablehne. Für den Soziologen sind die Menschen schlechthin Grenzfälle. Er muss ja entscheiden, welche Handlungen für die Soziologie relevant sind und welche nicht. Der Nutzen dieser Idee Simmels war schnell zu erkennen: Er befreite die Soziologie aus der „Zwangsvorstellung“, eine „Gesetzeswissenschaft“ sein zu müssen. Daraus folgt, dass zeitgenössische Gesellschaft und deren Kulturgeschichte nicht um jeden Preis eine Übereinstimmung besitzen müssen und unabhängig voneinander betrachtet werden können. So kann man Gesellschaft einerseits gemäß „formaler Soziologie“ nominalistisch bestimmen, andererseits als Vergesellschaftung funktionalistisch. Eine Gesamtdeutung des Begriffes „Gesellschaft“ verbleibt im Feld der Philosophie, die aber nichts mit der exakten 56 Erforschung von Wechselwirkung und Kausalbeziehung - dem Bereich der Soziologie - zu tun hat. Im Unterschied zu Georg Simmel errichtete Max Weber das Gebäude einer „verstehenden Soziologie“. Wie erwähnt, empfand er die Kritik von Wilhelm Dilthey als eine Herausforderung und konstruierte seine Soziologie als eine empirische Geisteswissenschaft. Seine Position wird dort deutlich, wo er im „Methodenstreit“ in der Nationalökonomie um 1880 ein theoretisches wie methodisches Konzept vorstellte, das genau die Mitte zwischen den Streitparteien wählte: zwischen Gustav Schmoller und Karl Menger. Was war geschehen? Für Gustav Schmoller und dessen „Historischer Schule der Nationalökonomie“ galt die Entwicklung ökonomischer Begriffe als Ergebnis historisch-empirischer Forschung. Immerhin handelte es sich um so wichtige und fundierende Begriffe wie „Markt“! Karl Menger und dessen „österreichische Schule“, die auch als psychologische bezeichnet wurde, waren überzeugt, dass etwa die Funktion des Marktes über Angebot und Nachfrage geregelt werde, so dass man daraus ein „Gesetz“ ableiten könne, das etwa über die Preisentwicklung Auskunft gibt. So trennte er die traditionelle Theorie von der Empirie. War für Schmoller eine Erkenntnis in der Wissenschaft ein Wert, den die Wissenschaft kreierte und darin auch ihren Sinn empfängt, vertrat die „österreichische Schule“ die Ansicht, in der Wissenschaft gehe es nicht um die Konstruktion von Werten, die sogar ideologisch sein können. (Karl Menger, Untersuchungen über die Methoden der Sozialwissenschaften, Wien 1883) Max Weber stimmte beiden Seiten nur bedingt zu. Er stimmte überein, dass die Geistes- und Kulturwissenschaften, insbesondere die Geschichte einer Grundlage bedürfen. Aus ihnen gewinnt man das Anschauungsmaterial, das gerade Max Weber grandios zu nutzen verstand. Die Wissenschaft verfehlt aber ihr Thema, sollte sie etwa historische Entwicklungen gemäß sozialpsychoilogischer Axiome zu ordnen beginnen. Es war eine Kritik am Historiker Karl Lamprecht und dessen deutscher Geschichte. Ebensowenig ist es zulässig, ein soziologisches Modell nach biologischen Kriterien zu errichten - das war gegen Herbert Spencer. Es komme zwar häufig zur Sammlung wiederkehrender Phänomene, die zur Annahme verleiten, es könne eine soziale Gesetzmäßigkeit geben, aber damit wird der Untersuchungsgegenstand vergewaltigt. Es wird eben die Spannung zwischen einem „stationären“ Zustand und singulären Ereignissen unterdrückt. Es gibt ja auch „Massenerscheinungen“, die individuellen Charakter besitzen können wie es individuelles, einzelnes Handeln ebenso zeigt. Kurzum: Der Erkenntniswert wäre gering, 57 konstatierte Max Weber. (Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1985, S11, S.48) Nun versah Max Weber seine Skizzen und Entwürfe sehr sparsam mit der Bezeichnung „Soziologie“. Ihm war es darum zu tun, den soziologischen „Naturalismus“ grundsätzlich abzuwehren. Das heißt, soziale Gesetze seien nicht geeignet, eine Erkenntnis sozialer Wirklichkeit zu vermitteln, sondern es müssen aus der Kulturwissenschaft idealtypische Begriffsbildungen gewonnen werden, Viel zu oft stand in der französischen oder englischen Soziologie ein organisch gefasster, szientistischer oder ein naturalistisch gewonnener Gattungsbegriff der Menschen im Mittelpunkt, von dem aus der Werdegang der Vergesellschaftung abgeleitet wurde. Wenn nun die Konstruktion des Idealtypus das Ergebnis der Untersuchung Webers war, so soll er eine objektive Hilfskonstruktion sein, um die unterschiedlichen historischen Kausalbeziehungen zu charakterisieren. Max Weber bot dafür das Beispiel im berühmten Aufsatz: Geist des Kapitalismus und protestantische Ethik. Hier führte er aus, dass in der europäischen Welt ein spezifischer Rationalismus der Lebensführung begünstigt wurde und vermutlich mit den Wirkungen reformierter Ethik den Kapitalismus erzeugte. Sein Konstruktionsmodell war, seine Handlungstheorie mit den Typen der Herrschaftsformen konfrontiert zu haben. Mit der Bestimmung des „typologischen Ortes“ durch Weltreligion und deren Säkularisierung wurde eine Selektion sozialen Handelns vorgenommen. Da sie zur Herrschaftsform hinzugezählt wurde, förderte sie den Prozess der Institutionalisierung und Vergesellschaftung. Wissenschaftstheoretisch wichtig war dabei, dass Max Weber sein Erkenntnisinteresse stets formulierte, von dessen Aktualität ausging und hierauf sein grundbegriffliches und typologisches Ordnungsschema auf die Fragestellung anwendete. Und dieses Vorgehen nannte er „verstehende Soziologie“. In ihr ging es nicht um gesellschaftstheoretische Fragen, die spätere Soziologen ihrer Wissenschaft zur Pflicht auferlegten, sondern um Erklärungen von Vergesellschaftungsprozessen im dynamischen und funktionalen Sinn. Max Weber ging grundsätzlich dem „Kollektivbegriff“ Gesellschaft aus dem Weg, er sah in ihm kein verallgemeinerbares Handlungssubjekt, sondern zog es vor, den Sinn individuellen wie sozialen Handelns zu ermitteln, die Intentionen des Handelns zu untersuchen. Aus ihnen ergeben sich die sozialen Gebilde und können zugleich die einzelnen Teilnehmer daran integrieren. Diese „verstanden“ sich eben darin, kannten den „Sinn“ ihrer Handlungen und vereinten sich zu Kollektiven. Diesen stehen dann Institutionen zur Seite, die über die Herrschaftsformen ihre Dauerhaftigkeit, Haltbarkeit und Regeln 58 erhielten. Hier beginnt die Soziologie ihr Eigenleben als Wissenschaft und emanzipiert sich von der Geschichtswissenschaft. In den Grundbegriffen der Soziologie stellte Max Weber den Katalog her, nach welchen Kriterien das „Soziale“ beschrieben und gedeutet werden kann. Und in keinem Punkt lässt er Zweifel darüber aufkommen, dass es sich um Konstruktionen und Modellbildungen handelt, die soziale Prozesse, Ereignisse, Phänomene zwar erklären, aber hypothetisch sind. Sie sind erst dort als Wirklichkeiten zu erachten, wo die Ergebnisse im Kontroll- und Vergleichsverfahren, etwa kulturhistorisch oder juristisch, eine hohe Plausibilität erwerben konnten. So ist die Soziologie vornehmlich die Spezialistin für Kulturvergleich. So war für Max Weber der Begriff „Gesellschaft“ nebulos, so nicht eine kulturwissenschaftliche Fundierung unternommen wurde. Da um 1900 unter den Soziologen die Frage debattiert wurde, ob ihre Wissenschaft eine „Gesetzes- oder Wirklichkeitswissenschaft“ sei, würde Max Weber mit der verstehenden Soziologie eher für die zweite Variante votiert haben. (Vgl. Soziologie und Anti-Soziologie. Ein Diskurs und seine Rekonstruktion, hrsg. Peter Merz-Benz, Gerhard Wagner, Konstanz 2001) Wie sich Begriffe ändern..... Selbst die Langlebigkeit von Terminologien, zum Beispiel System und Struktur, Gemeinschaft und Gesellschaft, Funktion und soziale Rolle, kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die moderne Gesellschaft im 20. Jahrhundert vornehmlich über Gegensatzpaare definiert wird. Später wird zu zeigen sein, dass dieses Schema von den „Bindestrich“Soziologien abgelöst wurde, indem man den Untersuchungsgegenstand schon durch dessen Spezialität und Eigenschaft festlegte. Bis dahin setzte die Soziologie eine Wissenschaftstradition fort, die schon im 19. Jahrhundert den sozialen Wandel über Formenbildungen zu beschreiben versuchte. Gemeinschaft und/oder Gesellschaft, sozialer Status oder Gesellschaftsvertrag, mechanische oder organische Solidarität waren Begriffspaare, die dichotomisch gebildet den Zweck erfüllen sollen, Modernisierung zu veranschaulichen. Darin war die Hypothese verborgen, die Durkheim etwa aufstellte, es ließen sich „anonyme“ Gesetzmäßigkeiten oder „Proportionen“ ermitteln, die das 59 sinnhafte soziale Handeln des Menschen eingrenzen. Die Konzentration auf „Vergesellschaftung“ blendete die vielen Typen der Sozialisationen aus und zwang die Soziologie zur engen Definition sozialer Gruppen. Daher behauptete Robert Merton: „All groups are, of course, collectivities, but those collectivities which lack the criterion of interaction among its members are not groups.“ (Robert Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe 1957, S. 299) Das Ergebnis dieser terminologischen Spezialisationen war, dass sich die Soziologie immer häufiger auf „small groups“ stürzte, daraus eine Soziologie und Theorie kleiner Gruppen formulierte und hoffte, mit der gelungenen Analyse würde sich der Nachweis erbringen lassen, dass es in sozialen Einheiten Gesetzmäßigkeiten gibt. Im Rückblick auf die Eigenart von Vereinen und Gruppierungen wird man erkennen, dass in ihnen ja Interaktion zwischen den Mitgliedern gefordert ist. Soziale Gruppen erfüllen zwar nicht immer die Kriterien der Organisationssoziologie, haben aber ein differenziertes Selbstverständnis. Diese nahezu ideale Konstellation für eine soziologische Theorie wurde dadurch gestört, dass Kleingruppen nicht immer für das Verständnis von Gesellschaft herangezogen werden konnten, da sie entweder nicht repräsentativ oder erst gar nicht bekannt waren. Doch wer kann über die Repräsentativität von Gruppen für die Gesellschaft entscheiden? Da half auch nicht die genaue Trennung in „Mikro- und Makrosoziologie“. War damit aber die Bedeutung einer Kleingruppe für eine Analyse zureichend gesichert? Großteils bleiben für die Soziologie jene Gruppen interessant, die zuerst einmal das Kriterium häufiger Interaktion erfüllten - wie Robert Merton bestätigt. Alle anderen wurden dem Kriterium „Kollektiv“ zugewiesen. (Theodore M. Mills, Foundations of Modern Sociology, hrsg. Alex Inkeles 1967). So war die Forschung schon recht spezialisiert, engte das Interesse ein und das ergab eigentlich nahezu automatisch die Qualität einer „sozialen Tatsache“. Der weitere Schritt war zu erwarten: In den ausgewählten Gruppen wurden Systemmerkmale gesucht, funktionale Gesetzmäßigkeiten und wie das sinn- und zweckhafte Handeln in der Gruppe zu bewerten ist und wie in der Gruppe die soziale Wirklichkeit „rekonstruiert“ wird. Die Sammlung dieser zahlreichen Darstellungen sind in jenem Punkt sehr kohärent, wo für die Zusammengehörigkeit in Gruppen relativ homogene und vergleichbare Motive gelten. Da mag zwar das Bedürfnis nach sozialer Nähe wegen gemeinsamer Weltanschauung ausschlaggebend sein, in einem anderen Fall ein praktisches Ermessen oder eine kulturelle Überzeugung der Traditionspflege, so entscheidet dennoch die Soziologie darüber, welchem Merkmal das Interesse gilt. (Vgl. Friedrich Tenbruck, Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft, 60 .....S. 218) Wird von einer Gruppe die Erwartung der Soziologie erfüllt, ein System gebildet zu haben, einen funktionalen Ablauf der Zusammenkünfte zu regeln, so ist damit noch lange nicht der Grund für dieses „Gemeinschaftshandeln“ beantwortet. Solche Gruppenverhalten ergeben sich in Gesellschaften nahezu „naturgemäß“. Es ist fragwürdig, nun auf eine Kausalität zu schließen, dass etwa Arbeitsverhältnisse Arbeitervereine hervorrufen oder gar ein Proletariat. Es ist eine soziologische Systemannahme, die dann keineswegs die Art von „Vergesellschaftung“ oder „Vergemeinschaftung“ entschlüsselt. Die Sozialgeschichte bietet hier ein subtileres Bild. Wenn die soziologische Erklärung mehr sein will als eine exemplarische Konstruktion, so wird sie sich darum kümmern müssen, was denn die Voraussetzung des Gruppenverhaltens ist. Und diese wird ohne Darstellung individuellen Verhaltens nicht auskommen. Und sollte sich sogar aus dieser Gruppe eine „soziale Kraft“ entwickeln, so wird jeder Kausalschluss nur beiläufig gelten können, denn vergleichbare Bedingungen haben nicht die vergleichbaren Ergebnisse gebracht. Die Soziologie sah sich gerade in ihrem empirischen Zuschnitt veranlasst, die Formen von „Vergemeinschaftung/Vergesellschaftung“ anonymen Prozessen zuzuschreiben, unpersönlichen Strukturen oder abstrakten Systemeigenschaften. Die Begriffe für „soziale Gruppen“ sollten darin überzeugen, dass dieses prozessuale Geschehen im Gegensatzpaar von „Konformismus“ und „Non-Konformismus“ ausgedrückt werden kann. Die Akteure in der Gruppe bewegen sich innerhalb der Konzepte „sozialer Rollen“. Nun hat die Darstellung sozialen Wandels in den Formen der Modernisierung diese Beschwörung anonymer Prozesse erleichtert, aus denen Strukturgesetze, Formen sozialer Differenzierung und Systemeigenschaften abgeleitet wurden. Daher ist auch das Vokabular der Wissenschaft intolerant geworden, da es unverrückbare Merkmale „verleihen“ wollte und neue Bezeichnungen entwickelte, die nicht leicht zu „realisieren“ sind: So war schon die „Säkularisierung“ ein Begriff, der in der Soziologie zu heftigem Streit führte. Noch schwieriger war es bei den Begriffen „Systemkomplexität“, „Strukturzwang“ oder „Emanzipation“. Sie erlaubten, einer Gegenwartsgesellschaft Merkmale zu verleihen, Entwicklung als „naturbedingt“ zu bezeichnen oder als Produkte gesellschaftlicher Wechselwirkungen, aber insgesamt können diese Begriffe nicht jenen Rang beanspruchen, den die Zäsuren der Revolutionen oder der Industrialisierung haben. Aus der Geschichte ist zu erfahren, dass Gruppenbildungen in der Antike die Institutionen der Städte veränderte und als Oligarchien über die politische Zukunft entschieden. Und nahezu parallel zu diesen Forschungen ergab die Sozialgeschichte für das 19. Jahrhundert, 61 welchen Einfluss Vereine hatten, weshalb sie auch zeitweise verboten waren, wie auch das Vereinsweisen einen hohen Beitrag zur Modernisierung des politischen Systems leistete. Eigentlich war es zur „Selbstmobilisierung“ gesellschaftlicher Kräfte gekommen und förderte einen politischen Aktivismus, der von der politischen „Reaktion“ als erhebliche Gefährdung gefürchtet war. Erstmals ware an diesen Bewegungen Menschen beteiligt, deren sozialer Status oder die frühere „Ortsgebundenhit“ eine solche Mobilität nicht erlaubt hätte. Die Modernisierung kann als eine sehr wirkungsvolle Mischung verschiedener Faktoren angesehen werden, wenn sich etwa der private und öffentliche Bereich der Gesellschaft zu durchdringen begann. Das war einersweits für das Ende für die alte Ständegesellschaft, das Ende von Sippenverbänden und Familienclans, andererseits eine gewaltige Mobilisierung des kreativen und innovativen Milieus, das nicht leicht in ein soziales Schichtmodell einzuordnen gewesen wäre. Die bürgerlichen Freihitsrechte von 1848, speziell das Koalitionsrecht, also Vereine gründen zu dürfen oder ihnen auch anzugehören, schuf eine völlig neue politische Situation, die aus den vielen Interaktionen aus den Vereinen stammte. Erst dadurch gewannen die Begriffe „Struktur“ und „System“ ihren Anschaulichkeit und waren keineswegs solche „überirdischen Mächte“, wie sie später in der Soziologie zuweilen beschrieben werden. Eine Struktur ist eben keine anonyme Verfügung oder gar Fügung, die auch nicht die Gesellschaft wie ein Schicksalsschlag heimsucht, sondern der Grundriss einer Gesellschaft und so real wie ein Plan für ein Gebäude. Ebenso erfolgreiche Begriffe waren die „Arbeitsteiligkeit“ oder die „soziale Differenzierung“. Bislang waren sie von der Soziologie als Typisierung der Gesellschaft verwendet worden. Das heißt, die Arten des Zusammenlebens und gemeinsamen Handelns der Individuen, der Gruppen und Institutionen erzeugten Synergieeffekte, die je nach Grad sozialer Organisation und Verwendung technischer Mittel über die Arbeitsteiligkeit ein hohes Niveau erreichten. Die Überlegung von Auguste Comte war gerechtfertigt, wenn er in den Weltanschauungen und im Bewusstsein den Ablauf von Stadien vermutete. Er wollte damit auf die qualitativen Unterschiede in den Gesellschaften und deren Kulturen vereisen. Und die strukturellen „Tatbestände“ zeigen die spezifischen Strukturen an, Systemeigenschaften und sozialen Differenzierungen. Über diesen Begriff ist zu erkennen, dass strukturell ausgeformte soziale „Typen“ nicht zugleich auch ein Entwicklungsmodell abgeben. Es gibt eben unterschiedliche Wege des sozialen Wandels und unterschiedliche Entwicklungen. Es war ein verbreiteter Irrtum in der 62 Entwicklungssoziologie, dass Industrialisierung unbedingt moderne Gesellschaft und Demokratie fördert. Allein die lleider oft voreilige Erwähnung „primitiver“ Gesellschaften, die zum Belegexemplar für Entwicklung und Fortschritt werden musste, berücksichtigt nicht die äußerst komplexe soziale Differenzierung in Stammesgesellschaften, hingegen wird die Ansicht verbreitet, soziale Komplexität sei zumindest die Errungenschaft europäischer Neuzeit. Die enge Form des Zusammenlebens, die überschaubare Dimension des sozialen Raumes und „mechanische Solidarität“ verlangte von den Mitgliedern eine deutliche „Triebreduktion“, strenge Regeln und Riten, die sogar die zwischenmenschlichen Beziehungen dominierten. So wurden soziale Einheiten geschaffen, getragen von Identifikation und Loyalität, über die offenbar eine moderne Gesellschaft nicht mehr im gleichen Umfang verfügen muss. Herrschaft, Verwandtschaft und Tradition stabilisierten das soziale Leben und bilden verbindliche Institutionen aus. Dadurch waren diese Gesellschaften stabil, weil die Herrschaft zeitlich und sachlich begrenzt blieb. Die große Verwandtschaft sorgte für ein dichtes Netz horizontaler Verknüpfungen und die Tradition war ein Teil einer gemeinsam erlebten Erfahrungswelt. In der Kultur der „primitiven“ Gesellschaften stand die mündliche Kommunikation an erster Stelle und bezog sich prinzipiell auf vorwiegend existentiell-praktische Fragen. Da besaßen die Mitglieder wirklich eindeutig festgelegte Funktionen und Rollen, die sich als gemeinsam erfahrener Sinn des Handelns in die individuelle Erfahrungswelt eingeprägt haben. Würde man nun wirklich dieses „Leitfossil“ „Primitive Gesellschaft“ zum Vergleich und für die Unterschiede moderner Gesellschaften heranziehen, wäre die Bestimmung weitaus schwieriger als angenommen. Die Verteilung der gesellschaftlichen „Gewinne“ oder Defizite würde nicht nur ein sehr differenziertes Bild ergeben, sondern auch zeigen, wie soziale Verflechtung und „Entflechtung“ beschaffen sind, wie sich Partizipation und soziale Distanz veränderten oder wie es zur Verschiebung der horizontalen zur hierarchischen Struktur kam. Da wird es auffallen, dass soziale Differenzierung nicht allein über Arbeitsteiligkeit organisiert ist, sondern deren ökonomische Effizienz um den Preis sozialer Segmentarisierung errungen wurde. Die gemeinsame Erfahrbarkeit industrieller Lebenswelt rückt für die moderne Gesellschaft in weite Ferne. Der Mensch selbst wird in den jeweiligen Disziplinen so dargestellt, dass er funktionsspezifisch isoliert erscheint, ökonomisch reguliert und in flüchtigen sozialen Beziehungen existiert. In „primitiven“ Gesellschaften ist die kulturelle Differenzierung gering, da es eben kein „Expertenwissen“ einzelner oder von Gruppen gibt, es sei denn der 63 „Außenseiter“, der durch seine Stigmatisierung das Bindeglied zwischen Realität und Kult/Mythos verkörpern muss. Nun sollen das keine wehmütigen Erinnerungen an eine „primitive“ Gesellschaft sein oder gar ein Bedauern, diese Eigenschaften einer Kultur nicht mehr zu besitzen, sondern nur den Nachweis antreten, dass Begriffe die Wirkung haben können, in ihrer Definition zu pauschalieren und zu generalisieren und damit den Reichtum an Nuancen zu verlieren - eigentlich das Salz des gesellschaftlichen Lebens. In der Umkehrung und Entgegnung war der Begriff der „Hochkultur“ geläufig, der gegenwärtig aber negativ besetzt ist. Dieser meinte nichts anders als die Verselbständigung von Herrschaft und Bürokratie. Nun gewinnt die soziale Differenzierung einen anderen Stellenwert, ebenso die Arbeitsteiligkeit. In diesem Konglomerat der Faktoren wachsen die Ansprüche auf innere und äußere Machtentfaltung. Und erweist sich die Organisation von Herrschaft dauerhaft und stabil, kann sie individuelle Interessen viel besser „integrieren“, die ökonomische Effizienz steigern und die Bildung sozialer Klassen kann sogar stabilisierend wirken. So entstehen städtische Strukturen, die ihre überregionale Wirkung erweitern und in Bürokratien die nötigen Funktionen vereinigen. Es ist die Summe aus politischer Hierarchie, ökonomischer Dominanz, Rechtsinstanz, religiöser Kompetenz und militärischer Organisation. Das bedeutet, dass sich soziale Schichten bilden, die eine vom unmittelbaren Existenzerhalt befreit, die andere in „untertänigen“ Pflichterfüllungen gehalten. So kann soziale Differenzierung auch aussehen und sollte besser als „soziale Ungleichheit“ bezeichnet werden. Sehr gut beschreiben die lateinischen Begriffe „otium“ und „negotium“ diesen Unterschied und definieren gleichzeitig die Bewusstseinslage in der römischen Antike nach Klassen und Systemfunktionen. Ausgerechnet in dieser Phase erhöht die Gesellschaft eine bis dahin noch nicht gekannte Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit, die erstmals den Gesellschaften der Spätantike eine genuine Geschichtlichkeit zur Reflexion und Selbstvergewisserung eröffnet. Innerhalb dieser, in Organisationen aufgespaltenen Beziehungsformen zwischen den Menschen, wird aber nicht nur eine eigene Rationalität des Sozialen möglich, nicht nur der organisatorische Wandel der Betriebsformen verursacht, sondern die frühere, fast autonom erscheinende individuelle Handlungskompetenz löst sich aus dem sozialen Raum sich selbst bestimmender Gruppen/Sippen/Verbänden ab und wechselt in den politischen Raum, in dem die Varianten indirekten Handelns wirksamer sind. Wenn Prozesse der Machtbildung stattfinden, dann verändert sich die Handlungskompetenz ins Indirekte und Intrigante. Da wäre allerdings an die Soziologie die Frage zu 64 richten, ob sie nicht nach dieser Veränderung von Handlungskompetenz sich grundsätzlich für dieses indirekte Handeln interessierte und daraus die axiomatischen Bestimmungen ableitete? Immerhin hatte die These der Entfremdung auf diesen Punkt verweisen. Vermutlich war es dann auch leichter geworden, aus der Handlungstheorie ein Schema von Verhalten, Reizen und Reaktionen zu machen. Die Untersuchung sozialer Gruppen hatte dann doch den Erfolg, Konzepte sozialer Rollen zu entwickeln. Damit konnte man sehr gut die Vermischungen der Rollen in der modernen Gesellschaft beleuchten, aber auch wieder die strikte Aufteilung in Segmente. Und so konnte man auch feststellen, dass die „privaten“ Rollen nicht mehr jenen Halt verleihen, wovon man früher ausgegangen war, andererseits erhielten die Rollen im öffentlichen Bereich eine zunehmende Fremdbestimmung. Die sinnstiftenden Handlungen scheinen wirklich privatisiert worden zu sein, aber verlieren in ihren kleinen sozialen Einheiten auch ihre Zuständigkeit als Folge der vielen Emanzipationen und des Verlusts an Identität. Nun ist soziales Handeln nahezu beliebig geworden, eine unbestimmte Tätigkeit und verringerter personaler Verantwortung. Es sind wahrscheinlich die Bedingungen, um eine westliche moderne Gesellschaft sein zu können. 65