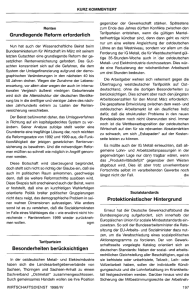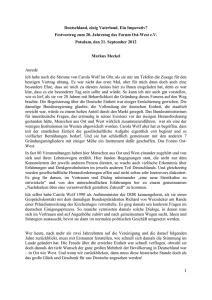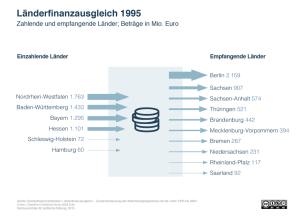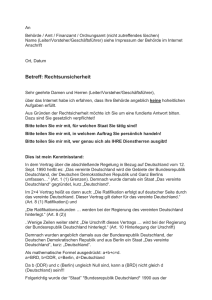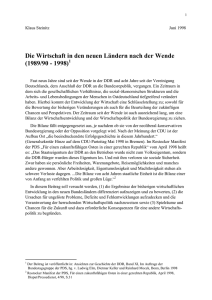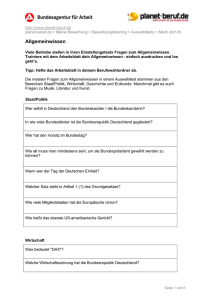Document
Werbung
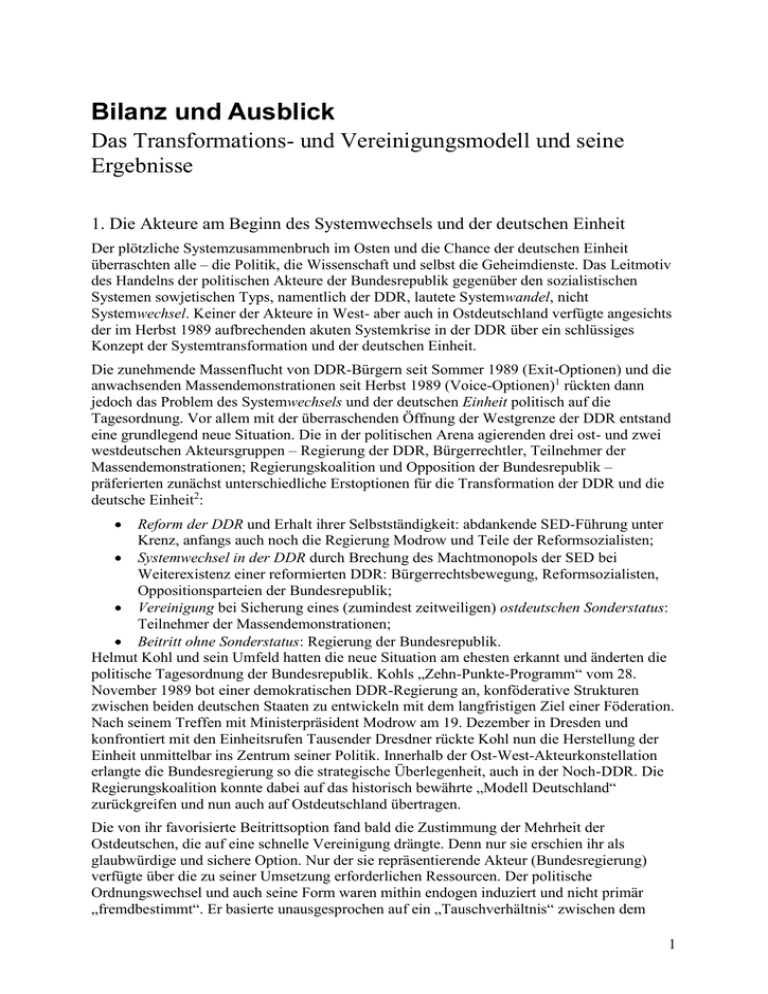
Bilanz und Ausblick Das Transformations- und Vereinigungsmodell und seine Ergebnisse 1. Die Akteure am Beginn des Systemwechsels und der deutschen Einheit Der plötzliche Systemzusammenbruch im Osten und die Chance der deutschen Einheit überraschten alle – die Politik, die Wissenschaft und selbst die Geheimdienste. Das Leitmotiv des Handelns der politischen Akteure der Bundesrepublik gegenüber den sozialistischen Systemen sowjetischen Typs, namentlich der DDR, lautete Systemwandel, nicht Systemwechsel. Keiner der Akteure in West- aber auch in Ostdeutschland verfügte angesichts der im Herbst 1989 aufbrechenden akuten Systemkrise in der DDR über ein schlüssiges Konzept der Systemtransformation und der deutschen Einheit. Die zunehmende Massenflucht von DDR-Bürgern seit Sommer 1989 (Exit-Optionen) und die anwachsenden Massendemonstrationen seit Herbst 1989 (Voice-Optionen)1 rückten dann jedoch das Problem des Systemwechsels und der deutschen Einheit politisch auf die Tagesordnung. Vor allem mit der überraschenden Öffnung der Westgrenze der DDR entstand eine grundlegend neue Situation. Die in der politischen Arena agierenden drei ost- und zwei westdeutschen Akteursgruppen – Regierung der DDR, Bürgerrechtler, Teilnehmer der Massendemonstrationen; Regierungskoalition und Opposition der Bundesrepublik – präferierten zunächst unterschiedliche Erstoptionen für die Transformation der DDR und die deutsche Einheit2: Reform der DDR und Erhalt ihrer Selbstständigkeit: abdankende SED-Führung unter Krenz, anfangs auch noch die Regierung Modrow und Teile der Reformsozialisten; Systemwechsel in der DDR durch Brechung des Machtmonopols der SED bei Weiterexistenz einer reformierten DDR: Bürgerrechtsbewegung, Reformsozialisten, Oppositionsparteien der Bundesrepublik; Vereinigung bei Sicherung eines (zumindest zeitweiligen) ostdeutschen Sonderstatus: Teilnehmer der Massendemonstrationen; Beitritt ohne Sonderstatus: Regierung der Bundesrepublik. Helmut Kohl und sein Umfeld hatten die neue Situation am ehesten erkannt und änderten die politische Tagesordnung der Bundesrepublik. Kohls „Zehn-Punkte-Programm“ vom 28. November 1989 bot einer demokratischen DDR-Regierung an, konföderative Strukturen zwischen beiden deutschen Staaten zu entwickeln mit dem langfristigen Ziel einer Föderation. Nach seinem Treffen mit Ministerpräsident Modrow am 19. Dezember in Dresden und konfrontiert mit den Einheitsrufen Tausender Dresdner rückte Kohl nun die Herstellung der Einheit unmittelbar ins Zentrum seiner Politik. Innerhalb der Ost-West-Akteurkonstellation erlangte die Bundesregierung so die strategische Überlegenheit, auch in der Noch-DDR. Die Regierungskoalition konnte dabei auf das historisch bewährte „Modell Deutschland“ zurückgreifen und nun auch auf Ostdeutschland übertragen. Die von ihr favorisierte Beitrittsoption fand bald die Zustimmung der Mehrheit der Ostdeutschen, die auf eine schnelle Vereinigung drängte. Denn nur sie erschien ihr als glaubwürdige und sichere Option. Nur der sie repräsentierende Akteur (Bundesregierung) verfügte über die zu seiner Umsetzung erforderlichen Ressourcen. Der politische Ordnungswechsel und auch seine Form waren mithin endogen induziert und nicht primär „fremdbestimmt“. Er basierte unausgesprochen auf ein „Tauschverhältnis“ zwischen dem 1 ostdeutschen Massenakteur und der Bundesregierung: Teilhabe der Ostdeutschen am westdeutschen System der Wohlfahrt und persönlichen Freiheit gegen Delegierung der Steuerung des Systemwechsels, der Transformation und der Vereinigung von Ost- nach Westdeutschland. Die Grundlagen der offiziellen westdeutschen Politik bedurften bei dieser Transformationsund Einheitsoption scheinbar keiner Revision. Strategische Problemvereinfachung und Komplexitätsreduktion3 schienen dieser Umbruch- und Krisensituation angemessen zu sein. Neue Suchprozesse und Problemlösungen wurden bei den dominierenden Akteuren und in ihrem Strategiemuster verworfen. 2. Das spezifische deutsche Transformations- und Einheitsmuster Der Systemwechsel in und die Transformation der DDR sind durch ein ganzes Bündel von Gemeinsamkeiten mit den anderen postsozialistischen Ländern Mittel-Ost-Europas gekennzeichnet. Doch ist das deutsche Transformations- und Einheitsmuster durch eine Reihe spezifischer Prämissen und Merkmale gekennzeichnet: Die DDR-Transformation vollzog sich unter den Bedingungen einer Staatsauflösung und eines Beitritts (Inkorporation) zu einem „Fertigstaat“; d. h. eines Beitritts zu einer alles in allem stabilen Demokratie und funktionierenden Marktwirtschaft. Die Transformation Ostdeutschlands und die Integration der neuen Bundesländer in die Bundesrepublik sind eng miteinander verknüpft und bilden zwei Seiten einer Medaille. Für die Lösung der Transformationsprobleme Ost sind mit der Bundesrepublik West das Modell und die Ressourcen da. Transformation bedeutet in diesem Fall primär „Außensteuerung“ des sozialen und politischen Wandels sowie Institutionen-, Elitenund Ressourcentransfer von West- nach Ostdeutschland. Das primäre Ziel der Transformation und Einheit ist die Herstellung der institutionellen Gleichheit. Dies hat Vorrang vor allen anderen Zielen, nicht zuletzt vor Konzepten zur bestmöglichen Entwicklung bestehender Potenziale und der gezielten Förderung neuer endogener Potenziale in Ostdeutschland. Das schloss den Verzicht auf die Konstituierung einer besonderen ostdeutschen Transformationsgesellschaft, deren Institutionen, Akteure und Ressourcen primär auf die Lösung spezifischer Transformationsprobleme gerichtet sind, aus. Besondere gesetzliche (Übergangs)Regeln, Normen, Experimentierklauseln sind nicht erforderlich. Kontinuität und Stabilität der „alten“ Bundesrepublik haben Vorrang vor möglichen Neuerungen, Wandlungen, Reformen in Ost und West und der sich formierenden gesamtdeutschen Bundesrepublik. Reformen können nur die Risiken, Ambivalenzen und Kosten der Transformation und Einheit erhöhen. Die Transformation Ostdeutschlands und die Herstellung der deutschen Einheit waren so durch spezifische Erwartungen geprägt: Nach einer kurzen, vielleicht etwas schmerzhaften, Übergangsphase selbsttragender Wirtschaftsaufschwung in Ostdeutschland, blühende Landschaften sowie gleiche Lebensverhältnisse in ganz Deutschland, spätestens in 10 Jahren. Wachsendes Zufriedenheits- und Zukunftspotenzial sowie rasch zunehmendes Systemvertrauen in der ostdeutschen Bevölkerung. Anpassung und schließlich Angleichung der Einstellungen und Werteorientierungen, der politischen Kultur der Ost- an die Westdeutschen und damit Vollendung auch der inneren Einheit. Die „neue“ gesamtdeutsche Bundesrepublik wird durch den Beitritt der ostdeutschen Länder die vergrößerte „alte“ sein. 2 Dieses durch Beitritt, Modellübertragung und Adaption bestimmte Transformations- und Einheitsmuster war der Hintergrund dafür, dass sich bei den dominierenden Akteuren eine spezifische gesellschaftspolitische Vorstellung von Transformation und Einheit herausbildete: Der ostdeutsche Transformationsfall ist ein privilegierter, ja ideal machbarer Fall; denn alles, was gebraucht wird, ist schon da und erprobt – in Westdeutschland. Verglichen wurde der ostdeutsche Fall mit der Ingangsetzung der Operation des westdeutschen Wirtschaftswunders 40 Jahre zuvor. Im Osten sollte sich alles, im Westen brauchte sich nichts zu ändern. Das entsprach durchaus der damaligen Mehrheitsmeinung in West- und Ostdeutschland. Die Westdeutschen wollten, dass alles so bleibt wie es war; die Ostdeutschen, dass alles so wird, wie es in Westdeutschland ist. Es ging um die Fortschreibung ihrer Erfolgsgeschichte. Das Vertrauen in das bundesdeutsche Modell und seines Institutionensystems, das Vertrauen in die Übertragungsstrategie war nahezu grenzenlos. 3. Der privilegierte deutsche Fall – Bilanz und Wertung Die Perspektive ist hier nicht, ob es 1989/90 eine grundlegend andere Alternative gegeben hätte, sondern welche Resultate die gewählte hatte, haben musste. Dabei ist zu beachten, dass gesteuerte gesellschaftliche Großprojekte immer Risiken und Brüche beinhalten und die ursprünglichen Intensionen der Akteure sich meist nicht oder nur partiell realisieren lassen. Das gilt es auch beim „privilegierten“ deutschen Fall von Transformation und Einheit zu bedenken. Erklärungsbedürftig ist also vielmehr, was aus diesem privilegierten Fall wurde, welche Folgewirkungen das spezifische Transformations- und Einheitsmuster hatte, was also die neuen Bundesländer und die gesamtdeutsche Bundesrepublik heute prägen, wo ihre Konflikte und wo ihre Entwicklungschancen liegen. Und erklärungsbedürftig ist ferner, warum Ostdeutschland und die gesamte Bundesrepublik 15 Jahre nach der Vereinigung dort stehen, wo sie heute stehen. Es gibt heute weniger einen Mangel an empirischen Befunden zur ostdeutschen Transformation und deutschen Vereinigung, als vielmehr einen Mangel an ausgewogenen Urteilen und Wertungen sowie an tragfähigen Zukunftskonzepten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen liegt eine verbindliche Theorie für diesen Transformations- und Vereinigungsfall, mit der der gesellschaftliche Erfolg bzw. Misserfolg genau zu definieren wäre, nicht vor. Zum anderen überlagern und widersprechen sich die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Tendenzen der Transformation und Vereinigung und sind deshalb nicht immer eindeutig zu klassifizieren. Unterschiedliche Urteile sind also nichts Außergewöhnliches. Nicht zuletzt, da sie oft interessengeleitet oder parteipolitischen Kalkülen untergeordnet sind. Will man zu einem ausgewogenen, objektivierbaren Urteil kommen, ist in einem ersten Schritt das Einheitsprojekt auf drei unterschiedlichen Ebenen zu evaluieren: a) auf der Ebene der Systemintegration; b) auf der Ebene der Sozialintegration; c) auf der Ebene der kulturell-mentalen Integration. In einem zweiten Schritt können zur inhaltlichen Bewertung der Ergebnisse der Transformation und Vereinigung sowohl die Institutionen und „Werte des westlichen Systems“ als auch das „Ausmaß der Erhaltung von Institutionen und Errungenschaften der DDR“ zugrunde gelegt werden oder es kann von einer „vergleichenden Betrachtung“ ausgegangen werden, die die Entwicklungspotenziale der politischen und wirtschaftlichen Institutionen in den Mittelpunkt stellt.4 3 Blickt man auf den Verlauf der Transformation und Vereinigung zurück, so wird deutlich: die Logik des spezifischen deutschen Transformations- und Vereinigungsmusters als Modellübertragung, als Institutionen-, Eliten- und Ressourcentransfers von West nach Ost und als gesamtdeutscher Reformverzicht hat sich in diesen 15 Jahren voll entfaltet. Aber welche Ergebnisse hat dieses Transformations- und Einheitsmuster gebracht? Sind die mit der Institutionenübertragung gesetzten Erwartungen – Etablierung des demokratischen Rechtsstaates, selbst tragender Wirtschaftsaufschwung, Zugangschancen zu Arbeit und Bildung für alle, gleichwertige Lebensverhältnisse, Herausbildung eines innerdeutschen Gemeinschaftsgefühls, Stärkung der Zivilgesellschaft in Ost und West – eingetroffen? 3.1. Die Systemintegration „Systemintegration“ hinterfragt die Ergebnisse des politischen Ordnungswechsels, der staatlichen, rechtlichen und politisch-institutionellen Einheit und nicht zuletzt die Orientierungs- und Integrationsleistungen der übertragenen Institutionen. Im deutschen Fall konnten die für einen politischen Ordnungs- bzw. Systemwechsel typischen Turbulenzen, Konflikte, Rückschläge durch den Modell- und Institutionentransfer von West nach Ost minimiert werden. Der rasche und effiziente Institutionentransfer von West nach Ost führte zu einer baldigen organisatorischen Konsolidierung Ostdeutschlands und zum schnellen Aufbau einer funktionsfähigen Verwaltung. Die neuen Länder wurden relativ zügig in die institutionelle Ordnung der Bundesrepublik integriert. Die Konflikte konnten nun in „institutionalisierter“ Form ausgetragen und ausgehandelt werden. Im Vergleich zu den anderen postsozialistischen Transformationsländern fallen hier die Vorteile des spezifischen deutschen Transformations- und Einheitsmuster ins Auge. Und die mit dem Institutionentransfer entstandene (ostdeutsche) Akteurs- und Kompetenzlücke wurde durch einen umfangreichen Eliten- und Wissenstransfer von West nach Ost erst einmal ausgeglichen. Zur deutsch-deutschen Systemintegration gehört somit der erfolgte politische Ordnungswechsel in Ostdeutschland und die Herstellung der institutionellen Gleichheit, also die Existenz einer gemeinsamen politisch-administrativen Ordnung, einer gemeinsamen Rechtsordnung, einer gemeinsamen föderalen Struktur und kommunalen Selbstverwaltung. Die Herstellung der staatlichen Einheit kann somit als gelungen betrachtet werden. Eine ernsthafte politische Gegenbewegung war nach 1990 und ist bis heute nicht in Sicht, obgleich noch im Sommer 1989 eine Mehrheit in Ost und West die staatliche Einheit ausschloss. Das heißt, aus den ehemals zwei Staaten und zwei entgegengesetzten gesellschaftspolitischen Systemen mit ihrem Ausschließlichkeitsanspruch ist mit der deutschen Einheit ein integriertes Staatswesen geworden. Schließlich wurde die deutsche Vereinigung auch international eingebunden, sowohl in den Prozess der europäischen Integration als auch in den der internationalen Staatengemeinschaft. Der Vorteil des privilegierten Falls offenbarte jedoch bereits auf dieser Ebene seine Nachteile. Die anders als im westlichen Modernisierungsprozess im ostdeutschen Transformationsfall elitengesteuerten, instrumentell und von „außen“ eingeführten politisch-administrativen (u. a. staatliche Institutionen, Verwaltung, Rechtsordnung) und intermediären Institutionen (u. a. Parteien, Gewerkschaften, Verbände, Medien) waren und sind bis heute in der ostdeutschen Gesellschaft und in den Lebenswelten der Bürger noch relativ schwach verankert. Es mangelte der neuen institutionellen Ordnung damit von Anfang an den erforderlichen kulturell-politischen Stützen.5 Die symbolische Repräsentation der eingeführten Institutionen einerseits und die Erwartungen, Überzeugungen und Wertorientierungen der Bürger 4 andererseits waren und sind in Ostdeutschland wenig kompatibel. Als Folge verzeichnen wir auf Seiten der Institutionen schwache Orientierungs- und Integrationsleistungen, auf Seiten der Bürger eine brüchige Vertrauens- und Legitimationsbasis. So ist das Vertrauen der Bürger in Institutionen wie dem Bundestag, der Bundesregierung, den politischen Parteien und den Medien gering und hat im Verlauf der Vereinigung – entgegen den Transformationserwartungen – sogar noch abgenommen. Eine starke Zivilgesellschaft hat sich in Ostdeutschland noch nicht herausgebildet. Der Verzicht auf eine gemeinsame Verfassung und die schnelle Einschränkung der in Ostdeutschland 1989/90 entstandenen politischen Öffentlichkeit kostete der neuen politischen Ordnung viel an Legitimation und zivilgesellschaftlicher Fundierung. Hinter dem intakten institutionellen Ordnungsrahmen ist die Konflikthaftigkeit von politischer Struktur und politischer Kultur virulent und die Gesellschaft in Ostdeutschland deshalb noch fragil. Zu den im Verlauf der Transformation und Vereinigung deutlich sichtbar werdenden Nachteilen der Vorteile des (ost)deutschen Falls gehört ferner und ganz besonders, dass das Modell der ostdeutschen Adaption kaum oder nur wenig Innovation hervorbrachte. Die nahezu vollständige Übertragung aller westdeutschen Institutionen, Regeln, Normen, Vorschriften, die in Westdeutschland selbst bereits reformbedürftig waren, ließ in Ostdeutschland nur wenig Spielraum für notwendige Abweichungen, für andere und neue Wege. Gerade die werden in einem solch grundlegenden Prozess des Gesellschaftsumbaus jedoch unausweichlich. Dieses Spannungsfeld zeigte sich u. a. bei der Eigentumsregelung, bei den Existenzgründungen, der Wirtschaftsförderung, der Entwicklung des Hochschulbereiches, des Bildungswesens und nicht zuletzt des Gesundheitswesens. Erst spät, viel zu spät wurde erkannt, dass dieser Adaptionsmodus, also das Fehlen kontextspezifischer Institutionen und soziokultureller Einbettungen, zu einer Innovationsblockade in Ostdeutschland führte. Frühzeitige sowie alle nachfolgenden Überlegungen zu Einheitskorrekturen wurden jedoch von Helmut Kohl und den dominierenden Akteuren zurück gewiesen. Das betraf z. B. die Frage möglicher Anschlussstellen von DDR-Institutionen, die Überlegungen über einen Mix von Privatisierungs- und Sanierungspolitik der Treuhandanstalt, ein Niedrigsteuergebiet, die Einführung staatlicher Lohnsubventionen, die Beteiligung der Ostdeutschen am Produktivvermögen im Gegenzug für einen bestimmten Lohnverzicht, die Einführung einer „Sonderzone Ost“. Und die Forderung, den Umbruch im Osten als Chance für die notwendige Reform des bundesdeutschen Institutionensystems zu nutzen, wurde als „Wiedererfindung des Rades“ lächerlich gemacht.6 3.2. Sozialintegration Bei der „Sozialintegration“ wird gefragt nach den gleichwertigen materiell-sozialen Lebensverhältnissen, nach dem gleichberechtigten Zugang zu Arbeit, Bildung, Forschung, Vermögen und Eigentum, nach der Elitenrekrutierung und -zusammensetzung sowie den Partizipationsmöglichkeiten der Bürger in Ost und West. Eine wesentliche Voraussetzung der Sozialintegration ist eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Gerade hier schien mit der Übernahme des westdeutschen Erfolgsmodells von sozialer Marktwirtschaft, Wohlfahrtsstaat und sozialen Sicherungssystemen der Garant erfolgreicher wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung in Ostdeutschland gegeben. Die bestehenden OstWest-Asymmetrien sollten so in einem überschaubaren Zeitraum überwunden werden. Seit Beginn der Transformation und Vereinigung hat sich wirtschaftlich und sozial in den neuen Bundesländern zweifellos viel getan. Die positiven Veränderungen gegenüber der Ausgangslage sind unübersehbar. Der Aufbauprozess Ost ist nach der Phase schwerer 5 volkswirtschaftlicher Depression und nachhaltiger Deindustrialisierung vorangekommen. So stieg das reale Brutto-Inlandsprodukt im Vergleich zu 1990/91 um rund 40 Prozent. Der Kapitalstock der Wirtschaft und die Infrastruktur wurden grundlegend erneuert. Der Abstand der neuen zu den alten Ländern konnte damit verringert werden. Doch liegt das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner heute erst bei rund 63 Prozent des westdeutschen Niveaus. Im Unterschied zum Aufbauprozess ist der Aufhol- und Angleichungsprozess jedoch seit 1996/97 faktisch zum Erliegen gekommen. Die Schere zwischen Ost und West geht bei wichtigen Indikatoren inzwischen sogar weiter auseinander. Obgleich in den neuen Bundesländern viel geschaffen wurde, bleiben bis heute alle ostdeutschen Länder, auch die vermeintlichen Spitzenreiter Sachsen und Thüringen, bei den wichtigsten Kennziffern hinter den Schlusslichtern des Westens zurück.7 Das Kernproblem Ostdeutschlands besteht darin, dass kein selbst tragender Entwicklungspfad, kein tragfähiges Zukunftsmodell entstanden sind. Nur rund 60% der Ausgaben für privaten und staatlichen Verbrauch sowie für öffentliche Investitionen werden in Ostdeutschland selbst erwirtschaftet. Dies ist eine Leistungsdiskrepanz, die es in keinem vergleichbaren Land Europas gibt. Die strukturelle Abhängigkeit der ostdeutschen Volkswirtschaft vom westdeutschen Finanz- und Gütertransfer bleibt bestehen, kann jedoch auf Dauer nicht die Lösung sein. Dennoch haben sich die individuellen materiell-sozialen Lebensbedingungen der meisten Menschen in Ostdeutschland seit Beginn der Transformation und Vereinigung verbessert. Das betrifft die Lohnentwicklung der Beschäftigten, die Haushalts-Netto-Einkommen der Familien, die Ausstattung der privaten Haushalte mit langlebigen Konsumgütern, die Renten.8 Trotz dieser finanziellen Anstrengungen und distributiven Maßnahmen zur Absicherung und Besserstellung der Ostdeutschen sind die erhofften und versprochenen qualitativ gleichwertigen Lebensverhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschland nicht in Sicht. Gemessen am westdeutschen Niveau liegen die Bruttolöhne/-gehälter der Arbeitnehmer in Ostdeutschland bei 77,5 Prozent. Das Gesamtnettovermögen der Ostdeutschen im Vergleich zum Durchschnitt der Westdeutschen liegt bei rd. 40 %, das Immobilienvermögen bei ca. 35 % und der Besitz am Produktivkapital nur bei etwa 17 %. Zu den größten Problemen Ostdeutschlands gehört die prekäre Beschäftigungssituation. Die im Zuge des Strukturwandels seit 1990 abgebauten Arbeitsplätze sind nicht gleichermaßen durch neue Beschäftigungsmöglichkeiten ersetzt worden. Der Saldo beider Entwicklungen ist negativ. Die Erwerbslosenquote liegt 2005 im Durchschnitt bei 20 Prozent. Sie ist damit um das Doppelte höher als in den alten Bundesländern. Die Unterbeschäftigung beträgt – gemessen an der Zahl derer, die eine reguläre Beschäftigung suchen – über 25 Prozent. Und das, obgleich gut 300.000 Ostdeutsche als Pendler in Westdeutschland arbeiten und Hunderttausende sich aus dem Arbeitsmarkt „verabschiedet“ haben. Schwer lastet die Abwanderung auf der Entwicklung der neuen Bundesländer. Seit Ende 1989/Anfang 1990 verließen weit über 2 Millionen, vor allem junge (zwei Drittel jünger als 30 Jahre), gut ausgebildete und qualifizierte Menschen Ostdeutschland. Saldiert um die Zuzüge aus dem Westen verbleibt ein negatives Wanderungssaldo von ca. 1 Million. Über ein Drittel der jungen Ostdeutschen trägt sich heute mit dem Gedanken, Ostdeutschland in Richtung Westen zu verlassen. Die Ursache für diese Abwanderung liegt darin, dass über 70 Prozent der Jugendlichen Ostdeutschlands überzeugt sind, dass ihnen in Westdeutschland bessere Ausbildungs-, Arbeits- und Zukunftschancen als in den neuen Bundesländern geboten werden; gleich ob in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Osten Deutschlands wird gerade in der Jugend nicht mehr Zukunft verbunden. Im Unterschied zur Systemintegration ist die Wirtschafts- und Sozialintegration bislang keineswegs gelungen. Der wirtschaftliche Konvergenzprozess selbst ist bislang eher gescheitert. Natürlich – die gravierenden Unterschiede im wirtschaftlichen und sozialen 6 Niveau zwischen der DDR und der Bundesrepublik sind heute so nicht mehr vorhanden. Doch das Ziel selbst tragende Wirtschaftsentwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse ist bis heute noch nicht eingelöst. Und der Zugang der Ostdeutschen zu Arbeit, Vermögensbildung, Eigentum, Elitenrekrutierung und Partizipation ist noch immer schwieriger. Neuere Forschungsprognosen gehen davon aus, dass eine Angleichung sowohl des BIP als auch der materiell-sozialen Lebensverhältnisse selbst bis 2020 kaum realistisch sei.9 Ohne gesellschaftliches Umsteuern ist auch eine Vertiefung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten nicht mehr auszuschließen. 3.3. Kulturell-mentale Integration Bei der „kulturell-mentalen Integration“ wird gefragt nach dem Grundbestand gemeinsamer Einstellungen, Ziel- und Wertvorstellungen zwischen Ost- und Westdeutschen oder anders formuliert danach, ob aus dem einheitlichen „Staatswesen“ auch ein tragfähiges „Gemeinwesen“ wurde. Die subjektiven, kulturell-mentalen Ausgangsbedingungen für die Ost- und Westdeutschen im Vereinigungsprozess schienen gegensätzlicher nicht sein zu können. Die Ostdeutschen hatten nicht nur einen einmaligen Systembruch, sondern zugleich einen tiefgreifenden Kulturbruch zu verarbeiten. Von heute auf morgen fand eine grundlegende Umbewertung aller vormals geltenden gesellschaftlichen Werte, Leitorientierungen, Normen, Symbole statt. Auch wenn sich eine Mehrheit der Ostdeutschen nie wirklich damit identifizierte und sich nie eine DDRIdentität ausprägte, waren sie mit ihren Biographien dennoch in die 40jährige DDRGeschichte und –Entwicklung eingebunden. Die DDR basierte ja nicht allein auf Repression, sondern lange zeit auch auf Hinnahme und Zustimmung. Und wie immer der Einzelne zum Staat DDR stand, mit dem Beitritt der neuen Bundesländern zur Bundesrepublik war er als Ostdeutscher im Vergleich zur Mehrheit der Westdeutschen Teil der strukturellen Minderheit, ein Ankömmling und nicht ein Etablierter, eher Fremder denn Einheimischer. Diesen Kulturschock zu verarbeiten erforderte von den Ostdeutschen die Mobilisierung immenser psychisch-sozialer Ressourcen. Für die Westdeutschen hingegen schien alles beim Alten zu bleiben. In ihren Wahrnehmungen war das vertraute „Westdeutsche“ zugleich das neue „Gesamtdeutsche“. Und so würde es auch bleiben, glaubte man. Das dem spezifischen Transformations- und Einheitsmuster entsprechende kulturelle Leitbild der Vereinigung lautete denn auch (ausgesprochen oder unausgesprochen): Anpassung und Angleichung der Ost- an die Westdeutschen, an ihre Normen, Einstellungen, Deutungsmuster und Mentalitäten. Schnell verdrängt wurden die Aufbruchstimmung und die Selbstbefreiung der Ostdeutschen von 1989. Vergessen, dass der offiziellen Wende 1989/90 eine von Bürgerrechtlern, kritischen Intellektuellen und Reformsozialisten erstrittene zivilgesellschaftliche Wende in der DDR seit Mitte der 80er Jahre voraus ging. Die Voraussetzungen dafür, dass aus dem Staatswesen auch ein Gemeinwesen wurde, waren im Vereinigungsprozess also nicht die besten. Vor allem, als die Einheitseuphorie nach 1989 bald verblasste. Wie lautet nun die Bilanz der kulturell-mentalen Integration 15 Jahre nach Herstellung der staatlichen Einheit? Wurde aus dem Staatswesen auch ein Gemeinwesen bzw. folgte der äußeren Angleichung die innere Einheit? Die Mehrheit der Ostdeutschen erlebte mit dem System- und Kulturbruch gesellschaftliche, berufliche und nicht zuletzt private Brüche und schwere Krisen. „Wendestress“ ist der Zustand treffend genannt worden, in dem sich Ostdeutsche über Jahre hinweg permanent befanden. Sie haben jedoch dem mit dem Systembruch einhergehenden Kulturbruch, der 7 Einstellungen, Werteorientierungen, kulturelle Symbole und Normen sowie die Alltagskultur betraf, auf eigentümliche und z. T. unvorhergesehene Weise verarbeitet. Heraus gekommen ist weder eine „Verostung“ des Westens (Arnulf Baring) noch eine „Verwestung“ des Ostens (Laurence Mc Fall). Bezogen auf die Ostdeutschen als einer spezifischen Gruppe in der Bundesrepublik kann eher von etwas „Drittem“, besser formuliert, etwas „Eigenem“ gesprochen werden. Die meisten Ostdeutschen haben sich inzwischen individuell auf die neuen Verhältnisse der Bundesrepublik und der Nachwendezeit eingestellt; abwägend, mit gesellschaftlicher Distanz und neuem Selbstbewusstsein. Heute dominieren nicht mehr die Verlustgefühle der Vergangenheit ihr Denken und Handeln. Auch die nach 1990/91 vorherrschende, unterschwellige Anti-West-Stimmung ist verblasst. Man betont heute eher selbstbewusst, woher man kommt und nur eine Minderheit sehnt sich zurück in eine nostalgisch verklärte Vergangenheit. Dennoch – Jahre nach dem Untergang der DDR nimmt sich eine Mehrheit der Bevölkerung in den neuen Bundesländern weder zuerst als West- noch als Gesamtdeutsche, sondern eher als Ostdeutsche wahr. Im Jahre 2003 fühlten sich 73 % der Bürger der neuen Bundesländer mit Ostdeutschland stark (33 %) bzw. ziemlich stark (40 %) verbunden, 21 % fühlten sich wenig und 4 % gar nicht verbunden (3 % ich weiß nicht bzw. ohne Antwort). 10 Als „richtiger Bundesbürger“ fühlen sich nur 20 % der Ostdeutschen.11 Das überraschte, jedenfalls im Westen; und kam doch nicht so überraschend: Denn ohne Rückgriff auf die gelebte Identität und ohne Konstruktion einer positiven Eigengeschichte ist ein Selbstbewusstsein der Menschen gerade in Umbruchzeiten undenkbar. Das wurde in der Vereinigungspolitik und im westdeutsch dominierten DDR-Diskurs lange Zeit ignoriert. Zugleich nimmt die Tendenz der Herausbildung regionaler Identitäten zu: Sachse, Mecklenburger, Thüringer, Brandenburger. Dabei ist „Ostidentität“ durchaus keine „Abgrenzungsidentität“. Denn die Ostdeutschen befürworten auch nach 15 Jahren wechselvoller Erfahrungen und Reibungen die deutsche Einheit. Im Rückblick bewerten rund 55 Prozent von ihnen die deutsche Einheit „an sich“ eher positiv.12 Hervorgehoben werden vor allem das Waren- und Dienstleistungsangebot, die Reisemöglichkeiten und neuen individuellen Freiheiten. Kritisch bewertet und als in der DDR „besser“ gelöst werden die Bereiche Arbeit, soziale und persönliche Sicherheit, Gerechtigkeit und Solidarität angesehen. Rund 36 % verbinden mit der Einheit für sich vorrangig Gewinn, 30 % sowohl Gewinn als auch Verlust und 30 % mehr bzw. vor allem Verlust.13 Die Enttäuschungen unter den Ostdeutschen über das Ausbleiben der wirtschaftlichen und sozialen Einheit wandelten sich in Resignation – allmählich mehr in einen nüchternen Realismus. Die Bewertungen der Lebensverhältnisse reflektieren inzwischen recht genau die materiell-sozialen Gegebenheiten in den neuen Bundesländern – im Vergleich zu den vergangenen Jahren, zu den Lebensverhältnissen in den alten Bundesländern und den künftigen Erwartungen. Die Hoffnung auf eine rasche Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West ist stark gesunken. Man ahnt, dass auch das westdeutsche Erfolgsmodell an seine Grenzen gestoßen sein könnte. Dass die bundesdeutsche Gesellschaft eine gerechte Gesellschaftsordnung sei, glauben zwei Drittel der Westdeutschen, aber nur ein Drittel der Ostdeutschen. Die Demokratie als Staatsform wird mehrheitlich in West und Ost als wichtig akzeptiert. Die Zufriedenheit mit der erlebten Demokratieentwicklung ist hingegen vor allem in Ostdeutschland seit Jahren rückläufig. Die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland (2003) beträgt im Westen 63 % und im Osten 39 %.14 Eine Mehrheit der Ostdeutschen erwartet auch keine Verbesserungen der Demokratieentwicklung. Stattdessen steigt die Anzahl jener Befragten, die sogar von einer Verschlechterung der praktischen demokratischen Entwicklung ausgehen.15 Ebenso sinken das Systemvertrauen und der Zukunftsoptimismus. Auch hier haben sich die frühen Transformationsannahmen bislang nicht bestätigt. 8 Die Mehrheit der Ostdeutschen hat sich vom System der DDR verabschiedet und die Bundesrepublik angenommen. Sie will keine grundlegend andere Republik, jedoch solche Veränderungen, die ihr einerseits einen besseren Zugang zu Arbeit, beruflichem Fortkommen und Eigentum garantiert und ihr andererseits mehr gesellschaftliche Anerkennung bringt. Ausgeprägter als bei der Gruppe der Westdeutschen sind bei ihnen sozialstaatliche Zielsetzungen, Gerechtigkeits- und Gleichheitsideen und Vorstellungen von verschiedenen Formen direkter Demokratie. Diese vorwiegend „traditionelle Verfasstheit“, offiziell bislang meist als fragwürdige Abweichung thematisiert, könnte sich in der neuen Entwicklungsetappe gesellschaftlichen Wandels durchaus noch als ein Kulturvorteil erweisen. Und zwar in dem Maße, wie sozialer Sinn und Gemeinschaftlichkeit wieder stärker in der Gesellschaft nachgefragt werden. Da bieten sich auch neue Chancen einer kulturellen Ost-West-Mischung. So zum Beispiel bei einer sinnvollen Kombination von Freiheit und Gleichheit, von individueller Leistung und sozialer Gerechtigkeit, von repräsentativer und direkter Demokratie. Nur setzt das eine Abkehr vom kulturellen Leitbild der deutschen Vereinigung als einseitigen Anpassungsprozess der Ostdeutschen an die Westdeutschen voraus. Auch weil ein wirkliches innerdeutsches Gemeinschaftsgefühl noch nicht entstanden ist und viele OstWest-Gruppensterotype weiter existieren. Resümierend lässt sich zu „Bilanz“ und „Wertung“ von Transformation und Vereinigung festhalten: - Der Systemwechsel in Ostdeutschland ist vollzogen. Die neuen Bundesländer haben sich beträchtlich gewandelt und entwickelt. Die staatliche Einheit ist hergestellt und wird national und international nicht in Frage gestellt. Die Mehrheit der Ost- und Westdeutschen trägt die Einheit, wenngleich auch die mit ihr verbundenen großen Hoffnungen verschwunden sind. - Dennoch – grundlegende Resultate und Folgen der Transformation und Vereinigung stimmen nicht mit den ursprünglichen Zielen und Erwartungen überein. Der erwartete selbst tragende wirtschaftliche Aufschwung kam bislang nicht zustande. Die angenommene und versprochene wirtschaftliche und soziale Konvergenz ist nicht erreicht. Das Einholen Westdeutschlands, seit Jahren Kern des wirtschaftlichen und sozialen Einheitsprojekts, erweist sich immer mehr als Illusion. - Der Osten Deutschlands hat sich seit 1990 nicht nur grundlegend gewandelt, sondern auch an den Westen der Republik angepasst und ist doch anders geblieben. Anders in seinen Wirtschaft- und Sozialformen, anders auch in seiner partei-politischen und kulturell-mentalen Verfasstheit. Trotz ihrer inneren sozio-kulturellen Differenziertheit verkörpern die Ostdeutschen als spezifische Gruppe in der Bundesrepublik eine relativ stabile politische Orientierung, die auf ein klassisches „soziales“ und „demokratisches“ Demokratie- und Gesellschaftsmodell schließen lässt. Dieses sozial-staatliche Grundmuster mit spezifischen Gleichheitsideen ist aber durchaus in das System der parlamentarischen Demokratie und politischen Ordnung der Bundesrepublik integrierbar. Zu diesen Besonderheiten gehört auch, dass sich die Ostdeutschen persönlich weniger einer Partei verbunden fühlen und ihr Wahlverhalten stark pragmatisch und doch zugleich durch rationale Züge geprägt ist. Ein Staat also, aber noch divergierende Teil-Gesellschaften, Sozialformen, Wir-Gruppen, kollektive Identitäten.16 Das ist die eigentliche Überraschung eines Transformations- und Vereinigungsmodells, das auf Modellübertragung und Inkorporation basierte. Doch sind dies Differenzen innerhalb eines vereinigten Landes. Damit sind sie relativ und nicht absolut. Werden sie jedoch unterschätzt oder durch Praktiken vertieft, können sie sich als Gegensätze neu beleben und Spaltungen hervor bringen. Das zumindest zeigt ein Vergleich der verschiedenen europäischen Vereinigungsfälle.17 Die angenommene Blaupause kam jedenfalls nicht zustande, nicht strukturell und nicht kulturell-mental. Viele „Abweichungen“ äußern sich als „Hinterherhinken“ (z. B. bei wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsdaten), andere erweisen sich eher als Innovationen – so z. B. eine Reihe der 9 neuen Länderverfassungen mit ihren Sozialstaatszielen sowie weit reichenden Formen der Bürgerbeteiligung. Das gilt auch für das erwähnte und sich gerade in den letzten Jahren herausgebildete moderne, flexible Wahlverhalten der Ostdeutschen sowie für einige Aspekte ihres gesellschaftlichen Wertehaushaltes. Dieses „Anderssein“ Ostdeutschlands, dieser „Eigensinn“ der Ostdeutschen belegt überdies, dass selbst ein durch Beitritt gekennzeichneter Transformations- und Vereinigungsfall sich weniger als zielgerichteter, linearer Anpassungs- und Angleichungsprozess, sondern als historisch voraussetzungsvoll und als eigendynamischer Prozess vollzieht. - Doch auch die „alte“, erfolgreiche Bundesrepublik steht heute anders da, als man es 1990 prophezeite. Die „neue“ Bundesrepublik ist nicht einfach eine vergrößerte „alte“ geworden. Nichts ist geblieben wie es war, fast nichts so geworden wie es sollte. Die vereinte Bundesrepublik stellt sich als „Übergangsgesellschaft“ dar, deren weiterer Weg heftig umstritten ist. 4. Vom idealen Transformations- und Vereinigungsfall zum prekären Reformfall – Erklärungen Warum haben Transformation und Vereinigung nicht die Resultate gebracht, die von den dominierenden Akteuren verkündet und von Mehrheiten in West und Ost erwartet wurden? Die Antworten darauf fallen sehr unterschiedlich aus. Vor allem jene Wissenschaftler, Politiker, Medienvertreter, die einem modernisierungstheoretischen Ansatz folgen, sehen darin unvermeidliche Ambivalenzen einer nachholenden Modernisierung, noch dazu unter ungünstigen Wachstumsbedingungen in Deutschland im Rahmen einer globalisierten Welt. Nicht zuletzt seien die schwerwiegenden Erblasten der DDR mit ihren Folgewirkungen auf den Transformations- und Vereinigungsprozess unterschätzt worden. Insgesamt aber sei das Transformations- und Vereinigungsprojekt durchaus gelungen, stabilisiert und konsolidiert. Denn das Wichtigste, die institutionelle Gleichheit Ost-West, sei erreicht. Andere, die eher einem transformationskritischen Ansatz folgen, verweisen vor allem auf aus ihrer Sicht grundlegende Fehler der Transformations- und Vereinigungspolitik. Das gelte für den Verzicht auf eine neue, gemeinsame Verfassung, für die zu schnelle Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion, für die spezifische Eigentumsregelung „Rückgabe vor Entschädigung“ und nicht zuletzt für die Treuhandpolitik, die Verkauf und Abwicklung statt Sanierung und Umwandlung präferierte. Zweifellos verweisen diese Erklärungen auf wesentliche Ursachen und Faktoren, die den Dilemmata der Transformation und Vereinigung zugrunde liegen bzw. sie beförderten. Hinreichend scheinen diese Deutungen die gesellschaftliche Blockade- und Krisensituation der ostdeutschen und gesamtdeutschen Transformation jedoch nicht zu erklären. Offensichtlich sind die Ursachen dafür in dem der Transformation und Vereinigung zugrunde liegenden Modell und den darauf fußenden Prämissen begründet. Dieses Transformationsund Vereinigungsmodell erwies sich als ein ambivalentes Projekt. Seine Schwächen sind die Kehrseite seiner Stärken. Die Sicherung der Stabilität der „alten“ Bundesrepublik hat die „neue“ geschwächt – strukturell und mental. Die schnelle organisatorisch-technische Konsolidierung des Ostens hat nicht gleichzeitig den Weg zu einer innovativen, selbst tragenden Entwicklung geöffnet. Die institutionelle Einheit wurde nicht zum Katalysator der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Einheit. Die Chance gar, gemeinsam eine Art von Neuanfang zu wagen, wurde damit verpasst.18 Das Transformations- und Vereinigungsprojekt führte so zu Folgen, die seine Grundlagen in Frage stellten und zum Umsteuern zwingen. 10 Die Übertragung eines fordistischen Wachstums-, Wohlfahrts- und Sozialmodells von Westnach Ostdeutschland mit all seinen Strukturen, Institutionen, Regeln und Normen erfolgte zu einem Zeitpunkt, wo dessen Erfolgsgeschichte schon mehr Vergangenheit war und sich sein Reformbedarf in Westdeutschland längst abgezeichnet hatte.19 Diese rigide Modell- und Institutionenübertragung mochte dem damaligen Zeit- und Problemdruck entsprechen, eine adäquate Antwort auf die neuen Herausforderungen der Gesellschaftstransformation im Osten und dem Reformbedarf im Westen war sie schon nicht mehr. Die Übernahme des Modells erfolgte, als die Grundlagen seines Funktionierens bereits erodiert waren. Oder anders formuliert: der deutsche Vereinigungsprozess ist weitgehend nach den Mustern und den Instrumenten organisiert worden, die sich in der alten Bundesrepublik seit den 50er Jahren bewährt hatten – mit fatalen Folgen, was zumal die westlichen Bundesländer und ihre Selbsttäuschung betrifft.20 Der Zusammenbruch des Staatssozialismus und die Vereinigung haben dieses Erfordernis gemeinsamer Reformen zeitweilig überlagert, verdeckt. Tatsächlich jedoch wurden im deutschen Vereinigungsfall de facto zwei unterschiedliche Modernisierungsexperimente mit ungleichzeitigen Entwicklungsstufen zusammengebündelt. Das eine, das autoritärstaatssozialistische, war am Ende und nicht mehr reformierbar; das andere, überlegene fordistisch-kapitalistische, befand sich jedoch zum Zeitpunkt der Vereinigung auch in einer grundlegenden Entwicklungskrise, global und als Typ westlicher Industriegesellschaft. Der Systembruch im Osten und der „Systemschock“21 im Westen haben beide ihren Ausgangspunkt in den Ereignissen der Jahre 1989/90. In Verkennung dieser Zusammenhänge wurde jedes kritische Nachdenken über die eigene Gesellschaft verbannt. Die Bewahrung der Kontinuität und Stabilität der „alten“ Bundesrepublik hatte im Transformations- und Vereinigungsprozess absoluten Vorrang. Die Furcht vor Reformen und sozialen Experimenten, vor möglichen Rückwirkungen des Ostens auf den Westen der Bundesrepublik dominierte das Handeln der politischen Klasse. Zweifellos hat dieses Strategiemuster – im Nachhinein betrachtet – die Kontinuität und Stabilität des politischen Systems der Bundesrepublik gesichert. Doch wurde so das Land zugleich gesellschaftlich und kulturell blockiert und geschwächt. Die erhoffte Verwaltung der Vergangenheit und die Verfestigung der Gegenwart erwiesen sich als Illusion. Dabei können angesichts des Problem- und Zeitdrucks nicht so sehr die ersten Entscheidungen im Vereinigungsprozess zur Kritik stehen, sondern die Nichtbeachtung oder Verdrängung der Folgewirkungen, die fehlende Kurskorrektur und die mangelnde Lernbereitschaft sowie Reflexivität der politischen Klasse im Vereinigungsprozess. Die Art und Weise des Vereinigungsprozesses hat so die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Probleme im Osten und Westen der Republik weiter potenziert. Die alten Probleme des Westens – Selbstblockaden der Institutionen, defizitärer Wachstumspfad, Krise des Wohlfahrtsstaates, Staatsverschuldung – potenzierten sich im Osten und umgekehrt. Das Festhalten am angeblich entscheidenden Ziel der Einheit, der Herstellung der institutionellen Gleichheit, und die ungebrochene Gläubigkeit in die Lösungskompetenz der westdeutschen Institutionen verhinderten dann auch Konzepte zur bestmöglichen Entwicklung bestehender und zur gezielten Förderung neuer endogener Potenziale in Ostdeutschland. Institutionelle und individuelle Potenziale der Ausgangsgesellschaft wurden nicht als mögliche Anknüpfungspunkte, sondern allein als schnell zu überwindende Erblasten betrachtet. Transformation wurde nicht als Vermittlung von Ausgangs- und Ankunftsgesellschaft, als Konstituierung einer „Übergangsgesellschaft“, deren Institutionen und Akteure primär auf die Lösung spezifischer Transformationsprobleme gerichtet sind und als Such- und Experimentierprozess verstanden, sondern als Übertragungs- und Transferproblem. Denn alles, was gebraucht wird – so die Überzeugung – ist schon da, in Westdeutschland. Auch der mit den Transformations- und Vereinigungsfolgen bald weiter zunehmende Problem- und 11 Wandlungsdruck führte in der Folgezeit bei den wirtschaftlichen und politischen Eliten nicht zu wachsender Lern-, Such- und Reformbereitschaft. „Der Neokapitalismus teilte in der Tat mit dem alten Staatssozialismus, den er als Erbfeind ansah, die Illusion, dass Maßnahmen, die nicht griffen, durch mehr Maßnahmen in die gleiche Richtung ersetzt werden mussten. Beide Paradigmen ließen sich ungern durch Skepsis gegenüber dem Endziel beirren…“22 Der privilegierte Transformations- und Vereinigungsfall wurde so zu einem prekären Reformfall; das „Modell Deutschland“ zu einer „blockierten Moderne“, die immer mehr in die Krise geriet. Schuld daran ist nicht zuerst der Osten, ist nicht zuerst die Vereinigung, wie wir es heute oft hören, sondern der seit den 70er/80er Jahren verzögerte Umbau der reformbedürftigen Industrie-, Beschäftigungs- und Sozialstaatsmodelle. Das bisherige „Modell Deutschland“ verlor so seinen früheren Glanz, gerade auch unter den Ostdeutschen. Mehr noch – mit dem Ende des Ost-West-Systemgegensatzes und dem Ende der DDR wurde auch das Ende der alten Bundesrepublik, das Modell des „mittleren Weges“23 eingeleitet. 5. Perspektiven Ost und West, die gesamtdeutsche Bundesrepublik befinden sich heute, 15 Jahre nach der Transformation Ostdeutschlands und der deutschen Vereinigung, an einer neuen Scheidewegsituation. Im Grunde geht es sowohl im Osten wie auch im Westen der Republik um einen neuen trag- und zukunftsfähigen Entwicklungspfad. Langfristig lautet das zentrale Problem des Wandels im Osten und Westen der Berliner Republik: Zukunftsfähige, d. h. nachhaltige Entwicklung; Innovation und soziale Gestaltung; neuer sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft. In diesem Sinne stehen sowohl das (Transformations-)Projekt Ost als auch das Einheitsprojekt vor weit reichenden Herausforderungen und müssen neu definiert werden. Erforderlich ist ein neues gemeinsames Leitbild als Ziel- und Orientierungsgröße für die Suche nach diesem zukunftsfähigen Entwicklungspfad. Die anstehenden Reformen sind durch die Art und Weise der Vereinigung drängender, aber auch schwieriger geworden, institutionell und mental. Die bürokratisch verkrusteten Institutionen haben sich inzwischen gesamtdeutsch etabliert und verfestigt. Von einer neuen kulturellen Aufbruchstimmung ist das vereinte Deutschland heute weit entfernt. In Ostdeutschland ist eine besondere Konfliktsituation entstanden. Die ungelösten Transformationsprobleme sind mit massiven Strukturbrüchen – Deindustrialisierung, strukturelle Arbeitslosigkeit, Schrumpfungsprozesse, demografische Entwicklung, wachsende soziale und regionale Disparitäten – und qualitativ neuen Herausforderungen – Übergang von der alten Industrie-, Wachstums- und Arbeitsgesellschaft zur wissensbasierten Wirtschaft, Verknüpfung von gesellschaftlicher Innovation und sozialer Gestaltung – verbunden. Am Ende der Transformation befinden sich also Ostdeutschland und seine Regionen nicht, wie angenommen, in der klassischen Konsolidierungsphase, sondern am Anfang eines neuen Umwälzungs- und Wandlungsprozesses. In diesem neuen Entwicklungsabschnitt sind Herausforderungen und Aufgaben zu meistern, die über die früheren Transformations- und Vereinigungskrisen der Jahre 1989/90 und 1990/91 hinaus reichen und die über die längerfristige Zukunft Ostdeutschlands und seiner Regionen entscheiden. Anders als in der klassischen Transformations- und Vereinigungsphase handelt es sich hierbei um langwierige, komplexe und ergebnisoffene Entwicklungen. Nachdem klar geworden ist, dass Ostdeutschland nicht mehr werden kann wie Westdeutschland früher war, ist ein Perspektiven- und Strategiewechsel notwendig. Die Leitfrage kann nicht mehr länger sein, wann endlich holt der Osten den Westen ein, wann endlich ist die Angleichung und Anpassung Ost an West vollzogen. Dieses bislang 12 dominierende Aufholjagd- und Anpassungsszenario, das nie das anvisierte Ziel erreicht, ist in der Krise und lähmt auf Dauer die Kräfte, ebenso wie das entgegengesetzte Niedergangsszenario. Beide führen letztlich zur kollektiven Resignation und Depression. Ostdeutschland braucht einen neuen Entwicklungspfad, braucht ein seinen Besonderheiten und Stärken entsprechendes Profil nachhaltiger wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung. Da es dafür keinen fertigen Masterplan gibt, erforderte dies einen Such-, Gestaltungs- und Experimentierprozess entlang des Konzepts einer innovativen, nachhaltigen Entwicklung. Voraussetzung wäre eine offene und öffentliche Debatte, die die verkürzte Standortdebatte in eine erweiterte Lebensortdebatte transportiert: „Wie wollen und wie können wir künftig leben – in Ostdeutschland und in der gemeinsamen Republik?“ Die Gestaltung neuer Entwicklungswege für Ostdeutschland verlangt heute zweierlei. Eine veränderte Kontextsteuerung, das heißt eine neue gesamtdeutsche respektive ostdeutsche Innovations-, Reform- und Strukturpolitik sowie eine verstärkte Selbstorganisation von unten; in den lokalen Räumen, Regionen, Ländern.24 In Zeiten historischer Umbrüche liegen keineswegs nur neue Risiken, sondern zugleich neue Möglichkeitsstrukturen und Chancen. Europäische Vergleichsfälle belegen das hinreichend. Für Ostdeutschland sind für den Zeitraum bis 2015/20 verschiedene Entwicklungsszenarien denkbar: Ein „Weiter-So“ wie bisher – d. h. ein Festhalten am Kurs nachholenden Anpassens und Aufholens gegenüber dem Westen, von Subventionen zur passiven Sanierung, ein „Durchwursteln“ ohne eigene, neue Gestaltungspolitik – würde Ostdeutschland in eine dauerhafte strukturelle und finanzielle Abhängigkeit und letztlich in die Pleite führen. Ein Setzen allein auf Angebotspolitik im Sinne der Gewinnsteigerung für die Wirtschaft als alleiniger gesellschaftspolitischer Zielgröße, ein Setzen auf Steuersenkung für Unternehmer, auf Deregulierung, Niedriglohnsektor, längere Arbeitszeiten, staatlichen Druck auf Arbeitslose verbunden mit Stärkung der (wenigen) wirtschaftlichen Wachstumspole könnte kurzfristig zweifelhafte Erfolge einfahren und eine prekäre wirtschaftliche und soziale Stabilisierung erreichen. Ostdeutschland könnte dadurch aber nicht auf Dauer im Europa der Regionen aus der 2. Klasse herausgeführt werden. Eine solche Strategie setzt nicht auf die wirklichen Standortvorteile und Innovationspotenziale des Ostens und untergräbt im Gegenteil die soziale und humane Substanz der Gesellschaft langfristig. Um einen langfristigen und zukunftsfähigen Entwicklungsprozess einzuleiten ist ein gesellschaftliches Umsteuern, ein Richtungswandel notwendig. Das erfordert auf Bundesebene einen neuen moderaten Mix von staatlicher, besonders zivilgesellschaftlicher, aber auch marktwirtschaftlicher Regulierung und auf EUEbene eine gezielte Präferenz der Regionalentwicklung. In den neuen Bundesländern geht es dabei vor allem um eine nachhaltige Innovationsstrategie mit sozialer Gestaltungskompetenz. D. h.: - Setzen auf eine nachhaltige, wissensbasierte Ökonomie; - verstärkte Investitionen in Bildung, Qualifikation und Forschung – von der Kindertagesstätte über Hochschulen und Forschungseinrichtungen bis zu innovativen Unternehmen und Wirtschaftskreisläufen – als die Zukunftsinvestitionen; - Förderung der abhängigen und selbständigen Erwerbsarbeit ebenso wie die Suche nach neuen, alternativen Beschäftigungsformen und einer gerechten Teilung der vorhandenen Arbeit; 13 - Konzentration auf die Entwicklung innovativer Räume und zugleich kooperative Verflechtungen aller, also auch der ländlichen und peripheren Räume; - Stärkung der Eigenverantwortung sowie der gesellschaftlichen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Um eine solche Entwicklung einzuleiten bedarf es eines grundlegenden Wandels der Institutionen – statt Bevormundung Innovation – und der Mentalitäten – statt Abwarten Aktivität. Auch ein solches gesellschaftliches Umsteuern bietet keine Erfolgsgarantie. Aber es ermöglicht unter den gegebenen Verhältnissen am ehesten die Chance, den Abwärtstrend zu stoppen, die Region zu stabilisieren und den Weg zu einem selbst tragenden, innovativen und sozial stabilen Entwicklungspfad zu öffnen. Die Beispiele Finnlands25 oder auch des „Dritten Italiens“26 (Venetien, Emilia-Romagna) zeigen auf je unterschiedliche Weise, dass solche neuen Entwicklungswege real möglich sind. Ostdeutschland kann sicher nicht allein und auf sich gestellt diesen Pfad beschreiten, aber es kann Impulsgeber dafür sein und selbst praktische Beispiele setzen. Die gezielte Stärkung Ostdeutschland durch den Bund hilft letztlich auch Westdeutschland und damit der gesamtdeutschen Bundesrepublik. Entscheidend bleibt der in der bisherigen Transformation und Vereinigung zunächst ausgesparte, nun aber unverzichtbare Wandel im gesamtdeutschen Kontext. Die Reform der Verfassung, der Wirtschaft, der Beschäftigungssysteme, der sozialen Sicherungssysteme, der Bildungsinstitutionen stehen auf der politischen Agenda oben an. Nicht wegen der Kassenlage und konjunkturellen Entwicklung, sondern wegen der langfristigen gesellschaftlichen Veränderungen. Dabei geht es weder nur um „Einhegung“ noch gar um den Bruch der Moderne, sondern um ihre grundlegende Weiterentwicklung und Neujustierung. In diesem Sinne beginnt die Vereinigung auf realer Grundlage gerade erst. Am Ende werden Deutschland Ost und Deutschland West, die gesamtdeutsche Bundesrepublik anders aussehen, als wir es 1990 annahmen und annehmen konnten. Das Einheitsprojekt ist deshalb keineswegs schon vollendet und stabilisiert. Es kann eher als ein zukunftsoffenes, aber gestaltbares Generationenprojekt interpretiert werden. 1 Siehe Albert O. Hirschmann: Abwanderung, Widerspruch und das Schicksal der Deutschen Demokratischen Republik. In: Leviathan, 1990, Heft 3, S. 330-358. 2 Vgl. Michael Brie: Die ostdeutsche Teilgesellschaft. In: Max Kaase/Günther Schmid (Hg.): Eine lernende Demokratie. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. WZB-Jahrbuch. Berlin 1999, S. 201 ff. 3 Gerhard Lehmbruch: Die deutsche Vereinigung: Strukturen und Strategien. In: Politische Vierteljahresschrift, 1991, Nr. 4, S. 585-604. 4 Klaus von Beyme: Verfehlte Vereinigung – verpasste Reformen? In: Everhard Holtmann/Heinz Sahner (Hg.): Aufhebung der Bipolarität. Veränderungen im Osten. Rückwirkungen im Westen. Opladen 1995, S. 55/56. 14 5 Claus Offe: Die politisch-kulturelle Innenseite der Konsolidierung. In: Jan Wielghos/Helmut Wiesenthal (Hg.): Einheit und Differenz. Berlin 1997, S. 216. 6 Klaus von Beyme: Der kurze Sonderweg Ostdeutschlands zur Vermeidung eines erneuten Sonderweges: Die Transformation Ostdeutschlands im Vergleich postkommunistischer Systeme. In: Berliner Journal für Soziologie, 1996, Heft 3, S. 315. 7 Initiative Soziale Marktwirtschaft: Studie. Ländervergleich. Berlin 2004. 8 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.): Datenreport 2004. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Berlin 2004. 9 Vgl. Deutsche Bank Research: Perspektiven Ostdeutschlands – 15 Jahre danach. Deutsche Bank Research. Frankfurt a. M. 2004, Nr. 306. 10 Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e. V.: Sozialreport 2004. Daten und Fakten zur sozialen Lage in den neuen Bundesländern. Berlin 2004, S. 25. 11 Ebenda, S. 73. 12 Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Umfrage zum Mauerfall. Berlin 2004. 13 Sozialreport 2004, a. a. O., S. 58. 14 Statistisches Bundesamt (Hg.): Datenreport 2004. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Berlin 2004, S. 650. 15 Sozialreport 2004, a. a. O., S. 308. 16 Siehe Rolf Reißig: Die gespaltene Vereinigungsgesellschaft. Bilanz und Perspektiven der Transformation Ostdeutschlands und der deutschen Vereinigung. Berlin 2000. 17 Siehe dazu Jörg Roesler: Der Anschluß von Staaten in der modernen Geschichte. Eine Untersuchung aus aktuellem Anlaß. Frankfurt a. M. 1999. 18 Wolfgang Thierse: Aus 15 Jahren Einheit lernen. In: Deutschland Archiv, 2004, Heft 6, S. 942. Siehe auch Rainer Land: Ostdeutschland – fragmentierte Entwicklung. In: Berliner Debatte Initial, 2003, Heft 6, S. 76-95. 20 Paul Nolte: Generation Reform. Jenseits der blockierten Republik. München 2004, S. 129. 21 W. Carlin/David Soskice: Shocks to the System: The German Economy under Stress. In: National Institute Economic Review, 1997, Nr. 159, S. 60. 22 von Beyme: Der kurze Sonderweg Ostdeutschlands, a. a. O., S. 309. 23 Siehe dazu Manfred G. Schmidt: Immer noch auf dem „mittleren Weg“? Deutschlands Politische Ökonomie 19 am Ende des 20. Jahrhunderts. In: Roland Czada/Hellmut Wollmann (Hg.): Von der Bonner zur Berliner Republik. 10 Jahre Deutsche Einheit. Leviathan Sonderheft 19/1999. Wiesbaden 2000, S. 491-513. 24 Siehe Rolf Reißig/Michael Thomas (Hg.): Neue Chancen für alte Regionen? Fallbeispiele aus Ostdeutschland und Polen. Münster/Hamburg/London 2005. 25 Vgl. Von Finnland lernen?! Perspektive21, 2004, Heft 24. 26 Jörg Aßmann: Das Gespenst des Mezzogiorno. Welches Entwicklungsszenario erwartet Ostdeutschland? In: perspektive21, 2004, Heft 21/22, S. 58-60. 15