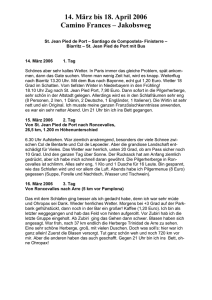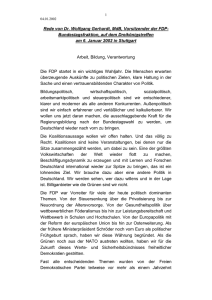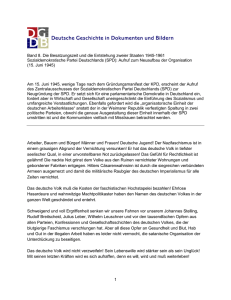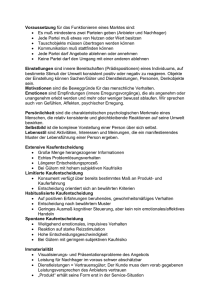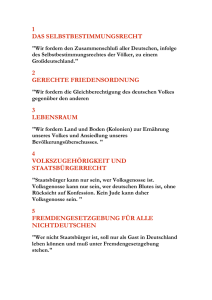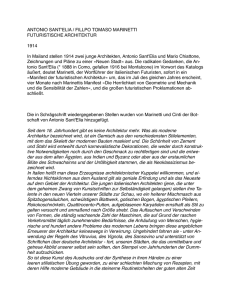Von Karsten Sinning Die Wanderung von Dresden nach Santiago
Werbung

Die Wanderung von Dresden nach Santiago de Compostella Von Karsten Sinning Die bisher einzige zusammenhängende Wanderung von Dresden nach Santiago de Compostella über 3.000 km in 100 Tagen 1 [3.4] Trallala, mein erster Bericht ist da! Live und in Farbe meldet sich hier der Weltreisende Karsten aus Pobershau im Erzgebirge! "Der Erholungsort Pobershau liegt als Bergdorf an den Hängen des Tales der Roten Pockau und reicht bis in das wildromantische Naturschutzgebiet des Schwarzwassertals. Er verdankt seine Entstehung vor mehr als 500 Jahren dem großen Berggeschrei- so hieß in alten Zeiten die Kunde von der Entdeckung des Silbererzvorkommens..." (© Medialine) Bin am Samstag nach der riiiesigen Verabschiedung mit Feuerwerk und allem Zubehör mit einem 170 Kilo- Rucksack (nach Gefühl) und gesunden Füßen in Begleitung von Roland, seiner Freundin und Jürgen bis zur Babisnauer Pappel losgewandert, um noch einen sehnsuchtsvollen Blick gen Heimat zu werfen (ach. liebe Corinna, nun ohne mich in der WG!) Übernachtet habe ich oberhalb von Reichstädt an einer kleinen Kirche. Alles eitel Sonnenschein und Schmetterlinge und ach so viel schöner Frühling! Der zweite Tag bringt mir einen Rucksack, der nach Gefühl nur noch 50 Kilo wiegt, dafür bilden sich an meinen Füßen blasenartige Gebilde, die das Laufen mächtig behindern und dazu verströmen sie einen unwiderstehlichen Duft. Meine geplagten Füße tragen mich nach Deutscheinsiedel, wo ich sonntags um acht noch ein Brot kaufe (auf tschechischer Seite) und im Bushäuschen schlafe. Heute nun lief ich durch Seiffen, Olbernhau und durchs Schwarzwassertal nach Pobershau, aß 5 Bananen (weil die so billig waren) und traf meinen alten Abikollegen Denis wieder, der ins Regionale Fernsehen mit Erfolg eingestiegen ist, wie ich bei einer Kostprobe seines Schaffens beim Verzehr eines Döners feststellen konnte. Den kleinen Auszug aus seiner Kunst und einen Link zur Firma habe ich euch oben hinterlassen. Morgen geht's weiter nach Annaberg- Buchholz, wo ich Kirsti treffen werde. Also machts schön gut bis zum nächsten Eintrag. Wer mir noch Geld geben möchte, bitte auf mein Konto überweisen! (KtoNr: 450 932 795, Stadtsparkasse Dresden BLZ 850 551 42) [5.4.] Kirsti ist gestern mit Erfolg in Annaberg-Buchholz zu mir gestoßen und meine Blasen haben sich mit Erfolg auch aufgestoßen, das heißt, es sind nun nicht mehr die, die wehtun, sondern nunmehr meine Knie. Da wir nun zu zweit sind, werde ich auch nicht mehr in Ich-Form schreiben können. Mal sehen, wie lange das anhält (HiHi)! Haben gestern einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt, dafür aber lange nach einer Unterkunft gesucht. Dabei irrten wir durch das nächtliche Schlettau, besichtigten den Stadtpark und schlugen unser Nachtlager in einem Schuppen an der Hauptstraße auf. Man hatte uns sogar einen Ballen feinster chinesischer Seide zum Drunterlegen hinterlassen sowie eine Handvoll Deckenpaneelen. Gut geschlafen. Morgens ist das Wetter noch schön, bevor es beschließt, den Tag grau in grau verkommen zu lassen. In Schwarzenberg endet die Etappe vorerst, wir trampen zu Claudia nach Schneeberg und ich hacke bei ihr in der Hochschule für Angewandte Kunst Schneeberg die Hieroglyphen in die Tasten des Monstergerätes "Computer". Dabei steigen Dampfwolken von meinen Füßen her hinauf zu meiner Nase. Sogar hier riecht man das! Nun wollte ich gern, daß sich die Kirsti ein bißchen vorstellt, doch sie möchte gern anonym bleiben. Der Rat der Weisen akzeptiert das. 2 Und nun: Wer mir eine Mail schicken will, bitte an: [email protected] . Und Geld überweisen: wie gehabt. Und gern. [7.4.] Claudia genehmigte uns eine komfortable Nacht, für Kirsti ist sogar ein Bad herausgesprungen. In der Früh wanderten wir los, zum Filzteich, einem alten Bergbauabwassergewässer und weiter durch den klingenden Wald bis zur Talsperre Eibenstock. Diese umschifften wir und gelangten so zur Stadt Eibenstock. In der Sonne sitzend genießen wir unsere PLUS-Einkäufe und begeben uns auf den kilometerlangen steil berganführenden Carolssteig nach Carolsfeld. Was wir nicht wußten und auch nicht erahnen konnten, war, daß im oberen Erzgebirge noch Unmengen von Schnee liegen. Und so versanken unsere Schuhe knietief in das glitzernde Weiß. Ein besonderer Genuß ist immer wieder, das kalte Naß in die geschundenen Füße laufen zu spüren. In Carolsfeld dann die Entschiedung: Laufen wir, es ist schon 17 Uhr, noch weiter nach Klingenthal (10 km) oder gammeln wir hier noch etwas rum. Wir laufen und Kirsti sieht es als meine Taktik an, sie durch die Gegend zu scheuchen. Wir wandern also über den Kamm bis fast nach Klingenthal, dort fragen wir im Gasthaus "Schöne Aussicht" nach einem Plätzchen zum Übernachten, denn trotz des strahlend schönen Wetters sind nachts Temperaturen unter Null Grad. Hier oben beginnt erst der Frühling mit den ersten zarten Krokusspitzen. Und dieser Gaststätte und besonders ihrer Köchin gebührt unser heutiger Dank, denn wir bekamen ein kostenloses und vor allem leckeres Abendbrot serviert (Kirsti: Salatteller; ich: Schwammerlstreifen) und durften bei der Köchin zu Hause übernachten. Im Übrigen ist diese im Stil der 20er Jahre aufgebaute Gaststätte wirklich einen Besuch wert, ist total gemütlich und hat einen wunderbaren Blick über die Berge. Morgens laufen wir dann los nach Klingenthal hinein, und ich versuche mein InternetGlück am Gymnasium Klingenthal und werde prompt und freundlich vom Direktor und Herrm Wahl, dem Computerspezialisten, bedient. Gleich gehe ich einen Ausflug in die Tschechei machen, etwas Eßbares einkaufen; Kirsti bewacht inzwischen die Rucksäcke. So ohne Rucksack zu laufen, das ist, als ob man fliegt, ehrlich! Also vielen Dank auch ans Gymnasium Klingenthal! [12.4.] Bin schon ein ganzes Stückel auf der Landkarte vorangekommen; und daß es auch real passiert ist, das zeigen mir meine Füße; die Blasenzeit ist vorbei; wir sind etwas höher hinaufgestiegen, nun sind es die Knie, die melden, daß sie auch noch da sind. Fast hätte ich beim vielen Wandern die Lust verloren, weiter zu schreiben. In der Welt herumzulaufen und sich um nichts weiter als um den Weg, das Essen und Schlafen einen Kopf zu machen, verführt dazu, die technischen Segnungen hinter sich zu lassen. Aber Ihr wollt natürlich wissen, wie es weitergegangen ist; das Abenteuer Spanien. Na, ob ich durchhalte werden wir ja sehen; aber noch steht es, das große Ziel: Santiago de Compostella. Also weiter im Text: Mein Abstecher in Klingenthal hinüber nach der Tschechei hat sich als wenig ergiebig erwiesen: eine lange Wanderung auf einer "entautoten" Straße voller Fußgänger und Radfahrer (wo sieht man schon noch so was?) bis zu einem Supermarkt, an welchem man von Vietnamesen in Beschlag genommen wird, 3 sobald man auch nur die kleinste Spur eines Interesses an ihren gehäuften Zigarettenstangen, bunten Handtüchern und diversen Alkoholika zeigt. Immerhin gibt es eine Flasche Camping-Tee, ein nützliches Hilfsmittel, um geschmacksneutrales Quellwasser in den Zustand eines rumaromatisierten Campinggetränkes zu versetzen. Bald bin ich also wieder hüben und wir besichtigen die einzige Rundkirche der Gegend. Eine leere, wunderschön schlicht gehaltene Kirche erwartet uns; erfüllt von herrlichen Orgelklängen. Nach soviel Naturverbundenheit kommen einem selbst die Übungsklänge des Organisten wie das Weihnachtsoratorium in der Kreuzkirche vor. Ich ruhe und genieße. Aufgerafft und los: hinauf auf den Erzgebirgskamm. Seit Klingenthal befinden wir uns ja nun schon im Vogtland. Immer wieder blockieren umgebrochene Bäume den Weg. Das Ziel der heutigen Reise, das wir mit äußersten Kräften erreichen, ist Markneukirchen. Eine der reichsten Städte, wie wir später erfahren. es hat einmal 21 Millionäre durch den Musikinstrumentenbau gegeben. So sieht man denn auch allerorten Schilder an den Häusern "Böhmflötenbauer", "Zitherbaumeister", "Metallblasinstrumente". Doch abends um acht interessiert uns das weniger, denn es wird kalt und wir haben noch kein "Quartier", wie man so schön sagt. Eine Anfrage an das Diakonische Altenheim zeigt uns wieder einmal die Unflexibilität deutscher Bürokratie: "Ist nicht erlaubt." Eine weitergehende Frage an eine Gruppe älterer Hundehalter auf ihrem Gassiweg läßt uns ihre Mühe erkennen, einen Ort zu finden, zu dem sie uns weiterschicken können. Als sie in ihrem Kramen einen Gasthof finden, sind sie froh, uns losgeworden zu sein. Wir jedoch, heiter wie wir sind, mieten uns für eine Nacht in einem im Umbau befindlichen Haus ein, in welchem eine Zimmer schon fast fertig hergerichtet ist. Unser Stolz ist dabei natürlich, alles wieder im Naturzustand zu hinterlassen, so, als ob wir gar nicht dagewesen wären. Im Keller läuft sogar noch Wasser. Morgens springe ich mit einem Satz aus dem Haus hinüber zum Bäcker (ich hoffe, mich hat keiner beobachtet) und hole eine Ladung guten Morgen in Tüten. Dann laufen wir zum Musikinstrumentenmuseum, zu dem wir uns nach einer kurzen Verhandlung und Erklärung unserer Wünsche Zutritt für den halben Preis verschaffen können. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal dafür! Uns erwarten Instrumente aus aller Welt: Kandeles aus Finnland, Trommeln aus Afrika und vor allem aller Arten einheimischer Kapelleninstrumente: Geigen, Flöten, Trompeten und natürlich auch eine Reihe meiner geliebten Konzertinas; eine davon meiner eigenen ziemlich ähnlich. Ein paar Kilometer sind es noch bis Reuth und Reuth (kommt von "roden"), das ist die Grenze; wir wollen den Zipfel Tschechei durchwandern; um abzukürzen (ich bin ehrlich: auch, um ein "gutes böhmisches Essen" abzufassen). Im "Hubertus" gibt`s smazeny syr, was heißt "leckerer überbackener Käse, dreihundert Gramm groß". Die Tschechei ist kurzer Ausdehnung an dieser Stelle, und so sind wir bald in Westdeutschland. echt komisches Gefühl, das erste Mal von zu Hause aus direkt in die "BRD" gewandert zu sein. Ich hatte echt Lust, dieses Gefühl dem deutschen Grenzer mitzuteilen, aber der ist gar nicht da; nicht mal durchgewunken werden wir. Selb ist die erste Kreisstadt, die wir erreichen können; sie "ist zwar keine Weltstadt, aber weltbekannt", wie man überall lesen kann. Weltbekannt für das Hutschenreuther-Pozellan, dessen Fabrikationshalle von Walter Gropius, dem bekannten Vorreiter des BAUHAUS, konstruiert wurde. Ein herzliches Dankeschön und die Ehrung des Tages an dieser Stelle gehen an zwei Frauen in Erkersreuth, die uns freundlich und hilfsbereit ihre "Hutzenstub`m" zum Übernachten zur Verfügung stellen, eine Matratze herbeischleppen und uns einheizen. In ihrer Hutzenstub`m 4 wurde gebastelt; es lag noch Heu herum; und was uns wundert ist, daß sogar Männer mitbasteln. Ost-Männer, lernt von den Wessis! Von Selb führt der Andreaskreuzweg durch menschenleere Dörfer bis Tirschenstein, wo eine Burg majestätisch über der Ebene thront und weiter bis zu einer Autobahnbaustelle; dort verliert sich der Wanderweg im Nirvana der derispurigen Fahrstraße. Uns bleibt nichts anderes, als querfeldein zu laufen; staubige Schuh und Hosen werden das Resultat sein. Aber so ereichen wir bis zum Abend Marktredwitz, den Flecken am Anfang des Naturparkes "Steinwald". Ich sitze so auf einer der wenigen Bänke am ewig langen und ewig häßlichen Industrieparkvorortes und prompt hält eine Streife des BGS an und kontrolliert meinen Ausweis. Ich will wissen, wieso er ausgerechnet mich kontrolliert; die lapidare Antwort darauf: "Der BGS darf jede Person kontrollieren." Ich bin halt jedermann. Ich denke, wenn ich im chicken Dreiteiler mit Hündchen Gassi gegangen wäre, hätte mich niemand nach dem Ausweis gefragt. Apropos Gassi: Haben Sie schon einmal jemanden gesehen, der seinen Hund mit dem Auto Gassi führt? Ich hab`s gesehen und bin immer noch erstaunt darüber. Nach der Anstrengung des Tages beschließen wir, in ein typisches regionales Spezialitätenrestaurant zu gehen und landen in einer Pizzeria mit tschechischer Bedienung. Nebenan liegt das Gemeindehaus der Stadtkirche. Wir klopfen dort an und bitten um die Möglichkeit, zu übernachten. Eine Gemeindehelferin schließt uns den Gemeinderaum auf, wo weiche Kissen liegen und ein Waschbecken zur Großwäsche einlädt. Wir bedanken uns und lassen es uns gutgehen. Am Morgen liegt zu unserer Überraschung eine Tüte mit Croissants und Brez`n auf dem Tisch. Unser Dank gilt der freundlichen Gemeindehelferin und der Gemeinde, dessen Namen wir leider nicht mal erfahren haben. In der Stadt kaufen wir eine Fritzsch-Wanderkarte und hoffen, sie im nächsten Gebiet umtauschen zu könne; denn es ist schon ein Kreuz mit den langen Wanderungen: man müßte soviel Kartenmaterial mitschleppen, damit man die kleinen Wanderwege findet; das geht nicht an. Und so muß man die Karten, die man jeweils nur ein, zwei Tage braucht, eben wieder zurückgeben und sich die neue geben lassen. Und daß das funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber es geht: wir werden sehen. Einer großen Straße folgen wir in Richtung Steinwald und erleben, daß fast alles für Autofahrer eingerichtet ist: ein Pennymarkt hat nicht mal einen Fußweg, sondern nur einen Autoparkplatz. Oben, fast am Gipfel, der Ruine Weißenfels, gibt Kirsti auf; ich bin ihr zu schnell und sie hat sich den weiten weg nach Spanien nicht so weit vorgestellt. Bin ich wieder alleine. Von Weißenfels ist nicht mehr viel übriggeblieben, außer den geklärten Besitzverhältnissen: die Familie von Nothafft, wohnhafft in München. Auf dem Kamm des Berges laufe ich an einer ökumenischen Kapelle vorbei und vorbei am nicht mehr existenten "Oberpfalzturm" hinunter nach Erbendorf. Es ist viertel nach sechs und ich überlege, ob ich noch die zehn Kilometer nach Pessnath laufe. Ich tu`s und meine Knie jammern. Aber es ist ein wunderbares Gefühl, durch den dämmernden, singenden Wald zu laufen. es wird finsterer, man hört es allerorten rascheln und bildet sich, je dunkler es wird, die finstersten Gestalten ein. Die bemoosten, urwüchsigen Bäume tun ihr übriges dazu. Übernachten werde ich auf der Veranda einer Forellenzüchterkaten mitten im Wald. Am frühen Morgen, nach einer beengten Nacht, mit Schulterschmerzen und Rückenweh, aber bei zaghaftem Sonnenschein, erreiche ich Pessnath und tausche meine Fritzsch- Karte gegen eine neue aus. Vielen Dank an den Buchladen in der Stadt. Ein Bäcker verkauft mir ein Frühstück von gestern zum halben Preis und ich 5 marschiere los, von Geschützdonner und Hubschraubergebrumm begleitet, umrunde ich den Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Es regnet und nebelt und man kann sich nichts deprimierenderes als Nebel mit Raketenbegleitung vorstellen. Doch gegen Nachmittag, nach einer ewigen Wanderung neben der Bundesstraße 299, lichten sich die Wolken, die Lerchen beginnen am Firmament zu jubilieren und der Tag wird schön. Auf einem Dorf lerne ich im Laden eine liebe Oma kennen, die schenkt mit Eukalyptusbonbons und erzählt wehmütig, daß sie bald ihren Laden schließen muß, den sie doch kennt, seit sie ein kleines Kind war. Der frühe Abend führt mich durch die Moore der Vils und das heißt wieder ein romantisches spannendes Erlebnis. Man könnte sich Märchen ausdenken hier. Kurz vor Vilseck frage ich eine Frau nach Übernachtung und sie sagt auf meine Erklärung hin, daß hier im Dorf auc drei Leute den Jakobsweg wandern wollten; aber die wollten am Tag 40, 50 Kilometer laufen und haben bald aufgegeben. Zum Übernachten fährt sie mich zum Heiner Winter, auf den Bauernhof, wo ich im Heu über den Kühen schlafen darf. Morgens gibt`s ein zünftiges Frühstück und zum Mitnehmen noch ein Packen "Bauerseufzer", eine Art Knacker. Liebe, freundliche Leute, durch die ich viel auch über die Gegend erfahren habe. Heiner fährt mich noch zur Volksschule Vilseck, wo ich freundlicherweise ins Internet darf und nun hier sitze und Euch berichten kann. Das paßt auch, denn heute regnet`s und hier drinnen ist`s schön warm und trocken. [17.4.] Paßt auf, liebe Leute; wieder mal habe ich es an einen Computer geschafft; diesmal in Dillingen an der Donau. Lest, wie es dazu gekommen ist: Am 12. Tage meiner Wanderung laufe ich also von Vilseck nach SulzbachRosenheim. In Vilseck bestaune ich die Unmenge von religiösen Erscheinungen, die die amerikanischen Soldaten mitgebracht haben: an vielen verschiedenen kleineren und größeren Häusern stehen die utopischsten Namen von Kirchen und anderen amerikanischen Einrichtungen. Doch die Sonne scheint und sie treibt mich voran, entlang der Vils. abends stoße ich auf die Wallfahrtskirche der Heiligen Anna. die Kirche thront auf einem Berge vor Sulzbach- Rosenberg und ist von unzähligen Buden umstanden, die zu nichts anderem dienen, als Wallfahrer zu beköstigen, wie ich später erfahre. Bei Abendsonnenschein laufe ich hinab in die Industriestadt, die von Schlackehalden umgeben ist und deren Zentrum die Maxhütte, eine Eisenhütte; das Stammwerk der bei uns bekannten Maxhütte Unterwellenborn ("Max braucht Wasser!"), bildet. Auf Anfrage werde ich zum Kaplan geschickt; dem Ortspfarrer; und der ist total praktisch und hilfsbereit: quartiert mich ins Ministrantenzimmer und bringt mich ins katholische Wirtshaus zu einer Stammtischrunde, der ich Rede und Antwort stehen muß, und bekomme ein Essen und Getränke frei. Die Leute am Tisch finden das Vorhaben interessant und ich bekomme sogar Geld geschenkt. Heute bin ich nach Illschwang gelaufen und mir einen Saft gegen den allzugroßen Durst im örtlichen Getränkeladen gekauft. Angelegentlich meines Besuches fängt die liebe Frau an, über den Ort zu erzählen: daß er 1996 als das schönste Dorf ausgezeichnet worden ist - von Europa oder von Deutschland, das weiß sie nicht so genau; aber die Sage von der Teufelskanzel, die kann sie mir genau erzählen: einst wohnte ein Einsiedler am Osterloch, einer Felshöhle unweit des heutigen Dorfes; der sah über der Anhöhe, auf der heute die Kirche steht, den Teufel rumoren. Ob seines großen Glaubens schwor sich der Einsiedler: genau an dieser Stelle soll eine Kirche stehen! Gesagt, getan - heute sieht man diese schmucke Kirche inmitten des schönsten Dorfes und in ihr drinnen findet man ein Gemälde vom frommen Einsiedler und auch eins vom wilden, argen Teufel und - wie es sich gehört, ist am Fußboden 6 sogar noch eine Platte mit dem Fußabdruck von... na, wem wohl? Und ehe man`s sich versieht, ist man über einem Saft in die finstersten geschichtlichen Tiefen Bayerns gestoßen. Man muß nur neugierig sein. Abends fängt es zu regnen an, ich koche mir in einer Wartehalle eine Suppe zum Aufwärmen. Kaum ist die hinter, erscheint der schönste Abensonnenschein und ich kann die Berge hinunter ins Tal laufen, Richtung Neumarkt; aber ich komme nur bis Pilsach, dann versagen die Füße und ich spreche eine Frau an, die mit zwei Schraubzwingen in der Hand die Dorfstraße hinunterläuft, ob sie jemanden wüßte, der... Sie bietet mir an, bei ihnen im Stroh zu schlafen. Sie hatten das zwar noch nie, aber sie wollen es versuchen. Wir gehen vorbei an ihrer Kirche, der Apostelkirche Peter und Paul und bei ihr zu Hause erzähle ich dem Mann nochmal die ganze Geschicht. Kann mich waschen, schlafe im Stroh und bekomme dazu noch ein schönes Frühstück. Die Familie heißt Riedel und ihr gehört ein liebes Dankeschön. Von Frau Riedel habe ich erfahren, daß ausgerechnet in ihrem Örtchen Pilsach, gleich in der Nachbarschaft das Schloß steht, in welchem Kaspar Hauser eingesperrt war, der berühmte. Doch leider ist in dem Schloß, das jetzt in Privatbesitz ist, keiner da. Aber es ist wunderschön; zwar klein, aber schön. Bis nach Neumarkt sind es noch gut 6 Kilometer. Die schafft man leicht an einer ausgebauten Bundesstraße, zentimeternah an Trucks vorbei; wie so oft. Voller Optimismus versuche ich wieder, meine Karte zu tauschen; habe aber weniger Glück; der Buchhändler will die nicht mal geschenkt haben. Und eine Wanderkarte vom folgenden Gebiet, die kann man vergessen - gibt`s nicht. Städte sind wie das Wetter; sie haben Launen. Und diese Stadt hatte nicht so gute. Keiner redete mit mir, man schickte mich weiter, es gab keine Sonderangebote, keine Sandalen; na ja, muß auch mal sein. Bis nach Freystadt gibt es außer der Schnellstraße und dazu rechtwinkligen Feldwegen keine gangbaren Pfade und so wende ich Methode "querfeldein" an und komme so zum Ziel. Unterwegs treffe ich unter einer Brücke bei Mittelricht, der einzigen etwas versteckten Stelle zum Rast machen, die kleine Michelle, die wie aus dem Nichts auftaucht, mir Löcher in den Bauch fragt, von ihrer Mutter erzählt, die so oft weg ist und wegen derer sie sich oft sorgt, und plötzlich ist sie wieder verschwunden. Als ich weiterziehe, winkt sie mir noch hinterher... In der Mittagspause ergibt sich noch eine amüsante Begebenheit: ich esse gerade, auf einer Mauer sitzend, Mittag, da kommt der Bäckerwagen angefahren, ich nutze die Gelegenheit und kaufe ein Brot, da fragt mich die Bäuerin, die ebenfalls einkauft, 7 nach dem Woher und Wohin, überläßt mir eine Mark ihres Wechselgeldes und empfiehlt mir unbedingt, in Freystadt die Wallfahrtskirche "Mariahilf" zu besichtigen. Das tue ich doch prompt. Schon von weitem lockt ihre äußere Erscheinung als lohnendes Ausflugsziel. Sie verkörpert italienisches Flair; liegt etwas abseits der Stadt und wird von einem noch bestehenden Zisterzienserorden betreut. (Der Orden hat ein sehr hilfreiches Behindertenklo eingerichtet, in de ich mich rasieren kann.) Die Geschcihte der Kirche zeigt, wie kleine Projekte zu großen werden können: Ende des 16. Jahrhunderts bauten zwei Buben eine spartanische Kapelle aus Lehm und Zweigwerk. Wahrscheinlich stellten sie eine Sammelbüchse auf, denn es kamen im Laufe der Zeit so viele Spenden zusammen, daß man davon eine größere Kapelle bauen konnte. Und irgendwie kam es dann in Mode, in italienischem Stil zu bauen und ein Fürst war wohlgesonnen und so wurde justament an dieser Stelle die wohl prächtigste Wallfahrtskirche Bayerns, mit Fresken der Brüder Aman, erbaut. Weiter geht es querfeldein; über den Main- Donaukanal und über zwei Autobahnen; man fühlt sich an solchen Wanderengpässen wie ein zartes Würmelein zwischen mächtigen Autoströmen; bis zum Zereshof bei Eysölden. Ich frage den Bauern, einen Mann mit mächtigem Vollbart, ob ich hier übernachten dürfe; ich darf es tun im Gartenhaus. Die kleinste Tochter erklärt mir die Details des Bauernlebens; insbesondere der Kuhhaltung. Familie Peipp hat nämlich einen ganz besonderen Stall, der auch mein Interesse weckt. Ein offener Stall, in dem die Kühe frei umhergehen könne, fressen, wann sie wollen (computergesteuert), sich hinlegen und saufen, wann sie wollen. Sie liegen auf einer schiefen Ebene aus Stroh, welches immer 30 Grad warm ist (durch die Gärung) und ständig nachrutscht, so daß die Kühe immer auf sauberem Heu liegen. Sogar einen "Kratzautomaten", wie die Kleine sagt, haben die Kühe; eine Bürste und ein Besen an einem Stiel. Wir essen zusammen Abendbrot, dann schlafe ich im Gartenhaus. Morgens gibt`s noch ein Frühstück mit der kompletten Familie und eine Schokolade mit auf den Weg. Die Leute sind so nett gewesen und so freundlich, daß es mir vorkommt, ich kenne sie schon länger. Besonders das kleine Mädchen ist mir ans Herz gewachsen. (Liebe Peipps, wenn Ihr das lest, schickt mir doch bitte Eure EMailadresse!) Wieder geht es querfeldein, diesmal habe ich als Orientierungshilfe einen kleinen Bach, der mich nach Weißenburg leitet. Vor dem eigentlichen Stadtbesuch werfe ich vom Bismarkturm einen Blick auf sie. Ein Häusermeer in einer hügeligen Landschaft, umrahmt von einer in weitem Bogen die Stadt umrahmenden brummenden Autotrasse. Drinnen die Stadt empfängt mich mit schmucken Häusern, einer Stadtmauer und dem gotischen Rathaus von 1470, aber mit menschenleeren Gassen. Ich fühle mich so richtig verloren. Ab und zu brummen ein paar Autos an mir vorbei... Es ist, als ob man heimlich in einem Museum ist; der Wärter hat schon abgeschlossen und hat nicht gemerkt, daß da noch einer darinnen verborgen ist. Aber vielleicht liegt es ja auch nur an dem schmuddeligen Wetter, daß niemand zu sehen ist. Jedenfalls entdecke ich ein feines Cafè am Rathausplatz und in dieses verziehe ich mich erstmal mit geschundenen Füßen und lesegierigen Augen, bestelle ein Stück leckerstem Käsekuchen und ein Glas Mandelmilch und verschlinge den neuesten Spiegel, denn ich habe wochenlang keine Lektüre um mich gehabt. Und das fehlt einem Stadtmenschen. Schnell muß ich der Stadt den Rücken kehren; es geht gegen Abend zu und hier in den Mietswohnungen kann ich mir keine Übernachtung erhoffe; die Leute haben alle sicher zu wenig Platz dazu. Sind halt keine Bauern mit Stroh hinter der Tenne. Doch 8 es folgt ein ermüdender Fußmarsch durch ein unendliches Industriegebiet, dem ich fast erlegen wäre, wenn nicht bald die Erscheinung einer kleinen Sensation meine Gemütsregungen augefrischt hätte: direkt am Bahndamm stht ein Brunnen, der die südlichste Stelle der europäischen Wasserscheide markiert. Ich laufe ab sofort in dem Gebiet, dessen Wässer sich nicht mehr in die Ostsee, sondern in das Mittelmeer ergießen! Fast so, als böte die Natur alle ihre Künste auf, um mich aufzufrischen, zeigt sich mir am Himmel ein Naturschauspiel: der ganze Himmel ist den ganzen Tag über bewölkt gewesen, nur ein ganz schmaler Spalt am westlichen Horizont ist wolkenfrei. Durch diesen erscheint jetzt die Sonne und verzaubert mit ihren goldenen Starhalen die ganze Ladschaft in ein rotes Samtmeer mit Abenddunst und Hoffnungsgeruch. Man spürt das Aufatmen der Kreatur; der Himmel ist frei, die bleibeladene Schwere des Tages zeigt einen kräftigen Ausgang. Es ist wundervoll, bei son einem Licht mit 170 Kilo auf dem Rücken durch die Dämmerung zu steigen... Und damit dem nicht genug ist, gelange ich einige wenige hundert Meter weiter noch an ein tausend Jahre altes ingenieurtechnisches Meisterwerk: der "Flossa Carolinga". An der südlichsten Stelle der Wasserscheide sind die beiden Flüsse nur 3 Kilometer voneinander entfernt; verbände man die beiden, so hätte man eine schiffbare Verbindung zwischen Süden und Norden; zwischen Main und Donau; Ostsee und Mittelmeer. Diese Gedanken hegte um 900 nach Christus ein Berater des Kaisers Karl dem Großen. Dieser ließ sich begeistern und ging mit 600 Arbeitern zu Werke und baute einen Kanal, zehn Meter breit, 3 Kilometer lang; davon sind heute noch 1,5 Kilometer erhalten. Man läuft auf einem der beiden baumbestandenen Wälle zu beiden Seiten des wassergefüllten Kanalbettes und galangt an deren Ende in die Nähe von Treuchtlingen. Nun ist es schon dunkel; ich suche mir ganz bescheiden einen Schlafplatz unter dem Vordach einer Hütte; es wird kalt und ich kann früh, in der kältesten Stunde der Nacht, nicht mehr richtig schlafen. Des Morgens; es ist Palmsonntag; sehe ich die Prozessierenden um ihre Kirche ziehen: vorn bunte Gewänder mit Räucherfass und roter Samt und flatternde weiße Seide und Büsche aus Blättern und nach hinten zu wird der Zug immer unbunter, das heißt normalbunter, wie der Bürger eben zu gehen pflegt, wenn nichts besonderes anliegt. Die Menschen singen; das heißt der Chor, der im hinteren Drittel läuft und ein ununiformierter Polizist guckt ein bißchen nach dem Verkehr; das heißt, er grüßt mehr die Leute, die er kennt, als daß er irgendwas regelte. Ich will natürlich wieder eine Abkürzung laufen, die noch dazu nicht an der Bundesstraße entlang geht und so überwinde ich wieder einmal unzählige steilste Berge mit Reißhecken und Dornengebüschen zuhauf und mit Sümpfen und menschenfressenden Pflanzen und Skorpionen und Löwen und wilden Bestien, die im Untergestrüpp auf den ahnungslosen, rucksackschleppenden Wanderer nur so warten. Besonders schlimm sind die anstrengenden Berge. Eine kleine Gastwirtschaft erfrischt mich mich Spezilimonade aus der Flasche und mit Nachschub on Trinkwasser aus dem Gläserspülbecken. "Und das Wasser trinken sie dann?" will die Wirtin von mir noch wissen, bevor sie ihren Laden um zwölf Uhr zumacht. Ich solle schnell trinken. Und nach Spanien wandere ich... Nun komme ich doch auf die Bundesstraße 2 und an ihr liegt das Örtchen Rothenberg, in dessen Gasthof "Dr. Martin Luther nach einem anstrengenden Ritt nach seinem Verhör" eingekehrt ist. In Monheim lese ich, daß hier der Stammsitz der Firma Hama ist, die bis zum zweiten Weltkrieg in Dresden beheimatet war. Ich überlege, ob ich dem Firmenvater einen Besuch abstatte und einen Gruß aus Dresden überbringe, aber was soll ich kleines Wanderwürmelein bei einem 9 Firmeninhaber? Ich gehöre in ein Cafè, das sagt mir schon mein Appetit; und schon hole ich mir bei "Menninger" ein Stück Kuchen und sehe mich auf einer Marktplatztreppe sitzen und genießen und ganz verträumt in die Welt gucken. Kurz vor Donauwörth, dem Ziel der heutigen Etappe, durchwandere ich das Örtchen Kaisheim mit einem imposanten Zisterzienserkloster, dessen Gebäude heute als JVA dienen. Die riesige Kirche allerdings kann man besichtigen. Noch ein, zwei Stunden und ich erreiche Donauwörth. Von der Donau ist weit und breit nichts zu sehen. Das erste, was mir in den Blick kommt, ist der Mangoldfelsen. Bis 1301 stand hier die stolze Burg Mangoldstein. Mit dem Übernachten habe ich überhaut keine Sorge, wie ich zwei älteren Damen versichern kann, die sich meine ausgezogenen Schuhe, meine durchlöcherten Strümpfe und mich auf einer Parkbank sitzend, besehen. Ich gehe wieder einmal aufs geradewohl auf ein Haus zu, diesmal ist es das katholische Pfarrhaus der Kirche "Unserer lieben Frauen", wo mir der Diakon öffnet (Lieber Diakon, ich habe leider Deinen Namen vergessen. Schreibst Du ihn mir einmal?). Ich trage mein Anliegen vor, und darf meinen Rucksack ins Jugendzimmer stellen, mache erstmal einen Stadtbummel und werde vom Diakon zum Abendessen eingeladen. Ich sitze mitten in der guten Stube und bekomme aufgestafelt, wie man nur einem teuren Gast auftafeln kann. Der Diakon ist gewissermaßen auch in einem Anerkennungsjahr; er macht Praktikum bei einem älteren Pfarrer, der später auch hinzukommt; und so können wir locker über unsere Erfahrungen plaudern und uns gegenseitig ausfragen. Es ist spannend zu erfahren, wie offen man miteinander umgehen kann, wenn man auch ganz verschiedene Glaubenshintergründe hat. Es ist egal, wen man vor sich hat, man kann ihn als Menschen achten, kann auf ihn zugehen, ihn ansprechen und auch um etwa bitten. Der Diakon dachte schon, daß ich katholisch bin, weil ich so selbstverständlich angeklopft habe und um Nachtlager gebeten habe. Aber es ist etwas menschliches, sich in seiner Verschiedenheit zu akzeptieren und zu achten. Als später das, ich hätte fast gesagt, Pfarrersehepaar, was natürlich in Wirklichkeit der Pfarrer und seine Haushälterin waren, wurde es richtig gemütlich. Der Pfarrer holte noch einige Informationen über einen Verein zur Pflege der Jakobspilgerschaft hervor, doch der Vereinsvorsitzende war gerade, na wo schon- in Spanien! Morgens Frühstück und Abmarsch nach Dillingen, die Doanu hinauf. Das nette Angebot des Pfarrers, mich ein Stück zu fahren, muß ich schon aus Konsequenz dankend ablehnen. Ich will meinen Jakobsweg als Ganzes! Heute abend will ich bei Familie P. in Dillingen übernachten, sie sind SERVASMitglieder und so finde ich ihre Telefonnummer und werde gern aufgenommen. So ein Handy, das man ststs bei sich führt, ist schon eine tolle Sache, auch wenn es den Natur- und Besinnungsgedanken nicht so ganz konsequent fördert. Ich habe deswegen am Anfang ziemlich überlegt, ob ich es mitnehme oder lieber daheimlasse. Aber wenn man es mithat und es trifft einen die Sehnsucht und man sitzt gerade einsam und verlassen auf einer Feldbank, dann sollte man das verdammte Ding doch benutzen und es ist wunderbar, die Stimme aus dem kleinen Apparat zu vernehmen und hineinzusprechen und zu wählen und einer unter den anderen zehntausend Handybenutzern zu sein, die sich mit dem Gerätchen gerne schmücken. Ja. SERVAS und Dillingen. Im örtlichen Sportladen, den ich nach Sandalen befrage, lerne ich eine Voigtländerin kennen, deren Mann (Maa) aus Dresden kommt. Es fängt an zu regnen und so suche ich mir ein Plätzchen zum Verspeise meiner Habseligkeiten; und das möchte ich möglichst nicht im Stehen tun und so viele 10 Wünsche auf einmal verkraftet eine Stadt einfach nicht und so muß ich mich in einen Hauseingang schummeln, zwischen Raumteiler und Müllabstellplatz und lasse mich beim Essen meiner Habseligkeiten gerne von Herren in Anzug und von anderer Laufkundschaft neugierig beäugen. Ich muß hier mein Brot mühselig essen, während ihr, beschirmt und mit Auto, der ihr es gut habt, dem Regen entrinnen könnt auf vielfältigen Wegen! Laßt Euch das mal sagen, Ihr Gucker, der ihr vielleicht sogar auf meine Homepage guckt! Naß erreiche ich das bergende Dach der P.s. Frau P. muß schon wieder weg, zum Englischunterrricht und Herr P. st gerade von Arbeit gekommen. Schichtwechsel, um mich zu betreuen. Herr P. muß aber auch gleich wieder weg, zur SPD- Sitzung. Zum Glück gibt es noch die beiden Töchter, deren eine, die Feli, mit mir in Papas Büro fährt und mich an den Rechner setzt, damit ich meine Seiten ein bischen auf Vordermann bringen kann. Ich sehe nämlich von der Seite schlimm aus. Danach geht`s noch ins Segafredo, dem besten Cafè der Stadt, zu `nem Schwätzle, wo mir die katholische Feli offenbart, daß sie später gerne evangelisch werden möchte. Am Morgen werde ich nach einem ausgiebigen Frühstück von der Mitarbeiterin Felicita P. für die Jugendseite der Doanuzeitung interviewt und fotografiert; erst dann werde ich weggelassen. Vielen Dank für alles! (Und: liebe Leser der Donauzeitungsjugendseite: schickt mir doch bitte eine Mail, wenn ihr dies lest!) Der Rucksack Fall ich mir leicht Fällt er mir schwer, er geht mir immer hinterher. Wird er von mir getragen, dann kann ich nichts mehr sagen. Dann geh`ich hin und her Der Rucksack ist zu schwer. Über den heutigen Tag gibt es nichts Außergewöhnliches zu berichten, denn ich ruhe mich nur aus. Das Wetter ist grau, die Donau ist gerade, der Bauch grummelt, die Gedanken sind schwer, das Heim ist weh; und so wird nicht viel am Tag. Ich kaufe mir ein Buch von Rainer Maria Rilke und schmöckere darin. Das Stundenbuch (Auszug) Manchmal steht einer auf beim Abendbrot und geht hinaus und geht und geht und geht, weil eine Kirche wo im Osten steht. Und seine Kinder segnen ihn wie tot. Und einer, welcher stirbt in seinem Haus, bleibt drinnen wohnen, bleibt in Tisch und Glas, so daß die Kinder in die Welt hinaus zu jener Kirche ziehn, die er vergaß. 11 Abends schlafe ich in einem abgestellten Doppelstockhänger der guten alten Deutschen Reichsbahn. Am nächsten Tag laufe ich an der blauen Donau entlang bis nach Ulm. Und heute packe ich`s: ich ziehe mir die neuen Sandalen an, befürchtend, daß sie meinen Füßen durch ihre Neuheit Schmerzen zufügen werden. Na, was soll`s: sie tun`s und ich laufe und erreiche in den Abendstunden die Stadt Ulm, den Münster (mit 161 m der höchste Kirchturm der Welt!) und verabrede mich mit der neuen SERVAS-Gastgeberfamilie. Diese nehmen mich freundlich auf und dann auch die Kirsti, die wieder dazutrudelt und ich bekomme meine Sachen gewaschen und dusche mich und die Welt ist wieder heil, wie sie schon lange nicht mehr war. [20.04] Heute fahre ich mit dem geborgten Rad in die Universitätsstadt von Ulm, an sich schon eine Leistung, bis hier raus zu kommen, aber dann stellt es sich als gar nicht so einfach heraus, ans Internet zu kommen. Ich hangele mich bis in die höchsten Ebenen der Internetverantwortlichen hinauf und finde dann einen sehr freundlichen Mitarbeiter, der mir einen provisorischen Account einrichtet und mich sogar bis in den Computerraum begleitet und mir alles erklärt. Vielen Dank! Drei Stunden verbringe ich vor der Technikmöhre! Albert Einstein wurde in Ulm geboren. [21.04.] Das erste Mal bin ich im ausländischen Internet! Echtes Schweizer MarkenInternet! Aber alles bleibt ansonsten beim Alten, Ihr könnt weiterhin meine Berichte verschlingen, neugierig, wie Ihr nun einmal seid. Und ich könnte wetten, der eine oder andere wäre gern an meiner Stelle. Wenn Ihr wüsstet, wie schön das hier ist! Also fort: Nach dem kraftzehrenden und schönwettertagverschlingenden Internetieren in Ulm fahre ich mit dem geborgten Radel in die Stadt, um das Ulmer Münster zu besichtigen. Es hat den höchsten Kirchturm der Welt, 161 Meter ist er. Und die dazugehörige Kirche ist so gross, dass eine dauerhafte Reparaturwerkstatt arbeitet und jährlich über eine Million Mark verbraucht, um das Münster halbwegs in Schuss zu halten. Ebenso schön ist das Fischerviertel; kleine und schiefe Häuschen inmitten von einem Gewirr von Kanälen. Der Rückweg mit dem Rad nach Witzighausen zehrt an den Kräften. Und ich mache mir Gedanken, wie ich die Claudia aus Leipzig vom Bahnhof abholen könnte, wo ich es ihr doch versprochen hatte. Doch für die S.s ist das kein Problem; der Christian fährt mich mit dem Auto an den Bahnhof und holt die Claudia ab. Christian ist ja von der Idee des Jakobspilgerns ergriffen. Er will mich in der Schweiz einmal besuchen und ein Stück mitlaufen. Da habe ich dann wieder mal einen mitlaufen... Die Familie S. hat nun drei Jakobsbälger am Hals und versorgt uns mit großer Liebe. Jeder findet seinen Platz zum Schlafen und obendrein überlassen sie uns am letzten Vormittag ganz allein die Wohnung, denn sie wollen zeitig aufbrechen, zu ihren Verwandten in Leipzig. Sie haben soviel Vertrauen zu uns gehabt, daß ich gar nicht anders kann, als ihnen mein großes Osterdankeschön auszusprechen, hier an dieser Stelle! [22.4.] Der 20. Tag ist wieder mal ein altbewährter Querfeldein-Tag. Über die Iller 12 tragen uns unsere sechs Füße über Schnürpflingen bis nach Laupheim, wo wir mal die katholische Gründonnerstagsmesse besichtigen. Es ist immer ein Kreuz, zu überlegen, ob man immer mit aufsteht, wenn die anderen aufstehen oder ob man sitzenbleibt. Bleibt man nun konsequent und ehrlich oder paßt man sich an, um nicht aufzufallen? Jedenfalls bringt uns dieser Besuch die Bekanntschaft von zwei Steyler Schwestern; zwei junggebliebene resolute Frauen, die wissen, was Phase ist, die die Welt gesehen haben und auch schon Internet haben. Es ist eine neue Erfahrung, eine lächelnde achtzigjährige Dame über Email und Internet, über Indonesien und über den Verdacht, sie sei ins Kloster gegangen, "weil sie keinen abgekriegt hat" plaudern zu hören. Wir bekommen mordsmäßige Verpflegung, ein ordentliches Zimmer und viel Freundlichkeit und Interesse entgegengebracht. Übrigens hat eine Schwester 7 Jahre Zeit, um sich die Entscheidung, in den Orden einzutreten, reiflich zu überlegen. Dann wechseln sie ihren Vornamen und können aus einem "Bestand" an lustigen Vornamen ihres Ordens auswählen. Jeweils wenn eine Schwester gestorben ist, wird sozusagen ein Name wieder frei. Namen sind zum Beispiel Remberta, Brunhilda, Victima und so fort. Zum Frühstück im weißen Speisesaal kommen alle anderen Schwestern uns besichtigen und ihre guten Wünsche mitzugeben. Praktisch drückt sich das in einem guten Kilo Knackern und einem guten Kilo Käse und mehreren Kilos Obst aus, die sie uns mit auf die Reise geben. Wieder geht es durch liebliche Dorf- und Waldlandschaft bis nach Stafflangen, wo ich, am Waldrand stehend, meinen Augen kaum traue: im Dunstlicht des frühen Abends erheben sich in weiter Ferne: die ALPEN! Es ist wie ein Traum. Bislang wanderte ich konstant voran, durch Deutschland; doch nun rückt die Eigenschaft der FERNwanderung in sichtbare Existenz. Zum ersten Male begreife ich, daß ich wirklich vorankomme und meinem Ziele näher. In Stafflangen setzen wir uns zuerst einmal auf die Kirchentreppe, denn wir wollen heute mal, d.h. Claudia wünscht sich das, bei Kirchens übernachten. Im Programmheft lesen wir, daß es abends Osterfeuer, Gottesdienst und danach Empfang im Pfarrstadel geben wird. Osterfeuer ist kurz, von weißen Meßdienern umstanden, die Zettel mit den Sorgen der Leute ins Feuer werfen. Gottesdienst ist lang, und den kennen wir auch schon. Empfang im Stadel ist lustig; es gibt Hefebrot und Bier, Wein oder Limo und viele Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Der Bauer aus dem Dorf ist auch dabei. Familie R. möchte uns gern mit nach hause nehmen, vor vier Wochen ist ihr Sohn plötzlich gestorben. Und vielleicht erinnere ich sie ein wenig an ihn, sagen sie jedenfalls. Josef R. führt uns sein riesiges Alphorn vor. Er hat es sich als Muster geborgt, weil er selber eins bauen möchte. Zum Frühstück gibt’s wieder allerhand, auch etwas zum Mitnehmen auf die Hand. Doch dieser Tag wird anstrengend; die Mädels wollen nicht so gern wandern, sie haben sich gefunden zum Schwätzen und ich fühle mich nicht wohl dabei. Aber es ist Ostern und da ist es nicht schlimm, wenn wir einmal nicht vorankommen. In Ebersbach wollen die beiden übernachten und fragen dazu den Pfarrer. Der muß erst noch Gottesdienst halten und so warten wir. Später wird er von uns die Ausweise verlangen und uns ins Jugendzimmer stecken. [23.4.] Nach dem Regen duftet der Wald nach frischem Moos. Die Vögel zwitschern und trällern um so lauter durch das Geäst als sie still sind, bevor der Regen beginnt. Bin heute wieder allein weitergelaufen. Mich ziehen die Alpen mit magischer Kraft an. Das Flachland verlassen und hinauf zu den Höhen streben, die die Seele weit machen und den Körper tief durchatmen lassen. Vor Wittenhofen nehmen die Berghöhen plötzlich rapide zu, man hat von oben wunderbare Alpensicht. Die Berge und Täler sind bestanden mit Almwirtschaften und großen Bauernhöfen. In Markdorf 13 dann endlich stoße ich auf den "richtigen" Jakobsweg. Der Bodensee ist zu erkennen. Noch 12 Kilometer bis an die Küste, bis Konstanz. Doch es wird schon dunkel und ich beschließe, an einem wunderschönen Bauernhof nach Quartier zu fragen. Ein mürrischer Bauer schaut aus dem Fenster, fragt mißtrauisch Fragen, glaubt mir nicht, will mich weiterschicken, läßt mich dann doch im Stroh schlafen, um sich morgens bei mir für sein Mißtrauen zu entschuldigen und mir zwanzig Mark zu schenken, mit der Bitte, an seine verunglückte Frau zu denken, die im Krankenhaus liege. In einem Morgennebel, der die vorhandene Sonne mehr erahnen als erkennen läßt, besuche ich meine erste Jakobskapelle. An der Wand der ansonsten leeren Kirche finden sich rötliche Muschel- und Schiffszeichnungen. Auf gewundenen Wegen durch blühende Apfelgärten nähere ich mich Meersburg, der Fährstadt am Bodensee. Eine mittelalterliche Stadt mit verwinkelten Fachwerkhäusern und einem Jakobsweg, der mitten durch das Gewirr der Gassen hinab an den Bodensee, an die Fährstation, führt. Keiner will Geld von mir und so komme ich kostenlos hinüber. [Konstanz, Kloster Unserer lieben Frauen] Konstanz durchlaufe ich nur; frage in einem Buchladen nach Jakobskarten, die es nicht gibt, dafür kann ich mir ein Taschenbüchlein zum Lesen raussuchen. Die Schweizer Grenze hinter mir, und schon ist alles anders: Das Gras ist grüner, die Berge sind höher, die Leute rennen ihren Hunden mit braunen Plastiktüten hinterher und die Verbotsschilder klingen komisch. Auch die Menschen scheinen ansprechbarer; jedenfalls interessieren sich einige für mein Tun. Mit einem alten Jugoslawen sitze ich auf einer Bank und bewunder das Alpenpanorama; ein Schweizer teilt mit mir ein Stück des Weges und erzählt vom Kriegsdienst und der Angst, die die Schweizer zum Zweiten Weltkrieg hatten, die Deutschen würden nun auch sie überfallen. Ganze Gegenden sind von der Deutschen Grenze weggezogen, in die Innerschweiz hinein. Überall trifft man auf die landschaftverschandelnden, aber das schweizer Gewissen beruhigenden Panzersperren: große Betonkanten, von Moos spärlich überwuchert, wie Lindwürmer die Gegend belagernd. Ich laufe bis Weinfelden; die Berge sind hier schon mächtiger. Von Weinfelden quält mich eine kilometerlange Asphaltstrasse bis Märstetten, wo ich auf den Schwabenweg treffe; so tarnt sich hier im Kanton Thurgau der Jakobsweg. Eine Tafel tröstet mich: noch 1938 km bis Santiago de Compostella. Vor Kaltenbrunnen treffe ich einen deutschen Wanderer, zackiger Schritt; ein 14 Pensionär, vorher Berufssoldat, der seinen Dienst tun konnte, weil er wußte, daß die Deutsche Armee nie ein Land überfallen würde; sie ist eine Verteidigungsarmee. Er wandert die Kreuz und Quer; schläft im Gebüsch; er sei zu alt, um Leute zu fragen. Ich lande in Kaltenbrunn an einem Bauernhaus; zwei alte Leutchen tun mir auf. Sie haben da so ein Fleckchen für Pilger, ein Raum mit Teppich und Tisch, der ist genau gut für mich. Ich bekomme Brot, weil meines alle geworden ist. Wir sitzen noch im Abendlicht beisammen, erzählen über schweizer Besonderheiten, über das Leben im allgemeinen und über die Geschichte des Kaltenbrunner Kappellchens. Ich spiele ein bißchen Konzertina. [25.4.] Der heilige Jakobus diente im Laufe der Zeit als Patron der Arbeiter, Lastenträger, Hutmacher, Strumpfwirker, Ritter, Sennen, Siechen, Apotheker, Drogisten, Kettenschmiede und Wachszieher, lese ich im Buchladen. Die Pilgerei vollzog sich in drei Phasen: in der Kreuzfahrerzeit unternahm vor allem der Hochadel die Reisen. Die Blütezeit des Pilgerns waren das 12. und 13. Jahrhundert. Bürger, auch Frauen unternahmen in dieser Zeit der Umbrüche, der gesellschaftlichen Ungewißheiten, die langen Wanderungen. Die letzte Phase strebte eine Verinnerlichung des Pilgerns, eine mystische Reise an. "Elutreia!" riefen sich die Pilger zu, als Gewißheit, eine große Leistung vollbracht zu haben, als Verbundenheit des Miteinandergehens auf der großen Pilgerreise durchs Leben. Aber sie waren auch ein Problem: sie traten in großen Scharen auf; meist bettelten sie und sangen freie Lieder und wußten sich nicht dem Weibsvolk gebührlich zu nähern... Bei Fischingen schmücke ich zusammen mit dem fünfjährigen Lukas einen der vielen Brunnen mit gelbleuchtenden Sonnenblumen. Wir finden das beide toll. Dann besichtigen wir gemeinsam noch das kleine Kapellchen, wo der kleine Lukas oft fragt: "Darf ich das oder das?" Dann zeige ich ihm, was ich darf: Mundharmonikaspielen in dem Gewölbe. Das klingt so schaurig, klingt so fein. Da könnten wir glatt Freunde sein. Aber ich muß weiter und lasse den Lukas mit seinem Feuerwehrhelm vom Papa zurück. [Orgel, Kloster Fischingen] Im Kloster Fischingen darf ich im Sekretariat meine E-Mails abholen und bekomme obendrauf noch ein Früchtebrot geschenkt. Bei diesem Früchtebrot mache ich mir Gedanken: seit einer Woche habe ich keine Mark ausgegeben; es geht also doch, das Pilgern ohne Geld. Immer wieder habe ich von freundlichen Leuten etwas bekommen und gerade heute früh, habe ich mir Sorgen gemacht, daß meine Lebensmittel fast alle sind, da bekomme ich das Brot geschenkt. Wasser gibt es überall an Brunnen. Ebenso tut es total gut, ohne Uhr zu leben. Es verändert die Sinne, auf einmal spüre ich, wieviel Zeit ich wirklich habe, sie ist nicht mehr eingepresst in ein Korsett der Uhrzeit. Fischingen ist auf einer Legende entstanden: Die heilige Idda ist mit dem Grafen von Toggenburg vermählt und legte eines Tage ihren Ehering aufs Fensterbrett, von wo ihn eine vorwitzige diebische Elster stahl und in den Wald trug, wo sie ihn fallenließ. Ein Soldat findet den Ring und wird, weil man vermutet, er habe ein Verhältnis mit der Gräfin, ermordet. Die Gräfin wird aus dem Fenster der hohen Burg gestoßen; sie kommt aber unbeschadet unten an und beschließt nun, ihr Leben Gott als 15 Einsiedlerin zu weihen. Zu jeder Messe begleitet sie ein Hirsch mit 12 Kerzen auf dem Geweih. Auf diese Sage hin entstehen im späten Mittelalter die Wallfahrten ins Kloster Fischingen. In der Kapelle gibt es einen IddaAltar mit einem Loch unten drin. In dieses soll man seine Füße stecken und sie werden heil. Ich habs nicht getan; vielleicht geht’s ja auch so. Ich komme bis Steg im Tösstal, frage den Wirt vom Landgasthof in Steg und dieser verweist mich zur Familie G., wo ich in einem Holzbauernhaus gern und freundlich zur Nacht aufgenommen werde. Ich will den vier Kindern noch schnell vor dem Zubettgehen etwas auf der Konzertina vorspielen, da entdecke ich, daß die älteste auch Konzertina spielt. Wir veranstalten ein richtiges Konzert. [26.4.] "Der Weg in die Welt ist der Weg, auf dem man ohne Angst und allein in der Dunkelheit zurückkehren kann. Denn wer diesen Weg gefunden hat, ist wissend geworden und kann sich nicht mehr verlieren oder hetzen lassen." (aus: Christoph Dejung: "Geographie der Seele") [Rapperswil, altes Brückenhaus] Über Rapperswil am Zürichsee gelange ich auf den Etzelspass am St. Meinrad ( 934 m). [Meinrad wird ermordet] 828 kam Meinrad, ein Mönch des Bodenseeklosters Reichenau auf die Etzelpasshöhe und erbaute sich da eine Zelle, wo er sieben Jahre in der Stille betete, arbeitete und hilfesuchenden Menschen Rat und Trost gab. Dann zog er weiter in den Finstern Wald, wo er weitere 25 Jahre lebte und am 21. Januar 861 von Räubern erschlagen wurde. An der Stelle seiner Klause entstand 934 das Kloster Einsiedeln. Nach der Legende lebten bei Meinrad zwei Raben, die die Mörder bis Zürich verfolgten, wo man sie ergriff und hinrichtete (die Mörder, nicht die Raben). Heute sieht man die beiden Raben im Wappen der Stadt Einsiedeln. [Meinradkapelle auf dem Etzelspass] Der Etzelpass ist der Sammelpunkt der Pilger aus dem Osten, von hier führt die Etzelstrasse über die Teufelsbrücke bis zum Kloster. Neben der Brücke befindet sich das Geburtshaus von Theoprastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. 16 Der berühmte Naturkundler wurde dort 1493 geboren, sein Vater betreute Pilger, die nach Einsiedeln zogen. Gegen 20 Uhr erreiche ich den Etzelpass und hoffe zuerst, das Kloster Einsiedeln noch heute abend zu erreichen, aber es dunkelt zusehends, so daß ich in einer Wetterschutzhütte übernachte, mit dem wunderschönsten Blick, den eine Wetterschutzhütte überhaupt bieten kann: der Sihlsee mit dem Alpenpanorama im Hintergrund. [Kloster Einsiedeln] [Geschichte des Klosters] [27.4.] Ein Stündchen brauche ich noch, um die Türme der in der Ferne zu sehenden Klosterei zu erreichen. Ein riesiges Kloster und wunderschöne Bürgerhäuser am Klostervorplatz. Ich habe den Wunsch, hier drei Tage Pause zu machen: es ist wundervolles Wetter, ein schönes Städtchen und die Gelegenheit, ein Kloster von innen zu sehen. So klopfe ich an der Klosterpforte und ein netter Mann sagt, daß alle Zimmer im Kloster belegt sind und schlägt mir umliegende Gasthäuser und Hotels vor. Ich erkläre ihm mein anliegen, daß ich keinen Komfort möchte, sondern daß mir daran liegt, das Klosterleben und deren Menschen darin kennenzulernen. Nein, es geht nicht; heutzutage ist das Kloster ein richtiger Betrieb mit 220 Beschäftigten, da sind es Millionenausgaben, die man tätigen muß; und man kann heutzutage nicht mehr wie im Mittelalter kostenlos im Kloster übernachten. Mir tut es leid und ich gehe zur Stadtinfo, vielleicht können die mir helfen, wenigstens ins Internet zu kommen; und dann, im Klostergymnasium, bekomme ich auf einmal beides: einen Internetcomputer, in aller Ruhe, in der Bibliothek und die Bekanntschaft mit Bruder Johannes, der zufällig auch der Verantwortliche für Besucher ist; und der selbstverständlich auch ein Zimmer für drei Tage frei hat. Und am Klosterleben kann ich auch teilnehmen. Wie das ist, das berichte ich euch später. Bleibt schön neugierig. Das Klosterleben Nach der Vertreibung des Tages mittels verschiedenster Stadtrundgänge erscheine ich nach Plan 18:25 Uhr an der Gästepforte, wo bereits der bekannte Gästepater Johannes wartet, Er ist nur die Vertretung des eigentlichen Gästepaters. Alle anderen Gäste warten auch, es scheint durchaus üblich zu sein, in einem Kloster zu Besuch zu sein. Man bestellt vor, bezahlt für die Nacht; und die Sache ist gelaufen. Bei mir ist das ja etwas anders: kein Geld, aber die Leute kennenlernen wollen! Wir gehen geneinsam durch die geheimnisvolle Tür, die Klasur, dann durch eine andere Tür in den Speiseraum. Wir sitzen in der Mitte. Alles ist still. Eine Glcoke erklingt. Das Essen beginnt. In einer Ecke, etwas erhöht, eine Kanzel. Ein Mönch spricht: zuerst ein Abschnitt aus dem Evangelium, dann die Lebensbeschriebung eines Heiligen, dann eine (zugegeben interessante) Interpretation heutiger politischer Verhältnisse. Ich höre vor Aufregung fast nicht hin, doch ich höre: Oesterreich und Haider. Eine Beschreibung, die an Adjektiven nicht mangelt. Ich frage später, wer die politische Interpretation liefert - die Zürcher Zeitung - und, ob sich die Mönche auch sonstwie informieren können. Ja, sie haben Fernsehen und Zeitung, auch wenn sie wegen der Arbeit nicht so viel Zeit dazu haben. Gehts ihnen also wie mir. Die gleichmachenden Kutten der an die dreissig Mönche, die rundum an der Wand sitzen, lassen die Charaktere durch die Gesichter um so deutlicher hervortreten. Männer, die ihr ganzes Leben hier in der regelmässigen Aneinanderreihung von Tatsachen verbringen. Es wirkt auf mich bedrohlich, diese künstlich bezähmte Männlichkeit. Eine andere Welt; für mich noch unvorstellbar. Ich möchte eintauchen in deren ganz anderes Leben, möchte spüren, was sie treibt, wie sie leben, denken 17 und was sie tun. Eine erstaunliche Freiheit haben wir als Gäste: wir bekommen ohne nach dem Namen zu fragen, den Schlüssel des Klostes ausgehändigt, der passt an der Klosterpforte und sogar auch an die Klausurpforte und ich möchte gar nicht probieren, wo er vielleicht noch passt! Der Speiseraum ist vollständig bemalt: an den Wänden, an der Decke, die quaderförmigen Tische: grau in grau reihen sich Bilder von Menschen und dekorative Elemente in einer solchen Dichte aneinander, dass sie die Atmosphäre des Raumes nahezu erdrücken. Schwarze Bestecketuis liegen zu rechten jedes Mönches, geformt wie unheimlich grosse Brillenetuis. Diese behende Fertigkeit in den Abläufen, diese barocke Ausschaltung aller Ablenkung, diese Stille und diese stumme Beschallung mit geordnetem, geprüftem Vortrag. Ich merke fast nicht, was ich esse. Auf meinem Pltatz liegt eine Serviettentasche mit meinem Namen - richtig geschrieben, wie ich staunend bemerke. Und ich spüre: die Patres verzeihen mir meine Unzulänglichkeit. An der Stirnseite des Speiseraumes steht etwas hervorgehoben, mit gepolsterten Stühlen ausgestattet, der Tisch des Abtes; ein streng blickender Mensch, mit einem Glöckchen an seinem Platz ausgestattet, und man spürt: von diesem Manne geht Macht aus. Patres mit weissen Schürzen bedienen; sie sind ehrlich bemüht, uns wohlzutun. Zuerst bekommt der Abt und sein Tisch, dann die Gäste, dann die Uebrigen. Geschirr und Besteck ist vom Feinsten, die Speisen sind sehr liebevoll zubereitet; es gibt Wein oder Selters oder Apfelsaft, in riesigen Flaschen auf dem Tische stehend zur freien Bedienung. Das Glöckchen der Macht klingelt aus den Händen des Abtes, das Essen ist vorbei, schweigend verlassen die Mönche das Areal. 20 Uhr beginnt das Abendgebet. Ich darf mit hinter das Gitter, das den Chor vom übrigen Kirchenraum trennt. Die Patres bilden zwei Gruppen und stehen sich gegenüber. Ein beruhigender Wechselgesang erfüllt die Schwülstigkeit seiner ehrwürdigen Excellenz, der Barockkirche. Sie singen von Freude und Geborgenheit, Ruhe und Schutz vor dem Bösen der Nacht. Dabei denke ich: wovor ich mich fürchte, das ist noch ein unbekannter Fleck in meinem Leben. Kann ich ihn akzeptieren, dann muss ich mich auch nicht mehr vor dem Dunklen fürchten. Schwarz sind sie gekommen und schwarz gehen sie wieder und jeder trägt seine Lebensgeschichte mit sich unter seiner Kutte, und er bringt sie in die Gemeinschaft ein. Ich lese im Regelbuch des heiligen Benedikt, das in meinem Zimmer liegt, dass die Benediktiner die Unterschiedlichkeit der Menschen nicht als Gefahr, sondern als Bereicherung ihrer Gemeinschaft sehen und erleben. Bei Rückweg schält sich einer aus der Anonymität der Gemeinschaft heraus, ruft mir hinterher: "Du gehst doch nach Santiago? Ich habe dich an deinem Zöpfli wiedererkannt!" Er wünscht mir Glück. Er ist erst Sonntag wieder da. Ich sage, dass wir uns dann ja vielleicht noch einmal sehen können und darf für`s erste entschwinden, um beim Sonnenuntergang in der Stadt die Gewalt der Eindrücke niederzuschreiben. Wie allgemein und unumstösslich wirkt doch das allgemeine Gesetz, wenn man es täglich in den Mauern lebt, wo man doch alles mit einem wissenden Schmunzeln u die Augen tiefer und ernster leben könnte. Kloster Einsiedeln Diorama Einsiedeln Welttheater Einsiedeln [29.04.] Beim Frühstück habe ich heute zwei junge ungarische Mönche kennengelernt; Frühstück findet immer im sog. "Hofspeisesaal" statt; in Anwesenheit 18 des Abtes werden hier die Gäste befrühstückt. Die anderen Gäste sind deutsche Musiker, die die Ruhe und Versorgung des Klosters nutzen, um üben zu können. Die jungen Ungarn sind sehr offen und erzählen, dass es schon ein radikaler Schritt ist, in einen Orden einzutreten. Ihre Eltern waren auch nicht immer damit einverstanden, aber jetzt haben sie sich damit abgefunden. Nachmittags lerne ich etwas mir sehr Bekanntes kennen: die neue Tonbildschau des Klosters wird im Hofsaal vorgeführt: und siehe da: es ist eine Diaüberblendschau! Ich spreche mit einem Macher und sehe mir die Technik an. Stumpfl und Kodak- Projektoren. Der kleine Junge in mir drin freut sih köstlich. In der Diaschau erfahre ich allerhand über das Kloster: Die Mönche arbeiten: in einer Gärtnerei, in Tischlerei und Gestüt, in Bibliothek und Archiv. Die wichtigste Aufgabe aber vor allem ist die Versorgung der vielen Wallfahrer und Pilger, die hierher kommen. Tausende sind es zu hohem Festtagen und ich beschaue mir in Ruhe den ganzen Zauber dieser Veranstaltung. Die Wallfahrtskirche hat eine Kapelle in ihrem Bauch; die Kapelle der "Schwarzen Madonna von Einsiedeln"; ihretwegen erscheinen die Menschenströme. Heilend ist ihr Anblick; die Erwartenden strömen zu ihrem Bild, singen, bewegen Kerzen, atmen geweihräucherte Luft ein, tragen Bücher und gekaufte Andenken, lassen Gegenstände weihen: ein Geschäft, bei dem die grosse Kirche sicher nicht ärmer wird dabei. Nachmittags besuche ich den ältesten Lebkuchenbäcker des Dorfes mit eigener Homepage. Vieles erinnert an die Pulsnitzer Lebkuchen. Es gibt Schafböcke, das erste Trockengebäck für die Wallfahrer, ungefüllt; und die Biberfladen, die wEiterentwicklung für den heutigen anspruchsvollen Pilger; gefüllt mit der Ansicht der Kirche drauf. Die Verkäuferin kennt den Dresdner Stollen nicht, auch nicht die Pulsnitzer Pfefferkuchen; wahrscheinlich ist die Gegend hier einfach zu weit weg von der Heimat. Man merkt die Entfernung ja gar nicht bei Wandern. Beim Abendessen spricht mich Camillo, ein Gast, aus Versehen laut an. Der Abt ermant ihn. Der Gastpater schickt uns heute schnell nach oben. Keine Zeit zum Reden wie sonst immer kurz nach dem Abendbrot. Ich glaube, wir Gäste sind nur institutionell willkommen; weil es in der Regel steht. Ich vermisse persnliche Begegnungen. Man kommt an den einzelnen Mönch nicht heran, sie erscheinen immer als ein Teil der Masse. Das ist schade. [30.04.] Erwandere morgens den Sihlsee, der gleich um die Ecke liegt. Mittags gibt`s Rinderbraten, Pommes, Erbsen und Eistorte. Dazu echten Leutschen-Wein, eine Kostbarkeit aus den klostereigenen Gärten am Hang des Zürichsees. Wir sitzen diesmal ebenso am Rand des Raumes und haben eine eigene schwarze Besteckuritarie. Nach den ersten Sützen des Vorlesers lässt der Abt plötzlich die 19 Glocke erklingen und alle Mönche fangen an, fröhlich sich bei Tische zu unterhalten. Die Schweigepflicht ist aufgehoben. Sowas kommt an Feiertagen vor. Ich lerne den Pater Joachim Salzgerber kennen, den Schriftleiter von "Maria Einsiedeln", einer Wallfahrtszeitung, den ich anspreche, weil ich in der Zeitung einen Artikel über Wilhelm von Kügelgen gelesen habe, der ja bekanntlich in Dresden starb. Zufällig erfahre ich so, dass er der Archivar des Klosters ist, also der Verwalter und Hüter der uralten Schätze. Bei einem Rundgang durch den Klostergarten erlebe ich einiges vom Charm und Witz dieses weisen Mannes. "Warum es im Kloster immer so gutes Essen für die Mönche gibt?" - "Sonst würde ja keiner dableiben." Schalk in den Augenwinkeln. Pater Franz, der Gästepater, macht mit mir einen Rundgang durch die Anlagen: Konvent, Barockbibliothek, Archiv im Keller. [Barockbibliothek im Kloster Einsiedeln] Ich besichtige den Trubel um den "Weissen Sonntag". Eine Blaskapelle, rot eingekleidet mit weissen Susaphones am Ende, marschiert in die Kirche ein. Weihrauchgeruch. Tausende Leute. Pilger. Italiener. Die Kirche wird zum geschäftige Grossbetrieb. Die Stille im Kloster ist an solchen Tagen sicher ein guter Patz zum Ausruhen. Es ist Sonntag; und nach dem Abendessen lerne ich Pater Hieonymus kennen; er ist wieder da. Er arbeitet mit Jugendlichen, zeigt mi sein Zimmer, ist ganz aufgeregt, einen Jakobspilger zu sehen. Er wünscht mir einen guten Weg. Sein Zimmer (seine Zelle) ist voller Pappkartons voller Schriften und Fotografien von den vielen Ausflügen mit "seinen" Kindern. (Puh!! Ich habe eine echte Zelle gesehen!!!) [1.05.] Beim Frühstück gibt mir Pater Hieronymus, der als Junge Antonio hiess, einen Briefumschlage mit, den ich erst am Abend öffnen soll. Wie Hieronymus zu seinem zweiten Namen gekommen ist? Ihm ging es wie allen anderen Mönchen: er durfte dem Abt drei Vorschlàge machen, einer wurde ausgewählt und ist nun ganz seiner. Uebrigens bekommt der Bruder, der als erster unter einem bestimmten Abt in den Orden eintritt, denselben Vornamen wie der Abt; so dass es immer einen Abt und einen Pater mit dem gleichen Vornamen gibt. Ich darf mir noch Verpflegung vom frühstück mitnehmen und darf für die Bewirtung soviel bezahlen, wie ich möchte. (Trachslau) (Alpthal mit dem kleinen Mythen im Hintergrund) 20 Nach der Pause habe ich wieder Saft in den Waden und übersteige den Haggenegg-Pass bei den beiden imposanten Steinfiguren der "Mythen". Wieder wate ich durch den Schnee, habe aber keine Lust, dei Sandaen gegen die Bergschuhe einzutauschen, und so wird es eine matschige Angelegenheit. Nebel zieht von den Myten her auf; es wird geheimnisvoll. (Haggenegg-Pass mit Blick nach Schwyz) (Mythen) (Sankt Barbarakapelle) Dann, beim Abstieg, ein See und riesige Zuckerhütenberge: Schwyz. In Brunnen muss ich die Fähre über den Vierwaldstätter See nach Treib nehmen. (Brunnen) (Treib) Ab Fährstation treib geht es immer am Abhang entlang; eine Handbreit über dem Wasser. An einer Almhütte begegnet mir eine Horde Kühe; ich spiele ihnen etwas auf der Konzertina vor. Solange ich spiele, klimpern die Glocken, die Kühe fressen und gucken und fressen; sobald ich aber aufhöre, ist es still und die Kühe gucken mich 21 an. Als ich weitergehe, rennen sie mir hinterher. Als sie nicht mehr weiterkönnen, muht mir eine Kuh hinterher. Der Abend überwältigt mich zuerst mit einem imposanten Naturschauspiel: Sonnenstrahlen brechen durch eine dichte Wolkendecke und beleuchten ein klitzekleines Fleckchen des Sees. Später, ich kämpfe mich gerade durch einen Urwald von ugestürzten Bäumen, bricht sich ein Unwetter Bahn: Ströme von Regen fallen sturzbächig hinunter und verwandeln in Minuten die Gegend in eine schlammige finstere Einöde. Blitze zucken durch die Dunkelheit. Es hagelt. Kein Ende ist zu erkennen. Der Weg hört auch nicht auf, wird im Gegensatz immer steiler. Unter einer kleinen Plane, die ich unterwegs finde, ziehe ich mir Pullover und Jacke an. Stunden vertreibe ich mir so, aber es kommt voran und gegen halb zehn erreiche ich eine Ortschaft und eine Scheune ohne Riegel ist mir willkommen, mich für die Nacht zu beherbergen. (Der Weg bei schönem Wetter) [2.05.] Ueber Buochs und Stans geht der Weg, der mit total klammen Sachen beginnt. Unterwegs treffe ich die erste Pilgergruppe, die man erkennen kann an ihren grossen weissen Muscheln auf rucksackfarbenem Grund. Wir verabreden uns für Compostella. (Stans am Vierwaldstätter See) (Bruderklausenweg nach Flüeli Ranft) Gegen Mittag erreiche ich die Ranft des Klaus von der Flüe. 1417 wurde Niklaus von Flüe in Flüeli geboren. Flüeli ist ein Ort der Gemeinde Sachseln. Er heiratet mit dreissig Jahren die jüngere Dorothea Wyss und bekommt mit ihr zehn Kinder. Er ist 22 ein in Gemeinderat und Gericht angesehener Mann. Mit 50 bekommt er zunehmend Depressionen und wird nachdenklich, zieht sich in den Nächten ins Wohnzimmer zurück und grübelt auf der Ofenbank. Schliesslich ist sein Entschluss gereift und er bittet Frau und Kinder, weggehen zu dürfen, als Einsiedler, um Gott besser suchen zu können. Er reist zuerst Richtung Frankreich, bekommt aber in der Fremde den Rat, in der Heimat zu dienen. Unterwegs erlebt er einen Strahl, der seinen Körper trifft und ihn frei von den leiblichen Bedürfnissen macht. So kommt er wieder zurück und lebt einige hundert Meter von seiner Familie entfernt an einem ins Tal hruntergerochenen Abhang, dem Ranft von Flüeli, zuerst ein armes, einsames Leben. Bald aber baut ihm die Gemeinde eine Kaluse und eine Kapelle. Einen ziemlich guten Kontakt zu seiner Familie behält er bei. Zwanzig Jahre lang fastet er vollständig, trinkt nur Wasser, bis er 1487 stirbt. Sachseln ist fast die geografische Mitte der Schweiz und im Mittelpunkt Europas. (Flüeli Ranft) (Das Geburtshaus von Nikolaus von Flüe) Ich wandere den Weg der Visionen hinunter nach Sachseln, auf dem Weg, den Bruder Klaus gewissermassen täglich auf Arbeit ging. Immer hoch am Talhang entlang führt der Weg und gibt einen Ueberblick über die Landschaft. Hat man solch einen Ausblick, dann bekommt man auch eine innere Grösse. Bei Gehen denke ich daran, was für Geschichten Wege beinhalten und was für Geschichte auf Wegen geschrieben wurde. Oft sind es die alten verborgenen Strassen, denen der Jakobsweg folgt; abseits der breiten, lauten, flachen Schneisen, die sich der Autoverkehr geschlagen hat. Ich laufe ständig auf historischem Boden. Die Metallplastiken am Rand des Weges der Visionen erinnern an Situationen im Leben des Klaus: der Turm (die Vision in der Jugend), die Entscheidung des jungen Mannes. Sie lassen mich übr die Heiligenverehrung nachdenken: es werden im Uebereifer viele Geschichten zur Geschichte hinzugereimt (der Teufel stässt Klaus in die Dornenhecke), aber das Volk ist fasziniert und so bleibt mit den alten Geschichten auch die Geschichte unter den Menschen lebendig. Wie gern würde ich doch die Schweiz zechnen! Doch sie ist so gross und ach! so schön! Wie soll ich das denn auf`s Papier bringen? 23 (Weg der Visionen nach Sachseln) (Sachseln am Obwalder See) [3.05.] In einer Schutzhütte geschlafen, früh beim Bauern Milch getrunken und das erste Mal echten Schweizer Käse gekauft! Ueberquere den Brünig- Pass (1008 m). Auf den Pass hinauf quält sich eine Zahnradbahn. (Obwalden) (Brünig- Passweg) (Brünig- Passweg) 24 Ich fühle mich nach der Hitze total staubig und finde eine Ziegenhütte mit Wasseranschluss, wo ich mich und meine Hosen wasche. Der Ziegenbock findet das aber gar nicht so lustig und will mich von meinem Platz verscheuchen. Schon von weitem sieht man den Brienzer See. Die erste Ortschaft ist Brienzwiler, dann kommt Brienz, dann nehme ich den, wie sich später herausstellen wird, sinnlosen Aufstieg zur Axalp vor. Gegenüber erkenne ich einen riesigen Wasserfall, der sich vom abgebrochenen Rand in die Tiefe des Tales ergiesst. (Brienzwiler) (Brienzwiler) (Brienzersee) Hinauf zur Axalp auf 1500 Metern in dreieinhalb Stunden. Der Aufstieg beschert mir einen faszinierenden Sonnenuntergang: Für einen schmalen Spalt öffnet sich der Himmel vor dem Sonnenuntergang und taucht die gesamte Landschaft in einen goldenen Schleier aus gerichtetem Licht. Weil es geregnet hat, zeigt sich dazu noch ein prachtvoller Regenbogen, der sich quer über das gesamte Tal spannt. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man sogar schemenhaft seine Doppelung. Oben im Schnee eine Siedlung von Wintersport- und Ferienhäuschen, die meisten sind verlassen. Aber aus einem kommt mit einem dicken Teller voll Spiegelei mir hungrigem Wanderer ein dicker Mann entgegen, der mir aber freundlicherweise seine Garage und die Toilette zur Verfügung stellt. Ich schlafe neben einem uralten Chevrolet. 25 (Volligen) [4.05.] Sieben Uhr wache ich auf und ziehe gleich los, denn in der Garage ist es ungemütlich, draussen ist keine Sonne und ich habe kein Essen mehr bei mir. Ich suche einen Runenstein, der hier sien soll, aber nicht ist, komme zu den tosenden Wasserfällen des Giessbach, finde den Jakobsweg wieder und gelange über Iseltwald und Bönigen nach Interlaken. (Haus vor Interlaken) Mittags erreiche ich Interlaken, man sieht beim Zumarsch sofort, woher der Name stammt: die Stadt liegt zwischen den Seen. Hier gelingt es mir, anderthalb Kilo Bananen mit einem Male zu kaufen. Wieder mal sind sie das billigst Nahrungsmittel; und wie ihr ja wisst, sind meine Mittel auf zehn Mittel pro Tag begrenzt. Weiter über Sundlauenen zu den Beatushöhlen. (Sundlauenen) (Aufstieg zu den Beatushöhlen) 26 (Wasserfälle an den Beatus-Höhlen) (Kloster an den Beatus- Höhlen) Link zur Tourismusseite Link zum Jakobsweg in der Schweiz Link zur Pilgerbewegung der Schweiz Die Beatushöhlen sind eine heute mit Kirchlein und Tourismushäuschen verbautes Höhlensystem mit mächtigem Wasserfall. Zur Geschichte: Lange vor christlicher Zeit sind weise Männer über den "Schwarzen Berg" (Brünig) gekommen, die den Ort als Tempel und Druidenheiligtum einrichteten. Gegen 60 n.Chr. sind der heilige Beatus und sein Jünger Justus ebenfalls über den Schwarzen Berg gekommen, Beatus nach der Legende aus Brittanien, wo er seinen Reichtum gerade den Armen geschenkt hatte, um Christ zu werden. Er sol zu den Zeiten der Christenverfolgungen durch Nero in Rom von Petrus getauft worden und als Apostel zu den Helvetiern in die Schweiz geschichkt worden sein. Als sie zu den Hirten von Sundlauenen kamen, berichteten diese von eine furchtbaren Drachen, der in besagter Höhle lebe. Beatus wagte sich allein bis zur Höhle vor und bezwang den furchtbarn Drachen, indem er wildentschlossen mit einem Kreuz vor sich herumfuchtelte. Der Drache beschloss, sich in den Wendelsee zu stürzen und dieser brach in ein Tosen und Stieben aus, dass es nur so rauschte. Beatus und Justus nahmen Wohnsitz in der Höhle, Beatus wurde schliesslich 90 Jahre alt und wurde in der Höhle begraben. Nun gab es das Augustinerkloster Interlaken, welches sich die Beatuslegende zunutze machte. Um die Kasse und den Ruf ein wenig aufzubessern, machten sie aus der Legende einen Wallfahrtsort. Während der Reformation wurde die Pilgerstàtte abgerissen und vermauert, man berichtet sogar von einer so profanen Nutzung wie der als einem Ziegenstall! Doch die Leute hatten ihre Pilgerstätte so liebgewonnen und wollten sie immer wieder errichten. Der Tourismusboom im beginnenden 18. Jahrhundert tat sein Uebriges; man entdeckte die verzweigte Höhlengänge, baute die Kirche wieder auf und kann sie nun besuchen. Wie so viele berühmte Männer hat auch Goethe den Thunerse bereist. Und bekanntlich wird dort, wo Goethe ein Wort gesagt hat, eine Stadt errichtet. so auch hier: der 1779 von Goethe in seinem Tagebuch erwähnte Efeubaum ist als Stammrelikt hinter Glas ausgestellt: "Heiliger Epheubaum, hoch den Felsen hinanlaufend, dessen Zweige feierlich darüber herabhängen." So Goethe. 27 Die Landschaft heisst übrigens "Balmholz", was germanischen Ursprungs ist und Höhlenwald heisst. Ich erreiche die Höhlen gegen 17 Uhr, der Schliesszeit des Museums; und so bekomme ich zwar keinen Eintritt mehr, aber ein Heft mit der Geschichte der Höhle geschenkt. Durch einen schönen Waldpfad gelange ich bis Merligen, wo ich auf Empfehlung einer Dorfbewohnerin ins Schloss Ralligen (dort wohnen nette junge christliche Männer) gehe und dort um Uebernachtung frage. Die netten jungen christlichen Männer sind leider ausser Haus, aber ein paar Freunde von denen sind da und lassen mich in der Scheune übernachten. [5.05.] Am Morgen werde ich noch zu einem köstlichen Frühstück eingeladen und erfahre einiges zur Geschichte des Schlosses: einst einer russischen Fürstin gehörend, wurde es von evangelischen Mönchen, den "Christusträgern", in mühevoller Arbeit rekonstruiert und dient ihnen nun als Kloster- und Gästegebäude. Bei einer Führung kann ich die barocke und rustikale Ausstattung bewundern. Ich gelange nach Oberhofen, einer netten Kleinsatdt mit farbenprächtiger Schloss- und Parkanlage und einer hochdotierten Privatsammlung moderner Kunst. Diese hat zwar noch nicht geöffnet, aber ich klingele trotzdem mal und bekomme so eine Privatführung (wie sich das gehört!) durch die "Galerie im Obersteg": Picasso, Chagall und Künstler des Blauen Reiters. Gegen Mittag bin ich in Thun; auch hier hat Goethe einen Spruch abgelassen: "Man sähe das Matterhorn, wenn Eiger, Mönch und Jungfrau nicht davor stünden ..." Ich ziehe nur durch die Buchläden; ich will etwas über die schweizer Geschichte erfahren. In der Bibliothek sammle ich einige Daten: Die Schweizer Geschichte Die Helveten waren ein keltischer Stamm, der im Gebiet des heutigen Südwestdeutschland lebte und ca. 600 v.Chr. einerseits nach Süden expandierte, andererseits von den Germanen im Norden bedrängt wurde und so in die heutige Schweiz gelangte, wo er ca. 100 v.Chr. von den Römern kolonialisert wurde. Die Kelten waren ein kulturell hochentwickelter Stamm, der die Naturkräfte kannte. Während in der heutigen Kultur der Mensch im Mittelpunkt steht, war bei den Kelten die Einbettung in die Natur und ihre Kräfte, die durch eine reiche Götter- und Mythenwelt symbolisiert wurde, von grösserer Bedeutung. Der innere Mensch - seine Kräfte, Vorstellungen, Zukunft und Vergangenheit - waren ebenso wichtig wie der äussere Mensch. (Scherzligen) So will ich nun der Stadt den Rücken kehren, aber ich finde keine Wegweiser, und so laufe ich direkt nach Scherzligen, zur Kirche und von dort direkte sechs Kilometer Asphalt nach Amsoldingen, wo mich eine romanische Kirche mit einer Krypta 28 erwartet; unter der Kirche wurde bei Ausgrabungen eine noch ältere Kirche entdeckt. Westlich laufe ich weiter durch einen Truppenübungsplatz, immer unter dem Massiv des Stockhorn entlang, den Alpenblick immer weiter zurücklassend. Gegen sieben frage ich zuerst eine ältere Frau mit Kindern, dann drei Männer ohne Baby; alle behaupten, man könne doch nicht ohne Geld übernachten. Ich muss es doch aber besser wissen und so komme ich auch zu S.s, einer Holland- Schweizerin, einem Schweizer Ingenieur, der Röntgenröhren herstellt, drei Kindern und einem Hund. Den Kindern spiele ich zum Schlafengehen noch ein Lied auf der Konzertina, mit dem Eltern sitze ich abend snoch zusammen, es ist recht schön. Ich schlafe auf dem Boden in einer Kammer. Christian, der Mann, guckt noch etwas verunsichert ob des plötzlichen, fremden Besuchs, aber Heidi ist ganz locker. [6.05.] Wir frühstücken zusammen, ich bekomme noch eine Wurst mit auf dem Weg. Auf ihre Empfehlung hin besuche ich noch eine Chäserei, in der ich ein Stück Greyerzer (nun mein LieblingsKäse) kaufe und mir die Produktion von Emmentaler zeigen lasse: Zuerst werden Milch und Lab in zwei grossen Kupferkesseln bei 57 Grad gerührt, dann in zwei kleinere runde Behälter gepumpt, wo durch Siebe die überschüssige, nicht geronnene Flüssigkeit abläuft und zur Schweinefütterung verwendet wird. Ist die meiste Flüssiglkeit abgelaufen, wird der Käselaib mit bis zu 2000 kg gepresst. Dann kommt der Laib für zwei Tage in ein Salzbad, wo die feste Schale entsteht. Danach ruht er ein paar Tage kühl, worauf er in den 32 Grad warmen Reiferaum gebracht wird, wo sich die Lécher bilden. Der Umfang wird zunehmends grösser. Mit einem kleinen Hämmerchen wird die Garheit kontrolliert. Ist er gut, kommt, der Laib in einen anderen Kühlraum, wo er auf den monatlichen Abtransèport harrt. Ein Laib ist 90 bis 120 kg schwer, pro Tag werden zwei Laibe hergestellt. In Rüegisberg sehe ich die Vorbereitungen auf eine Hochzeit; die Männer schleppen riesige Kuhglocken herum: was das wohl bedeuten mag? Nach Rüegisberg kommt Wahlern; eine Kirche steht auf einem ehemaligen Thingplatz ausserhalb des Dorfes. (Rüeggisberg) (Wahlern) Ich laufe auf einer alten Römerstrasse bis ins Sodbachtal, wo ich trotz drohender Gewitterwolken beschliesse, das erste Mal im Freien zu Uebernachten. (Abstieg zum Sodbach, alte Römerstrasse) 29 Habe mir auf Flusskies ein wunderschönes Plätzchen herausgesucht und beobachte gerade, was sich am gewitternden Himmel so tut, da kommen auch schon die ersten Tröpfchen und ich muss mich in das überdachte Schlafzimer zurückziehen, an irgendsoeinen Schotterplatz, wo die ganze Nacht über irgendwelche Chaoten mit ihren Autos wie die Irren durch mein Schlafzimmer düsen. An Schlaf ist fast gar nicht zu denken. (Sodbachbrücke) [7.05.] Und am Morgen um 7 Uhr stehen schon wieder die ersten Guten-MorgenSchweizer auf der Matte. Ich habe schon gemerkt: nirgends ist man so richtig alleine in der Schweiz; ist halt ein kleines Land. Selbst später am "Schweizer-FamilienGrillplatz" umrunden mich Hund und Frau. Heute erreiche ich Freiburg /Fribourg, eine alte Stadt auf den Rändern und in der Tiefe einer imposanten Sandsteinschlucht. Ich besuche die Franziskanerkirche, worin - ich glaube es kaum - eine exakte Kopie der Kapelle mit der "Schwarzen Madonna von Einsiedeln", die ich schon in Einsiedeln sah, steht. Ebenfalls hier findet man das älteste noch erhaltene Chorgestühl der Schweiz (1280) und einen Hochaltar des Freiburger Nelkenmeisters von 1480. (Fribourg) Ein Brot und eine Schokolade lasse ich die Stadt meinen Durchzug kosten; am Hauptbahnhof verfitze ich mic infolge mangelnder Wegweisung, finde mich aber dann doch und gelange im Mühlental zu einer überaus schönen Rundbrücke mit angeschlossener Magdalennekapelle. Magdalenenkapelle an der Brücke) 30 Mit Fribourg habe ich die Sprachgrenze erreicht: ab hier wird fast nur noch französisch gesprochen. Und auch die Wegweiser ändern sich: in Städten gelbe Muschel auf blauem Grund, auf dem Lande weiterhin weiss auf brauenm Grund. Kurz vor Romont will mich auf einmla so ein blöder Hund beissen, er erwischt mein Hosenbein und reisst ein Loch hinein. Die Nachbarn des Hundebesitzers sind da, sie rufen den Besitzer an und spritzen etwas Desinfektionsmittel auf den Kratzer. Ich bin ja mächtig erschrocken gewesen! So ein blöder Hund! Für die Hose gibt mir der Besitzer hundert Franken und ich mache mich wieder auf den Weg. Apropos Geld: Wer mir was überweisen will. her damit, Pilger brauchen immer Geld. Die ersten Zusagen sind bereits eingetroffen. Jeder, der mir Geld schickt, bekommt ein extra Wörtchen bei den Heiligen in Compostella und einen Eintrag in mein Pilgertagebuch gratis! Und wird im Internet veröffentlicht! Schlafen tue ich in einer schönen grossen überdachten Fussballplatzbaude, wo ich mir ein paar Bänke zusammenstelle und so richtig gut liege. Wenn man so lange allen wandert, wird man vom vielen Neuen richtig abgehärtet und ich habe manchmla keine Lust, wieder fremde Menschen kennenzulernen. Irgendwie ist es jetzt ein Durchkämpfen; ich hoffe bald in Richtung Frankreich ein paar andere interessante Pilger zu treffen, mit denen ich ein Stück gemeinsam laufen kann. [8.05.] Ich freue mich richtig darauf, Romont zu sehen und laufe ziemlich weit und schnell. gegen elf sehe ich es auf einmal auftauchen. Es liegt wie ein mittelalterliches Bollwerk auf einem Hügel. Am Fusse ein Franziskanerkloster mit einer Kirche, die mich beeindruckt. Ich nenne sie Licht-Farben-Kirche, denn bei all ihrer Dunkelheit ist das erste, was man sieht, ein blauer Lichtschimmer im Chorraum. Immer mehr gewöhnt sich das Auge an die Dunkelheit und nimmt eine immense Farbigkeit wahr, die sich durch die modern gestalteten Bleiglasfenster schlägt. An den Wänden kommen matt Reste alter Bemalung zum Vorschein. Eine kühle Ruhe für die Füsse und eine Freude für die Augen. (Klosterkirche unterhalb Romont) Das Städtchen Romont will erobert sein. Erst auf dem Plateau zeigt es sich in aller Schönheit, zuerst in Form der Stiftskirche Maria Himmelfahrt, in der ich im Chorgestühl eine Darstellung des Jakobus mit Muschel und Pilgerstab entdecke, darauffolgend in Form eines Ladens, der mir das gute Frühstück liefert. 31 (Romont) Die Stadt hat drei Türme, der erste gehört zur Kirche, der zweite ist ein nördlicher Wehrturm, den dritten besuche ich jetzt; der Schlossturm. Unter ihm ein tiefer Brunnen, man knipst die Beleuchtung mit einem Lichtschalter an. Wieder durch Wald und Feld; in dreieinhalb Stunden ist man in Modon. Die Landschaft und die Leute verändern sich merklich: entweder sind es die fehlenden Berge oder die französische Sprache, die die Identität der Leute prägt. Ich jedenfalls finde, die Häuser sehen französischer aus, nicht merh so schweizerisch- perfekt, nicht mehr so viele Verbotsschilder, aber auch nicht merh so viele JakobswegSchilder, wie ich leider bald feststellen muss. (Moudon) Moudon besitzt die imposante Pfeilerbasilika St. Etienne, die am Fusse, am Eingang der Stadt gleichzeitig als Stadttor dient. An steilen Strassen zieht sich die Siedlung bis zur Burg hin, wo sich wie auf einem schmalen Bergkamm Häuschen an Häuschen reiht - ein romantischer Anblick. Drei verschiedene Leute frage ich nach dem Weg und drei verschiedene Antworten bekomme ich. Die letzten, zwei junge Leute, nehmen mich sogar zu zwei Herrschaften mit, deren Haus noch über der Burg thront; deren Rat folge ich; laufe entlang des Flusses und gelange auch wirklich wieder zu einem Schil mit de Aufschrift "Le Chemin de St. Jaques. Itineraire des europeen culturell". Ein Wartehäuschen ist meine heutige Endstation. [9.05.] Zuerst nähe ich meine Hose, dann schlafe ich ein wenig in der Sonne und an einem Bach kann ich mich sogar richtig waschen. Bin ich also wieder stadtfein. in Puveyres sind es erstaunlicherweise nur noch 3:50 Stunden bis Lausanne, bald habe ich den Stadtrand erreicht und mit ihm ein Kirchlein mit herrlichem See- und Stadtblick. In der Stadt die Kathedrale Notre Dame, ab 1170 einhundert Jahre lang gebaut, und das einzige, was sie an Pilgerzeichen hat (obwohl der Pilgerweg früher sogar direkt durch die Kirche ging), sind vier kleine Muscheln auf der Grabplatte eines Otto von Grandson (1240 - 1328). Die Stadt ist viel schöner als ich sie beim ersten Trampen erlebt habe. es bewahrheitet sich wieder mal der Spruch: Geh`zu Fuss, dann siehste mehr als im blöden Grossverkehr! 32 Nur die französische Sprache macht es mir schwer, ich traue mich kaum, jemanden um ein Quartier anzusprechen. Deshalb esse ich in einem Cafè einen schönen griechischen Salat und übernachte in einem Tennisclub auf einer Bank. Nun sitze ich schon den ganzen Vormittag im Gymnasium des Kantons Bugnon, wo ich freundlicherweise an den rechner gelassen werde. Nun ist aber erstmal Schluss, ich stürze mich in die Stadt. bis zum nächsten Wiederlesen: Bleibt schön neugierig! (Lausanne mit der Kathedrale Notre Dame) Und zum Schluss noch ein paar Impressionen vom Weg: [10.5.] Das ist die Last des Internet: den ganzen Morgen sitze ich in der schönen Stadt Lausanne am Computer und schreibe den Reisebericht in´s Netz. Dann habe ich Freigang und genieße die schöne Stadt, die ich nur kurz beim Trampen kennengelernt hatte. Am Abend überlege ich, wie ich am Besten eine Unterkunft in der Stadt finde; ich will noch ein bißchen in der Stadt bleiben, noch nicht weiterziehen. Wo findet man die meisten Leute am Abend? Im Stadtpark hat man eine fantastische Aussicht auf die untergehende Sonne,auf das Alpenglühen. Dort frage ich mich durch: wo kann man übernachten? Eine Gruppe von Musikern verweist mich auf eine Adresse im Norden, am Bahngelände. Dort empfängt mich ein 33 romantischer großer Garten mit Kastanien, der das Haus verbirgt. Eingang in die Küche. Dinge überhäuft; Eßwaren, Teller, Schüsseln, Abwasch. Ein italienisch sprechender junger Mann wuselt hin und her und findet überhaupt kein Problem dabei, mich heute hier übernachten zu lassen. Beim Reden kommen so einer nach dem anderen aus ihren Zimmern. Aber alle sprechen französisch, und dem kann ich nur zuhören und mich am schönen Klang erfreuen; verstehen kann ich es nicht. Ein Mädchen kann deutsch und dazu noch Konzertina spielen. Es ist eine wunderbare schöne verträumte Wohngemeinschaft. Sie erzählen, dass sie sich das Haus von der Eisenbahn zu einem Spotttpreis gemietet haben; die Eisenbahn ist froh, dass das Haus bewohnt ist und nicht verfällt. Ich fühle mich wohl hier, bin sofort aufgenommen in das Geflecht aus Musikern, Jobbern und Studenten. [11.5.] Der erste Weg führt mich durch römische Ruinen am Strand des Genfer Sees. Es gelingt mir, in einem Kaufhaus ein Französisch-Wörterbuch zu kaufen. Der Weg folgt dem Strand. Gegen Abend glaube ich zuerst, draußen schlafen zu können, doch dann zieht ein furchtbares Unwetter auf und donnert in Rolle gnadelos vom Himmel; mit Sturm und starkem Regen. Ich flüchte mich unter ein Garagenvordach. Mitten im Sturm rennt eine Frau aus dem angrenzenden Haus heraus zu einem Wohnwagen, um zu sehen, ob alles dicht ist. Sie lädt mich ein, mit ins Haus zu kommen. Dort finde ich mich inmitten einer Gruppe lachender und essender alter Leute wieder: Eine Altersheimgruppe aus Genf auf Ausflug. Ich bekomme Abendbrot und lerne einen Amerikaner in seinem Praktikum kennen. Schlafen darf ich in einem eigenen Bett im eigenen Zimmer. [12.5.] Nyon, Coppet, Genf. Das gesamte Ufer des Sees ist verbaut. Man kommt nirgends an´s Ufer. Erst als ich eine Kirche entdecke, kann ich mich an deren Strand setzen und mich von der langen Asphaltstrassenwanderung ausruhen. In Genf laufe ich zuerst durch das große Diplomatenviertel. Grünanlagen, dunkle Wagen und verglaste Fassaden. Nichts erinnert an Natur oder an Jakobsweg. Beim Bummel durch die Altstadt entdecke ich zufällig ein deutschsprachiges Schild an einer kleinen Kirche. Drinnen wird gerade für eine Feier umgeräumt. Der alte Pastor wird verabschiedet. Eine deutschsprachige evangelische Kirchgemeinde. Eine Frau, die Leiterin des "Petershöfli", einem Wohnheim für junge Mädchen, nimmt mich dahin mit und läßt mich im Kellerraum kostenlos übernachten. Ich könne doch etwas länger bleiben, bis Sonntag, und im Gottesdienst etwas über meine Reise erzählen. Wunderbar, ich habe die Stadt drei Tage für mich alleine und kann sie in Ruhe entdecken! Duschen und Toilette habe ich nebenan, mein Bett kann ich mir raussuchen im Zimmer. Ich mache mich fein und unternehme abends einen kurzen Stadtbummel. [13.5.] Das ist eine beruhigende Erfahrung, die ich auf der Wanderung nicht so oft habe: meine Sachen untergebracht zu wissen, ausgeschlafen und frisch gewaschen zu sein und eine ganze Stadt auf eigene Faust entdecken zu können: Genf liegt mir zu Füßen. Das Petershöfli liegt auf dem Altstadtberg Genfs. Ringsum alte enge Gassen mit Antiquitätenläden und Museen. Ich bin auf der Suche nach dem berühmten Flohmarkt, entdecke unterwegs die Synagoge und das Stadtmuseum, das im ältesten Bürgrhaus, dem Haus Tavel von 1480, untergebracht ist. Zwei große Kelleretagen untermauern die Ausstellung, im dritten Stock ist ein Modell der Stadt im Mittelalter zu bestaunen. Mächtige Wehranlagen machen deutlich, dass Genf schon immer einen wichtigen Platz im Gefühge der europäischen Politik gespielt hat, nicht umsonst sind heute viele große europäische Institutionen hier angesiedelt. Durch die fehlende Rucksacklast wird mir auch innerlich ganz leicht. Ich bekomme Lust auf Kultur, deshalb gehe ich am Abend in ein Experimentalvideofestival und sitze dort mit gestylten Nichtmehrteenagern im Kinoraum und ziehe mir mysteriöse Produktionen rein. Ich verstehe nichts, und das 34 nicht aus sprachlichen Gründen. Am Ufer der Rhone ist eins der vielen Nightlifezentren. Ein altes Wasserkraftwerk wurde hier zum Theater umgebaut, wird blau angestrahlt und vermittelt Weltstadtflair. Auf einem Platz zwischen Werkhallen, Cafés und Diskotheken hat ein Straßencafé seine Stühle und Tische ausgebreitet; eine Akkordeonspielerin singt ihre sehnsüchtigen Songs in den lauen Nachthimmel. Vor Mitternacht beginnt die Diskothek. Herumstehen, Zugucken, Leute ansprechen - viel passiert nicht, die Schweizerinnen sind nicht besonders. Gegen drei bin ich im Bett. [14.5.] Früh, beim Gottesdienst der deutschen Gemeinde, interkulturelles Flair: zwei Taufen mit Verwandten aus Südamerika, Lieder aus aller Welt, Verabschiedung des Pastors, Besuch von polnischen Bischöfen. Ich sage kurz was zum Weg und bedanke mich. Nachher gibt´s noch ein Buffett im Keller, dabei lerne ich eine nette Französin kennen, die perfekt Deutsch spricht, und Familie Neumeier, die mich zu Mittag einlädt, weil sie ein Französischlehrbuch für mich haben. Irgendjemand steckt mir einen Geldschein in die Tasche, der sich beim späteren genaueren Hinblicken als 50 Franken herausstellt. Neumeiers wohnen in einem Neubauhochhaus, wir sitzen auf dem sonnigen Balkon mit Blick über die ganze Stadt und den Genfer See. Die Fontäne, die pro Minute 500 Liter Wasser in den Himmel pumpt, direkt vor unseren Augen. Herr Neumeier kennt sich fantastisch in der Geschichte aus, Frau Neumeier macht fantastischen Gänsebraten mit Spargel und Tomatensuppe. Ich lebe nicht schlecht. Genf ist die letzte schweizerische Bastion und an drei Seiten von Frankreich umgeben, und so dauert es nur einige Minuten, bis ich selbst in Frankreich bin. [15.5.] Ich freue mich auf Frankreich, auf die Lebensart, die Landschaft, auf das Savoir vivre. Das erste, was ich mitbekomme, ist, dass meine Wanderschuhe schimmeln. Ich hatte sie in eine Platiktüte gepackt und dort haben sie begonnen, sich ungefragt zu zersetzen. Aber das ist nicht so schlimm, sie fliegen über Bord und ich bediene mich weiterhin meiner bewährten Sandalen, damit habe ich keine Sorgen, ich sehe immer meine Zehen. Da weiß man, was man hat. Ich laufe heute den ganzen Tag durch das waldige Rhonetal. einmal komme ich über die wilde Schlucht eines kleinen Bächleins, das sich seinen Weg tief in den harten Stein gegraben hat und dabei eine schöne Badestelle hinterlassen hat. Da bade ich. Abends komme ich bis Seyssel, frage eine ältere Frau an einem großen Baueernhof, wo man übernachten kann. Sie haben Stroh und lassen mich dort schlafen. Beim abendlichen Plausch erzählt die Tochter, dass ihre Mutter Deutsche war und nach Frankreich ausgesiedelt ist. Ich schlafe wunderbar warm und weich im Stroh. [16.5.] Habe noch eine Menge gute Wünsche, Landkarten und einen ganzen Beutel zu Essen nach dem Frühstück mitbekommen. Überall blühende Natur, Hügel, und im Talgrund die silbern glänzende Rhone. Über die Weinberge der Savoy führt der Weg, dann am Chanaz-Kanal entlang. In einer uralten Mühle wird aus Walnüssen Öl gepreßt. Der Stein, von Wasserkraft angetrieben, rumpelt herum. Am frühen Abend schlafe ich auf einem hohen Fels an einem Abhang am Rhonetal. Hunderte Meter unter mir die kleine Welt, ein kräftiger Wind zieht hier hinauf. Ich will doch noch ein Stück weiterkommen, mich vielleicht auch im Fluß baden, und so steige ich in den Grund hinab, durch einen dunklen, verzauberten Wald. In Yenne ist schon alles zu, die Fußwege hochgeklappt und die Kleinstadtseelen komfortabel vor der Bildröhre untergebracht. Ich schlafe in einem Park am Flußufer. [17.5.] Nach Zähneputzen am Kleinstadtbrunnen folgt ein langer Aufstieg über ein Kalksteinmassiv. Zwischen Hecken und Gestrüpp verläuft der Weg an der Flanke eine Schlucht, die von einer alten Festung am gegenüberliegenden Hang geschützt wurde. Dann verschwindet der Pfad für den Rest des Tages in der Dämmerung. Mir 35 ist irgendwie nicht gut, mag es Heimweh sein oder Magengrummeln, aber es wird durch die Dunkelheit der ewigen Bäume auch nicht besser. Am späten Nachmittag dann endlich der Abstieg nach Genix. Es sind wieder Häuser, Weiden und Wiesen zu sehen, das Wetter bessert sich zunehmend. In Genix dann kaufe ich etwas zu essen ein. Erst am Rande eines Kanals, dann zwischen Dörfer und Wiesen, durch Wälder der Weg. Spät abends frage ich in einem Häuschen nach Quartier und darf erst in die Scheune, dann in den herumstehenden Wohnwagen der Lehrerfamilie. [18.5.] Noch 1722 Kilometer. Es wird immer dörflicher, ich folge brav den blauen Markierungelandschaft zusehends flacher, die Sonne brennt heißer, aber viele Hecken und Bäume bieten ausreichenden Schutz vor der Sonne. In Cote St. André wird es Zeit, an Übernachtung zu denken, und so frage ich einen Anwohner, der gerade ein großes Haus abschließt, wo ich denn etwas finden könnte. wie immer werden zuerst alle professionellen Herbergen ud Hotels aufgelistet, doch wer kann die sich schon leisten? Am Ende sagt er mir, herabblickend in die weite Ebene: Einfach dieser Strae folgen, dann ach zwei Kilometern nach rechts abbiegen, und schon ist dort "Alte St. Martin", was immer das ist. Ich dorthin, natürlich nichts gefunden, und so lege ich mich auf einen Kiesberg, der ein Plateau gebildet hat, in der Hoffnung, dass es nachts nicht regnet. Die Hoffnung erfüllt sich nicht und so wechsele ich mitten in der Nacht meinen Standort und ziehe in einen einachsigen Bauwagen ein, der beim Einsteigen umkippt. Aber drinnen ist ein Brett zum Drauflegen, es geht mir vom Kopf bis zum Bauch. Die Beine lege ich auf eine Tonne. Aufpassen muß ich nur beim Bewegen: jede Gewichtsverlagerung beantwortet das Gefährt mit Umkippen. [19.5.] Endlich wird es morgen. Der Wagen kippte unzählige Male hin und her, und jedes Mal bin ich aufgewacht. Geschlafen habe ich wie auf einem Operationstisch. Ich sammle also meine Knochen ein und wandere die kleine Ewigkeit zurück nach St. André. In der Stadt sehe ich eine große überdachte Halle, beeindruckend. Zwischen zwei Hügelketten führt der Weg durch den Faramans- Sumpf, ähnlich wirkend wie der Spreewald, ziehen sich sehr wasserreiche Kanäle durch dichte Wälder. Das ganze Gebiet ist als Naherholungsgebiet ausgebaut, mit Sportplätzen und Bänken und Naturlehrpfaden. Wenn in Frankreich einmal etwas angeordnet und gefördert wird, dann wird alles perfekt eingerichtet. Alle anderen Flecken beleiben dagegen unberührt. Eigeninintiative und kleine verschönerte Stellen oder Bänke im Dorf findet man kaum. Als es schon sehr spät ist und der Weg in einen großen Wald einbiegt, gehe ich einfach geradeaus weiter auf einen großen Bauernhof zu, um nach Stroh zu fragen. Ich lande bei Michel, dessen Familie mich sehr, sehr gern aufnimmt. Sein Vater ist 83 Jahre alt und tischlert immer noch in seiner Werkstatt, ich kann ihm dabei zusehen. Michel selbst lebt allein, aber liebt seine Arbeit: in der Wohnküche sammelt er Holzstücke, die mit Fantasie nach Tieren oder Menschen aussehen und Kühe in allen möglichen Materialien. Problemlos redet er mit mir auf französisch und dadurch lerne ich sehr schnell. Dann treiben wir zusammen die Kuh und die Ziegen ein und ich sehe einen Stall, wie ich noch nie einen schöneren gesehen habe: Kuh, Ziege, Hund und Schaf leben einträchtig nebeneinander, wie eine Familie. In einem Nebenraum stellt Michel Frischkäse her: er rührt Milch von Schaf uns Kuh mit Lab zusammen und läßt die Mischung einen Tag stehen. Das verklumpte füllt er am nächsten Tag in kleine Becher. Daraus läuft mit der Zeit die Molke ab. Zum Schluß werden die Frischkäsestückchen noch an frischer Luft in einem Gazeschrank getrocknet. Ich bekomme ein leckeres Abendommelett mit frischem Salat und darf im großen Gästebett schlafen. [20.5.] Heute geht´s hinunter ins Rhonetal. Das erstes Mal schlage ich mir den Bauch mit Kirschen und Himbeeren voll. Lecker ! Noch bevor ich die Rhone 36 überquert habe, sehe ich an einem Gebäude in einem Park eine Menge Leute wie zu einer Feier stehen. Ich frage, ob sie eine Toilette haben. Danach spricht mich Robert Fabbri an, der Bürgermeister eines Ortes, ob ich etwas trinken möchte. Aus dem Trinken wird ein Plausch und ein luxuriöses Abendessen. Ich in in eine Sponsorenversammlung von "Resto du Cœur" geraten, einer ehrenamtlichen Organisation, die im Winter Arme und Obdachlose mit Essen versorgt. Familie Moguel nimmt mich mit in ihr feines Vorstadthäuschen, ich dusche, bekomme meine Hosen gewaschen, schlafe im Bett der Tochter und frühstücke mit dem Kernkraftwerkselektriker und der Krankenschwester. Dann bringen sie mich noch zurück zum Weg. [21.5.] Das Massiv Centrale! Sonne pur, Lehmhaeuser und Obstplantagen. Treffe mich immer wieder mit einer Gruppe Deutscher, Beatrice, Norbert, Udo und Paul. Paul ist Musiklehrer und setzt sich in jeder Kirche an die Orgel. wir schafen es leider nicht, einmal zusammen zu spielen. Udo ist Polizist. Ein ganzes Stück verfolgen wir den asphaltierten sanft ansteigenden Bahndamm einer abgebauten Kleinbahn. Ein Hund ist auf einmal neben uns und geht zehn Kilometer mit, bis ihn sein Herrchen wutenbrannt per Auto zurückholt. Udo und Paul wandern wie so viele den Weg in Etappen. Sie wollen bis Le Puy kommen und von dort dann nächstes Jahr weiterwandern. Ich muß mich beeilen, um zur ausgemachten Zeit in BourgArgenthal zu sein, ich habe nämlich ein Rendezvous: Robert, der Bürgermeister, hat seinem Bruder Bescheid gesagt, dass er mich aufnimmt, und wir wollen uns im Hotel de France treffen. Dieser aber hat´s vergessen, die Rezeptionistin muß ihn erst anrufen, dann kommt er und holt mich. Bei ihm zu Hause fühle ich mich nicht wohl. Er scheint mich nur aufzunehmen, um seinem Bruder einen Gefallen zu tun. Ich frage aber trotzdem, ob ich mir sein Fahrrad borgen kann, um in die etwas entfernte Stadt zu fahren. Das darf ich gerne, gehe kurz in die Bar auf ein Bier und eine Bananenmilch. Die Bar ist toll. [22.5.] Heute passieren wir ein ewig langes Waldstück ohne viele Häuser, im Hintergrund immer die Gipfel des Zentralmassivs. Ich gehe mit Udo, uns folgt Paul. Beatrice und Norbert sind immer Unlängen voraus. So langsam bekommen wir Hunger, aber es gibt keinen Laden, nur Kiefernwälder. Als es uns zu bunt wird, sprechen wir zwei junge Frauen vor einem Haus am Wegesrand an, und die geben uns Käse, Bier und Weißbrot. Wir wollen auf die anderen warten, weil die Frauen uns den Weg zur Herberge erklären konnten, doch wo die jetzt sind, wissen wir nicht. Ich will den Weg weitergehen, Udo wird zur Herberge gehen und hoffen, dass die anderen nachfinden. Doch so geschieht es, dass ich Udo für die ganze nächste Zeit aus den Augen verliere. Die Entfernung bis zum nächsten Ort ist doch nicht so groß, ich erreiche ihn kurz vor sechs und damit bekomme ich noch eins der letzten Brote im Bäckerladen von Montfaucon. Es ist ziemlich kalt hier, wir sind wahrscheinlich in einer großen Höhe. Beim Kneiper gibt´s zwar einen Schlüssel für die Gite de Etape, aber der kostet 12 Mark, und so treibe ich mich noch in einer Kirche mit einer Statue der wunderhübschen Jeane d Arc und 12 Bildern eines flämischen Meisters herum. Die Bilder sind aus dem 14. Jahrhundert und so farbenfroh und realistisch, dass ich vor jedem einzelnen staunend eine Zeitlang stehenbleibe. Die Bilder wärmen von innen. Weil warten nicht immer hilft, gehe ich weiter, hinaus aus dem Ort, in die Natur, wo nur noch vereinzelte Gehöfte stehen, und frage mich durch. Leider habe ich erst beim vierten Mal Glück. Doch diese Familie, die Dantonys, Tischler, nehmen mich liebevoll auf und geben mir sogar ein Bett im Nebenhaus. Es ist erstaunlich: Um neun Uhr abends stehe ich, ein fremder Mann, vor der Tür, und frage nach einem Quartier und werde vertrauensvoll aufgenommen! Ich kann es manchmal gar nicht glauben, was für Mut und Güte in den Leuten steckt. 37 [23.5.] Habe von Dantonys Kekse und deutsches Bier mitbekommen. Zweimal muß ich wegen schlechter Beschilderung den Weg suchen. Als ich über einen Paß komme, sehe ich ein Wunder: die Vulkankegel des inneren Zentralmassivs. Eine von Sonne durchflutete bewaldete Hochebene. Gleich eines der ersten Dörfer ist eine besondere Augenweide: einige Häuschen umstehen einen riesigen Monolithen. Ich folge einer fadenscheinigen Markierung, es ist aber die einzige, die ich finden kann, un lande, das merke ich aber erst am Abend, an einer ganz falschen Stelle. Ein Dorf an einer Fernferkehrsstraße. Ich fühle mich verloren hier, werde von einem Hund dumm angemacht und finde nur in letzter Not einen Schlafplatz. Ein Mann, der in einem heruntergekommenen Haus wohnt, läßt mich in der noch heruntergekommeneren Scheune übernachten. Mich aber kann mittlerweiel wohl nichts mehr erschüttern. Ich sammle mir etwas Heu zusammen und schlafe ein. [24.5.] Morgens wasche ich mich direkt an der Straße an einer Quelle und muß nun den ganzen Weg zurück an der Straße laufen, immer in Richtung Le Puy. Plötzlich findet sich auch die Muschelmarkierung wieder. Ein Auto hält an, daraus grinst mich Udo an. Er kann nicht mehr richtig laufen, trampt sich so Stück für Stück vorwärts und wartet auf den Zeltplätzen auf seine Kollegen. Gleich nach der Überquerung eines Flusses auf einer unbeschreiblich alten und buckeligen Brücke entdecke ich ein großes Gymnasium und kurz entschlossen steuere ich das Direktionszimmer an, um noch einmal, es soll das letzte Mal werden, live ins Internet zu schreiben. Der Direx ist zwar supernett, aber zuerst sehr schwierig zu erreichen. Er führt mich persönlich zu einem der wenigen Internetrechner. Dort hilft mir ein Mitarbeiter weiter. Ich werde gebeten, mich später nochmal beim Direktor zu melden. Dabei bekomme ich die Einladung, im hauseigenen Internat zuübernachten und in der Mensa zu essen. So finde ich mich dann mitten unter einer Menge Schüler wieder, die mich anstarren. Ich versuche den ersten Kontakt mit meinen Französischbrocken, doch da ist einer, der Englisch kann, und schon geht es besser. Abends spiele ich das erste Mal in meinem Leben Boule, das französische Nationalspiel. [25.5.] Le Puy - große Zwischenstation auf dem Weg. Für viele Etappenpilger ist die Stadt Anfang oder Ende der Reise. Ich bin beeindruckt von der Kulisse und gleichzeitig bestätigt sich die schon vorher gewußte Tatsache: die Madonna ist kitschig. Le Puy ist eine geheimnisvolle Stadt auf Hügeln. Gleich einem tibetanischen Himmelspalast liegt die große Kathedrale auf dem Berggipfel und hat durch Lage und Konstruktion etwas Mystisches. Im Inneren eine schwarze Madonna. Eine Frau sitzt versunken direkt vor dem Altar. Eine Frau kehrt unbeeindruckt Müll zusammen. Große Gedanken werden Materie. Alle Häuser der Stadt sind historisch, es findet sich eine Jakobusgasse; sie führt die beiden zum GR 65 vereinigten Jakobswege zur Stadt hinaus. Täler und Häuser aus schwarzem Tuffstein. Die Landschaft hat sich wieder total verändert: der löcherige Vulkanstein liegt zu Mauern aufgeschichtet an den Wegrändern. Es gibt keine größeren Baumbestände, nur Hecken und Wiesen. Die Architektur hat sich den natürlichen Voraussetzungen angepaßt und verstrahlt, hervorgerufen durch die Dunkelheit des Gesteins einen historischen Charme und ein Geheimnis. Abends erhöhen sich die Klippen, ich gelange an einen Canyon gigantischer Ausmaße. Tief unten windet sich eine Eisenbahnlinie durch die Klamm. Ich will nahe am Fluß eine Schlafstelle finden und gehe einen Weg ein Stück vom Jakobsweg weg. Ich finde kein Dach gegen den Tau, aber eine weiche Wiese. [26.6.] Wache durch die Nässe sehr früh auf. Es geht sehr schnell bergauf, wieder aus dem Canyon heraus. Oben eine Magdalenenkapelle, in den Fels gehauen. Davor, schon so zeitig, eine französische Pilgerinnengruppe. Sie lesen aus dem 38 Reiseführer vor. Diese Informationen bleiben mir unbekannt, ich kann oft nur die äußeren Schalen der Baugeheimnisse oder deren innerste Ausstrahlung ergründen. In Saugues ist Markttag. Eine Frau verkauft graue Käseballen, denen ich nicht widerstehen kann. Der Käseballen beglgeitet mich in die folgende "Sauvage" - die Wildnis. Er stinkt. Die Sauvage - das sind riesige Steppengebiete, keine Menschenseele trifft man an. Goldener Ginster blüht hier. Ich esse den Käse, und er schmeckt ganz sauer und schlimm. Wegwerfen ist aber nicht drin. Bis auf 1790 Meter Höhe quält sich der Weg, es wird immer kälter und unwegsamer. Andere Pilger trifft man sowieso nicht. Aber die Einsamkeit ist nicht quälend. Man ist total konzentriert auf Wahrnehmung, spürt, riecht und sieht mehr als sonst möglich. Vor der Einöde Le Falzet besichtige ich den mir empfohlenen phallusförmigen Menhir; beeindruckend. Es beginnt zu regnen. Rochusquelle, Rochuskapelle auf dem Paß. Ich flüchte mich in die Refuge an der Kapelle und verbringe die Nacht auf dem großen Eichentisch. Im Refugenbuch lese ich, dass ich in jedem Fall nihct der erste bin, der auf dem Tisch nächtigt. Ich bin total allein hier oben, draußen tobt das Unwetter, hier drin ist es finster, es gibt kein Licht. Draußen auf der Straße vor der Refuge kommen die ganze Nacht über nur ein, zwei Autos. [27.6.] Gegen halb neun kommen die ersten Pilger, in Regenmäntel gehüllt, schauen sie in die Refuge und scheuen erschrocken zurück, weil da einer auf dem Tisch liegt. Es geht nur noch hinab, nach Sankt Alban, einer Siedlung, die einem erzbegirgischem Ort sehr ähnlich sieht: schindelgedeckte Dächer, weiße Mauerwände, Wiesen und kleine Nadelwaldbestände. Nachmittags erreiche ich die Stadt Aumont-Aubrac an der Autobahn E 11, dann geht´s in die Wildnis Aubrac. Abends erreiche ich den Hof "Chez Regine" - bei Regine. Eine kleine Bar, es gibt Omelette, Tee und einen Wohnwagen zum Übernachten. Eine Omi schmeißt zusammen mit ihrer Tochter den ganzen Laden. [28.6.] Im Wohnwagen habe ich gut und warm geschlafen, doch dann muß ich hinaus in den strömenden Regen. Einige Stunden wandere ich durch unendliche, 1300 Meter hohe baumlose, kalte Ebenen. Nur Findlinge und ab und zu ein paar Aubrac- Rinder, die ihr Hinterteil in den Wind strecken. Ich bin schon nach zwei Stunden völlig durchgeweicht und kann mich nach vier Stunden kaum noch auf den Beinen halten; nirgends kann man sich setzen. Ich laufe in Höchstgeschwindigkeit, um nicht zu sehr abzukühlen. Mittags erreiche ich Nasbinals, endlich. Ich kann nicht mehr denken, suuche nur noch ein warmes, trockenes Plätzchen. Das erste, was mi auffällt, ist eine offene Tür zu einem Kulturhaus. Drinnen eine Toilette. Die Heizung geht. Ich stehe die nächste volle Stunde an der herrlichen Heizung, um endlich wieder Leben in meinen Gliedern zu spüren. Dazu bin ich auch richtig ausgehungert, finde einen Kuchen unter einer Theke und verschlinge diesen an der Toilettenheizung. Die Hosenbeine beginnen wieder zu dampfen, ich kann langsam wieder denken, und nach einiger Zeit gehe ich zur Gite de Etape, um mir ein Bett zu reservieren. Es regnet immer noch in Strömen. Heute bezahle ich mal die Unterkunft, mir ist alles egal. Jürgen aus Dresden hat mir fünfzig Mark überwiesen, von denen möchte ich heute mal so richtig gut im Restaurant essen. Das ist übervoll, wir müssen alle stundenlang stehen, bis ein Platz frei wird. Dann esse ich einen Bauernsalat und ein Rippensteak inmitten dampfender und schwitzender Gäste. Draußen schüttet es. Ich treffe Markus, den Pferdeliebhaber wieder, wir setzen uns zusammen und freuen uns aneinander. Schön, wieder mit jemandem Deutsch reden zu können. Die Pension ist toll, neu und beherbergt von netten Leute. Ich unterhalte mich mit einem Lastwagenfahrer, der berufsbedingt in der Pension übernachtet. Er ist mit einem Kleintransporter mit einem großen schrecklich häßlichen Werbeplakat unterwegs und kommt aus einer ganz anderen Welt. Was ich tue, ist für ihn 39 unvorstellbar. [29.6.] Alle Läden haben zu, es ist nämlich Sonntag. Das habe ich nicht gewußt, ich dachte, es wäre gestern schon Sonntag gewesen. Aber nicht so schlimm, mir geht es später noch mehrmals so, dass ich den Wochentag nicht weiß. Aber es gibt kein Brot. Markus hat auch nicht gewußt, dassheute Sonntag ist. Wir treffen uns im Ort, weil wir heute zusammen weiterwandern wollen. Er ist mit zwei Pferden und einem Hund unterwegs. Ein Pferd, Nafees, ist sein richtiges Reitpferd und richtig wertvoll; der andere, Sultan, den hat er für zweitausend Mark als Lasttier billigst gekuft, extra für diese Wanderung. Zwei Jahre ist Markus schon von zuhause weg, hat in Frankreich auf Pferdehöfen gearbeitet. Die Hündin heißt Lea. Wir müssen mit dem Weg durch einige Hochlandweiden mit Aubrac-Rindern. Kleimachenne Durchlässe für Menschen sind an den Zäunen. Für die Pferde öffnen wir extra den Maschendraht. Plötzlich steht die ganze Herde der braunen, gehörnten und sehr agilen Viecher vor uns. Sie haben es auf Lea abgesehen und jagen den Hund durch die Koppel, dass der Schlamm nur so spritzt. Wahrscheinlich sehen sie im Hund den Wolf, den bösen Feind der Herde. Arme Lea sprintet mit hängender Zunge über die Wiese. Dann bildet sich ein Pulk aus Neugierde um uns und die Pferde. Wir müssen die Kühe mit Stöcken auseinandertreiben. Ich habe keine Furcht, die Rinder reagieren auf die sanften Stockberührungen, und so kommen wir Stück um Stück vorwärts. Hinter uns kommt eine Gruppe älterer Wanderer, die nicht so freimütig mit den Tieren umgehen. Ihnen steht der Schweiß auf der Stirn. Flink rennen sie über die Weide, kommen ganz erschöpft am Zaun an, wo wir ihnen aufhalten. Heute regnet es nicht; im Gegenteil, die Wolken verziehen sich und es wird richtig angenehm. Den Zustand allerdings warm zu nennen, wage ich hier noch nicht. In Aubrac setzen wir uns in eine Gaststätte, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Dabei grinst uns ein riesiger frischer Waldbeerenkuchen an, woraufhin wir uns in seinen Einfluß verstricken lassen und uns ein Stück teilen. Jetzt kommen auch schon wieder richtige Wälder, mit bemoosten Stämmen, nach unten zu immer dichter werdend. Mitten in einem Wald geht es über eine verwachsene Brücke. Die warmen großen Pferde immer um uns herum, die schüchterne Lea zu unseren Füßen. Jede Ankunft in einem Ort gerät zum Ereignis, und Uwe vermag seinen Teil dazu beitragen. Ein stolzer Mann mit Cowboyhut. Bis Sant Come d`Olt kommen wir, bereiten unser Lager im Freien, am Ufer des Flusses. [30.6.] In der Nacht fängt es mit Nieseln an. Ich hab keine Lust, groß zu wandern und verziehe mich nur unter einen etwas dichteren Baum. Der Schlafsack wird trotzdem ganz naß, ich wache am Morgen sehr zeitig auf, weil das Wasser durchkommt. Hole beim Bäcker etwas zum Frühstück und mag nicht länger im Regen warten, denn Uwe schläft noch. Immer im Tal entlang geht es nach Espalion. Es regnet, ich mache Rast in einer wunderschönen alten romanischen Kirche mitten im Wald mit Kapelle im Kirchturm. Aufstieg über einen schlammigen Pfad, vorbei an einem Schloß nach Estaing. Dort kommt zum ersten Mal die Sonne hervor und bringt den ganzen Wald und mich zum Schwitzen. Alles dampft, man fühlt sich wie neugeboren. In Estaing sitzen schon die anderen Pilger lachend im Straßencafé. Eine hohe Burg überragt den historischen Ort im Tal. Ich gehe nun einmal nicht den GR weiter, sondern möchte mir den Canyon des Lot ansehen und laufe Straße. Der GR geht parallel, nur oberhalb des Tales. Ich finde ein Plätzchen am Fluß und hänge alle meine Sachen zum trocknen in einen Baum. Abends ein sechs Kilometer langer steiler Aufstieg nach Golinhac, wo ich um neun eintreffe ud von französischen Pilgern empfangen werde, die sich rührend um ein Nachtquartier für mich kümmern. Als wir aber keines finden, lädt mich einer in die Gite ein und bezahlt für mich die Nacht. Ich bin damit aber gar nicht so glücklich, denn mich hat keiner gefragt; die Franzosen sind einfach 40 losgezogen und haben mit den Leuten im Dorf gesprochen, als ob ich gar kein Französisch könnte. Ich hatte gar keine Chance mitzureden. [31.6.] Es regnet wieder, habe gar keine Lust loszugehen. Es ist so schön in der Gite. Durch Felder und Wälder führt der Weg, durch Nebel und Regen, einige kleinere Dörfer passierend. Gegen Nachmittag erreiche ich den Abstieg ins Tal von Conques und setze mich etwas abseits vom Weg auf meinen Rucksack um mich auszuruhen. Da kommt ein Kameramman und fragt, ob es mir gutgehe, weil ich so zusammengekauert auf dem Rucksack sitze. Dann kommt noch einer und fragt mich, ob er mir helfen kann, ob wir zusammen in die Stadt gehen wollen. Ich will mich aber nur ausruhen. das Erlebnis ärgert mich den ganzen Tag. Hoffentlich bleibt die "Hilfsbereitschaft" der Pilger nicht den ganzen weiteren Weg so! Conques. Erreiche Conques, ein wirklich traumhaftes Städtchen. Alles alte Häuser und eine riesige romanische Hallenkirche mit einem interessanten Portal. Mich faszinieren die Galerien in der Kirche, auf denen früher die Pilger geschlafen haben sollen. Immer wieder möchte ich mir die Pilgerei im Mittelalter vorstellen: Burgen, Schwerter, einfache Kleidung, Regengüsse, interessante Gesichter. Jedes der über hundert Kapitelle ist hier verschieden gestaltet: Außer einigen Figuren scheint das der einzige Schmuck zu sein und das tut der Wirkung des Innenraums enorm gut. Mit 22 Metern Schiffhöhe ist die Sant Fe die höchste romanische Kirche. Ich kann in einem extra für Pilger eingerichtetem Kloster schlafen. Jetzt ist am Weg immer mehr für Pilger vorgesorgt, aber da gefällt mir gar nicht sehr: selbst für mich zu sorgen, mich durchzuschlagen, Leute zu fragen und so deren Leben kennenzulernen, fand ich viel besser. Aber ich lasse mir die wirklich liebevolle Betreuung auch gern einmal angedeihen. Bekommen Abendbrot und besuchen abends eine Messe mit Orgelmusik in der Kathedrale. Die untergehende Sonne widerspiegelt sich in den Fenstern, dann wird ein Scheinwerfer eingeschaltet und beleuchtet das Altarfenster von außen. Lieblich und gewaltig zieht die Musik durch den ungeheuren umkleideten Raum. Wir schlafen in einem großen Saal mit dreistöckigen Betten. [1.6.] Schon zwei ganze Monate bin ich jetzt unterwegs und es könnten noch zwei weitere werden. Heute kommen mich Herrmann, Maria und Siegfried aus Dresden besuchen und bringen gleich Fotoapparat und WunschzettelErfüllung mit. Bin gespannt, was das für Leutchen sind. Ich lege mich bei der Rochuskapelle in die Wiese und genieße die ersten Morgenstrahlen. 41 Dann besehe ich mir Conques und esse im Kloster zu Mittag. Nachmittags kommt Markus an und läßt sich bestaunen. Seine Bekannte, eine Schweizerdeutsche, ist auch da. Plötzlich kommt eine SMS; die Dresdner sind da, wo ich wäre. Doch da erraten wir uns auch schon. Sie sind extra wegen dem Wochenende tausende Kilometer Autobahn gefahren. Wir vespern an der Rochuskapelle schaffen Maria ins Kloster, wohlgemerkt zum Übernachten und schlafen als Männer zu dritt neben der Kapelle im Freien. Heute ist Männertag. [2.6.] Männerfrühstück an der Kapelle, Maria hat verschlafen. Durch das Tal, an einer Kapelle vorbei hinauf, über Land und Dörfer. Meine Begleiter haben ein ziemliches Tempo. Ich bin sio froh, jemanden aus der Heimat bei mir zu haben. Die sächsischen Klänge kann man nicht imitieren. Wandern bis Figeac. Von dort aus holt Siegfried das Auto, wir übrig Gebliebenen essen Eis, ich gehe mit Herrmann einkaufen. Abends setzen wir uns in eine Bar, essen Käse und Bguette und trinken Bier. Spät gehen wir aus der Stadt heraus und schlafen auf einem freien Feld. [3.6.] Gemeinsames Frühstück, dann geht Siegfried zum Auto, fährt es zum nächsten Etappenort und will uns entgegenkommen. Abends verabschieden wir uns mit einem leckeren Pizzaessen, ich grübele, ob ich die Konzertina mit nach Hause gebe, behalte sie aber doch. Herrmann macht ein Inteview für die Schule mit mir. Ich bin total froh, dass die drei da waren, sie haben mir ganz viel Auftrieb gegeben weiterzumachen. Aufstieg bis zu einem Betonkreuz, schlafe auf einem Holztisch mit Ausblick auf Figeac. [4.6.] Starte zeitig, dusche mich in einer Gite, in welcher ich die Helferin aus dem Kloster in Conques wiedertreffe.Nun erfahre ich, warum sie sich in den Herbergen so engagiert: sie will selbst eine Herberge eröffnen. Ich informiere mich gleich mal über den weiteren Verlauf des Weges. Sie fragt mich, ob ich denn keine Karten dabei habe, das wäre doch ganz wichtig. Finde ich nicht. Ganz abgesehen davon, dass ich sowieso nicht so viele Karten tragen kann, wie ich zum Wandern bräuchte, oder viel zu viel Geld ausgeben müßte, um alle zu kaufen, finde ich, dass mir die Zufälle und Glücksfälle immer weitergeholfen haben als alle Planung. Bestes Beispiel ist ja die hiesige Situation: Hätte ich mich an den Karten orientiert, wäre ich den normalen Weg GR 65 gelaufen. So aber habe ich, buchstäblich in letzter Minute, erfahren, dass die Variante GR 651 die schönere Lösung ist. Pilgertheorien. Los geht`s: im nächsten Ort schon ist die Abzweigung. ein Häuschen ist über und über von Pfeilen und Hinweisen bedeckt. Ich muß geradeaus und folge dunklen Pfade durch schwarzes Dickicht in´s Tal hinab. Auf einer schönen Lichtung mache ich erst einmal Pause, rutsche mit der Sonne immer weiter herum, um nicht in den Schatten zu kommen. Maria hat mir eine riesige harte Wurst und eine ungarische Salami mitgebracht. Als erstes entdecke ich ein Bächlein, dass frisch und kühl an einem Felsen 42 herunterrint. Ich koste einen Schluck. Dann bei einer Ansammlung von drei Häusern, findet sich am Wegesrand eine kleine Grotte, das heißt, ein Stein stützt sich an eine Felswand und unterhalb vom Straßenniveau fidet sich verborgen im Felsen, ein Wasserloch voller kostbarem Nass. Ich wasche meinen Schweiß ab und gehe frisch weiter.Mich interessiert eine dunkle Abzweigung in einem dornigen Wald, folge dem Pfad, und entdecke eine Quellhöhle ungeheurer Ausmaße mit Kies und einem kleinen See darin. Direkt vom Stein aus geht ein trockenes Flußbett zum Tal hinab. Die Dimension dieses Laufes geben eine Vorstellung der Menge Wassers die zu flüssigen Zeiten hier aus dem Berg rinnt. Der Himmel verdunkelt sich als ob es regnen würde, aber es tut es nicht. Der Weg führt auf einen Talrand und dann in schwindelerregende Höhen hinauf auf eine Felskante. Die Witterung hat viel kleine Höhlen aus dem Kalkstein gewaschen. Dann führt der kleine Pfad plöptzlich durch eine Mauer mit Tor und Schießscharten. Abends gegen acht erreiche ich St. Sulpiere, ein Dorf dessen Häuser teilweise in die Felswände hineingebaut worden sind. In einer Nische finde ich wieder eine umbaute Quelle mit einem Fensterchen ins kristallklare Wasser. Zuerst will ich auf einer glattgefressenen Weide mit Blick auf das Dorf unter einem baum schlafen doch ich ziehe doch, falls es regent, die benachbarte Scheune vor und bereite mir mit etwas Stroh das Nachtlager vor. Zuerst aber sammle ich die toten Mäuse auf, die zu Dutzenden herumliegen. Die Ursache deren Sterbens ist auch gleich gefunden: ein Häufchen Mäusegift in der Ecke. [5.6.] Ich habe sehr gut in der Scheune geschlafen, es hat die ganze Nacht über gegossen und gewittert. Am schönsten ist es, wenn man das Unwetter aus einer sicheren Position hinter einem Fenster beobachten kann. Dann macht das Regnen richtig Spaß. Den ganzen Tag über bleibt es bewölkt und schauert ab und zu. Beim Loslaufen ist alles noch ganz naß. Ich entdecke ein zweites Dorf an die Felsen gebaut und ein Dorf mit romanischer Kirche aus dem 15. Jahrhundert. Ich kaufe ein und frühstücke regenbedingt in einem kleinen Spielplatzhäuschen am Ufer der Celé. In einer schönen Höhlenkletterergite informiere ich mich über den Weg. Ich bin hier in einer prähistorischen Gegend, so scheint es. Es gibt unzählige Höhlen, viele ehemals bewohnt und mit prähistorischen Felszeichnungen. Ich besuche die Höhle im Berg Pech Merle und bin begeistert von deren Felszeichnungen und natürlichen Schönheiten. 17.000 Jahre alte Fußspuren sind zu sehen und die gesprühten Umrisse einer Frauenhand. Ich bin beeindruckt. Ich würde nur zugern wissen, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Ich bin überzeugt dass sie mindestens genauso intelligent wie wir waren nur noch nicht solche Werkzeuge hatten. Um das Höhlenleben live zu testen, übernachte ih in einer besonders schönen Höhle am Zusammenfluss des Celé und des Lot. Es regnet wieder, ich bereite mir aus dem vorhandenen Gras eine Untelage, damit Schlafsack und Isomatte nicht so staubig werden. Ich sehe die Höhlendecke und frage mich, welche Augen ales auch schon diesen Anblick vor sich gehabt haben und was deren Gedanken waren. Man erkennt kleine eingestemmte Vierecke die einmal Balken getragen haben müssen. Ich fühle mich hier - fünf Meter über der Straße - wie ein kleiner Urmenschenkönig. [6.6.] Wache gut ausgeruht aus meinem königlichen Lager auf und steige in der Hoffnung hinunter, in Bouzies etwas zum Frühstück zu bekommen. Doch es ist noch zu zeitig. Ich mache einen Abstecher zum Lot auf dem Hagal-Weg in Richtung der Felsen, die ich gestern so attraktiv, aber unerreichbar vom anderen Ufer aus gesehen hatte. Und wirklich: der Lot hat hier eine kalkene Steilwand gegraben und eine Unmenge Höhlungen und Klüfte erzeugt. Der Mensch hat sich über Wasserniveau einen Fußweg gebrochen (Eben jenen den ich schonauf der Postkarte sah und gerne selbst sehen wollte) und ein ganz besonderer Mensch hat in dem 43 rauhen Kalkstein ein ungewöhnlich schönes Relief hinterlassen. Ein sonninger Morgen nach einer Regennacht, ich steige durch glitzerndes Gras, den ganzen Tag bergauf und bergab durch den Wald, durch zwei Dörfer aber kein einziger Laden (in der Not ißt man die Wurst auch ohne Brot) ist zu sehen. Der Weg geht durch Hecken und wälder, immer hart an der Kante entlang, man hat wunderschöne Ausblicke auf den Flußlauf, aber leidet an Umwegen. Endlich dann ein Bäcker, der sein Brot über Holzkohlefeuer bäckt und mit Schokolade ausgerüstet ist. Ich lasse vor Freude gleich meinen Wanderstock im Laden stehen. Ich laufe jetzt an der Straße entlang, die ist zwar gefährlicher, aber führt sicher zum Ziel: nach Cahors. Im Supermarkt finde ich endlich Batterien, die meine Kamera funktionieren lassen. Zuerst will ich am Rande der Stadt auf einem Aussichtspunkt übernachten, doch dann beobachte ich die Wolkenbewegungen und erinnere ich mich an die adressenliste zum Übernachten, dei ich in Conques mitbekommen habe und frage mich durch bis zur Rue Fondue Haute, zum Foyer Jeunesse, einem Heim für junge Arbeiter, wo ich ein Bett bekomme. Abends Stadtbummel. Blick nach Cahors In Cahors Brücke aus Cahors [7.6.]Gleich hinter dem Ortsende beginnt ein steiler Aufstieg, wieder in eine Ödnis. Den ganzen Tag laufe ich durch staubige Ebenen. Mir tun heute die Knie weh, ich laufe nicht weit, mache oft Rast und halte Mittagsschlaf. Abends bei goldenem Sonnenuntergangsschein erreiche ich Lascabanes, wo ich in der Gite nachfrage, ob ich dort im Garten schlafen darf. Die Gite ist privat und ich darf sogar drinnen, auf 44 dem Fußboden schlafen. [8.6.]Wecke schon fünf Uhr auf und beschließe so zeitig loszugehen. Es fällt leicht, die Sachen zu packen und in den Sonnenaufgang zu wandern. Gleich am Weg ist eine kleine Kapelle. Weiter nach Montcuq mit dem Turm aus dem 12. Jahrhundert. und Montlauzun auf dem Berg, ein mittelalterliches Städtchen, aber noch ganz verschlafen, weil noch keine Saison ist. In der Kapelle St. Sernin du Bosc, neu restauriert und innen noch ganz leer und voller Harmonie, spiele ich Konzertina und finde ein neues Lied. Im Abendlicht unendliche Obstplantagen: Kirschen, Pflaumen, Kiwis, Wein, Nüsse. Frage bei einem Hof nach Wasser und werde kurz in den Hof eingeladen, wo ich Limo und Gebäck bekomme. Abends schlafe ich auf einer Wiese an einem Bauernhof. Am Abend lädt mich der Bauer ein, von seinen Kirschen so viel zu nehmen wie ich möchte. [9.6.] Ich bin wieder einmal von unendlichen Zweifeln hinund hergerissen,ob ich denn nun meine Konzertina weiter mitnehme oder mit der Post zurückschicke. Sie ist schon ganz schön schwer und macht den Rucksack auch nicht leichter. Ich scheine das mit dem einkaufen auch noch nicht so richtig unter Kontrolle zu haben: Manchmal kommt einfach ewig kein Laden und ich habe nichts zu essen. Um dem vorzubeugen und besonders vor Feiertagen kaufe ich dann für die nächsten Tage etwas mehr ein. Doch habe ich dann alles im Rucksack verstaut, vielleicht auch einmal die Zutaten für ein warmes Essen, will ich es so schnell als möglich wieder loswerden und esse schon, damit der Rucksack etwas leichter wird. Also: kleine Portionen kaufen. Doch das ist teuer und nicht üblich eher bekommt man ja die 45 Dreierpacks hinterhergeworfen und noch eins gratis dazu. Pilgerprobleme. Nun weiter: habe mir nach dem Aufstehen (die beiden bäuerlichen Hunde haben mir nichts angetan, waren eher schwanzwedelnd besorgt um mich) noch den Bauch mit den Kirschen vollgeschlagen und bin wieder vor Sonnenaufgang zur riesigen Ebene des Lot gezogen. Vorerst alles nur Ebene. Bis zum Horizont. Moissac- das ist eine riesige gotische Kirche mit angebautem Kloster einem Kreuzgang mit wunderschönen Säulenkapitellen. Im Office de Tourisme hole ich mir den Stempel, frage, was der Eintritt ins Kloster kostet. 15 Franc nein, danke. Doch beim Erzählen, wo ich herkomme, tun sich Türen auf und ich darf kostenlos hinein. Drinnen treffe ich eine Kulturreisegruppe aus Salzburg. Die Kirche ist riesig, aber häßlich, hat aber schöne figürliche Holzschnitzereien. Ich lasse mich vor dem Portal von einer holländischen Pilgerin fotografieren. Sie hat ein Muschelabzeichen am Rucksackriemen. Laufe am Kanal bis nach Malause, eine unendliche unveränderliche Strecke immer zwischen Kanal und Fluß. In Malause, an einer Bootsanlegestelle, dusche ich und esse. dabei lerne ich einen Bootseigner kennen, der einen Spatz füttert. Er ist Fernfahrer und hat sich vor einigen Jahren einen Bootsrumpf gekauft und sich selbst ei Haus darauf gebaut. Die Fenster sind aus einer Eisenbahn, ein uriger Motor soll das Boot vorwärtsbewegen, oben weht eine Fahne. Ich treffe zwei Holländer, wir wollen in Malause die Kirche (12. Jhdt.) besichtigen, aber die ist zu, dafür werden wir von des Nachbarn Bulldogge beschnuppert. Über Espalais geht´s nach Fluvillar, es fängt an zu regnen. Ich besichtige die Kirche St. Pierre, ehemals Benediktiner (12. Jhdt.). Drinnen ist es ganz dunkel, das Laub wird vom Sturm durch die Tür geweht. Dann schließt scih die Tür hinter mir und von drinen dringt leise gregorianische Musik an mein Ohr. Ich suche die Mönche, finde aber nur zwei Lautsprecher. 46 Dann kommt ein Mann die Kirche abschließen. Wo ich schlafen könnte, weiß er nicht. Vielleicht unter dem bemerkenswerten Rondell in der Mitte des Dorfes. Kaum bin ich dort kommt ein Mann aus der Mairie, dem Rathaus und fragt ob ich die Gite suche. Ich erkläre, dass ich kein Geld dazu habe, und auch irgendwo draußen schlafen kann, nur überdacht muß es halt sein - wegen dem Regen. Er gibt mir trotzdem den Schlüssel zur Gite. Ich merke, dass Gastfreundschaft heir sehr groß geschrieben wird, ich fühle mich von der Gemeinde als Ganzem eingeladen.In der Gite gibt´s Tajine. ist zwar mehr als ich Hunger habe, aber eine der wenigen warmen Mahlzeiten, und die genieße ich inmitten der anderen Pilger. Wasche meine Hose. [10.6.] Buah! Kalt und naß! Den ganzen Tag hat es geregnet. Nach der tollen Übernachtung bei draußen stürmendem Unwetter besichtige ich noch einmal die "Halle des grains". Es fängt mittags wieder an zu regnen, ich frage in der Gite in St. Antoine, ob ich mich solange es regnet etwas reinsetzen kann. Dann hört es nicht wieder auf zu regnen und ich bekomme ein warmes Mittagessen geschenkt. Die Wirtin hat auch den Kirchenschlüssel. Ich staune, wie bunt die Kirche ausgemalt ist. Irgendwann, als es einmal kurz weniger regnet, gehe ich weiter, anch flammarens und zwei weiteren unaussprechlichen Orten. Überall alte Burgen und Kirchen und hügelige Landschaft. Es wird immer hügeliger; die Pyrenäen kündigen sich wohl schon an. Ich freue mich, meine alten Bekannten wiederzusehen. Gleichzeitig bin ich aber auch traurig denn das heißt ja für mich, mein geliebtes Frankreich verlassen zu müssen. Und irgendwie geht alles ja auch schondem Ende der Reise zu. Es regnet in Strömen und ich bedaure, die vielen schönen Ecken hier nicht zeichnenen und fotografieren zu können und überall so schnell durchhuschen zu müssen. Ich will heute bis Lecture. Die dortige Gite ist aber voll, ich sehe alte Bekannte von gestern wieder. Schlafe auf dem Fußboden des Vorraums. Abends lerne ich einen Amerikaner kennen der sehr wortkarg ist, schnell Nüsse knabbert und den Weg verkehrt herum läuft. [11.6.] Überhaupt merke ich, dass viele Pilger den Weg allein laufen und gar nicht auf Konversation aus sind. So bin ich froh, dass ich Mai- Lille wiedertreffe. selbst heute, im Restaurant von Condom sitzt jeder Pilger separat an seinem eigenen Tisch. Mir ist unbeschreiblich zumute, als ich zum Salatessen an einen einzelnen Tisch plaziert werde und so zwischen Messer und Gabel geichwohl als Bestandteil des Restaurants drapiert werde. Also: morgens ging´s los mit Frühstück holen beim Bäcker, dann Richtung Condom. Wir laufen zu dritt, Mai-Lille und ihre Freundin Evelin. Wir haben wieder die Wahl. Diesmal präferiere ich den knöchelstauchenden Asphalt mit den wasserspritzenden Autos vor dem schlammtriefenden Weg im gelände. Ich treffe einen einsamen Pilger an der Straße. 47 In Condom beeindruckt die Größe der Kathedrale und die Leere der Straßen. Eine Gite gibt´s für 43 Franc, die leiste ich mir heute. Sie ist eim dritten Stock eines Schulgebäudes untergebracht, abends um acht kommt die Kassiererin. [12.6.] Es ist Pfingstmontag, ich stehe mit Mai- Lille und Evelin auf und gehe mit ihnen und der gesamten Pilgermannschaft los. Die Sonne scheint heute wieder, aber es wird nicht sehr heiß. In Dresden ist es da mit 45 Grad wärmer. Dem Tempo von Mai-Lille kann ich nicht den ganzen Tag folgen. Ich lasse mich zurückfallen und treffe Goorde aus Belgien, der mit einem Jugendlichen unterwegs ist. Wenn der Jugendliche namens Sebastian Santiago erreicht, wird er vom Jugendrichter von allen seinen Vergehen freigesprochen. Für das Pilgern bekommt Geert so sogar Geld, und das ist für den belgischen Staat sogar noch billiger als der Jugendknast. Wir passieren Montreal und erreichen 16 Uhr Eauze. Die Kirchen interessieren mich schon lange nicht mehr - ich bin zu voll von Eindrücken, möchte nur noch vorankommen und nun die Pyrenäen sehen und Spanien erreichen. Abends spielen wir auf einer Ausfallstraße neben unserem Schlafplatz das Kettengliederspiel und etwas Konzertina. Stefan macht sich fabelhaft als Konzertinaspieler. [13.06.] Gehen noch gemeinsam einkaufen, wenn man das so bezeichnen kann, mit gerade mal noch 70 Franc in der Tasche. Nach reichlichem Rundgang und Inerwägungziehung sämtlicher bekannter Überlebensstrategien entscheidet sich mein Unterbewußtsein für ein Kilo der billigsten weil wohlschmeckendsten Kekse und ein Pfund destogleicher Schokolade. Ich gehe nur kurz vor, weil Goorde und sein Kumpan sich die Entscheidung schwerer machen; das führt allerdings dazu, daß wir uns überhaupt nicht mehr wiedersehen. Mai- Lille hat mir gesagt, daß sich der, der sich auf dem Weg von jemandem verabschiedet, sich immer so verabschieden sollte, als ob man sich nie wiedersieht. Ist es im Leben nicht ähnlich? Im Laufe des Tages merke ich: irgend etwas fehlt mir. Aber was? Ich grübele und grübele und komme letztendlich darauf: mir fehlt die Motivation, irgend ein bestimmtes Ziel; etwas, worauf ich mich richtig freuen kann. Ich bin nun schon tagelang gelaufen, von einem Ort zum anderen, ständig in fremden Gefilden voll unruhigem Herzen und hohlem Geldbeutel. Das schlaucht. Und 48 gerade eben hier kommt mir ein Gedanke: ich sehe mal nach, was meine aufgeriebenen Kartenreste im Rucksack sagen. Bis hierher bin ich in Frankreich ermangels mitgebrachter Karten ja nur nach Gehör gelaufen und ich habe das Gefühl, das muß sich ändern. Ich krame also in meinen Utensilien und ziehe doch nicht wirklich eine Autokarte hervor, die meinen jetzigen Standort und die Pyrenäen auf einer Seite zeigen! Noch vier oder fünf Tage bis Roncesvalles, also bis zur Grenze! Ich bin überwältigt von der Vorstellung der Dimensionen der Wanderung. Die Distanzen schrumpfen in meinem Kopf mit jedem Schritt. Mit der unerhörten Langsamkeit des Vorwärtskommens und der Nähe zu den Ländern, in denen man wandert, verringert sich auch deren Fremdheit, das Gefühl der Ferne wird unbedeutender. Kontinuierlichkeit beherrscht den Alltag, und die unaufhörliche Veränderung der Orte, der Schlafplätze, der Menschen bewirkt, daß man sich immer mehr seinen Mittelpunkt in sich selbst sucht. Man kann sich an keinen Pfad gewöhnen, greift nicht täglich dieselbe Klinke seines Hauses, sieht keine bekannten Gesichter auf den Straßen der Stadt. Es ist kein beständiges Grübeln, kein Einsamkeitsgefühl, das da auftaucht, sondern ein Zuhausegefühl, das sich begrenzt auf die engen Umrisse des Körpers und der mitgeführten Sachen. Der Körper wird einerseits unverwundbarer, andererseits viel empfindlicher für die Schwingungen der Gefühle. Man nimmt die Gefühle viel tiefer wahr. Ich habe Träume auf dem Weg, wie ich vorher noch keine gehabt habe. Ich höre Musik aus mir herauskommen, pfeife und summe den ganzen Tag, sogar in der Stadt und in Geschäften. Musik, die mir unterwegs begegnet; und das ist meist handgemachte; gräbt sich sofort in das Gedächtnis ein und begleitet mich noch die folgenden Tage. Ich freue mich so auf die Pyrenäen, daß ich den ganzen Tag nur noch laufe, nehme hinter Nogaro eine Abkürzung Straße über Riscle. Ich merke gar nicht, daß ich durstig werde; beständig halte ich Ausschau, ob ich nicht schon die ersten Gebirgsspitzen sehe, doch nichts dergleichen; es ist düsig und in den nächsten Tagen wird diese Verschleierung der Ferne noch zunehmen. Ich soll die Pyrenäen nicht sehen; ich soll sie erwandern. Ja, ja. Plötzlich meldet sich mein Durst mit riesen Gewalt und mich zerrt´s zu einer Frau im Garten eines Hauses, damit beschäftigt, ihren Gartenschlauch aufzuwickeln. Ich rieche förmlich das Wasser. Sie, eine Rentnerin, füllt mir prompt meine Flasche, sagt, ich solle doch auch ihren Kirschbaum plündern, sie kann ihn nicht mehr ernten; und dann kommen wir zum Höhepunkt: wir kosten gemeinsam den berühmten Floc de Gascogne; einen Likör, gemischt aus ArmagnacLikör, Wein und Fruchtsaft. Ist unwiderstehlich lecker und nach fünf Gläsern liegen wir beide betrunken unter dem Kirschbaum. Eine Stunde später habe ich Durchfall und nicht mehr sehr viel Klopapier. Freudetrunken ob der Pyrenäennähe schlage ich abends mein Lager im Freien auf einem Feld auf. Die Welt ist so schön! Nachts wache ich mehrmals auf; einmal, weil ich großes Tier in der Nähe grast, eine andermal, weil es regnet. [14.6.] Ganz zerschlagen und müde wache ich zeitig auf, schalte die Asphaltdämpfer ein und wandere stundenlang an der Seite einer Bundesstraße. Lange finde ich den Weg nicht wieder, den ich gestern ob der Abkürzung verlassen hatte, dafür finde ich ein Portemonnaie mit einem Tagessatz; das heißt mit 27 Franc Cash. Das Portemonnaie ist auch nicht schlecht. Beides verschwindet in der Hosentasche und wird zu nützlichen Zwecken weiterverwendet. Noch immer sehe ich die Pyrenäen 49 nicht. Ich treffe zwei Pärchen Holländer, mit Schirm und Stock und Hut auf dem Jakobsweg unterwegs und einer, ein kräftiger Hüne mit gegerbter Haut auf der Nase, will mich schlagen, als ich behaupte, von Dresden aus den Jakobsweg zu laufen. Ich heule fürchterlich. In der nächsten Stadt, ziemlich unbedeutend, weil deren Namen vergessen, koche ich mir einen Pott Chili con Carne aus dem Supermarkt. Danach muß ich ganz oft pupsen. Am späten Nachmittag laufe ich weiter, getrieben von Pyrenäen - Sehnsucht, erreiche aber, wie ich es mir zuerst vorgenommen hatte, die Autobahn Pau- Tarbes noch nicht und suche mir einen Schlafplatz auf einem Berg, von dem aus ich morgen früh bei klarer Sicht die Pyrenäen sehen kann. Ich freue mich so auf den Augenblick. Jeden Moment werde ich auch im französischen Teil von meinem geliebten Baskenland sein - man merkt das schon an den Ortsnamen: Navarrenx, Ostarix, Asterix... Auch der Weg - der Königsweg - nähert sich einem Höhepunkt. Die Via Podensis, so von den Römern genannt wegen ihrem Beginn in Le Pu, vereinigt sich in Ostabat mit dem Weg aus Paris im Norden und mit dem Weg aus Vezelay. Dann kommt schon Sant Jean Pied de Port, die französische Grenzstadt und dann die Pyrenäen! Morgen werde ich sie sehen! Nur noch 50 Kilometer Luftlinie! [15.6.] Der Nebel ist so dicht, daß ich beim Aufwachen nicht einmal meine Füße klar sehe. Es ist sieben Uhr noch dunkel, alles ist voller Tau und ein unerhörter Geruch nach Land liegt in der Luft. Ich stapfe durch eine Traumlandschaft. Irgendwo da hinten sollen ja wirklich die Pyrenäen sein. Glaube ich. Der Weg geht durch Felder und einzelne Gehöfte. Alles in weiße Soße getaucht. Hunde schlagen in der Nähe an, Moorhühner geiern in der Ferne und die Nebelfeen schwingen sich summend durch das Geäst der mächtigen Bäume. Ich raste an einer Dorfschule und beobachte die morgendliche Anlieferung der zwölf Schüler. Was mag wohl in deren Kopf vorgehen? Ich stelle mir vor, allmorgendlich in einem kleinen wackeligen Bus in die Schule gekarrt zu werden, mit Pausenbrot und Silberbanane im Gepäck, hier in der tiefsten Provinz Südfrankreichs. Und dann sieht man auf einmal am Schuleingang einen verwahrlosten Pilger sitzen, der ein Kilo Kekse und ein Pfund Schokolade im Morgentau vertilgt. Was mag in deren Kopf vorgehen? Wer hier der Lehrer ist, erkennt man wie bei uns auch schon von weitem. Nach Morlanne und Arthez endlich die Autobahn. Wüster Krach, Schmutz, weggeworfene Autoreifen, wilde Urlaubsgedanken der fahrenden Urlauber dringen ebenso zur Brücke hoch wie wüste Arbeitsgedanken der fahrenden berufstätigen Bevölkerung. Ich stehe eine Weile über der Bahn. Was mag die Leute da unten, die heraufwinkenden, bewegen? Warum fahren sie? Wo fahren sie hin? Fahren sie um des Fahrens willen oder weil sie kein schönes Zuhause haben? Lauter quälende Pilgerfragen. Fahren Sieh da- ich drück auf die Tube, weil ich vorwärts will. wohin steht auf einem anderen Blatt. Hier ist es nicht. Mal sehen, ob es dort ist. Wenn ich fahre, muß ich nicht hier sein und warten, daß ich werde. Jedenfalls markiert für mich die Autobahn eine Grenze, die ich zu überwinden habe, bis ich wirklich vor den Pyrenäen stehe. Nun sind die Pyrenäen ja wahrhaftig nicht mehr hinter der Autobahn, sondern sie liegen buchstäblich vor mir. Ich kann es kaum glauben. Ich will ja gar nicht so oft von den Pyrenäen reden. Wenn ich sie nur sehen könnte! In Lacq sitzen junge Frauen auf der Straße und fangen Pilger weg. Eine fragt mich mit ziemlich unverständlichen Fragen aus. Ich verstehe nicht viel. Die Frau ist schön. Sie gibt mir einen Kaffee. Sie gibt mir eine belegte Stulle. Die Frau ist immer noch schön. Und die Frau ist politisch aktiv. Sie hat ein riesiges Transparent ans Haus gehängt, auf dem sie den Bürgermeister doof findet und die Politiker korrupt. Aber schön ist sie, die Frau. Ein Mann sitzt auch bei den beiden. Er heißt Teyn und ist der lange Niederländer, der mich bis ans Ende des Weges immer wiedertreffen wird (Aber wir wollen hier noch 50 nicht verraten, was ich alles noch über die Zukunft weiß). Teyn hat 13 Wochen frei bekommen, arbeitet in der Regierung und ist für Geldgeschäfte verantwortlich, was man ihm gar nicht ansieht. Er kommt von Holland herunter und hat den Norden Frankreichs, die Normandie, Paris, Vezelay und Le Puy durchstreift und geht nun ebenso nach Santiago. Um achtzehn Uhr drei sehe ich zum ersten Mal die Pyrenäen! Wir laufen den Abend gemeinsam bis Navarrenx, wo er die kommunale Gite aufsucht und ich mich zum angeblichen Kloster führen lasse, das sich als das verwunschene Pfarrhaus herausstellt. Ein kleiner Pfarrer sieht mich von oben bis unten an, dann führt er mich durch dunkle verwunschene Zimmer mit wehenden Gardinen und versteckten Schreien hinter den Schränken in ein großes grünes Gemach und bedeutet mir, den Rucksack abzulegen und speisen zu kommen. Meinem Rucksack ist nicht wohl, er ruft: "Laß mich nicht allein! laß mich nicht allein!" Der Priester faßt mich am Arm, ruckartig fliegen wir in die Höhe, umkreisen das Pfarrhaus inmitten einer Schar krächzender schwarzer Raben, senken uns herab in ein großes Zimmer voller Gesottenem und Gebratenem, daß mir förmlich das Wasser im Munde zusammenläuft. An einem Tisch in der Mitte sitzen vier gebadete und gespeiste Herrschaften aus einer anderen Welt, die auch den Jakobsweg laufen. Sie bieten mir einen Platz an, der Pfarrer herrscht mich kreischend an, die Suppe zu essen und von dem Gesottenen und Gebratenen zu kosten. Ich habe keinen Hunger. Ich will schlafen, es ist schon spät. Ich schlafe mit einer älteren Dame auf dem Zimmer, die mir lachend zuraunt: "Na, na, junger Mann, passen sie bloß auf! Na sie wissen schon!" da sehe ich sie wieder, die blutrünstigen Fratzen hinter dem Fenstervorhang! Sie verziehen ihre Gesichter zu fürchterlichen Grimassen. Es wird dunkler und dunkler. Dann schlafe ich ein... [16.6.] Sieben werde ich wach, die Sonne lacht ins Fenster hinein, der Spuk ist einschließlich der älteren Dame aus dem Zimmer verschwunden und ich kann mein Tagwerk beginnen. Ich will noch einkaufen, deshalb bin ich so spät aufgestanden. Um mich vom Pfarrer zu verabschieden, gehe ich hinunter in die Küche und entdecke die Reste des Frühstücks und ein für mich vorbereitetes Gedeck. Eine freundliche sonnige Fee bittet mich, Platz zu nehmen und das Frühstück zu genießen. Ich darf nehmen, wieviel ich will. Baguettes sind da, Marmeladen, Schokolade, Joghurt, Butter (welch Rarität für einen Pilger!). Doch außer der halbdurchsichtigen Fee ist niemand weiter im Haus und so mache ich noch den Abwasch und sehe mir die Küche an, wo noch viele leckere Sachen stehen. Dann gehe ich. Puh! Ich sehe heute den ganzen Tag die Berge. Als Kulisse zwar und mir scheint es, als ob ich ihnen gar nicht näherkomme, teilweise entfernt sich der Weg von ihnen und schlägt wilde Bögen, aber der Anblick erwärmt mein Herz und hebt meinen Kopf und macht mich zum König des Tages, so wohl fühle ich mich. Berge haben etwas unerhört energievolles. Man muß sie nur ansehen und schon fühlt man sich erhaben. Es ist, als ob man sich ihrer Größe gleichsetzt, unverwundbar wird und alle Dinge von oben betrachten kann. Ich spüre gar nicht, wenn der Weg steil nach oben geht, denn oben angekommen, bietet sich ein wahrer 51 Augenschmaus: Pyrenäen, Pyrenäen, Pyrenäen, soweit das Auge reicht! der Weg ist ein Stück weit sehr schlecht, wenn überhaupt markiert. gelbe Fetzen und Papierzipfelchen soll man deuten, was mir nicht immer gelingt und mich so auf einen kleinen Umweg begebe, den ich natürlich wieder zurücklaufen muß. Ich bin jetzt im Baskenland, wo Guten Tag "Aguch" heißt und alle Schilder zweisprachig geschrieben sind, wobei die Baskische Schrift lustige blockige Lettern mit Verdickungen an den Enden verwendet. Die Schrift und die Sprache ist wie Musik. Baskisch soll mit dem Ungarischen und dem Finnischen verwandt sein, aber so richtig glaubt keiner daran, ich glaube, es ist eher die Faszination und die Exotik dieser drei Sprachen, die die Wissenschaftler dazu gebracht hat, sie in eine Sprachfamilie zu fassen. Die Basken kämpfen für ihre Unabhängigkeit; sie haben einen Teil ihres Landes in Frankreich und einen Teil in Spanien. Vor allem bekannt ist die ETA für ihre unschöne Art, Wünsche zu äußern. Während meiner Zeit in Spanien erschütterten zwei Terroranschläge das gesamte spanische Land. Nach einigen Kilometern treffe ich die Leute wieder, die mit mir im Pfarrhaus übernachtet hatten. Sie rasten in einem drolligen Waldstück, in dem lange Leitern an hohen Bäumen lehnen. In schwindelerregender Höhe thront über den Wipfeln ein Baumhaus und Unmengen Kisten, Stangen und anderer Gerätschaften bevölkern den Waldboden. "Für die Vogeljagd", wird mir gesagt. Aha. Es ist extrem heiß, keine Wolke am Himmel, der Weg geht bergauf und bergab. Ich frage eine Frau,bei der ich um Wasser bitte und sie in ihrer Küche total erschrecke, wie weit es denn noch bis Ostabat sei. Oh! Sagt sie und schlägt ihre Hände über dem Kopf zusammen - bestimmt vierzig Kilometer! Einen Kilometer weiter spricht ein Mann nur noch von zwanzig. Wegen der schlechten Beschilderung verirre ich mich, dann kommt plötzlich eine neue Art von Wegweisern: große Steine mit Muscheln beklebt und einem großen Plastikpfeil. Nun häufen sich die verschiedensten Wegezeichen, auf einmal stehe ich vor einem riesigen Wegweiser: "Stele von Gibraltar 1h30 und Ostabat 2h30". Ich bin wie geschockt, denn nun nähere ich mich einem wichtigen Ort; dem Vereinigungspunkt der drei großen Wege; und das viel schneller als gedacht. Wege verbinden sich hier und Schicksale. Gemeinsam sind nun die Pilgerströme auf dem Hauptjakobsweg durch Spanien gezogen. Gleichzeitig ist dieser Ort ein Symbol für den zaghaften Beginn der europäischen Vereinigung, die in den Begegnungen der Pilgerer wachsen konnte. Ich laufe an der Stele vorbei und wundere mich nur, daß ein Wegweiser die Stele in rückwärtiger Richtung anzeigt. Sie ist unscheinbar und liegt in einem Dorf abseits des Weges auf einem kleinen Platz. Ich setze mich an die Stele und lasse meine Gedanken fliegen. Tausende und Abertausende von Menschen haben hier ihre Schritte hinterlassen, sind aufgebrochen aus der vertrauten Umgebung; und das Jahr für Jahr, tausende von Jahren. Die Bewohner an den Jakobswegen können erzählen, daß täglich Pilger vorbeikommen. Es sind keine Scharen, aber es vergeht kaum ein Tag ohne einen 52 Wanderer, der seine Gedanken, sein Leben mit sich führt, gestiefelt und gerüstet ist und vorwärts geht. Was bewegt die Menschen, ihre Heimat für eine Zeitlang zu verlassen. Ich schweife ins Mittelalter zurück und stelle mir vor, wie unendlich schwieriger die Reise damals war. Ständig von der Gefahr eines Überfalls oder Raubes bedroht, in fernen Ländern mit exotischen Sitten und hunderten von Währungssystemen. Der damalige Pilgerer hatte keinen Schlafsack und keine Isomatte, sondern nur einen schweren filzernen Mantel. Dafür aber brauchte er keinen schweren Rucksack schleppen, sondern er hatte nur eine kleine Tasche an der Seite und eine Trinkflasche aus einem Kürbis, die Kalebasse. Zwei Kilometer führt nun ein steiniger Weg nach oben auf einen Berg mit Kapelle, wo es wieder Wasser gibt und ich den letzten Rest Baguette und den inzwischen zerlaufenen Käse, den ich mittags an der Tankstelle gekauft hatte, esse. Durch einen knorrigen Eichenwald geht's hinab nach Ostabat, dem Ort mit der ersten gemeinsamen Kirche für alle drei Wege. Es ist schon Abend und ich bin froh, an der Gite angekommen zu sein, stelle meinen Rucksack hinein und will noch was zu Essen kaufen. Ich begrüße die anderen, alles Radler, die am Tisch sitzen und das vom Wirt servierte Abendbrot genießen. Ich will mich nur etwas duschen, aber zuvor muß ich etwas essen, mein Magen zieht sich zusammen beim Anblick der essenden Leute. Als ich vom Einkauf zurückkomme, ist der Besitzer der Gite da, es stellt sich heraus, es ist eine private Gite und ich muß die Gefilde verlassen oder echt Geld bezahlen. Im Ort soll es eine öffentliche Dusche geben. Die Reinemachfrauen in der Kirche wissen von nichts, dann kommt mir eine hintergergelaufen und sagt, im Rathaus wäre so etwas. Und tatsächlich findet sich in den öffentlichen Toiletten auch eine Dusche. Es ist neun, als ich Ostabat verlasse. Ich treffe auf dem Marktplatz Teyn, den langen Holländer noch einmal. Er muß morgen bis zehn Uhr (es ist Samstag) in Sant Jean Pied de Port sein, um seine postlagernde Post abzuholen. Er rast ebenfalls. Der Abend ist vorzüglich zum Wandern geeignet. Die Luft ist lauer, die Sonne scheint milder, die Berge werden im Abendrot imposanter. Durch den Wald zu gehen wird geheimnisvoll; alles beginnt zu rascheln und zu surren, zu grunzen und zu ächzen. Auf halber Höhe über der Strasse bildet der Weg eine kleine Anhöhe; dort lege ich mich schlafen; direkt auf dem Weg. [17.6.] Damit keiner über mich stolpert, stehe ich zeitig auf und wandere noch vor dem Sonnenaufgang los. Überall glitzert der Tau auf den Gräsern und wird in den ersten Sonnenstrahlen zu goldenen Fäden. In den Tälern ballen sich Nebelwolken und machen die Gebirgsniederungen zu einem Gemälde von beeindruckender Pracht und Vollkommenheit. Es ist, als ob man keinerlei körperliche Bedürfnisse hat zu dieser Stunde. Man ist befreit von Zwängen, atmet den Morgenduft ein, schaut und geht. Es ist eine Durchlüftung der Seele. Nachzudenken habe ich schon lange aufgehört; ich lebe nur noch den Tag. Alle Sorgen, alle Probleme habe ich ausreichend zerkaut in den ersten Tagen und nun bin ich wirklich frei, bei mir und im Heute zu sein. Es ist ein einmaliges Gefühl und ich glaube, man kann es nicht oft haben. Den ganze 53 Morgen über sehe ich keine anderen Pilger. Gegen neun erreiche ich das liebliche kleine Städtchen St. Jean Pied de Port, das mich zuerst mit einer Stadtmauer inklusive Jakobstor begrüßt, durch das ich gehe und urplötzlich in einer engen alten Gasse bin mit Trödel-, Kram- und Ramschläden. Vom Pilgerbüro werde ich förmlich abgefangen. Ich bekomme einen Kaffee serviert, erhalte Informationen über den Paß über die Pyrenäen nach Roncesvalles und meinen Pilgerausweis, den "Credencial", der mich von nun an vor allen Gefahren staatlicher und menschlicher Mächte schützen wird, mir den Eintritt in die spanischen Pilgerherbergen ermöglichen, Unmengen von Stempeln aufnehmen wird und mich obendrein mit Weisheit ausstatten. Der erste Stempel mit einem Pilgerer vor einem hohen Berg und dem Wappen von St. Jean bekommt den handgeschriebenen Zusatz "Bon chemin!" - "Guten Weg!", der Gruß, den ich nun schon auswendig kann. Ich bekomme meinen Credencial geschenkt. Nun sind es noch 35 Tage bis Compostella, oder 764 Kilometer. Ich tausche spanische Peseten ein und kaufe für das Wochenende ein, dann ziehts mich raus aus der Stadt, hinein in die Berge. Trotz größter Mittagshitze steige ich los; es hält mich nichts mehr, ich will in mein geliebtes Spanien! Gleich meine erste Begegnung ist exotisch: eine Familie aus dem fernen Mexiko ist unterwegs nach Santiago und hat heute mit dem wandern begonnen. Man sieht ihnen den Schweiß des Beginns an; der Berg ist steil, die Sonne steht hoch im Zenit. Der Paß nimmt den Napoleonischen Weg, führt immer weiter in den Himmel, läßt die Baumgrenze hinter sich und schlängelt ich durch offenes Wiesenland an Felsen vorbei; Berggipfeln, die sich mächtig ins Zeug gelegt haben. Mit stolz erhobenen zerschrundenen Köpfen verkünden sie ihre Königswürde und setzen die I-Punkte auf eine Kulisse, die sich aus den Augen direkt in mein begieriges Herz schlägt. Ich kann mich nicht sattsehen an der Majestät, an der Weite, an der Größe der Gipfel. Hier ist die Welt aufgehangen. Alles, was unten ist, muß sich dem fügen, was hier oben beschlossen wird. Hier ist der Hort der Welt. Ich bin nur Gast, gehöre nicht dazu. Aber ich darf schauen und den Wind fühlen und darf mitnehmen, was meine Sinne aufnehmen können. Mein Trinkwasser geht langsam zur Neige, ich habe schon alles Wasser, was ich in mir drin habe, herausgeschwitzt und brauche nun dringend Nachschub, doch der angekündigte Rolandbrunnen läßt auf sich warten. Bergkuppe um Bergkuppe eröffnet Ausblicke auf weitere Teilstücke des Weges, doch kein Brunnen kommt in Sicht. Dann plötzlich ein Wald und - der Brunnen: eine klare Quelle sprudelt quecksilbernes Wasser. Kleine Umpfen springen im Wasserstrahl umher und kichern. Als ich trinke, sind sie husch- verschwunden und man hört sie tief im Bergesinnern, am Ursprung der Quelle, lachen und quietschen ob des Wanderers, den sie mit ihrem Wasser erfrischen können. Vom Gekicher und vom Wasser angelockt, kommen zwei Brasilianer angeradelt, die mich mit ihren Rädern noch bis hinter Pamplona begleiten werden. Sie haben lustige Wasserschläuche auf ihrem Rücken, mit einem Schlauch, der direkt zum Mund führt. Ob sich da auch ein paar 54 kleinere Umpfen drin versteckt haben? Es kichert so merkwürdig... Bis auf 1.057 Meter haben die Riesen den Paß schaufeln können, dann hat sie die Macht des Himmels aufgehalten. Abends neun Uhr stehe ich auf dieser Höhe und sehe zum ersten Mal, weil steil abfallend, die spanische Seite. 55 Riesige Wälder und Hochebenen bis zum Horizont, vollkommen anders als die französische Seite. Spanien! Habe ich also doch unbemerkt das Land gewechselt! Hinter der Rolandquelle stand nämlich ein Stein, eine unscheinbarer, mit der Aufschrift" Navarra", und dieser Stein also war die spanische Landesgrenze. Unerhört, wie einfach es geworden ist, eine Grenze zu passieren. Das darf es doch nicht geben! brummelt mein ostdeutsches Gedächtnis. Ich sage: Still! Und setze mich in Bewegung: bergab! der Eichenwald nimmt mich für eine düstere Stunde in sich auf und spukt mich erst in Roncesvalles, am Kloster, wieder aus, nachdem er mir gezeigt hat, wie Mäuse huschen, Schlangen kriechen, Eichhörnchen klettern und Spinnen sich in den Haaren verfitzen. Es ist dunkel, das Kloster liegt mit seinen riesigen Gebäuden breit vor mir. Es hebt seine Schwere durch einen wunderbaren Turm auf, der seinen Finger in den Himmel reckt und auf die Sterne zeigt, auf die Milchstraße, die uns Pilgerern den Weg in den Westen zeigt. Die erste spanische Herberge ist ein Überfall auf mich. Durch mehrere Etagen voller Betten muß ich mich kämpfen, um das letzte von 80 Betten zu erhaschen, muß mich mit spanischsprechenden Leuten herumschlagen, mein eben gelerntes Französisch noch im Kopf. Es gibt nur drei Duschen mit kaltem Wasser, keinen Platz zum Handtuchhinhängen, Stimmengewirr. Der Herbergsvater taut auf, als ich ihm von meiner Begeisterung für Navarra, die baskische Musik und insbesondere die Gruppe "Oskorri" erzähle. Dann zehn Uhr Nachtruhe, völlig unpassend für spanische Klima- und Lebensverhältnisse. In der sogenannten Nachtruhe werden Bäume umgesägt, Teenager atmen ihren Angstschweiß und Fußgeruch aus, Matten und Betten knarren und ächzen ob ihrer täglichen Last. Überall schlafendes Mensch. So fürchterlich, daß auch ich bald einschlafe. [18.6.] Um fünf Uhr wird auf einmal alles wach. Rucksäcke werden komplett aus- und wieder eingepackt, Schuhe geschnürt und Hosen gewechselt. Ich kann beidem Durcheinander nicht mehr schlafen, stehe auf, packe meinen Schlafsack zusammen und verlasse das Haus als erster. Draußen ist es noch dunkel, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, finde die Wegezeichen fast nicht und tappe und stolpere über Äste und Steine. Der Weg ist hier völlig anders: Man stelle sich inmitten eines Waldes einen mit weißem Kies beschütteten, einsachtzig breiten eingeebneten Weg vor. Aller Ecken große Hinweisschilder aus Beton. Alles tut mir weh. Ich bin geneigt, abseits der Schneise im Wald zu laufen. Später am Tag wird der Weg noch schlimmer: Mit EU- Fördermitteln wurden zementierte Schneisen in den Wald geschlagen, mit Steinplattenimitation. Man spürt, wie die Vegetation an den Wegesrändern ächzt und stöhnt und ums Überleben kämpft. Aber das alles ist nicht aufzuwiegen gegen meine Freunde, im geliebten Navarra zu sein. Die ersten zwei Dörfer, die ich im Morgendunkel passiere, sind Burguete und Espinal und es verbinden sich wunderbare Erinnerungen mit diesen Orten. Vor zehn Jahren, als ich arbeitslos wurde und des Arbeitslossein satt wurde, arbeitete ich einen Monat in Karlsruhe und trampte von dem verdienten Geld bis Spanien und erlebte hier meine 56 erste Fiesta. Man kann sich vorstellen, welch einen Eindruck die spanische Lebenslust und Feierfreude auf einen ungebildeten jungen Ostdeutschen gemacht hat. Die ganze Nacht waren wir damals unterwegs und mich beschleicht eine starke Lust, das wiederzuhaben. Ich suche die Stellen, an die ich mich erinnere: die Turnhalle, wo die spanische Band gespielt hatte, das Haus, wo wir das zehnte Bier getrunken hatten...Aber alles sieht am Morgen nüchtern aus, still, abwartend. Fiesta ist hier wieder in zehn Tagen, erfahre ich. Soll ich warten? Aber ich spüre: Das geht nicht, ich kann nicht stillstehen, meine Beine und mein Geist erlauben das nicht. Ich bin unterwegs und alles in mir ist auf diese Tatsache ausgerichtet. Wenn ich an dieser Stelle gewußt hätte, wieviele Fiestas... Aber wir wollen nicht vorgreifen und woher soll ich denn überhaupt wissen, was in der Zukunft geschieht? Ich bin doch nur der Schreiber und kann nur wortgetreu wiedergeben, was erlebt wurde. Die Zukunft geht mich nichts an. Wollen wir doch mal schön dabei bleiben! es wird hell und nach meiner ersten Frühstücksrast haben sie mich ein: gruppenweise erscheinen sie, mit Pilgerabzeichen und Pfadfinderrucksäcken und bunten Tüchern und überlangen Pilgerstäben schreiten sie bedeutsam den geschotterten Weg entlang. Ein Abenteuer beginnt. Ich bin auf dem Camino de Santiago! Zu beiden Seiten der Bundesstraße schlägt sich der Weg durch den Wald und passiert trutzige Dörfer mit der typischen Granitquaderarchitektur. Viele Häuser sind weiß gestrichen und haben in der Mitte der Stirnseite ein großes hölzernes Eingangstor. Überall Blumen und der Geruch nach frischgemolkenen Kühen (kann man das riechen?). Dann höre ich in weiter Ferne Musik. Sie kommt aus dem Dörfchen Zubiri, etwas abseits des Weges. Über eine alte buckelige Steinbrücke kommt man direkt auf den Marktplatz, der voller Menschen, voller Geruch und voller Musik ist. Kinder tanzen in Trachten den Trachtentanz, klatschen sich auf die Schenkel, drehen sich, werfen bunte Bänder, wickeln sich in die Bänder ein und wieder aus und die Großen freuen sich über die Kleinen. Das Publikum wandert mit den Schatten, die die Häuser werfen, mit, den die Sonne brutzelt vom Himmel. Dann tritt Udo Pustefix auf. Er stemmt Gewichte von 250 Kilo und alle feuern ihn an. Stolz stemmt er seine Arme in die Seiten und präsentiert die "Airtel"- Reklame auf seinem ledergepanzerten Wanst. Dann werfen seine Kollegen, schmächtige Kerlchen im Vergleich zu ihm, mit einer Mistgabel Strohballen über eine Latte, die immer höhergestellt wird. Das dauert ca. zwei Stunden, ist aber voller Lokalkolorit, denn das Stroh weht schon in Flocken über den Marktplatz. Dazu gibt's Maisfladen mit Bratwurst und Blasmusik. Die Blaskapelle sind lauter junge Männer, die mit einer Begeisterung Blasmusik machen, wie man sie in Deutschland sich im schönsten Dirndlfilm nicht vorstellen kann. Die Musik ist aktuell und wird aus vollster Seele gespielt und dadurch gewinnt sie an Charme, wird mitreißend und lebendig. Ich bin so glücklich - ich habe mein Navarra wieder! Hier kann man sein, wie man ist. Man stellt sich einfach dazu und schon ist man dabei. Man spricht fremde Leute an und wird angesprochen; keiner legt Wert auf das Äußere. Es tut so gut. Ich würde gern hier bleiben. Aber die Fiesta trudelt so langsam aus und ich gehe weiter Richtung Pamplona. An einem Brunnen lerne ich Josephina kennen. An einem Brunnen sprechen wir uns das erste Mal an, nachdem wir uns laufend begegnet sind; und siehe da, die spanische Sprache kommt ins Rollen. Wir gehen zusammen bis Arre, wo sie in der Pension übernachtet. 500 Peseten will der Besitzer haben; das ist zwar verdammt wenig, aber für mich doch mehr als der halbe Tagessatz. Eine Deutsche treffe ich in der Herberge und wir setzen uns ein bißchen vor den Eingang. Anglika ist von Konstanz am Bodensee losgelaufen, schläft nur in Herbergen und läßt sich viel Zeit. Sie bleibt in den Herbergen, die sie nachmittags erreicht, während ich noch bis abends durchlaufe. Sie hat auf diese Weise viel Zeit, Leute kennenzulernen. Ich komme mir vor wie ein Hochleistungssportler, der mit 57 ärmlichen Mitteln dem Ziele zujagt und nicht rechts und links guckt. Aber dem ist ja nicht so, ich habe einfach einen anderen Wanderstil drauf: sich durchschlagen wie die alten Pilger, mit wenig Geld, ohne zu wissen, wo man die nächste Nacht verbringen wird. Heute abend sitze ich im Park von Arres, einer Stadt, die mit Pamplona ein einziges zusammenhängendes Häusermeer bildet. Ich überlege, wo ich schlafen werde. Überall laufen Hunde mit Herrchen herum, sitzen Leute. Es ist nicht ruhig hier, aber ich werde auch kein besseres Plätzchen finden. Wozu tue ich das alles? Meine Sachen sind total ausgeblichen und aufgerieben, ich bin müde und kann noch nicht schlafen. Ich fühle mich hier im Stadtpark wie ein Landstreicher. Noch 700 Kilometer. Ich will nach Hause. Doch so ist das Pilgerleben: man geht weiter, man kann nicht einfach stehenbleiben. Morgen sehen wir weiter. [19.6.] Ein verrückter Tag. Konnte lange nicht einschlafen, weil immer wieder Hunde mit Menschen kamen. Doch irgendwann habe ich mir dann doch gesagt: laß sie kommen und gehen und schlafe einfach. Gegen sechs Uhr werde ich wach, noch vor Sonnenaufgang laufe ich los durch die leeren hohen Straßenschluchten von Arre. Einzelne Menschen gehen durch die Stadt, aber längst nicht so viele wie in Deutschland um diese Zeit. Pamplona erreicht der Jakobsweg von hinten: Durch Parks, über eine mittelalterliche Steinbrücke, eine Rampe zur Stadtmauer hinauf und durch ein wappengeschmücktes Portal gelange ich in eine verträumte Stadt mit engen Gassen. In einigen Tagen wird sie völlig verwandelt sein: wenn zu San Fermin Stiere durch die Straßen getrieben werden und über Menschen rennen und jedes Jahr einige Schwerverletzte oder Tote produzieren. Ernest Hemingway hat hier seine "Fiesta" geschrieben. Doch jetzt erwacht die Stadt nur zögerlich aus ihrer nächtlichen Trance, ein Laden nach dem anderen öffnet, die Tauben umgurren den einsamen Zeitungsverkäufer auf der Straße. Der letzte Schmutz wird weggespült. Doch man spürt die Menschen, die hier wohnen. Sie haben Paläste gebaut, mit Cafes und Balustradengängen, Parks in der Stadt angelegt und viele Blumen. Die Architektur atmet einen großherzigen, starken Geist. Schon einige Tage beobachte ich argwöhnisch meine Sandalen. Die Sohle der linken ist in Auflösung begriffen und ich glaube, daß es nun höchste Zeit ist, ein paar neue Schuhe zu kaufen. Günstige Gelegenheit, hier in der Großstadt. Ein Schuhmacher lehnt ab, die alten zu reparieren. In einem Laden finde ich für 18 Mark ein paar gute weich gefederte Sandalen. Die müssen bis Santiago halten; macht zweikommafünf Pfennige pro Kilometer. Wie werden das schon schaffen! Trotz die Stadt riesig ist, ist man, geleitet von großen blauen Hinweistafeln, schnell wieder draußen. Im zentralen Empfangsgebäude des Campus gibt`s den Pilgerstempel. Eine mittelalterliche Anlage wurde hier mit modernster Technik ausgerüstet und liegt inmitten einer grünen Oase: die Universität von Navarra. Auf halber Höhe zu einem Bergübergang steht eine kleine romanische Kirche; in ihr sind hinter spanische Wände spanische Pilgerbetten gestellt. Ich treffe eine Gruppe Brasilianer wieder, spiele Konzertina und auf einmal kommt denen doch nicht etwa der Einfall, zur Musik zu tanzen! es ist wunderbar, immer wieder bekannte Gesichter wiederzutreffen. Man freut sich miteinander und trotzdem geht jeder seinen eigenen Weg weiter. Die Sonne brennt ihre Ansichten in meinen Nacken, ich stapfe wacker durch Dörfer den Hang hinauf, dahin, wo eine Unzahl von Windrädern die Luft umrührt. Aber hier, wo ich bin , weht kein Lüftchen. 58 Oben angekommen, haut es mich fast um. Eine steife Brise kitzelt meinen Bauchnabel und bringt die metallene Plastik zum Summen. Ein Blick zurück auf das Land der tapferen Leute von Navarra. Im letzten Ort vor Puenta la Reina liegen vier erschöpfte Pilger im Schatten einer riesigen Kirche, die viel zu groß für das kleine Dörfchen ist, in dessen Mittelpunkt sie gesetzt wurde. Wie die meisten anderen Kirchen am Weg auch, ist sie verschlossen und nur durch den glücklichen Umstand der Annäherung einer Reisegruppe mit schlüsselgewaltiger Führerin gelange ich ins Innere. Die Reisegruppe verteilt sich, ich setze mich in die hinterste Bank und lasse das allgewaltige Innere auf mich wirken. Kirchen sind Ideenbauwerke. Mich fasziniert ihr atmendes Inneres. Es hat eine Seele, es dissoniert mit der eigenen Seele. Licht fällt aus den hohen Seitenfenstern hinein und macht das Gold glitzern, den Staub sichtbar und die Zeit stillstehn. Die Touristen lassen einen Schwall von mir unbekannten Worten über sich ergehen, schauen hierhin und dorthin, sehr geordnet. Einigen alten Männern ist es unschwer anzumerken, daß sie sich distanzieren wollen. Sie sitzen kurz vor mir und versichern sich verschwörerisch ihrer Haltung. Die Kirche wirkt. Sie summt die Zeiten in Moll, sogar die Augen vermögen den tiefen Klang zu hören. Der Klang geht weiter zurück als die sichtbaren Bestandteile des Gebäudes: tief unter der Stätte verborgen sind die Urgründe der Kirche. Oft wurden Kirchen an Stellen gebaut, die ein heidnisches, keltisches Heiligtum waren. Ideen in Stein gehauen. Ein Däne und eine Neuseeländerin wandeln nach Puenta La Reina, sie sind völlig in ihr Gespräch vertieft, merken gar nicht, wie sie schon siebzehn Zentimeter über dem Erdboden schweben. Sie strahlen. Sie fühlen ihre Rucksäcke nicht. Sie fühlen nicht die Entfernung ihrer beiden Heimaten. Ich summe vorbei. Puenta La Reina. Die Brücke der Königin. Eine Stadt, dahingestreckt zu beiden Seiten einer engen Gasse. Der Ort, an dem sich der andere Weg, vom Somport-Paß kommend, mit dem Hauptweg verbindet. Gleich zu 59 Beginn des historischen Zentrums liegt die Herberge; ein buntleuchtender Flickenteppich frisch gewaschener Wäsche auf einem Rasenstück kündet von der Anwesenheit einer großen Menge von Pilgern. Es zieht mich weiter. Ich will heute mal keine Socken riechen. Wieder ist dieselbe Reisegruppe da und öffnet mir die Türen. Zum Dank spiele ich mein gefundenes Kapellenstück. Es hallt in der Kathedrale. An der Seite sehe ich eine geschnitzte Jakobsfigur. Jakobus guckt ganz nachdenklich. An der Brücke am Ende der Stadt sitze ich und träume in den Abend werdenden Himmel hinein. Wie ein alter grauer Katzenbuckel liegt die Brücke vor mir; die Brücke, über welche die Pilgerströme zum ersten Mal vollkommen vereinigt gehen. Der Bus schluckt seine Touristen und ich mache mich auf den Weg in den Abend hinein. Das sind die schönsten Stunden des Tages. Ein Spanier fragt mich besorgt, wo ich denn nächtigen will. Ja, wie soll ich ihm das denn erklären? Ich tanze den Weg in den Himmel hinein und da wird ein Bett sein, und da wird ein Bett sein... [20.6.] Es geht heute durch eine traumhafte Landschaft. Hügel und am Horizont hohe Berge; Kornfelder und Olivenhaine, kleine Dörfer mit geschlossenen Fensterläden und geöffneten und vollgestopften Tante- EmmaLäden. Das ganz besondere aber an dieser so andersartigen, wunderschönen und dörflichen Landschaft aber ist, daß alle Ansiedlungen gekrönt werden von Kirchen und Klöstern und uralten Gemäuern, die Geschichte atmen und so malerisch sind, als wären sie aus Italien geborgt. Obgleich überall Trockenheit herrscht, sprudeln in allen Dörfern Brunnen und Quellen; in Villamayor befindet sich am Ortseingang eine ganz besondere Quelle: ein mittelalterliches Brunnenhaus, an einer Seite offen. Über eine Treppe, die das gesamte Innere ausfüllt, gelangt man zur Wasserstelle tief unten. Der beständige warme Wind läßt einen sich fast durchsichtig fühlen. Es ist warm, aber ich schwitze nicht. Ein komischer Zustand, der zu Kopfe steigt. Wieder gehe ich abends weiter, aber es ist diesmal ein nicht enden wollender Weg zwischen Kornfeldern hindurch, in der Ferne Berge und ein immer nachdrücklicher mahnender Sonnenuntergang. Ich bereite mir ein Fleckchen im Schutze eines großen Strohballens, ein Lager aus Stroh, mit Krabbelkäfern, mit Sonnenuntergang und mit viel freier Natur. Als es finster ist, sehe ich keine einzige Lampe weit und breit. [21.6.] Im ersten Dorf, das wieder durch seine riesige Kirche besticht, gehe ich zur Herberge wegen Stempelns und lerne da einen Belgier kennen, der jedes Jahr 60 achtzig Tage lang den Camino geht und nun 15 Tage lang als freiwilliger Helfer in der Herberge arbeitet. Das kann übrigens jedermann tun, aber für mindestens 15 Tage. In Torres del Rio (Türme am Fluß, nicht Stiere in Rio) lerne ich eine Italienerin kennen, die den Weg oft gegangen ist und sich nun hier ein Haus gekauft hat und zur Herberge ausbaut. Sie lebt allein und hat die Hälfte der Dorfbewohner hinter sich stehen; die andere, stärkere Hälfte sind aber "Betonköpfe", sagt sie. Alles an ihrer Einrichtung zeugt von Liebe, Geduld und Genügsamkeit. Sie hat ein kleines Zimmerchen als ihr Eigenes und ein Stückchen Hof eingezäunt für ihre Wäsche. Oft läuft man einfach an der Seite der Nationalstraße N 111 und läßt die Lastwagen furchterregend nah an sich vorbeirauschen, oder der Weg wurde einfach mal zugeschüttet. Auch das kommt vor. Logrono ist eine riesige Stadt; sie kündigt sich schon durch verworrene Autobahnverzweigungen an, durch welche sich der Weg zwar europagestützt asphaltiert, aber mühsam windet. Man betritt die Stadt durch einen heruntergekommenen Vorort. Kleine Häuschen mit unzähligen Anbauten, Hundehütten und Materialablagerungen säumen beiderseitig den Weg. Mittendrin ein Tisch mit Kalebasse, Stempel, Muschel und Goldenem Buch. Ein liebenswürdiges Mütterchen in Kopftuch und blauer Kittelschürze dahinter, die jeden Pilger persönlich im Namen der Freunde des Jakobsweges in der Stadt begrüßt. Ich sehe nur ihre Augen, nicht ihre Armut, die so viele Pilger dazu bringt, an ihr vorbeizugehen. Als wir ein Foto von uns beiden machen wollen, ruft sie ihre Freundin, die gleich aus dem Häuschen gestürzt kommt und den Fotoapparat bedient. Am Abend in der Pilgerherberge erfahre ich, daß die alte Dame viel belächelt wird und eine Kuriosität darstellt. Ich habe ihr Herz gespürt und kann nicht verstehen, wieso die Menschen diese warme Begrüßung, die mir die Ankunft so schön, so persönlich und innig wie in kaum einer anderen Stadt gemacht hat, nicht verstehen und annehmen können. Auf dem Weg werden Äußerlichkeiten so nebensächlich. Genauso wie man die Natur und ihre Erscheinungen aus nächster Nähe und mit immer größerer Bereitschaft und Offenheit aufnehmen kann und dabei spürt, die diese nur wahr sein kann, genauso beginnt man bei den Menschen das zu unterscheiden, was wahr ist und was wirklich nützlich zum Leben und zum Zusammenleben und was nur Schein und Wollen ist. Auf dem gesamten Weg habe ich nur sehr wenige Menschen kennengelernt, die mir etwas bedeuteten und die meine geistige Beweggründe geteilt haben. Mit denen mußte ich gar nicht viel reden, es war von Angesicht her klar, vom ersten Eindruck, daß es stimmt. Eine andere interessante Erscheinung beim langen Wandern ist es, daß man, einfach weil man sich die ganze Zeit im Freien aufhält, immer mehr von den natürlichen Erscheinungen wahrnimmt und beginnt, sich Gedanken zu machen und alles in eine Ordnung zu bringen. Am Ende bin ich auf viele keltische Erfahrungen gestoßen, die unsere Zivilisation vergessen hat. Lassen sie mich das näher erläutern: Bei einem solch langen Weg ändern sich täglich, stündlich alle Dinge um einen herum. Täglich sucht man sich einen anderen Schlafplatz, man hat keine gewohnten Handlungen, alles ist neu und will reiflich überlegt sein. Man kann sich an nichts gewöhnen, kann sich nicht "einrichten". das einzige Vertraute wird man selbst und die eigene Ausrüstung, die eigenen Fähigkeiten. Man lernt sich kennen, spürt die Reaktionen auf natürliche Vorgänge, wird auch immer vertrauter mit dem ständigen Wechsel. Es ist erstaunlich, aber es ist wahr, man kann in einem sich ständig komplett 61 verändernden Umfeld eine große Sicherheit finden und sich in einer geregelten Existenz im Gegensatz dazu verirren. Durch die tägliche Gewöhnung und den täglichen Umgang mit Naturereignissen spürt man die Wechselwirkung des Körpers, der Seele und des Geistes mit der Natur. Die Suche nach dem Sinn der eignen Existenz findet also nicht im Kopf statt, auch nicht durch Leistung, sondern man erfährt, daß man dazu gehört; daß ein Wechselspiel zwischen der Natur und mir stattfindet. Ich muß nichts tun, um mich zu beweisen, sondern muß nur meine Sinne offenhalten, um meine Reaktionen auf die Natur zu spüren. Um alle Erscheinungen etwas systematisieren zu können, bekam ich ein immer stärkeres Bedürfnis, mich mit den keltischen Weltvorstellungen und Erfahrungen zu beschäftigen. Mondeinfluß, Sterne und Jahreskreislauf bilden die Grundlage für ein Weltbild, das sich als Teil der Natur und als von ihr abhängig begreift. Die Rhythmen der Natur, das Wachstum der Bäume, der Ablauf der Jahreszeiten, die Kenntnis der Früchte der Pflanzen bilden einen Rahmen, innerhalb dessen man sich sehr geborgen und sinnspürend bewegen kann. Logrono. Über den Ebro betritt man die Stadt, schlüpft in kleine Gäßchen und begreift Schritt für Schritt, zu was für einer Größe und Lebendigkeit sich diese Metropole inmitten der Wüstenei entwickelt hat. In einer wunderschönen Herberge kann ich übernachten. Alles ist perfekt: Duschen gehen, Küche ist vorhanden, Kaufläden in der Nähe. Solche Glücksmomente sind selten und so muß man sie auch schnell annehmen. Weil ich seit Ewigkeiten nichts Warmes mehr gegessen habe, erlaube ich mir, einen Supermarkt im Inneren des Stadtriesen aufzusuchen. Volle Regale, leckere Sachen, Schinken, Artischocken, Weintrauben, Milch und Honig überfüllen meine Augen, lassen mein Herz hüpfen und meinen Geldbeutel klingen. Ich bin erschlagen von der Vielfalt, Pracht und Exotik all der Dinge, die da meines Griffes harren. Meine Augen irren hierhin und dahin, saugen sich an Plastikbeuteln fest, durchstöbern die Fischtheke, sehen den leckeren Rioja-Wein und bilden Wasserbäche unter meiner Zunge. So lange habe ich nicht mehr geshoppt. Bin richtig ausgenoppt. Wie wertvoll einem die täglichen Dinge werden können und wie man all die Pracht und den Luxus, der uns zuhause täglich umgibt, zu schätzen lernt! Zwei Schweineschnitzel, einiges an Gemüse, eine Kiste Kekse, Bananen, eine Flasche Rioja-Wein. Ich bestaune mit armverlängernd schwerem Beutel das Flair der Stadt; die vielen Treffpunkte im Abendsonnenschein, die lebendigmachenden Wasserspiele, die ruhigwerdenden Gassen, die taubenduldenden historischen Mauern, die ansprechende Lebensart. Abends, beim Kochen, kommt plötzlich eine einheimische Folkloregruppe mit Gitarren, Flöten, Mandolinen, Kastagnetten und Tanzgruppe und erhellt den Abend, die Sinne, läßt den guten berühmten Rioja-Wein noch samtiger die Gurgel hinunterlaufen. Das ist die Chance, im Nachhinein auf dem Hof ein bißchen Konzertina zu spielen, und weil die Tür wieder zehn zugemacht wird, stapfe ich noch ein bißchen durch die Straße und ziehe das langsam erwachende spanische Nachtleben tief in meine Nüstern. 62 [22.6.] Sechs Uhr geht`s los, die Landschaft ist unbeschreiblich schön: große Ebenen mit vielen Berginseln, trockenes mediterranes Klima, Sonne den ganzen Tag, im Hintergrund dezent schneebedeckte Hochgebirge. Überall Wein, Mandeln und Oliven. Die Pilger schichten sich. Vor mir über Brücken und auf Bergesanhöhen wälzt sich die unendliche Karawane der Sehnsucht. Ich habe keine Sonnencreme dabei, deshalb klemme ich mir täglich ein frisches Blatt unter die Brille, so daß die Nase bedeckt ist. Sieht ulkig aus und krabbelt im ersten Moment fürchterlich, aber ich gewöhne mich daran. Ich bin der Nasenschnief. Abends dann ziehen ehrfurchterregende Regenwolken auf. Ich komme über einen Hügel und sehe auf einmal, ganz erschöpft und unverhofft, Santo Domingo vor mir liegen. Ich bin heute 49 Kilometer gelaufen. Die Gebäude leuchten hell und werden überschattet von einem schwarzen Etwas voller Regendrohungen. Es rumpelt und formiert sich zum Angriff, pustet wie wild das Laub und den Staub in die Augen. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie sagt mir heute etwas tief drinnen in meinem Unterbewußtsein, daß ich lieber doch nicht draußen schlafe. Die Herberge ist prunkvoll ausgestattet und hat etwas Orientalisches an sich. Ich werde in den Vorraum gebeten, in welchem der Mufti mit fünfzig barbusigen Frauen im Gange ist. Ein schwarzer Negersklave reicht mir ein goldenes Buch, in welches ich meine Insignien eintragen soll. Dazu beugt sich eine Sklavin vor mir herab und stellt ihren Rücken als Unterlage zur Verfügung. Ich sehe gar nicht, was ich schreibe, denn schon kommen von zwei Seiten weitere Sklavinnen, eine tupft mir mit einem feuchten Tuch die Stirn ab, die andere nestelt an meinem Rucksack herum. Jetzt erst höre ich die verführerische Musik aus dem Hintergrund, Betelgeruch strömt in meine Nase. Meine Personalausweisnummer. Ein Springbrunnen plätschert in der Nähe, die Wände sind von schillernden Mosaiken bedeckt. Von wo aus ich gewandert bin. Von Dresden. Meine Stirn ist schweißnaß, ständig wischt die Sklavin darauf herum und es wird nicht besser. Der Stift schreibt nicht mehr, so eine Feuchtigkeit hier! Plötzlich ist alles verflogen. Es wird ernst: auf dem Empfangsschreibtisch steht vor aller Augen ein Schrein, in welchen ich nun die freiwillige Spende hineintun soll. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Ich fühle es. Dreihundert. Puhh! An den Wänden stehen Regale mit goldenen und silbernen Souvenirs, T-Shirt und Wanderstöcke kann man erwerben. Oben die Zimmer sind komfortabel, im Aufenthaltsraum stehen zwei uralte gemütliche Sofas und die Küche funktioniert auch. Ich sitze neben Kim aus den USA und so lerne ich sie auch kennen. Sie erzählt mir die Sage der hiesigen Kirche. Ich kann es fast nicht glauben. Aber urteilen Sie selbst: in der Kirche, der gewaltigen, von Santo Domingo de Calzada, leben zwei Hühner, zwei lebendige. Sie bewohnen eine Nische über dem 63 Hauptportal und haben freien Durchblick zum Hauptschiff. Wenn sie Lust dazu haben, dann krähen sie, wenn nicht, dann nicht. Wie es dazu kam? Eines Tages, tief im Mittelalter, reist eine Familie mit Sohn unter beschwerlichen Umständen von Deutschland aus in Richtung Santiago und kommt auch durch Santo Domingo. Der Sohn ist eine attraktive Erscheinung und wird durch das Wandern noch schöner, so daß sich eine Einheimische beim Gottesdienstbesuch in den gerade anwesenden deutschen Sohn verliebt. Doch dieser will von ihr nichts wissen, er hat auf der Wanderung genug noch hübschere Frauen getroffen, daß er auf die eine nicht angewiesen ist. Er zeigt ihr die kalte Schulter und sie, voller Zorn, trägt nun finsterste Racheglüste unter ihrem Busen. Sie schmuggelt des Nachts einen silbernen Becher vom Kirchenschatz in den Rucksack des ahnungslosen, aber noch immer attraktiven Burschen. Morgens wird dieser plötzlich von einer Garde umstellt und vor den Richter geschleift, der ihn, weil diese Strafe dazu erkoren, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Es wird vollstreckt und die Eltern sehen, daß ihr Junge gar nicht tot ist, sondern munter am Galgen baumelt. Sie rennen zum Kommandanten und flehen um Gnade, daß man den Jungen nun vom Galgen nähme und frei laufen lasse. "Er lebt? das wäre ja gerade so" murmelt der Kommandant, der gerade an einem gebratenen Huhn knabbert, "als wenn dieses Huhn hier gackern und losliefen würde!" und siehe da, das Huhn gackert und flattert los, geradewegs zum Fenster hinaus. Da staunen alle nicht schlecht, am meisten aber der Kommandant, der befiehlt, den Sohn sofort loszuschießen, ihm alles zurückzugeben und frei laufen zu lassen. "Und bringt mir diese Verleumderin, damit wir sie hängen!" der Stadtschreiber überlegt schon, wie er alles am besten aufschreibt, damit es der Nachwelt erhalten wird, der Sohn reibt sich den Hals und umarmt überglücklich seine überglücklichen Eltern und der Pfarrer überlegt:" Hm, wie machen wir das am besten zu einem Geschäft?" Ja, heute sieht man das Ergebnis seiner Überlegungen: die, glaube ich, einzige Kirche der Welt, die zwei lebendige Hühner bewohnen, die monatlich ausgetauscht werden. Und: wenn man unter den Hühnern steht und sie fangen an zu gackern oder der Hahn kräht gar, dann hat man sein Leben lang unwahrscheinliche Sahne. Echt. [23.6.] Schlafe bis sieben, denn ich will heute mit Kim und Jennifer, ihrer Freundin, gemeinsam laufen. Wir kommen durch eine leicht hügelige Mittelgebirgslandschaft, die gar nicht mehr mediterran wie gestern noch aussieht, sondern eher wie Zuhause Die Landschaft hat sich schlagartig, innerhalb weniger Kilometer verändert. Wir sind jetzt in Kastilien, in der Provinz Burgos. Bis nach Belorado laufen wir fast nur an der Nationalstraße oder auf geschotterten Wegen am Rande. Die Geschäfte haben gerade Siesta, und so ernähre ich mich von den "para todos" in der liebenswürdigen Herberge. Kim bleibt hier und so verabschiede ich mich und ziehe weiter bis Villafranca Montes de Oca, wo 64 Chris, der Franzose übernachten will, den ich heute kennengelernt habe. Das wird zum Horrortrip. Gegen sieben Uhr erreiche ich den Ort mit dem langen Namen und kaufe, weil nichts anderes mehr da, das letzte Brot von gestern. Mit diesem ziehe ich durch den Ort, ohne eine Herberge zu finden. Ich gelange in den Wald, der im Mittelalter dafür berüchtigt war, ein Lager von Räubern und ein Ort des sicheren Überfalls für Pilger zu sein. Doch heute ist das ganz anders. Ich raste an einer Tischgruppe mit Quelle und sehe dunkle Wolken heranziehen. Es wird kalt. Auf einmal kommen schwarze Hunde und sehen mich an und gehen nicht weg. Ich gehe weg. Zurück in den Ort. Und es gibt tatsächlich eine Herberge: ein Hinterzimmer mit Doppelstockarmeebetten in einem heruntergekommenen Gebäude an der Straße. Drinnen versuchen zwei Halunken, das Fest des Sankt Paulus und Pedro zu feiern, indem sie Zwiebeln essen, lautstark herumgröhlen und nicht ins Bett gehen. Um elf dann, als ich froh bin, daß es etwas ruhiger wird, kommt die Kassiererin und rüttelt mir 300 Peseten aus dem Kniegelenk. Dann, noch später, kommt dann eine Erscheinung, in Decken gehüllt, eklig, und wirft sich in eins der Betten. Brummelt die ganze Zeit in sich hinein und ist nicht anzusprechen. Ich hoffe, er wird von allein ruhig. Weiter: halb vier wird die Tür aufgerissen und ein Scheuereimer mit Wasser und Lappen fliegt in hohem Borgen ins Zimmer. Chris, der Franzose, der hier auch übernachtet, zum Glück, da bin ich nicht allein hier im Lande Tunichtgut, fühlt sich angesprochen und will das Wasser aufwischen. Das gefällt dem einen Halunken nicht und er beschwert sich lautstark, daß hier keine Ruhe wäre und er ja doch heute pilgern müsse. Der Franzose Chris will jetzt, vier Uhr, loswandern. Niedergeschlagen gehe ich mit. [24.6.] So stapfen wir nun den unheimlichen Berg hinan, im Schein seiner Taschenlampe. Es ist noch vollkommen dunkel. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir machen Rast an jener Tischgruppe, um zu warten, ob es wenigstens etwas heller wird. Aber es wird uns nur kälter. Also gehen wir los, durch den Hochwald bis ins Kloster Ortega. Es ist sehr kalt, die Sonne scheint nicht, ab und zu nieselt es. Im Kloster, einer Herberge, gibt`s keine Küche, wo man sich einen lebendigmachenden Tee brühen könnte, und so warten wir, bis die Bar aufmacht. Die Barfrau hat ein ganz großes Gesicht, es 65 lugt, freundliche Geschichtchen erzählend, über den Tresen, füllt Kaffeetassen auf, sammelt Geschirr ein, verkauft Gebäck. Und so nach und nach füllt sich die Bar an diesem frühen Morgen mit Menschen, Wanderern und Kaffeeatem. Ich sitze einfach nur saftlos in einer Ecke, schlurfe meinen Kaffee und beobachte. Dann gehe ich alleine weiter, ich vertrage heute nichts mehr. Noch einundzwanzig Kilometer bis Burgos. Die Stadt taucht nach einer Hügelüberquerung wie eine Fata Morgana am Ende eines Tieflandes auf. Ich freue mich auf sie, kann ich mich doch dort ausruhen und wieder mit vernünftigen Menschen zusammensein. Die Vorfreude beschleunigt meine Schritte. Doch bald erreiche ich die Stadt und werde enttäuscht: Außer den handgemalten gelben Pfeilen tut die Stadt so, als ob es den Jakobsweg gar nicht gebe. Keine Hinweisschilder, keine Informationen und ein ewig langer Weg durch die ganze Stadt und wieder hinaus. In einem Park weit außerhalb steht eine Barackensiedlung für die Pilger, aber ohne Küche, und ich habe mir voller Vorfreude einen Beutel eingefrorenes Gemüse gekauft. Ich bin so stinksauer! Ich bin mit der letzten Kraft hierher gekommen und nun gibt`s hier nichts! Ich habe das Gefühl, und das haben auch schon andere Pilger erzählt, man ist von der Region nicht willkommen, wird als Pilger eher geduldet denn begrüßt. Ich bin so geschafft, daß ich den Beutel wutentbrannt einfach in die Botanik haue, mich auf eine Bank lege und erst mal ein bißchen schlafe. Nach dem Schlaf ist die Welt ganz anders: ich unterhalte mich mit der Frau, die die Herberge führt und erfahre, daß die Stadt gerade unter großen Mühen eine neue Herberge baut und daß das hier nur ein Provisorium ist. Alle Helfer arbeiten auch nur ehrenamtlich und ein Freund der Pilger hat hier im Park sogar seinen Privatgrund zur Verfügung gestellt, damit es überhaupt eine Herberge gibt. Das stellt die Sache natürlich wieder auf die Beine, ich sammle meinen Beutel ein, bekomme sogar einen Topf geborgt und fühle mich nach dem Gemüse wieder als vollständiger Mensch. In der Stadt erlebe ich ein großartiges Spektakel, eigentlich sogar mehrere: die großartige Architektur des Domes, die Luftigkeit, die Mystik in Mauerwerk gefangen. Die Angewohnheit der Spanier, nachmittags auf den Beinen zu sein, die Stadt zu bevölkern, die Straßen und Plätze zu füllen und den Kindern Gelegenheit zu geben, sich mit anderen Kindern zu verbünden und wilde Spiele zu spielen. Das Fest von San Juan mit Pauken und Trompeten, Tanz und Wein und Karneval. Der goldene Sonnenschein, der sich den Weg durch die Äste der vielen Bäume bricht. Die Unmengen von Hochzeiten und Hochzeitsfotos im Park im Abendgold, mit Aufheller und Weichzeichner. Das ist ein Gewimmel in der Stadt: überall Musiker, Gaukler und Verkäufer allerlei Dinge. Es ist unbeschreiblich, dieses Lebensgefühl, unglaublich lebendig. Man sieht sich, man 66 beguckt sich und läßt sich begucken, man fährt die kranke Großmutter spazieren, man spielt Schach im Stadtpark. [25.6.] Heute ist mein freier Tag. Urlaub im Urlaub! Ich stehe spät auf, trödele herum, frühstücke in der Garage und mache dann einen Stadtbummel. Überall ist was los: es ist Sonntag und die Leute promenieren durch die Straßen. Ihre Töchter haben feinste weiße Kleidchen an. Ich finde einen Trödelmarkt unter Hochhäusern. Auf dem Rathausplatz werden monströse Figuren herumgetragen. Ich esse in einem Restaurant ein Menü inclusive einer ganzen Flasche Wein. Ich lasse nichts verkommen und habe danach zu tun, daß ich in der Mittagshitze den Weg zu einer Wiese am Flußufer finde. Um Mitternacht ist mitten in der Stadt, direkt neben der Kathedrale, ein gigantisches Konzert. Ich verstaue meinen Schlafsack und die Isomatte außerhalb der Herberge und stürze mich in den Festtrubel. Überall ist Musik, Blasmusikkapellen ziehen durch die Straßen, hinter sich eine Traube tanzender Menschen. Wir Pilger werden mahlströmartig in ein Event unter einem Torbogen gesogen. Wein in Lederbeuteln geht herum. Man muß trinken, indem man mit dem Strahl aus der Düse den Mund aus möglichst großer Entfernung trifft. Dann wird getanzt. Gegen Abend werde ich von einer Mädchengruppe entführt zum Kalimotxo trinken. Sie sind alle verrückt. Alles wird in großen Kübeln getrunken. In einer Bar machen wir ein Tischspiel: Du trinkst! Ich trinke! Alle trinken! es ist wie ein wogendes Meer, die Farben, die Menschen, die Bars, die warme Luft, das Konzert... [26.6.] Vier Stunden kann ich schlafen, dann werden die ersten Pilger wach. Heute geht es durch die Meseta, eine baumlose Ebene. Nur Gras, Steine und Lehmstaub. Die Sonne brennt erbarmungslos, man ist ihr ohne Schutz ausgeliefert. Nach Stunden erscheint eine kleine Hütte in der Ferne abseits des Weges, mit einem Wäldchen daran, das soll mir eine willkommene Stätte für eine Mittagspause sein. 67 Beim Näherkommen entpuppt sich da Häuschen als die Refuge Sarbol, mit einem Kuppeldach und phantastischer Bemalung einer polnischen Künstlerin. Die Innenseite der Kuppel ist mit einem Sternenhimmel ausgemalt. Die Herberge wird von einem Deutschen geleitet, der vom Dorf in der Nähe das Gebäude gepachtet hat, den Sommer über hier verbringt und den Winter in wärmeren Gefilden. Er wirkt sehr müde, er wünscht sich jemanden, der mit ihm dableibt und hilft. Ich stelle es mir schrecklich einsam vor, zwar täglich interessante Leute zu Gast zu haben, aber ständig wechselnde. Er verneint und gibt mir einen Teller Bohnensuppe, die er selbst gekocht hat. Im Hintergrund stehen zehn Doppelstockbetten, oben ist sein Zimmer. Er sagt, ich sei der am weitesten gewanderte, der bis jetzt bei ihm eingekehrt ist. Was ist das für ein Typ? Ich kann ihn nicht durchschauen, er ist so ruhig und geübt, stürmische Fragen umschweifend zu beantworten. Auf welche Weise formt und verändert der Weg; das auf-dem-Weg-sein die Menschen? Hinter dem Haus, in einem bezaubernd erfrischenden Wäldchen läuft eine frische Quelle, und in ein Becken geleitet, wird sie zum gänsehauttreibenden Erlebnisbad. Allerdings muß ich erst warten, bis alle Leute verduftet sind. Etwas Wichtiges lasse ich in der Herberge: meine geliebten Sandalen haben mich bis hierher getragen und werden es nicht weiter tun können, denn dem linken ist die Sohle durchgegangen. 2000 Kilometer, von Ulm bis hierher waren sie mir treue Begleiter und Bindeglied zwischen Mutter Erde und Fußsohle. Weiter geht die ewig flache Ebene, bis zum Horizont sieht man nichts als Felder, doch plötzlich taucht neben ernsten Gewitterwolken ein Kirchturm in einer Senke auf, urplötzlich treffe ich mich in einem kleinen von den Zeiten vergessenen Dörfchen wieder und sehe die anderen bekannten Gesichter vor der Herberge sitzen. Kaum die Sachen eingeräumt, fängt es an zu regnen. Wir bekommen von den Herbergiers ein fantastisches Abendbrot vorgesetzt, danach sitzen wir nach dem Regen noch draußen: Verity aus Südafrika, Susan und "Bad" Kitty von den Virgin Islands, Fernando aus Brasilien, Anne-Maria und Nicky aus England, zwei Holländerinnen und so fort. Zum Konzertinaspiel kommen auch einige Dorfbewohner geguckt. Zum Sonnenuntergang gehen wir mit Ann und Nicky auf einen Berg und bauen ein Steinmännchen. [27.6.] Ich wache auf und alle sind schon fort. Frühstücke und gehe allein los. Treffe unterwegs einen Amerikaner, gehe mit ihm ein Stück bis zum Konvent St. Antonio. Jetzt geht´s im Tal entlang, es ist nicht mehr so flach und auch nicht so heiß heute. Ein kühler Wind bläst und trieibt ein paar lockere Wölckchen vor sich her. Castrojeriz 68 erscheint zuerst als eine undefinierbare gigantisch wirkende Ruine auf einem Berg, dann eröffnet sich der Blick auf eine Ansammlung von Häusern. Am Ortseingang steht eine große Kirche, die zwar schon Anzeichen des Verfalls zeigt, aber noch immer die Gewaltigkeit ihrer Umrisse zur Schau stellt. Störche haben die Zinnen und Schwalben die Giebel in Besitz genommen und ihre Spuren hinterlassen. Menschen dürfen nicht eintreten, der Pfad zum Portal ist wenig ausgetreten. Ein Hülle ohne Innenleben, wie ein verlassener Kokon eines Schmetterlings. Viele Kirchen und Gebäude am Weg sind verschlossen. Wo ist der Schmetterling, der sich einst in den Gebäuden entwickelte, hingeflogen? Was ist er jetzt, als reifes Etwas? Zwischen den ersten lehmgebauten Häusern erscheint eine Bar. Jedes kleine Dorf hat eine eigene Bar, und hier pulsiert das Leben, allerdings erst ab gegen elf in der Nacht. Kommunikationszentrum, Arbeitsamt, Kino und Spielhölle in einem. Meist sind die Bars gigantisch groß, mit einem laangen Tresen und ziemlich einfachem Mobiliar ausgestattet. Erlebnisgastronomie heißt hier nicht: bunter Schillerlook und stille Menschen, sondern dermaßen Ramba-Zamba, daß das Mobiliar gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Die hiesige Bar ist etwas Besonderes: lateinamerikanische Rhythmen kommen aus dem Lautsprecher und versprühen ein Feeling von Freiheit und Abenteuer, das sich in der Dekoration fortsetzt, einschließlich eines Papageien, der sich auf dem Tresen mit Keksen und Kuchen füttern läßt. Der Stempel ist eine Rarität. Eine Kanadierin und ein Brasilianer laden mich zu einem spanischen Kaffee ein, und das ist fast immer ein leckerer Milchkaffee mit Zucker. Die Kanandierin arbeitet als Touristenbetreuerin in Spanien, und ihre Erzählungen darüber machen Lust, ebenso im Ausland zu arbeiten. Ich glaube, es ist so bereichernd, weil man am eigenen Leibe erfährt, daß man das Leben auch ganz anders organisieren kann. und dieses wissen schafft in der Heimat eine tolle Freiheit, mit all den gesellschaftlichen Zwängen umzugehen. Einige Kilometer hinter Castrojeriz, an einer Quelle, sind Verity und unter anderem auch ein Schotte, gerade erst den Weg begonnen, mit 69 weißer Haut und beblasten Füßen. Ein Opa aus dem Dorf sitzt an der Quelle. Er ist extra aus seinem Dorf hierher gefahren, um sich die Pilger zu besehen, um sie zu begrüßen und mit ihnen zu reden. Wir gehen zusammen weiter, Verity singt und lacht und springt herum, ist voller Lebensfreude und steckt uns alle an. Irgendwie ist auch heute ein Tag zum Brezelnbacken; alle sind fröhlich und guter Dinge und alle spüren es und sagen es immer wieder. Ich treffe einen Spanier, in Galizien geboren und jetzt in Madrid lebend. An den Namen kann ich mich wie bei vielen nicht erinnern. Unsere Namen sind auch so nichtssagend, sie passen nicht zur Person. es gab Zeiten, da hat man sich selbst Namen gegeben, nach einer besonderen Tat oder zu einer besonderen Eigenschaft, oder, wenn man sich persönlich verändert hat. Diese Namen paßten stets, auch wenn man nicht immer wußte, wie eine lange nicht gesehene Person gerade hieß. Der Spanier erklärt mir, wie eine Paella gemacht wird: Zwiebeln in Olivenöl anbraten, dann die jeweiligen Zutaten, die nach Region variieren, dazu, dann Wasser und Reis. Alles wird eine halbe Stunde auf kleiner Flamme kochengelassen. Wir nähern uns einem kleinen Hospital am Wege, ehemals Hospital. Was heute geblieben ist, das sind die Außenmauern. Hinzugekommen sind zwei freundliche Wesen, die das Gebäude zu einem erquickenden Rastplatz für Pilgerer machen. Einer von ihnen liegt faul in der Sonne. Leben und lebenlassen könnte man ein Lebensmotto der Spanier beschreiben. Drinnen eine lange Tafel; im Chor dicht gedrängt eine Reihe von Doppelstockbetten, am Altar ein Gedenkstein für einen im April diesen Jahres gestorbenen Pilger. Das wahre Leben holt uns auch hier ein. Pilgern ist kein Spiel. Über eine mittelalterliche Brücke, dann sortiere ich mich zu einem Puertoricaner, der eine Ananasplantage besitzt. Fernando lebt noch bei seinen Eltern, der Vater betreibt eine Kuhzucht. Fernando kann Kühe nicht leiden. Der Vater kann Ananas nicht leiden. Wir reden über den Weg, das Wandern und den Wein. Dann erreichen wir Kitty, unsere Spezialfreundin von den Virgin-Islands. Sie erzählt, daß sie den Weg als Strafe gehen muß für ihre schlechten Schulnoten. Damit sie "nicht verblödet", hat sie sich ein "Cheese-wheel", ein Käserad gebastelt; ein grellbuntes Plaste-Laufrad mit einer Klapperkugel darin an einem knorrigen Stock befestigt. In Bordilla del Camino steht eine Unabhängigkeitssäule auf dem Dorfplatz. Alle bleiben hier. Ich schlafe ein bisschen im Herbergshof, repariere meine Hose, esse ein Eis und finde eine Holländerin unsympatisch. 70 Zum Bleiben ist es noch zu früh, ich gehe weiter und improvisiere Konzertinamusik an einem historischen Kanal. Bei Sonnenuntergang klingt alles tiefer und feierlicher. In Fromista kaufe ich zwei Spezialitätenbüchsen: Spargel und Tintenfischstückchen für`s Abendbrot. Noch ein wenig Straße, dann sehe ich links das Kirchlein Sankt Manuel mit Rastplatz. Bei näherem Hinschauen entdeckt sich eine Quelle, erstaunlich, hier ín der Ebene. An der Quelle wasche ich mich, genieße deren frisches Wasser und schlafe auf der Wiese daneben. [28.6.] Der Weg ist eine tolle Sache: Man trifft immer wieder neuen Leute und immer wieder auch Bekannte. Alle sind wir verbunden durch das Ziel und passieren dieselben Schwierigkeiten, Hitze, Blasen und Trockenheit. Jetzt, gegen Ende des Weges, verändert er sich, wird, glube ich, interessanter und schöner. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, eines Tages am Ziel zu sein und nicht mehr zu laufen. Ich glaube, ich laufe dann, wenn es nicht mehr weitergeht, immer noch weiter, im Herzen. Das kriege ich wohl nie los. In der Povinz Palencia geht es nun den ganzen Tag über flache trockene Feldwege. Unterwegs begegnet mir der Esel Lulu und seine drei französischen Freunde. Sie sind alle vier zusammen seit Le Puy in Südfrankreich unterwegs. Lulu ist auch ohne dass er iaht oder andere eseltypische Dinge tut, immer im Mittelpunkt. Die Namen der Orte sind hier irgendwie alle gleich ungewöhnlich: ich raste in der 1000 Peseten teuren Herberge in Carrion de los Condes zu mittag im Schatten und treffe Nicole aus Aschaffenbutg und Angelika aus Österreich, die beide zusammen unterwegs sind, weil sie sich als Au-Pair in Bilbao in der Spanischschule kennengelernt haben. Wir laufen nach der größten Hitze weiter bis zu einem Baum mit Quelle in einer ansonsten ziemlich baumlosen Ebene. Die Quelle ist ein überdachtes Loch, läßt uns erst über die Trinkbarkit zweifeln, überzeugt dann aber durch einen herzhaft frischen Quellgenuss. Wir genießen unsere Leckereien und schlafen ein unter dem großen behütenden Baum. [29.6.] Die Ebene will einfach nicht hügelig werden. Wir befinden uns in der legendären Meseta, einer staubig-lehmigen Trockenebene. Riesige Felder bis an den Horizont, strohgedeckte Lehmhäuser und viel viel Zeit hat man hier. Endlos dehnt sich der Weg, man verfolgt den Weg der Sonne am Firmament und versucht sich so gut es geht, vor ihren sengenden Strahlen zu schützen. Es geht die Sage um, 71 es wäre in Terradillos de los Templarios eine Fiesta, das läßt natürlich ein ordentliches Pilgerherz höher schlagen und macht die Schritte länger. Eine Herberge für 24 Personen ist angekündigt, sie soll aber etwas kosten. Naja, für eine Fiesta soll`s mal so sein. Wir haben sogar die Wahl: wollen wir im ordentlichen Bett schlafen, kommt es uns teurer als wenn wir das Fußboden-Appartement wählen. Ihr dürft raten, was wir gewählt haben. Dann waschen alle ihre Wäsche und - nun folgt die Beschreibung eines Abenteuers - wir kommen auf die dumme Idee, uns gemeinsam mit anderen etwas einfaches in der Küche machen zu wollen. Küchennutzung ist im Prospekt angegeben und so mahchen wir uns nichts daraus, die Wirtin zu fragen, ob wir uns in ihrer Küche umtun dürfen. Sie ist ein wenig im Streß, weil die Großfamilie da ist und sie kochen muß. Aber wenn sie fertig ist, versprich sie uns, dürfen wir unsere Plinsen machen. Fernando, der Charmeur, hat sie mit seiner unwiderstehlichen Art überzeugt. Wir kaufen also in ihrem Laden noch die notwendigen Eier und das schlecht zu transportierende Mehl ein und warten auf unseren Auftritt. Da erscheint sie in der Tür: Los! Nach zehn Plinsen wird es ihr entschieden zuviel, sie dreht den Gashahn unter dem halbfertigen Plinsen ab, ruft: "Fuera", was soviel wie "Hinaus" heißt. Wir sitzen mit unseren zehn Plinsen und dem Rest Mehlsoße da und müssen prusten vor Lachen. Abends die Fiesta auf dem Dorfplatz. Wir sind, glaube ich, zu spät, denn die Recordermusik ist gerade am Ausklingen. Auf dem Platz zerstreuen sich gerade die letzten Leute. Aber es gibt zehn Uhr ein Konzert. Wir warten vor der Kneipe, aber einen Pilger nach dem anderen zieht`s in`s Bett. Wir lernen einen Spanier mit Schiebermütze und Trommel kennen, er strahlt noch die Energie seiner Jugend aus und stellt stolz drei seiner fünf Kinder vor. Dann trommelt er wie ein wilder auf seiner Trommel herum, das Dorf kennt ihn schon. Gegen zehn sind nur noch der trinkfeste Ricardo, der die Mädels anschwärmt, Angelica und Nicole und ich übrig. Die beiden Mädels verziehen sich auch recht schnell und so bleiben wir beide Herren als letzte übrig, erleben eine Mischung aus Folklore und Pop-oper, bekommen ein Lied extra für die Pilger vorgespielt, trauen uns aber trotzdem nicht, mit einer spanischen Seniora anzubändeln, ein Tanz mit uns Ausländern wäre das sichere Ende ihrer ehrbaren Dorfkarriere. [30.6.] Ich wecke fünf Uhr auf und spüre in mir das Verlangen, in der Finsternis loszuwandern.. Um diese Zeit ist das Geheimnis der Nacht noch wach und man kann deren langsames Verschwinden mitverfolgen. Ich bin allein mit der Ebene. Gegen halb acht bekomme ich wilden Hunger und beobachte ein Bäckerauto, wie es aus der Bäckerei fährt. Der Fahrer grüßt mich, hält neben mir an und fragt, ob ich den Jakobsweg wandere, er wäre ihn selbst schon gelaufen. Meine Chance! "Haben Sie Brötchen zu verkaufen?" Da zeigt er mir alles in seinem Wagen: Baguettes, Brot, Pfannkuchen. Ich schlage zu. In Sahagun steht eine Jakobsmetallplastik vor der Kirche, deren Hochparterre zur Pilgerherberge ausgebaut ist. Die Reinemachfrau gibt mir den Stempel. Treffe in der Stadt Annemarie und Nicky und besichtige mit ihnen die großen Kirchen. Nicky muß noch warten, sie braucht Pflaster und Binden aus der Apotheke, hat arge Probleme mit ihren Füßen. Mittags lege ich mich auf eine Bank am Rande des Weges und werde von Nicole, Angelika und Fernando "überfallen". Wir essen zusammen und schlafen dann noch eine Runde. Das ist das wahre Leben: essen, laufen und schlafen. Darin erfüllt sich der Lebenssinn. Mit Fernando gehe ich 72 zwei Kilometer bis zu seiner Endstation. Ich kann nicht anders: er schleppt mich in eine Bar ab und wir essen einen fetten Bocadillo. Dazu sitzen wir an der Bar und beobachten wieder einmal das beeindruckende spanische Leben. Eine Herrenclique im Durchschnittsalter von siebzig zockt in der Ecke, fünfjährige Kids belagern das Computerspiel. Ich verlasse Fernando und setze meine Reise fort. In El Burgo ist schon wieder Fiesta. Wieder San Pedro. An einer großen Pelote-Wand ist das halbe Dorf versammelt. Ich beziehe die Herberge, die diesmal ein ganz tolles Lehmhaus ist. Im Lehm mit verputzt ist die Liebe der engagierten Leute des Dorfes. Weil ich die heutige Geldration schon verbraucht habe, frage ich die nette Herbergsmutter, ob ich kostenlos im Garten übernachten darf. Doch die kann sich das gar nicht vorstellen. Ich soll bis abends warten. Wenn ein Bett frei bleibt, kann ich darin schlafen; wenn nicht, dann im Aufenthaltsraum. Es wird ein schöner Abend. Alle kochen und essen wir gemeinsam. Fernandos und mein Anteil ist ein "Reisdessert mit Flügeln". In der Ferne erstrahlt ein herrlich bunter Sonnenuntergang, wir unternehmen einen Dorfspaziergang, reißen irgendwo den Küster auf, der uns in die Kirche führt. Ein goldener Altar, eine Prozessionsfigur von San Pedro, ein Jakob in der Ecke. [1.7.] Was kann man groß erzählen über einen Weg im flachen Land. Ewig zieht sich der Schritt. Mal zählt man mit, mal zählt man die Bäume, mal die entfernten Telefonmasten. -manchmal, und das kommt auch vor, macht man sich kluge Gedanken. Bei der Zahl zehntausend komme ich in Mansanilla de las Mulas an. Eine Existenzgründung empfängt mich: "Bar con Sello" - "Bar führt Stempel". Eine ausgebaute Garage. Drinnen ein älteres typisches amerikanisches Pärchen. Frau braucht Socken, ich biete ihr meine ungebrauchten an, falls es gar nicht mehr gehe. Es geht noch. Einige Schritte weiter verbergen sich Erdhöhlen, Relikte der Vergangenheit. Früher Wohnungen, heute Lager und Datsche. Auf dem Gipfel des 73 Lehmberges thronen die Reste einer imposanten, bis auf einige beeindruckende Mauerreste verfallenen Kirche. Nachmittags erreiche ich Leon: Großstadt, Oase inmitten der Wüste. Ein Konsumtempel zieht mich in seinen Bann. Ich schlüpfe hinein, mit meiner alten ausgeblichenen Hose. Ich habe unzählige Male geschwitzt, nun sehne ich mich nach einer frischen, kurzen. Die gibt es auch schon für 18 Mark. Bevor ich weiter einkaufe, ziehe ich mir sofort auf Toilette die neue Hose an. Nun bin ich ein neuer Mensch und darf als neuer Mensch gesittet einkaufen gehen, darf zwischen Putenbrüsten, Oliven und Meerbrassen lustwandeln. Bunte Schilder preisen mir die Kaufwürdigkeit der Waren, bunte Menschen fahren ihre bunt gefüllten Einkaufswagen zu den bunten Kassen, zahlen mit ihren bunten Karten der buntlächelnden Verkäuferin. Wo ist das Schwarzweiß? Am späten Nachmittag bin ich in der Herberge der Benediktiner, 112 Plätze. Die Praktikanten bemühen sich redlich, kommen aber trotz der hohen Bettenzahl kaum mit dem Ansturm der Pilger zu Rande. Ich habe Glück, bekomme ein Bett im überfüllten Schlafraum. Die nächsten aber schon müssen in die Turnhalle. Leon - das sind Gassen angefüllt mit Leben. Kneipen, Bistros und Bambule. Ich würde mich ja gern in den Trubel stürzen, aber wir werden von der Uhr zurückgerufen. Zehn Uhr ist wieder mal Zapfenstreich für uns. Um noch etwas Kultur abzubekommen, besuchen wir die Zehnuhrmesse der Benediktinerinnen. Anstehen vor der Tür, Einführung durch die Gästenonne, Eintritt. Jeder Pilger vollführt seine zuhause gelernten Bewegungen, bevor er sich hinsetzt. Eine Nonne predigt, die Nonnen singen. Die 74 Kapelle ist irgendwie grell beleuchtet, indirekte neonweiße Leuchten bringen eine unruhige Lichtstimmung in den Raum. Nachtgebet, Nachtruhe. [2.7.] Die Herbergspraktikanten haben ein leckeres Frühstück für alle vorbereitet; die lockere Athmosphäre und die Reichhaltigkeit des Frühstücks sind eine gute Kombination, um den Tag freundlich starten zu lassen. Nicole, Angelika und ich lassen unsere Rucksäcke in der Herberge und stürmen die Stadt. Unser erstes Ziel ist natürlich die riesige Kathedrale. Morgendunkelheit umhüllt uns darinnen, Geschichtsdunst und vereinzelt auch Menschen. Jedes Steinchen ist eine Kostbarkeit voller Reiz und Geschichtlichkeit. Und wen treffen wir, als wir wieder hinausgehen? Den Bayerischen Rundfunk. Die wollen uns auch gleich filmen, wollen ein Interview von uns machen. Ach bin ich aufgeregt, aber dann, als das rote Lämpchen leuchtet und die neugierige dunkle Linse auf mich gerichtet ist, werde ich erstaunlich ruhig und beginne vom Weg zu erzählen, gerate ins Schwärmen und möchte gar nicht mehr aufhören. Mal sehen, ob ich so überzeugen war, daß ich auch im Fernsehen gezeigt werde. Wenn, dann im Januar 2001, irgendwann an einem Donnerstag 18 Uhr, bei "Wege nach Spanien". Bin gespannt. Nach dem Interview werden wir vom Filmteam ins Cafe eingeladen. Natürlich schlage ich zu: Eis und Kuchen. So nebenbei erfahren wir mehr von der Arbeit des Filmteams, von der Begeisterung des Regisseurs für Spanien, von der Aufgabenteilung beim Film, vom Hobby des Tonmeisters und lernen den Spanier, der Boy für alles ist, kennen. Angelika läßt es sich nicht nehmen, in einer Modeboutique die neueste Kollektion auszuprobieren. Nachmittags verlassen wir die Stadt und treffen dabei Annemarie und Nicky. Ich kaufe mir eine coole Sonnenbrille, mit der ich zwar nicht mehr scharf sehe, aber dafür scharf aussehe. Das hat was. Echt. Am Rande der Stadt wieder eine Wohnhöhle. Ich kann nicht widerstehen und frage die davorsitzenden Besitzer, ob ich mir deren Höhle mal angucken darf. Angelika ist das peinlich, ich kann das doch nicht machen, das ist doch so, als ob ich jemanden frage, ob ich mal seine Wohnung angucken dürfte. Drinnen ist es total gemütlich, sauber und praktisch. Die Leute wohnen nicht mehr hier, sie treffen sich am Wochenende zum Grillen oder zu Parties hier. Aller Lehm ist per Hand mit der Hacke herausgeholt worden. Es gibt mehrere Räume, einen Kamin, elektrisch Licht, eine große hölzerne Weinpresse. Faszinierend. Wieder draußen sehe ich Angelika und Nicole bereits am Tisch sitzen und mit den Leuten essen. Wir dürfen probieren. Spanier sind so herrlich einfach, nur wir machen immer alles so kompliziert. Nach 75 einem weiteren Kilomter Vorstadt haben wir die Wahl: Straßenrand und 10 Kilometer oder Wanderweg, aber 13 Kilometer. Ich überrede die Mädels zum Wanderweg. Wir kommen bei Sonnenuntergang in Villar del M. an und spüren wieder einmal eine herzliche Gastfreundschaft uns umwehen: die Dorfbevölkerung hat für die Pilger ein einfaches, aber praktisches Haus hergerichtet, wir können auf der Innenhofterrasse schlafen, in der Küche steht ein Beutel mit frischen Kartoffeln für die Pilger bereit. Bratkartoffeln gibt es also, eine wahre Gaumenfreude. Ich lerne Uwe kennen, der bis zum Ende des Weges immer wieder in der Geschichte auftauchen wird. Uwe besorgt Wein und darf bei uns mitessen. [3.7.] Am Horizont türmen sich, während wir frühstücken und Uwe noch seinen Rausch ausschläft, dunkle Gewitterwolken auf. Ein Pilgerer läßt sich jedoch keinesfalls von Wettererscheinungen einschüchtern. Er hat eine wasserdichte Jacke mit und trabt bei jedem Wetter seine vorgeschriebenen Kilometer los. So auch wir. Es regnet. Drei Stunden. Irgendwie vergeht uns die Pilgerlaune, alles ist naß und kalt ist es obendrein. Vor uns treideln im Regenschleier vier andere Gestalten, ebenso durchgefroren wie wir. Deshalb machen wir im nächstgelegenen Dorf Rast, trinken einen Kaffee und warten ab, was sich tut. Siehe da, der Regen hat ein Ende. Uwe kommt trockenen Fußes daher. "Warum geht ihr denn bei dem Regen so zeitig los?" Nach Hospital del Orbigo, nachdem wir über dessen große romanische Brücke gelangt sind, beginnt das Gelände, hügelig zu werden. Die Meseta ist zu Ende, die Vegetation ändert sich spürbar. Es wird feuchter, mehr Pflanzen, Obst und Gemüse wächst zu beiden Seiten des Weges. Abends erreiche ich Astorga, bin wieder mal schneller als Nicole und Angelika. Der erste Anblick Astorgas überwältigt: Nachdem man schon ein ganzes Stück in die Bergwelt bergauf gestiefelt ist, öffnet sich urplötzlich noch einmal eine Ebene vor unseren Augen, in deren Mitte die große Kathedrale von Astorga und der Palast von Gaudi erscheinen. Aber die kleine Herberge ist schon restlos überfüllt. Es ist wie immer: die spät Ankommenden finden keinen Platz mehr, weil die, die mittags schon zu wandern aufhören, alle Plätze restlos belegt haben. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als auf den Marktplatz zu gehen, mich auf einen Kaffe einladen zu lassen und der Dinge zu harren, die da kommen werden. So Allah will. Wer Allah ist? Ein Araber, den ich im Cafè kennenlerne. Er ist Ägypter und fährt in Berlin Taxi. Das will er aber nicht auf ewig tun, deshalb ist er auf dem Weg und hofft, eine Entscheidung treffen zu können, die er eigentlich schon weiß und im Herzen trägt. Aber es ist wie mit allen Dingen: eigentlich weiß man es schon, man traut sich nur nicht so recht und braucht irgendwoher eine Bestätigung, und wenn es der Weg ist. Hier nun tritt Fernando wieder in Erscheinung. Er hat sich ein Zimmer in einer Pension gemietet und die Pensionsdame gefragt, ob in seinem Zimmer noch jemand übernachten darf. Darf. So ziehen wir hin zur Pension, Fernando scharwenzelt mit Angelika herum, denn er hat ihr auch einen kostenlosen Platz in der Pension besorgt; wir erreichen nach einer Stunde die Pension. 76 [4.7.] Habe sehr gut geschlafen, bis neun Uhr. In der Kathedrale ist eine grandiose Ausstellung über Künstler der Umgegend. Eine Kombination von multimedialer Technik und echter Vergangenheit in Form von Gemälden und Plastiken. Mich beeindruckt der Unterschied: Technik ist Technik, kann zwar die ganze Welt auf einen Computermonitor zaubern,aber niemals den Kunsthauch eines echten Gemäldes, des lebendigen Eindrucks, ersetzen. Die Kathedrale von Gaudi ist gleich nebenan, aber man muß bezahlen; deshalb Außenansicht. Spiele Konzertina, woraufhin sich wieder alle Bekannten um mich versammeln: Fernando, Angelika, Roberto, Rico, Annemarie und Nicky. Ich bin losgehfertig, die anderen noch nicht, deshalb tigere ich wieder mal allein los, bergan. Ich treffe und kennenlerne Roberto "mit dem Herzen eines Löwen und der Stimme eines Vögelchens", das beweist er gleich und vögelt darauflos. Wir nähern uns Rabanal del Camino, eins der Bergdörfer, die allein zur Versorgung der Pilger entstanden sind. Es gibt zwei Herbergen: eine englische und eine einheimische. Ich gerate in die nette englische und erwische das letzte Bett, d.h. es wird extra noch eins in der Ecke eingerichtet. Abends gehen zwei Hospitaleros mit mir in die Kneipe und überlassen mir einen Teil ihrer Mahlzeit und laden mich zu einem Bier ein. Sie sind Praktikanten wie so viele hier am Weg. Alexandra kommt aus London und Maria aus Barcelona, Spanien. Man kann in den Herbergen am Jakobsweg ehrenamtlich arbeiten und die Hospitaleros unterstützen, wenn man mindestens 14 Tage Zeit hat. In der Dorfkirche improvisiere ich bei Anbruch der Dämmerung auf der Konzertina für mich allein, doch plötzlich kommen, von der Musik angelockt, einige Pilger aus der Herberge herüber. Komisches Gefühl, andere teilhaben zu lassen an dem Versuch, die Töne fließen zu lassen, ohne sich an Notenblätter zu halten. Nachher angesprochen, sagt mir jemand, dass die Musik sehr tiefgehend war, aber auch sehr traurig. [5.7.] Wir bekommen Frühstück von der Herberge, wieder einmal ist alles kostenlos, man braucht nur einen freiwilligen Beitrag in die Kasse zu geben. Aufstieg zum Cruz de Fer, dem eisernen Kreuz, einer wichtigen historischen Station des Jakobsweges: auf dem Paß steht epin Kreuz auf einem Steinhügel, jeder Stein hat eine eigene Geschichte. Hier haben die Pilger die stellvertretend für ihre Sünden mitgetragenen Steine abgelegt und dafür symbolisch, versteht sich, ihre Sünden erlassen bekommen. Direkt unter dem Kreuz finden sich die neuesten Steine mit Faseerstift sind Grüße auf der glatten runden Oberfläche der Steine verfasst. Es liegen kleine, aber auch einzelne sehr große Steine auf dem künstlichen Hügel. Hat da jemand so große Sünden zu vergeben gehabt? Die Sonne brennt auf die Haut, jetzt wird es langsam heiß, das Gebirge will überwunden sein. Steine. rote Erde und viele Ginsterbüsche. Wir kommen durch verlassene Dörfer, nur noch Ruinen der aus dem harten Stein erbauten Häuser säumen den Weg bzw. die Straße, der der Weg teilweise folgt. In El Acebo dann plötzlich als einziges Haus die verrückte Herberge: Hunde, Hühner, Andenken, Wasserkanister, Sitzecken zwischen Blechteilen: eine freakige Absteige. Aber den Stempel gibts auf herkömmliche Weise. Vor dem Abstieg ein Ausblick über die gesamte Bergwelt, dann der Weg durch die Hauptgassen von Bergdörfern, die sich, Adlerhorsten gleich, an kleinste Unterbrechungen der Steilheit klammern. An einem Flußlauf gründet scih gerade eine neue Herberge. Rauch quillt aus einer Feuerstelle, man sieht die Ergebnisse der 77 ersten Arbeiten: ein Stück Erde ist planiert worden, vier Pfähle ragen aus der Erde. Um sich zu finanzieren, liegen Coladosen im Bach, frisch gekühlt. Das letzte Stück quält sichd der Weg in der brütenden Hitze auf einer breiten neuen Asphaltstraße entlang.Ich flüchte der Sonne, habe mich ganz schön verbrannt. Fast zuasphaltiert, stehen, unansehnlich, die Wegemarken in Ecken oder liegen einfach herum. In Ponferrada erwartet uns (ich habe zwei Spanierinnen getroffen) die luxuriöseste Herberge: eine Stiftung, ein Neubau. er erinnert an ein Hotel, mit Frühstück, Küche, Dusche mit Chromglanz und allen Schickanen. Die Herbergseltern und die Praktikanten sind sehr freundlich, ich mag aber den Luxus nicht. Kleine, liebevolllebendige Herbergen kann man nicht mit viel Geld ersetzen. Die Herberge heißt Sankt Niklaus von der Flüe. Der Name kommt mir bekannt vor, bin ich doch in Sachseln in der Schweiz, dem Heimatort der Legendengestalt, vorbeigewandert. Mit großem Interesse hört der Herbergsvater meiner Nacherzählung der Geschichte von Jakob zu. Einiges weiß auch er über Niklaus. In einer kleinen Kapelle neben der Herberge findet sich ein neues, aber nichtsdestotrotz wunderschönes Deckengemälde der Geschichte des Niklaus, der vier Evanelisten und anderer Geschichten, farbenfroh und perspektivisch gezeichnet. Ich bin begeistert. Beim abendlichen Stadtrundgang entdecke ich die alte imposante Burg und die Riesigkeit der Stadt in der Wüste. Spanische Städte sind Ereignisse, nicht nur Ansammlungen von Häusern. Treffe Uwe wieder; quatschen den ganzen Abend. Er möchte nach Portugal, zu einem Technofestival und dort seine Freundin Kathrin treffen, aber er hat nicht viel Hoffnung, daß sie noch mit ihm zusammen ist. Wir sitzen noch lange draußen am Springbrunnen, keiner ist müde und die Luft ist so schön und klar. [6.7.] Genau sechs Uhr beginnt ein großes Geräume in meinem Zimmer. Einer scheint seinen Rucksack komplett aus- und dann wieder einzupacken. Ich stehe um sieben auf, es gibt ein reichhaltiges Frühstück an der großen Tafel im Empfangsraum. Ich möchte heute einkaufen, deshalb brauche ich erst kurz vor zehn losgehen und setze mich noch zu Uwe, der feststellt, daß er gestern doch zwei Pappen Wein getrunken hat und nun ziemlich mau ist. Aber Uwe hat mich dazu inspiriert, wieder einmal draußen im Freien zu schlafen. Ich möchte heute für meine Kamera eine neue Speicherkarte kaufen, oder die fotografierten Bilder auf normale Disketten umladen. In einem kleinen Laden, der Drucker repariert, werde ich fündig: ein sehr freundlicher Mann, der sich ebenfalls für Computer interessiert, hilft mir dabei, ohne eine müde Pesete zu verlangen. Nebenbei erfahre ich, dass sein Bruder in Paris lebt. Ihn besucht er zweimal im Jahr. Eine schwindelerregende Brücke spannt sich über den Fluß, der die beiden Stadtteile Ponferradas verbindet, dann schließt sich ein Stadtviertel mit reichen Geschäftsauslagen an. Hochhaus lehnt sich an Hochhaus, eine unwirkliche Kulisse inmitten der ariden Trockenvegetation. Eine endlose Vorstadt erstreckt sich an den Stadtkern und begleitet unseren Marsch über die nächsten Stunden: Unmengen an Autowerkstätten und Pizzerias, ein weltbekanntes Szenarium. Ich wünsche mir, dass es bald wieder spanisch wird. Endlich kommen mir Weinberge unter die Füße, ein Hubschrauber löscht einen kleinen Flächenbrand; er überfliegt mich und sendet einen feuchten Nieselgruß aus seinem Wassertank. Die Beobachtung des Weines ist mir eine liebe Angewohheit über die Monate geworden; als Indikator für den Fortschritt des Pflanzenjahres. Villafranca del Bierzo ist die letzte Ortschaft der Bierzo-Ebene und Eingang zur Bergwelt Galiziens, der nordwestlichsten Region Spaniens. Es finden sich zwei Herbergen; die neugebaute ist praktisch und nichtssagend, die danebenliegende erzählt Geschichten. In ihr treffe ich natürlich Bekannte wieder: Uwe, Kitty und ihre Mutter Susan, Fernando und die Franzosen. Maria, die junge Spanierin, ist wieder da und ihre Eltern. Mich zieht`s in die Berge, beflügelt von dem Wunsch, wieder einmal den Abend unvorbereitet mit 78 allen Möglichkeiten auf mich zukommen zu lassen. Doch zuerst einmal finde ich eine schöne Badestelle, tauche ins eiskalte Wasser ab und befreie mich so vom Staub des Tages. Frischgewaschen kann der Abend kommen. Urplötzlich befinde ich mich im weiteren Verlauf des Tales auf einer nicht endenden Baustelle: in einem schmalen Tal verläuft eine stark befahrene Staatsstraße und daneben entstehen Brücken, Tunnel, Berge. Alles ist voller Dreck und Lärm, man kämpft sich wagemutig auf dem schmalen Seitenstreifen der Straße voran, zentimeternah pfeifen die Lastwagen vorbei, daß einem der Atem ins Stocken kommt. Ich denke, ich bin falsch hier, doch immer wieder mal taucht das Fragment eines der gelben Pfeile auf. Nach zwei Stunden Überlebenskampf taucht das von Straßen und Baustelle eingezwängte Dörfchen Vega del Valcarce auf. Ich finde die Herberge und setze mich ob des Preises von 800 Peseten nur zu den Pilgern und will dann weiterziehen und mir ein Fleckchen in den Bergen suchen. Doch zwei Spanierinnen, Elena und Lourdes aus Leon, wollen mich unbedingt einladen, hier zu bleiben. Sie bezahlen mir die Gebühr und obendrein schenkt mir noch die Schwester von Elena durchs Telefon tausend Peseten. Wie das geht? Ganz einfach. Ich soll ein Buch schreiben über die Reise. Im Garten spiele ich noch etwas Konzertina und bekomme wieder einmal zu erfahren, dass die deutschen Volkslieder sehr traurig klingen. [7.7.] Bin nun schon fast einhundert Tage unterwegs. Wüßte ich nicht, dass die Reise ein unabänderliches Ziel hätte, könnte ich, glaube ich, noch ewig weiterwandern. Aber nun stelle ich mich bereits auf das Ende ein. Ich freue mich auch, wieder nach Hause zu kommen. Mit Elena und Lourdes geht es zunächst an der verruchten Straße weiter, wir trinken Kaffee an einer Autoraststätte und sehen den Stierkampf von San Fermin in Pamplona. Wieder sind einige Menschen schwerverletzt. Dann gelingt es dem Weg, dem Elend der Straße auszuweichen auf einen kleinen 79 Dorfpfad. Und nun wird es romantisch. Während das Wetter über der Entscheidung sitzt, zu regnen oder nicht, erfüllt sich das Tal mit Dunstwolken und erzeugt eine traumhafte Stimmung. Uralte weißgekalkte Häuser beherbergen baskenbemützte Männer, schwarzgekleidete Senioras, behörnte Kühe und schlafende Balkonkatzen. Misthaufen dampfen, große Holzschuppen gewähren und geheimnisvolle dunkle Einblicke. Unmerklich steigt der Weg an, das Wetter ist zu einer Entscheidung gekommen. Wie es sich für Galizien gehört, fängt es an zu regnen, ganz leicht zuerst, dann jedoch so ausdauernd, dass es nichts gibt, was die Feuchtigkeit aufhalten könnte, bis ins Körperinnere vorzudringen, dann die Seele zu umgarnen, zu einem Wasserfisch zu machen. Der Wasserfisch hat ganz große Augen. Das äußere Wasser vermischt sich mit dem Schweiß, den der Aufstieg in die Wolken bewirkt. Endlich, in unglaublichen Höhen, sind wir in Galizien. Eine steinerne Platte kündet davon. Aus dem Nebel taucht O Cebrero auf. Wir haben irgendwie im Nebel eine unsichtbare Zeibarriere überschritten, denn wir befinden uns nun im keltischen Mittelalter. Schwarze bemooste Steinhäuser im dunstigen Nebelregen. Menschengestalten huschen vorüber, wollen ein trockenes Plätzchen erhaschen. Um uns eine Mahlzeit bereiten zu können, kaufen wir im einzigen kleinen Laden Mehl, Eier, Zucker und Äpfel. Dann verschwinden wir in einer der vielen Kneipen, um uns von der Tristesse der Sonnenlosigkeit zu erholen. Eine breite Bar verströmt warmen Kaffeduft, aus den Lautsprechern tönt keltische Musik, frische Tortilla wird bereitet, ein Buffett lädt zum Frühstücken ein: Lebewelt zum Fallenlassen und Genießen. Fast könnte man in dieser warmen Gemütlichkeit den regnerischen Tag vergessen und festwachsen. Mit Elena und Lourdes am Tisch wird`s richtig gemütlich. Alles paßt zusammen, die keltische Kultur werden wir später noch genauer kennenlernen. Als wir glauben, der Regen würde nun weniger werden, reißen wir uns vom Paradies aus vergangenen Zeiten los, schnallen die Satteltaschen auf unsere Adler und schwingen uns auf die wilden Gebirgspfade. Doch plötzlich lichtet sich der Nebel und man bekommt unerwartete Aussicht auf eine weitgefächerte nie geschaute Bergsilhouette. Die Landschaft würde ich vom Anblick am ehesten nach Irland lokalisieren. In Hospital de Condesa, einem Dörfchen von fünf Häusern und zwölf Seelen, hat der umsichtige "Jaxobeco", das Maskottchen des Jakobsweges im letzten, dem heiligen Jahr, eine neue Herberge errichtet, die dem Wetter trotzt und Obdach für ca. 40 Leute gibt, obwohl eigentlich nur Kapazität für 18 Personen ist. Einkaufsbedingt gibt es abends Plinsen mit Apfelstückchen und wieder einmal hat es Uwe geschafft, an der Mahlzeit teilzunehmen, er ist gern gesehener Gast, trägt mit seiner köstlichen 80 Gabe der Gesprächigkeit zur Tischrunde bei. Eigentlich sollten die Plinsen eine versunkene Apfeltorte zu Lourde`s Geburtstag werden, aber es war kein Backofen da, so wurde kurzfristig umdisponiert. [8.7.] Wieder beginnt der Tag nebelig, gegen Mittag lichtet sich der Blick und gibt das herrliche Bergpanorama frei. Dieser Rhythmus scheint zuden vielen örtlichen Regelmäßigkeiten zu gehören. Es geht durch viele kleine Dörfer in keltisch-irischem Stil, alle halben Kilometer steht jetzt ein Wegstein mit der Muschel und der genauen Entfernungsangabe bis nach Santiago. Der Zähler tickt nun unaufhörlich und wird die nächsten Tage begleiten. Das Ende nähert sich unaufhaltsam. Dass der Weg so schnell zu Ende geht, hätte ich nicht gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer werden wird, scih wieder an das normale Leben zu gewöhnen. Es ist schon ein ganz anderes Lebensgefühl als Pilger. Man kann die Bedingungen nicht genau beschreiben, man merkt nur den Unterschied, die Freiheit, die Größe, die Außergewöhnlichkeit, die geistige Auseinandersetzungsbereitschaft. Eine besondere Zeit; keine "Auszeit"; eher eine "Einzeit", eine Zeit, in der man bar aller Normalitäten eine Reise nicht nur in die geografische Ferne, sondern besonders in die eigene Tiefe macht. Der Weg, und dieses Wort wird für mich zu einem Heiligtum, war ein beständiges Kennenlernen, Verabschieden, Wiedersehen, aus den Augen verlieren. Und trotzdem wußte man von jedem, der auf der Reise war. Der Buschfunk funktioniert über Kilometer hinweg, oft wurde man von Fremden mit den Worten empfangen:" Ach, du bist wohl der...!" Die kuriosesten und die normalsten Leute unternahmen eine Zeit etwas gemeinsam, was sie über ihre Verschiedenheiten hinweg verband, gleichzeitig mit dem großen historischen Geschehnis "Jakobsweg" verband und dadurch zum Sprechen brachte. Zum Sprechen mit Worten und zum Sprechen durch Existenz, durch gemeinsames Erleben. Ein Weg kann zur Heimat werden, ständige Veränderung zur Sicherheit werden. Man gewöhnt sich daran, jeden Abend den Kopf woandershin zu betten. In jetzigem Zustand stelle ich mir vor, in meinem Zimmer zuhause unsicherer zu sein. Warum? Weil man die ständigen Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr hat, nicht mehr die Freiheit zu agieren. Ich hoffe, von diesem Gefühl etwas in mein heimatliches Dresden hinüberretten zu können. Gegen Mittag muß ich mich für einen von zwei Wegalternativen entscheiden, ohne zu wissen, was mich erwartet. Entscheide mich zuerst für die linke Version, weil die meisten nach rechts gehen, dann werde ich unschlüssig, weil der Weg an einer breiten Straße entlang führt, doch dann kommt die Pilgerin Martha aus Spanien entgegen und wir beschließen, ein Stück zusammen zu gehen. Mit schwarzen Haaren sagt sie mir, daß auf diesem Weg ein schönes Kloster wäre. Doch zuerst finden wir einen Wasserfall und haben Lust zu baden, es ist aber noch zu kalt mangels Sonne, doch später werden wir einen sonnigen Platz an einem Mühlgraben entdecken und ausgiebig der Badelust frönen. Wir gelangen auf ausgetretenen, von riesigen Bäumen bestandenen Wegen durch abgelegene Dörfchen, deren Alter kaum zu schätzen ist. Überall lebt Getier und viele Pflanzen, deren Namen Martha kennt. Erreichen schließlich das imposante Kloster Samos. In einem stallähnlichen Gebäudeteil ist die Pilgerbettenburg aufgebaut, die sich erstaunlicherweise füllt. 42 Plätze. Heute ist mein hundertster Tag, deshalb möchte ich in ein Restaurant gehen und einmal ausgiebig abendessen, so wie es andere Pilger tagtäglich tun. Es findet sich auch eine Gruppe, die mitkommt. Halb sieben gehen wir in die riesige Kirche zur Abendmesse. Kurz vorher verläßt ein Brautpaar die heiligen Hallen und wird vom gemeinen Volk mit Reis beworfen. Drinnen dann gregorianische Gesänge der wenigen Mönche. 81 Überdimensionale Gemälde entschlossener Heiliger an den Wänden. Ich bin barfuß. Natürlich ist im Dorf wieder eine Fiesta. Selbst das kleinste Nest kennt keine Knausrigkeiten und fährt eine riesige Bühne mit Band auf, zur Freude aller Anwesenden. Um allerdings in den Genuß der Party zu kommen, müssen wir als Pilger besondere Vorbereitungen treffen: zuerst suche ich einen Tapferen, der mitkommt. Eric. Dann befestigen wir im Laubwerk eines Baumes unsere Schlafsäcke und Isomatten, dann wird Eric unschlüssig. Dann kommen einige Leute mit, wir tanzen als erste schnell los, dann gehen wir kurz vor zehn wieder zurück, um zu erleben, dass die Herberge doch nicht schließt. Dann kommt wieder keiner der Pilger mit zurück ins Dorf, ich lege mich hin. Kaum eingeschlafen, kommt Eric und weckt mich, weil er doch tanzen gehen will. Aber ich will nicht mehr. [9.7.] Sitze am Weg und werde von den Nachfolgenden mit allem Nötigen versorgt: von Annemaria mit Sonnencreme, von Susan mit Lippencreme. Der Kilometerstein Einhundert ist schon ein Besonderer. An sich sieht er genauso aus wie all die anderen, aber er hat eine magische Fähigkeit in sich: er verwandelt alle Kilometerangaben, die bisher dreistellig waren, in zweistellige Beträge. Dafür ist sein Umfeld breitgetreten und sicher wurden unzählige Meter Zelluloid hier belichtet. Seine Oberfläche ist gnadenlos beschriftet. Schlafe an einer Herberge ein Stündchen und fange mir ein Zeckchen weg, welches ich handoperativ entfernen muß. Dabei kommt mir der Einfall, die letzten hundert Kilometer barfuß zu laufen. Sandalen an den Rucksack, und los geht`s. Beim wahnwitzigen Experiment lerne ich Fernando kennen, ein Restaurantbesitzer aus Madrid. Er hat sein Leben vollständig verändert, der Weg hat ihn dabei begleitet. Er geht ihn schon zum dritten Mal, hat einmal ziemlich viel von Reichtum, Geld und schickem Auto gehalten, jetzt führt er ein spirituelles Leben, tut nur noch Dinge aus Überzeugung. Ein Stück begleitet er mich, ich bin barfuß ein bißchen langsamer als er. Beim Unterhalten entdecken wir unserer beider Kochleidenschaft. Aber ich kenne ihm noch zuwenig von der spanischen Küche, deshalb werde ich in Portomarin gleich mal zu einem standesgemäßen Abendessen eingeladen. Ich richte mich im Notquartier, einer Turnhalle, häuslich ein und gehe zum ausgemachten Treffpunkt. Alles wird mir erklärt, alles muß ich probieren. Zuerst Empanadas, gefüllte Teigtaschen, dann gekochter Tintenfisch, "Pulpo", eingelegt in eine Ölsoße. Die Saugnäpfe grinsen mir entgegen, aber es schmeckt köstlich. Als dritter Gang panierter Aal mit Fritten, frisch gefangen. Es folgt Caldo Gallego, die typische galizische Suppe aus Bohnen, Kartoffeln und Kräutern. Weiter im Text mit Käsestückchen und Honig und einem guten Stück Tarte Santiago. Krönender Abschluß: ein Tässchen Cafè Solo. Zu trinken gibt es Wein und Selters. Fernando hat Bücher mitgebracht, eines über den 82 Jakobsweg aus den siebziger Jahren, leider in spanisch, aber die Bilder sagen viel über den Inhalt und ich begreife immer mehr von Fernandos Motivation des Pilgerns und er wird mir immer sympatischer. Wenn ich möchte, kann ich bei ihm im Restaurant ein Jahr lang kochen lernen. Was für ein Angebot! In der Turnhalle schlafen ungefähr 400 Pilger. Die Masse ist dadurch begründet, dass man die Urkunde "Compostellae" bereits bekommt, wenn man nur 100 Kilometer wandert. Und so gerät der letzte Teil des Weges zu einer Belastungsprobe für Leib und Seele. [10.7.] Gruppenweise wachen die Pilger auf. Mir macht es mittlerweile nichts mehr aus, wo und wie ich schlafe; ich habe sehr gut geschlafen. Der Weg führt die Pilgerschar zunächst über eine schmale Hängebrücke über einen Ausläufer des Mino, dem bedeutendsten Fluß Galiziens, gleichzeitig Grenzfluß zu Portugal im Norden. Die Kilometer verfliegen, man kann es an den steinernen Wegzeichen ablesen. Stellenweise haben sich Künstler und andere kreative Menschen verewigt, und ich habe Lust, es ebenso zu tun, bei einer zweiten Reise auf dem Camino. Einmal Camino- immer Camino! Die Pilger pilgern in Scharen parallel der Fernstraße, viele davon Jugendliche mit Fotoapparat und Gitarre. Ich treffe Allah wieder. Er spendiert köstlichen Milchkaffee, der unsere Kräfte weckt. Auf dem Camino habe ich das Kaffeetrinken gelernt. Der Weg führt durch kleine Dörfer, deren Leben sicherlich vom nicht abreißenden Pilgerstrom geprägt ist. Einige Bewohner haben ihren Geschäftssinn entdeckt und verkaufen Himbeeren, Obst, oder haben einen kleinen Kiosk aufgemacht. Durch das Bild, das ich gestern in einem der Bücher Fernandos entdeckt habe - ein Mädchen blickt in Finisterra gedankenverloren hinaus auf´s Meer - wird mir immer deutlicher, dass mein Weg erst richtig in Finisterra aufhört, wo es wirklich nicht mehr weitergeht. Santiago ist ein künstlich errichtetes Ende. Es symbolisiert für mich das Chrstliche: eine künstlich aufgepropfte Weltanschauung, die ein Ende setzt, wo noch keines ist: Suchende finden einen tieferen Weg, einen tieferen Bezug zur Geschichte und zu sich selbst. Ich erreeiche die "Fuente del Peregrino" - Peregrino ist der Pilger, Fuente ist die Quelle, ein liebevoll eingerichtetes, stilvolles altes Bauernhaus. Vor dem Haus schenken sich Trauben von Pilgern den kostenlosen Kaffee ein. Auf die beiläufige Frage eines Mädchens, das sich aus der Traube kichernder Helfer in der Küche herausgeschält hat, woher ich komme, antworte ich wahrheitsgemäß. Daraufhin trommelt sie die gesamte Mannschaft zusammen, die mit offenen Mündern vor mir steht und einige förmliche Fragen zusammenstammmelt. Dann zerstreut sich der Spuk und ich kann in Ruhe meinen Kaffee zu Ende trinken. Was macht man mit den letzten hundert Kilometern einer Reise, die einen monatelang beschäftigt hat, im 83 Mittelpunkt des Interesses stand? Schnell das Ziel erreichen wollen? Oder die Zeit hinauszögern, um die letzten Stunden noch zu genießen? Ich mache so weiter wie bisher und parke bei Kilometer 50, in Melida. [11.7.] Der letzte Teil des Weges, von Kilometer 50 bis Kilometer 20, Arca. Die Zeit, die man nun in Kilometern mißt, vergeht so schnell, man kann gar nicht alles aufschreiben. Letzte Nacht ist in der Herberge Arca ein Mann gestorben, friedlich in der Nacht eingeschlafen. Er war mit seiner Tochter unterwegs. Wenn sie kann, sollte die Tochter für ihren Vater den Weg zu Ende gehen, denke ich. Der Weg ist ein Weg zur Hoffnung. Durch Eukalyptuswälder und Mikrodörfer immer an der Fernstraße entlang. Gehe mit Spaniern zusammen bis zur letzten Herberge vor Santiago. Beim Abendbrot merke ich, dass es meinem Magen nicht gut geht. Die Aufregung? Trinke Tee und esse Weißbrot. Morgen bin ich in Santiago! [12.7.] Heiliger Morgen! Santiago! Nach einer kleinen Verirrung bin ich Punkt zwölf Uhr zur Messe zur Begrüßung der Pilger in der Kathedrale: ein riesen Monument, eines der wichtigsten Orte der katholischen Kirche. Architektur wie Musik. Doch wie fühle ich mich? Eingepfercht in den Touristenrummel, eine unbedeutende Nebenfigur. Keiner bemerkt, wer da gepilgert kommt. Drei Nächte "darf" man im Seminar für 500 Peseten die Nacht bleiben. Überall muß man Schlange stehen und Eintritt bezahlen. Gleich bei Ankunft in Santiago, noch unter den Eindrücken stehend, wurde ich gefrgt, ob ich ein Zimmer haben will. Es ist schrecklich, ich leide. Das, was einmal Ziel war, ist so nichtig und aus dem Traum entrückt, zur banalen Realität entartet. 84 Ich mache alle Riten mit, die ich bei den anderen reisegeführten Menschen beobachten kann: das Anfassen des Türpfostens, das Niederknien und Umarmen eines Steinkopfes, das Umarmen der Jesus-Altarfigur von hinten, die Besichtigung des silbernen Apostelgrabes. Aber es sind für mich inhaltslose Rituale. Ich bin von Enttäuschung und Banalität erfüllt. Ein riesiges Räucherfass wird über die Köpfe der Leute hinweg geschwenkt. Gekreisch, Jauchzen, Ducken. Dann hole ich mir die CompostellaUrkunde im Pilgerbüro ab. Lasse meinen Rucksack da, nehme nur den Schlafsack mit und ziehe mit Andy bis sechs Uhr morgens durch die Stadt. Ich will nicht in die Herberge. Andy labert mich mit seinen verrückten englischen Vokabeln voll und schleift mich durch alle Kneipen der Stadt, nigends kann er länger als zehn Minuten bleiben. Wir erleben gegen Mitternacht ein herrliches irisches Konzert auf dem Zentralplatz vor der Kathedrale, tanzen mit Amerikanern wild herum. Schlafen im Freien auf den Stufen einer Kirche abseits, am Rande der Stadt. [13.7.] Gegen zehn Uhr wachen wir müde und unausgeschlafen auf. wir besorgen uns ein Frühstück, Andy will mich wieder zutexten, ich wehre mich und will nur raus aus dieser Stadt. Und wirklich: nach einer halben Stunde Fußmarsch die letzten Häuser hinter mir, der Wald wieder um mich herum, Natur, Vogelgezwitscher, und meine Laune bessert sich spürbar auf, es kommt wieder Leben in meine Seele. Aufatmen. Nach einiger Zeit nimmt mich ein Kleintransporterfahrer ein Stück mit, bis zu seinem Zuhause. Dann laufe ich durch ein wunderschönes basaltenes Dorf mit romanischer Brücke und schon werde ich wieder mitgenommen: von Carlos, Veterinärmediziner, Mensch, Autofahrer. Er will auch zu dem keltischen Folkfestival 85 in Ortigueira, zu dem es mich auch zieht. Er will mich morgen mit hin nehmen, es sind immerhin noch 200 Kilometer bis Ortigueira. Bis Cee fährt er, dort sehe ich zum ersten Mal die Atlantikküste. Blau. Bis Finisterra nimmt mich ein Paar mit. Während die Frau die Tochter vom Kindergarten abholt, fährt mann mich bis an den Leuchtturm von Finisterra. Das Ende der Welt, die Küste des Todes am Atlantik, dem stillen. Nichts geht mehr. Nun sitze ich hier am Abgrund über den Wellen, wo das Reich der Fabelwesen beginnt und schaue in die Unendlchkeit und fülle meine Seele mit deren Geruch. Hier ist das Vorwärtskommen beendet, es gibt nur noch zurückdenken und -gehen. Meine Gedanken schweifen in die Ferne. Im Bild des Weges als dem des Lebens bin ich hier am Ende des Lebens angelangt. Doch es ist nnicht fremd und leer, das, wo ich hinschaue. Es ist fern, blau, kräuselt sich, rauscht... Eine Österreicherin geleitet mich zurück zur Pilgerherberge, ein todschickes neues Haus, wie üblich aber wird wieder gegen zehn Uhr dichtgemacht, während sich gerade draußen auf den Straßen das Leben zu regen beginnt. Ich will noch nicht schlafen und so setze ich mich an den Tisch zu einem exotisch turbanisierten Mädchen namens Frauke, wie die alten normannischen Kämpferinnen, die sich an der Seite der Männer verwegen in den Kampf stürzten. Sie kommt aus Ostfriesland, wohnt in Beerlin, ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin und flunkert herrlich. Sie begreift nicht, dass ich die letzten Kilometer mit dem Auto gefahren bin. Für sie ist der Camino der keltische Sternenweg an´s Ende der Welt, und der geht bis Finisterra... [14.7.] Die ersten Schritte rückwärts. Die Welt dreht sich andersherum, und dazu noch viel schneller. Ich verbringe den Tag damit, an den Atlantikstrand zu gehen, das Wasser zu fühlen, Muscheln zu suchen... Ich bin ein wenig betäubt von der Situation. Die Sonne scheint, das Wetter ist herrlich, alles riecht nach Meer und Fisch und Wasser. Gleichzeitig befinde ich mich hier aber an einer wichtigen historischen Stelle, an einem Schnittpunkt menschlicher Sehnsüchte, Träumen von der Unendlichkeit, Umkehrpunkten; und das für unzählige Menschen seit tausenden von Jahren. Ich denke, dass ich diese Tiefe nicht einmal ansatzweise erfassen kann. Die Auswirkungen der Wanderung und die Tiefe der Erlebnisse ist so umfangreich, dass ich dazu noch Monate brauchen werde. Und so nehme ich hier nur ganzheitlich wahr: den Wind, die Wellen, das Meer auf meiner Haut... Ich besehe mir den kleinen Hafen der Stadt, koche mir eine Fischpaella und warte auf die Rückkehr von Frauke, denn ich habe sie eingeladen, mit mir auf das Ortigueira´sche Folkfestival zu kommen. Einen Platz in seinem Wagen wird Carlos sicher noch übrig haben. Ich mache mir Gedanken darüber, warum das Ende des Weges so unangepaßt bedeutungslos ist. 86 Ich habe mir mehr erwartet; etwas, das zu der langen Distanz meiner Wanderung paßt. Ich komme mir vor wie ein gelandeter Raumschiffpilot, der nach einer monatelangen Mission an einer Straße landet, seine Sachen selber einsammeln muß und mit den Fußgängern gemeinsam an der nächsten Toilette anstehen muß. Es ist frustrierend, aber es wiederholt sich in den Berichten aller Reisenden, die den Jakobsweg auf einer längeren Distanz gewandert sind. Alle sind enttäuscht von Santiago und wundern sich über die völlig andere Wahrnehmung der Stadt durch die Kurzzeitwanderer: diese finden Santiago spannend, kulturell, bunt und schön; können drei Tage billig übernachten und dann nach Hause zurückkehren. Ich werde beobachten und lernen... Wir trampen los und völlig unerklärlich hält doch wirkllich ein deutscher Reisebus an und nimmt uns ein Stück mit. Drinnen Jakobsweginteressierte und -belesene ältere Damen und Herren, die uns neugierig begucken und befragen. Dann kramt eine Frau ihre Fotokopien raus und beginnt, über die alten keltischen Jakobswege zu referieren. Ein nächstes Stück werden wir von einem sehr alten Mann mitgenommen und an einer Kreuzung abgesetzt, mitten in der Pampa und wir fragen uns, wie wir Carlos erreichen, doch da kommt er auch schon angedüst... Was bleibt noch groß weiter zu erzählen? Wir feiern drei Tage den Tag und die Nächte durch, ich scheide bereits am zweiten Tag aus dem Rennen aus, bekomme einen Leistenbruch, den ich mir vom Notarzt diagnostizieren lassen muß. Nach drei Tagen bin ich schon wieder in Santiago und das schon bekannte Santiagosyndrom schlägt zu: eine Odyssee wird der Aufenthalt und die letzte Nacht in Santiago. Wir kommen am Busbahnhof an, ich schließe meinen Rucksack im Schließfach ein, weil ich ihn nicht mehr tragen kann, nehme nur Schlafsack und Isomatte mit. Wir gehen zum Pilgerbüro in der Innenstadt, weil Frauke dort nach einer Annonce sehen möchte. Wir erfahren dort, dass nur morgen oder in vier Tagen ein Bus nach Deutschland fährt. Vier Tage können wir nicht bleiben, weil man nur drei Tage in der Herberge darf. Also muß ich noch zum Busbahnhof einen Platz reservieren. Damit ich schneller bin, lasse ich den Schlafsack im Pilgerbüro. Laufen muß ich, weil kein Bus dahinfährt. Unterwegs steht ein armes altes Mütterchen neben einer Mülltonne und bittet mich, ihr einen schweren Müllsack in die Tonne zu heben. Es tut mir so leid, ihr wegen dem Leistenbruch nicht helfen zu können. Aber diese Situation ist typisch für mein Erleben von Santiago. Im Bahnhof ist aber der Computer gerade kaputt, aber mir wird zugesichert, dass ein Platz frei ist. Ich muß nur morgen zeitig da sein. Das kann schwierig werden. Nun muß ich nur noch schnell etwas einkaufen. Nur gut, dass ich Schlafsack und Isomatte nicht dabei habe, da kann ich ein bißchen mehr tragen. Dorthin muß ich wieder laufen, weil auch dahin nichts fährt. Als ich mit dem Einkauf fertig bin und am Busbahnhof bin, merke ich, dass die Zeit soweit fortgeschritten ist, dass ich nicht mehr an meinen Schlafsack komme. Und auch die Herberge hat bald geschlossen. Also düse ich zur Herberge. Die ist voll, kein Bett mehr frei, nur noch ein Platz auf dem Fußboden. Also meine Aussicht: mit Leistenbruch ohne Isomatte und Schlafsack auf dem Fußboden schlafen und dafür 500 Peseten bezahlen. Ich bin überglücklich! Aber es geht nicht anders: ich sammle mir in der Herberge alte Decken zusammen und schlafe in einem Klassenzimmer. Ich greine und hasse Santiago! [18.7.] Ist das nicht fabelhaft: ich habe ein Busticket, die Einkäufe sind im Bahnhof deponiert, meine Wanderniere muckert nicht, wenn Sie wissen, was ich meine, und: ich lebe! Gleich früh um sieben gehe ich in die Stadt. Ich reiße mich zusammen. In der Kathedrale herrscht eine unglaubliche Stille. Eine lange Zeit über habe ich meinen Jakobus alleine; das heißt, seine Kiste. Ich lümmel vor dem Grab so vor mich hin und denke an Jakobus und was er mir so eingebrockt hat, da kommt eine Gruppe mit Pfarrer, der das Gitter öffnet und schon bin ich direkt vor dem Grab des Apostels. Direkt vor mir wird 87 gelesen, Oblate gegessen, gesungen, gesprochen, das Grab berührt. Faszinierend und ein wenig tröstlich, heilend für die Wunden, die mir die Stadt zugefügt hat. Drinnen im Busbahnhof treffe ich die zermürbte Frauke, die mit sich ringt, den Bus zu nehmen oder zu trampen. Wir fahren zusammen. Santiago- Dresden in einem Stück. Ein Bus, zwei Fahrer und fünf Passagiere... Der Himmel kommt näher. [Ende] 88 Der "Sankt- Jakobs- Weg" oder auch "Chemins de St. Jacques de Compostelle" oder der "Camino de Santiago" genannte Weg ist ein mittelalterlicher Pilgerweg, der aus allen Orten Europas ausgeht, mit dem gemeinsamen Ziel Santiago de Compostella. [Link zur europäischen Karte der Jakobswege] 1986 setzte die UNESCO den Pilgerweg nach Santiago de Compostella auf die Liste des Weltkulturerbes, unter dem Titel "Pilgrimage 2000 – unterwegs für das Leben" werden derzeit viele der mittelalterlichen Jakobus-Pilgerwege wiederbelebt. Nach Mitteilung der Deutschen Jakobus-Gesellschaft in Aachen sind derzeit 350 Kilometer, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, rekonstruiert, 250 weitere sollen in diesem Jahr hinzukommen. Tips und Hinweise für Pilger gibt es bei: Deutsche St.Jakobus-Gesellschaft e.V., Wilhelmstraße 50, 52970 Aachen, Telefon 02 41 / 47 9 01 27. Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V., Sekretariat Wolfgang E. Biernat, Keesburgstraße 1, 97074 Würzburg, Telefon 09 31 / 7 97 26-0. Santiago de Campostela steht für die berühmte Jakobswallfahrt, einer Massenpilgerwanderung zu einem besonderen heiligen Ort. Jakobswege gibt es außer in Spanien auch in Deutschland, Italien, England und natürlich Frankreich. Was treibt die Menschen zu so beschwerlichen Wanderungen und wo besteht der Zusammenhänge zum Gral? Menschen wie Augustin, Luther oder Dante meinten, das gesamte Leben sei als Pilgerreise anzusehen. Im Beresinalied (1812) heißt es z.B.: Unser Leben gleicht der Reise eines Wandrers in der Nacht jeder hat auf seinem Gleise etwas was ihm Kummer macht Die Entdeckung, daß einer der Apostel Jesu hier begraben ist, führte zur Gründung einer heiligen Stadt. Seit über 1000 Jahren ziehen Pilger aus ganz Europa über den Jakobsweg in den Nordwesten Spaniens, nach Santiago de Compostella. Viele haben der anstrengenden Reise Monate ihres Lebens gewidmet, sie gehen zu Fuß und halten bei den zahlreichen Klöstern, Hospizen und Kirchen entlang der Strecke. Die prachtvolle Kathedrale steht in dem Ruf, die sterblichen Überreste Jakobus zu enthalten, des Apostels und Cousins Christi und späteren Schutzheiligen Spaniens. Zusammen mit Petrus und Johannes nahm Jakobus unter den Jüngern eine besondere Stellung ein, denn diese 89 drei sind Zeugen der Transfiguration Christi gewesen. Die Legende erzählt, daß Jakobus nach dem Tod Christi nach Spanien zog, um dort das Evangelium zu verkünden. Jakobus wurde 44 n. Chr. von Herodes Agrippa I. in Jerusalem hingerichtet und damit zum ersten Apostel, der den Märtyrertod erlitt. Die Legende berichtet weiter, daß seine Schüler die sterblichen Überreste bei Jaffa in Palästina in ein Boot legten. Sieben Tage später erreichte dieses - geleitet von der Hand Gottes und günstigen Winden - die Atlantikküste Spaniens bei Iria Flavia, 32 Kilometer vom heutigen Santiago entfernt. Nach einer weiteren Reise im Ochsenkarren wurde Jakobus schließlich genau dort beigesetzt, wo die Ochsen wunderbarerweise plötzlich anhielten. Anfang des 9.Jahrhunderts wurde der Eremit Pelagius, der in der Nähe von Iria Flavia lebte, durch wundersame Himmelszeichen zu einem Marmorgrab geleitet. Der zuständige Bischof erkannte darin sofort den Schrein des hl. Jakobus und benachrichtigte König Alfons II., der keine Zeit verlor und Jakobus umgehend zum Schutzheiligen des Königreiches ernannte. Damit hatte Alfons eine ausgesprochen kluge politische Entscheidung getroffen, denn das christliche Spanien war wieder einmal in Gefahr, von den Mauren überrannt zu werden. Wer konnte die Christen nun besser motivieren als der hl. Jakobus? Bei der Schlacht von Clavijo in Kastilien (844 n. Chr.) soll der Heilige auf einem weißen Pferd an der Spitze des christlichen Heeres erschienen sein, dem es dank des Wunders ein leichtes war, den Feind rasch zu überwältigen. Die Kunde von der Entdeckung des Schreines des hl. Jakobus verbreitete sich schnell über die Christenheit. 950 zog der erste berühmte Pilger, Bischof Godescalc aus Le Puy in der französischen Auvergne, mit einer Reihe von Gefolgsleuten nach Santiago. Die Wallfahrt wurde bald zu einer festen Tradition, nicht zuletzt dank Einflußnahme der mächtigen Benediktinerabtei von Cluny in Frankreich, die entlang der Strecke Priorate, Hospitäler und Herbergen errichtete. Endgültiges Reiseziel der Pilger, die es zum hl. Jakobus zieht, ist die prachtvolle Kathedrale von Santiago. Der architektonische Prachtbau ist reich an Altären, Kapellen, Gemälden und Skulpturen. Als erste große Kathedrale des spanischen Mittelalters wurde Santiago - spanisch für hl. Jakobus - etwa 1074 begonnen. Bauherr war der Bischof Gelmirez. Über den Jakobsweg kommen Pilger aus ganze Europa nach Compostela. Die Ausgangspunkte der vier Hauptstrecken liegen in Frankreich - Tours, Vezelay, Le Puy und Arles - und treffen später zu einer Route zusammen, die durch Nordspanien nach Santiago führt. Auch durch Deutschland führen Jakobswege; man sagt überhaupt, daß es soviele Jakobswege wie Pilger gibt. Bei einer Radtour nach Torgau entdeckte ich ein Schild, welches darauf hinwies, daß an dieser Stelle der Jakobsweg in einer Furt die Elbe querte. Der Jakobspilger kennzeichnet sich mit einer Muschel, die er bei seiner Ankunft in Compostella erhält. Dies hat die Historie, daß der heilige Johannes, als er ins Meer sprang, von den Muscheln gerettet wurde und ans Land geschoben wurde. Der "Liber Sancti Jacobi" bzw. "Codex Calixtinus" schreibt in seinem ersten Kapitel: Vier Wege führen nach Santiago, die sich zu einem einzigen in Puente la Reina in Spanien vereinen; einer geht über St.Gilles, Montpellier, Toulouse und den Somportpaß; ein anderer über Notre-Dame in Le Puy, Ste.Foy in Conques und St.Pierre in Moissac; ein weiterer über Ste.Marie Madeleine in Vézelay, St.Léonard in Limousin und die Stadt Périgueux; ein letzter über St.Martin in Tours, St. Hilaire in Poitiers, St.Jean in Angély, St.Eutrope in Saintes und die Stadt Bordeaux. Diejenigen Wege, die über Ste.Foy, St.Léonard und St.Martin führen, vereinigen sich in Ostabat, und nach dem Überschreiten des Cispasses treffen sie in Puente la Reina auf den Weg, der den Som portpaß überquert; von dort gibt es nur einen Weg bis Santiago. Der Weg nach Santiago de Compostela ist ein Weggeflecht, das sich über ganz 90 Europa zieht, in vier großen Wegen von Paris, Vézelay, Le Puy und Arles durch Frankreich zieht, bei Roncesvalles und Somport die Pyrenäen überquert und sich bei Puente la Reina zur großen Pilgerstraße, dem camino frances durch Nordspanien, vereinigt. Die romanische Kunst hat entlang dieser Pilgerstraßen bedeutende Kunstwerke geschaffen. Pilger aus dem Norden und dem nördlichen Mitteldeutschland suchten hauptsächlich über Köln und Aachen (die sog. "Niederstraße"), zuweilen auch über das Moseltal, Anschluß an die Wege von Paris/ Tours bzw. Vézelay/St.Gilles. Pilger aus dem südlichen Mitteldeutschland und aus dem oberdeutschen Raum zogen die "Oberstraße" über Einsiedeln und Genf ins Rhonetal, von dort dann die Straße nach Le Puy. Vom Norden Deutschlands und von England aus wurden oft Pilgerfahrten per Schiff unternommen. 91