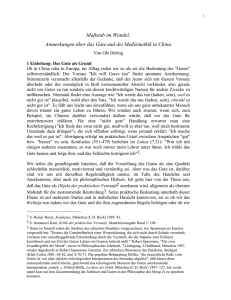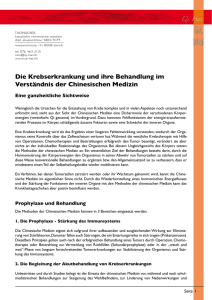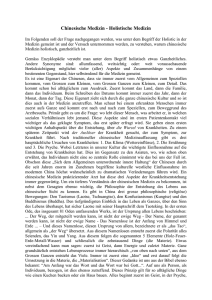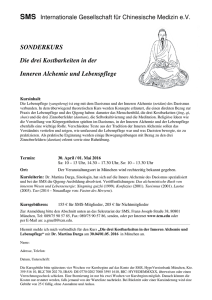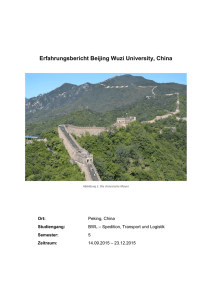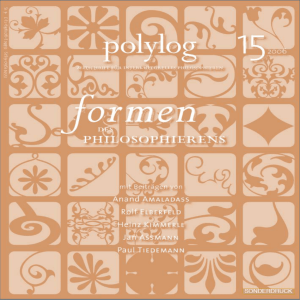das beispiel china - Ruhr
Werbung

Erscheint in: Kurt Bayertz, Hg, Die menschliche Natur. Welchen und wieviel Wert hat sie?, Mentis 2004 Heiner Roetz DER STEIT UM DIE MENSCHLICHE NATUR. DAS BEISPIEL CHINA I. Hintergründe des „achsenzeitlichen“ Naturdiskurses Dem Thema Natur kommt in der „Achsenzeit“ (K. Jaspers) der antiken Hochkulturen eine Schlüsselrolle zu. In den Traditionsbrüchen der Epoche wird gegen das Herkommen und damit gegen die Geschichte das Denken auf ein neues Zeitparadigma umgestellt – an die Stelle der Traditionen, zumindest in Konkurrenz zu ihnen, tritt die Besonderheit der Gegenwart oder die Konstanz der Natur. Vor allem ist es dabei um die Orientierung an der Natur des Menschen gegangen – bis heute ein Thema mit brisanten politischen Implikationen. Die griechischen Sophisten des 5. und Kyniker des 4. Jahrhunderts v. Chr. attackieren in ihrem Namen Sitte und positives Gesetz (Heinimann 1945; Strauß 1977; Roetz 2000), nicht anderes als in etwa zeitgleich die Daoisten Chinas. Zur Frage der menschlichen Natur sind für das alte China über ein Dutzend verschiedener Positionen nachweisbar, wenngleich oft nur die Grundthesen überliefert sind (Roetz 1992: 318). Neuere archäologische Funde haben das Spektrum noch erweitert. Im Unterschied zu den Griechen wurde es zur Mehrheitsüberzeugung der chinesischen Antike, dass die Menschen nicht von Natur verschieden sind (Munro 1969) – wie es schon bei Konfuzius heißt, „stehen sie von ihrer Natur her einander nahe, und sie entfernen sie sich voneinander erst durch ihre Gewohnheiten“1 (Lunyu 17.2). Wie aber die allen gemeinsame Natur einzuschätzen sei, wurde aufgrund ihrer normativen Implikationen zur wohl meistumstrittenen Frage der klassischen chinesischen Philosophie. In später Zeit ist auch die Skepsis gegenüber der Annahme einer für alle Menschen gleichen Natur selbst gewachsen. Alternative Übersetzungsmöglichkeiten sind „durch (tägliche) Übung“ oder „durch die Sitten.“ 1 118 Das Beispiel China Die sehr frühe Prominenz der Thematik verdankt sich der historischen Entstehungsbedingung der chinesischen Philosophie – nämlich einer tiefgreifenden Krise der politischen Ordnung, des sozialen Systems und des Weltbildes um die Mitte des letzten Jahrtausends v. Chr.. Hintergrund ist der Zerfall der etablierten Feudalordnung unter der Dynastie Zhou und ihrer tragenden Säulen Tradition und Religion – genauer: des tradierten Kodex der sittlichen Verhaltensregeln (li), der auf die alten Stammesinstitutionen der Zhou zurückgeht, und der Religion des „Himmels“ (tian). Diese Krise führt zu einem bis dahin völlig unbekannten neuen Weltgefühl – nämlich in einer „chaotischen“ und „untergehenden“ Welt zu leben, die aus ihren Angeln geraten ist, sich „zerspalten“ und womöglich irreparablen Schaden genommen hat. Als intellektuelle Antwort auf diese Herausforderung entstehen die großen Grundrichtungen der chinesischen Philosophie. Sie sind, wie unter den gegebenen Umständen kaum anderes denkbar, gekennzeichnet durch Distanznahme gegenüber all jenen Faktoren, die die Zerreißkrise der chinesischen Gesellschaft zumindest nicht verhindern konnten: den etablierten religiösen Mächten (Himmel und Geister), den sozialen Autoritätsinstanzen (Eltern, Ältere, Lehrer, Herrscher), den geteilten Überzeugungen der „Vielen“ (zhong – den polloi der Griechen), den hergebrachten Konventionen und den Vorbildfiguren der Vergangenheit. Sie alle geraten unter Verdacht und unter Angriff, wenngleich je nach philosophischer Richtung in unterschiedlicher Akzentuierung und Intensität und mit unterschiedlichen Implikationen. Die lange Zeit funktionierende Orientierung am historisch Überlieferten wird auch als solche systematisch in Frage gestellt. Es findet sich ein breites Spektrum von Zweifeln, aus denen die Überzeugung spricht, dass eine Lösung nicht einfach im Zurück zu den schon bekannten Standards liegen kann.2 All dies heißt nicht, dass jede Vorbildfunktion des „Alten“ aus den intellektuellen Diskursen der Zeit verschwände. Die Geschichte verliert 2 (Sach)logisch wird argumentiert, dass die Tradition bzw. das Alte schon deshalb nicht gegen das Neue gestellt werden können, weil sie selber einmal entstanden ist, also neu waren. Geschichtstheoretisch wird argumentiert, dass die Tradition dem Wandel der Zeiten nicht standhält. Empirisch wird auf die Heterogenität und Komplexität und damit Uneindeutigkeit der Tradition hingewiesen. Epistemologisch wird die Vagheit allen überlieferten Wissens hervorgehoben. Ontologisch wird die Unmöglichkeit der Weitergabe des Wahren – des Dao – behauptet, das, so die Daoisten, nur jeder in eigener unmittelbarer Anstrengung (vor allem: meditativ) erlangen kann. Ethisch wird auf die mögliche moralische Fragwürdigkeit der Tradition verwiesen – so duldeten Traditionen etwa die Tötung der Erstgeborenen oder der Alten, obwohl dies Menschlichkeit und Gerechtigkeit widerspreche. Ideologiekritisch schließlich – ein nachklassisch ergänztes Argument – werden die Zeugnisse vom Vergangenen als erfunden oder manipuliert entlarvt, da nun einmal „die vulgäre Welt das Alte liebt und der Gegenwärtige verachtet“. Vgl. hierzu Roetz (2004a). Heiner Roetz 119 aber doch den unumstrittenen Status, den sie in der frühen, vorkritischen Literatur mit der permanenten Anrufung der heroisierten Dynastiegründer und der wertvollen vergangenen Erfahrungen besitzt. Allen normativen Orientierungen am Vergangenen und Hergebrachten erwächst nun die Konkurrenz neuer ahistorischer Paradigmen, die nicht mehr (zumindest nicht primär) auf Überlieferungswissen bauen und in einer anderen Zeitdimension liegen – der Gegenwart. Begleitet werden die betreffenden Argumente von einer expliziten und mehrfach dokumentierten Verschiebung des epistemologischen Fokus' vom bloßen Hören – vom Hören nämlich, was andere sagen und gesagt haben – zum persönlichen direkten „Sehen“, wie vom „Entfernten“ zum „Nahen“ und Gegenwärtigen (Roetz 2004a). Bei den konkurrierenden Paradigmen, die dem Traditionalismus entgegengesetzt werden oder ihn doch in einer bestimmten Weise zurechtrücken, handelt es sich in einer allgemeinen Taxonomie um die Paradigmen des Nutzens (yong), der Praktikabilität oder nüchtern kalkulierten sozialtechnischen Machbarkeit (ke), der internalisierten Moralität (ren) und schließlich des Natürlichen (tian, xing). Sie stehen jeweils für den Mohismus, den Legismus, den Konfuzianismus und – zunächst – den Daoismus, die damit nahezu idealtypisch ein Spektrum an (in den einzelnen Ausformungen sich freilich auch überlappenden) postkonventionellen ethischen bzw. quasi-ethischen Positionen abdecken. Hierbei sind noch die geschichtsnächsten Positionen, so die des Konfuzianismus, vom geschichtskritischen Zweifel berührt. II. Der Daoismus Das Paradigma „Natur“ wandert über Mengzi (ca. 372-281) auch in den Konfuzianismus über; es kann aber zunächst insofern für den Daoismus stehen, als es durch diesen und seine Vorläufer zu einem zentralen Diskussionsthema gemacht, wenn nicht in die Diskussion eingebracht wird. Wenn der Daoismus unter einem gemeinsamen Motto operiert, dann ist es eben jenes des Natürlichen. Die Natur ist in der Vorstellung der frühen Daoisten eine zweckfreie, bunte, gemessen an menschlichen Maßstäben chaotische (hundun) Mannigfaltigkeit von sich selbst steuernden Prozessen und Wesen, die in ihrem ungeplanten „von selbst so sein“ (ziran) von absoluter Vollkommenheit ist und um jeden Preis von menschlichem Zugriff freigehalten werden muss. So heißt es im daoistischen Klassiker Zhuangzi: 120 Das Beispiel China Ein Mensch der höchsten Richtigkeit wird des Wesens seiner Natur (xing) und seiner physischen Existenz (ming, auch: Bestimmung) nicht verlustig gehen. Deshalb wird er Verbundenes nicht für einen [abnormen] Zusammenwuchs und Verzweigtes nicht für einen [abnormen] Auswuchs halten. Er wird das Lange nicht als Übermäßig und das Kurze nicht als unzureichend ansehen. Deshalb: Mögen die Beine der Wildente auch kurz sein, sie zu verlängern, würde ihr Kummer bereiten. Mögen die Beine des Kranichs auch lang sein, sie zu kürzen, würde ihm Leid zufügen. So ist das von Natur aus Lange nichts, was zu kürzen und das von Natur aus Kurze nichts, was zu verlängern wäre, und es gibt keine Sorge, der man abhelfen müsste... Was sich mit Hilfe von Kurvenlineal, Lot, Zirkel und Parallelmaß richten lässt, lässt sich seine Natur (xing) vergewaltigen. Was sich mit Schnüren, Leim und Lack zusammenfügen läßt, läßt sich seine Urtugend antasten. Wer Etikette und Musik zurechtbiegt und Menschlichkeit und Gerechtigkeit heuchelt, um das Herz der Welt zu trösten, der hat deren invariante Beschaffenheit (chang ran) verfehlt. Die Welt hat eine invariante Beschaffenheit. Diese invariante Beschaffenheit besteht darin, dass Krummes nicht ein Kurvenlineal, Gerades nicht ein Lot, Rundes nicht einen Zirkel, Viereckiges nicht ein Parallellineal, Zusammenfügung nicht Leim und Lack und Verbindung nicht Kordel und Seil voraussetzt. (Zhuangzi 8, 142 f.) Ferner: Was bedeutet Natur (tian), und was bedeutet Mensch?... Daß Rinder und Pferde vier Beine haben, das heißt Natur. Den Kopf des Pferdes unter das Zaumzeug zu zwingen und die Nase des Rindes [für den Ring] zu durchbohren, das heißt Mensch. Deshalb sage ich: Zerstöre die Natur nicht durch Menschliches! Mache die physische Existenz (ming) nicht durch Zwecke zunichte! Opfere die Gabe nicht dem Ruhm! Bewahre [sie alle] sorgfältig und gehe ihrer nicht verlustig! Das nennt man die Rückkehr zum Wahren. (Zhuangzi 17, 260 f.) Diese Passagen verdeutlichen die spezifische Struktur des Wortfeldes „Natur“, die den chinesischen Diskursen zugrunde liegt – es wird mit Begriffen operiert (tian, Himmel, bzw. spätzhouzeitlich die Natur im Großen, wenngleich auch noch mit der ursprünglichen religiös-ethischen Konnotation verwandt, xing, die jeweilige Natur einer Art, weniger eines Individuums, im Sinne der spontanen „natürlichen“ Tendenz, ming, die Bestimmung oder das physische Leben, ferner ziran, das, was „von selbst so ist“), die mit dem uns vertrauten Gesamtbegriff „Natur“ nicht deckungsgleich sind, aber dessen Bedeutung und Extension hinreichend entsprechen, um mit ihm in einen direkten Bezug gesetzt zu werden und Heiner Roetz 121 überhaupt von einer chinesischen Naturdiskussion sprechen zu können (Roetz 2004b). Die aus dem Zhuangzi zitierten Stellen zeigen die typische Doppelschichtigkeit des daoistischen Naturalismus: Die Natur ist nicht nur auf der deskriptiven Ebene Inbegriff des gerade in seiner Unreglementiertheit Selbstgenügsamen und Zureichenden. Sie hat hierin normativen Gehalt für den Menschen selber. der aufgefordert ist, aus ihr seine eigenen grundlegenden Verhaltensmaximen zu gewinnen – allen voran die Maxime wuwei, die Handlungsenthaltung bzw. der Manipulationsverzicht, die den Naturzustand auszeichnet, zudem Intellektlosigkeit, Affektlosigkeit und Amoralität, für die das Nämliche gilt. Hiermit allerdings folgt der Mensch nicht nur dem Vorbild der äußeren Natur – er verwirklicht zugleich die Bestimmung seiner eigenen spontanen Disposition xing, die „ganz zu bewahren“ ist (quan xing, Yang Zhu lt. Huainanzi 13, 218). Sich dieser seiner „Natur“ zu überlassen, wird für den Daoismus zum Inbegriff des Guten. Dieses selbst wird entsprechend rein naturalistisch definiert, explizit gegen jede menschliche oder auch göttliche Normgebung: Was ich gut nenne, ist nicht das, was man Menschlichkeit und Gerechtigkeit nennt, sondern gut zu sein in seiner [vormoralischen] Urtugend. Was ich gut nenne, ist nicht das, was man Menschlichkeit und Gerechtigkeit nennt, sondern sich dem Wesen seiner Natur und seiner physischen Existenz zu überlassen, und nur dieses. (Zhuangzi 8, 148) Was das Zhuangzi das „Wesen seiner Natur und seiner physischen Existenz“ (xingming) nennt, zeigt sich zunächst im schlichten Leben der Mitglieder der Urkommune, die sich „unwissend“ und „begierdelos“ „wie Frühlingsraupen“ träge vor sich hin bewegen (Zhuangzi 9 u. 12, Roetz 1984: 151 f.) in einer Welt, der jede Spur von Aggression und Gewalt fremd ist. Doch erlebt diese idealisierte Einheit mit dem Aufkommen der spezifisch menschlichen Zivilisation ein tragisches Ende: Der Herrscher des Südmeeres war Hu (Jäh), der des Nordmeeres war Shu (Abrupt), und der der Mitte war Hundun (Chaos). Hu und Shu trafen sich von Zeit zu Zeit auf dem Gebiet von Hundun, und stets behandelte sie Hundun mit der größten Freundlichkeit. Da berieten Jäh und Abrupt, wie sie die Güte von Hundun vergelten könnten. Sie sprachen: 'Jeder Mensch hat sieben Öffnungen, nur Hundun hat keine. Wir wollen ihm mal welche meißeln!' Jeden Tag meißelten sie eine Öffnung. Am siebten Tag war Hundun tot. (Zhuangzi 7, 139) 122 Das Beispiel China „Hu“ und „Shu“, „Jäh“ und „Abrupt“, sind Versinnbildlichungen des gewaltsamen Einbruchs des Menschen in die Natur, der dieser als dem jeder Norm fremden und selbstgenügsamen „Chaos“ sein Gesicht aufzwingt. Voran geht die „Aufrührung“ des menschlichen Denkens (Zhuangzi 11, 168-171, Chang 1982: 342 f.), das Kalkül und Strategie freisetzt, um über Menschen und Dinge zu herrschen. Die Folge ist eine doppelte Entzweiung von Mensch und Natur: Der einmal entfesselte kalkulierende Verstand zerstört nicht nur die äußere Natur, sondern auch die dem Menschen angeborene innere und damit den Menschen selber. Der Daoismus steht im Zeichen des Bemühens um die „Rückkehr“ zur verloren gegangenen Einheit durch Mimesis. Hierbei greift er u. a. auf die frühkindliche natürliche Spontaneität zurück, die die ontogenetische Entsprechung zum substantiellen Leben des Urzustandes ist.3 Gegen die Zerstörung alles Natürlichen durch den Menschen setzt er die Parole „Zurück zur Kindheit“ (fu gui yu ying'er, Laozi 28). Er formuliert so im Namen der Natur eine doppelte Provokation für alle Ethiken, die in den Bemühungen der menschlichen Zivilisation bei allen Schattenseiten auch einen Fortschritt sehen: Er verwirft nicht nur die vom Menschen zu verantwortende Geschichte, die mit Staat, Moral, Kultur und Technik eine repressive Manipulation über die Welt gebracht hat, sondern auch jede Erziehung, die die präkonventionelle Spontaneität durch eine normierte Künstlichkeit erdrückt. Die dem präkonventionell Natürlichen entgegengebrachte Huldigung hat allerdings ihren Preis: Der chinesische Legismus biegt den Daoismus funktionalistisch um, indem er eben nach dem Modell des natürlichen Selbstlaufs ein politisches System entwirft, in dem jede Spur der Freiheit verschwindet (Roetz 1992: 416, 421) – eine Usurpation der ersten durch zweite Natur, gegenüber der der Daoismus hilflos ist. III. Die konfuzianische Antwort 1: Mengzi Angenommen wird die daoistische Herausforderung durch den Konfuzianismus, der in der Ethik den Weg zur Überwindung der Krise Chinas sieht, und der zwei ihrerseits miteinander konkurrierende Antworten findet, um den amoralischen daoistischen Naturalismus zu kontern. Die eine Antwort ist die Mengzis, der, ohne sich auf die genannten, zu seiner Zeit in der Luft liegenden daoistischen Theoreme explizit zu beziehen, der Sache nach eine Gegenposition zu ihnen entwickelt. Er 3 Zu den zahlreichen Idealisierungen der frühen Kindheit im Daoismus s. Roetz (1992: 394 f.). Heiner Roetz 123 folgt der Idealisierung der menschlichen Natur, besetzt sie aber konfuzianisch. Mengzi erwidert den moralkritischen Protagonisten des Natürlichen, dass die menschliche Natur tatsächlich „gut“ ist – aber nicht im außermoralischen Sinne, sondern eben im Sinne der vom Konfuzianismus vertretenen moralischen Werte. So sollen dem Menschen die „Ausgangspunkte“ der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit, der Höflichkeit und des Wissens um richtig und falsch vom „Himmel“ verliehen, also angeboren sein. Allerdings unterscheidet Mengzi hierbei einen höheren und einen niederen Teil des Menschen und differenziert zu diesem Zweck die im Daoismus zusammengefügten Begriffe xing und ming (Natur und Bestimmung/physische Existenz) – nur dem höheren Teil, der für Mengzi auch die „wahre Verfassung“ qing des Menschen ausmacht (Mengzi 6a:8), kommt der Name xing zu, während ming die niederen Lebensfunktionen kennzeichnet (Mengzi 7b:24). Gleichwohl – die moralischen „Ausgangspunkte“ brauchen den Körper. Sie entfalten, vorausgesetzt, sie bleiben ungestört, bei den entsprechenden Auslösern eine unmittelbare, im biologischen Teil der menschlichen Konstitution physiologisch registrierbare Wirkung. Mengzi demonstriert dies anhand einer Art moralischer Phänomenologie – Schweißausbrüche, Veränderungen der Pupillen, die Körperhaltung, wieder das spontane Verhalten der Kinder, nämlich ihre liebevolle Zuneigung zu den Eltern, vor allem aber das Erschrecken und Gepacktwerden von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft beim Anblick eines Kindes, das dabei ist, in einen Brunnen hineinzustürzen, all dies belegt für ihn das Vorhandensein ihrerseits nicht phänomenaler moralischer Impulse im Menschen (Roetz 1992: 322, 336-340). So wird aus der daoistischen Quasi-Moral der natürlichen Spontaneität die konfuzianische natürliche Spontaneität der Moral. Mengzi ist für diese Fundierung der Ethik in der Natur des Menschen des Verrates an der Tradition und an der Politik bezichtigt worden. Denn wofür, so fragen später die Konfuzianer Xunzi (ca. 310- ca. 230) und Dong Zhongshu (179-104), bräuchte man noch die Kulturheroen der Vergangenheit, wofür die Herrscher und wofür die Erziehung, wenn die menschliche Natur ihnen ihre mögliche Funktion bereits abnimmt (Roetz 1992: 355-356)? In der Tat birgt Mengzis Theorie diese Konsequenzen, wenngleich er sie selbst nicht hat ziehen wollen. Mengzi steht allerdings in einer auch schon konfuzianischen Tradition der Enthistorisierung des ethischen Denkens, die bei Konfuzius (551-479) einsetzt – und zwar im Einbau der Goldenen Regel in das Zentrum seiner Ethik. Den besonderen Status der Goldenen Regel bei Konfuzius belegen nicht nur ihr gleich mehrfaches Vorkommen in seinen „Gesammelten Worten“ (Lunyu), sondern auch unzweideutige Formulierungen wie die, sie sei das „Eine, das alles durchzieht“, das, „was aus einem Wort besteht 124 Das Beispiel China und das ganze Leben hindurch befolgt werden kann“, sowie die „Methode der Menschlichkeit“ (Lunyu 6.30, 4.15, 15.24, Roetz 1992: 219-222). Mit der Goldenen Regel wird eine formale Maxime eingeführt, die nicht mehr durch einen tradierten Wertekanon gebunden ist – dessen Krise ja gerade der Hintergrund für das Auftauchen neuer Ethiken ist –, sondern nur durch den hier und jetzt zu vollziehenden fiktiven Rollentausch zwischen Handelndem und Betroffenem, auf Basis der Annahme eines bestimmten Guts bzw. „Unguts“, das Gegenstand der Bedürfnisse bzw. Abneigungen ist. Worum es sich bei diesem Gut vorrangig handelt, belegen andere Stellen in der antiken chinesischen Literatur: Es sind die allgemeinen natürlichen Grundbedürfnisse des Menschen. So heißt es im Hanshi waizhuan (2. Jh. v. Chr.) in einer Auslegung von Lunyu 4.15: In alten Zeiten kannte man die Welt, ohne aus seiner Tür zu treten, und man sah den Gang des Himmels, ohne aus dem Fenster zu lugen (Laozi 47). Nicht dass die Augen damals 1000 Meilen weit hätten sehen und die Ohren 1000 Meilen weit hätten hören können – man maß die Welt an den eigenen Gefühlen. Wenn einem selbst Hunger und Kälte verhasst waren, dann wusste man, dass die ganze Welt sich Kleidung und Nahrung wünschte. Wenn einem selbst Mühsal und Bitternis verhasst waren, dann wusste man, dass die ganze Welt sich Ruhe und Muße wünschte. Und wenn einem selbst Verfall und Mangel verhasst waren, dann wusste man, dass die ganze Welt sich Reichtum und ein Auskommen wünschte. (Hanshi waizhuan 3.38, 147) Der klarste Beleg aber, wie durch die Goldene Regel in der Ethik ein historisches Paradigma durch ein anthroplogisches abgelöst wird, findet sich in einer Passage aus dem Lüshi chunqiu (239 v. Chr.), die als Quintessenz des zhouzeitlichen Antitraditionalismus gelten kann. Der Text ersetzt zunächst die traditionalistische Devise, man solle sich die Normen der „frühen Könige“ zum Modell nehmen, durch die neue Devise, man solle sich zum Modell nehmen, wie jene überhaupt Normen aufstellten, und geht hiermit zu einer Orientierung "zweiter Ordnung" – von der Orientierung an konkreten Normen zur Normengenerierung – über. Sodann fährt er unter Anspielung auf das Argumentationsmuster der Goldenen Regel fort: Was war es aber, aufgrund dessen die frühen Könige Standards aufstellten? Es war der Mensch. Aber auch [wir selbst] sind Menschen. Deshalb können wir die anderen verstehen, indem wir uns selbst beobachten, und wir können vom Alten wissen, indem wir das Jetzt beobachten. Das Alte und das Jetzt sind ein und dasselbe, die anderen und ich sind gleich. Ein Gelehrter, der das Dao besitzt, schätzt, vom Heiner Roetz 125 Nahen aus das Ferne und vom Jetzt aus das Alte zu kennen, und vom Gesehenen aus das nicht Gesehene. Beobachte deshalb den Schatten unten vor der Halle, und du kennst die Bahn von Sonne und Mond und den Wandel von Yin und Yang. Beobachte das Eis in der Vase, und du weißt, daß es kalt ist auf der Welt und Fische und Schildkröten sich verstecken. Koste einen Bissen Fleisch, und du kennst den Geschmack des ganzen Topfes und die Würze des ganzen Kessels. (Lüshi chunqiu 15.8) IV. Die konfuzianische Antwort 2: Xunzi In der antiken chinesischen Ethik findet somit eine anthropozentrische Wende statt, der zufolge der Mensch die grundlegenden Orientierungen für sein Handeln nicht mehr außerhalb seiner selbst in übermittelten Normen und Vorbildern findet, sondern innerhalb seiner, und zwar letztlich in seiner Natur, gleich ob diese als vermittelt über den bewussten Schritt der Generalisierung eigener Bedürfnissen und Abneigungen oder als unmittelbar handlungsorientierend angesehen wird.4 Es war nur eine Frage der Zeit, dass sich hiergegen wieder Protest im Namen der historisch realisierten Vernunft erhob. Diesen Protest repräsentiert Xunzi, der die zweite konfuzianische Antwort auf den daoistischen Naturalismus findet: Während Mengzi der Idealisierung der menschlichen Natur folgt, die Idealität der Natur aber eben im Sinne der konfuzianischen Ethik fasst, rückt Xunzi das in den daoistischen Idyllen ganz außer Acht gelassene natürliche Gewaltpotential des Menschen in den Blick. Er weist jedes normative Verständnis der Natur überhaupt, der menschlichen wie der außermenschlichen, zurück. Die Natur ist nun das Trieb- und Impulshafte nicht im Sinne moralischer Spontaneität, sondern rein egoistischer „Sucht nach Vorteil.“ Xunzis berühmte Schrift „Die menschliche Natur ist schlecht“ (Xing e) hebt an: Mit der Natur des Menschen ist es so, daß von Geburt an die Freude am eigenen Vorteil in ihr liegt. Gibt man dem nach, entstehen Streit und Raub, und Höflichkeit und Bescheidenheit gehen verloren. Von Geburt an liegen Neid und Schlechtigkeit in ihr. Gibt man dem nach, entstehen Grausamkeit und Gewalttätigkeit, und Loyalität und Verläßlichkeit gehen verloren. Von Geburt an liegt die Begierde der Ohren und Augen Es gibt auch eine nicht naturalistische, „transzendentale“ Version dieser Wende, die aus der Vermeidung von Selbstwidersprüchlichkeit normative Argumente gewinnt, vgl. Roetz (1992: 93). Ihr kommt allerdings weder zeit- noch wirkungsgeschichtlich die gleiche Bedeutung zu wie dem philosophischen Naturalismus. 4 126 Das Beispiel China in ihr und die Freude an Ohren- und Augenschmaus. Gibt man dem nach, dann entstehen Ausschweifung und Chaos, und Etikette, Gerechtigkeit und alle kultivierten Regeln gehen verloren. (Xunzi 23, 289) Dass die dem Menschen angeborene Natur „schlecht“ ist, folgt für Xunzi aber nicht nur aus ihrer Begierdenhaftigkeit, sondern auch aus der mangelhaften physischen Ausstattung des Menschen. Sie zur Norm zu erheben, ist ein Verrat nicht nur an der Moral, sondern am Menschen selber, der zurück in ein Tierreich gestoßen wird, in dem er, anders als in den daoistischen Utopien, nicht überleben kann. Der Mensch ist im doppelten Sinne ein Mängelwesen.5 Aus moralischen wie überlebenspraktischen Gründen vertritt Xunzi deshalb die Notwendigkeit einer Kompensation der natürlichen Defizite durch die menschliche „Kunst“ (wei oder shu). Der Mensch muss zurechtgebogen werden, wie krummes Holz – ein auch von Aristoteles und Kant benutztes Bild – mit einer Biegemaschine zurechtgebogen werden muss. Hierin sieht Xunzi eine historisch bereits verwirklichte Leistung der „frühen Könige“, der Erfinder der Institutionen und der Moral, die das realisiert haben, „aufgrund dessen der Mensch ein Mensch ist“ (ren zhi suoyi wei ren zhe, Xunzi 5, 50), nämlich eine differenzierte, das gemeinsame Überleben sichernde Gesellschaft. Das Wesen des Menschen ist hiermit, anders als bei Mengzi, gerade nicht mit seiner „Natur“ (xing) im Sinne der „natürlichen Tendenz“ (tian zhi jiu, Xunzi 22, 284, und 23, 290), die „angeborenerweise so ist“ (sheng zhi suoyi ran, Xunzi 22, 274), identisch. Nicht nur die innere Natur des Menschen, auch die äußere Natur ist Xunzi zufolge in ihrem Rohzustand für die eigentlichen menschlichen Zwecke unzulänglich. Auch ihr gegenüber bedarf es, damit sie „ohne dem Menschen gemäß zu sein, doch Nutzen für ihn abwirft“, der „Kunstfertigkeit“ (shu) (Xunzi 10, 113, Roetz 1984: 338). Sie ist „über die Entfesselung des [menschlichen] Vermögens zu verändern (hua)“ (Xunzi 17, 212, Roetz 1984: 316, 326). Hiermit wird der Natur eine Art zweiter Ordnung verliehen, die sich über die ihr eigene feste Regelhaftigkeit (chang) legt und sie dem Menschen allererst verfügbar macht. So wird die von ihr selbst „hervorgebrachte“ (sheng) Ordnung vom Menschen in einem weiteren Ordnungsakt „vollendet“ (cheng) (Roetz 1984: 331-340). Xunzi schreibt die Leistung der Kultivierung der Natur frühen Kulturschöpfern (shengren) zu. Hiermit rehabilitiert er die Tradition, die eine lebensnotwendige und unverzichtbare bereits gewonnene Einsicht 5 Ein in antikchinesischen wie griechischen Texten mehrfach zu findendes Motiv (natura noverca). Vgl. Roetz (1992: 359, Anm. 36). Heiner Roetz 127 vermittelt und uns insofern in der Tat belehrt. Allerdings sind die Kulturheroen für Xunzi bei genauem Hinsehen nur historische Personifizierungen der jedem Menschen als Menschen eigenen Vernunft. Ihr Werk ist hier und jetzt von jedem „Mann von der Straße“, der über Lernen und Überlegung sich selbst zu einem shengren bilden kann, nachvollziehbar (Xunzi 23, 296, Roetz 1992: 357). Auch Xunzi zollt damit der Abkehr von der Geschichte Tribut: Auch wenn er der Natur misstraut, ist das Zeitparadigma, in dem er denkt, dem seiner naturalistischen Gegner verwandt. So ist die Theorie Xunzis ohne die naturalistische, anti- oder doch ahistorische Tendenz der zeitgenössischen Philosophie, auf die sie antwortet, nicht nur unverständlich, sie ist von ihr mit geprägt. V. Griechischer Naturalismus Die Präokkupation mit dem Thema Natur kann als ein Schlüsselindiz antiker Aufklärungsbewegungen gelten, die in einer nicht mehr mit traditionellen Mitteln lösbaren Krise ihrer Gesellschaften nach einer neuen, „festen“ Instanz jenseits der brüchigen hergebrachten Normen und konventionellen Autoritätsformen suchen. Sie findet sich auch im antiken Griechenland, wo die zivilisationskritischen Attacken der chinesischen Daoisten in den sophistischen Angriffen auf das von Menschen Gemachte, nicht natürlich Gewachsene ihre genaue Entsprechung finden. Der chinesischen Entgegensetzung von xing und wei, der angeborenen Natur und des Künstlichen, oder, analog, von nei und wai, dem Inneren und dem Äußeren, entspricht dabei die griechische von physis und nomos bzw. thesis oder syntheke (Heinimann 1945). Entlang dieser Linie argumentieren vor allem die Sophisten des 5. und die Kyniker des 4. Jahrhunderts v. Chr., die die Natur über die Sitte und das von Menschen gemachte Gesetz stellen, mit bleibenden Nachwirkungen in der Stoa (Bloch 1961: 20-29). Sie ziehen allerdings entgegengesetzte Schlussfolgerungen aus der Wertschätzung der Natur vor der Sitte und dem positiven Gesetz: Im Namen der Natur wird sowohl die Gleichheit aller Menschen wie das Recht des Stärkeren gefordert (Roetz 2000: 133-134). Nicht zuletzt aufgrund dieser Schwierigkeit erwächst den naturalistischen Ansätzen schon in der Antike, der chinesischen wie der griechischen, die Konkurrenz anderer Konzeptionen, für die die Natur nur der negative Boden der Normativität ist, insofern sie den Menschen aufgrund ihrer Mängel zu Konventionen und Übereinkünften zwingt (ebd. 134 ff.). Will man das Phänomen naturalistischer Argumentationen in den Geistesgeschichten erklären, so liefert der Daoismus wahrscheinlich einen besonders schlüssigen Hinweis: Seine provokative Koketterie mit der ungebundenen Freiheit der Kindheit legt es nahe, den hier 128 Das Beispiel China vorliegenden Rückgriff auf die „naturnahe“ präkonventionelle Rationalität der ontogenetischen Adoleszenzkrise zuzuordnen; sie wäre also, übertragen auf die Soziogenese, Ausdruck einer Reifungskrise von Gesellschaften, in denen das Ungenügen einer Orientierung am Hergebrachten auf breiter Front offenkundig geworden ist. VI. Ausblick auf den heutigen bioethischen Diskurs Was hilft nun der Blick in den antiken, namentlich chinesischen Naturdiskurs bei der Beantwortung der Frage, wie mit der noch einmal gesteigerten Verfügbarmachung der Natur durch die heutige biotechnologische Revolution umzugehen sei? Zunächst ist eines festzuhalten: Die Grundfrage selbst, ob nämlich die Natur primär zu bewahren oder primär zu verändern sei, ist offenkundig eine notwendige Begleiterscheinung der Herausbildung der menschlichen Zivilisation und steht schon am Anfang der Reflexion über deren Folgen. Mit der Vollkommenheitsthese und der Defizienz- bzw. Vervollkommnungsthese in Bezug auf die menschliche wie die außermenschliche Natur stehen sich dabei schon in der Antike zwei noch heute konkurrierende Grundpositionen gegenüber. Beide Positionen sind in gleicher Weise kulturelle Phänomene und entwicklungsgeschichtlich nur vor dem Hintergrund des Heraustretens des Menschen aus dem unmittelbaren Naturzusammenhang verstehbar. Dies gilt für die naturnahe Position nicht anders als für die naturferne – die erstere hat nicht etwa den Bonus des Unmittelbaren und Wirklichkeitsnahen, sondern muss sich zivilisatorisch rechtfertigen. Zudem liefert die Natur nicht die gesicherte Orientierung, die sie liefern soll. Aus der Normativsetzung des Natürlichen werden vielmehr konträre Konsequenzen gezogen. Was China betrifft, so setzen sich diese Konflikte und Ambivalenzen bis in die heutige chinesische bioethische Debatte (Döring und Chen 2002; Döring 2004) fort, die sich stark an der internationalen Diskussion orientiert, aber auch auf die chinesische Tradition Bezug nimmt, vor allem, wenn es gilt, einen „eigenständigen“ Weg zu reklamieren. So argumentiert etwa der taiwanesische Philosoph Li Ruiquan (Lee Shuichuen), ganz im Sinne des Konfuzianers Xunzis, mit der „Unzulänglichkeit der Natur“ (tiandi zhi buzu), der mittels der modernen Biotechnologie unter Einschluss aller Formen des Klonens von Menschen endlich abgeholfen werden könne. Hierbei sei der chinesische Mensch selbst Schöpfer; er habe nicht etwa, wie im christlich beeinflussten „Westen“, die Bewahrung einer ihm anvertrauten Schöpfung zu beachten und sich so mit einem Entwicklungshemmnis herumzuschlagen – Max Heiner Roetz 129 Weber auf den Kopf gestellt (Li 1999a: 130f.; Lee 1999: 192; Roetz 2004). Qiu Renzong wiederum, der Nestor der volksrepublikanischen Bioethik, der sich gleichfalls als Konfuzianer versteht, befürwortet unter Berufung auf einen normativen Yinyang-Naturalismus das sog. therapeutische und wissenschaftliche, verwirft aber mit dem gleichen Argument das reproduktive Klonen (Qiu 2003). Hierbei bleibt allerdings unklar, warum in dem einen Fall gegen Yin und Yang, also die Natürlichkeit, verstoßen wird, in dem anderen aber nicht. Im Übrigen ist eine solche Argumentation durch die erwähnten konfuzianischen Philosophen der Zhouzeit nicht abgedeckt. Mengzi z. B. hat einen normativen Gehalt des alle Wesen vereinigenden energetischen Grundstoffes Qi, dessen Formen Yin und Yang darstellen, ausdrücklich bestritten (Mengzi 2a:2, Roetz 1992: 325). Wenn er von moralischen Impulsen im Menschen spricht, bezieht er sich auf eine spezifisch menschliche Ebene des Natürlichen, die von der Natur im Allgemeinen und auch von den vitalen Lebensfunktionen des Menschen unterschieden ist. Deutlicher noch hat Xunzi die Kosmologie aus seiner Ethik herausgehalten. Sie wird erst im nachklassischen Konfuzianismus dominant, wenngleich sich unterschwellig Xunzis Anthropozentrismus durchgehalten hat (Roetz 1992: 368f.; 2004b). Dies gilt gerade heute: Die Majorität der chinesischen Bioethiker folgt nicht dem Gedanken der Bewahrung der Natur, sondern dem der Verfügung über sie, wobei sich die entsprechende chinesische Tradition mit moderner instrumenteller Vernunft und Utilitarismus vermischt. Außer Acht bleibt hierbei, dass für den Konfuzianer Xunzi die Arbeit an der Natur nichts anderem diente als eben der Moralisierung des Menschen und die Verselbständigung des Nutzensdenkens nicht anderes als Ausdruck einer naturhaften Sucht selber gewesen wäre. Welch starker Entscheidungsdruck von der biotechnologischen Entwicklung ausgeht, zeigt sich in China insbesondere daran, dass auch Bioethiker in der Tradition des Daoismus sich bemüßigt fühlen, an die technische Entwicklung Anschluss zu halten. Der originäre Daoismus weist die Manipulation alles Natürlichen zurück – „das von Natur aus Lange ist nichts, was zu kürzen und das von Natur aus Kurze nichts, was zu verlängern wäre“, wie es in der bereits zitierten Passage aus Zhuangzi 8 heißt. D. Chen indes stellt unter Berufung auf einen Satz aus Laozi 77, wonach „das Dao des Himmels wegnimmt, wo zu viel ist, und hinzufügt, wo zu wenig ist“, fest, dass das Klonen von Menschen nicht gegen das „Gesetz der Natur“ verstoße (nach Qiu 2003). Viel plausibler ist allerdings, Laozi 77 gerade im Sinne von Zhuangzi 8 als Attacke auf die menschliche Störung des von der Natur immer wieder hergestellten Gleichgewichts zu lesen. Chens Lesart ist ein Beispiel für eine permissive Umdeutung ursprünglich restriktiver, gegen die menschliche Hybris 130 Das Beispiel China gerichteter Ethiken, die sich heute auch in anderen kulturellen Kontexten findet. Folgt nun aus der Verworrenheit des Umgangs mit Begriffen des Natürlichen, dass der Bezug auf die „menschliche Natur“ in der Ethik tunlichst vermieden werden sollte? Man wird hierauf eine wohl differenzierte Antwort geben müssen. Zunächst legt das chinesische Beispiel, nicht anders als jenes der Griechen, eines nahe: Die „menschliche Natur“ spricht, wie die Natur im Allgemeinen, nicht für sich selbst; der Mensch spricht, auch wenn er gerade hierin an sie gebunden bleibt, über sie als Teil seiner Selbstverständigung, und er tut dies in sehr unterschiedlicher, ja, entgegengesetzter Weise. Die unmittelbare Ableitung eines Sollens an sich aus einem vorgegebenen Naturbegriff steht zu Recht unter dem Verdacht der bloß dogmatischen Setzung und der Heteronomie (Bayertz 2002). Bedeutet dies aber, dass der Natur gar kein moralischer Status mehr zukommt? Das stärkste Argument hiergegen ist von Robert Spaemann vorgetragen worden: Gerade Autonomie, die an der Natur keinerlei Grenze mehr fände und sich ihr gegenüber verselbständigte, fiele zurück in eben jene Naturwüchsigkeit, von der sie sich zu Recht losgesagt hat. Denn sie müsste dann eine andere Grenze menschlichen Handelns festlegen, was nicht in die Freiheit, sondern in die tyrannische Willkür führt (Spaemann 1983, vgl. auch Schweidler 2003). Auch Jürgen Habermas begründet die „Moralisierung der menschlichen Natur“ mit den „gattungsethischen“ Voraussetzungen von Autonomie (Habermas 2001). Mit den Argumenten des alten China wäre schließlich zu fragen, was aus Denkfiguren wie der Goldene Regel (ihre bekannten Paradoxien einmal außer Acht gelassen) und, in der Konsequenz, dem ethischen Universalismus wird, wenn die Bezugsbasis einer geteilten körperlichen und psychischen Leidensfähigkeit durch eine einseitige Manipulation der Menschennatur verlassen würde, und ferner, ob die Rede von einem autonomen moralischen Sollen, die den Naturbezug substituieren können müsste ohne zwangsläufig in die von Spaemann prognostizierte Tyrannei zu führen, nicht ihrerseits eine bestimmte Natur des Menschen voraussetzt: eine Natur nämlich, die diesen vom Tier unterscheidet im Sinne einer, mit Mengzi zu sprechen, nur ihm eigenen Befähigung zum Guten im Unterschied zum Nützlichen (Mengzi 6a:6, Roetz 1992: 343) und der entsprechenden körperlich-physiologischen Ausstattung, diese Befähigung zu realisieren und umzusetzen. Negativ gesagt: Man darf sich für das Böse nicht schlechthin auf seine „Natur“ berufen können und eine „Schuld der Anlagen“ bemühen (ebd.). Hier ist ein Begriff von Natur im Spiel, der Autonomie allererst möglich macht und nicht, wie der bei Xunzi unterstellte negative Naturbegriff, des Ausgangs in Heteronomie Heiner Roetz 131 verdächtigt werden kann. Die chinesische Bioethik wäre gut beraten, sich mit Mengzis Vorstellung von Natur mehr auseinanderzusetzen.6 LITERATUR: Bayertz, Kurt (2002): Der moralische Status der menschlichen Natur. In: Information Philosophie. Bd. 4. S. 7-20. Bloch, Ernst (1961): Naturrecht und menschliche Würde. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Chang Tsung-tung (1982): Metaphysik, Erkenntnis und praktische Philosophie im Chuang-tzu. Frankfurt am Main: Klostermann. Döring, Ole (2003): „Maßstab im Wandel. Anmerkungen über das Gute und die Medizinethik in China.“ In: Ralf Elm, Mamoru Takayama (Hg.): Zukünftiges Menschsein: Ethik zwischen Ost und West. Schriftenreihe des ZEI, Bd. 55. Baden-Baden: Nomos. S. 319-353. –, Chen Renbiao (2002) (Hg.): Advances in Chinese Medical Ethics. Chinese and International Perspectives. Hamburg: Institut für Asienkunde. –, (2004): Chinas Bioethik verstehen. Ergebnisse, Analysen und Überlegungen aus einem Forschungsprojekt zur kulturell aufgeklärten Bioethik. Hamburg: Abera. Habermas, Jürgen (2001): Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hanshi waizhuan (1972): Lai Yanyuan, Hanshi waizhuan jinzhu jinyi. Taipei: Shangwu. Heinimann, Felix (1945): Nomos und Physis. Basel: Reinhardt. Huainanzi (1978): In: Zhuzi jicheng. Hong Kong: Zhonghua, Bd. 7. Laozi (1978): In: Zhuzi jicheng (Wang Bi, Laozi zhu). Hong Kong: Zhonghua, Bd. 3. Lee Shui-chuen (Li Ruiquan) (1999): „A Confucian Perspective on Human Genetics.“ In: Ole Döring (Hg.): Chinese Scientists and Human Responsibilty. Ethical Issues of Human Genetics in Chinese and Internationel Contexts. Proceedings of the "First International and Interdisciplinary Symposium on Aspects of Medical Ethics in China: Initiating the Debate", Hamburg, April 9-12, 1998. Hamburg: Institut für Asienkunde. S. 187-198. 6 Vgl. hierzu die Überlegungen in Döring 2003. In der Menschenrechtsdebatte ist die Ethik Mengzis seit längerem ein Thema; vgl. Roetz (2001). 132 Das Beispiel China Li Ruiquan (1999): Rujia shengming lunlixue [Konfuzianische Bioethik]. Taipei: Ehu chubanshe. Lunyu (1972): Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series, A Concordance to the Analects of Confucius. Nachdruck Taipei. Lüshi chunqiu (1978): In: Zhuzi jicheng. Hong Kong: Zhonghua, Bd. 6. Mengzi (1973): Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series, A Concordance to Meng Tzu, Nachdruck Taipei. Munro, Donald J. (1969): The Concept on Man in Early China. Stanford: Stanford UP. Qiu Renzong (2003): „Cloning Issues in China.“ Vortrag auf dem Symposium „Cross-Cultural Issues in Bioethics: The Example of Human Cloning.“ Ruhr-Universität Bochum, 4.-6.12.03 Roetz, Heiner (1984): Mensch und Natur im alten China. Zum SubjektObjekt Gegensatz in der klassischen chinesischen Philosophie, zugleich eine Kritik des Klischees vom "chinesischen Universismus.“ Frankfurt am Main, Bern und New York: Peter Lang. –, (1992): Die chinesische Ethik der Achsenzeit. Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des Durchbruchs zu postkonventionellem Denken. Frankfurt am Main: Suhrkamp. –, (2000): „Moralischer Fortschritt in Griechenland und China. Ein Vergleich der achsenzeitlichen Entwicklungen.“ In: Oskar Fahr, Wolfgang Ommerborn und Konrad Wegmann (Hg.) Politisches Denken Chinas in alter und neuer Zeit. Münster: LIT. S.123-151. –, (2001): „Menschenpflicht und Menschenrecht. Überlegungen zum europäischen Naturrecht und zur konfuzianischen Ethik.“ In: Konrad Wegmann, Wolfgang Ommerborn, Heiner Roetz (Hg.): Menschenrechte: Rechte und Pflichten in Ost und West (Strukturen der Macht: Studien zum politischen Denken Chinas, Bd. 9). Münster: LIT. S. 1-21. –, (2004): „Muß der kulturelle Pluralismus einen substantiellen ethischen Konsens verhindern? Zur Bioethik im Zeitalter der Globalisierung.“ In: Eva Baumann, Alexander Brink, Arnd May, Peter Schröder, Corinna Schutzeichel (Hg.): Weltanschauliche Offenheit in der Bioethik. Festschrift für Hans-Martin Sass. Berlin: Duncker und Humblot. –, (2004a): „Tradition, Moderne, Traditionskritik. China in der Diskussion.“ In: Siegfried Wiedenhofer (Hg.): Kulturelle und religiöse Traditionen. Zum Stand traditionstheoretischer Forschung im deutschsprachigen Raum. Münster: LIT. –, (2004b): „On Nature and Culture in Zhou China.“ In: Günter Dux und Hans Ulrich Vogel (Hg.): Concepts of Nature in Traditional China: Comparative Approaches. Leiden: Brill. Heiner Roetz 133 Schweidler, Walter (2003): „Zur Analogie des Lebensbegriffs und ihrer bioethischen Relevanz.“ In: Walter Schweidler, Herbert A. Neumann, Eugen Brysch (Hg.): Menschenleben – Menschenwürde. Interdisziplinäres Symposium zur Bioethik. Münster: LIT. S. 13-29. Spaemann, Robert (1983): „Zur Aktualität des Naturrechts.“ In: Ders., Philosophische Essays. Stuttgart: Reclam. S. 60-79. Strauß, Leo (1977): Naturrecht und Geschichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Xunzi (1978). In: Zhuzi jicheng. Hong Kong: Zhonghua, Bd. 2. Zhuangzi (1978). In: Zhuzi jicheng (Guo Qingfan, Zhuangzi jishi). Hong Kong: Zhonghua, Bd. 3.