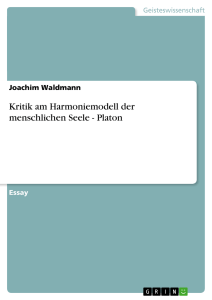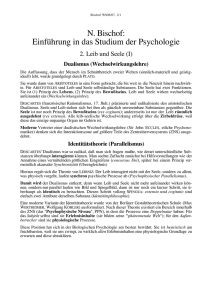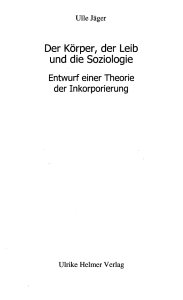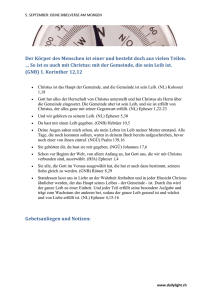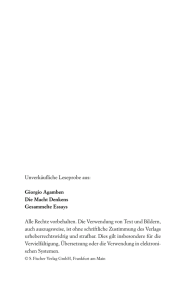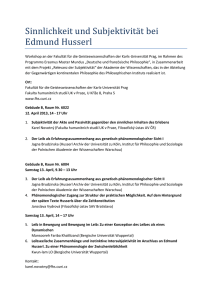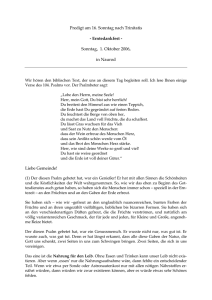Document
Werbung
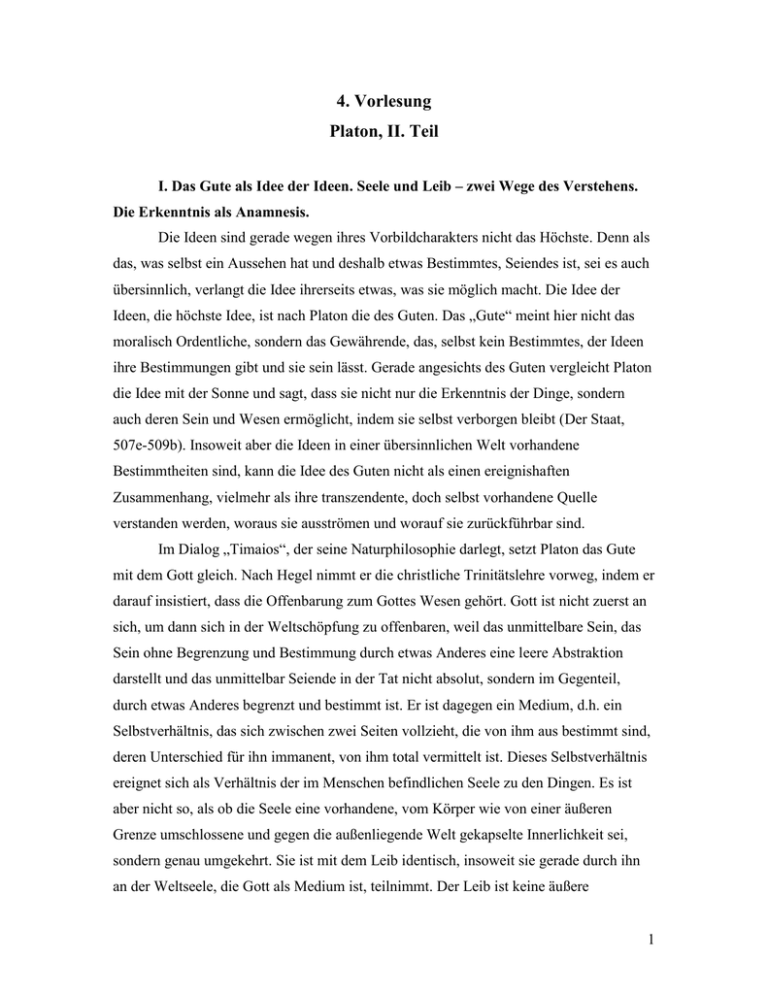
4. Vorlesung Platon, II. Teil I. Das Gute als Idee der Ideen. Seele und Leib – zwei Wege des Verstehens. Die Erkenntnis als Anamnesis. Die Ideen sind gerade wegen ihres Vorbildcharakters nicht das Höchste. Denn als das, was selbst ein Aussehen hat und deshalb etwas Bestimmtes, Seiendes ist, sei es auch übersinnlich, verlangt die Idee ihrerseits etwas, was sie möglich macht. Die Idee der Ideen, die höchste Idee, ist nach Platon die des Guten. Das „Gute“ meint hier nicht das moralisch Ordentliche, sondern das Gewährende, das, selbst kein Bestimmtes, der Ideen ihre Bestimmungen gibt und sie sein lässt. Gerade angesichts des Guten vergleicht Platon die Idee mit der Sonne und sagt, dass sie nicht nur die Erkenntnis der Dinge, sondern auch deren Sein und Wesen ermöglicht, indem sie selbst verborgen bleibt (Der Staat, 507e-509b). Insoweit aber die Ideen in einer übersinnlichen Welt vorhandene Bestimmtheiten sind, kann die Idee des Guten nicht als einen ereignishaften Zusammenhang, vielmehr als ihre transzendente, doch selbst vorhandene Quelle verstanden werden, woraus sie ausströmen und worauf sie zurückführbar sind. Im Dialog „Timaios“, der seine Naturphilosophie darlegt, setzt Platon das Gute mit dem Gott gleich. Nach Hegel nimmt er die christliche Trinitätslehre vorweg, indem er darauf insistiert, dass die Offenbarung zum Gottes Wesen gehört. Gott ist nicht zuerst an sich, um dann sich in der Weltschöpfung zu offenbaren, weil das unmittelbare Sein, das Sein ohne Begrenzung und Bestimmung durch etwas Anderes eine leere Abstraktion darstellt und das unmittelbar Seiende in der Tat nicht absolut, sondern im Gegenteil, durch etwas Anderes begrenzt und bestimmt ist. Er ist dagegen ein Medium, d.h. ein Selbstverhältnis, das sich zwischen zwei Seiten vollzieht, die von ihm aus bestimmt sind, deren Unterschied für ihn immanent, von ihm total vermittelt ist. Dieses Selbstverhältnis ereignet sich als Verhältnis der im Menschen befindlichen Seele zu den Dingen. Es ist aber nicht so, als ob die Seele eine vorhandene, vom Körper wie von einer äußeren Grenze umschlossene und gegen die außenliegende Welt gekapselte Innerlichkeit sei, sondern genau umgekehrt. Sie ist mit dem Leib identisch, insoweit sie gerade durch ihn an der Weltseele, die Gott als Medium ist, teilnimmt. Der Leib ist keine äußere 1 Begrenzung, vielmehr das, wodurch die menschliche Seele in je eine ereignishafte Konfiguration eingeschrieben wird, welche eine innere Gliederung dieses Mediums ist. Das Dingliche, das Stoffliche ist wiederum kein Vorhandenes, sondern das Anderssein der Weltseele, die äußere Seite, die Spur der Unterscheidung, die in deren immanenten Grenzen geschieht. Somit ereignet sich Gott als Selbstverhältnis derart, dass Er als Sein des Menschen sein Anderssein in den Dingen erkennt. Der Mensch entspricht dieser seiner Bestimmung, indem er über das Vorhandene hinausgeht, d.h. indem er sich selbst in seiner Zugehörigkeit zu je einem situativen Zusammenhang übernimmt und sich zu den Dingen von diesem her verhält, also die Dinge von diesem her erscheinen lässt. Nach der dargestellten Interpretation sind mithin Seele und Leib ein und dasselbe, weil sie nicht als vorhanden gedacht werden. Allein lässt sich auch Platos Verständnis von Seele und Leib zweideutig interpretieren. In „Phaidon“ sind sie als vorhandene, auseinander liegende einander entgegengesetzt, und zwar unversöhnlich: „(D)em, was man zusammengesetzt hat und was seiner Natur nach zusammengesetzt ist, kommt wohl zu, auf dieselbe Weise aufgelöst zu werden, wie es zusammengesetzt worden ist; wenn es aber etwas Unzusammengesetztes gibt, diesem, wenn sonst irgend einem, kommt wohl zu, daß ihm dieses nicht begegne“. „(W)as sich immer gleich verhält..., davon ist wohl am wahrscheinlichsten, daß es das Unzusammengesetzte sei; was aber bald so, bald anders..., dieses das Zusammengesetzte“. „Und diese Dinge... kannst du doch anrühren, sehen und mit den andern Sinnen wahrnehmen; aber zu jenen sich Gleichseienden kannst du doch wohl auf keine Weise irgend anders gelangen, als durch das Denken der Seele selbst; sondern unsichtbar sind diese Dinge und werden nicht gesehen“. „(I)st nicht von uns selbst das eine Leib und das andere Seele?“. „(D)ie Seele, wenn sie sich des Leibes bedient, um etwas zu betrachten, es sei durch das Gesicht oder das Gehör oder irgend einen andern Sinn..., dann von dem Leibe gezogen wird zu dem, was sich niemals auf gleiche Weise verhält, und... sie dann selbst schwankt und irrt und wie trunken taumelt, weil sie ja eben solches berührt“. „Wenn sie aber durch sich selbst betrachtet, dann geht sie zu dem reinen, immer seienden Unsterblichen und sich stets Gleichen, und als diesem verwandt hält sie sich stets zu ihm..., und diesen ihren Zustand nennt man eben die Vernünftigkeit“. „(S)olange Leib und Seele zusammen sind, die Natur ihm gebietet, zu 2 dienen und sich beherrschen zu lassen, ihr aber, zu herrschen und zu regieren“. „(D)em Göttlichen, Unsterblichen, Vernünftigen, Eingestaltigen, Unauflöslichen und immer einerlei und sich selbst gleich sich Verhaltenden am ähnlichsten ist die Seele, dem Menschlichen und Sterblichen und Unvernünftigen und Vielgestaltigen und Auflöslichen und nie einerlei und sich selbst Gleichbleibenden wiederum der Leib am ähnlichsten ist“. „Es erkennen nämlich die Lernbegierigen, daß die Philosophie, indem sie ihre Seele findet, ordentlich gebunden im Leibe und ihm anklebend, und gezwungen, wie durch ein Gitter durch ihn das Sein zu betrachten, nicht aber für sich allein, und daher in aller Torheit sich umherwälzend, und indem sie die Gewalt dieses Kerkers erkennt, wie er ordentlich eine Lust ist, so daß der Gebundene selbst am meisten immer mit angreife, um gebunden zu werden; ...indem die Philosophie in solcher Beschaffenheit ihre Seele annimmt... und versucht, sie zu erlösen, indem sie zeigt, daß alle Betrachtung durch die Augen voll Betrug ist, voll Betrug auch die durch die Ohren und die übrigen Sinne, und deshalb sie überredet, sich von diesen zurückzuziehen, soweit es nicht notwendig ist, sich ihrer zu bedienen, und sie ermuntert, sich vielmehr in sich selbst zu sammeln und zusammenzuhalten und nichts anderem zu glauben als wiederum sich selbst, was sie für sich selbst von den Dingen an und für sich anschaut; was sie aber vermittelst eines anderen betrachtet, dieses, weil es in jeglichem anderen wieder ein anderes wird, für nichts Wahres zu halten, und solches sei ja eben das Wahrnehmbare und Sichtbare“ (78c-83c). Hier ist die Seele keine Aufnahme der situativen Beziehungen, in denen je der Mensch, bevor er so oder so bestimmt ist, durch seinen Leib eingewoben ist. Stattdessen wird sie als eine einfache, an sich seiende Einheit dargestellt, die durch ihr fremden, ebenfalls an sich seienden Körper von der äußeren Welt wie im Gefängnis isoliert ist und irgendwie an einer übersinnlichen Welt teilnimmt. Die wahrnehmbaren Dinge werden ihrerseits auch als vorhandene, der Situation entrissene betrachtet, indem die situativen Bestimmungen, darin sie je erscheinen, zum Sein kommen, sich in deren Bestandteile verwandeln. Entsprechend der beständigen Anwesenheit der Ideen in der transsituativen, übersinnlichen Welt ist die Seele unsterblich, während die sinnlichen Dinge, als bloße Materie gedacht, vergehen. 3 Nach der ersten der hier gefolgten Deutungslinien ist die Seele die antithetische Synthesis des Selben und des Anderen, d.h. die Negation sowohl ihrer eigenen Vorhandenheit als auch jener ihres Anderes, der Dingen. Sie lässt den Gegensatz von Leben und Tod in diesem Sinn hinter sich, dass sie in ihrer Negation, Begrenzung durch das Andere nicht verendet, vielmehr zu sich selbst zurückkehrt. Anders gesagt, erhält sie sich selbst, indem sie sich an der jeweiligen Situation entäußert, d.h. sich auf sich selbst als vorhanden verzichtet. Dieses Verständnis wird im „Phaidon“ in der Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele, von ihrer Kreisbewegung zwischen Leben und Tod essentialisiert. Die Erkenntnis der Idee ist schon kein Hinausgehen über die Vorhandenheit, das ein Sein-zum-Tode meines unmittelbar gegebenen Selbst bedeutet, sondern Erinnerung, Rückkehr zum Vorbild, das als vorhanden im Jenseits angeschaut worden ist: „(W)enn jemand irgend etwas sieht oder hört oder anderswie wahrnimmt und er dann nicht nur jenes erkennt, sondern dabei noch ein anderes vorstellt“. „Wir nennen doch etwas gleich? Ich meine nicht, ein Holz dem andern oder einen Stein dem andern noch irgend etwas dergleichen, sondern außer diesem allen etwas anderes, das Gleiche selbst“. „Ehe wir also anfingen, zu sehen oder zu hören oder die anderen Sinne zu gebrauchen, mußten wir schon irgendwoher die Erkenntnis bekommen haben des eigentlich Gleichen“. „(W)er etwas wahrnimmt, es sei nun durch Gesicht und Gehör oder irgendeinen anderen Sinn, dabei etwas anderes vorstellen könne, was er vergessen hatte und was diesem nahekam als unähnlich oder als ähnlich“. „Wenn das etwas ist..., das Schöne und Gute und jegliches Wesen dieser Art, und wenn wir hierauf alles, was uns durch die Sinne kommt, beziehen als auf ein vorher Gehabtes, was wir als das Unsrige wieder auffinden..., so muß notwendig, ebenso wie dieses ist, so auch unsere Seele sein, auch ehe wir noch geboren worden sind“ (73c-76e). V. Die Kunst als Poiesis. Die Kunst als Nachahmung „Jede Veranlassung für das, was immer aus dem Nicht-Anwesenden über- und vorgeht in das Anwesen, ist poeisis, ist Her-vor-bringen“ (Symposium, 205b). Ein Hervorbringen ist nicht nur das, was die Griechen „techne“ nannten – das handwerkliche Verfertigen und das künstlerische Zum-Scheinen- und Ins-Bild-Bringen. Auch die Physis ist ein poiesis, sogar im höchsten Sinne, da das „natürlich“ Seiende den Aufbruch des 4 Hervorbringens, z.B. das Aufbrechen der Blüte ins Erblühen, in sich selbst hat. Dagegen hat das handwerklich und künstlerisch Hervorgebrachte diesen Aufbruch in einem anderen, im Handwerker und Künstler. Die Techne entbirgt solches, was sich nicht selber hervorbringt und noch nicht vorliegt, was deshalb bald so, bald anders aussehen kann. Andererseits aber ist dieses Hervorbringen keine Bewirkung eines Effekts, Verursachung im Sinne von der Materialisierung einer im „Kopf“ vorhandenen Vorstellung. Das Hervorgebrachte ist ein Projekt nicht des Meisters, sondern der Situation selbst, in der er sich befindet und der er somit unterworfen ist. Das Einzige, was dem Meister zukommt, ist das, dass er die von der Situation vorgezeichneten Form und Materie hinsichtlich des Zweckes zusammenbringt, den ihm seine Situiertheit auferlegt hat. Er gibt zwar Anstoss aber ist kein Urheber. Darum lässt sich die Techne folgendermaßen bestimmen: etwas so in die Unverborgenheit bringen, als ob es von sich her aufgegangen ist. Wie es zu sehen ist, hat in diesem Verständnis das Poetische und das Künstlerische die maximal umfangreiche Bedeutung einer Teilnahme am Ereignis der Wahrheit. Andererseits insistiert Platon im Zehnten Buch der „Politeia“ darauf, dass die Kunst sich auf der dritten Stufe der Entfernung von der Wahrheit befindet und ein entstellender Schein ist. Hier geht der Philosoph widerum vom Verständnis aus, die Ideen seien übersinnlich vorhandene Vorbilder der Dinge und das wahrhaft Seiende. Am nähesten zu ihnen steht der „praktische“ Gebrauch der Dinge, der diese „von innen heraus“ kennt (dieses Verständnis lässt sich auch als eine Version der Einsicht auslegen, dass jenes, das ein Ding bestimmt, also sein Wesen ausmacht, dessen „praktisch“ erkannte „Verwendung“ innerhalb eines situativen Zusammenhangs ist; hier gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, Anschauung und Handlung – das Ding wird schon dadurch erfasst, dass man es als „etwas, um zu...“ nimmt). Auf der zweiten Stufe in dieser Hierarchie steht das handwerkliche Herstellen, das auch ein Sichauskennen-in fordert und deswegen den Gebrauch des Werks als Richtlinie hat. Das künstlerische Herstellen ist von der Wahrheit am weitesten entfernt, weil es diesen Gebrauch nicht einmal zur Kenntnis nimmt, sondern nur die Art und Weise, wie die Dinge aussehen, oberflächlich, in der Form einer bloßen Widerspiegelung nachahmt. Die zwei Weisen der Techne sind zwar eine Nachahmung der ewigen Vorbilder, die diese nicht vollends wiederherstellen kann, aber die Kunst bildet das Äußerliche, Zufällige, 5 Fragmentarische ab. Außerdem wendet sie sich an die unvernünftige, affektive Seite des Menschen. Abgesehen davon, dass in diesem Falle Platon von seiner Zweiweltenlehre ausgeht, kann seine These auch so interpretiert werden: die Kunst korrumpiert den Menschen, indem sie ihn dazu verführt, einige Aspekte seiner situativen Befindlichkeit gedanklich nicht anzueignen und derart sie als eine wilde Kraft loszulassen. 6