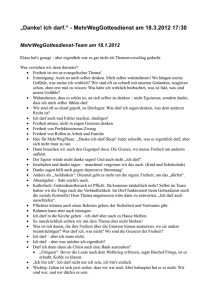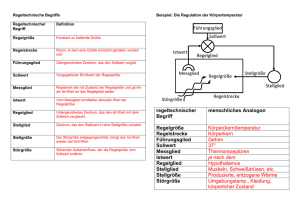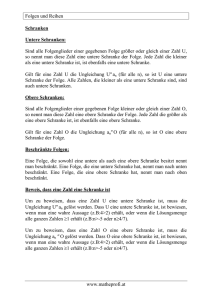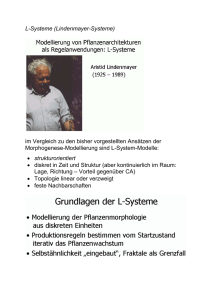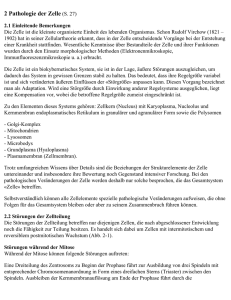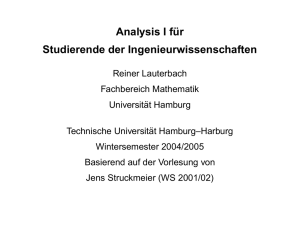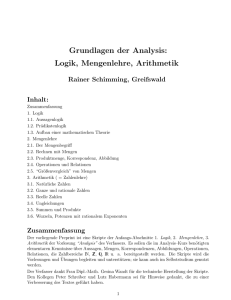Parameteridentifikation
Werbung

Parameteridentifikation Grundsätzlich versucht man, die Koeffizienten der z-Übertragungsfunktion des Prozesses zu bestimmen (bei einer Funktion n-ter Ordnung sind das 2n+1 Koeffizienten). Zur Bestimmung wird zumeist ein Digitalrechner herangezogen, deshalb ist eine Diskretisierung des Prozesses notwendig - vorzugsweise mittels Abtast- und Haltegliedern. Im Digitalrechner wird nun ein Modell der Ordnung n erstellt, das zunächst unbekannte Koeffizienten hat. Diese werden im Laufe der Parameteridentifikation so bestimmt, dass das Ausgangssignal des Modells mit dem Ausgangssignal des Prozesses im störungsfreien Fall bei gleicher Erregung übereinstimmen würde. Die Störung selbst wird dabei als eine Zahlenfolge modelliert, obwohl sie tatsächlich ein kontinuierliches Signal ist. Sie bewirkt, dass auch bei perfekter Parameteridentifikation die Ausgangssignale von Modell und Prozess unterschiedlich sind. Man geht jedoch davon aus, dass hier der Unterschied (nennen wir ihn Modellfehler) minimal ist - eine Tatsache, die durch die Erfahrung gestützt wird, jedoch keineswegs eine logische Notwendigkeit ist! Direkt die Differenz der Ausgangssignale zu verwenden ist ungünstig, da hierbei die Fehlerfolge nichtlinear von den Modellparametern abhängig ist. Man wählt deshalb einen anderen Ansatz für den Modellfehler: TODO Methode der kleinsten Quadrate Man hofft, durch Minimierung der Fehlerenergie die Prozessparameter identifizieren zu können. Dazu verwendet man die Ein- und Ausgangswerte der letzten N Abtastschritte und erhält damit die Messmatrix M: y n 1 y 0 y y1 n M : y N 1 y N n u0 u1 u N n un u n 1 uN Diese ist eine schlanke Matrix mit N Zeilen und (2n+1) Spalten, wobei N >> n. Der Messfehler berechnet sich nun zu: e y M̂ Durch Nullsetzen der Ableitung des quadratischen Fehlers erhält man jene Modellparameter, bei denen der Modellfehler minimal ist. Man geht nun davon aus, dass in diesem Fall die Modellparameter am besten mit den Prozessparametern übereinstimmen: ̂ M T M M T y M y 1 Dies trifft jedoch nur zu, wenn der Modellfehler ein weißes Rauschen ist. Das wiederum legt gewisse Voraussetzungen für die Störfolge fest, die nun einem mit 1 A( z ) gefilterten weißen Rauschen entsprechen muss. Grundsätzlich sollte man alle Kenntnisse über den Prozess bei der Parameteridentifikation mit einfließen lassen. Weiß man also, ob ein System sprungfähig ist oder nicht, lässt sich unter Umständen bereits ein Parameter von vornherein bestimmen. Numerische Berechnung der Lösung Man unterscheidet zwei verschiedene Möglichkeiten: die QR-Zerlegung und die Singulärwertzerlegung. Bei der QR-Zerlegung wird die Massenmatrix in eine orthonormale Matrix Q (diese wird mithilfe des Gram-SchmidtVerfahrens bestimmt) und eine obere Dreiecksmatrix R zerlegt. Die Modellparameter ergeben sich zu: M QR R̂ Q T y Die Matrizeninversion kann man umgehen, da R eine obere Dreiecksmatrix ist, und man das Gleichungssystem von unten nach oben fortschreitend auflösen kann. Bei der Singulärwertzerlegung (SVD) wird die Messmatrix in das Produkt dreier Matrizen zerlegt, wobei die mittlere der drei Matrizen eine Diagonalmatrix mit absteigend sortierten Singulärwerten (eine Art von Eigenwerten) ist. Die Pseudo-Inverse der Massenmatrix, die zur Berechnung der Modellparameter herangezogen wird, berechnet sich nun wie folgt: M UV T M V 1U T Die SVD hat bessere numerische Eigenschaften als die QR-Zerlegung, mit ihrer Hilfe ist eine Datenreduktion (Teile von U und V mit niedrigen Singulärwerten werden verworfen) mit Fehlerabschätzung möglich. Rekursive Methode Oft ist es notwendig, eine Parameteridentifikation im Betrieb vorzunehmen (On-Line-Identifikation), um den Regler an die veränderte Strecke anpassen zu können. Bei der rekursiven Methode wächst die Messmatrix mit jedem Abtastschritt um eine Zeile weiter. Mit der Messmatrix alleine zu rechnen, ist in diesem Fall also nicht ratsam. Daher geht man darauf über, mehrere Rechenschritte gleichen Aufwands zu betreiben, und stattdessen nur M T N MN 1 in jedem Schritt neu zu berechnen. Diese Matrix hat stets die Dimension (2n+1) x (2n+1). Bei dieser Methode werden aber alle Werte der Vergangenheit mitberücksichtig, was nicht sinnvoll ist, da sich ja das System verändert. Alte Werte können durch Fensterung oder exponentielle Gewichtung vernachlässigt werden. Im einfachsten Fall betrachtet man zu jedem Zeitpunkt nur M zurückliegende Werte. Es sind zur Bestimmung der Modellparameter in jedem Schritt nun zwar noch mehr Rechenoperationen nötig, diese besitzen aber wieder konstanten Aufwand. Diese Methode schafft es nicht nur, die neuen Modellparameter nach einer Änderung zu bestimmen, es ist sogar eine Anpassung während der Änderung möglich. Die Breite des Fensters ist hier von großer Bedeutung: Je schmäler das Fenster ist, desto leichter folgt das Modell einer Änderung, aber desto schlechter wird auch das Einschwingverhalten. Die Anforderungen an die Störungen sind dieselben wie bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Identifikation durch Beschränkung der rekonstruierten Störgröße Grundsätzlich ist zu sagen, dass wenn man die Modellparameter denen des Prozesses angepasst hat, man im Modellfehler eine Rekonstruktion der Störgröße findet. Wenn nun z.B. die Störungen, die auf ein System wirken ihrer Größe nach beschränkt sind, so gilt das auch für die rekonstruierten Störungen. Es lässt sich also ein Identifikationsprozess entwickeln, bei dem man versucht, der rekonstruierten Störgröße gewisse Eigenschaften aufzuprägen. Man kann nun also die Differenzengleichung für die rekonstruierte Störgröße aufstellen (in diesem Fall für ein einfaches System erster Ordnung): vˆk aˆvˆk 1 yk aˆyk 1 bˆuk 1 Durch Annahme einer Schranke ergeben sich für die Modellparameter und den Startwert der Störgröße Ungleichungen, die zu erfüllen sind (die entspricht einem Bereich im 2n+1-dimensionalen Raum). Mit jedem Abtastwert wird dieser Bereich aber eingeschränkt und er zieht sich immer weiter auf die wahren Werte zusammen. Zur Berechnung wird nun eine Zielfunktion eingeführt, die die Werte, um die die Störgröße die Schranke überschreitet, für alle Abtastschritte zusammenzählt: v M vk M mk k vk M 0 J (aˆ , bˆ, v0 ) mk N Diese Straffunktion wird nun mittels einer Optimierungsaufgabe minimiert und man erhält die Modellparameter. Dabei ist die Wahl der Schranke von großer Bedeutung: Wählt man die Schranke zu groß, erhält man sehr schnell ein Ergebnis, das von dem wahren Wert möglicherweise inakzeptabel weit entfernt liegt (die größere Schranke resultiert in einem größeren Bereich um den wahren Wert). Wählt man die Schranke allerdings zu klein, erhält man kein Ergebnis, weil die Optimierungsaufgabe nicht mehr lösbar ist (der Bereich verschwindet). Alternativ dazu kann man die Zielfunktion derart wählen, dass die Schranke minimiert wird, dass also durch Verändern der Modellparameter das Maximum der Störfolge minimal wird. In diesem Fall müssen die Beschränkungen der Störgröße noch nicht einmal bekannt sein. Das Verfahren ist toleranter gegenüber einer falsch gewählten Modellordnung, es benötigt jedoch erheblich mehr Rechenzeit. Außerdem kommt man hier um ein Probieren nicht herum (vor allem, wenn man keine genauen Informationen über die Störgröße besitzt). Auch eine On-Line-Identifikation ist mit dieser Methode möglich. Formalismus von Lagrange Die Berechnung der Bewegung eines Systems von Körpern mit Hilfe der Newtonschen Axiome 1. Es gibt Inertialsysteme, also Systeme, in denen der Impuls eines Körpers konstant ist. 2. An einen Körper angreifende Kräfte bewirken eine Impulsänderung. 3. Kraft und Gegenkraft sind gleich und entgegengesetzt gerichtet. benötigt die Lösung eines Gleichungssystems. Zu diesem Gleichungssystem gehören neben den Bewegungsgleichungen noch Zwangsbedingungen, die die Einschränkung der Bewegung beschreiben. Wir betrachten nur holonome Zwangsbedingungen (diese lassen sich in Gleichungsform anschreiben; sind sie von der Zeit direkt abhängig, heißen sie rheonom, andernfalls skleronom). Diese Zwangsbedingungen werden dann als Zwangskräfte dargestellt, die zusätzlich zu den äußeren Kräften auf die Massenpunkte einwirken. N sei hierbei die Anzahl der Massenpunkte, k die Anzahl der Zwangsgleichungen. Da die Zwangskräfte ebenso unbekannt sind wie die gesuchten Ortskoordinaten, besteht das Gleichungssystem aus 3N 3k Gleichungen. Macht man jedoch einen Ansatz für die Zwangskräfte, verringert sich die Anzahl der Gleichungen folgendermaßen: k Z l (t ) grad ri g l (r1 ,..., rN , t ) l 1 k g mi ri Fi l (t ) l ri l 1 g l (r1 ,..., rN , t ) 0 Man nennt dies die Lagrange Gleichungen erster Art. Es lässt sich aber noch eine weitere Vereinfachung machen. Betrachtet man nämlich die n 3N k Freiheitsgrade des Systems von Massenpunkten, kann man leicht n generalisierte Koordinaten q einführen, die einerseits die Lage aller Massenpunkte eindeutig bestimmen müssen, und andererseits selbst keinen Beschränkungen unterliegen dürfen (d.h. sie erfüllen die Zwangsbedingungen in jedem Fall). Es zeigt sich, dass sich die Zwangskräfte damit auslöschen. Die an die Körper angreifenden Kräfte müssen nun jedoch auf die generalisierten Koordinaten projiziert werden, man spricht dann von generalisierten Kräften. Durch Umformungen gelangt man schließlich zu den Lagrange Gleichungen zweiter Art, also zu einem System von gewöhnlichen Differentialgleichungen zweiter Ordnung (sie sind zwar nichtlinear, dennoch oft leichter zu lösen als das Gleichungssystem, das mit den Newtonschen Axiomen aufgestellt wurde). Diese stellen die minimale Anzahl von Gleichungen dar; nachteilig ist jedoch, dass man die Ortskoordinaten der Massenpunkte nicht mehr direkt erhält und auch eine Berechnung der Zwangskräfte nicht mehr möglich ist. Durch die Ableitung N T i 1 mi 2 ri 2 d T dt q j T Qj q j T T q j , q j , t T h j q j , q j , t q j T f j q j , q j , t q j d T dt q j T f j f j f q1 ... q1 ... hj Qj q q1 q1 t j Mq Dq r ist ersichtlich, dass es tatsächlich gewöhnliche Differentialgleichungen sind. Diese lassen sich in ein System von Differentialgleichungen erster Ordnung überführen: Mq Dq r q v v q v M 1 Dv M 1r M 1 Die Lagrange Gleichungen lassen sich sogar noch weiter vereinfachen, wenn man weiß, dass einige der äußeren Kräfte von Potentialen resultieren. Diese Potentiale können entweder konservativ (nur von der Position und der Zeit abhängig) sein, wie z.B. das Federpotential und das Gravitationspotential, oder sie können verallgemeinert sein (von der Position, der Zeit und der Geschwindigkeit abhängig) sein, wie z.B. das magnetische Potential. Zieht man die Potentiale V von der kinetischen Energie T ab, erhält man die Lagrange-Funktion L. Schließlich kann man mithilfe der Dissipationsfunktion P noch die dissipativen Kräfte (Reibungsverluste, ohmsche Verluste in mechatronischen Systemen) berücksichtigen. Da diese Kräfte zumeist von der Geschwindigkeit abhängig sind, müssen sie auf die zeitlichen Ableitungen der generalisierten Koordinaten projiziert werden. Man erhält als letzte Vereinfachung der Lagrange Gleichungen zweiter Art: L T V d L dt q j L P Qj q q j j Anwendung auf mechatronische Systeme Man kann in elektrischen Schaltungen als generalisierte Koordinate die Ladung wählen. Die kinetische Energie ist dann jene Energie, die in der Spule gespeichert wird. Der Impuls ist durch die Flussverkettung, das Potential durch Kondensatoren vorgegeben. Die generalisierte Kraft ist eine Spannungsquelle. Wählt man hingegen den Fluss als generalisierte Koordinate, wird die Energie im Kondensator, das Potential in der Spule und die generalisierte Kraft in der Stromquelle begründet. Die Spannung ist die zeitliche Ableitung des Flusses, der Strom jene der Ladung. Würde man diese üblichen Variablen verwenden, würden die Netzwerke durch Integro-Differentialgleichungen beschrieben. Numerische Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen Grundsätzlich muss bei einer numerischen Lösung einer Differentialgleichung diese zuerst diskretisiert werden. Man unterscheidet Verfahren mit konstanter und Verfahren mit variabler Schrittweite. Letztere stellen sich als sinnvoller heraus, um den Rechenaufwand (und damit die Rundungsfehler) zu minimieren: In Bereichen großer Dynamik wählt man kleine Schrittweiten, in Bereichen kleiner Dynamik hingegen große Schrittweiten. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze für Algorithmen: Die Taylorreihe und die Polynomapproximation. Bei der Taylor-Reihe verwendet man lediglich die Information der letzten Stützstelle, um den Ort der folgenden Stützstelle zu berechnen; man setzt sie daher bei Einschrittverfahren ein. Bei der Polynomapproximation hingegen verwendet man die letzten k Stützstellen, um ein Polynom aufzustellen, das man dann zur nächsten Stützstelle extrapoliert. Diese Mehrschrittverfahren benötigen viele Startwerte, die oft mit Einschrittverfahren berechnet werden. Dafür sind sie genauer. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen lokalen Fehler und globalen Fehlern. Lokale Fehler entstehen unter der Voraussetzung, dass die bisher berechneten Werte korrekt waren; sie akkumulieren sich im Laufe der Berechnung aber zu globalen Fehlern. Die Fehler werden weiter in Diskretisierungsfehler und Rundungsfehler unterteilt. Diskretisierungsfehler entstehen aus dem Algorithmus: Sowohl bei der Taylor-Reihe als auch bei der Polynomextrapolation wird der Fehler umso größer, je größer die Schrittweite ist. Rundungsfehler hingegen entstehen aus dem endlichen Zahlenformat des Rechners: Je mehr Rechenoperationen notwendig sind, desto größer ist also der Rundungsfehler - der Rundungsfehler sinkt mit steigender Schrittweite. Es gibt also für jede Differentialgleichung bei gewähltem Zahlenformat und gewähltem Algorithmus eine unbekannte, optimale Schrittweite. Einschrittverfahren Das Euler-Verfahren entspricht einer Taylor-Entwicklung erster Ordnung: An der alten Stützstelle wird die Tangente angelegt und man wandert auf dieser um eine Schrittweite weiter. Euler-Verfahren besitzen große globale Fehler. Verbesserungen bieten die Runge-Kutta-Verfahren. Wir diskutierten hier zwei Verfahren zweiter Ordnung, nämlich den Heun-Algorithmus und den modifizierten Euler. Bei Verfahren höherer Ordnung wird die Ableitung der rechten Seite durch mehrfaches Auswerten derselben umgangen. Der Heun-Algorithmus z.B. macht einen Euler-Schritt (Prädiktorschritt) und ermittelt an der neuen Stützstelle die Steigung. Dann führt er einen Korrektorschritt aus, indem mit einem Mittelwert aus der Steigung von alter und im Euler-Schritt ermittelter Stützstelle die neue Stützstelle berechnet. Der modifizierte Euler macht einen halben Euler-Schritt und verwendet die Steigung an diesem Punkt, um von der alten Stützstelle ausgehen die neue zu berechnen. Mehrschrittverfahren Bei Mehrschrittverfahren interpoliert man die vergangenen Stützstellen zu einem Polynom und extrapoliert es um einen Schritt. Man hat hier Einfluss auf zwei Parameter: Die Anzahl der zurückliegenen Schritte und den Grad des Interpolationspolynoms. Die Ableitung zeigt, dass es sinnvoll ist, Stützstellenanzahl und Polynomgrad gleich zu wählen und zudem noch ein Polynom gerader Ordnung anzustreben (die Zahl der Stützstellen ist damit ungerade): Bei dieser Wahl ist der Fehler nämlich von der Ordnung r+2, wobei das Polynom den Grad r-1 hat. Implizite Verfahren verwenden bei der Berechnung des Polynoms auch zunächst unbekannte Funktionswerte (nämlich jene, die in diesem Schritt zu berechnen wären). Diese Funktionswerte werden dann zuerst mittels expliziter Verfahren oder mittels eines Euler-Schrittes geschätzt. Stabilität Ein Algorithmus ist absolut stabil, wenn die numerische Lösung des Testproblems abklingt, sofern auch die analytische Lösung abklingt. Um das Gebiet absoluter Stabilität zu untersuchen, betrachten wir eine Exponentialfunktion, deren Differentialgleichung und die z-Transformation der Differentialgleichung. Wir erhalten also das Gebiet absoluter Stabilität für Euler-Verfahren: y e x y ' y yi 1 yi hf ( xi , yi ) yi hyi yi 1 h z y ( z ) y0 y ( z )1 h y ( z ) z 1 h zy0 zy0 z 1 h i yi 1 h y0 y( z) stabil für : 1 h 1 Es lässt sich zeigen, dass Runge-Kutta-Verfahren höherer Ordnung keine wesentliche Vergrößerung des Stabilitätsgebietes mit sich bringen. Die Untersuchung zeigt, dass die Schrittweite durch die Eigenwerte eines Systems, genauer: durch den größten Eigenwert des Systems, vorgegeben wird. Bei mechatronischen Systemen liegen die Eigenwerte aber oft in ganz unterschiedlichen Bereichen: Die elektrischen Eigenwerte sind groß (schnelles Abklingverhalten, große Dynamik), die mechanischen hingegen klein (träge Massen). Während also die elektrischen Eigenwerte die Schrittweite klein halten, interessieren uns aber oft die mechanischen Auswirkungen - das erfordert lange Simulationszeiten. Systeme, in denen das Verhältnis zwischen dem größten und dem kleinsten Eigenwert größer als 1000 ist, nennt man steife Systeme. Diese werden durch eigene Algorithmen (stif-Algorithmen, GearAlgorithmus) behandelt; diese Algorithmen haben aber den Nachteil, dass sie für kombinierte diskrete und kontinuierliche Systeme nicht gut geeignet sind. Schrittweitensteuerung Grundsätzlich steuert man die Schrittweite abhängig vom Diskretisierungsfehler. Diesen berechnet man, indem man die neue Stützstelle zweimal berechnet, beim zweiten Mal aber mit einem höherwertigeren Verfahren. Beim Heun-Algorithmus wird z.B. die Stützstelle im zweiten Durchgang mit korrigierter Steigung berechnet. Beim Verfahren Runge-Kutta-23 wird hingegen im ersten Durchlauf mit einem modifizierten Euler die Stützstelle berechnet, und durch eine einzige zusätzliche Auswertung der rechten Seite erhält man die Stützstelle, wie sie ein Verfahren dritter Ordnung berechnet hätte. Die Differenz der beiden Werte, bezogen auf den genaueren Wert, nennt man Diskretisierungsfehler. Über- bzw. unterschreitet er eine bestimmte Grenze, wird die Schrittweite verkleinter bzw. vergrößert.