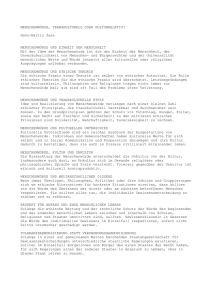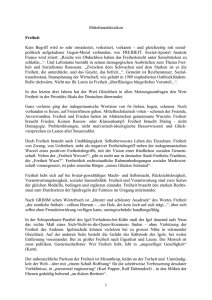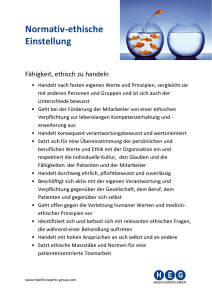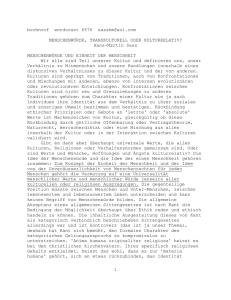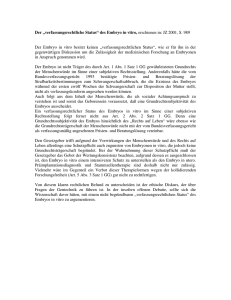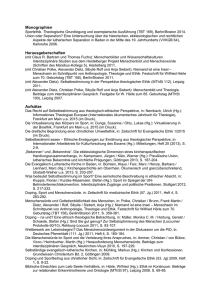Zur Analogie des Lebensbegriffs und ihrer bioethischen Relevanz
Werbung

Walter Schweidler Zur Analogie des Lebensbegriffs und ihrer bioethischen Relevanz Nach einem berühmten Wort von Konfuzius besteht der Kern ethischen Nachdenkens darin, „die Bezeichnungen richtig zu stellen“.1 Ich interpretiere dieses Wort im Kontext unseres Themas als den in der Tat entscheidenden Hinweis auf den fundamentalen Unterschied zwischen dem ethischen Diskurs und jenen beiden anderen Diskursen, welche die Grundlage unseres politischen Umgangs mit dem Leben und der Gesellschaft bilden, nämlich dem naturwissenschaftlichen und dem juristischen Diskurs. Dem naturwissenschaftlichen Diskurs liegt die Kompetenz spezialisierter Forscher zugrunde, Fakten zu erklären, sie in die Strukturen der Wirklichkeit einzuordnen und gegebenenfalls neue Fakten zu entdecken bzw. neues Wissen um die Strukturen der Wirklichkeit zu gewinnen. Bezeichnungen haben hier den Sinn, Wirkliches so wie es ist, wiederzugeben. Die Bedeutung des Wortes „Wasser“ lässt sich durch eine bestimmte molekulare Verbindung definieren, H²0, und die Bestätigung dieses Sachverhalts ist eine Angelegenheit empirischer Beobachtung und experimenteller Überprüfung. Die ärztliche Kompetenz ist wesentlich naturwissenschaftlich gegründet; aber die tiefste Verantwortung, der sich das ärztliche Handeln an den Grenzen der menschlichen Existenz stellen muß, lässt sich nicht mehr innerhalb des naturwissenschaftlichen Diskurses definieren. Die Frage, was der Tod ist, gehört dem ethischen Diskurs an. Das bedeutet nicht, daß ihre Entscheidung etwa in der Kompetenz von Philosophieprofessoren stünde. Sondern es bedeutet, daß jede und jeder, die oder der von ihr berührt werden, ihre Antwort auf diese Frage nicht mit dem Hinweis auf naturwissenschaftliche Erkenntnis, sondern auf andere Weise zu rechtfertigen haben. Man kann medizinische Methoden entdecken, die das definitive Absterben der Hirnfunktionen festzustellen erlauben, aber man kann nicht mit medizinischen Methoden „entdecken“, daß im definitiven Absterben der Hirnfunktionen der Tod des Menschen besteht. Exakte Maßstäbe der Definition und Überprüfung gibt es auch im juristischen Diskurs, nur tritt als deren Grundlage an die Stelle der empirischen Beobachtung die gesellschaftliche und letztlich die politische Dezision: Der Gesetzgeber entscheidet, was ein Rechtsbegriff bedeutet, 1 Vgl. Lunyu (Ralf Moritz: Konfuzius. Gespräche, Stuttgart 1998) XIII.3. und wenn er beispielsweise bestimmt, daß der Begriff des Todes mit Hilfe der „Hirntoddefinition“ neu zu bestimmen sei, dann hat sich mit dem Tatbestand des entsprechenden Paragraphen die Bedeutung des Begriffs geändert; die Frage, ob der Gesetzgeber mit der Neudefinition das getroffen habe, was der Tod wirklich ist, hat in dieser Form keinen oder jedenfalls keinen wissenschaftlich rekonstruierbaren Sinn. Andererseits geht der politischen Entscheidung, bevor sie dergestalt juristisch fixiert wird, eine ethische Diskussion voraus, bei der sehr wohl gefragt wird, welche gesetzgeberische Entscheidung die richtige sei. Worin besteht der Maßstab dieser Diskussion und damit des ethischen Diskurses? Wo verlaufen die Grenzen, an denen sich unser Umgang mit den ethischen Begriffen ausrichten kann und ausrichten muß, mit jenen Begriffen also, deren Eigentümlichkeit nach Kant darin besteht, daß sie den Gegenstand, auf den sie sich beziehen und nach dem sie sich zu richten haben, zugleich mit ihrem richtigen Gebrauch erst mit hervorbringen? Welcher Art ist dieser eigentümliche Gegenstand? Es ist genau diese Frage, die uns zwingt, den Begriff der Menschenwürde heranzuziehen und seine Bedeutung richtig zu stellen. Dieser Begriff ist keine Leerformel, kein versteckter Appell und keine Glaubensgröße. Er bezeichnet die Verständigungsbasis, von der her der ethische Diskurs seine Vernünftigkeit und Vermittelbarkeit gewinnt. Er bezeichnet ganz präzise eine eigentümliche Form von Wirklichkeit, durch die alle menschlichen Wesen miteinander verbunden sind. Er bezeichnet ein abstraktes Verhältnis, ähnlich wie etwa der Begriff des Eigentums im Unterschied zu dem des Besitzes ein abstraktes Verhältnis bezeichnet, in dem eine Rechtsperson durch ihre Macht über eine Sache indirekt zu allen anderen Personen steht. Und ähnlich wie es für eine Rechtsperson keinen Sinn hat, gegenüber einem Wesen, das dem Rechtsverband nicht angehört, ihr Eigentum einzuklagen, ist die Menschenwürde etwas, das nur Menschen miteinander verbindet. Der Affe, der den Fotoapparat des Touristen zerlegt, verletzt ebenso wenig dessen Eigentumsrecht wie der Löwe, der den Wärter frisst, dessen Recht auf Leben negiert. Tiere stehen mit Menschen in keinem Rechtsverhältnis, das heißt sie können sich Menschen und Menschen können sich ihnen gegenüber nicht rechtfertigen. Die Menschenwürde hingegen ist das, was uns zwingt, uns vor allen anderen Menschen für das, was wir tun, zu rechtfertigen. Warum aber können Menschen sich gegenüber Menschen rechtfertigen? Die Frage ist doppeldeutig. Man kann sie im Blick auf individuelle Einzelfälle beantworten und etwa sagen, daß ein Mensch sich für seine Taten rechtfertigen könne, weil er seine Pflichten erfüllt, weil er in Notwehr gehandelt oder weil er größeren Schaden verhindert habe. Man kann die Frage aber auch als grundsätzliche Frage nach den Bedingungen verstehen, die solch konkrete Rechtfertigung erst möglich machen, die also der Grund dafür sind, daß es zwischen Menschen überhaupt normative Ansprüche und normative Kriterien ihrer Erfüllung oder Verfehlung gibt. Als solche ist die Frage dann eindeutig Bestandteil des ethischen Diskurses, denn wer sie stellt, hat die prinzipielle Notwendigkeit, sich als Mensch für sein Tun rechtfertigen zu müssen, schon anerkannt. Der ethische Diskurs ist gegenüber seinem Gegenstand nicht neutral; wir suchen in ihm mit vernünftigen Gründen nach einer Rechtfertigung für das Verhältnis, aufgrund dessen wir uns gegenüber anderen Menschen rechtfertigen. Es ist also eigentlich dieses Verhältnis selbst, um das es im ethischen Diskurs geht. Indem wir ethische Grundbegriffe richtig stellen, leisten wir nicht etwa eine Vorarbeit, aufgrund derer dann die Frage nach den Bedingungen, die es möglich machen, daß Menschen sich voreinander rechtfertigen können, erst noch zu beantworten wäre; sondern die Richtigstellung der Begriffe und die Begründung für das zwischen Menschen bestehende Rechtfertigungsverhältnis fallen in eins. Nicht weniger ist beansprucht, wenn es darum geht, die Begriffe der Menschenwürde und des Menschenlebens richtig zu stellen. Damit Menschen sich im individuellen Einzelfall rechtfertigen können, müssen sie über bestimmte Eigenschaften verfügen: sie müssen der Sprache mächtig sein, ein gewisses Maß an Intelligenz besitzen und die Regeln kennen, aufgrund derer sie sich für ihr Tun zu verantworten haben. Aber all dem ist immer schon vorausgesetzt, daß überhaupt zwischen Menschen die Notwendigkeit besteht, sich zu rechtfertigen. Wäre diese Notwendigkeit ihrerseits eine Implikation bestimmter Eigenschaften konkreter menschlicher Individuen, dann könnte man sie ganz einfach aus der Welt schaffen, indem man jene Eigenschaften beseitigt oder indem man verhindert, daß sie sich ausbilden. Das berüchtigte mittelalterliche Experiment, bei dem man verhinderte, daß Kinder auf die ihnen natürliche Weise ihre Muttersprache erlernten und dem diese Kinder zum Opfer fielen, verstieß gegen ihre Menschenwürde, gerade weil es sie daran hinderte, in einen Zustand hineinzuwachsen, in dem sie den ihnen zustehenden Respekt hätten reklamieren können. Und diese Feststellung gilt unabhängig von der Frage, ob sie alle diesen Zustand tatsächlich erreicht hätten, wenn das Experiment nicht durchgeführt worden wäre. Der Grund, der es verbietet, ein Kind daran zu hindern, auf natürlichem Weg sprechen zu lernen, liegt nicht in dem Zustand, den es am Ende dieses Weges erreicht, sondern eben darin, daß dieser Weg von Natur aus zu einem menschlichen Leben gehört. Die Maßstäbe des menschenwürdigen Handelns können letztlich nicht von den konkreten Eigenschaften der von diesem Handeln betroffenen Individuen abhängig sein. Nur unter dieser Voraussetzung ist das für unsere Rechtsordnung so zentrale, aber in seiner Bedeutung durchaus verwickelte, ja geradezu paradoxe Wort von der „Unantastbarkeit“ bzw. der „Unverletztlichkeit“ der Menschenwürde überhaupt verstehbar. Bestünde die Würde nicht in Verhältnissen zwischen, sondern – wie etwa die Gesundheit – in Eigenschaften oder Vermögen von Menschen, dann würde man sie in eben dem Maße verlieren, in dem sie verletzt wird. Aber der Mensch, an dem eine würdeverletzende Handlung begangen wird, verliert durch sie gerade nicht seine Würde, eben weil diese Würde nicht etwas „an“ ihm Vorhandenes, sondern ein Verhältnis ist, das jeder konkreten Beeinträchtigung gegenüber unversehrt bleibt. Man kann wieder den Eigentumsbegriff zur Parallele heranziehen: Während man den Besitz durch faktischen Entzug der Zugriffsgewalt auf eine Sache verliert, bleibt das Eigentumsverhältnis an ihr bestehen, auch wenn die Rechte, die sich aus ihm ergeben, verletzt werden. Die Würde des Menschen wird nicht durch faktische Vermögen des Individuums, sondern durch abstrakte Normen konstituiert, die uns ungeachtet aller individuellen Besonderheiten miteinander verbinden. Es ist genau die Eigentümlichkeit dieser Normen, die dem ethischen Diskurs seine Eigenart verleiht; denn bei ihnen handelt es sich weder um Naturgesetze noch um staatliche Setzungen. Die abstrakte Qualität dieser Normen zeigt sich nicht zuletzt daran, daß ihre Geltung auch unabhängig davon ist, ob sich die Subjekte, auf die sie sich beziehen, ihrer bewusst sind oder nicht. Es gibt eklatante Fälle menschenunwürdiger Behandlung, bei denen gerade die Ahnungslosigkeit des Opfers ein entscheidender Unwertsfaktor ist. So wurde vor nicht langer Zeit von einem Pfleger in einem Altenheim berichtet, der seine Verachtung gegenüber einem alten Patienten dadurch manifestierte, daß er ihm den selben Lappen, den dieser zur Reinigung des Gesäßes benützte, auch für das Gesicht verabreichte, ohne daß er es merken konnte. Wenn der Respekt vor der Menschenwürde an das Bewusstsein ihrer Träger gebunden wäre, dann müsste man, um mit einem Menschen machen zu dürfen, was man will, ihm nur das Bewusstsein von dem, was ihm geschieht, rauben. Und umgekehrt wäre derjenige, der sich der menschenunwürdigen Qualität seines Tuns nicht bewusst ist, dadurch von seiner Verantwortung für es freigesprochen. Wenn wir als Träger der Menschenwürde nur diejenigen Wesen anerkennen wollten, die sich der Normen, welche diese Würde konstituieren, aktuell bewusst sind oder sich ihrer zum Zeitpunkt eines Normverstoßes doch bewusst werden könnten, dann müssten wir einen signifikanten Teil der Menschheit aus diesem Trägerkreis ausschließen. Vor allem würde dann das ärztliche Handeln, insofern dieses seine Bedeutung gerade daraus bezieht, daß es Menschen, denen die bewusste Herrschaft über ihr Leben verlorengegangen ist, wieder in sie zurückversetzt, zu einem reinen Willkür- oder Geschäftsakt, zu einer Dienstleistung anstelle jener humanitären Grundaufgabe, von der her der Arztberuf in allen Kulturen seine unvergleichliche Reputation erfährt. Träger der Menschenwürde können deshalb nicht nur diejenigen Wesen sein, die gerade augenblicklich über die körperlichen und psychischen Fähigkeiten verfügen, die Normen wahrzunehmen, welche diese Würde konstituieren; sondern Träger der Menschenwürde müssen alle Wesen sein, für die diese Normen gelten. Wie aber wird dieser Kreis festgelegt, wenn es sich bei den hier in Frage stehenden Normen weder um Naturgesetze, die unserem Willen entzogen sind, noch um politische Dezisionen handelt, die auf unserer freien Entscheidung zum Zusammenleben mit einer bestimmten Gemeinschaft beruhen? Wer definiert, worin die Würde des Menschen besteht und wem sie zukommt und wem nicht? Es dürfte genau die mit dieser Frage bezeichnete Schwelle sein, an der sich die Zukunft des ethischen Diskurses, insofern er auf den Begriff der Menschenwürde aufgebaut ist, entscheidet. Der Begriff „Menschenwürde“ enthält seiner innersten Natur nach nichts anderes als das Verbot, die genannte Frage zu beantworten.2 Niemand hat das Recht, darüber zu befinden, ob einem anderen Menschen Würde zukommt oder nicht. Das heißt, die Würde des Menschen lässt sich nicht definieren, sondern nur respektieren. Daher kann es auch so etwas wie eine „abgestufte“ Würde prinzipiell nicht geben. Würde hat nach der klassischen Definition von Kant, was „über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet“ 3. Einem Wesen Würde zusprechen bedeutet, es jeglicher Abwägung gegen irgendwelche Güter anderer Art – oder auch gegen Interessen anderer Wesen seiner eigenen Art – zu entziehen. Weil der Würdebegriff seiner innersten Anlage nach ein Verbotsbegriff ist, obliegt seine Konkretisierung nicht dem naturwissenschaftlichen, sondern dem juristischen Diskurs, für den es ja typisch ist, daß er von Störungen des menschlichen Zusammenlebens ausgeht und 2 Dieser Verbotscharakter ist für Rechtsbegriffe insgesamt charakteristisch, womit natürlich nicht gesagt ist, daß der Würdebegriff nicht positiv definiert und in der Rechtsprechung differenziert ausgelegt würde. Gemeint ist, daß seine Definition und Auslegung immer auf konkrete Konfliktfälle bezogen ist, deren Bewältigung durch die Rechtsordnung geleistet wird. Die Legitimität von Gesetzgebung und Rechtsprechung wird eröffnet durch den konkreten Entscheidungsfall, die Gefahr und die Störung, gegen welche die Rechtsordnung eine Gesellschaft zu schützen hat, und insofern tragen rechtliche Begriffe, wenn sie auf dem Gedanken des Menschenrechts aufbauen, konstitutionell den Charakter einer Negation der Negation, einer „Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen“ (Immanuel Kant: Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (Werke, hrsg. Von W. Weischedel, Band IV, Darmstadt 1983, AB 35). Vgl. dazu Walter Schweidler: Geistesmacht und Menschenrecht. Der Universalitätsanspruch der Menschenrechte und das Problem der Ersten Philosophie, Freiburg i.Br. 1994, §§ 36 f., insbes. 445 f., sowie Walter Schweidler: Menschenrechte und kulturelle Identität, in: Ders.: Das Unantastbare. Beiträge zur Philosophie der Menschenrechte, Münster 2001, 163-188, insbes. 167. 3 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Sämtliche Werke in sechs Bänden, Band IV, Darmstadt 1983, BA 77. Regeln zu deren Behebung implementiert. Die juristischen Maßstäbe der inhaltlichen Konkretisierung der Menschenwürde ergeben sich aus Tatbeständen möglicher Würdeverletzung und den zu ihrer Verhinderung gezogenen gesetzlichen Konsequenzen. Das staatliche Gesetz legitimiert sich als Schutz-, nicht als Definitionsinstanz der Menschenwürde. Wenn das staatliche Gesetz die Würde des Menschen für unantastbar erklärt, dann legitimiert es auch noch sich selbst aus einem Verbot und einer Grenze, die es sich setzt. Es schließt die Fragen, welchem menschlichen Wesen Würde zukomme und welchem nicht oder welchem ein höherer Grad an Würde zukomme als einem anderen, aus dem Bereich legitimer Inhalte des juristischen Diskurses aus. Es gründet sich damit auf ein kategorisches Verbot der Abwägung des „Wertes“ von Menschenleben gegen andere Güter oder gegeneinander und auch der Instrumentalisierung eines menschlichen Wesens für die Interessen anderer. Hier, in dieser rechtlichen Konstitution des Würdebegriffs, liegt der in der ethischen und auch in der politischen Diskussion immer wieder ausgeblendete Grund für die Unrelativierbarkeit und absolute Schutzbedürftigkeit des menschlichen Lebens. Wenn wir es zum obersten Legitimationskriterium unserer Rechtsordnung machen, daß kein Mensch darüber befinden darf, ob einem anderen menschlichen Wesen Würde zukommt oder nicht und daß kein Mensch den Wert eines anderen Menschen gegen andere Güter abwägen darf, dann folgt daraus als Reflex, daß alle Menschen, allein weil sie Menschen sind, ein unveräußerliches Recht auf Leben haben. Es ist eben nicht so, daß man zuerst aus irgendwelchen religiösen oder weltanschaulichen Motiven heraus die „Heiligkeit“ des menschlichen Lebens postulieren müsste, um dann auf die Forderung zu schließen, daß kein Exemplar der Gattung Mensch in seinem Lebensrecht beeinträchtigt werden dürfe. Wer diese Reihenfolge unterstellt, hat es leicht, die Kritik am „naturalistischen Fehlschluß“ anzubringen und die rhetorische Frage zu stellen, warum denn ausgerechnet die menschliche Gattung höher gewichtet werden solle als alles andere in der Welt. Um eine „Höhergewichtung“ kann es schon deshalb nicht gehen, weil die Kriterien für „höheres“ oder „niedrigeres“ Dasein wieder aus Eigenschaften und Wertabwägungen gezogen werden müssten, auf die der Würdebegriff gerade nicht gestützt werden kann. Die biologischen Zusammenhänge, welche die menschliche Gattung konstituieren, erlangen ethische Relevanz nicht aufgrund einer angeblich „speziesistischen“ Auszeichnung dieser Gattung durch uns als ihre Angehörigen, sondern sie treten gewissermaßen subsidiär in das Vakuum ein, das wir bewusst schaffen, wenn wir uns die Beantwortung der Frage, was ein menschliches Leben zum Träger von Würde mache, verbieten. Wenn der juristische Diskurs sich aus ethischen Gründen hier die unüberschreitbare Grenze setzt, dann bleibt als die Instanz, die darüber entscheidet, wer Mensch ist und wer nicht, nur die Natur übrig. Wenn uns die positive Auszeichnung von Eigenschaften, aufgrund derer ein menschliches Leben einem anderen überzuordnen wäre, verboten ist, dann bleibt nur übrig, als menschliche Wesen alle diejenigen gelten zu lassen, die durch natürliche Abstammung aus anderen menschlichen Wesen hervorgehen. Wir müssen die Natur respektieren, nicht weil sie an sich heilig wäre, sondern weil wir sie nur nach Maßgabe von Kriterien korrigieren könnten, die uns, ob wir wollen oder nicht, zu Herren über das Leben anderer Menschen machen müssten.4 So jedenfalls ist es, solange wir die Schwelle, die mit der Frage nach solchen Kriterien berührt wird, nicht überschreiten. Die Diskussion, die sich in den letzten Jahren auf dem Feld der Bioethik abgespielt hat und die nunmehr in eine neue und in ihrer Brisanz noch einmal gesteigerte Phase getreten ist, geht jedoch gerade um diese Grenzüberschreitung. Die Position, die, wie ich jetzt skizziert habe, den ethischen Diskurs auf der Basis eines letztlich Verbotscharakter tragenden Konzepts von Menschenwürde verankert sieht, ist auf einer ganzen Reihe von Ebenen zurückgedrängt und relativiert worden. Abgetriebene Föten, sogenannte überzählige Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung „anfallen“, genetisch krankes Leben, das nach seiner pränatalen Untersuchung als unzumutbare Belastung seiner Eltern klassifiziert wird, nunmehr Embryonen, die vernichtet werden, um Stammzellen zur Züchtung von Gewebe zu gewinnen, das Krankheiten zu heilen erlaubt – und möglicherweise einmal menschliches Leben, das anderem menschlichen Leben überhaupt nicht mehr auf natürliche Weise entstammt, sondern aus ihm durch Klonieren künstlich erzeugt wird: Der Mensch ist auf breiter Front zum Gegenstand der Abwägung seines Lebensrechts gegen Zumutbarkeits- und Wünschbarkeits-, gegen Kosten- und Nutzengesichtspunkte geworden. Heißt das, daß der ethische Diskurs, der auf dem Verbotskonzept von Menschenwürde basiert, durch einen anderen widerlegt oder jedenfalls ersetzt worden ist, daß sich also eine neue Ethik in unseren Gesellschaften durchgesetzt hat? Gibt es ein Prinzip, das an die Stelle der Menschenwürde getreten wäre oder um dessen Durchsetzung zumindest gerungen würde? Betrachtet man die Beispiele, die ich gerade kurz benannt habe und die ja allesamt Fälle der Relativierung des Lebensschutzes am Beginn des menschlichen Lebens sind, dann wird man diese Frage nicht bejahen können. Mit geradezu instinktiver Zähigkeit hat unsere Rechtsordnung an der Behauptung des für ihre ganze Systematik und für die Legitimation des 4 Vgl. Robert Spaemann: Zur Aktualität des Naturrechts, in: Ders.: Philosophische Essays, Stuttgart 1994, 60-79, insbes. 77 f. modernen Staates überhaupt fundamentalen Würdekonzepts festgehalten. Sie hat dafür allerdings einen hohen Preis bezahlt, der an ihre Wurzeln rühren könnte, nämlich den Preis der zunehmenden Rechtsunsicherheit und tendenziellen Inkonsistenz. Das menschliche Leben ist nach der deutschen Verfassungsrechtsprechung von der Befruchtung an geschützt, aber Abtreibung wird in den bekannten Grenzen nicht bestraft und überdies sozialstaatlich organisiert. Behindertes menschliches Leben darf nach unserem Grundrechtsverständnis in keiner Weise diskriminiert werden, aber zwei Senate des höchsten deutschen Gerichts kommen zu diametral entgegengesetzten Entscheidungen hinsichtlich der Frage, ob die Geburt eines behinderten Menschen ein Schadensfall sei, der zu finanzieller Kompensation führen müsse.5 Ein „menschliches Wesen“ ist nach der Bestimmung der Bioethik-Konvention des Europarats gegen jede Instrumentalisierung für Zwecke, die nicht seiner Erhaltung oder Heilung dienen, geschützt. Aber in der Erläuterung dieses Rechtssatzes wird ausdrücklich gesagt, daß die Definition dessen, was ein „menschliches Wesen“ sei und insbesondere wann es beginne, dem nationalen Gesetzgeber überlassen bleibe.6 Dieselbe Konvention statuiert zum Prinzip der Nichtinstrumentalisierung des menschlichen Lebens Ausnahmetatbestände, die dazu geführt haben, daß eine Reihe von Ländern, unter anderem unseres, ihre Unterzeichnung verweigert und ihr Inkrafttreten damit verhindert haben. Die Gewinnung von embryonalen Stammzellen durch verbrauchende Forschung bleibt in Deutschland aufgrund unseres Embryonenschutzgesetzes verboten, der Import der durch eben die bei uns verbotenen Methoden gewonnenen Zellen jedoch ist aufgrund eines Gesetzes erlaubt, das wiederum zur Bedingung für die Verwendung von Stammzellen macht, daß dieser die Vorschriften eben des Embryonenschutzgesetzes nicht entgegenstünden.7 All die Dehnungen und Verrenkungen, die man in Kauf nimmt, um den faktischen Zusammenbruch des ursprünglichen Konzepts einer unteilbaren Menschenwürde juristisch zu kompensieren, deuten darauf hin, daß wir weit davon entfernt sind, eine ethische Alternative zu ihm für akzeptabel zu halten. Insbesondere die weltweit einhellige juristische und politische Verdammung des Klonens von Menschen lässt sich gar nicht erklären, wenn wir sie nicht als instinktive Erinnerung daran verstehen, daß unser rechtliches Zusammenleben und 5 Vgl. dazu im einzelnen: Eduard Picker: Menschenwürde und Menschenleben. Das Auseinanderdriften zweier fundamentaler Werte als Ausdruck der wachsenden Relativierung des Menschen, Stuttgart 2002, 43 ff., 195 f. 6 Vgl. dazu m.w.N. ebd. 10, 182 f. sowie: Walter Schweidler: Bioethische Konflikte und ihre politische Regelung in Europa: Stand und Bewertung. Discussion Paper des Zentrums für Europäische Integrationsforschung C 13 1998, Bonn 1998, 40. 7 Vgl. dazu die von Ernst Benda erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken, zitiert bei Georg Paul Hefty: „Nicht verboten ist die Einfuhr...“. Der Gesetzesentwurf zum Stammzellimport, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.2.2002, Nr. 50, 4. daß jene Fähigkeit zur Rechtfertigung, die den Menschen von allen andersgearteten Wesen in der Natur unterscheidet, darauf beruhen, daß wir an der natürlichen Einheit der Menschheit festhalten und diese gegen jede Relativierung verteidigen. Denn so kategorial, wie seine einhellige weltweite Ablehnung impliziert, würde sich das Klonen von Menschen von vielen bereits realisierten und erlaubten Praktiken nicht unterscheiden, jedenfalls was seine Folgen für die von ihm betroffenen und eventuell durch es erzeugten Individuen anginge. Total verändert würde durch es nur die Gesamtstruktur der Menschheit, die in einen natürlich gezeugten und einen künstlich erzeugten Teil auseinandergerissen würde. Wenn wir davor zurückschrecken, dann letztlich deshalb, weil mit der natürlichen Einheit der Menschheit genau das endgültig verloren ginge, worauf unser Verbotskonzept von Würde ungeachtet aller faktischen Relativierungen immer noch basiert. Wir müssten uns dann vor anderen Menschen dafür rechtfertigen, daß sie sind, wie sie sind, und eben das Wissen, das wir dafür benötigten, haben wir nicht und können wir nicht haben. Die Lage ist also die, daß wir zum ethischen Diskurs auf der Basis des Verbotskonzepts der Menschenwürde keine adäquate Alternative haben, seine juristische Konkretisierung jedoch durch politische Kompromisse mit der Relativierung des unbedingten Respekts vor der Menschenwürde zu vereinbaren gezwungen sind. In dieser Situation kommt nun eine mögliche Strategie ins Blickfeld, über deren Charakter wir uns Klarheit verschaffen müssen, wenn wir verstehen wollen, ob sie uns vor weiterer Inkonsistenz und Rechtsunsicherheit tatsächlich bewahren kann oder ob sie die Tendenz dazu nicht noch entscheidend verschärfen wird. Ich meine die Strategie, Entscheidungen über die Zugehörigkeit menschlicher Wesen zum unteilbaren Verband der Träger der Menschenwürde doch in den naturwissenschaftlichen Diskurs zu verlagern. Im Zentrum dieser Strategie steht die Frage nach den Grenzen dessen, was, wie mir scheint, am präzisesten mit dem Begriff des „Menschenlebens“ benannt werden kann. Die Auseinandersetzung um diese Strategie bildet die Fortführung, vielleicht sogar die Neuformulierung jener noch lange nicht abgeschlossenen Debatte, in deren Zentrum der Streit um die mögliche Differenz zwischen Personsein und Menschsein steht. Was dort als die Frage nach den Grenzen des Personseins im Unterschied zu denen des Menschseins formuliert wurde, taucht nun als die Frage nach den Grenzen des Lebens menschlicher Wesen im Unterschied zu denen von menschlichem Leben auf. Der entscheidende Schritt, der in diese Debatte geführt hat, ist gar nicht auf dem Feld der Auseinandersetzung um den Beginn des Menschenlebens geschehen, sondern dort, wo es um dessen Ende geht. Jeder soliden philosophischen Auseinandersetzung mit der Strategie der scheinbar naturwissenschaftlich begründeten Zertrennung des Bandes zwischen menschlichem Leben und Menschenwürde muß die Einsicht zugrunde liegen, daß die ethische Relevanz der Grenzen des Menschenlebens nur geklärt werden kann, wenn die Frage nach seinem Ende, die nach seinem Anfang und die nach seinen Grenzzuständen neu aufgerollt und eng miteinander verknüpft werden. Insofern steht die „Hirntoddebatte“, was ihre ethische Relevanz angeht, eigentlich noch am Anfang. Denn sie war es, die zum ersten Mal die Differenzierung zwischen Menschenleben und menschlichem Leben zum Leitfaden einer Auseinandersetzung um die Menschenwürde gemacht hat. Der Mensch, dessen Hirnfunktionen definitiv abgestorben sind, wird gesetzlich als Leichnam betrachtet; aber die Organe, deren Funktion durch technische Mittel aufrecht erhalten wird, sind doch zweifellos seine, also die Organe eines Menschen. Es ist menschliches Leben, das in ihnen konserviert wird. Demnach gibt es menschliches Leben, das nicht einem Menschen zugehört. Wessen Leben ist dies dann aber? Es kündigt sich auf diese Frage eine Antwort an, die den bioethischen Diskurs in den naturwissenschaftlichen hinüberzu geleiten scheint, nämlich die Antwort: Es ist eben das Leben der Organe. Wenn es Leben „von Organen“ gibt, dann gibt es auch das Leben „von Zellen“. Es gäbe demnach das „Leben“ menschlicher Zellen unabhängig, vor und nach, vielleicht sogar neben dem Leben des Menschen, dem sie entstammen. Und damit scheinen sich ungeahnte Möglichkeiten der Befriedung gesellschaftlicher Konflikte durch Anrufung naturwissenschaftlicher Kompetenz zu eröffnen: Können wir nicht mit sicheren naturwissenschaftlichen Methoden den Faktor ermitteln, ja haben wir ihn nicht schon mit dem Gehirn als dem „kritischen“ Organ entdeckt, der das Leben menschlicher Zellen und Organe erst zum Menschenleben, zur Einheit eines Wesens organisiert, dem wir dann gerne die Würde zugestehen können, die es von allen anderen Lebewesen – einschließlich jenen Zellen, aus denen es hervorgeht und die nach seinem Ende von ihm übrig bleiben und die vielleicht sogar neben ihm existieren können – unterscheidet? Sind wir dann nicht auch in der Lage, mit naturwissenschaftlich begründeten Methoden auch die andere Grenze zu bestimmen, diejenige, die den Beginn des Menschenlebens von den ihm vorhergehenden Stationen bloßen menschlichen Zellen- und Organlebens trennt? Warum soll beispielsweise nicht das naturwissenschaftlich feststellbare Einsetzen von Hirnfunktionen innerhalb jenes ihm vorausgehenden zellulären Agglomerats, also gewissermaßen der Anfang des „Hirnlebens“ entsprechend zum „Hirntod“, den Beginn der Existenz eines Menschenlebens markieren? Mag die Würde des Menschen in der Tat aus Verhältnissen und nicht aus Eigenschaften begründet sein, für das Ende und dementsprechend für den Anfang eines Menschenlebens kommt es doch offenbar auf Merkmale an, die sich einzig und allein an einem individuellen Lebewesen finden lassen; und zumindest dort, wo diese Individualität noch nicht einmal ausgebildet, noch nicht einmal entschieden ist, scheint dann zwar die Existenz menschlichen, nicht jedoch die des Lebens eines menschlichen Individuums zugestanden werden zu müssen. Es ist nicht zu bestreiten, daß sich für denjenigen Diskurs, auf den ich bisher explizit noch gar nicht zu sprechen gekommen bin und der an einer operationalisierbaren Verständigungsbasis über die Grenzen der Menschenwürde am meisten interessiert ist, nämlich den politischen, durch diese Differenzierung zwischen menschlichem Leben und Menschenleben wichtige Perspektiven eröffnen, um der direkten Infragestellung des Verbotskonzepts der Menschenwürde auszuweichen. Wenn man das Menschenleben erst mit dem Stadium beginnen lässt, in dem menschliche Zellen sich soweit entwickelt haben, daß die Ausbildung eines konkreten Individuums festgelegt ist, dann stünde der Träger des diesem Stadium vorhergehenden Lebens für die Gewinnung von embryonalen Stammzellen zur Verfügung, bevor sich die Frage der Menschenwürde stellte. Damit wäre auch der Weg für die Zulassung des sogenannten „therapeutischen Klonens“ geöffnet.8 Dann könnte man auch argumentieren, daß die Herstellung eines Embryos durch Klonierung eines aus der Blastozyste gewonnenen Zellkerns unter der – noch hypothetischen – Voraussetzung, daß diese Blastozyste durch neue medizinische Methoden erhalten und zu einem Menschenleben fortentwickelt werden kann, gar kein eigenes Individuum, sondern einen genetisch mit seinem Spender identischen Ableger hervorbringt, der eher den Status eines diesem zugehörigen Gewebes als den eines selbständigen menschlichen Wesens habe.9 Dann hätten wir tatsächlich den Fall nebeneinander existierenden Menschenlebens und zu ihm als Ersatz- und Rohmaterial gehörigen „menschlichen Lebens“. Zudem erscheint ein politischer Kompromiß hinsichtlich der Frage nach dem Beginn des Menschenlebens zwischen verschiedenen religiösen Menschenbildern durchaus denkbar. Würde man den Beginn des Menschenlebens dort ansetzen, wo die Anthropologie des heiligen Thomas von Aquin10 oder die den islamischen Grundvorstellungen von der Natur des Menschen die Beseelung des menschlichen Leibes Vgl. in diesem Sinne etwa: „Unglaubliche Ignoranz der Politiker. Der Biologe Rudolf Jaenisch über Politik und Kommerz in der Stammzellforschung, in: Neue Zürcher Zeitung, 25.5.2002, zugänglich unter http:\www.nzz.ch/dossiers/biomedizin/2002.05.25-zf-article85E20.html. 9 Vgl. dazu Eve-Marie Engels: Ethische Aspekte der Transplantations- und Reproduktionsmedizin am Beispiel der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen, in: Nova Acta Leopoldiana NF 82, Nr. 315 (2000), 159 – 183, 177. 8 10 ansetzen,11 so hätte man eine erhebliche Zeitspanne reserviert, in der menschliches Leben mit anderem Status als dem des Menschenlebens zur Disposition der Gesetzgebung stünde. Noch weitergehend wird in der deutschen Diskussion schon die Frage gestellt, „was denn eigentlich gegen (die seit Jahrtausenden praktizierte Auffassung) spricht“, Menschenleben „mit der Geburt beginnen zu lassen“12. Es dürfte kein Zufall sein, daß die Befürworter einer solchen Art von religiösweltanschaulichem Kompromiß gerade auf Positionen verweisen, die geschichtlich hinter der Entwicklung des modernen Verbotskonzepts der Menschenwürde zurückliegen. Es ist schon eine Verzerrung der Diskussion, wenn man derartige Erörterungen aus dem ihnen eigenen anthropologischen Kontext reißt und sie unmittelbar für die ethische Frage nutzbar machen will, was Menschen mit dem nicht oder noch nicht beseelten menschlichen Leben tun dürfen. Im Kontext der theologischen oder religiösen Anthropologie wird an dieser Stelle prinzipiell eine Kategorie relevant, ohne die man in den ethischen Kontext nicht hinübergelangt, und das ist die Kategorie der Schöpfung. Über menschliches Leben zu verfügen, auch wenn es nicht die volle Gestalt des Menschenlebens erreicht haben sollte, heißt doch in einen Prozeß einzugreifen, der vom Schöpfer als kontinuierlicher und in sich einheitlicher gewollt worden ist. So beruft sich eine für die islamische Anthropologie typische Argumentation gegen die ethische Vertretbarkeit des Klonens darauf, daß die Erzeugung eines menschlichen Wesens unter Durchbrechung der natürlichen Abstammungslinie die kausale Verbindung des Menschengeschlechts mit dem einen Schöpfer, der allein dieses Geschlecht ins Leben gerufen hat, zerschneiden würde.13 Und im Kontext des philosophisch-theologischen Systems eines Thomas von Aquin geschieht der Schritt von der Anthropologie in die Ethik in entscheidender Weise dort, wo nicht nach so etwas wie dem „Status“ unbeseelten menschlichen Lebens, sondern nach dem Charakter bestimmter es betreffender Handlungen zu fragen ist. Für die Beantwortung der Frage, wie ein Handelnder mit unbeseeltem menschlichem Leben umgehen darf, kommt es zuletzt nicht auf den humanen Status solchen Lebens, sondern auf den dieses Handelnden an: Nicht ob dem unbeseelten Leben innewohnende spezifisch menschliche Dem Propheten Mohammed wird die Aussage zugeschrieben, der Mensch sei nach der Befruchtung „vierzig Tage Samen, vierzig Tage Knoten, vierzig Tage Fleischklumpen“, dann erst werde ihm die Seele eingehaucht. Die maßgeblichen sunnitischen Rechtsschulen setzen die Beseelung mehrheitlich vierzig Tage nach der Befruchtung an; vgl. Holger Tillmann: Menschen? Ach nein, das sind ja Fleischklöpse. Die Worte des Propheten Mohammed können einen strengen Embryonenschutz nicht begründen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2001, Nr. 296, 56. 12 Volker Gerhardt: Der Mensch wird geboren. Philosophische Würdigung der Gentechnik, in: Zur Debatte, 31. Jahrgang (2001), Sondernummer B 215 75 F, 9 (mit „menschlichem Leben“ anstelle meines hier aber entsprechenden Ausdrucks „Menschenleben“). 13 Majdah Zawawi: Human Cloning. A Comparative Study of the Legal and Ethical Aspects of Reproductive Human Cloning, Institute of Islamic Understanding Malaysia 2001, 20. 11 Eigenschaften beeinträchtigt würden, sondern ob der Handelnde seine naturgegebene Berufung, das menschliche Leben „als Mitwirken an der göttlichen Schöpferliebe“14 weiterzugeben, verletzen würde, ist die Frage, deren ethische Beantwortung dazu zwingt, auch das unbeseelte Leben als ein zu Respekt und Schutz verpflichtendes Rechtsgut zu betrachten. Das moderne Konzept der Menschenwürde ist ohne den metaphysischen Kontext eines solchen Schöpfungsbegriffs entstanden und kann insofern nicht unmittelbar auf frühere Vorstellungen von beseeltem oder nicht beseeltem menschlichem Leben zurückbezogen werden. Der neuzeitliche Staat, auf dessen Legitimationsmodell unsere heutige Rechts- und Friedensordnung beruhen, überlässt große Bereiche der Lebensführung dem privaten Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger, das sie insofern gegebenenfalls durchaus aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen bilden und fällen mögen – aber das Urteil über Beginn und Ende des Menschenlebens gehört zu diesen Bereichen mit Sicherheit nicht. Kein weltanschaulicher Konsens oder Kompromiß zwischen privaten Auffassungen könnte die staatliche Verpflichtung zum ungeteilten Respekt vor der Würde allen menschlichen Lebens relativieren. Das Prinzip der Unantastbarkeit der Menschenwürde ist der Regelungsgewalt des modernen Staates entzogen, nicht weil er das diesem Prinzip innewohnende Verbot aus irgendwelchen metaphysischen Vorstellungen abgeleitet hätte, sondern weil er seine Gewalt selbst aus ihm begründet. Er hat überhaupt kein anderes, kein transzendentes Legitimationskriterium, er hat ebenso wenig ein ethisch begründbares Korrektiv gegen die Freiheits- und Entfaltungsansprüche der ihm unterworfenen Regierten als nur das Prinzip des Respekts vor der gleichen Würde aller Menschen. Was er gegen den Willen irgend eines seiner Bürger durchsetzen darf, das kann er nur aus seiner Verpflichtung gegenüber den Rechten anderer und letztlich aller seiner Bürger begründen. Das bedeutet umgekehrt, daß jede Inanspruchnahme der Definitionsgewalt darüber, wer zum Kreis der von ihm zu respektierenden menschlichen Wesen gehört, gleichbedeutend ist mit der Ermächtigung eines letztlich willkürlich zusammengesetzten Kreises seiner Bürger, das aus diesem Kreis ausgeschlossene menschliche Leben daraufhin zu beurteilen, ob und inwieweit seine Zulassung zu diesem ausgewählten Zirkel den Interessen der bereits zu ihm Gehörigen dient oder nicht. Würde und Lebensrecht würden damit zu Funktionen der gesellschaftlichen Vereinbarung über erwünschte Ausdehnung von Freiheits- und Eigentumsspielräumen. Dagegen eben schützt allein das Verständnis des Begriffs der Menschenwürde als eines 14 Martin Rhonheimer: Natur als Grundlage der Moral. Eine Auseinandersetzung mit autonomer und teleologischer Ethik, Innsbruck/Wien 1987, 115. Konzepts, das uns auch die Trennung zwischen menschlichem Leben und dem Leben von Menschen noch verbietet. Weil auch mit ihr seine letzte Legitimationsbasis berührt ist, kann der Rechtsstaat die Frage nach der Differenz zwischen menschlichem Leben und dem Leben von Menschen weder auf den naturwissenschaftlichen noch auf den (inter-)religiösen Diskurs abschieben; sie bleibt unweigerlich eine ethische Frage, die seine rechtliche Verantwortung gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern mit begründet. Um dies zu erkennen, muß man sich allerdings gerade an dieser Stelle noch einmal klarmachen, daß die ethische Dimension einer Frage oft mehr als in ihrer Beantwortung dort entschieden wird, wo es darum geht, sie richtig zu stellen. Die ethische Brisanz des Streits um die Stammzellforschung beispielsweise ist nicht zu verstehen, wenn man einfach nur nach dem „Status“ embryonaler Zellen und nach den Möglichkeiten fragt, die sie der medizinischen Forschung eröffnen. Ethisch ausschlaggebendend ist hier nicht die Qualität von Zellen, sondern von Handlungen. Die entscheidende Frage lautet nicht, was Stammzellen sind, sondern was für Handlungen nötig sind, um an Stammzellen zu kommen. Ganz entsprechend hierzu hat man den ethischen Aspekt schon verfehlt, wenn man sich Fragen stellt wie die, ob transplantierbare Organe, gezüchtetes Gewebe oder „endgültig“ nicht mehr für Fortpflanzungszwecke in Frage kommende Embryonen denn als „menschliche Wesen“ betrachtet werden könnten; worauf es ankommt ist vielmehr, wie die Handlungen ethisch zu beurteilen sind, aufgrund derer wir mit solchen Entitäten konfrontiert werden. Ethisch kommt es eben nicht darauf an, ob wir eine Differenz zwischen menschlichem Leben und dem Leben von Menschen erzeugen können, sondern ob wir dies dürfen. Nicht ob menschliches Leben jenseits lebender Menschen, sondern ob es auf deren Kosten existiert, ist entscheidend. Wenn gezüchtetes Gewebe, transplantierbare Organe oder embryonale Stammzellen auf Kosten menschlicher Wesen existieren, aus denen sie „gewonnen“ oder denen sie entnommen wurden, dann ist die Feststellung, daß es sich bei ihnen um das „Leben“ dieser Organe oder Zellen handle in hohem Maße irreführend, weil sie impliziert, daß das Leben eine Art Eigenschaft oder Zustand eines materiellen Trägers wäre, der von diesem auf einen anderen Träger oder einen Teil des ursprünglichen Trägers quasi übertragen werden könnte. Aber ein solches Bild verwirrt gerade den Unterschied zwischen lebendigen Wesen und toter Materie. Kein philosophisches Diktum drückt diese für die gesamte ontologische Gliederung der Wirklichkeit so fundamentale Differenz urtümlicher aus als das aristotelische vivere viventibus est esse.15 In diesem durch die Philosophiegeschichte fortwährend wiederholten Satz ist eine ganz entscheidende Aussage enthalten, die wir mutatis mutandis noch in der modernen Konzeption der unteilbaren Würde des menschlichen Lebens aufgehoben finden, nämlich die Aussage, daß Leben nicht die Eigenschaft einer es tragenden Entität ist, sondern daß die Lebewesen selbst die letzten substanziellen Einheiten dessen sind, was wir lebendig nennen. Wenn ein Lebewesen stirbt, dann verliert es nicht eine oder einen Komplex von Eigenschaften, sondern dann hört es auf zu existieren. Thomas von Aquin sagt darum einmal, daß wir die Glieder eines toten menschlichen Leibes nicht mehr im selben, das heißt im univoken Sinne Glieder nennen können wie die eines lebenden Menschen; 16 eine abgeschlagene Hand ist nur noch in einem analogen Sinne eine Hand, weil sie dem Träger nicht mehr angehört, der sie als das, was sie ist, konstituiert. In keinem Fall ist die Hand selbst dieser Träger. Gerade die Befürworter des „Hirntodkriteriums“ liefern, indem sie Atmung und Reflexe des immerhin der Bestattung noch nicht fähigen Leibes eigentlich als etwas zu betrachten gewillt sind, was einem wirklichen Organismus bloß analog ist, für die Plausibilität dieser Sichtweise noch einen indirekten Beleg. Es ist überhaupt nicht zu sehen, warum und inwiefern die angebliche Eigenschaft „Leben“, die der das zu entnehmende Organ enthaltende Leib mit dem „Hirntod“ verloren haben soll, ausgerechnet mit der Entfernung des Organs aus ihm in dieses zurückkehren soll. Das Wort „Hirntod“ hat einen guten Teil seiner suggestiven Kraft ohnehin aus der Ambiguität, mit der es zwischen der herkömmlichen Beziehung auf das Ende der Existenz eines lebendigen Menschen („Herztod“) und der irreführenden Vorstellung vom Ende des „Lebens“ eines Organs namens Gehirn schillert. Wenn wir Organe oder Zellen getrennt von dem Leib, dem sie entstammen, in Funktion erhalten, kultivieren und sogar in selbständige Weiterentwicklung versetzen können, dann ändert das nichts daran, daß das „Leben“, dem sie ontologisch zugehören, das Leben der menschlichen Person ist oder gewesen ist, welcher sie entnommen wurden. Was diese Organe zu Organen macht und was diesen Zellen ihre ontologische Identität verleiht, ist das Leben des organischen Wesens, in dem sie ihre Funktion entfaltet haben oder auch zu entfalten bestimmt sind. Und sofern es sich um menschliche Organe oder Zellen handelt, dann sind es die Würde und der Schutz des Lebens einer menschlichen Person, was auf dem Spiel stand, als sie gewonnen wurden, und was weiterhin involviert ist, wenn wir mit ihnen umgehen. Die ontologische Ureinsicht des vivere viventibus est esse ist ja nicht etwa eine metaphysische Antithese zum naturwissenschaftlichen Weltbild, sondern sie steckt selbst noch und wiederum 15 16 Aristoteles: De anima III.4, 429 b (in : Philosophische Schriften, Band 6, Darmstadt 1995). Thomas von Aquin: Kommentar zu de generatione et corruptione 1, 15 (n. 108).. im Zentrum des Konzepts, mit dem die heutige biologische Wissenschaft die Gliederungsund damit die Erklärungsprinzipien der lebendigen Natur formuliert, nämlich des biogenetischen Artkonzepts.17 Die „Arten“ des Lebendigen sind eben nicht, wie es das überkommene morphogenetische Verständnis noch implizierte, als Unterfälle einer abstrakten Kausalgesetzlichkeit zu rekonstruieren, aus der sie aufgrund quasiphysikalischer Kräfte nebeneinander hervorgehen, sondern sie werden durch evolutionäre – und das heißt letztendlich geschichtliche – Prozesse konstituiert, in denen sich aus Populationen aufgrund biologischer Barrieren neue, in sich geschlossene Ketten der Weitergabe des Erbmaterials abspalten. Jede Art, der ein heute auf der Erde existierendes Lebewesen angehört, verdankt sich einem derartigen evolutionsgeschichtlich zurückliegenden Bildungsprozeß, und alles biologische Leben ist in so konstituierte Arten gegliedert. Wenn dem aber so ist, dann ist gar nicht zu sehen, inwiefern von Organen oder Zellen als natürlichen „Trägern“ von Leben gesprochen werden könnte. Sie mögen aufgrund künstlicher Vorrichtungen für eine kürzere oder längere Zeitspanne von den Lebewesen getrennt existieren können, denen sie entstammen; aber es existieren deshalb nicht neue „Arten“ von Leben neben den bisherigen, und auch um Mutationen handelt es sich hier natürlich nicht. Vivere viventibus est esse heißt, daß „das Leben“ vollständig und lückenlos in Arten von Lebendigem, in „Lebewesen“ aufgeteilt ist, welche die Identität von allem definieren, was aus ihnen hervorgeht. „Lebewesen“ sind daher die beiden Würmer, die aus der Teilung des einen hervorgehen, aber doch nicht die Zellen, aus denen sie bestehen und die man ihnen künstlich wegnehmen könnte. Für die Frage nach dem Beginn des Lebens von Menschen folgt daraus, daß es keinen anderen Träger des menschlichen Lebens geben kann als die Lebewesen der Gattung homo sapiens sapiens, die aufgrund der Weitergabe des Lebens aus den anderen ihrer Art hervorgehen. Über „Kontinuität“ oder „Diskontinuität“ dieses Hervorgehensprozesses braucht insofern überhaupt nicht spekuliert zu werden. Wie der Prozeß auch genau aussehen mag, in dem ein menschliches Lebewesen aus zwei anderen hervorgeht, es können an ihm doch 17 Vgl. zu den philosophischen Grundlagen dieser Betonung des geschichtlichen Aspekts der biologischen Evolution die differenzierte Verbindung zwischen darwinistischer und aristotelischer Artkonzeption in den Beiträgen von Ernst Mayr: Evolution und die Vielfalt des Lebens, Berlin/Heidelberg/New York 1979, insbes. 223 f., sowie die Charakterisierung des biogeschichtlich orientierten im Gegensatz zum kausalistischmorphologischen Artbegriff: Eine Art ist nicht durch sie mit anderen Arten übergreifende Eigenschaften definiert, die dann wiederum auf eine sie gemeinsam als ihren Unterfall hervorbringende materielle Gesetzlichkeit hin zu erklären wären, insbesondere also auch „nicht aufgrund des Besitzes bestimmter sichtbarer Attribute..., sondern durch ihre Relation zu anderen Arten. Das Wort Art entspricht hier sehr genau anderen Bezeichnungen für Relationen, z.B. dem Wort Bruder...Eine Population ist eine Art nur in bezug auf eine andere Population. Eine andere Art sein ist nicht eine Frage des Unterschiedes, sondern der Relation“ (235). niemals mehr als die Wesen beteiligt sein, die und aus denen diese durch diesen Prozeß hervorgehen. Und bei allen diesen Lebewesen handelt es sich, sofern wir an der Bedeutung des Rechtsbegriffs der Menschenwürde festhalten, um Personen. Daß menschliches Leben bis zu einem gewissen Stadium noch keine individuelle Identität ausgebildet hat, heißt nur, daß sich über eine gewisse Zeitspanne hinweg aus den es weitergebenden Menschen nicht nur eines, sondern noch mehrere Wesen entwickeln können, die dieses früheste Stadium gemeinsam haben; aber es heißt nicht, daß dieses Stadium einen von ihnen getrennten Träger hätte, dessen „moralischer Status“ aufgrund naturwissenschaftlich feststellbarer Grenzen in Frage gestellt wäre. Eben aufgrund der biologischen Konstitution des Lebendigen ist nicht zu sehen, wie dieser Träger ontologisch zu kategorisieren wäre. Das Leben, um das es in den Fragen der ethischen Beurteilung von Techniken wie denen der Organtransplantation, der Stammzellforschung oder der Präimplantationsdiagnostik geht, ist deshalb nicht das „Leben der Zellen“ oder „der Organe“, die hierbei untersucht, gezüchtet oder verpflanzt werden; es ist und bleibt das Leben von Menschen, und zwar auch dann, wenn sich lange nicht entscheidet oder überhaupt offen bleibt, welche Menschen genau dies sind oder gewesen sind. Wo jedenfalls von Menschen abstammende menschliche Wesen geopfert oder instrumentalisiert werden, um solche angeblichen Träger von „Leben“ zu gewinnen, dort ist es das Leben dieser geopferten oder instrumentalisierten Menschen, dessen Missachtung den Schlüssel zur ethischen Qualifikation der relevanten Handlungen und Anschlusstatbestände bildet. Man darf hier nicht außer Acht lassen, daß es gerade die Verbannung jeder Unterscheidung zwischen menschlichem Leben und Menschenleben ist, die seit jeher im Zentrum der Humanisierung der zivilisierten Welt im Zeichen der Menschenrechte und der Menschenwürde gestanden hat. Wir haben es uns verboten, jemals von Wesen, die von Menschen abstammen, zu sagen, dies seien „eigentlich“ keine Menschen. Die Separierung zwischen vollem und zweitklassigem menschlichem Leben ist die Urform der Inhumanität, und sie liegt auch noch dort vor, wo zwischen Menschenleben und menschlichem Leben getrennt wird. Der umfassende Schutz menschlichen Lebens hat seine ontologische Basis in der vollständigen Aufteilung allen menschlichen Lebens unter die Menschen, das heißt die Personen als seine Träger. Das neuzeitliche Konzept der Menschenwürde als desjenigen Verhältnisses, aufgrund dessen einem Angehörigen der menschlichen Art prinzipiell die Möglichkeit abgesprochen wird, menschliches Leben auf seinen humanen Status hin zu beurteilen und zu bewerten, entspringt dieser ontologischen Einsicht; es ist gerade nicht Ausdruck irrationaler Dezisionen, sondern des Respekts vor der dialektischen Verknüpfung von Vernunft und Natur als der Grundbedingung rationalen Umgangs mit dem, woraus Rationalität erwächst. Konsistenz und Berechenbarkeit unserer Rechtsordnungen hängen wesentlich davon ab, daß dieser Respekt als Grenze jeden erlaubten politischen Zugriffs auf die Bedingungen des Menschseins gewahrt wird. Geht er verloren, so wird der ethische Standpunkt am Boden des politischen Diskurses suspendiert und durch den politischen Standpunkt ersetzt, das heißt durch die nicht mehr weiter überprüfbaren Mechanismen der Selbsterhaltung politischer Akzeptanz- und Machtstrukturen. Die Frage, welches menschliche Leben beanspruchen dürfe, das Leben von Menschen zu sein, gewinnt nicht an Humanität, wenn ihre Beantwortung „demokratisiert“, das heißt Mehrheitsentscheidungen unterworfen wird. Sie gehört zu den Gefährdungen der Humanität, von deren Abwehr her sich vielmehr der demokratische Staat selbst noch legitimiert.