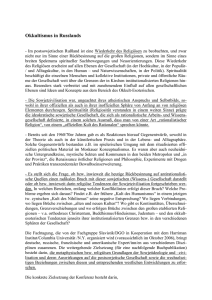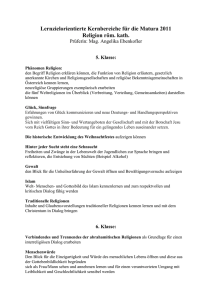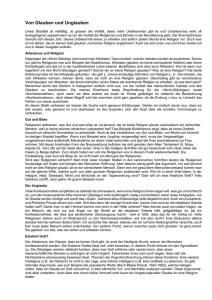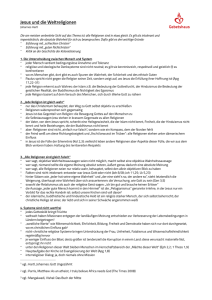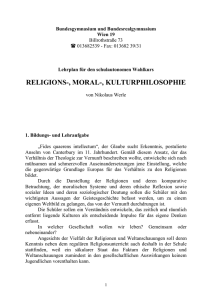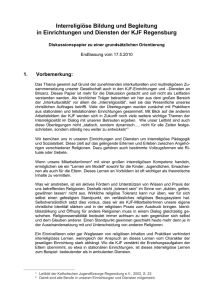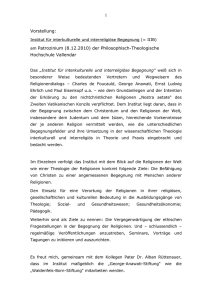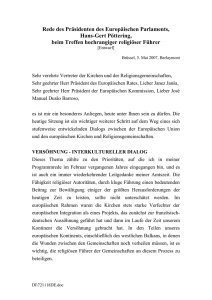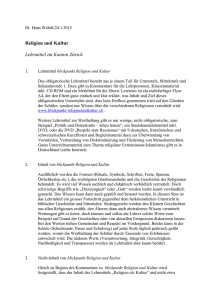Religion im Rahmen öffentlicher Bildung
Werbung
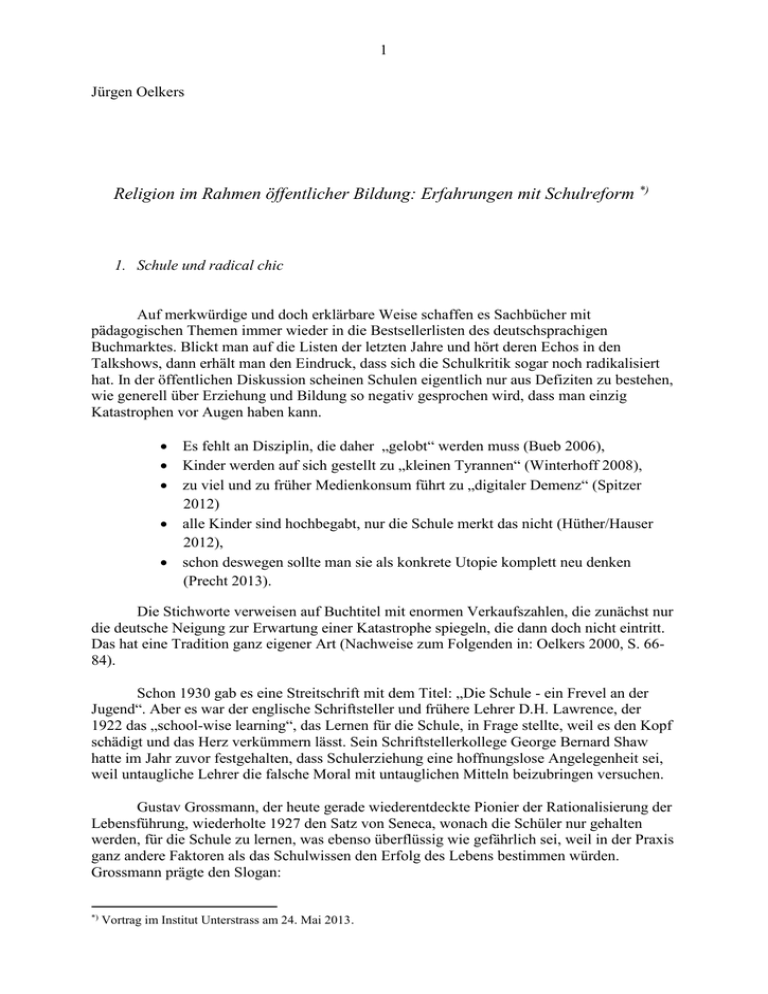
1 Jürgen Oelkers Religion im Rahmen öffentlicher Bildung: Erfahrungen mit Schulreform *) 1. Schule und radical chic Auf merkwürdige und doch erklärbare Weise schaffen es Sachbücher mit pädagogischen Themen immer wieder in die Bestsellerlisten des deutschsprachigen Buchmarktes. Blickt man auf die Listen der letzten Jahre und hört deren Echos in den Talkshows, dann erhält man den Eindruck, dass sich die Schulkritik sogar noch radikalisiert hat. In der öffentlichen Diskussion scheinen Schulen eigentlich nur aus Defiziten zu bestehen, wie generell über Erziehung und Bildung so negativ gesprochen wird, dass man einzig Katastrophen vor Augen haben kann. Es fehlt an Disziplin, die daher „gelobt“ werden muss (Bueb 2006), Kinder werden auf sich gestellt zu „kleinen Tyrannen“ (Winterhoff 2008), zu viel und zu früher Medienkonsum führt zu „digitaler Demenz“ (Spitzer 2012) alle Kinder sind hochbegabt, nur die Schule merkt das nicht (Hüther/Hauser 2012), schon deswegen sollte man sie als konkrete Utopie komplett neu denken (Precht 2013). Die Stichworte verweisen auf Buchtitel mit enormen Verkaufszahlen, die zunächst nur die deutsche Neigung zur Erwartung einer Katastrophe spiegeln, die dann doch nicht eintritt. Das hat eine Tradition ganz eigener Art (Nachweise zum Folgenden in: Oelkers 2000, S. 6684). Schon 1930 gab es eine Streitschrift mit dem Titel: „Die Schule - ein Frevel an der Jugend“. Aber es war der englische Schriftsteller und frühere Lehrer D.H. Lawrence, der 1922 das „school-wise learning“, das Lernen für die Schule, in Frage stellte, weil es den Kopf schädigt und das Herz verkümmern lässt. Sein Schriftstellerkollege George Bernard Shaw hatte im Jahr zuvor festgehalten, dass Schulerziehung eine hoffnungslose Angelegenheit sei, weil untaugliche Lehrer die falsche Moral mit untauglichen Mitteln beizubringen versuchen. Gustav Grossmann, der heute gerade wiederentdeckte Pionier der Rationalisierung der Lebensführung, wiederholte 1927 den Satz von Seneca, wonach die Schüler nur gehalten werden, für die Schule zu lernen, was ebenso überflüssig wie gefährlich sei, weil in der Praxis ganz andere Faktoren als das Schulwissen den Erfolg des Lebens bestimmen würden. Grossmann prägte den Slogan: *) Vortrag im Institut Unterstrass am 24. Mai 2013. 2 Ein klarer Kopf ist ein von unnötigem Wissensballast vollständig befreiter Kopf, der Schulbesuch sei daher nur eine hemmende Form von Aufbewahrung und am besten lernen ohnehin Autodidakten.1 Schulen verraten nur Kennzeichen stupider Lernarbeit Ungefähr dasselbe sagt der Philosoph Richard Precht rund 90 Jahre später. Die Bezüge der Kritik sind beliebig und das Ergebnis ist vorhersehbar, wie noch ein anderes Beispiel zeigt. Der amerikanische Journalist und Politikberater Lewis J. Perelman veröffentlichte 1992 eine Streitschrift, die den Titel trug School’s out: Hyperlearning, the New Technology, and the End of Education. Vor zwanzig Jahren erregte das Buch in den Vereinigten Staaten grosses Aufsehen, war ein Ereignis in den alten Medien und trug dem Verfasser eine Unmenge an Vorträgen ein. Die Nachfrage und das Interesse an das Ende der Bildung in ihrer gewohnten Form hielten etwa fünf Jahre an. Die amerikanische Schule gibt es immer noch. Das Grundargument bezog sich auf das Missverhältnis von Bildungsausgaben und den Leistungen von öffentlichen Schulen. Zu Beginn der neunziger Jahre betrugen die Gesamtkosten für das amerikanische Bildungssystem über 400 Billionen Dollar pro Jahr, während gleichzeitig die Drop-out-Quote ständig anstieg und die Schulleistungen zurückgingen. Wenigstens war das die öffentliche Wahrnehmung. Perelmans These ging von einer heruntergewirtschafteten Schule aus und formulierte eine radikale Alternative. Ausgangspunkt waren die neuen interaktiven Lernmedien, von denen angenommen wurde, dass sie innerhalb kürzester Zeit den Schulbesuch ersetzen würden. Man sollte aber deutlich trennen zwischen dem, was organisierte Bildung leistet und dem, was die Kritik der Intellektuellen fordert. Oft verwendet die Kritik Massstäbe, denen die Schule mit Sicherheit nicht folgt, und oft ist gerade die emphatische Kernidee der „Bildung“ an der Schule vorbei gedacht. Wenn Schüler von der Fron schulischen Lernens befreit werden sollen, dann immer in Namen einer besseren Idee der Bildung, die gleichsam hinter der Realität gesucht wird und dann aber daran nichts wirklich ändern kann. Schulen sind Grosssysteme, die aus eigenen Prämissen heraus lernen und keineswegs auf den Anstoss der Kritik warten und dies umso weniger, wenn die Kritik zu konkreten Problemen gar nichts zu sagen hat. Sie ist nur radikal, und das ist im Blick auf träge Systeme wie das der Schule zu wenig. Anderseits ist hat diese Kritik wiederum ihre Geschichte. Die Bildungsromane der deutschen Klassik nutzten diese Chance ebenso wie die literarische Schulkritik des 20. Jahrhunderts, die zwischen Upton Sinclair, Thomas Mann und George Bernard Shaw illustre Namen zu verzeichnen hat. Auf der Linie dieser Kritik sind „Individualität“ und „Bildung“ kaum noch zu unterscheiden; was der Mensch von der Welt sich aneignet, ich zitiere den jungen Humboldt,2 ist dann seine Bildung, ohne damit 1 So auch in bildungshistorischer Sicht: Bosse (2012). Bruchstück Theorie der Bildung des Menschen (Humboldt 1980, S. 234-240). Der Text stammt vermutlich aus dem Jahre 1793, den Titel hat der Herausgeber Albert Leitzmann besorgt. Was „Theorie der Bildung“ bei Humboldt heissen soll oder nur heissen kann, ist umstritten. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Zürcher Lizentiatarbeit von Werner Hürlimann (2003). 2 3 didaktische Formate oder Standards des Lernens zu verbinden. Diese Art Bildung ist frei, sie geschieht spontan und ihr Anlass ist nichts weniger als die ganze Welt, die nicht schulisch sortiert sein muss, um sich in ihr und mit ihr bilden zu können. Die Bildung ist sozusagen der Roman des Lebens, der sich wohl aufschreiben, aber nicht institutionalisieren lässt. In diesem Sinne ist Bildung Selbstformung, nicht Schulabschluss. Das Ende der Schule ist schon mehrfach in der Geschichte des Bildungsdiskurses proklamiert worden, zumeist unterstützt mit dem Argument, dass Aufwand und Ertrag in einem Missverhältnis stünden. Bekannt ist etwa das Programm des österreichischen Sozialrevolutionärs Ivan Illich, der 1971 den Slogan Deschooling Society prägte, seinerzeit noch Lichtjahre entfernt von der Internetrevolution. Die Idee, dass die Schule nichts sei als „ein Frevel an der Jugend“ stammte von dem Anarchisten und Wirtschaftsfunktionär Walther Borgius. Und schon der Philosoph und Gymnasiallehrer Max Stirner hielt 1842 jede Form von Verschulung für einen durch nichts zu begründenden Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Zeitgleich opponierte aus gegenteiligen Gründen die katholische Kirche gegen die staatliche Schulpflicht. Heute kommen erneut Stimmen auf, die das Ende der gesellschaftlichen Institution Schule vorhersagen und Ideen vertreten, wie sie Reformation diskutiert wurden, nämlich dass mit Hilfe des Internet jeder jeden unterrichten könne und somit ein professioneller Stand von Pädagogen überflüssig sei, so der amerikanische Informatiker und Kulturkritiker David Gelernter am 8. Februar 2012 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das hören staatlich angestellte Lehrkräfte natürlich nicht gerne wie auch schon die Reaktion auf die Thesen von Ivan Illich blankes Entsetzen war. Die Lehrerschaft reagiert auf Kritik leicht mit dem, was der Wiener Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld das „beleidigte Pädagogengemüt“ nannte. Man gibt sein Bestes, aber niemand will es. Ist das nur übertrieben oder Teil von Profilierungssucht? In demoskopischen Umfragen teilen viele Eltern die Schlagworte der Kritik, also beklagen die blosse Schulförmigkeit des Lernens und wünschen sich für ihre Kinder mehr praktische oder musische Tätigkeiten, sie kritisieren auch die Lebensferne des Unterrichts und besonders intensiv jenen Leerlauf des Tages, der „Stundenausfall“ genannt wird. Das erklärt, warum die Bücher gekauft werden und wieso auch ganz radikale oder ziemlich aussichtlose Themen Anklang finden. Fragt man die gleichen Eltern nach den konkreten Erfahrungen mit der Schule ihrer Kinder, dann entsteht ein ganz anderes Bild: Den Lehrkräften wird hohe Professionalität bescheinigt, im Unterricht werden sichtbare Fortschritte erzielt, die Entscheidungen bei den Übergängen gelten überwiegend als fair und transparent, Konflikte finden Bearbeitung und Anliegen der Eltern werden beachtet. Nicht zufällig dominieren in der kantonalen Rekursstatistik die Klagen über die gefährlichen oder zu weiten Schulwege. Die Volksschule in der Schweiz gilt als bewährt und verlässlich, sie kann sich weiterentwickeln und niemand will sie ernsthaft abschaffen. Das unterscheidet Eltern von Schulkritikern. 4 Der Grund für die hohe Akzeptanz ist evident: Ohne öffentliches, staatlich finanziertes Schulwesen hätte die heutige Bildungsqualität nicht aufgebaut werden können, wäre es unmöglich, Basisfertigkeiten über Generationen konstant zu halten und könnte keine ungefähre Gleichverteilung des Angebots erreicht werden. Das setzte und setzt ein Kalkül des Nutzens voraus, keine Gesellschaft könnte sich auf Bildung einlassen, wenn sie nichts davon hätte. 2. Schulentwicklung und Qualitätssicherung Bildung wurde im 19. Jahrhundert gleichermassen verstaatlicht und verschult. Der Staat übernahm mit den Kosten auch die curriculare Steuerung, einschliesslich der Normierung der didaktischen Formate und der zur Verfügung gestellten Zeit. Der Unterricht wurde auf ein einheitliches Zeitmass eingestellt und mit Effektivitätsanforderungen konfrontiert, die umso mehr Organisation erforderten, je engmaschiger sie verstanden wurden. Notwendig für den Aufbau der Organisation waren die Professionalisierung der Lehrerschaft, die Standardisierung der Lehrmittel, die Normierung der Überzeugungen und vieles mehr. Die Ausbreitung der Bildung geschah flächendeckend und unter der Voraussetzung eines bestimmten institutionellen Arrangements, das bis heute massgebend ist. Die Schulen, könnte ich auch sagen, werden in ihrer Grundform nicht ein zweites Mal erfunden, und wir müssen mit ihnen leben. Zu Schulen gehören Standards und das ist offenbar nicht einfach eine Last. Die Entwicklung des modernen Schulsystems war in vielen Hinsichten eine Erfolgsgeschichte und eine Fortschrittserfahrung. Das gilt materiell wie symbolisch: Die Investitionen stiegen im historischen Längsschnitt rapide an, die staatlichen Haushalte waren von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr umkehrbar, die Bildungsversorgung wurde zu einer festen gesellschaftlichen Erwartung und im Gegenzug stiegen die Leistungserwartungen und gewann die Schule öffentliches Ansehen. Alle Bildungssysteme sind selektiv, anders könnte das Grundprinzip der Beurteilung nach Leistung nicht durchgehalten werden. Leistungen sind unterschiedlich, also können damit nicht gleiche Berechtigungen verbunden sein. Aber genau diese Ungleichheit erscheint oft als anstössig, was umso mehr gilt, wenn der Verdacht aufkommt, persönlich lohne sich das Ganze nicht, weil die Schulerfahrung eine künstliche ist, die nichts wirklich mit dem Leben zu tun hat. Auch dieser Verdacht hat seine Geschichte. Wenn es auf dem umkämpften Markt der originellsten Schulkritik schon vor zehn Jahren hiess, die Schule sei eine einzige „Bildungslüge“ (Fuld 2004), weil sie überflüssiges Wissen vermittle, das nicht zu dem führe, was in den Zielen der Bildung behauptet wird, so ist das seit der Antike geläufig. Geändert hat diese Kritik nichts, sie rechnet nicht mit den institutionellen Bedingungen der Schule und verfügt nicht über wirkliche Daten, die den zunehmenden Verfall der Bildung erhärten könnten. Letztlich läuft das Argument der „Bildungslüge“ darauf hinaus, sich entweder einen Zustand ohne Schule vorzustellen 5 oder aber anzunehmen, früher sei alles besser gewesen, wofür im Falle der Entwicklung gesellschaftlicher Bildung nichts spricht. Auffällig ist demgegenüber, dass immer Gebildete Kritiker der Bildung sind, für die es leicht ist, das eigene Privileg in Frage zu stellen, weil sie selbst es nicht mehr verlieren können. Umso wichtiger ist dann aber die Frage, was die Qualität der Schule ausmacht und wie sie verbessert werden kann. Die Schule als gesellschaftliche Institution wird nicht ein zweites Mal komplett neu erfunden, sie kann daher nur weiterentwickelt werden. Aber wie entwickeln sich Schulen zum Besseren? Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten: Schulen brauchen gute und praktikable Ideen, die sich in erreichbare Ziele umsetzen lassen, sie benötigen ausreichend Zeit und Rückhalt, sie müssen sich vernetzen und den eigenen Prozess beobachten, sie können auf ihrem Weg auch Rückschläge verarbeiten und sie erhalten Gelegenheit, von den Besten im Feld zu lernen. Die öffentliche Schule erfüllt viele der an sie gerichteten Erwartungen nicht, weil sie ihre institutionelle Form oder, wie manche Bildungshistoriker sagen, ihre „Grammatik“, nicht beliebig verändern kann. Für viele Ansprüche, also, ist die Schule schlicht der falsche Adressat: Sie kann nicht zugleich die Persönlichkeit bilden, den Lehrplan erfüllen, auf den Kanon der Literatur zurück kommen, das naturwissenschaftliche Weltbild befestigen, die Erziehungsausfälle der Gesellschaft beseitigen und für die fortlaufende Motivation von Schülern sorgen, deren grundlegende Freizeiterfahrungen schulferne und gelegentlich auch schulzynische Kinder- und Jugendkulturen sind. Hier müssen klare Grenzen definiert werden, die deutlich machen, was Schulen leisten und vor allem, was sie nicht leisten. Das hiesse auch, „Schulbildung“ oder die Qualifizierungsleistungen der staatlichen Institution Schule von allen unpassenden Ansprüchen der Bildungstheorie zu entlasten. Bildung im Sinne des Prinzips der Selbstformung ist immer mehr, als in der Schule erfahren wird und auch nur erfahren werden kann. Die Schulerfahrung ist nicht freiwillig, sie hat ein Obligatorium zur Voraussetzung und kann nur begrenzt Zumutungen vermeiden. Die Schule muss auch Lernleistungen abverlangen können, für die im Augenblick des Unterrichts keine Motivation besteht und deren Sinn erst im Nachhinein verständlich wird. Letztlich ist das Ergebnis wichtiger als die Motivation, so anstössig das pädagogisch auch klingen mag. Daher wird nicht zufällig der Erfolg der Schule mit den Abschlüssen verbunden, die das Bildungssystem verteilt, was nicht nur Folgen hat für die gesellschaftliche Selektion, sondern zugleich eine innere Dynamik auslöst, die Qualität zusehends an Beschleunigung bindet und dabei die Verschulung ausdehnt. Die Schule als Institution bietet neben dem Unterricht, feste Zeiten für Anfang und Ende, einen strukturierten Lerntag, spezialisiertes Personal, verantwortliche Aufsicht und 6 nicht zuletzt die Abwechslung vom Konsumalltag. Sehr wahrscheinlich ist das Verschwinden der Schule also nicht. Etwas anderes ist dagegen unübersehbar, nämlich, dass sich Schule anpasst und den Gewinn für sich auslotet, so wie sie das bisher noch mit jeder Medienrevolution getan hat. Konkret: Die Lernformen und Aufgabenstellungen in der Schule werden sich die Internetrevolution nutzbar machen, ohne dass sie staatliche Schulpflicht verschwindet oder jeder mit eigenen Links lernen kann. Facebook ersetzt die öffentliche Schule nicht, aber beeinflusst die Lernerwartungen und so das Verhalten. Die Standardsituation des Unterrichtens wird sich verändern. Die Stichworte dafür lauten „selbstorganisiertes Lernen“, „Lernen nach eigenem Tempo“ und „Steuerung durch Systeme der Rückmeldung“. Das traditionelle Lehrbuch wird seinen Stellenwert verlieren, die Lehrpersonen werden nicht mehr einfach „ihre“ Klasse unterrichten, sie werden keine vorbereiteten Lektionen mehr geben, sondern häufiger mit elektronischen Lernplattformen arbeiten, die in der Technologie bereits weit fortgeschritten sind. Der Wandel ist in heutigen Schulen bereits deutlich sichtbar und wird sich in den nächsten Jahren massiv beschleunigen. Die Standardsituation des Unterrichts stammt aus dem 19. Jahrhundert und setzt die Lehrbuchgesellschaft voraus. Lehrbücher sind träge Medien, die sich nur langsam verändern können, weil sie viele Auflagen erleben müssen, um rentabel zu sein. Lernmedien dieser Art können mit der Entwicklung der Wissensgesellschaft sicher nicht Schritt halten. Zudem schränken sie die Lernmöglichkeiten ein und basieren auf der Vermittlung des Durchschnitts. Die Schulen der Zukunft dagegen müssen die Zugänge zum Lernen öffnen, den Habitus des selbstorganisierten Lernens ausprägen und die Schülerinnen und Schüler davor bewahren, von Lernleistungen auszugehen, die irgendwann einmal abgeschlossen sind. Das hat etwa Konsequenzen für die Leistungsbeurteilung, das Prüfungswesen und das abschliessende Zertifikat eines Schulbesuchs. Alles das wird sich fundamental ändern müssen, wenn die Schule nicht tatsächlich riskieren will, zwischen Laptop-Lernumgebungen ihre gewohnte Form zu verlieren und ihre Vorteile nicht länger zur Geltung bringen zu können. Die Schulen machen sich aber nur dann auf den Weg, wenn sie nicht allein sind und sich auf Trends beziehen können. Das erklärt, warum sich bestimmte Reformideen im Schulfeld schnell durchsetzen können, ohne dass eine Gewähr bestehen würde, mehr als eine Mode vor sich zu haben. Ich werde jetzt nicht über „altersdurchmischtes“ oder „selbstorganisiertes“ Lernen sprechen, ein Blick in die Geschichte genügt, um vorsichtig zu sein. Sprachlabore wurden in den sechziger Jahren als Durchbruch für den Unterricht propagiert, auch deswegen, weil sie teuer waren; heute gelten sie als eine der durchaus nicht wenigen Fehlinvestitionen in der Schulgeschichte (Bosche/Geiss 2011). Die Frage, die mein Vortrag diskutieren soll, bezieht sich auf die Stellung der Religion in der öffentlichen Bildung. Ich beschränke diese Frage auf die obligatorische Schule und den staatlichen Lehrplan. Das Thema Religion und öffentliche Bildung wird in keiner der radikalen Schulkritiken angesprochen, es gehört weder zur konkreten Utopie der neu gedachten Schule oder zur Prävention gegen digitale Demenz. Warum stellt es dann aber? Und warum steht es nicht auf der Agenda der Schulreform? Man könnte vermuten, dass Religion gar nicht mehr Teil der öffentlichen Bildung ist, weil der Glaube heute als Privatsache angesehen wird. Damit werde ich beginnen: Warum ist Religion Teil der öffentlichen Bildung, wenn jeder selbst entscheiden kann, was er glaubt oder nicht glaubt? 7 3. Religion und öffentliche Bildung Vor 150 Jahren wäre die Beantwortung dieser Frage leicht gewesen, genauer: die Frage hätte sich gar nicht gestellt, weil sie Distanz voraussetzt, die gar nicht gegeben war. Das Verhältnis von Bildung, Religion und Kultur war weder strittig noch konfrontiert mit Alternativen. Die Religion war Teil der lokalen Öffentlichkeit und niemand wäre auf den Gedanken gekommen, ein Volksschulfach „Religion und Kultur“ einzurichten, weil für die Schülerinnen und Schüler neben der religiösen Kultur, der sie angehörten, andere gar nicht zugänglich waren und die Schulen sich auf die bestehenden religiösen Umwelten einstellen mussten. Kultur war oft einfach gelebte Religion, oft ohne die Möglichkeit einer inneren wie äusseren Distanzierung. Mitte des 19. Jahrhunderts war auch in der Pädagogik die grosse Zeit des Historismus, Geschichte diente der Rechtfertigung der Gegenwart und die Lehrwerke bemühten sich daher um einen möglichst geschlossenen Sinnzusammenhang. Eines dieser Werke erschien zwischen 1860 und 1862 in vier grossen Bänden und hiess Die Geschichte der Pädagogik in weltgeschichtlicher Entwicklung und im organischen Zusammenhangen mit dem Culturleben der Völker dargestellt Der Titel war irreführend. Lesen konnte man die „weltgeschichtliche Entwicklung“ allein des Christentums, und das „Culturleben der Völker“ kam unabhängig gar nicht vor. Die christliche Religion war die Kultur, ohne dass dem Verfasser3 in den Sinn gekommen wäre, die Prämisse seines Werkes irgendwie zu bezweifeln. Er hätte sich auch nicht vorstellen können, wie problematisch die Entwicklung der Weltgeschichte aus dem Christentum heute gesehen werden würde. Die Geschichte der Pädagogik war die von Christus bis zur Reformation und von Luther über Rousseau und Pestalozzi bis zur Gegenwart. Alle anderen Weltgeschichten der Erziehung, die chinesische, die persische oder die byzantinische, kamen entweder nicht vor oder wurden als „ vorchristlich“ bezeichnet und so dann auch dargestellt. Sie wurden nicht bewusst ausgeschlossen, sondern der christlichen Sichtweise dienstbar gemacht. Aber schon die war eingeschränkt, es war ein protestantischer und nochmals enger: ein lutherischer Blick auf die Geschichte, der als solcher nicht kenntlich gemacht wurde, sondern so tat, als sei er der wahre und einzig mögliche. Mit Christus, hiess es, tritt die Menschheit in ihr Mannesalter ein, die Antike war also höchstens die Kindheit, die mit dem christlichen „Evangelium der Humanität“ überwunden wird (Schmidt 1861, S. 3). Die „Fundamentalwahrheiten“ des Christentums begründen die „wesentliche Gleichheit und Ebenbürtigkeit aller Menschen“, aber nur dann, wenn sie sich als „Kinder“ des christlichen Gottes bekennen (ebd., S. 4). Das „Evangelium der Humanität“ setzt voraus, das es einen einzigen „Lehrer und Erzieher der Menschheit“ gibt, nämlich Jesus Christus (ebd., S. 9). Alle anderen Lehren sind falsche Bekenntnisse und gehören letztlich bekämpft. Das 19. Jahrhundert war bekanntlich auch das Jahrhundert der christlichen Mission. 3 Verfasser war der Theologe und Gymnasiallehrer Karl Schmidt (1819-1864). Schmidt war von 1850 an Lehrer am Gymnasium von Köthen und wurde 1863 als Seminardirektor und Schulrat für das Volksschulwesen nach Gotha berufen. 8 1860 liess sich zwischen Theologie und Pädagogik noch kaum unterscheiden, die Kinder besuchten streng getrennte Konfessionsschulen, die „Fundamentalwahrheiten“ des Christentums waren in der konfessionellen Hermeneutik bis in das Detail hinein umstritten und kein Kind konnte sich die Erziehung zum Glauben aussuchen. Ich bin protestantisch aufgewachsen und kann mich gut daran erinnern, dass wir gelernt haben, unsere wenigen katholischen Mitschüler zu bedauern, während wir sie heimlich beneideten, weil sie mehr Feiertage hatten als wir. Die Erziehungssphären selbst waren streng getrennt, ich habe als Kind keine katholische Kirche von innen gesehen und eine Moschee habe ich mir erst gar nicht vorstellen können. Heute wachsen Kinder in einer pluralen Welt auf, oft ohne religiösen Glauben und jedenfalls ohne die Dominanz des einen „richtigen“ Glaubens, der sich gegenüber allen anderen Glaubensrichtungen abweisend bis feindlich verhält. Wer heute „Fundamentalwahrheiten“ als gegeben hinstellt, ist schnell Fundamentalist, weil kein heiliger Text deutungsfrei zugänglich ist und jeder Versuch in der Wortgläubigkeit endet. Mit ihr entstehen Sekten, die sich vor der pluralen Erfahrungswirklichkeit abschotten müssen, wenn sie den Anspruch aufrecht erhalten wollen, dass ihre Wahrheiten die fundamentalen sind und keine Hermeneutik verlangen. Noch etwas unterscheidet uns vom 19. Jahrhundert, als die Glaubensgegensätze innerhalb des Christentums ausgetragen wurden und so konfessioneller Natur waren. Heute sind die Gegensätze kaum noch spürbar, die christliche Ökumene hat sich jedenfalls in der Schweiz weitgehend durchgesetzt und es hat sich auch so etwas wie ein interessierter Blick für andere als christliche Religionsgemeinschaften geöffnet. Ich könnte auch sagen, die theologische Intoleranz ist verschwunden, die nicht zuletzt durch die Kirchenzucht in der Erziehung geprägt wurde. Gegen diesen Befund sprechen natürlich Ressentiments, die durchaus auftreten können und gelegentlich auch die Schlagzeilen unserer Medien erreichen. Aber von einem Kulturkampf wie am Ende des 19. Jahrhunderts kann keine Rede sein und der Grund ist einfach, die Trennung zwischen Staat und Kirche ist vollzogen, wie im Zivilleben, so auch in der Erziehung. Niemand wird mehr exkommuniziert, der sich zivilrechtlichen trauen lässt und jeder kann sich die Religion aussuchen, an die er glauben will. Und wer keine Transzendenz braucht und ohne irgendeinen Gott leben will, kann das ungestraft tun. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnte ein „gottloser Mann“ in Zürich in den Turm geworfen werden (Denkwürdigkeiten 1841, S. 10). Heute wächst in der Schweizerischen Bevölkerung eine Gruppe sehr stark, die sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlt4 oder darüber keine Angaben macht. Daraus zu schliessen, dass sie „gottlos“ sind, würde die Perspektive der Glaubensgemeinschaften voraussetzen, doch wer keiner dieser Glaubensgemeinschaften angehört, muss weder Atheist noch Nihilist sein, was immer darunter verstanden werden mag. Und man kann auch nicht einfach auf religiöses Desinteresse schliessen, weil sich Formen des Glaubens auch ohne Kirchen oder Religionsgemeinschaften äussern können. 4 Die Zahl vervierfachte sich in zwanzig Jahren und lag im Zensus des Jahres 2000 bei rund 800.000 Personen. (Angabe gemäss Bundesamt für Statistik) 9 Auf der anderen Seite hat die anhaltende Migration Folgen für die Verbreiterung der Religionsgemeinschaften gesorgt. Wer ins Land kommt und hier bleibt, bringt seine oder ihre Religion mit. Daher wächst in der Schweiz nicht nur die Zahl derer, die islamischen Gemeinschaften angehören,5 sondern etwa auch derer, die sich zum christlich-orthodoxen Glauben bekennen.6 Die Frage von Religion und Kultur ist also nicht mit Hinweis auf die Häufung von Kirchenaustritten zu beantworten, sondern muss auch von der Zuwanderung her verstanden werden. Die Frage erledigt sich auch nicht durch den Verdacht, dass alle monotheistischen Religionen absolute Ansprüche vertreten, also mit Notwendigkeit Mission betreiben müssen und daher leicht militant werden können. Es gibt religiös motivierte Militanz, aber die Religionsgemeinschaften sagen sich davon aus eigenem Interesse los, denn sie werden nur dann mit anderen Gemeinschaften friedlich zusammenleben können, wenn sie ihren Glauben nicht gewaltsam ausbreiten, und genau das ist seit Jahrzehnten in der Zivilgesellschaft der Schweiz zu beobachten. „Toleranz“ war das grosse Stichwort der Aufklärung, und wer sich auf sie beruft, setzt meistens voraus, dass mit „Aufklärung“ letztlich die Überwindung und Auflösung des Glaubens gemeint war. Aber John Locke, Deist und Begründer des englischen Empirismus, verwies 1689 in seinem Letter Concerning Toleration darauf, dass Toleranz nicht für Atheisten gelten könne. Wer Gott leugnet, und sei es auch nur in Gedanken, löst „alles“ auf (A Letter 1689, S. 48). Nun, was immer das „alles“ sein mag, das Sein, die Welt oder das Universum, es ist auch ohne Gott stabil und fällt nicht auseinander, nur weil es Atheisten gibt, deren Zahl im Jahrhundert der Aufklärung noch sehr begrenzt war. Gemäss dem Eurobarometer von 2005 sind 9% der der Schweizerinnen und Schweizer mehr oder weniger klar bekennende Atheisten. In der gleichen Umfrage geben nur 4% der Befragten an, niemals über Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken, 50% tun das oft und 35% manchmal. 52% aller in Europa Befragten gaben an, dass sie an die Existenz eines Gottes glauben, in der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren waren 44%, wobei niemand sagen kann, wie sie zu dieser Annahme gekommen sind und was im Blick auf Wissen und Reflexivität bedeutet (Special Eurobarometer 225, S. 7-10). Was immer diese Zahlen bedeuten, ob die Zahl der Atheisten steigt oder nicht, ist schwer zu ermitteln, sicher ist, dass die beiden christlichen Konfessionen Mitglieder verlieren, ohne dass dadurch im gleichen Masse das Interesse an Religionen abnimmt. Global gesehen wachsen mit der Bevölkerungsentwicklung auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften, wenngleich unterschiedlich. Die christlichen Kirchen wachsen in absoluten Zahlen, aber verlieren in den Prozentanteilen. Über das Wachstum der Glaubensgemeinschaften, besonders der islamischen, ist viel spekuliert worden, meistens negativ, etwa im Blick auf den angeblich unvermeidlichen Clash of Civilizations, fest steht, dass die Weltreligionen nach der naturwissenschaftlichen Widerlegung ihrer Dogmen nicht verschwunden sind und auch in Zukunft das kulturelle Leben beeinflussen werden. 5 Die Zahl betrug 1980 56.600 Personen und stieg bis 2000 an auf 310.800. (Angabe gemäss Bundesamt für Statistik) 6 Die Zahl betrug 1980 37.200 Personen und stieg bis 2000 an auf 131.900. (Angabe gemäss Bundesamt für Statistik) 10 Wer das von der Aufklärung erwartet hat, sieht sich enttäuscht, ohne auf der anderen Seite überall „unaufgeklärte“ oder gar unaufklärbare Verhältnisse sehen zu können. Zum einen war die historische Aufklärung nur ihren radikalen Zuspitzungen wirklich atheistisch und zum anderen liegen Glaubensfragen offenbar tiefer als ihre Widerlegungen. Und der Glaube hat sich mit der Aufklärung auch erneuern können, nicht überall gleich, doch sichtbar, und in jedem Falle sind religiöse Erfahrungen, in welcher Hinsicht auch immer, Teil der Kultur und so auch Teil der Bildungsgeschichte. 4. Religion und Kultur Von dem Volksschulfach „Religion und Kultur“ kann in dieser Hinsicht gesprochen werden. Es ist ein Bildungsfach in einem zunächst ganz elementaren Sinne. In der Schule lernt man, was man woanders nicht lernen kann. „Religion und Kultur“ ist kein konfessioneller Unterricht, man lernt nicht, dass und wie man einen bestimmten Glauben annehmen soll, sondern lernt verschiedene Religionen kennen, ohne damit eine bestimmte Glaubensaufforderung und so eine Wahl zu verbinden. In der Schule lernt man auch Geschichte, Literatur oder Geographie ohne persönlichen Glauben, nur dass im Fach „Religion und Kultur“ der religiöse Glauben zum Thema wird. Wissen und Kompetenzen über Religionen gehören zum Weltverstehen. Je weniger man die symbolischen Zusammenhänge einer Religionsgemeinschaft kennt, ihre Rhythmen, Rituale und Lebensformen, desto geringer ist das Interesse und desto weniger kann man mit Konflikten umgehen. Toleranz ist nicht einfach ein Problem der gegenseitigen Duldung, sondern setzt Kenntnis und Verstehen voraus. Wer über einen Roman urteilen will, muss ihn gelesen und wer ein mathematisches Problem lösen will, muss es verstanden haben. Warum sollte das in der Schule mit Religionen anders sein? Die American Academy of Religion hat vor einigen Jahren Guidelines for Teaching About Religion in öffentlichen Schulen publiziert, die in etwa dem nahe kommen, was im Kanton Zürich unter dem Unterricht im Fach „Religion und Kultur“ verstanden wird. Die Leitlinien beginnen mit einer Beschreibung der „religiösen Illiteralität“, also dem, was der Unterricht beseitigen soll. Illiterat oder unwissend in religiösen Fragen ist, wer über kein ausreichendes Verständnis verfügt in: „The basic tenets of the world’s religious traditions and other religious expressions not categorized by tradition; the diversity of expressions and beliefs within traditions and representations; and the profound role that religion plays in human social, cultural, and political life, historically and today” (Guidelines 2010, S. 4). Es geht - wie in Zürich - um Weltreligionen und andere religiöse Ausdrucksweisen, wobei zu ergänzen ist, dass auch Atheismus eine Weltsicht ist. Die Leitlinien der American Academy of Religions beziehen sich auf die Vielfalt und Diversität des Glaubens und sie gehen davon aus, dass Religionen auch in Zukunft eine profunde Rolle im öffentlichen Leben spielen werden. Sie haben alle eine Stimme, aber gibt nicht mehr die Stimme, die es in den Vereinigten Staaten ohnehin nie gab. 11 Hinter den Leitlinien stehen Studien zur wachsenden religiösen Illiteralität bei amerikanischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Moore 2007). Wer Atheist ist, braucht die Kenntnis der Religion, der er oder sie ablehnt; wer einfach nichts weiss, kann sich mangels Bildung nicht entscheiden, in keiner Richtung. Wohl aber sind mit Nichtwissen oft Vorurteile und Intoleranz verbunden, die nur mit verbindlicher schulischer Bildung zu bekämpfen sind. Religion ist so wie Mathematik oder die Naturwissenschaften ein kognitives Bildungsgut, das an eine öffentliche Schule gehört, wenngleich nicht als Glaubensfach (Greenawalt 2007). Hier herrscht unter Experten weitgehend Konsens, und auch das amerikanische Beispiel zeigt, dass in Zürich keine Anomalie in die Welt gesetzt wurde. Wer Ausgleich unter den Religionsgemeinschaften befördern will, muss Kenntnis und Wissen befördern, es also nicht bei abstrakten Toleranzappellen bewenden lassen. Eben dazu braucht man ein Volksschulfach. Auf einer vergleichbaren Linie bestimmt die American Academy of Religion, welche Anforderungen sich mit religiöser Literalität verbinden, also welches Wissen und welches Können aufgebaut werden müssen, damit die Ignoranz überwunden werden kann. Grundsätzlich heisst es: Eine religiös gebildete Person verfügt über a basic understanding of the history, central texts (where applicable), beliefs, practices and contemporary manifestations of several of the world’s religious traditions and religious expressions as they arose out of and continue to shape and be shaped by particular social, historical and cultural contexts; and the ability to discern and explore the religious dimensions of political, social and cultural expressions across time and place” (Guidelines 2010, S. 4). Was daraus für den Lehrplan folgt und wie sich im Blick darauf Lehrmittel entwickeln lassen, war ein zentrales Problem bei der Entwicklung des Faches. Dazu werde ich abschliessend etwas sagen. Begründet wird ein solcher Unterricht über Religionen mit drei Prämissen, die sich auch auf die Schweiz übertragen lassen. Erstens: Die religiöse Illiteralität verbreitet sich, wenn nichts geschieht. Zweitens: Sie hat gefährliche Folgen im Blick auf Vorurteile und Feindseligkeit. Und drittens: Ein konfessionsneutraler Unterricht über Religionen auf allen Schulstufen, kann dazu beitragen, Nichtwissen und Ignoranz zu verringern (ebd., S. 5/6). Für diesen Zweck muss unterschieden werden zwischen einer religiösen Erziehung, die in eine bestimmte Glaubensgemeinschaft hineinführt und so andere ausschliesst, auf der einen und einem Unterricht über Religionen auf der anderen Seite. Dieser Unterricht dient keinem Glauben, er ist inklusiv und lässt Vergleiche zu. Er führt die Lernenden in das grosse Spektrum religiöser Ausdrucksformen ein, die in und zwischen den Glaubenstraditionen bestehen. Das Ziel ist die Erweiterung des Verstehens religiöser Vielfalt und der besonderen Rolle, die Religionen im politischen, ökonomischen und politischen Leben spielen und immer gespielt haben (ebd., S. 4). Die Ziel sind die eine Seite, die Erfahrungen mit dem Aufbau 12 eines konkreten Schulfaches die andere. Weil ich den Prozess miterlebt und mitgestaltet habe, erlaube ich mir das zu am Ende meines Vortrages noch einige Anmerkungen. mioch 5. Erfahrungen mit dem Fach Die Einführung neuer Fächer in öffentlichen Schulen, die nicht einfach auf Zusammenlegungen basieren, ist eine seltene Erfahrung. Der Bildungsrat des Kantons Zürich beschloss am 15. August 2000, also vor fast dreizehn Jahren, ein Modell für ein neues Schulfach in die Vernehmlassung zu geben. Dieses neue Fach hiess „Religion und Kultur“ und sollte das bestehende, nicht obligatorische Volksschulfach „Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht“ („Kokoro“), das auf der Sekundarstufe I angeboten wurde, ablösen. Die Ergebnisse der Vernehmlassung lagen ein Jahr später vor und waren grossmehrheitlich positiv. Das neue Fach sollte „Kenntnis über alle grossen Weltreligionen“ vermitteln (Auszug 2004, S. 4) und als ein konfessionsneutraler Unterricht über Religionen konzipiert werden. Die Grundzüge dieses Faches wurden im Verlaufe eines mehrmonatigen Prozesses von einer Expertengruppe erarbeitet, die aus Vertretern von sechs grossen Religionsgemeinschaften, darunter auch die beiden christlichen, zusammengesetzt war. Die Religionsgemeinschaften waren frei, die Mitglieder selbst zu bestimmen. Am Ende des Prozesses stand ein Papier mit den „Essentials“, die aus Sicht der Religionsgemeinschaften die Grundlagen des Lehrplans darstellen. Diese „Essentials“ wurden 2004 vom Bildungsrat verabschiedet. Parallel dazu kam ein politischer Prozess in Gang, der zu einer Volksinitiative führte, die den Erhalt des christlichen Religionsunterrichts auf der Primarstufe forderte. Dieser Unterricht war aufgrund von Sparmassnahmen fraglich geworden. Der Zürcher Regierungsrat schlug als Kompromiss vor, das neue Sekundarschulfach „Religion und Kultur“ auf die Primarschule hin auszuweiten und ihm einen christlichen Schwerpunkt zu geben, ohne jedoch Glaubensunterricht zu erteilen. Abgelöst wurde damit das bisherige Freifach „Biblische Geschichte“. Für den Glaubensunterricht sollten fortan die Religionsgemeinschaften selbst und mit eigenen Mitteln zuständig sein. Im März 2007 wurde das neue und nunmehr obligatorische Volksschulfach „Religion und Kultur“ vom Zürcher Kantonsrat einstimmig verabschiedet. In diesem Fach wird über alle neun Jahrgangsstufen der Zürcher Volksschule hinweg ein nicht mehr auf Konfession und Glauben bezogener Unterricht erteilt. Religion wird als Bildungsgut verstanden und ist Teil der schulischen Allgemeinbildung. Das neue Fach ist auf verschiedenen Konferenzen öffentlich vorgestellt worden und ist abgesehen von einer bestimmten Oppositionsgruppe unbestritten. Die Einführungskosten lagen projektiert bei 5 Millionen Schweizer Franken.7 Seit dem Beschluss des Kantonsrates lief die Implementation, also die eigentliche Reformarbeit. In diesem Falle war unter „Implementation“ zu verstehen die zeitlich gestufte Einführung des Faches in den Zürcher Gemeinden, die Umstellung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, die Entwicklung von facheigenen Lehrmitteln 7 NZZ Online vom 4. September 2008. 13 und die gezielte Weiterbildung der bisherigen Lehrkräfte. Eine spezielle Pädagogik war dabei ebenso wenig erforderlich wie Rückgriffe auf radikale Schulkritik. Sie hätten bei der Bewältigung der unvermeidlichen Schwierigkeiten auch kaum weitergeholfen. Es ging einfach um ein neues Fach, das mit der Schulstruktur kompatibel sein musste und doch Innovation bewirken sollte. Die Schwierigkeiten seien klar benannt. Im Blick auf die Ausbildung der angehenden Lehrkräfte musste ein neuer Lehrgang konzipiert werden. Als Dozenten standen zunächst nur christlich geschulte Fachdidaktiker zur Verfügung, die nicht das ganze Spektrum des Fachwissens abdecken konnten. Die Lösung war, die örtliche Religionswissenschaft an der Ausbildung zu beteiligen und auch die Religionsgemeinschaften stärker einzubeziehen. Die Weiterbildung konnte nicht auf ein Lehrmittel zurückgreifen, das parallel zur Einführung des Faches entwickelt wurde und heute gerade erst fertig geworden sind.8 Die Lehrmittelproduktion selbst stand vor grossen Problemen, denn einerseits gibt es im deutschsprachigen Bereich für ein solches Fach kein Lehrmittelvorbild und zum anderen mussten die ausgewählten Inhalte akribisch und unter Einbezug der Religionsgemeinschaften sowie anderer Gruppen auf ihren sachlichen Gehalt hin überprüft werden. Die Weiterbildung der amtierenden Lehrkräfte erwies sich als besonders schwierige Aufgabe, weil die Lehrkräfte bislang anders unterrichtet haben und ohne verbindliche Lehrmittel nur dann eine Repertoireanpassung vornahmen, wenn sie die Philosophie des neuen Faches tatsächlich übernommen haben. Niemand hat diesen Verlauf vorhergesehen und die Aufgabe bestand darin, den Prozess fortlaufend anzupassen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Das gilt letztlich für alle grösseren Reformprojekte. Diese Projekte sind nur dann nachhaltig, wenn sie länger dauern als vorgesehen, Umwege gehen können und imstande sind, klug auf neu auftauchende Probleme und Schwierigkeiten zu reagieren. Die anfänglichen Pläne und Hypothesen müssen mit einer robusten Wirklichkeit rechnen, die sich nie in toto überblicken lässt und sozusagen von selbst für Überraschungen sorgt. Das sind Schulreformen und nicht die, die die radikale Kritik vor Augen. Man braucht ein lohnendes Ziel, ausreichend Ressourcen und einen langen Atem; eine konkrete Utopie habe ich zu keiner Phase vermisst. Literatur A Letter Concerning Toleration: Humbly Submitted, etc. Licensed, Octob. 3. 1689. London: Printed for Awnsham Churchill 1689. Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich. Sitzung vom 22. Dezember 2004. 1978. Postulate … Zürich 2004. 8 Die Einführung der drei Lehrmittel für die Unter-, die Mittel- und die Oberstufe der Volksschule ist für die Jahre 2012 und 2013 vorgesehen. 14 Bosche, A./Geiss, M.: Das Sprachlabor - Steuerung und Sabotage eines Unterrichtsmittels im Kanton Zürich, 1963-1976. In: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung Band 16 (2011), S. 119-139. Bosse, H.: Bildungsrevolution 1770-1830. Hrsg. v. N. Ghanbari: Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2012. Bueb, B.: Lob der Disziplin. Eine Streitschrift. 7. Auflage. Berlin: List-Verlag 2006. Denkwürdigkeiten aus General Buser’s politischem Lebenslaufe. Von ihm selbst aufgezeichnet und herausgegeben von einem seiner Freunde. Zweite Auflage. Liestal: Druck und Verlag von Wilhelm Honegger 1841. Fuld, W.: Die Bildungslüge. Warum wir weniger wissen und mehr verstehen müssen. Berlin: Argon-Verlag 2004. Greenawalt, K.: Does God Belong to a Public School? Princeton, N.J.: Princeton University Press 2007. Guidelines for Teaching About Religion in K-12 Public Schools in the United States. April 2010. Atlanta, GA: American Academy of Religion 2010. Humboldt, W. v.: Werke in fünf Bänden, hrsg. v. A. Flitner/K. Giel, Bd. I: Schriften zur Anthropologie und Geschichte. 3. Aufl. Darmstadt 1980. Hürlimann, W.: „Es wäre ein grosses und treffliches Werk...“ Sprangers Leistung zur vermeintlichen Bildungstheorie Humboldts. Lizentiatsarbeit Universität Zürich, Pädagogisches Institut (Fachbereiche Allgemeine Pädagogik). Ms. Zürich 2003. Hüther, G./Hauser, U.: Jedes Kind ist hochbegabt. Die angeborenen Talente unserer Kinder und war wir daraus machen. München: Albrecht Knaus Verlag 2012. Moore, D.L.: Overcoming Religious Illiteracy: A Cultural Studies Approach to the Study of Religion in Secondary Schools. New York: Palgrave 2007. Oelkers, J.: Schulreform und Schulkritik. 2. vollst. überarb. Aufl. Würzburg: Ergon Verlag 2000. (= Schule und Gesellschaft, hrsg. v. W. Böhm u.a., Band 1) Precht, R. D.: Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern. München: Goldmann Verlag 2013. Schmidt, K.: Die Geschichte der Pädagogik in weltgeschichtlicher Entwicklung und im organischen Zusammenhange mit dem Culturleben der Völker dargestellt. Zweiter Band: Die Geschichte der Pädagogik von Christus bis zur Reformation. Erste Abtheilung: Die Geschichte der Pädagogik von Christus bis zur Reformation,. Cöthen: Druck und Verlag von Pauk Schettler 1861. Special Eurobarometer 225: Social Values, Science and Technology. Publication Date June 2005. Brussels: European Commission 2005. Spitzer, M.: Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. München: Droemer Verlag 2012. Teaching about Religion. http://www.teachingaboutreligion.org/index.2html Winterhoff, M.: Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Oder: Die Abschaffung der Kindheit. Unter Mitarbeit von Carsten Tergast. 10. Auflage. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2008.