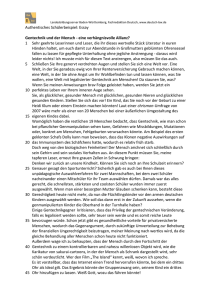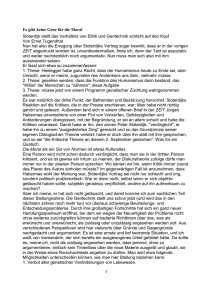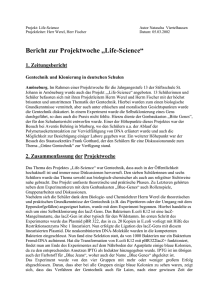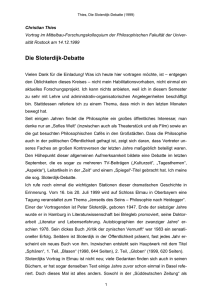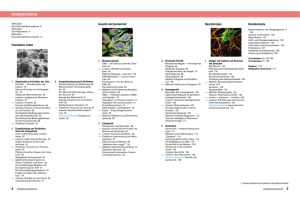Konrad Paul Liessmann
Werbung
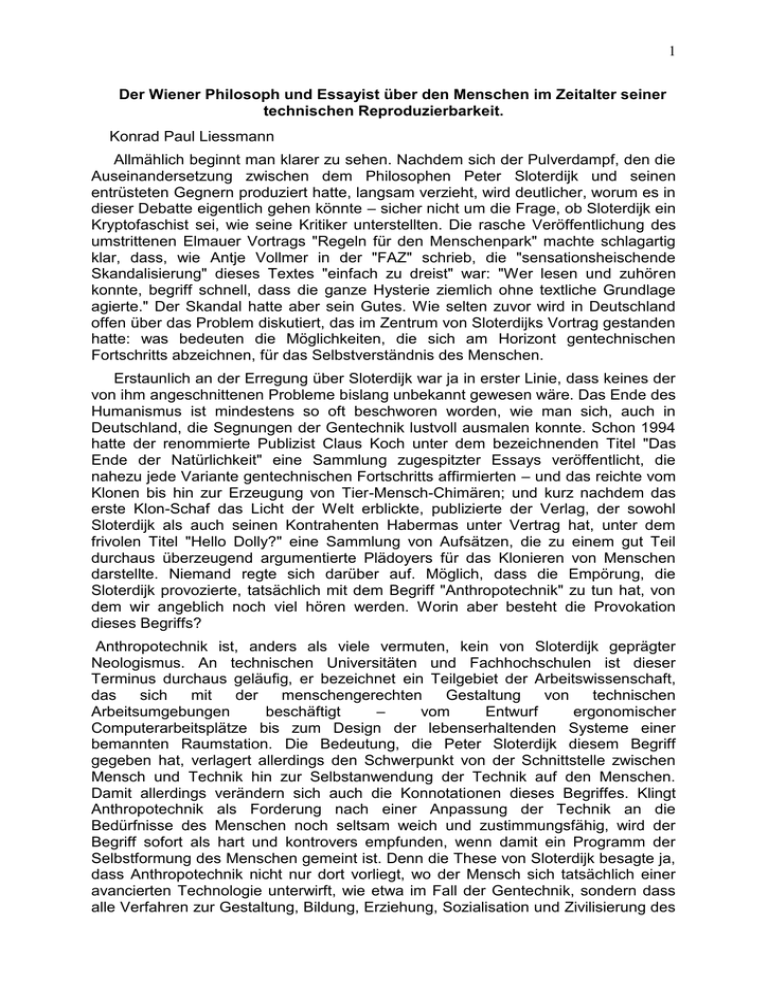
1 Der Wiener Philosoph und Essayist über den Menschen im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Konrad Paul Liessmann Allmählich beginnt man klarer zu sehen. Nachdem sich der Pulverdampf, den die Auseinandersetzung zwischen dem Philosophen Peter Sloterdijk und seinen entrüsteten Gegnern produziert hatte, langsam verzieht, wird deutlicher, worum es in dieser Debatte eigentlich gehen könnte – sicher nicht um die Frage, ob Sloterdijk ein Kryptofaschist sei, wie seine Kritiker unterstellten. Die rasche Veröffentlichung des umstrittenen Elmauer Vortrags "Regeln für den Menschenpark" machte schlagartig klar, dass, wie Antje Vollmer in der "FAZ" schrieb, die "sensationsheischende Skandalisierung" dieses Textes "einfach zu dreist" war: "Wer lesen und zuhören konnte, begriff schnell, dass die ganze Hysterie ziemlich ohne textliche Grundlage agierte." Der Skandal hatte aber sein Gutes. Wie selten zuvor wird in Deutschland offen über das Problem diskutiert, das im Zentrum von Sloterdijks Vortrag gestanden hatte: was bedeuten die Möglichkeiten, die sich am Horizont gentechnischen Fortschritts abzeichnen, für das Selbstverständnis des Menschen. Erstaunlich an der Erregung über Sloterdijk war ja in erster Linie, dass keines der von ihm angeschnittenen Probleme bislang unbekannt gewesen wäre. Das Ende des Humanismus ist mindestens so oft beschworen worden, wie man sich, auch in Deutschland, die Segnungen der Gentechnik lustvoll ausmalen konnte. Schon 1994 hatte der renommierte Publizist Claus Koch unter dem bezeichnenden Titel "Das Ende der Natürlichkeit" eine Sammlung zugespitzter Essays veröffentlicht, die nahezu jede Variante gentechnischen Fortschritts affirmierten – und das reichte vom Klonen bis hin zur Erzeugung von Tier-Mensch-Chimären; und kurz nachdem das erste Klon-Schaf das Licht der Welt erblickte, publizierte der Verlag, der sowohl Sloterdijk als auch seinen Kontrahenten Habermas unter Vertrag hat, unter dem frivolen Titel "Hello Dolly?" eine Sammlung von Aufsätzen, die zu einem gut Teil durchaus überzeugend argumentierte Plädoyers für das Klonieren von Menschen darstellte. Niemand regte sich darüber auf. Möglich, dass die Empörung, die Sloterdijk provozierte, tatsächlich mit dem Begriff "Anthropotechnik" zu tun hat, von dem wir angeblich noch viel hören werden. Worin aber besteht die Provokation dieses Begriffs? Anthropotechnik ist, anders als viele vermuten, kein von Sloterdijk geprägter Neologismus. An technischen Universitäten und Fachhochschulen ist dieser Terminus durchaus geläufig, er bezeichnet ein Teilgebiet der Arbeitswissenschaft, das sich mit der menschengerechten Gestaltung von technischen Arbeitsumgebungen beschäftigt – vom Entwurf ergonomischer Computerarbeitsplätze bis zum Design der lebenserhaltenden Systeme einer bemannten Raumstation. Die Bedeutung, die Peter Sloterdijk diesem Begriff gegeben hat, verlagert allerdings den Schwerpunkt von der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik hin zur Selbstanwendung der Technik auf den Menschen. Damit allerdings verändern sich auch die Konnotationen dieses Begriffes. Klingt Anthropotechnik als Forderung nach einer Anpassung der Technik an die Bedürfnisse des Menschen noch seltsam weich und zustimmungsfähig, wird der Begriff sofort als hart und kontrovers empfunden, wenn damit ein Programm der Selbstformung des Menschen gemeint ist. Denn die These von Sloterdijk besagte ja, dass Anthropotechnik nicht nur dort vorliegt, wo der Mensch sich tatsächlich einer avancierten Technologie unterwirft, wie etwa im Fall der Gentechnik, sondern dass alle Verfahren zur Gestaltung, Bildung, Erziehung, Sozialisation und Zivilisierung des 2 Menschen Anthropotechniken sind. Der Mensch kann gar nicht anders, als sich zu sich selbst technologisch, das heißt gestaltend und eingreifend, formend und selektierend, zu verhalten. Sloterdijk verblüffte bei einer improvisierten Pressekonferenz am Rande des diesjährigen Philosophicum Lech dann auch die anwesende Journalistenschar mit einem Hinweis auf die Renaissance-Anthropologie des Humanisten Giovanni Pico della Mirandola, der schon die universelle Autoplastizität des Menschen gelehrt haben sollte. Tatsächlich lässt Pico della Mirandola in einer Abhandlung über die Würde des Menschen aus dem Jahre 1486 Gottvater zu seinem Geschöpf sagen: "Wir haben keinen bestimmten Wohnsitz noch ein eigenes Gesicht, noch irgendeine besondere Gabe verliehen, o Adam, damit du jeden beliebigen Wohnsitz, jedes beliebige Gesicht und alle Gaben, die du dir wünschst, auch nach deinem Willen und nach deiner eigenen Meinung haben und besitzen mögest. Den übrigen Wesen ist ihre Natur durch die von uns vorgeschriebenen Gesetze bestimmt und wird dadurch in Schranken gehalten. Du bist durch keinerlei unüberwindliche Schranken gehemmt, sondern du sollst nach deinem eigenen freien Willen sogar jene Natur dir selbst vorherbestimmen." Man mag das als Beginn der neuzeitlichen Hybris des Menschen zur Selbstermächtigung und auch Selbstschöpfung deuten oder als vertiefte Reflexion jenes Verdachts, der den Menschen umtreibt, seit er über sich nachdenkt: dass er dasjenige Wesen ist, das sich selbst immer erst herstellen muss. Zumindest seit Nietzsches Bemerkung, dass der Mensch das "nicht festgestellte Tier" sei, gehört die Annahme einer fundamentalen Plastizität und Weltoffenheit des Menschen zu den Grundüberlegungen der modernen philosophischen Anthropologie. Ausgerechnet Günther Anders, einer der schärfsten Kritiker der technischen Zivilisation unseres Jahrhunderts, hatte diesen Befund in jungen Jahren auf den Punkt gebracht: "Künstlichkeit ist die Natur des Menschen, und sein Wesen ist Unbeständigkeit." Anthropotechnik, so ließe sich sagen, ist die Transformation von Natur in Kunst, angewendet auf den Menschen selbst. Technik ist hier allerdings eher im Sinne der antike techné zu verstehen: als ein methodisches Verfahren, als eine Kunstfertigkeit zur Erreichung bestimmter Zwecke. Sie hat zur Voraussetzung, dass es keine wie immer geartete Natur des Menschen gibt, die sich selbst genügt oder als Maßstab gelten könnte. Der Naturmensch war immer schon eine Fiktion. Für den Menschen war seine eigene Natur nur das Ausgangsmaterial, das es erst zu gestalten galt. Eine prekäre Radikalisierung erfuhr dieser Sachverhalt allerdings durch die Überlegung, dass es nicht nur darum gehen sollte, den Menschen nach ethischen und ästhetischen Überlegungen zu formen – antike Verfahren, die Michel Foucault als "Technologien des Selbst" beschrieben hat –, sondern darum, den Menschen zu verbessern. Dieses Konzept des "neuen Menschen", der einen alten hinter sich lassen sollte, ist aber christlichen Ursprungs. Im Christentum taucht die Idee der Menschenerneuerung in aller Deutlichkeit auf, wenngleich noch gedacht als spirituelles Erlösungsprogramm, so etwa wenn Paulus in einem Brief an die Korinther schreibt: "Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden." Dass dies zu einer rasanten Weiterentwicklung von Anthropotechniken führte, zeigen nicht zuletzt die Innovationen auf dem Gebiet der Selbstdisziplinierung, wie sie etwa ein mönchisches Leben vorschreibt, von der Kasteiung bis zu den Meditationstechniken der Mystiker. Aber auch der umstrittene Begriff des "Übermenschen" aus Nietzsches "Zarathustra", den Sloterdijk zur Irritation vieler zitierte, ist christlichen Ursprungs. Er wurde in der Reformationszeit geprägt, findet sich bei Martin Luther und wurde zu 3 einem beliebten Terminus der pietistischen Erweckungsliteratur: "Im neuen Menschen bist du ein wahrer Mensch, ein Über-Mensch, ein Gottes- und ChristenMensch", heißt es in einem Erbauungsbüchlein des 17. Jahrhunderts. Die Idee des neuen Menschen entfaltete allerdings erst in ihrer säkularisierten Gestalt ihre ganze Sprengkraft. Die Utopien der Neuzeit wollten samt und sonders den neuen Menschen kreieren, nun nicht mehr als Resultat einer inneren Anstrengung, sondern als Produkt einer zivilisationstechnischen Revolution, die von allem Anfang an auch die Reproduktion des Menschen aus den Klauen des Zufalls befreien wollte. Im totalitär-utopischen Sonnenstaat des Dominikanermönchs Campanella wird der neue Mensch tatsächlich schon durch eine sexuelle Zuchtwahl produziert, andere Utopisten suchten ihn durch eine radikale Umwälzung der bestehenden Verhältnisse zu erzeugen. Für den russischen Revolutionär und späteren Volkskommissar Lunatscharski war die Gesellschaft "ein Stück Marmor", aus dem er eine "schöne Menschheit" kreieren wollte. Der neue Mensch gehörte so zum Standardrepertoire marxistischer und kommunistischer Wunschvorstellungen, und getreu der Doktrin, nach der die Umstände die Menschen machen, mussten zuallererst die Umstände und mit ihnen so manche Menschen daran glauben, ohne dass der neue Mensch am Horizont der Geschichte je aufgetaucht wäre. Spätestens seit Anbruch der Moderne sind Anthropotechniken, welcher Art auch immer, so als Verbesserungstechniken gedacht worden. Das hatte zur Voraussetzung, dass man den Menschen, so wie man ihn erlebte, als misslungen, als defizitär, wenigstens als verbesserbar empfand. Abhängig von der politischideologischen Ausrichtung wollte man den Menschen seitdem im Komparativ: aggressiver oder friedlicher, kälter oder gefühlvoller, härter oder weicher, belastbarer oder sensibler, egoistischer oder solidarischer. Seit dem 18. Jahrhundert war die Pädagogik die avancierteste Anthropotechnik zur Erreichung dieser Ziele, mittlerweile hart bedrängt von den Massenmedien und längst schon konfrontiert mit dem Eingeständnis ihres Scheiterns. Denn die Geschichte der Erziehung des Menschengeschlechts ist durchzogen von seltsamen Paradoxien. Einmal, wie etwa bei Kant, sollte sie notwendig sein, um die barbarische Natur, die Wildheit zu zivilisieren, und dann wieder, etwa bei Rousseau, rührte alles Unglück von eben diesem Zivilisationsvorhaben her, und die Rückkehr zu einer unverstellten Natur schien der einzige Weg, um den Menschen zu vervollkommnen. Noch Marx träumte von einer "Resurrektion der Natur" in einer befreiten Gesellschaft. Die Dramatik gegenwärtiger Debatten um die gentechnische Optimierung des Menschen hat die Erfahrung oder die Einsicht im Hintergrund, dass diese pädagogischen Projekte gescheitert sind. Nach 200 Jahren Aufklärung ist, wie das 20. Jahrhundert lehrt, der Mensch offenbar nicht besser geworden. Interessanterweise will sich niemand damit bescheiden, dass der Mensch nun einmal so ist, wie er ist: den anderen Menschen ein Wolf, wie es Thomas Hobbes formulierte, der nur durch seine eigene Angst gezähmt werden kann. In der Regel halten wir – und vielleicht ist dies das entscheidende Problem – an den überzogenen Verbesserungsfantasien fest, wobei die von zeitgenössischen Reformpädagogen immer wieder erneuerten Appelle, es doch noch einmal und immer wieder mit der Erziehung zu versuchen, für viele immer unglaubwürdiger werden. Damit steigt die Bereitschaft, das Übel an den Wurzeln, das heißt an den Genen, zu packen. So gesehen müssten die modernsten Anthropotechniken in der Tat die letzte Hoffnung der humanistischen Weltverbesserer sein: Gentechnik als Fortsetzung der Pädagogik mit anderen, womöglich tauglicheren Mitteln. Dieser Gedanke, den auch Sloterdijk andenkt, hat allerdings eine paradoxe Voraussetzung: dass die Formung 4 des formbaren Menschen letztlich daran scheiterte, dass sich seine Natur als widerständiger erwies als erwartet, weshalb in diese Natur selbst eingegriffen werden muss. Die These von der Plastizität des Menschen war offenbar überzogen, die Natur des Menschen selbst muss zuerst unter Kontrolle gebracht und dann optimiert werden. Oder, im Computerjargon: Die Softwareprogramme der Humanisierung liefen schlecht bis gar nicht auf der bestialischen Hardware des Menschen. Nun soll diese selbst umgebaut werden. Abgesehen davon, ob die Thesen vom bestialischen Charakter des Menschen und vom Zivilisationsverfall überhaupt stimmen: mit der Verlagerung der Selbstformung des Menschen von der Kultur zurück in die Natur selbst fände ein qualitativer Schnitt statt, der zweifeln lässt, ob Gentechnik tatsächlich als lineare Fortsetzung bisheriger kultureller Selbststeuerungssysteme gedacht werden kann. Der Ruf nach Gentechnik zur Verbesserung des Menschen kann deshalb nicht mit der Plastizität der Menschennatur argumentiert werden, sondern eher damit, dass diese sich über alle Maßen als resistent erwiesen hatte. Gleichzeitig aber, und das markiert den eigentlich problematischen Punkt dieser Debatte, hat sich die moderne Gesellschaft darauf festgelegt, dass die Natur alle Menschen gleich und frei geschaffen habe, und dies zu ihrem Fundament genommen. Wer die Natur des Menschen verändern will, muss sich so über die politischen Konsequenzen dieses Vorhabens im Klaren sein. Abgesehen davon, dass vieles, was gegenwärtig lautstark unter dem Stichwort Gentechnik diskutiert wird, noch blanke Utopie ist – von der Keimbahntherapie bis zum Gendesign seiner Kinder, radikalisieren auch die derzeit möglichen Anwendungen der Reproduktionstechnologien – von der In-vitroFertilisation bis hin zum Klonen – in erster Linie die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zu seiner Natur. Wenn der Prozess der Modernisierung auch als einer der fortschreitenden Herrschaft und Kontrolle über die Natur aufgefasst werden kann, dann bleibt es fraglich, warum dieser Vorgang ausgerechnet vor der Natur des Menschen selbst Halt machen sollte, zumal diese noch von niemandem eindeutig bestimmt werden konnte. Solch offene Fragen führen übrigens dazu, dass sich für und gegen die Gentechnik seltsame Allianzen bilden. So verwundert es, dass gerade erklärte Anhänger der Milieutheorie oft vehemente Gegner der Gentechnik sind, wo doch eher das Gegenteil zu erwarten wäre: Wer überzeugt davon ist, dass die Umwelt einen wesentlich größeren Einfluss auf die Bildung von Eigenschaften und Verhaltensweisen hat als Erbanlagen, könnte der gentechnischen Modifikation gelassen entgegensehen; und ähnlich vertreten aufgeklärte Zeitgenossen, die hinter jedem Versuch, menschliches Verhalten genetisch zu erklären, schon Biologismus und Rassismus witterten, nun selbst einen krassen Naturalismus, wenn sie die vermeintliche Natur des Menschen vor den Zugriffen der Gentechnik retten möchten. Hinter der Angstlust angesichts der gentechnischen Zukunftsvisionen zur Menschenbildung steckt bei Gegnern und Befürwortern der Glaube, dass letztlich doch die Gene für alles verantwortlich seien – nur wollen die einen dies ausnützen und die anderen die Finger davon lassen. Dieser Glaube selbst könnte sich aber als verhängnisvoller Irrtum erweisen. Abgesehen von der Schwierigkeit, Verhalten und Eigenschaften von Menschen auf genetische Determinanten zu reduzieren, könnte es sich bald erweisen, dass genetische Modifikationen den Menschen vielleicht gesünder und langlebiger, aber nicht in einem moralischen Sinn besser machen. Solange der Mensch ein Bewusstsein von Freiheit bewahrt, wird er hin und wieder anders handeln, als es das Design-Programm vorgesehen hatte. 5 Das bedeutet nicht, dass Gen-Technik, auch am derzeitigen Stand, nicht gravierende Folgen hätte. Gentechnik, nicht zuletzt das viel diskutierte Klonen, könnte vorerst einmal beschrieben werden als die Anwendung der Prinzipien der wissenschaftlich-technischen Zivilisation auf den Menschen selbst. Zum Inbegriff dieser Prinzipien gehört die Produktion von Identitäten. Ein wissenschaftliches Experiment etwa ist nur gültig, wenn es gelingt, identische Ergebnisse durch identische Verfahren unter identischen Bedingungen zu gewinnen. Mit anderen Worten: Ein Experiment muss jederzeit wiederholbar sein. Der industriellen Produktionsweise hat dieses Prinzip zum Erfolg verholfen: Sie stellt massenhaft identische Güter unter identischen Bedingungen her, und selbst in der Kunst triumphiert seit Walter Benjamin die Kopie über das Original. Günther Anders hat schon in den fünfziger Jahren vermutet, dass es der Mensch auf Dauer nicht aushalten werde, nicht in einer ähnlichen Weise gemacht zu werden wie seine erfolgreichen Produkte. Unter dem Stichwort "Human Engineering" hatte Anders, wenn auch mit großer Abwehr, die Tendenz der Entwicklung vorausgesehen: Der Mensch wird seine eigene Entstehung letztlich den von ihm geschaffenen Produktionstechnologien anvertrauen und sich dort, wo er es für profitabel erachtet, in Serie herstellen, um seine "Malaise der Einzigartigkeit" zu überwinden und den Zufall auszuschalten. In einem bemerkenswerten Essay in der "FAZ" hat der Berliner Philosoph Rüdiger Safranski jüngst in Bezug auf diese Reproduktionstechnologien die These formuliert, dass Menschen demgegenüber ein Recht darauf haben müssen, geboren anstatt gemacht zu werden, dass sie ein Recht darauf haben, ihr genetisches Schicksal nicht zu kennen, und er argumentiert dies mit einem notwendigen Respekt vor den letzten Geheimnissen der Natur, die sich unseren Verfügbarkeiten entziehen: "Man will nicht nur von seinesgleichen gemacht, sondern ein Geschöpf des Ungeheuren sein." Genau an diesem Punkt werden sich die Konturen einer Selbstdeutung des Menschen herausbilden, wie sie durch die Fortschritte der Reproduktionsmedizin provoziert werden. Nach dem derzeitigen Stand der Technik und der Diskussion kann allerdings vermutet werden, dass Safranskis Vorschlag, der übrigens einen schon vor anderthalb Jahrzehnten geäußerten Gedanken von Hans Jonas aufgreift, zu spät kommt. Das eingeforderte Recht des Menschen auf ein Nichtwissen seiner genetischen Disposition und der Bedingungen seines Zur-WeltKommens wird – so steht zu vermuten – rasch umschlagen in eine Pflicht zur Produktionskontrolle des Menschen. In dem Maße, in dem es technisch möglich wird, Erbkrankheiten frühzeitig zu diagnostizieren, steigt der Druck zur vorgeburtlichen Therapie oder Selektion: In den USA führen behinderte Kinder Prozesse gegen ihre Eltern, weil diese es unterlassen haben, sie abzutreiben. In dem Maße, in dem es technisch möglich sein wird, Verhaltensdispositionen genetisch zu modellieren, wird der Druck steigen, nichts unversucht zu lassen, um dem Nachwuchs die besten Ausgangschancen zu bieten. Der Druck wird nicht nur einer der Genmedizin und der sozialpolitischen Umwelt sein; der Druck wird vor allem durch diejenigen erzeugt werden, die sich in einer Welt der genetisch optimierten Zeitgenossen zunehmend benachteiligt fühlen müssen, gerade weil ihre Eltern noch das Recht auf zufallsgesteuertes Zeugen und Gebären in Anspruch nahmen, statt dass sie die Pflicht zur planmäßigen Konfiguration des Embryos auf sich genommen hätten. Damit allerdings hört Gentechnik auf, eine Frage der individuellen Entscheidungsfreiheit zu sein, und schlägt um in Biopolitik. Die Reduktion gen-ethischer Fragen auf den Entscheidungsspielraum eines Individuums verkennt den sozialen und politischen Charakter jeder Anthropotechnik. 6 So attraktiv Gentechnik und Reproduktionsmedizin für die Gesundheit, Lebensgestaltung und Nachwuchsplanung des Einzelnen auch sein können, weil damit eine Reihe neuer Handlungsoptionen erwächst, so fatal oder zumindest unerwünscht können die gesellschaftlichen Auswirkungen sein. Es geht eben nicht nur darum, wie der Einzelne sich in Zukunft fortpflanzen möchte, sondern mit den damit verbundenen Optionen und der Art und Weise, wie sie wahrgenommen werden, fallen kulturelle und politische Entscheidungen höchsten Ranges. Und wie immer man es dreht und wendet, wie zurückhaltend oder wie intensiv man Gentechnik angewendet sehen möchte: Sie kratzt am Postulat der natürlichen Gleichheit der Menschen und führt, auf welchen Umwegen auch immer, zurück zu den nicht zuletzt durch die deutsche Geschichte diskreditierten Fragen der Eugenik. Dass man deshalb in Deutschland – im Gegensatz etwa zu den USA, wo Menschenzüchtungsprogramme in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durchaus diskutiert werden können – diesem Problemkomplex gegenüber äußerst sensibel ist, hat gute Gründe; daraus allerdings Denk- und Sprechverbote abzuleiten ist kontraproduktiv. Sloterdijk vorzuwerfen, dass er einen Begriff wie Selektion verwende, der doch an Auschwitz erinnere, wie es der Philosoph Ernst Tugendhat jüngst in der "Zeit" getan hat, trifft nicht genau die Sache. Zu fragen wäre, ob die immanenten Perspektiven der Gentechnik nicht Selektionsoptionen parat halten, die tatsächlich an Grundzüge der Biopolitik der Nazis erinnern. Es genügt die Vorstellung, dass sich das technisch mögliche Gen-Screening, wie von manchen gefordert, im Arbeits- und Versicherungsbereich durchsetzen werde, um sich über mögliche gesellschaftspolitische Konsequenzen klar zu werden. Menschen mit genetisch determinierter höherer Krankheitsanfälligkeit oder niedrigerer Lebenserwartung würden auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft zweifelsohne gezielt diskriminiert und benachteiligt werden – bis hin zu eingeschränkten Möglichkeiten, sich fortzupflanzen. Es würde zweifellos eine Selektion stattfinden – so unscheinbar diese auch in ihren ersten Erscheinungsformen auftreten mag. Gegenüber den bisherigen Formen der Benachteiligung von Menschen erreichte diese aber eine neue Qualität: Der Selektionsnachteil wäre nun tatsächlich in der Natur selbst verankert, quasi objektiviert durch die genetische Identität, die jeder als Strichcode mit sich trüge, und das Postulat von der natürlichen Gleichheit der Menschen hätte sich als das entpuppt, was viele immer schon vermuteten: als Nichtwissen von den natürlichen Ungleichheiten der Menschen. Wer dann noch immer an diesem Postulat aus guten politischen Gründen festhalten wollte, könnte gar nicht anders: Er müsste überhaupt erst einmal die Herstellung einer Gleichheit der Menschen durch Verbesserung und Angleichung ihres genetischen Basismaterials fordern. Da aber niemand glaubt, dass unter gegenwärtigen und zukünftigen Bedingungen die Segnungen der Gentechnik allen Menschen gleichermaßen zuteil werden, ist bei einem beschleunigten Fortschritt der modernen Anthropotechniken eher zu erwarten, dass sich die Differenzen zwischen den reichen und armen Zivilisationen noch einmal dramatisch verstärken würden. Man braucht ja gar nicht den in Amerika beliebten Horrorvisionen zu folgen, nach denen eine Rasse gentechnisch optimierter Menschen weder willens noch fähig wäre, sich mit den naturbelassenen zu paaren, man muss auch nicht von Züchtung und Übermenschen träumen oder warnen. Ein Blick auf den gegenwärtigen Weltzustand zeigt, was es für eine globalisierte Erde bedeuten muss, wenn sich in naher Zukunft in den Industrieländern schmale, genmedizinisch hoch gerüstete Bevölkerungssegmente mit einer Lebenserwartung von nahezu hundert Jahren ganzen Kontinenten gegenübersehen, auf denen ein 7 durchschnittliches Menschenleben nicht länger dauert als einstens im europäischen Mittelalter. Bei einer Diskussion in Berlin hat sich Peter Sloterdijk der Forderung angeschlossen, in Sachen Genpraxis eine Nachdenkpause von 50 Jahren einzulegen. Wenn man, was zu erwarten ist, diesen Vorschlag achtlos beiseite schiebt, sollte man zumindest nicht diejenigen inkriminieren, die versuchen, die Bedingungen und Konsequenzen dessen zu verstehen, was gerade geschieht.