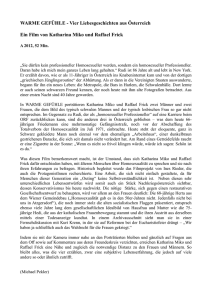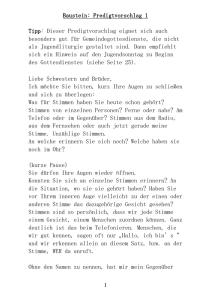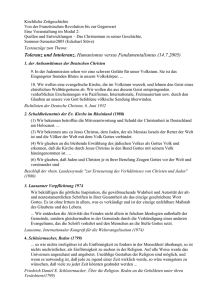Frick - Evangelische Akademie Tutzing
Werbung

Macht Glaube gesund? Theologische und psychotherapeutische Perspektiven der Krankheitsbewältigung Eckhard Frick sj Vortrag in der Evangelischen Akademie Tutzing Rothenburg odT 15.11.2002 1. Annahmen und In-Frage-Stellung Wenn wir uns mit der Frage der religiösen Krankheitsverarbeitung beschäftigen, ist es hilfreich, zunächst zwei Annahmen zu formulieren, die unsere Beschäftigung mit dem Thema gerade dann bestimmen, wenn sie nicht klar ausgesprochen werden: Annahme 1: Gläubige sind gesünder als Ungläubige. Wenn Krankheiten nicht heilbar sind, haben Gläubige eine bessere Krankheitsbewältigung. Annahme 2: Religiöse Menschen sind schicksalsgläubig und suchen Kontrollmöglichkeiten eher außerhalb ihrer selbst. Aus diesen Formulierungen wird schon deutlich, dass die beiden Sätze durchaus gegensätzlich sind. Die erste Annahme stützt sich auf eine umfangreiche wissenschaftliche und vor allem populäre Literatur, die den religiösen Glauben als schützenden oder gar heilsamen Faktor beschreibt. Sie greift damit eine viel ältere, in Kirche und Theologie mitunter vergessene Dimension auf, nämlich den Zusammenhang zwischen dem Verkündigungs- und dem Heilungsauftrag an die Apostel (vgl. Lukas 9,2: „und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen.“). Die zweite Annahme hingegen speist sich aus der Skepsis gegenüber religiösen Glaubenssystemen, wie sie z.B. in soziologischen, psychoanalytischen oder philosophischen Religionskritik vielfach vertreten wird. Beide Annahmen müssen sich mit der Problematik des Erfolgskriteriums auseinandersetzen. Woran bemisst sich denn im einen und im anderen Fall das Bewältigungsergebnis? Werden Erfolg, Machbarkeit und Prognose letztlich medizinisch verstanden, z.B. als Verschwinden der Hauptsymptomatik oder sozial, als Wegfallen der Krankenrolle? Mir scheint nun, dass derartige, am Erfolg orientierte, Erklärungsversuche häufig von geheimen Allmachtsphantasien bestimmt sind und angesichts von Sterben und Tod an ihre Grenze stoßen. Mit anderen Worten: „Wirksamkeit“ oder „Unwirksamkeit“ bestimmter Bewältigungsformen wird hier im Kontext von Gesundheitsstörungen verstanden, die grundsätzlich behebbar sind, im Kontext einer Gesundheit, die „wiederherstellbar“ ist. Wenn jedoch die Begrenztheit des Lebens ins Bewusstsein rückt wie nach einer Krebsdiagnose, bei palliativer Behandlung oder auch bei einer chronischen Erkrankung geht es darum, angesichts der unausweichlichen Grenze einen Sinn zu finden. Die Grenze möglichst „wirksam“ zu beseitigen oder herauszuschieben, ist dann ein Ziel, das in den Hintergrund rückt. 2. Zum Beispiel: www.nunstudy.org Am 22. September 1930 schrieb die nordamerikanische Regionaloberin der Armen Schulschwestern an alle Konvente und bat die jungen Schwestern darum, vor Ablegung der Letzten Gelübde eine handgeschriebene Autobiographie zu verfassen. Diese zwischen 1931 und 1943 verfassten Texte bildeten 60 Jahre später die Basis für eine erstaunliche prospektive Längsschnitt-Untersuchung: 678 hochbetagte Schwestern erklärten sich zur jährlichen körperlichen und psychometrischen Untersuchung bereit und stimmten der Sektion ihres Gehirns nach dem Tod zu, um mögliche demenzielle Prozesse (vor allem Alzheimersche Krankheit) nachweisen zu können. In diesem Zusammenhang konnten 180 Lebensläufe in den Archiven gefunden werden, die den von den Forschern zuvor definierten Einschlusskriterien entsprachen. Diese unabhängige, den Schwestern nicht Texte bekannte, wertete Forscher zwei getrennt inhaltsanalytisch aus. Bewertet wurden nicht Lebensereignisse als solche, sondern deren emotionaler Widerhall. Trotz der sehr homogenen Stichprobe (Schwestern vor den Letzten Gelübden mit der Hoffnung, bald unterrichten zu dürfen), finden sich rechtunterschiedliche Stile des emotionalen Ausdrucks. Das Ausmaß positiver Emotionen in den Texten korreliert in statistischsignifikanter Weise mit der Lebenserwartung der Schwestern. Welche Folgerung ist aus den hier nur knapp skizzierten Befunden zu ziehen, über die Alltagsvermutung hinaus, dass optimistische Menschen länger leben? Es handelt sich bei den hier untersuchten Texten nicht um einen (sozial erwünschten)Optimismus, sondern um die Fähigkeit, auf Lebensereignissemit einem positiven gefühlsmäßigen Widerhall zuantworten, das heißt günstige, zufriedenstellende Erfahrungen so in sich aufzunehmen, dass sie mitteilbar werden (ausstrahlen). Im Falle schwieriger Lebensereignisse heißt dies, dass sie in fruchtbarer Weise verarbeitet werden und die positive Emotionalität nicht beeinträchtigen können. Das inhaltsanalytische Kriterium „positive Emotionalität“ ist zugleich ein Hinweis auf die spirituellen Erfahrungen, Haltungen und Praktiken durch Jahrzehnte. Dieses Kriterium bietet auch die Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher spiritueller Beheimatung zu vergleichen und jene Auswirkungen von Glaubenserzeugungen genauer zu erfassen, die in epidemiologischen Studien als gesundheitsförderlich beschrieben wurden. Offenbar gibt es Ausprägungen von Spiritualität, die gesundheitsförderlich wirken (Danner et al., 2001). 3. Fokus „Kontrolle“ Wie oben formuliert, gelten religiöse Menschen vielen als schicksalsgläubig, indem sie Kontrollmöglichkeiten eher außerhalb ihrer selbst suchen (Annahme 2). Am Beispiel der Schmerzbehandlung wird deutlich, wie zentral die Möglichkeit der Kontrolle möglicherweise unerträglicher Schmerzen ist und wie verheerend sich die Angst vor dem Kontrollverlust (auch wenn dieser nur phantasiert ist) auswirken kann, nicht zuletzt auf das Ausmaß der Schmerzen selbst. Es ist die Basis jeglicher Schmerztherapie, nach wirkungsvollen Hilfen zu suchen und die Betroffenen an Entscheidungen über Ausmaß, Zeitpunkt und Arzt dieser Behandlung zu beteiligen. Die wirkungsvolle Schmerzbehandlung versichert den Patienten in Palliativbehandlung und in anderen medizinischen Bereichen der Nähe einfühlsamer Helferinnen und Helfer. In der Forschung hat sich die folgende Differenzierung von Kontrollattributionen (Krampen, 1989) durchgesetzt: internal (ich selbst habe die Kontrolle über das, was geschieht; external-sozial (Mächtige andere [Ärzte, Pflegepersonal, Angehörige] haben die Kontrolle; external-fatalistisch (was geschieht, hängt vom Schicksal ab). Gerade die external-fatalistische Kontrollattribution wurde vielfach mit dem religiösen Glauben identifiziert: Passiv-kindlich gibt der Gläubige die eigenen Kontrollmöglichkeiten aus der Hand und erwartet alles von Gott. Ich möchte hingegen dafür plädieren, die Frage möglichst offen und vorurteilsfrei zu stellen: Zu welchen der drei Attriubutionstypen gehört religiöse Krankheitsverarbeitung, und Kontrollüberzeugungen? 4. Psychotherapeutische Kriterien wie verändert Spiritualität die In der Forschung werden drei Formen der religiösen Krankheitsverarbeitung unterschieden (Pargament et al., 1988): In der Kooperation sieht sich der gläubige Mensch als Partner Gottes, der mit Gott im Prozess der Heilung zusammen arbeitet. In der Unterwerfung betrachtet sich der Mensch gewissermaßen als Marionette Gottes, der nichts anderes übrig bleibt, als sich in den Willen Gottes zu fügen. Hingegen betont der Typus Selbststeuerung, dass der gläubige Mensch handlungs-, entscheidungs- und kontrollfähig bleibt. Überblicksmäßig möchte ich die folgenden Kriterien für eine gelingende religiöse Krankheitsverarbeitung formulieren, zunächst aus psychotherapeutischer, im nächsten Abschnitt aus theologischer Sicht: • Orientierung an der individuellen Lebensqualität • Autonome Konstitution von Sinn und Hoffnung • Aktiv-akzeptierendes Coping • Adaptive Kontrollüberzeugungen • Nicht mehr erreichbare Ziele aufgeben / neue Ziele formulieren Orientierung an der individuellen Lebensqualität setzt voraus, dass über die gesundheitsbezogenen Messungen hinaus der subjektive Urteilsprozess des Patienten ernst genommen wird (Birnbacher, 1999; Frick, im Druck; Frick et al., submitted; Hävry, 1991). Einen solchen Perspektivwechsel von der Experteneinschätzung zum Patientenurteil müssen nicht nur Ärzte und Pflegepersonal, sondern auch die Patienten selbst und deren Angehörige vollziehen. Damit hängt die autonome Konstitution von Sinn und Hoffnung eng zusammen: Sinn und Hoffnung können weder durch Ratgeberliteratur vermittelt noch infundiert oder transplantiert werden. Professionelle Helfer können diesen persönlichen Prozess lediglich begleiten. Ein aktiv-akzeptierendes Coping sowie adaptive Kontrollüberzeugungen gelten in der Forschung als günstige Voraussetzungen gelingender Krankheitsverarbeitung (vgl. (Frick, in Vorbereitung)), möglicherweise sogar im Sinne einer Verlängerung der Überlebenszeit (Tschuschke et al., 1999). Im spirituellen Kontext von Sinn und Hoffnung („meaning based coping“) nicht mehr erreichbare Ziele aufzugeben, bzw. neue Ziele zu formulieren, verlangt von der kranken Person und ihren Helfern, sich mit der Realität der begrenzten Lebenszeit aktiv auseinander zu setzen. Im einzelnen heißt dies (Folkman und Greer, 2000): • die spezifische Krankheitssituation nicht nur als Belastung, sondern auch als Herausforderung zu begreifen • herauszufinden, was für den Patienten wichtig ist • mit ihm / ihr realistische Ziele zu formulieren • alles zu fördern, was die persönlichen Kontrollmöglichkeiten stärkt • Verhaltensweisen zu verstärken, die der Erreichung der gesteckten Ziele dienen • auch angesichts der möglicherweise vitalen Bedrohung auf eine positive Grundstimmung zu achten. 5. Theologische Kriterien Der Theologe, besonders wenn er als Seelsorger ans Krankenbett tritt, steht in der Gefahr, in die Rolle von Hijobs Freunden zu geraten, d.h. mit Ratschlägen, Erklärungen oder gar moralischen Appellen aufzuwarten. Auch wenn diese gut gemeint sind, so stellen sie doch die betroffenen Kranken eine Überforderung oder nicht selten eine zusätzliche Belastung dar. In diesen Zusammenhang gehört auch der Terror des „positiven Denkens“, mit dem manche Besucher meinen, ihre kranken Angehörigen oder Freunde aufheitern zu müssen. In theologischer Hinsicht kann demgegenüber als erstes Kriterien eine möglichst große Offenheit für die Gottesbeziehung (und deren Entwicklung) formuliert werden. Damit ist auch die Bereitschaft gemeint, wie Hijob mit Gott zu streiten, ihm die eigene Klage und Verzweiflung entgegen zu schreien. Ein weiteres Kriterium ist die Akzeptanz Gottes als des Anderen (nicht kontrollierbaren, nicht zu „verordnenden“). Im Gegensatz zu Tendenzen einer therapeutischen Verdinglichung und Verzweckung ist Glauben keine Wunderdroge, die sich wie ein Antibiotikum rezeptieren ließe (Frick, 2002; Sloan et al., 2000). Ferner sind zu nennen: der Gemeindebezug des Glaubens, die Relativierung von Zielen (eschatologischer Vorbehalt) und die Hoffnung auf das letztlich unzerstörbare Leben. Schließlich müssen Deutungsmuster der jüdisch-christlichen Tradition dialogisch aufgegriffen werden. Z.B. kann die Hijobsgestalt dem / der Betroffenen bereits bekannt sein oder in einem günstigen Augenblick bekannt gemacht werden, so dass sie als kräftige Identifikations- und Bewältigungsmöglichkeit entdeckt wird. Dies gilt auch für Leben und Sterben Jesu und für viele Beispiele der Klage und des Kampfes mit Gott, die in einen Bezug zur eigenen Geschichte gebracht werden können. Im Hinblick auf den oben gewählten Fokus der Kontrolle möchte ich als abschließende Kurzformel Bonhoeffers (Bonhoeffer, 194?) „Widerstand und Ergebung“ wählen, die Auseinandersetzung mit dem phantasierten oder erlittenen Kontrollverlust. Cole & Pargament beschreiben die „spirituelle Hingabe“ als „paradoxen Weg zur Kontrolle“ (Cole und Pargament, 1999). Sie empfehlen den Begleitern, den Konflikt „Things under my control“ vs. „Things under God’s control“ zu fokussieren und auf diese Weise die Balance eigener Kontrollmöglichkeiten (etwa im aktiven Kampf gegen die Krankheit) und der Annahme der Begrenztheit des Lebens neu auszubalancieren. 6. Schluss: Durch Verwundung heilen Aus dem Bisherigen dürfte deutlich geworden sein, dass der christliche Glaube nicht mit medizinischen Therapieangeboten um „Wirksamkeit“ konkurrieren möchte. Dann würde er die finale Dimension (Niemann) christlicher Anthropologie verleugnen. Das Christentum nimmt zu Krankheit, Verwundung, Heilung eine durchaus paradoxe Position ein, die über die Vertröstung auf ein „Happy end“ weit hinaus geht. In archetypischer Hinsicht (Frick, 1996) ist Jesus der verwundete Heiler, der von Gott getroffene Knecht des Herrn (Jesaja 53). Er heilt nicht durch Wirksamkeit und Macht, sondern durch Annahme der Verwundung. Birnbacher, D. (1999). Quality of life - Evaluation or description? Ethical Theory and Moral Practice, 2:25-36. Bonhoeffer, D. (194?). Widerstand und Ergebung. Cole, B. F. & Pargament, K. I. (1999). Spiritual surrender: a paradoxical path to control. In Integrating spirituality in treatment: Resources for practioners, ed. E. Miller. Washington, D.C.: American Psychological Association, 1999. Danner, D. D., Snowdon, D. A. & Friesen, W. V. (2001). Positive emotions in early life and longevity: findings from the Nun study. Journal of Personality and Social Psychology, 80:804-813. Folkman, S. & Greer, S. (2000). Promoting psychological well-being in the face of serious illness: when theory, research and practice inform each other. Psycho-Oncology, 9:119. Frick, E. (1996). Durch Verwundung heilen. Zur Psychoanalyse des Heilungsarchetyps. Göttingen Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht. —. (2002). Glauben ist keine Wunderdroge. Hilft Spiritualität bei der Bewältigung schwerer Krankheit? Herder Korrespondenz, 56:41-46. —. (im Druck). Lebensqualität angesichts der Krebserkrankung. Stimmen der Zeit. —. (in Vorbereitung). Religöse Krankheitsverarbeitung aus theologischer und ärztlichpsychotherapeutischer Sicht. Frick, E., Borasio, G. D., Zehentner, H. & Bumeder, I. (submitted). Individual Quality of Life of patients undergoing Peripheral Autologous Blood Stem Cell Transplant. Hävry, M. (1991). Measuring the quality of life: Why, how and what? Theoretical Medicine, 12:97-116. Krampen, G. (1989). Diagnostik von Attributionen und Kontrollüberzeugungen. Theorien, Geschichte, Probleme. In Diagnostik von Attributionen und Kontrollüberzeugungen, ed. G. Krampen. Göttingen: Hogrefe, 1989, pp. 3-19. Niemann, U. (persönliche Mitteilung) Pargament, K. I., Grevengoed, N., Hathaway, W., Kennell, J., Newman, J. & Jones, W. (1988). Religion and problem solving: Three styles of coping. Journal for the Scientific Study of Religion. Sloan, R. P., Bagiella, E., VandeCreek, L., Hover, M., Casalone, C., Hirsch, T. J., Hasan, Y., Kreger, R. & Poulos, P. (2000). Should physicians prescribe religious activities? New England Journal of Medicine, 342:1913-1916 (Diskussion 1339-1342). Tschuschke, V., Hertenstein, B., Arnold, R., Denziner, R., Bunjes, D., Grulke, N., Heimpel, H. & Kächele, H. (1999). Beziehungen zwischen Coping-Strategien und Langzeitüberleben bei allogener Knochenmarkstransplantation - Ergebnisse einer prospektiven Studie. In Psychotherapeutische Interventionen in der Transplantionsmedizin, ed. B. Johann & R. Lange. Lengerich Berlin Riga Rom Wien Zagreb: Pabst Science Publishers, 1999, pp. 80-104.